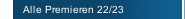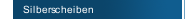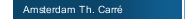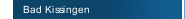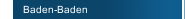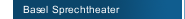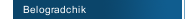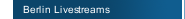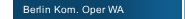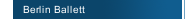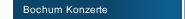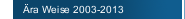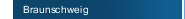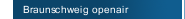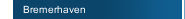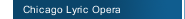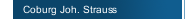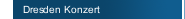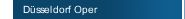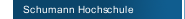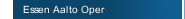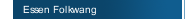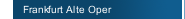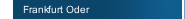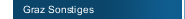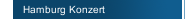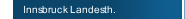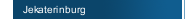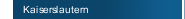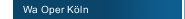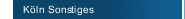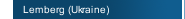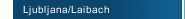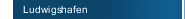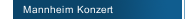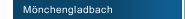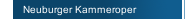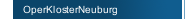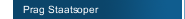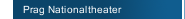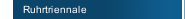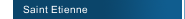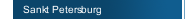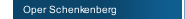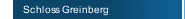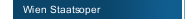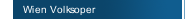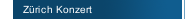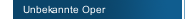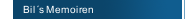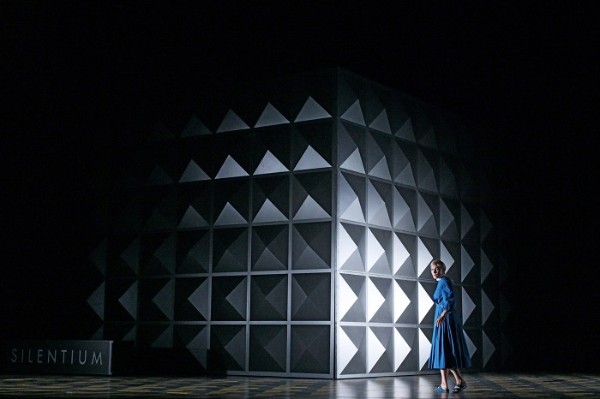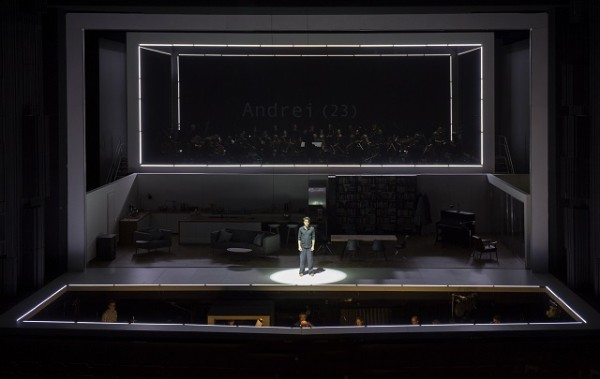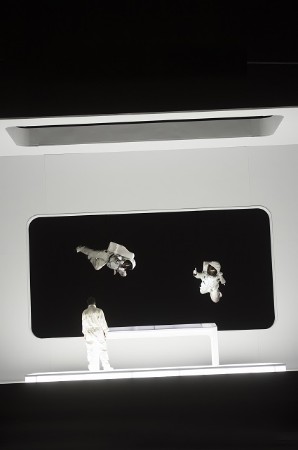Bernd Loebe

Intendant / Geschäftsführer



DIE ZAUBERFLÖTE
Bericht von der Premiere am 2. Oktober 2022
Zauberflöte ohne Zauber
Die Inszenierung der Zauberflöte von Alfred Kirchner war zuletzt die älteste Produktion am Frankfurter Opernhaus. Seit der Premiere im Oktober 1998 hatte sie über 150 meist ausverkaufte Aufführungen erlebt. Für viele Besucher, nicht nur Kinder, war sie die ideale Einstiegsdroge in die Welt der Oper. Dafür sorgten insbesondere die wunderbar verträumten, genial ironisch unterwanderten Bühnenbilder von Michael Sowa. Gezeigt wurde ein vor phantasievollen Einfällen überschäumendes, saftiges Wunderwerk, welches so humor- wie lustvoll die Möglichkeiten dieses Zauber- und Maschinenstücks auskostete mit dramatischen Auf- und Abtritten samt Feuereffekten. Allein: Trotz traumhafter Auslastungszahlen und begeisterter Publikumsreaktionen über 20 Jahre hinweg wurde Intendant Bernd Loebe nicht müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Distanz zu diesem Erbstück aus Zeiten seines glückloseren Vorgängers zu demonstrieren. Im zwanzigsten Jahr seiner Intendanz sollte es nun endlich eine Zauberflöte „für Erwachsene“ sein. Und man muß ihm zugestehen, daß tatsächlich bei Kirchner-Sowa von einer in den letzten Jahren gerade in Frankfurt mit Regisseuren wie Christof Loy und Claus Guth zur Perfektion entwickelten psychologisch fundierten Personenführung kaum (noch) etwas zu bemerken war.
Nun sieht das Publikum in der aktuellen Neuproduktion von Mozarts letzter Oper, wenn der Vorhang sich nach der dankenswerterweise unbebilderten Ouvertüre hebt, ein Bühnenbild (Andrew Lieberman), wie es sich in ungezählten Loy- und Guth-Produktionen als idealer Hintergrund für ausgefeilte Personenregie erwiesen hat: Weiße, schmucklose Wände, viele Türen, zurückhaltende, edle klassizistische Möblierung. Auch ein Flügel darf in diesem gutbürgerlichen Haushalt nicht fehlen. Auf der Drehbühne sind unterschiedliche Räume angeordnet, durch welche Tamino bis zur ersten Pause wie benommen in Pyjamahose und dicken Socken schlafwandlergleich herumschlurft. Natürlich wird er zu Beginn von keiner Schlange verfolgt und folglich auch nicht von den drei Damen errettet. Diese sind als Party-Girls mit Champagnerflaschen ausgestattet und necken beschwippst den verschlurften Prinzen und den inzwischen hinzugetretenen, in einen zitronengelben Dreiteiler gewandeten Papageno.

Kelsey Lauritano (Zweite Dame), Michael Porter (Tamino), Cláudia Ribas (Dritte Dame) und Monika Buczkowska (Erste Dame)
Die Handlung des Stückes wird bewußt allenfalls rudimentär dargestellt. Die heiklen Dialoge, welche oft durch radebrechende Nichtmuttersprachler recht peinlich wirken können, werden vom Band eingespielt. Die Schauspielerin Heidi Ecks findet dafür mit angenehmer Sprechstimme einen überzeugend natürlichen Erzählton. Während dieser Sprecheinspielungen erstarren alle Bühnenfiguren außer Tamino zu Tableaux vivants. So gerät, da eine die Handlung vorantreibende Bebilderung der Sprechszenen fehlt, die Aufführung zu einer Nummernrevue. Die vielen Wunschkonzertstücke werden schlicht abgehakt, eines nach dem anderen. Schnell zeigt sich, daß Regisseur Ted Huffman an Loy oder Guth nicht heranreicht. Bis zur Pause bleibt rätselhaft, was er denn überhaupt sagen möchte und insbesondere, wie die auftretenden Figuren miteinander zusammenhängen. Sie sind hier ja samt und sonders Bewohner desselben Haushalts. Ist Sarastro etwa der strenge Vater von Tamino, die Königin der Nacht seine vereinsamte Mutter? Oder sind es eher die Eltern von Pamina? Oder beides zugleich? Wer ist dieser zitronengelbe Papageno? Ein Alter ego Taminos? Und welche Funktion hat Monostatos? Im Original-Libretto ist er ein lüsterner, verschlagen-devoter „Mohr“, ein rassistisches Zerrbild, das aber immerhin zu einer aufklärerisch-humanistischen Reflexion Papagenos führt, der in seiner geistigen Schlichtheit erkennt, daß auch ein farbiger Mensch eben zuallererst ein Mensch ist („Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt, warum denn nicht auch schwarze Menschen?“). Das Produktionsteam hat sich entschieden, diesen Reibungspunkt vollständig zu eliminieren, die Problematik aus den Sprechtexten gänzlich zu streichen und in den gesungenen Texten woke und feige zu verharmlosen. Die einzige Arie des Monostatos baut im Original auf dem Hautfarbengegensatz auf, um dessen Außenseitertum und Komplexbeladenheit herauszustellen und zugleich die Motivation seiner sexuellen Begierde psychologisch zu grundieren. Wo es im Libretto heißt: „weil ein Schwarzer häßlich ist“ erklingt nun: „weil mein Antlitz häßlich ist“ und aus „weiß ist schön, ich muß sie küssen“ wird ein mattes und banales „sie ist schön“. Damit macht man es sich zu einfach.

Tamino (Michael Porter), angeblich vor den Toren des Weisheitstempels
Erst im zweiten Teil nach der Pause wird die übergeordnete Idee der Inszenierung, die das wie immer instruktive Begleitheft entwickelt, auch auf der Bühne deutlicher: Als weitere, stumme Gestalt taucht ein Greis auf, eine gealterte Version von Tamino, wie seine Kleidung verrät. Er ist offensichtlich dement, bewegt sich mühsam, halt- und orientierungslos durch das Haus, umsorgt von einer gleichalten Gefährtin, bei der die Kleidung nicht verrät, ob es sich um die gealterte Version der Pamina handelt. In dem geistigen Nebel seiner Demenz erscheinen die Musiknummern der Zauberflöte wie Fetzen der Erinnerung, letzte Anker aus einer Vergangenheit vor der Erkrankung. Auf dem Flügel liegt, wie sich am Schluß zeigt, eine Partitur der Zauberflöte. Der junge Tamino schlägt hier einmal traumverloren einige Tasten an, der alte Tamino kramt zu der Verzweiflungsarie Papagenos mit ihren Selbstmordgedanken die Töne der Panflöte hervor und probiert sie am Flügel aus. Dies ist einer der wenigen Momente, in denen sich der behauptete Überbau mit den Vorgaben des Stückes musikalisch verbindet. Schon kurz zuvor, bei der Feuer- und Wasserprobe hatte sich sogar szenisch eine stille und berührende Umdeutung des Textes ereignet. Wenn Tamino und Pamina im Duett Feuer und Wasser durchschreiten und hier erst durch gemeinsam bewältigte Not und Gefahr zum Paar werden („Wir wandeln durch des Tones Macht, froh durch des Todes düstre Nacht! Wir wandelten durch Feuergluten, bekämpften mutig die Gefahr.“), sitzt das gealterte Paar am Flügel, schaut in die Partitur der Zauberflöte. Sie blickt in sanfter Melancholie zurück auf die gemeinsame Vergangenheit, in ihm blitzen Erinnerungen wieder auf. Sie haben ihren Frieden gemacht mit dem nahenden Ende, dem allmählichen Verdämmern, getröstet durch ihre Verbindung, dankbar für das gemeinsam Erlebte. Derart aus dem Märchenkontext herausgenommen zeigt sich eine unerwartete Parallele zum letzten von Richard Strauss‘ „Vier letzten Liedern“, wo es im Text von Eichendorff heißt: „Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand: Vom Wandern ruhen wir beide nun überm stillen Land. … Zwei Lerchen nur noch steigen nachträumend in den Duft. Tritt her und laß sie schwirren, bald ist es Schlafenszeit, daß wir uns nicht verirren in dieser Einsamkeit. O weiter, stiller Friede! So tief im Abendrot, wie sind wir wandermüde - Ist dies etwa der Tod?“

Michael Porter (Tamino), Corinna Schnabel (Frau) und Micha B. Rudolph (Mann)
Das Begleitheft zitiert dazu Schopenhauers überraschende Gedanken zur Zauberflöte, wonach der Tod als „unbekannter Führer“ gleich dem ägyptischen Priester die Suchenden zu ihrem Ziel führt: dem Ende des Lebens. So sieht man in der letzten Szene das alte Paar kurz vor dem physischen Erlöschen. Sie bereitet eine Mahlzeit, er läßt sich von ihr umsorgen. Der triumphale Schlußchor ertönt dazu aus dem Off, weht bloß von Ferne herein. Auch wenn so im letzten Drittel der Aufführung die philologisch diskutable Deutung des Stückes unter dem Leitmotiv des Übergangs vom Leben zum Tod an Prägnanz gewinnt, hat Ted Huffman insgesamt der Zauberflöte jeden Zauber und fast jeden Charme ausgetrieben. Allein die Papageno-Szenen läßt er zu ihrem Recht kommen, erlaubt hier dem famosen Danylo Matviinko sein enormes darstellerisches Potential auszuspielen und für wenige humorvolle Farbtupfer zu sorgen. Endlich ist dieser Sänger mit seinem gut fokussierten, virilen aber noch schlanken Bariton einmal in einer herausgehobenen Partie besetzt. Bei diesem Rollendebüt stimmt alles: Stimmfarbe, Gestaltung, Agilität und ausgezeichnete Textverständlichkeit. Hier ist ein großes Talent aus dem Opernstudio herausgewachsen, das dem Haus hoffentlich noch lange erhalten bleiben wird.

Belebende Farbtupfer: Danylo Matviinko (Papageno) und Karolina Bengtsson (Papagena)
Bei der Besetzung der übrigen Hauptpartien muß man trotz gediegenem Niveau hie und da kleine und einmal sogar größere Abstriche machen. Michael Porter geht den Tamino nachdenklicher als üblich an. So läßt etwa schon zu Beginn die differenzierte Gestaltung der Bildnis-Arie aufhorchen. Das ist technisch gut gemacht und überzeugt gerade in der intelligenten Textbehandlung. Jedoch bleibt sein Stimmtimbre, dem ein durchgängig klagender und mitunter leicht schluchzender Ton zu eigen ist, Geschmackssache. Für Andreas Bauer Kanabas liegt die Partie des Sarastro hörbar zu tief. Auch wirkt sein dunkel getönter Baßbariton gaumiger und schroffer als gewohnt. Der Pamina von Hyoyoung Kim fehlt es bei ihrem technisch tadellos geführten und angenehm klingenden Sopran dagegen (noch) an stimmlicher Individualität. Als Königin der Nacht führt der Besetzungszettel Anna Nekhames auf und weiß zu berichten, daß sie an der Wiener Volksoper in dieser Partie gefeiert worden sei. Entweder war sie an diesem Premierenabend vollständig indisponiert. Dann hätte sie es ansagen lassen müssen. Oder aber die Sängerin lag gefesselt und geknebelt im Keller des Opernhauses, während eine nahe Verwandte von Florence Foster Jenkins die Rolle gekapert hatte. Zu hören war eine piepsige Stimme mit ältlichem Timbre, die sich schon in der Auftrittsarie durch die Koloraturen mogeln mußte und den Spitzenton nur kurz anreißen konnte. Das ließ für die berühmte Rache-Arie nichts Gutes ahnen, und tatsächlich waren dann allenfalls Fragmente von Mozarts Komposition zu hören.

Anna Nekhames (sitzend) versucht sich an der Königin der Nacht
Über die Besetzung der Nebenpartien ist dagegen durchweg Erfreuliches zu berichten. Die drei Damen Monika Buczkowska, Kelsey Lauritano und Claudia Ribas gefallen mit frischen Stimmen und fügen sich zu einem gut aufeinander abgestimmten Terzett. Drei Knäbinnen aus dem hauseigenen Kinderchor bewältigen ihre Partien souverän und mit klarer Stimme (daß das Programmheft die jungen Sängerinnen jeweils als „SolistIn“ mit Binnen-I ausweist, entlarvt einmal mehr die Gedankenlosigkeit der epidemischen Durchgenderei). Theo Lebow gibt den Monostatos im traditionellen Ton eines Charaktertenors. Nach seinem Hausdebüt als Angelotti in der aktuellen Aufführungsserie der Tosca erfreut Erik van Heyningen erneut mit seinem satten, dunklen und zugleich noch jugendlichen Baßbariton in den beiden Partien des Sprechers und des Ersten Priesters. Karolina Bengtssons Sopran gefällt in der kleinen Partie der Papagena mit rundem Ton, der auf ihre Einsätze als Pamina in späteren Aufführungen neugierig macht. Eine beglückende Leistung bietet das Orchester unter der Leitung von Steven Sloane. Daß die ersten beiden Einsätze der Pauke in der Ouvertüre zu früh kommen, ist der Premierennervosität geschuldet. Die Musiker zeigen sich in allen Gruppen in bestechender Form. Die Streicher meistern den historisch informierten Verzicht auf Dauervibrato ohne die sonst so oft zu hörenden Intonationstrübungen. Trotz reduzierter Besetzung klingen sie nicht anämisch dünn, sondern erfreuen mit klarem, spannungsreichem Ton und sprechender Phrasierung. Die stark geforderten Holzbläser entfalten solistisch eine breite Palette an Klangfarben und fügen sich im Ensemble zu leuchtenden Harmoniemusiken. Dem Dirigenten gelingt es trotz des beständigen Stopp-and-Go der Regie immer wieder gleichsam aus dem Stand die Musik unter prickelnde Spannung zu setzen. Die oft sehr raschen Tempi wirken dabei nie gehetzt. Würde es allein auf den Orchestergraben ankommen, so wäre von einem perfekten Premierenabend zu berichten gewesen. Daß der Chor sich mit gut ausbalanciertem Klang ideal hinzufügt, bedarf in Frankfurt kaum noch der Erwähnung.
Das Publikum geht im Schlußapplaus mit den Sängern freundlich um und belohnt die Orchesterleistung mit ungeteiltem Zuspruch. Bei der Bewertung von Regie und Bühnenbild zeigt es sich gespalten. Zum Publikumsliebling wird diese Produktion nicht werden. Für den Erstkontakt mit der Kunstform Musiktheater eignet sie sich für Kinder und Opernanfänger kaum. Selbst die Gutwilligen im Stammpublikum werden ohne Vorbereitung mit dem Regieansatz nicht warm werden können. Es ist kaum vorstellbar, daß diese Produktion allzu viele Wiederaufnahmen erleben wird.
Michael Demel / 3. Oktober 2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
Luigi Dallapiccola: ULISSE
Bericht von der Premiere am 26. Juni 2022
Trailer
Zwölfton-Belcanto und Euro-Trash
Als der Komponist Luigi Dallapiccola anläßlich der Uraufführung seiner Oper Ulisse (unter dem in Deutschland gebräuchlicheren griechischen Namen „Odysseus“) an der Deutschen Oper Berlin im Jahr 1968 gefragt wurde, warum denn das Werk in deutscher Sprache aufgeführt werde, entfuhr ihm ein Seufzer. Das sei ein „notwendiges Übel“. Schließlich müsse ja das Publikum in die Lage versetzt werden, dem Drama zu folgen. Seinerzeit gab es aber noch keine Übertitel. Warum die Oper Frankfurt unter dem italienischen Titel „Ulisse“ nun trotz Einsatzes von Übertiteln den deutschen „Odysseus“ gibt, erschließt sich nicht. Man mag darin allenfalls den Beweis dafür erbracht sehen, daß dieses Werk sich nicht durchgesetzt hat. Denn Dallapiccola erläuterte damals weiter, daß in solchen Fällen, bei denen eine neue Oper sich nach vierzig bis fünfzig Jahren etablieren könne, also Teil einer Kultur werde, welche keine Grenzen kenne, man dann zur Originalversion zurückkehren könne. Schließlich werde ja auch inzwischen Wagner in Italien auf Deutsch und Verdi in Deutschland auf Italienisch gegeben. Der Verzicht auf die Originalsprache bei der Frankfurter Erstaufführung ist also ein untrügliches Zeichen dafür, daß hier eine Oper den tiefsten Tiefen des Vergessens entrissen wurde. In Deutschland wurde sie zuletzt 1984 in Oldenburg aufgeführt.

Das hat Gründe. Nicht zuletzt liegt es an dem vom Komponisten selbst verfassten Libretto, welches Homers Epos mit der Weiterspinnung der Odysseus-Geschichte in Dantes Göttlicher Komödie und allerlei sonstigen literarischen und philosophischen Lesefrüchten anreichert und modifiziert, die sich allenfalls Kennern erschließen, und vollständig wohl noch nicht einmal diesen. Zunächst aber folgt Dallapiccola in geraffter Form dem klassischen Original und präsentiert in rascher Szenenfolge den Abschied von Kalypso, den Aufenthalt bei den Phäaken, wo dann über Erzählungen des Titelhelden die Episoden bei den Lotophagen, mit der Zauberin Kirke und der Abstieg in den Hades heraufbeschworen werden, und schließlich die Heimkehr nach Ithaka mit dem Gemetzel an den Freiern der Penelope. Aber schon dabei findet eine philosophische Übermalung statt, spielt das Motiv der Selbstfindung, ausgedrückt in der Eigen- und Fremdbezeichnung als „Niemand“ die zentrale Rolle. So läßt Dallapiccola den heimgekehrten Helden keine Ruhe finden, sondern schickt ihn mit Dante als rastlos Suchenden wieder hinaus auf das Meer. Dort, und das ist eine über Dante hinausgehende Erfindung des Komponisten, erfährt Odysseus eine Art pantheistische Epiphanie: Der gestirnte Himmel über dem Meer verschafft ihm die Erfahrung einer göttlichen Präsenz als Antwort auf seine Suche. Der Zuschauer sollte also vor dem Besuch der Vorstellung mindestens seine Homer-Kenntnisse auffrischen, besser noch den Einführungsvortrag in dem etwas trockenen, aber informativen Video der Frankfurter Dramaturgie anhören, nicht nur, um sich szenisch zu orientieren, sondern auch, um die Abweichungen, Ergänzungen und Fortspinnungen zu erkennen.

Iain McNeil in der Titelpartie
Die Musik dazu hat einen besonderen Reiz. Da sie einem vom Komponisten in Abgrenzung zu Schönberg entwickelten, durchaus aber ähnlich strengen Zwölfton-Dogma folgt, gibt es keinerlei erinnerbare melodische Motive oder zusammenhangstiftende harmonische Beziehungen. Vielmehr schafft der Komponist trotz der für das menschliche Ohr und Hirn zufällig wirkenden Tonfolgen und vertikalen Abläufe reizvolle Kontraste über eine für jede Szene charakteristische, abwechslungsreiche Instrumentierung. Die Führung der Gesangsstimmen schließlich wahrt oft ein gewisses Moment von Sanglichkeit. Das hat den großen Ulrich Schreiber, der dem Ulisse in seinem monumentalen Standardwerk „Die Kunst der Oper“ im vierten Band immerhin fast sechs Seiten widmet, zu der verwegenen Zwischenüberschrift „Ein Füllhorn des Wohlklangs“ verführt. Die Oper Frankfurt tut in der Neuproduktion alles, um diese Zuschreibung zu beglaubigen. Das Orchester unter der Leitung von Francesco Lanzillotta entfaltet den Farbenreichtum der Partitur und ermöglicht es dem Zuhörer so, wo doch harmonische und melodische Sinnstiftung fehlt, die kompliziert ausgetüftelte Musik wenigstens als suggestiven „Soundtrack“ zu erleben. Bei der Besetzung kombiniert die Oper Frankfurt die Stars ihres Ensembles mit aufstrebenden jungen Talenten und wenigen Gästen. Die großartige Claudia Mahnke etwa ist sich nicht zu schade, mit ihrem warmen Mezzo in einem kurzen Auftritt als Odysseus‘ Mutter Antikleia zu glänzen, Andreas Bauer Kanabas hat sichtlich Spaß daran, neben dem Ausspielen der stimmlichen Möglichkeiten seines profunden Baßbaritons darstellerisch den König Alkinoos als doppelbödige Figur zwischen Herrscher und Entertainer zu zeichnen. Auch Katharina Magiera mit ihrem sonoren Mezzo in der Doppelrolle als Kirke und Melantho und Juanita Lascarro mit ihrem fruchtigen Sopran in der Doppelrolle als Kalypso und Penelope liefern darstellerisch ausgefeilte und musikalisch profilierte Kabinettstückchen ab. Die Krone aber gebührt Iain MacNeil in der Titelpartie. Der junge Sänger verströmt sich mit seinem frischen und markanten Bariton geradezu und weiß sein attraktives Stimmmaterial dabei differenziert abzutönen. Er führt tatsächlich vor, daß „Zwölfton-Belcanto“ keine paradoxe Wortkombination sein muß. Die Saftigkeit gerade seiner hohen Lage hat sogar gleich zwei Kritikerkollegen in ihren Premierenberichten zu dem Fehlschluß verleitet, es handele sich bei ihm um einen Tenor. Mit im Kontrast dazu dunklerer Stimmfärbung stellt auch Danylo Matviienko als Antinoos erneut die Potenz seines Baritons unter Beweis. Er schwingt sich im zweiten Teil als Wortführer unter den Freiern der Penelope zum nicht nur stimmlich vor Virilität strotzenden Gegenspieler des Odysseus auf. Wie stets bereitet Brian Michael Moore mit seinem gut geführten, angenehm timbrierten Tenor Freude, dieses Mal in der kleinen Partie des Hirten Eumäos. Es wäre an der Zeit, sein Potential in größeren Partien auszuschöpfen. Die wenigen Gastsänger fügen sich in das Ensemble, ohne aus ihm herauszustechen, so Sarah Aristidou mit mädchenhaft-hellem Sopran als Nausikaa, Yves Saelens in der Doppelrolle als Demodokos und Teiresias sowie Dmitry Egorov, für dessen in Frankfurt in vielen Partien bewährten Countertenor die kleine Rolle des Telemachos wenig Gelegenheit zur Profilierung gibt. Schließlich ist der Chor zu loben, der szenisch stark gefordert ist und musikalisch die nicht geringen Anforderungen der Partitur souverän bewältigt.

Iain MacNeil (Odysseus), Yves Saelens (Demodokos), Andreas Bauer Kanabas (Alkinoos) und Sarah Aristidou (Nausikaa)
Musikalisch steht diese Produktion also glänzend da. Die Regiearbeit von Tatjana Gürbaca im Bühnenbild von Klaus Grünberg und den Kostümen von Silke Willrett vermag dagegen die Einschätzung von Ulrich Schreiber nicht zu entkräften, daß das Stück sich wohl eher für konzertante Aufführungen eigne. Schon das Setting kann nicht überzeugen: Die Einheitsbühne zeigt eine heruntergekommene Tiefgarage mit zum Teil abgebrochenen metallenen Stützsäulen unter gedrungener Decke. Daß man ein Stück, das durchgängig einen szenischen Bezug zum Meer aufweist und seine abschließende Erlösungsszene auf offener See spielen läßt, dessen Komponist sein musikalisches Material aus einer wellenförmigen Zwölftonreihe gestaltete, die er „Mare I“ nannte und von der er zwei Ableitungen unter der Bezeichnung „Mare II“ und „Mare III“ entwickelte, daß man also ein solches in Text und Musik gleichsam meerdurchflutetes Werk durchgängig in einem offensichtlich unterirdischen, von Luft, Licht, Wasser und gar einem Meeresblick abgeschotteten Raum spielen läßt, drückt auf die Stimmung der Zuschauer und vereitelt ein atmosphärisches Einfühlen in das physische Erleben des Protagonisten. Viele Kritikerkollegen haben dazu die Behauptung der Regisseurin im Programmheft abgeschrieben, es handele sich hier um eine „Ausgrabungsstätte“, in welcher "Schichten freigelegt" würden. Auf der Bühne ist aber nichts von Ausgrabungen zu sehen. Diese Inszenierungsidee ist eine bloße Behauptung und bleibt szenisch folgenlos. Ausgegraben wird allenfalls jener Inszenierungsstil, den man mit einigem Recht „Eurotrash“ nennt und der allenfalls noch für Theaterhistoriker von Interesse schien, hier aber als poppig-bunter Untoter seine oft aufdringlichen Verrenkungen mit einer unangenehmen Neigung zur Überdeutlichkeit aufführt. Da gibt es ein Kopf-unter-den-Rock-stecken bei Odysseus‘ Begegnung mit Nausikaa, Penis-Aufsatz-Taschen für die Freier, Cheerleader-Gewuschel und eine Modenschau der scheußlichsten Verirrungen aus den letzten Jahrzehnten. Daß Gürbaca den Regisseur Konwitschny als Lehrer und großes Vorbild nennt, der allzugern mit dem Holzhammer inszeniert und dem kaum etwas zu trashig, zu ordinär, zu zotig oder zu plump ist, ist leider gerade in der ersten Hälfte allzu oft zu erkennen. De gustibus non est disputandum. Dem Sitznachbarn jedenfalls hat gerade das gut gefallen: „Immer was los auf der Bühne!“

Vor allem im ersten Teil verwischt die Inszenierung zudem die in der Musik durch Zwischenspiele markierte und durch Instrumentierungswechsel klar herausgestellte Trennung der episodenhaft präsentierten Szenen. Wer sich vorher nicht gründlich in Homer und am besten noch in Ulrich Schreibers Opernführer eingelesen hat, wird im szenischen Misch-Masch und allgemeinen Getümmel nur schwer identifizieren können, ob man sich noch bei den Phäaken, schon bei den Lotophagen oder gar bereits im Hades befindet. Der zweite Teil am Hofe Ithakas gelingt dann szenisch stringenter, weiß sogar nebst geschickten Beleuchtungseffekten die szenischen Aufbauten plausibel zu nutzen und ist dazu geeignet, den vom szenisch schwachen ersten Teil ermatteten Zuschauer mit der Inszenierung zu versöhnen.
Fazit: Das Stück ist literarisch und musikalisch fordernd. Man sollte sich diesem zwei Stunden langen Abend nicht unvorbereitet aussetzen. Die musikalische Qualität der Aufführung beglaubigt den Rang als eines der wichtigsten Musiktheaterwerke der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Die szenische Umsetzung belastet ein Libretto, das zu Recht als „Extremfall der Literarisierung“ (Ulrich Schreiber) gilt, mit einer zusätzlichen „Idee“, die sich als schwach und für das Verständlichmachen der Intentionen des Komponisten wenig hilfreich erweist und in dem der überwunden geglaubte „Euro-Trash“ fröhliche Urständ feiert.
Michael Demel / 10. Juli 2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
Weitere Vorstellungen gibt es am 15., 18. und 21. Juli.
MADAMA BUTTERFLY
Bericht von der Premiere am 22. Mai 2022
Radikal entfettet
„Ich gestehe, daß ich selber sozusagen mit der Psychose lebe, ein Italiener zu sein. Ich kann Puccini nicht vertragen und sage so oft „Nein“ wie möglich zu italienischem Repertoire. „Bohème“, das sehe ich ein, ist ein Meisterwerk. Aber „Tosca“? Das dirigiere ich auf keinen Fall.“
Das sprach der Dirigent Antonello Manacorda in einem Interview mit der Zeitschrift RONDO im Jahr 2016. Nun dirigiert er an der Oper Frankfurt die Madama Butterfly, die wir als Rührstück in Erinnerung haben, das traditionell auf der Bühne mit fernöstlichen Ausstattungsklischees vollgerümpelt wird, Kimono, Kirschblüten und was sich der Europäer so unter Japan vorstellt. Daß Manacorda nun trotz seines noch gar nicht so alten Verdikts nun ausgerechnet an diesem Repertoire-Schinken seine Puccini-Neurose erfolgreich bewältigen kann, verdankt er der Grundhaltung des für die Szene verantwortlichen Produktionsteams und vor allem der Besetzung der Titelpartie. Die junge Sopranistin Heather Engebretson gibt ihre erste Chio-Chio-San, und alles ist anders als gewohnt. Sie ist bereits optisch perfekt gecastet: Eine zierliche junge Frau, bei der im Publikum niemand kichern muß, wenn sie zu Beginn ihr Alter verrät: 15 Jahre. Daß die Amerikanerin chinesische Vorfahren hat, erspart der Regie die Auseinandersetzung mit der Frage, ob es politisch korrekt ist, eine nicht-asiatische Sängerin klischeehaft umzuschminken. Die Kostümbildnerin Doey Lüthi spendiert ihr zwei elegante, moderne Abendkleider, in denen die Engebretson eine ausgezeichnete Figur macht, eines in rot und ein silbrig schimmerndes. Dies sind die beiden zentralen Farbtupfer in der von Johannes Leiacker vollständig entrümpelten Bühne.

Dabei folgt er listig dem Libretto, in dem es zu Beginn über das vom Kuppler Goro für Pinkerton vorbereitete Haus heißt: „Diese Wände und Decken ... könnt Ihr alle verschieben, und immer nach Belieben in demselben Gemache 'nen wechselnden Anblick Euch verschaffen.“ Das Frankfurter Bühnenbild besteht dementsprechend aus zwei verschiebbaren Wänden, einer schwarzen im vorderen Bereich und einer weißen hinten mit jeweils einer fensterartigen Aussparung. Das einzige Möbelstück darin ist ein Stuhl. Mal gibt die vordere Wand den Blick auf das Geschehen frei, mal verdeckt sie es. Kaltes Licht (Olaf Winter) verstärkt die radikale Reduktion. Puccinis Tragedia giapponese ist damit aller Japonismus ausgetrieben worden. Und so zieht die zierliche Kindfrau alle Blicke auf sich.

Heather Engebretson als Chio-Chio-San
Engebretson hat für die Konversation des Beginns helle und klare Töne, die die mädchenhafte Naivität beglaubigen, zeigt dann jedoch, daß sie über eine zweite Stimme verfügt. Man staunt, zu welcher Kraft und welchem Volumen sie sich aufschwingen kann. Leidenschaft, Hoffnung, Verzweiflung, Resignation: Für jede Gefühlsregung findet sie eine überzeugende Stimmfarbe. Ihr Spiel bildet mit dem Gesang eine Einheit. Regisseur R.B. Schlather hat mit ihr Gesten und Aktionen erarbeitet, die fern von jeder Beliebigkeit sind. Der Jubel im Schlußapplaus für diese außerordentliche Leistung erreicht Orkanstärke. Die Chio-Chio-San mag schon saftiger oder kulinarischer oder pathetischer gesungen worden sein, nie aber wahrhaftiger.
Auf Augenhöhe mit der Protagonistin agiert Kelsey Lauritano als Suzuki, deren warmer Mezzosopran einen passenden Kontrast zur hellen Stimme der Engebretson bietet. Auch bei ihr sind Gesten und Blicke genau auf Szene und Musik abgestimmt und gelingen dabei mit eindringlicher Selbstverständlichkeit. Szenisch weniger gefordert ist Domen Krizaj als Konsul Sharpless, der mit seinem sonoren Bariton gefällt. Vincenzo Costanzo ist als Pinkerton kurzfristig für den erkrankten Evan Leroy Johnson eingesprungen. Er macht seine Sache ordentlich und fügt sich gut in das Regiekonzept ein. Seinem schlanken Tenor trotzt er einige Spinto-Töne ab und klingt dabei in der Höhenlage ein wenig steif und halsig.

Kelsey Lauritano als Suzuki
Einen kurzen, aber eindrucksvollen Auftritt hat Kihwan Sim als Onkel Bonzo. Mit seinem dunklen, machtvollen Baßbariton verleiht er der Verfluchung und Verstoßung Chio-Chio-Sans gnadenlose Autorität. Er ist als einzige Figur in japanische Tracht gekleidet und trägt zudem den Schädel kahlrasiert. Sein Auftritt wird von plötzlich aufwallendem Bühnennebel begleitet und so als geradezu katastrophisches Hereinbrechen des Geltungsanspruchs erstarrter Tradition herausgestellt. Nur an einer weiteren Stelle erlaubt sich das Produktionsteam noch einen solchen kalkulierten Rückgriff auf einen gewöhnlichen Theatereffekt: Zur Hochzeitsnacht senkt sich ein funkelnder Sternenhimmel von oben herab. Das Publikum weiß, dies ist bloß Kulisse. Nur Chio-Chio-San träumt dazu von der wahren Liebe.

Der böse Kern der Geschichte, den R.B. Schlather auf der nackten, kalten Bühne freilegt, rührt nicht, er schmerzt. Wie die junge Frau an einen amerikanischen Offizier zu dessen Vergnügen verschachert wird, seine Liebe für aufrichtig hält, geschwängert und verlassen wird, trotzdem unbeirrt an seine Rückkehr glaubt, als von ihrer traditionellen Gesellschaft Verstoßene Jahre lang auf ihren Geliebten wartet, bei dessen später Rückkehr erkennt, daß er inzwischen mit einer Amerikanerin verheiratet ist, ihr Kind hergeben muß und schließlich in den Tod geht, das alles ist nicht leicht zu ertragen, wenn man sich nicht von Folklore-Kitsch ablenken lassen kann und zudem auf der Bühne eine derart rückhaltlose Identifikation der Protagonistin mit ihrer Figur erlebt. Dazu wäre der übliche Puccini-Breitwandsound unpassend. Antonello Manacorda lenkt dagegen im Orchestergraben mit hochmotivierten Musikern kongenial den Blick auf die Struktur der Partitur und deren differenzierte Abstufung der Klangfarben. Selten hat man bei Puccini so interessiert auf den Orchestersatz gelauscht und selten hat man dabei so viel zu entdecken. Auch hier gibt es keine Sentimentalität, keine Kulinarik, keine italo-japanische Klangtapete. Diese Butterfly ist auch musikalisch konsequent entfettet worden, ohne dabei akademisch trocken zu wirken. Nachdem Manacorda nun seine Puccini-Psychose derart erfolgreich therapiert hat, könnte er sich eigentlich unerschrocken die Tosca vornehmen. Wir sind gespannt.
Michael Demel / 24. Mai 2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
Fedora
Zweite Kritik
Die große Schauspielerin Sarah Bernhardt, Diva par excellence, welche die Rolle der Fedora in Victorien Sardous Drama aus der Taufe gehoben hatte, sagte über die Figur: "Für mich ist Fedora wie eine zweite Erschaffung der Frau. Eva, die Schöpfung Gottes, ist die Frau. Fedora, die Kreation Sardous, das sind alle Frauen, das ist die Verkörperung aller weiblichen Vorzüge und Schwächen ... Ein gefallener Engel mit weißen Flügeln."
Genau diese Vielschichtigkeit Fedoras kommt in Christof Loys großartiger Inszenierung beeindruckend zur Geltung. In einem salonartigen Einheitsbühnenbild (die Bühne und die fantastische, einfallsreiche Kostümdramaturgie wurden von Herbert Murauer entworfen) läßt Loy das Melodram abspielen. Die Hinterbühne wird durch einen gigantischen Goldrahmen abgetrennt. Darauf werden in schwarz-weiß Projektionen live close-ups der Protagonistin, aber auch Wege, Handlungen und Emotionen aus dem Backstage-Bereich projiziert. Die Tapete, die den Rahmen ausfüllt, kann aber auch hochgefahren werden und den Blick auf stimmungsvolle tableaux vivants freigeben, so im zweiten Akt den Pariser Salon oder im dritten Akt die gelöste Stimmung in der Wohngemeinschaft der Ferienwohnung im Berner Oberland. Giordanos FEDORA läuft ja oft Gefahr, zum bloßen Ausstattungsstück zu verkommen (die dankbaren Schauplätze St.Petersburg, Paris und Schweizer Bergidylle laden natürlich vordergründig dazu ein) oder zum Vehikel für Operndiven gegen Ende ihrer Karrieren. Dies ist hier an der Oper Frankfurt weder mit Loys kluger Inszenierung (Übernahme aus Stockholm) noch mit der Interpretin der Titelrolle, Nadja Stefanoff, der Fall. Nadja Stefanoff besticht sowohl mit ihrer ausdrucksstarken, wunderschön timbrierten und vortrefflich geführten Stimme, als auch mit ihrer grandiosen szenischen Präsenz, welche in den intimen Nahaufnahmen ein überragendes schauspielerisches Talent offenbart. Da weht ein Hauch von Hollywood mit den melodramatischen Filmen der 40er und 50er Jahre durch das Haus. Und wie Sarah Bernhardt angemerkt hatte, ist auch Nadja Stefanoff alle Frauen, mal berechnend wie Bette Davis, mal rasend vor Rach- und Eifersucht wie Joan Crawford oder Glenn Close, gar naiv wie Doris Day. Da der Zuschauer in diesem pièce-bien-faite immer mehr weiß, als die Protagonisten, kriegt die ganze Handlung den Touch des Film noir.
Giordano hat eine stimmungsvolle, atmosphärisch dicht an die drei Handlungsorte angelehnte Musik komponiert. Die ist mit eingängigen Erinnerungsmotiven durchsetzt, die Musikalität der Dialoge ist eindrucksvoll an den Sprachduktus angelehnt und doch nie bloß Konversation. Immer wieder steigen ariose, emphatische Ausbrüche auf, der Spannungsbogen reißt nie ab. Dafür sorgt das wunderbar differenziert die Feinheiten der Partitur transportierende Frankfurter Opern- und Museumorchester unter der exzellenten, die Ausführenden auf der Bühne auf herrlichen Orchesterwolken tragenden Leitung von Lorenzo Passerini. Das ist Musik, die mal zum Dahinschmelzen schön ist, wie das bekannte Intermezzo sinfonico, dann wieder aufrüttelt wie Filmmusik zu einem Thriller. Einer der vielen musikalischen Höhepunkte stellt wohl die Salonszene in Paris dar: Während der Pianist auf der Hinterbühne als Neffe und Nachfolger Chopins ein Live-Konzert gibt, entlockt Fedora auf der Vorderbühne Loris das Geständnis des Mordes an ihrem Verlobten. Das ist musikalisch und szenisch Kino von der besten Sorte, dreißig Jahre bevor der Tonfilm erfunden wurde. Der Kapellmeister der Oper Frankfurt, Simone de Felice, sprang persönlich für den vorgesehenen und leider erkrankten Pianisten Mariusz Klubczuk ein. Simone de Felice glänzten mit brillant perlendem Klavierspiel und verführerischer szenischer Ausstrahlung. Schließlich verdreht er ja der lebenslustigen Gräfin Olga Sukarew - mit überragender stimmlicher und darstellerischer Gewandtheit gesungen von Bianca Tognocchi - den Kopf. In diesem Akt hat auch der primo uomo seinen ersten Auftritt. Und was für einen! Nach einem ultrakurzen Dialog mit Fedora stimmt er DIE Arie des Stücks an: Amor ti vieta di non amar. Jonathan Tetelman singt das natürlich mit dem gebotenen tenoralen Schmelz, seine Stimme ist dermaßen schon gefärbt, daß man einfach hin und weg ist, ja sogar Gänsehaut kriegt und wohlige Schauer spürt. Was seine Interpretation jedoch ganz einzigartig macht, ist das wunderbar organisch (und natürlich den Effekt nicht negierende) aus bezwingend feinem, intovertierten Piano aufgebaute Crescendo zum Ende der Arie hin. Ganz große Klasse! Auch im weiteren Verlauf des Stücks singt und agiert er mit sympathischer Naivität, läßt seine herrliche Stimme in den Ariosi und den Duetten immer wieder aufblitzen, wechselt im dritten Akt von verliebt-verspieltem Humor zu erbarmungsloser Wut und am Ende zu hilfloser Verzweiflung, wenn Fedora sich vergiftet und ihm entschwindet. Szenisch ist auch dies von Christof Loy sehr gelungen gelöst worden. Fedora stirbt hier nicht in seinen Armen, zum traurigen Gesang des Hirtenjungen (mit berührender Zartheit gesungen von Samuel Preissenberger) geht sie ganz unscheinbar nach hinten ab.
Das Gegenpaar zu den beiden tragischen Protagonisten verkörpern Olga und der Diplomat de Siriex. Dieser wird mit einnehmendem Bariton von Nicholas Brownlee verkörpert. Großartig seine Analyse der russischen Frauen, nicht weniger eloquent und witzig vorgetragen fällt Bianca Tognocchis Replik über die französischen Männer aus, worin Giordano und sein Librettist nicht gerade Werbung für die Champagnermarke Veuve Cliquot machten .... . Gabriel Rollinson macht großen Eindruck als Borow, Arzt und Freund von Loris. Einen bemerkenswerten Auftritt hat der Baß Thomas Faulkner als Kutscher Cirillo, als er zur Zeugeneinvernahme durch den Polizeikommissar Gretch (sehr gut dargestellt von Frederic Jost) aufgeboten wird. Aufhorchen ließ der samtene Mezzosopran von Bianca Andrew als Laufbursche Dimitri, dem vom Regisseur noch ein niedliches homoerotisches Verhältnis mit einem anderen Bediensteten angedichtet wurde, warum auch immer, vielleicht um weitere "Aspects of Love" in die an Elementen eh schon reiche Handlung einzufügen.
Eines wurde an diesem Abend klar: Diese Oper gehört (wieder) vermehrt auf die Bühne, nicht nur für Liebhaber des Verismo, sondern für alle, die gut gemachte, kurzweilige Stücke lieben. Die 100 pauenlosen Minuten vergingen jedenfalls wie im Flug. In dieser exzellenten Besetzung und mit diesem szenischen Konzept ist das einstige Erfolgswerk purer Opern- und Theatergenuss.
(Bilder: siehe Premierenkritik unten)
Kaspar Sannemann, 9.4.22
FEDORA
Premiere am 3. April 2022
Trailer
Musterhafte Produktion einer disparaten Verismo-Oper
In seinem voluminösen, fünfbändigen Referenzwerk „Die Kunst der Oper“ läßt Ulrich Schreiber kaum ein gutes Haar an Umberto Giordanos Verismo-Oper Fedora. Die Einrichtung des zur Entstehungszeit erfolgreichen Theaterstücks von Victorien Sardou für die Opernbühne sei „nicht gerade eindrücklich“ geraten. Der erste Akt sei sogar insgesamt „mißglückt“, der Komponist habe für dessen Parlandi kein „musikalisches Triebmittel“ gefunden. Der „Überhang an dialogischer Konversation“ habe eine „leerläuferische Wirkung“. Die existenzielle Auseinandersetzung an einer zentralen Stelle des zweiten Aktes – Fedora entlockt dem Mann, in den sie sich gerade verliebt hat, das Geständnis, ihren vormaligen Verlobten erschossen zu haben – klinge „wie ein Salonstück“, weil der Komponist hier den neuartigen Einfall gehabt habe, die Szene ohne Orchesterbegleitung spielen und stattdessen einen Pianisten im Hintergrund Chopin-artige Klaviersolostücke vortragen zu lassen. Derart vorgewarnt staunt der Besucher der aktuellen Premiere an der Oper Frankfurt nicht schlecht, daß ausgerechnet dieser angeblich vollständig mißratene erste Akt zum Glanzstück der Regie gerät. Sehr einnehmend ist schon zu Beginn das optisch attraktive Bühnenbild (Herbert Murauer). Es zeigt einen bürgerlichen Salon in Fin-de-siècle-Anmutung, der vollständig samt den Türen mit fliederfarbenen Stofftapeten bespannt und in vergoldete Holzleisten eingefaßt ist. Der Bühnenprospekt wird bestimmt von einem überdimensionierten Bilderrahmen, dessen Leinwand ebenfalls mit der Stofftapete bespannt ist.

Hierauf läßt Regisseur Christof Loy immer wieder Videos projizieren. Was in anderen Inszenierungen oft ein Ausdruck von szenischer Einfallslosigkeit ist, gerät hier zum Coup. Zunächst gibt es konventionelle Bilder, etwa eine Nahaufnahme der Protagonistin, die lediglich vergrößert, was gerade auf der Bühne geschieht. Auch nichts Neues sind Einblendungen von Erinnerungsbildern, etwa ein Porträt von Fedoras abwesendem Verlobten, während sie gerade von ihm schwärmt. Dann aber nutzt die Regie Livekameras, um das Bühnengeschehen aus anderen, dem Publikum auf der Guckkastenbühne verborgenen Blickwinkeln zu präsentieren und etwa aus sich öffnenden Türen heraus zu filmen oder sogar Parallelaktionen in (vermeintlich) angrenzenden Räumen zu zeigen. Höchst effektvoll wird auf diese Weise das Sterben des verwundeten Verlobten bebildert, samt Nahaufnahmen der Gefühlsregungen Fedoras in Stummfilmästhetik. So kommt es zu faszinierenden räumlichen Weitungen, zugleich zu einem virtuosen Spiel von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit. Nadja Stefanoff in der Titelpartie erweist sich dabei optisch und darstellerisch als ausgezeichnete Besetzung für die Beglaubigung dieses Amalgams aus vorgefertigten Sequenzen und unmittelbarer Bühnenaktion.

Die von Ulrich Schreiber harsch kritisierte Klaviermusikszene im zweiten Akt wird ebenso werkdienlich wie bühnenwirksam realisiert. Die Leinwand innerhalb des riesenhaften Bilderrahmens hebt sich vorhangartig und gibt den Blick auf einen dahinterliegenden weiteren Salon frei. Dort wird in räumlicher Distanz ein Klaviervirtuose von einer Abendgesellschaft für seine Darbietungen bewundert, während im vorderen Teil der Bühne die vermeintliche Enttarnung des von Fedora begehrten Loris als Mörder ihren Lauf nimmt. Die Entscheidung der Regie für die deutliche räumliche Trennung dieser Parallelaktionen ist dramaturgisch schlüssig und entkräftet das eingangs zitierte Verdikt des Musikwissenschaftlers. Der letzte Akt ist dann handwerklich konventioneller geraten, besticht aber ebenso durch plausible Personenregie und gute darstellerische Leistungen.

Insgesamt hat die Oper mit rund 100 Minuten lediglich Spielfilmlänge. In Frankfurt wird sie ohne Pause durchgespielt. Das verstärkt ebenso wie der Rahmen des Einheitsbühnenbildes den Eindruck von Geschlossenheit und verleiht der Produktion eine Stringenz, die dem Libretto abgeht. Der vermeintliche Mord am Verlobten Fedoras, einer russischen Adligen, ist im ersten Akt der Ausgangspunkt einer Kriminalermittlung. Im zweiten Akt gelingt es Fedora zwar, dem Täter Loris ein Geständnis zu entlocken und ihn und seinen Bruder als mutmaßlichen Mittäter bei der russischen Polizei zu denunzieren. Erst später aber erfährt sie das Tatmotiv: Fedoras Verlobter hatte ein Verhältnis mit Loris‘ Ehefrau. Als Loris die beiden bei einem Tête-à-Tête erwischte, wurde er vom ungetreuen Verlobten angeschossen, erwiderte das Feuer und traf diesen tödlich. Nach Kenntnis der wahren Hintergründe bewahrt Fedora Loris vor der Verhaftung und beginnt mit ihm ein neues Leben in der Schweiz. Doch die Vergangenheit holt sie ein. Durch ihre Denunziation wurde Loris‘ Bruder verhaftet und verstarb im Kerker. Die Nachricht von seinem Tod verursachte bei seiner Mutter einen tödlichen Schlaganfall. Loris erhält die Todesnachricht mit der Information, eine „russische Spionin“ habe die Verhaftung des Bruders bewirkt. Loris sinnt auf Rache. Fedora offenbart sich ihm, sieht ihr Glück jedoch unwiederbringlich zerstört und trinkt vor seinen Augen eine tödliche Dosis Gift.

Anders als Puccini in seiner Vertonung der Tosca, ebenfalls nach einem Theaterstück von Sardou, hat Giordano seiner Titelfigur keine große Wunschkonzertarie gegönnt. Wer auf Youtube die Suchbegriffe „Fedora“ und „Arie“ eingibt, bekommt als Treffer immer nur „Amor ti vieta“ angezeigt, eine Arie des Loris. Jonathan Tetelman singt sie mit allen Attributen eines potenten Spintotenors, kraftstrotzend, höhensicher und mit attraktiver Färbung. Die Oper Frankfurt hat hier einen angehenden Weltstar engagiert mit Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon. Doch angehender Weltstar hin, Exklusivvertrag her: Der junge Mann mit der blendenden Stimme singt laut, sehr laut. Allzu oft: zu laut, so als wolle er nicht den Zuschauerraum der Frankfurter Oper füllen, sondern die Arena in Verona oder gar die Tribünen samt Bodensee bei den Bregenzer Festspielen, und zwar ohne elektronische Verstärkung. Damit fällt er immer wieder aus dem Gesamtklang heraus, wirkt mitunter wie ein musikalischer Fremdkörper. Das ist schade, denn gelegentlich zeigt er auch, daß er diese Lautstärke nicht nötig hat, daß seine Stimme auch bei zurückgenommener Wucht tragfähig ist. Nadja Stefanoff überzeugt ihm gegenüber trotz kleinerer Stimme musikalisch sehr viel mehr, weil sie ihren klaren, gut geführten Sopran mannigfache Abstufungen in Lautstärke und Klangfarben abgewinnen kann. Womöglich fehlt es ihr an letztem Diven-Glanz, was aber gerade bei dieser Partie weniger ins Gewicht fällt, schon gar wenn stimmliche und darstellerische Mittel sich so gut zu einem rundum überzeugenden und facettenreichen Porträt fügen. Auch wenn es sich bei der Produktion um eine Übernahme von der Königlichen Oper Stockholm handelt, verleiht die Ausgestaltung der Titelfigur durch Nadja Stefanoff dieser Premiere Eigenständigkeit.

Wie man sich trotz kraftvoller Stimme gut in ein Ensemble fügt, demonstriert Nicholas Brownlee als De Sirex. Der junge Baßbariton darf in dieser Spielzeit die ganze Bandbreite seiner Möglichkeiten zeigen, vom donnernden Propheten Jochanaan in der Salome zum Saisonbeginn, über einen markanten Geisterboten in Frau ohne Schatten noch am Vortag der Premiere bis zu den Titelpartien in Król Roger und Herzog Blaubarts Burg am Ende dieser Saison. Der Einsatz im italienischen Fach gelingt ihm musikalisch souverän, und auch an seinen szenischen Aufgaben hat er sichtbares Vergnügen. Bianca Tognocchi ist mit ihrem hellen Soubrettenton auch dieses Mal in der Rolle der Olga für auflockernden Humor zuständig und wird der Partie quecksilbrig-munter gerecht. In einer Unzahl von Klein- und Kleinstrollen bewährt sich das Stammensemble der Oper Frankfurt. Mariusz Kłubczuk, Solorepetitor am Haus, brilliert nicht nur in dem wichtigen Klavierpart im zweiten Akt, sondern fügt sich auch szenisch als Starpianist im Frack und mit Chopin-Frisur gut in das Geschehen ein.
Das Orchester unter der Leitung des jungen italienischen Dirigenten Lorenzo Passerini ebnet die disparaten Elemente der Partitur vom üppigen, puccinesken Sound über Gesellschaftstänze zu Beginn des zweiten Akts bis zu lichteren Klängen beim in der Schweiz spielenden Schlußakt nicht ein. Sehr klar und unsentimental wird das dargeboten, Verismo ohne Schluchzer und Schmalz. Daß aus den gelungenen Einzelteilen kein Ganzes wird, liegt weniger an den Musikern als am Komponisten, dessen Partitur sich zwar experimentierfreudig gibt, der es jedoch an einem unverwechselbaren eigenen Ton mangelt.

Insgesamt hat sich Frankfurt eine starke Inszenierung mit attraktiver Ausstattung ins Haus geholt und in allen Partien rollendeckend besetzt. Wenn in den Folgevorstellungen der angehende Startenor seine Lautstärke noch in den Griff bekommt, bietet sich allen Freunden saftiger italienischer Verismo-Opern die Gelegenheit, ein selten gespieltes Stück in einer geradezu musterhaften Produktion zu erleben.
Michael Demel / 6. April 2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
BIANCA E FALLIERO
Bericht von der Premiere am 20. Februar 2022
Trailer
Musikalische Kunstfertigkeit und dramaturgische Schwächen
Nicht jede Ausgrabung einer vergessenen Oper fördert ein Juwel zu Tage. Das gilt zumal für Werke eines ansonsten erfolgreichen Komponisten. Gerade bei Rossini ist Vorsicht geboten, wenn einem seiner Musiktheaterwerke schon beim zeitgenössischen Publikum kein nachhaltiger Erfolg beschieden war und mehrere Generationen von Kunstschaffenden nicht auf die Idee gekommen sind, es aus der Versenkung zu holen. So liegt der Fall bei Bianca e Falliero, einem Melodramma in zwei Akten, das am 26. Dezember 1819 an der Mailänder Scala aus der Taufe gehoben wurde und anschließend dem Vergessen anheimfiel. Es geht um die geplante Zwangsverheiratung der titelgebenden Bianca mit einem venizianischen Patrizier. Biancas Vater will sich mit der von ihm arrangierten Ehe finanziell sanieren. Bianca aber liebt den Kriegshelden Falliero. Das Paar will fliehen, wird zuvor aber vom Vater überrascht. Falliero rettet sich auf das Gelände der spanischen Botschaft. Das galt in Venedig seinerzeit als Hochverrat, der mit dem Tode bestraft wurde. Falliero wird der Prozeß gemacht. Unter seinen drei Richtern befinden sich ausgerechnet der rachsüchtige Vater und der verschmähte Bräutigam. Bianca platzt in den Prozeß und verwendet sich für ihren Geliebten. Der verschmähte Bräutigam hat ein weiches Herz, verzichtet auf Bianca und verhindert das Todesurteil für Falliero.

Theo Lebow (Contareno), Heather Phillips (Bianca; kniend), Beth Taylor (Falliero) und Kihwan Sim (Capellio)
Das ist keine Kurzfassung, das ist bereits alles. Mehr passiert nicht. Es ist ein holzschnittartiges Libretto mit dünner Handlung und schwacher Dramaturgie. Auch das bewährte Regiehandwerk von Tilmann Köhler und engagierte Schauspielleistungen vermögen das nicht zu ändern. Dabei hatte der Beginn höhere Erwartungen geweckt: Falliero kehrt als Kriegsheld nach Venedig zurück und wird in einem Staatsakt gefeiert. Die Regie läßt ihn bei seinem Auftritt straucheln und stürzen, zeigt ihn somit als schwachen Helden. Der Staatsakt wird sodann mit feinem Humor karikiert. Doch dieser Fokus auf die politische Überwölbung wird nicht weiter verfolgt. Auch das Versprechen einer ironischen Brechung der Handlung wird nicht eingelöst. Es bleibt in homöopathischer Dosierung lediglich im dezenten gestischen Humor des Opernstudiomitglieds Carlos Andrés Cárdenas präsent, der in gleich drei Rollen als Staatsdiener schlüpfen darf und neben seinen mimischen Qualitäten auch mit einem attraktiven lyrischen Tenor auf sich aufmerksam macht.
Es ist überhaupt das Beste, das man von Bühnenbild und Regie sagen kann, daß sie den Sängern die Gelegenheit bieten, ungestört ihre Vokalkunststückchen zu servieren, die das Wesen einer Rossini-Oper ausmachen. Karoly Risz hat ein Bühnenbild bauen lassen, welches aus zwei bühnendeckenhohen Halbrotunden aus hellem Holz besteht, die ineinander und gegeneinander verdreht werden können, mal einen Innenraum freigeben, oft aber eine gerundete Fassade zeigen, vor der die Protagonisten das machen können, was in der Regie eigentlich verpönt, akustisch aber höchst vorteilhaft ist, nämlich an der Rampe direkt ins Publikum zu singen.

Diese Oper hätte man über weite Strecken auch konzertant aufführen können. Die mitunter doch recht langen Arien, Duette und Ensembles werden häufig mit auf die Rotunden projizierten Videos visuell aufgehübscht, welche Nahaufnahmen des Gesichts von Bianca zeigen und kaum szenischen Mehrwert besitzen. Mal beschmiert sie sich in Zeitlupe mit Lippenstift das Gesicht, mal posiert sie mit einem Revolver, der sich als Schokoladenattrappe herausstellt, um dann wiederum in Zeitluppe verzehrt zu werden. Immerhin gelingt Tilmann Köhler eine hübsche Schlußpointe, in welcher Bianca zu einem unerwarteten Akt der Selbstbefreiung vom tyrannischen Vater und ichbezogenen Liebhaber zugleich schreitet und der dünnen Handlung nachträglich den Sinn einer emanzipatorischen Entwicklungsgeschichte aufpfropft.
Daß man trotz der dramaturgischen Schwächen und Ereignisarmut des Librettos, trotz zum Scheitern verurteilten Bemühungen der Regie um Sinnstiftung und szenische Belebung mit geschickter Personenführung den Besuch dieser Produktion nicht bereuen muß, liegt an der guten Besetzung. In den Titelrollen machen zwei junge Gastsängerinnen auf sich aufmerksam. Die Hosenrolle des Falliero bietet eine Wiederbegegnung mit der Mezzosopranistin Beth Taylor, welche noch von ihrem Auftritt in Händels Amadigi zum Saisonbeginn in bester Erinnerung geblieben ist. Wiederum erweist sich das geradezu maskuline Timbre ihrer Stimme mit satter Tiefe und kraftvoller Mittellage als ideal für eine Hosenrolle. In passendem Kontrast dazu präsentiert Heather Phillips als Bianca ihren glockenhellen Sopran und überzeugt in ihrem Europadebüt ebenso mit glasklar präsentierten Koloraturen wie mit einem intensiven Ton, der es ihr erlaubt, mit leichter, gar nicht großer Stimme die dargestellte Leidenschaft ihrer Figur musikalisch zu beglaubigen. Ensemblemitglied Theo Lebow erweist sich nach seinem fulminanten Jago in Rossinis Version des Otello erneut als Idealbesetzung für einen Tenor-Bösewicht. Den tyrannisch-durchtriebenen Brautvater Contareno durchlebt er mit seinem koloraturwendigen und höhensicheren Tenor. Die helle Stimme besitzt eine charakteristische herbe Färbung, der Lebow bei Bedarf noch eine genau dosierte Schärfe beimischen kann.

Bilderbuch-Bösewicht: Theo Lebow
Mit seinem balsamischen und doch belcanto-beweglichen Baßbariton zeichnet Kihwan Sim den verhinderten Bräutigam Capellio stimmlich derart attraktiv, daß man nicht nachvollziehen kann, warum Bianca ihn verschmäht. Mit seinen wenigen baßgesättigten Tönen fügt sich Božidar Smiljanić als Doge in eine ausgezeichnete Besetzung.
Das Orchester unter der Leitung von Giuliano Carabella präsentiert sich als aufmerksamer Begleiter, trifft agil und wendig den richtigen Rossini-Ton und darf in einigen Vorspielen zeigen, daß die Virtuosen nicht bloß auf der Bühne zu finden sind.
So ist das eben bei Rossini: Für die literarischen Qualitäten von Libretti und die Erfordernisse bühnenwirksamer Handlungen hatte er wenig Gespür. Der Drive seiner Crescendo-Walzen, die delikaten harmonischen Färbungen seiner Ensembles, über die auch Bianca e Falliero reichlich verfügt, entfalten sich unabhängig vom dramaturgischen Anlaß. Rossini verwendete mitunter ein- und dieselben musikalischen Mittel für gegensätzliche szenische Wendungen, tauschte und mischte Arien aus unterschiedlichen Opern untereinander. Das gibt seiner Musik bei aller Kunstfertigkeit und Raffinesse eine gewisse Beliebigkeit. Es ist bezeichnend, daß gerade jene Schlußarie Biancas, die beim Zuhörer ohrwurmhaft nachhallt, aus der Oper La donna del lago entnommen ist.
Michael Demel / 1. März 2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
WARTEN AUF HEUTE
Premiere am 16. Januar 2022
Trailer
Herausragende Teile fügen sich zum stimmigen Ganzen
Arnold Schönberg ist der große Säulenheilige in der musikalischen Moderne des vergangenen Jahrhunderts. Seine Bedeutung wird von der Musikwissenschaft vor allem wegen seiner theoretischen Grundlegung für eine nicht-tonale Musik und deren fruchtbringende Wirkung auf seine Schüler und Nachfolger als essenziell eingeschätzt. Im Repertoire haben sich allenfalls seine frühen spätromantischen Werke gehalten (Verklärte Nacht, Gurre-Lieder). Sein im von ihm erfundenen Zwölfton-System komponiertes Hauptwerk gilt als spröde, kompliziert und unzugänglich. Gelegentliche Aufführungen haben meist den Charakter einer intellektuellen Pflichtübung. Warum das so ist und wie man zumindest im Musiktheater das schwierige Material publikumswirksam aufbereiten kann, ist in der aktuellen Neuproduktion an der Oper Frankfurt im Detail zu studieren. Gegeben wird ein Pasticcio, welches mit dem Einakter Von heute auf morgen die allererste Zwölfton-Oper der Musikgeschichte aus dem Jahr 1930 (übrigens an der Oper Frankfurt uraufgeführt), das im selben Jahr herausgebrachte Orchesterstück Begleitmusik zu einer Lichtspielszene und das 1924 zur Uraufführung gebrachte, noch freitonale Monodram Erwartung miteinander verbindet. Dabei zeigt sich, daß es für den Hörer keinen Unterschied macht, ob die Tonfolgen nach einem strengen mathematischen System ausgetüftelt sind wie in den beiden Werken von 1930, oder ob sie wie in dem früher entstandenen Werk der freien Intuition des Komponisten folgen. Mit dem Verzicht auf eine an der tradierten Harmonielehre orientierten Tonfolge fehlt jedenfalls die Grundlage zur Bildung von Melodien oder wenigstens erinnerbaren Motiven. Dafür rücken andere musikalische Parameter in den Vordergrund, ganz besonders die Klangfarbe. Erwartung erweist sich dabei als hochexpressionistisches Stück, das in seinen Stimmungsschwankungen und Ausbrüchen unmittelbar an das gestische Repertoire der Spätromantik anknüpft. Von heute auf morgen kommt dagegen nüchterner, cooler daher, läßt hier und da im komplexen Orchestersatz jazzartige Anklänge aufblitzen. Diese musikalischen Grundhaltungen reagieren adäquat auf die Textvorlagen: In Erwartung nimmt man an einem inneren Monolog einer aufgewühlten und zwischen Stimmungsextremen schwankenden Frau teil, Von heute auf morgen ist ein komödiantisches Konversationsstück. Das vorzügliche Orchester unter der souveränen Leitung von Alexander Soddy präsentiert die komplexen Partituren deutlich in den Nuancen der Klangfarben und gut durchhörbar, erzeugt im Monodram eine nie nachlassende Spannung und verleiht dem Konversationsstück knackigen Drive. Auf dieser Basis entfalten sich Gesangsleistungen, die man sich jeweils idealer kaum wünschen könnte.

Szenen einer Ehe: Elisabeth Sutphen (Die Frau) und Sebastian Geyer (Der Mann)
Elisabeth Sutphen und Sebastian Geyer geben in Von heute auf morgen ein Ehepaar in der Krise und breiten mit großer Textverständlichkeit deren Wortgefechte aus. Es ist bewundernswert, wie selbstverständlich die in atonalen Intervallfolgen geführten Gesangspartien von den beiden bewältigt werden. Wenn man in die Partitur schaut, hält man es kaum für möglich, daß man das ohne absolutes Gehör überhaupt singen kann, da ja eine Orientierung an einem harmonischen Grundgerüst fehlt. Hier aber wirkt es so, als sei diese Art des Singens das Natürlichste von der Welt. Sebastian Geyer besticht mit gut fokussiertem, kernigem und angenehm timbriertem Bariton und zeigt eine seiner besten Leistungen der letzten Jahre. Elizabeth Sutphen weiß mit ihrem hellen Sopran zu gefallen, dem sie sowohl zickige Schärfe als auch divenhafte Strahlkraft abgewinnen kann. Die beiden präsentieren das Paradox eines atonalen Belcanto. Das gilt erst recht für Brian Michael Moore, der mit schlanker, aber saftiger Stimme das Klischee eines schmachtenden Tenors bedienen darf. Juanita Lascarro rundet das vorzügliche Quartett in der kleinen Rolle der Freundin mit fruchtigem Soprantimbre ab.

Camilla Nylund (Eine Frau)
Warum Camilla Nylund zu den weltweit gefragtesten Interpretinnen in lyrisch-dramatischen Partien von Wagner und Richard Strauss zählt, zeigt sie im Monodram Erwartung. Ihre volle, üppige Stimme ist zu dramatischen Exaltationen ohne Schärfe ebenso fähig wie zu zurückhaltenden Tönen im tragfähigen Piano. Gestalterisch zeigt sie sich auf dem Gipfelpunkt ihrer Möglichkeiten, ja überhaupt des Möglichen. Die von ihr gezeigte Vielfalt der Ausdrucksnuancen, ihr expressives Ausdeuten der Textvorlage dürfte kaum überbietbar sein. Das Publikum klebt an ihren Lippen und feiert sie beim Schlußapplaus.

Johannes Martin Kränzle (Jedermann)
Auf einer Stufe mit dieser außerordentlichen Leistung, im gleichen Rang des kaum Überbietbaren hatte zuvor Johannes Martin Kränzle die Zuhörer mit den Sechs Monologen aus „Jedermann“ gerührt und überwältigt. Diesen Liederzyklus von Frank Martin aus dem Jahr 1949 hat das Produktionsteam in den Schönberg-Abend hineingepflanzt. Die musikalischen Mittel wirken inmitten der komplex-ambitionierten atonalen Klanggebilde wie melancholische Rückblicke auf eine vergangene Musiktradition. Das von Schönberg zuvor in höchste Aufmerksamkeit versetzte Ohr hört nun aber auch genauer auf die Textur und die dunklen Farben einer Komposition, die mit vertrauten Mitteln die Seelenlage eines Mannes am Ende seines Lebens auslotet. Kränzle ist für diesen Zyklus der ideale Interpret, da er seit Jahren sowohl bei seinen Liederabenden als auch auf der Opernbühne brilliert. Selbst mit Wagner-Partien ist er nie über die Grenzen seines edel timbrierten Bariton-Materials hinausgegangen. So hat er sich eine in allen Registern intakte Stimme über die Jahre bewahrt, sonor, aber nicht wuchtig in der Tiefe, voll strömend, dabei angenehm schlank in der Mittellage und unangestrengt in der Höhe. In den Texten von Hugo von Hofmannthal gelingt es Kränzle, deren Bedeutungstiefe nachzuspüren, ohne in manieristische Posen zu verfallen. Der Vortrag ist von großer Natürlichkeit und verbindet doch nuancierte Textbehandlung mit genauer musikalischer Ausdeutung.

Die vier Bestandteile des Abends werden vom Produktionsteam mit einem übergeordneten Erzählbogen zu einem Ganzen zusammengefügt. Erzählt wird von der Krise einer Ehe, ihrem Erstarren in Routine, ihrem Scheitern und schließlich dem Ende der beiden getrennten Ehepartner in Vereinsamung. Dabei führt die Inszenierung das Geschehen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Es beginnt mit dem Einakter Von heute auf morgen, der vom Entstehungsjahr 1930 in die Aufschwungjahre nach dem Weltkrieg versetzt wird, führt mit der Begleitmusik zu einer Lichtspielszene das Ehepaar in stummem Schauspiel über mehrere Jahrzehnte bis zum Bruch, präsentiert dann den gealterten Ehemann, auf dessen Vereinsamung und Sterben die Jedermann-Monologe bezogen werden, und läßt schließlich die ebenfalls gealterte Ehefrau mit Erwartung zu ihm zurückkehren, wobei sie nach verzweifelter Suche schließlich seine Leiche entdeckt.

Daß diese Konstruktion nicht bemüht wirkt, sondern sich szenisch flüssig und plausibel entfalten kann, verdankt die Aufführung neben engagierten Schauspielleistungen in sämtlichen Teilen dem raffinierten Bühnenbild von Jo Schramm. Es zeigt ein lebensgroßes Puppenhaus mit Erdgeschoß und Dachgeschoß aus hellem Holz, zusammengesetzt aus Modulen, die auseinander, gegeneinander und ineinander verschoben werden können, wodurch sich immer neue Raumeindrücke ergeben. Diese sich stets wandelnden Räume erweisen sich als ideale Spielwiese für das von David Herrmann angeleitete intensive und durchaus komödiantisch-ironische Kammerspiel des ersten Teils, das allmählich ins Groteske und Surreale abgleitet, um schließlich etwas unvermittelt in einer absurden Zombie-Szene mit mildem Splattereffekt zu enden (eine abgerissene Hand bleibt im Fenster eingeklemmt). Die innere Bedrohung der Familienidylle durch einen Sänger, mit dem die Ehefrau flirtet, und eine Freundin, auf die der Ehemann ein Auge geworfen hat, wird hier ein wenig plakativ als äußere Bedrohung durch monsterhafte Untote visualisiert.

Ehehorror als Zombie-Apokalypse: Elisabeth Sutphen und Sebastian Geyer stemmen sich gegen Brian Michael Moore (Der Sänger) und Juanita Lascarro (Die Freundin)
In der Lichtspielszene kommt die nackte Außenfassade des Holzhauses dann durch geschickte Videoprojektionen zu einer realistischen Anmutung mit gemauerter Basis, Holzlamellenverkleidung und gedecktem Dach. Der triste Alltag des Paares nach der Bedrohung von außen ist zurückgekehrt. Durch wandernde Schattenwürfe von Bäumen auf der Hauswand werden Tagesläufe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang simuliert. Die immer gleichen Abläufe der Kleinfamilie lassen Jahre trist verstreichen: Er verlässt mit Sohn und Aktentasche morgens das Haus, sie folgt etwas später, kehrt mit Einkaufstüten zurück und empfängt Sohn und Gatten am Ende des Arbeitstags. Hausfassade und Dach verwittern allmählich, die Kostüme wandeln sich, verorten das Geschehen zunächst in den 60ern, dann den 70ern und geleiten die Familie allmählich bis zur Gegenwart. Schließlich sieht man durch die Fenster des Hauses einen Ehestreit. Sie erscheint danach mit gepacktem Koffer und verlässt Mann und Kind (das erstaunlicherweise nicht gealtert ist). Damit endet die erste Hälfte des Abends.

Beim Betreten des Zuschauerraums nach der Pause ist der Mann bereits auf der Bühne, gealtert, mit schlecht sitzender Hose und schief geknöpfter Strickjacke als leicht verwahrloster Rentner kostümiert, und schlurft unentschlossen im leeren Innenraum des Hauses herum. Im Wohnzimmer türmen sich die leeren Styroporschachteln der täglich vom Pflegedienst vorbeigebrachten Mahlzeiten. Der Mann blickt auf sein Leben zurück, reflektiert seine Einsamkeit, kämpft mit seiner Todesangst und stirbt schließlich. Die Worte von Hofmannthals Jedermann fügen sich erstaunlich gut in diesen neuen Zusammenhang. Schließlich erscheint die gealterte Ehefrau (Erwartung). Unruhig streift sie um das Haus, schwelgt in Erinnerungen, gibt sich schwankenden Gefühlen hin, betritt endlich das Haus und findet dort den toten Mann.

Jeder der drei Hauptteile (die Musik zur Lichtspielszene untermalt lediglich eine kurze Transformation) könnte in seiner musikalischen und szenischen Qualität gut für sich alleine stehen. Des verbindenden Rahmens hätte es nicht bedurft. Gleichwohl erweist er sich als tragfähiges Konstrukt. Insgesamt bietet die Neuproduktion ein außerordentlich dichtes, abwechslungsreiches und fesselndes Musiktheatererlebnis mit einer ausgezeichneten Ensembleleistung in der ersten Hälfte und der Präsentation zweier Ausnahmekünstler auf dem Gipfel ihres Könnens in der zweiten Hälfte.
Man möchte jedem Opernliebhaber einen Besuch dieser Produktion dringend empfehlen, allein: bei sämtlichen Folgevorstellungen ist die Zahl der erlaubten Zuschauer nach den geltenden hessischen Corona-Regeln auf 250 reduziert. Rund 1.100 Plätze müssen pro Aufführung also unbesetzt bleiben. Die Oper Frankfurt hat bereits sämtliche Abonnentenplätze storniert und vergibt sie im Windhundverfahren neu. Freie Karten wird es daneben nicht geben. Es ist eine Schande.
Michael Demel / 18.01.2022
© der Bilder: Barbara Aumüller
Nikolai Rimsky-Korsakow:
DIE NACHT VOR WEIHNACHTEN
Vorstellung am 17. Dezember 2021 (Premiere am 5. Dezember 2021)
Trailer
Ein traumhaft schönes Gesamtkunstwerk

Ein großes Weihnachtsgeschenk hat die Oper Frankfurt mit ihrer jüngsten Neuproduktion dem Publikum gemacht. Genauer gesagt: Der Regisseur Christof Loy hat es der Oper Frankfurt und ihrem Publikum gemacht. Ihm ist es zu verdanken, daß von den ohnehin nicht sonderlich bekannten Opern Rimsky-Korsakows nun ausgerechnet eine der unbekanntesten mit dem eigenartigen Titel Die Nacht vor Weihnachten in den Spielplan aufgenommen wurde.
Loy hatte, wie er in dem wie immer gut gemachten und informativen Produktionsvideo erzählt, eine Schallplattenaufnahme dieser musikalischen Rarität entdeckt und Feuer gefangen. Es ist ihm gelungen, den Frankfurter Generalmusikdirektor Sebastian Weigle anzustecken, der für seine besondere Affinität zu russischer Musik bekannt ist. Und so ist eine Produktion entstanden, die das Publikum bezaubert, erheitert, beeindruckt, bewegt und am Ende restlos begeistert zurückläßt: Bezaubert von der traumhaft schönen Musik, die Weigle mit seinem Orchester zur vollen Entfaltung bringt, erheitert von den lustvoll ausgespielten komödiantischen Szenen, beeindruckt von dem Einsatz schwindelerregender Akrobatik und bewegt von der Poesie der Ballettszenen.

Ja, es gibt tatsächlich klassisches Ballett mit Spitzentanz und Tutu! Die phantasievolle Choreographie von Klevis Elmazaj wirkt dabei zu keinem Zeitpunkt altbacken, hat es aber auch nicht nötig, sich in ihren klassischen Elementen ironisch zu geben, sondern fügt sich organisch in die Inszenierung ein.
Das Stück nach einer Erzählung von Nikolai Gogol verwebt Märchen und Mythen der ukrainischen Folklore mit komödiantischen Szenen und überwölbt dies mit einer Liebesgeschichte. Der Schmied Wakula begehrt die schöne Oksana. Die erweist sich als kapriziös und stellt dem Verehrer die Aufgabe, ihr die Schuhe der Zarin als Brautgeschenk zu bringen. Das gelingt ihm schließlich mit Hilfe des Teufels, der ihn durch die Lüfte zum Zarenhof fliegen läßt. Zuvor hatte der Teufel Wakulas Mutter Solocha, einer attraktiven Hexe, die Liebschaften zur gesamten männlichen Dorfprominenz unterhält, vergeblich dabei Hilfe geleistet, die Verbindung des jungen Paares zu vereiteln. Mond und Sterne hatten die beiden dazu bei einem Himmelsritt geraubt, das Dorf so in Finsternis getaucht und obendrein einen Schneesturm entfesselt.
Diese märchenhaft verworrene Geschichte wird noch mit Elementen eines heidnischen Mythos zur Wintersonnenwende angereichert, in welchem böse Geister sich einen Kampf mit den Frühlingsgottheiten liefern.
Läßt sich so etwas überhaupt inszenieren? Und wie! Christof Loy hat dabei auf Deutungen, Metaebenen oder Aktualisierungen verzichtet, läßt das Stück für sich sprechen und bringt es zum Leuchten. Er präsentiert pralle Tableaus und poetische Bilder. Dabei darf er mit seinen Ausstattern aus dem Vollen schöpfen. Johannes Leiacker hat ein Einheitsbühnenbild entworfen, welches sich als ideale Spielwiese für den funkensprühenden Einfallsreichtum der Regie erweist. Auf einem transparenten Zwischenvorhang wird ein nächtlicher Sternenhimmel mit kosmischer Weiterung gezeigt.

Der raffiniert schlichte Bühnenkasten erweist sich als dessen Negativ: auf hellem Grund funkeln schwarze Sterne. Je nach Bedarf wird dieser hohe und helle Raum mit wenigen Requisiten ausgestattet. Die Kostüme von Ursula Rezenbrink zitieren dezent ukrainische Tracht, in der Szene am Zarenhof zeigen sie prächtige Barock-Ballkleidung. Der Clou der Inszenierung ist neben den Ballettelementen der Einsatz von Flugakrobatik. Gleich zu Beginn reiten Hexe und Teufel vom rauchenden Kamin eines Daches aus in den Himmel. Der Flug des Schmieds zum Zarenhof durch die Lüfte vollzieht sich ebenfalls vor den staunenden Augen des Publikums, und auch das Treiben der heidnischen Geister und Gottheiten spielt sich in schwindelerregender Höhe ab. Schon für die bravouröse Flugchoreographie von Tänzern und Sängern an dünnen Drahtseilen (Stuntkoordination von Ran Arthur Braun) lohnt sich ein Besuch der Aufführung.

Die restlos überzeugende Besetzung präsentiert russische Gastsänger in den tragenden Partien und schöpft für die vielen kleinen Charakterrollen aus dem üppigen Reservoir des hauseigenen Ensembles. Mit attraktivem Spinto-Tenor gibt Georgy Vasiliev den Wakula. Julia Muzychenkos Sopran erweist sich durch seine Verbindung eines klaren, mitunter mädchenhaften Tones mit staunenswerten Kraftreserven als Idealbesetzung für die Oksana. Mit dunkel abgetöntem, üppigem Mezzo gibt Enkelejda Shkoza die Solocha als reife, aber immer noch verführerische Frau. Alexey Tikhomirov verfügt als Oksanas Vater Tschub über einen saftigen, sonoren, „echt russischen“ Baß. Andrei Popov ist mit seinem hellen Charaktertenor eine treffliche Besetzung für den Teufel. Die Frankfurter Stammbesatzung muß sich dahinter nicht verstecken. Anthony Robin Schneider (Panas) und Thomas Faulkner (Pazjuk) zeigen, daß auch sie über profundes Baßmaterial verfügen, das in russischen Partien prächtig zur Geltung kommt. Peter Marsh stellt seine charakteristisch helle Stimme in den Dienst der scharf umrissenen Karikatur eines bigotten Geistlichen. Sebastian Geyer gefällt mit seinem Kavaliersbariton in der Partie des Bürgermeisters. Bianca Andrew schließlich verleiht mit ihrem edel timbrierten Mezzo der Zarin Anmut und Noblesse. Der von Tilman Michael vorbereitete Chor überzeugt mit einem dichten und warmen Klangbild.

Das Publikum zeigt sich hingerissen von diesem erfrischenden, herzerwärmenden Gesamtkunstwerk aus Musik, Spiel, Tanz und Akrobatik. Dieses unverhoffte Weihnachtswunder hat das Zeug zum Repertoireliebling. Wegen der pandemiebedingten Reduzierung der Zuschauerplätze sind bereits sämtliche Folgevorstellungen ausverkauft. Die Oper Frankfurt bemüht sich darum, Zusatzvorstellungen zu organisieren. Es ist dem Frankfurter Publikum zu wünschen, daß diese Produktion trotz ihrer enormen Anforderungen an die Sängerbesetzung und den großen technischen Aufwand von Choreographie und Akrobatik einen festen Platz in den Dezemberspielplänen der kommenden Jahre erhält.
Michael Demel / 20.12.2021
© der Bilder: Monika Rittershaus
MASKERADE
Premiere am 31. Oktober 2021
Reim dich, oder ich freß dich!
Auf ihren Streifzügen am Rande des gängigen Repertoires hat die Oper Frankfurt nun ein Werk ausgegraben, das immerhin in Dänemark den Status einer Nationaloper genießt: Maskerade von Carl Nielsen. Der Stolz des kleinen Nordvolkes auf das außerhalb der Landesgrenzen völlig unbekannte Stück ist so groß, daß die Frankfurter Produktion finanziell vom Dänischen Kultusministerium und der Königlichen Dänischen Botschaft unterstützt wird. Mit Prinzessin Benedikte, der jüngeren Schwester der dänischen Königin, konnte man sogar ein Mitglied des dänischen Königshauses zur Premiere begrüßen.
Der Text basiert auf einer Komödie des bedeutenden nordischen Dichters Ludvig Holberg von 1724. Ein junger Mann verliebt sich auf einem Maskenball in eine unbekannte Schöne. Sein Vater jedoch hat ihn bereits der Tochter eines Geschäftspartners versprochen. Einen neuerlichen Besuch auf einem Maskenball will er verhindern. Der Sohn schleicht sich trotz Ausgehverbots samt Diener aus dem Haus. Auf einem Ball finden sich neben ihm seine verkleidete Mutter, der ihm nachgeeilten Vater samt dessen Diener und die unbekannte Schöne ein, welche sich am Ende als die ohnehin für ihn vorgesehene Verlobte entpuppt.
Die Musik dazu imitiert zwar anders als Edvard Grieg in seiner beliebten Suite nicht den Stil Aus Holbergs Zeit, also des Barock, weist aber reichlich Referenzen aus der europäischen Musikgeschichte von Mozarts Singspielen bis zu Wagners Meistersingern auf. Reichlich verwendete Tanzmuster erinnern sowohl an die Operette vom Pariser Typ à la Offenbach als auch an das Wienerische Pendant à la Strauß. Ihre spezifische Färbung bezieht die Partitur aus ungewohnten Harmonierückungen. Der Text wird immer wieder lautmalerisch kommentiert. Im Gegensatz zum Zeitgenossen Richard Strauss meidet Nielsen aber Drastik und Überdeutlichkeit. Auch in den nicht wenigen musikalischen Pointen behält die Komposition einen volkstümlichen Grundton bei. Es ist eine gut konsumierbare, auch beim ersten Hören unmittelbar verständliche und eingängige Musik. Titus Engel arbeitet ihre Vorzüge mit dem glänzend disponierten Orchester plastisch heraus. Der Klang ist farbig und dabei gut durchhörbar. Die stark geforderten Bläser dürfen sich profilieren. Berückend schön etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, gelingt im Vorspiel zum zweiten Akt das Hornsolo, samtig weich und geradezu verträumt. Der dritte Aufzug mit seinen ausgedehnten Tänzen und Balletteinlagen gibt dem Orchester die Gelegenheit, für die Qualitäten des Komponisten zu werben, so daß man Lust verspürt, im eigenen Plattenschrank den Sinfoniker Nielsen wiederzuentdecken.
Glücklich war die Entscheidung des Produktionsteams, die Ballettsequenzen professionellen Tänzern anzuvertrauen. Kinsun Chan hat dafür flüssige und unprätentiöse Choreographien entworfen.

Susan Bullock (Magdelone) und Tänzer
Weniger glücklich ist man mit der Haltung des Regisseurs, trotz einer von Tanzrhythmen durchwebten Partitur außerhalb der dezidierten Ballettszenen auf eine stärkere Fassung der Bewegungsabläufe zu verzichten. Im wie immer lesenswerten Begleitheft erläutert Tobias Kratzer dies so: „Die Inszenierung ist dabei aber nicht durchgehend formal durchchoreographiert. Das führt bei Komödien manchmal zu einer Überbetonung der puren Mechanik, die mich nicht so interessiert.“ Damit setzt Kratzer einen Kontrapunkt zu R. B. Schlather, dessen präzise kalkulierten Bewegungsabläufe in der vorangegangenen Premiere Cimarosas L‘taliana in Londra zum spritzig-intelligenten Vergnügen gemacht haben (Kritik siehe unten). Im direkten Vergleich gewinnt man den Eindruck, daß Kratzer regelrecht vor dem Stück kapituliert hat. Aus dem trostlos grauen Bühnenbild von Rainer Sellmaier vermag er kaum Funken zu schlagen. Auch die Entscheidung des Produktionsteams, die Protagonisten (wieder einmal) in aktuelle Straßenkleidung (mitunter auch bloß Unterwäsche) statt in historisierende Kostüme zu stecken, verstärkt den Eindruck szenischer Beliebigkeit. Zu sehen sind oft Allerweltsgesten von Darstellern in Allerweltskleidung. Mitunter erschöpfen sich die Regieideen im Standardrepertoire von Boulevardkomödien: Tür auf, Tür zu, einer rein, einer raus. Wenn im abschließenden dritten Aufzug dann der Maskenball anhebt, besteht die Kostümierung im banalen Geschlechtertausch. Und wo außerhalb der Balletteinsätze von Profitänzern nun Choristen und Solisten tanzen sollen, knäulen sie sich auf einer Tanzfläche und vollführen bemühtes Discogehopse.

Dorfdisco in Kopenhagen statt Maskerade
Falls der Regisseur zu dem Stück etwas zu sagen hat, kann er es gut verstecken. Es scheint vielmehr so, daß Kratzer aus nackter Inszenierungsnot eine Tugend zu machen versucht, eine bei ihm ungewohnte Einfallslosigkeit geradezu ostentativ herausstellt, das aber mit Chuzpe und Konsequenz. Sehr genau hat er immerhin erkannt, daß das Stück im dänischen Original seine Komik gänzlich aus dem Wortwitz des Librettos bezieht. Die Musik ist damit minutiös verwoben. Einem des Dänischen nicht mächtigen Publikum ist das nur durch eine gute Übersetzung zu vermitteln. Da es sich aber über weite Strecken um ein Konversationsstück handelt, wären die Zuschauer ganz damit beschäftigt, die Übersetzung auf der Übertitelanlage mitzulesen. Das Bühnengeschehen wäre völlig an den Rand gedrängt. Kratzer aber, und das kann dann doch als kleiner Inszenierungscoup bezeichnet werden, stellt die Übertitelanlage wie einen längs gekippten Monolithen in das Zentrum der Bühne, wo man nun sehr bequem den in großen Lettern und angenehmer Schrift ablaufenden Text mitlesen kann, auf daß einem keine Pointe entgehe. Mal schwebt der Monolith über den Darstellern, mal wird er zum Bühnenboden herabgesenkt. Szenische Aktionen werden darum herum arrangiert. Trotz der physischen Präsenz des Textes läßt Kratzer das Stück zusätzlich in deutscher Sprache singen. Dazu hat er das Libretto eigens für diese Produktion von Martin G. Berger ins Deutsche übersetzen und aktualisieren lassen. Das scheint im Hinblick auf Duktus und Prosodie gelungen zu sein. Die größere Herausforderung für den Übersetzer war es jedoch, adäquate Endreime und Entsprechungen für die zahlreichen Wortspiele des Originals zu finden. Da ist mitunter die Lust am Kalauer mit Martin Berger durchgegangen, was ihm beim Schlußapplaus – angemessenerweise darf er sich nach dem Produktionsteam zeigen – einige saftige Buhrufe einbringt. Nach dem Motto „Reim dich, oder ich freß dich!“ gibt es reichlich Schenkelklopfer und einige Zoten – je länger der Abend dauert, desto mehr. Und so ersetzen die sich in den Vordergrund drängenden Schrifteinblendungen nicht selten das, was an Inszenierungsideen fehlt. Sogar Regieanweisungen und Beschreibungen der Szenerie aus dem Libretto werden eingeblendet. Der nackte Text muß leisten, was der Bühnenbildner verweigert.

Routinierte Personenregie wird immer da überboten, wo einer der Protagonisten mit seinem schauspielerischen Talent wuchert. Das gilt besonders für Alfred Reiter als reaktionärer Vater Jeronimus, der sich in der Welt der jungen Leute nicht zurechtfindet. Die Partie kommt ihm auch stimmlich entgegen, da sie nicht zu hoch liegt und ihm im bequemen Ambitus erlaubt, seine Fähigkeit zur prononcierten Textgestaltung mit knorrigem Baß vorteilhaft herauszustellen. Für eine der wenigen Arien des Stücks, mehr ein Lied im Volkston, bekommt er sogar Szenenapplaus. Als seine unbefriedigte Ehefrau Magdelone weiß Susan Bullock zu überzeugen. Jahrzehntelang hat sie ihre hell timbrierte und eher schlanke Stimme mit hochdramatischen Partien von Elektra bis Brünnhilde verschlissen. Nun überrascht sie angenehm mit einem geschmackvollen Einsatz ihres immer noch gut ansprechenden Materials. Mit quecksilbrigem Parlando beglaubigt sie, daß in der reifen Ehefrau noch Feuer und Abenteuerlust lodern. Im Zentrum steht aber Liviu Holender als Hendrik, eine komödientypische Dienerfigur von der Art des gewitzten Strippenziehers à la Figaro. Sein kerniger Bariton erweist sich als biegsam und wandlungsfähig. Ideal ergänzt wird er von Samuel Levine als zweiter Dienerfigur Arv, der mit jugendlich-frischem Tenor zu gefallen weiß.

Liviu Holender (Henrik) und Samuel Levine (Arv)
Michael Porter macht seine Sache als Jeronimus‘ aufsässiger Sohn Leander ordentlich. Monika Buczkowska als seine Geliebte Leonora überstrahlt ihn mit beinahe zu üppigem Sopran. Saftig-kernig gibt Bozidar Smiljanic den Nachtwächter, der sich aus Richard Wagners Nürnberg nach Kopenhagen verlaufen zu haben scheint. Auch die übrigen kleineren Partien sind wie üblich aus dem vorzüglichen Ensemble rollendeckend besetzt. Der von Tilman Michael vorbereitete Chor fügt sich stimmmächtig und gut gelaunt ein.
Musikalisch ist die Produktion geglückt. Die szenische Umsetzung erlaubt immerhin ein Kennenlernen des weithin unbekannten Werkes. Mehr aber auch nicht.
Michael Demel, 2. November 2021
© der Bilder: Monika Rittershaus
L’ITALIANA IN LONDRA
Bericht von der Premiere am 26. September 2021
Trailer
Scherz, Satire, Ironie und (keine) tiefere Bedeutung
Der jubelnde und von Bravi gesäumte Schlußapplaus zeigt, daß die Oper Frankfurt mit der ersten Premiere der Saison am Großen Haus beim Publikum einen Nerv getroffen hat. Die Neuproduktion bietet seinen in kargen Pandemiezeiten kulturell ausgehungerten Zuschauern l‘art pour l’art: Exzellente Sängerleistungen, einen fabelhaft-duftigen Orchesterklang und eine spritzige Regie. Der Anlaß dazu ist in Domenico Cimarosas „Intermezzo in musica“ aus dem Jahr 1778 so banal, daß eine Wiedergabe der spärlichen Handlung sich kaum lohnt. Fünf Menschen befinden sich in einem Hotel. Zwei Frauen sind Gegenstand der Begierde dreier Männer. Am Ende bilden sich zwei Paare. Einer geht leer aus. Das soll komisch sein? Ist es. Zum einen, weil das Libretto in seinen Protagonisten bestimmte Nationalcharaktere karikiert (steifer Engländer hier, feuriger Italiener da), zum anderen weil die witzigen Dialoge auch 250 Jahre nach ihrer Entstehung nicht wesentlich gealtert sind und mit jeder Boulevardkomödie konkurrieren können. Das Produktionsteam um Regisseur R. B. Schlather nimmt die Vorlage zum Anlaß, um ein Feuerwerk des Humors abzubrennen, mal übermütig, mal hintersinnig. Von einer „Inszenierung“ zu sprechen, wäre eine Untertreibung: Die schauspielerisch ungemein geforderten Protagonisten bewegen sich vielmehr in einer genauestens kalkulierten Choreographie über die Bühne. Slapstick und Ironie werden in der exakt richtigen Dosis und mit perfektem Timing serviert. Dankenswerterweise hat die Regie darauf verzichtet, dem bunten Treiben auf der Bühne mit wohlfeilen Aktualisierungen oder gar Politisierungen eine inadäquate Gedankenschwere mühlsteingleich um den Hals zu legen. Zwar wird das Setting mit moderner Hotelrezeption und Telephonzelle zeitlich irgendwo in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verortet (als es noch Münzfernsprecher gab). Der das Bühnenbild dominierende gewaltige Rundturm mit fachwerkartigen Aufmalungen in schwarz-weiß (entworfen von Paul Steinberg) bleibt aber bewußt abstrakt und erlaubt es einer klaren Lichtregie (Joachim Klein), den Fokus ganz auf die Darsteller zu richten. Hier gilt‘s der Kunst. Dabei ist die Kunst, das Allerleichteste auf die Bühne zu bringen, zugleich das Allerschwerste. Selten glückt es so wie hier.


Angela Vallone (Livia; unten) und Bianca Tognocchi (Madama Brillante; oben)
In traumwandlerischer Selbstverständlichkeit gelingt auch die Abstimmung mit dem Orchestergraben. Geboten wird eine durch und durch musikalische Inszenierung, die sich in szenisch hellwacher Musik spiegelt. Hierfür sorgt Leo Hussain, der das bestens disponierte Orchester leitet und zugleich gewitzt am Hammerflügel die Rezitative belebt. Man bekommt einen guten Eindruck davon, warum Mozart und Haydn die Musik ihres Zeitgenossen Cimarosa schätzten und selbst aufführten, warum sich Goethe für sie begeisterte und Rossini es als größtes Lob empfand, als Nachfolger des neapolitanischen Komponisten gehandelt zu werden. Farbig und abwechslungsreich spielt die Partitur mit Phrasen und Formen, die dem Operngänger von Mozart vertraut sind, um dann doch immer wieder mit überraschenden Wendungen und originellen Begleitfiguren zu verblüffen. Für die Streicher des Frankfurter Opernorchesters ist historisch informiertes Spiel mit sparsam dosiertem Vibrato und sprechender Phrasierung schon lange eine Selbstverständlichkeit. Hier gelingt es ihnen, den Klang dabei angenehm rund zu halten. Die Oboen blühen auf, die Hörner setzen klare Akzente.

v.l.n.r. Iurii Samoilov (Milord Arespingh), Gordon Bintner (Don Polidoro) und Theo Lebow (Sumers)
Bei den Sängern weiß man nicht, ob man sie mehr für ihre Gesangsleistungen oder für ihre schauspielerischen Qualitäten bewundern soll. Das beginnt mit Iurii Samoilov, der als steifer englischer Aristokrat mit Melone und weißen Handschuhen eine sehenswerte Show abliefert und die Partie durch seinen samtigen Bariton mit saftiger Höhenlage adelt. Als sein Gegenspieler um die Gunst der angebeteten Livia steht ihm Gordon Bintner mit seinem etwas kernigeren, aber nicht minder saftigen Bariton in nichts nach. Darstellerisch darf er als Klischee-Italiener Don Polidoro mit offenem Hemd und über dem Brusthaartoupet baumelnden Goldkettchen dem Affen Zucker geben.

Allein für dieses Duell der Baritone lohnte sich bereits ein Besuch der Produktion. Aber auch Theo Lebow als verschmähter holländischer Kaufmann Sumers zeigt eine unbändige Spiellust und ergänzt das Männerduo ideal. Seinen hellen und charakteristisch gefärbten Tenor bringt er pointiert zur Geltung und läßt es sich nicht entgehen, in exponierten Spitzentönen zu demonstrieren, daß sein Potential weit über das eines Spieltenors hinausgeht. Fabelhaft besetzt sind auch die weiblichen Rollen. Gleich zu Beginn präsentiert sich Bianca Tognocchi mit quirlig-silbrigem Sopran, der die Soubretten-Partie der Madama Brillante funkeln läßt. In passendem Kontrast dazu steht der ebenfalls schlanke, aber lyrischere Sopran von Angela Vallone in der Rolle der Livia. In der spektakulär inszenierten Auftrittsarie läßt die Regie sie in einen überdimensionalen Union-Jack gehüllt gleichsam hereinschweben. Schon die ersten Töne offenbaren eine wunderbar klare und edel timbrierte Stimme, die im Laufe des Abends keine Ermüdungserscheinungen zeigt. Auf ihre Micaëla in der Wiederaufnahmeserie der Carmen darf man sich freuen.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß dieses heitere Sängerfest allein mit Mitgliedern des Stammensembles veranstaltet wird. Bintner und Samoilov haben dabei längst eine internationale Karriere begonnen. Zuletzt gab es Hinweise darauf, daß sie das Ensemble für eine freie Tätigkeit verlassen könnten. Hier hat gewiß die Corona-Pandemie vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für das Frankfurter Publikum bietet sich so die Möglichkeit, diese beiden Pracht-Baritone noch ein wenig länger am Stammhaus erleben zu können.
Michael Demel, 28. September 2021
Bilder: Monika Rittershaus
DIALOGUES DES CARMÉLITES
Bericht von der Vorstellung am 8. Juli 2021 (Premiere am 4. Juli 2021)
Starke Frauen brauchen keine Treppen
Es ist ein Abend der starken Frauen, mit dem sich die Oper Frankfurt in die Sommerpause verabschiedet hat. Starke Frauen auf der Bühne sind bei Poulencs Dialogen der Karmelitinnen gleichsam werkimmanent. Die Frankfurter Erstaufführung dieses Klassikers der Opernmoderne bietet zusätzlich noch eine starke Frau im Orchestergraben auf. Die junge litauische Dirigentin Giedrė Šlekytė gibt ihr Hausdebüt und überzeugt mit einem unsentimentalen, klar disponierenden Dirigat. Der Frankfurter Studienleiter Takeshi Moriuchi hat ihr eine corona-gerechte Kammerorchester-Fassung erstellt, welche die raffinierten Klangfarbenmischungen Poulencs erhält und die Partitur entschlackt, ohne ihre Substanz zu mindern. Diese handwerklich vorzügliche Vorlage nutzt die Dirigentin, um mit dem gut disponierten Orchester einen transparenten Klang und fast durchgehend einen geradezu strawinskyhaften rhythmischen Drive zu erzeugen, welche der Komposition gut zu Gesicht stehen.

Unter den starken Frauen auf der Bühne möchte man keine hervorheben, so überzeugend und so individuell gelingen die Rollenporträts. Die wunderbare Maria Bengtsson kann in der Hauptpartie der Blanche die Vorzüge ihrer nobel timbrierten Stimme mit ihrer Fähigkeit zur psychologischen Durchdringung auf das Glücklichste verbinden. Erneut zeigt sich die Qualität des Frankfurter Stammensembles, denn die Hausbesetzungen in anderen wichtigen Rollen können sich spielend neben diesem international gefragten Opernstar behaupten. Zu erwarten war dies bei der schon seit einigen Jahren neben ihren Frankfurter Verpflichtungen an vielen großen Häusern geschätzten Claudia Mahnke. Sie gibt der Mère Marie strenge Würde und vermag der Figur mit ihrem im Kern glutvollen, hier aber gebändigten Mezzo berührende Menschlichkeit zu verleihen. Auf ihrem Weg in neue Rollenfächer überzeugt Ambur Braid als Madame Lidoine. Zum Frankfurter Ensemble ist sie 2017 als Koloratursopranistin gestoßen. Mit der Besetzung als Salome vor einem Jahr war Intendant Bernd Loebe noch ein Wagnis eingegangen. Ihr glänzender Erfolg in dieser oft hochdramatischen Sopranen vorbehaltenen Partie hat ihr neue Perspektiven eröffnet. Hier nun zeigt sie jugendlich-dramatische Anlagen. Ihre Stimme klingt im Vergleich zur glockenhellen Bengtsson herber timbriert. Im September steht die Norma an. Das kann was werden!

Ein Phänomen ist Elena Zilio als Alte Priorin. Nach unseren Recherchen wurde die Sängerin im Jahr 1941 (!) geboren und debütierte im Jahr 1963. Optisch ist die zierliche alte Dame mit ihrer enormen Bühnenpräsenz ohnehin eine Idealbesetzung für diese Rolle. Unglaublich ist aber, über welch wunderbar klare, starke Stimme sie verfügt. Man ist es gewohnt, bei in Würde gealterten Sängerinnen und Sängern respektvoll auch die Alterung der Stimmmuskulatur bei der Bewertung ihrer Leistungen einzupreisen, Verschleißerscheinungen und technische Einschränkungen als Mittel zur Beglaubigung des dargestellten Charakters zu akzeptieren. Bei der Zilio muß man derartige Kompromisse nicht eingehen. Da gibt es keine Brüchigkeit, keine hörbaren technischen Einschränkungen, keine schrille Höhe oder dünne Tiefe.
So präsentiert sich ein Quartett von vorzüglichen Protagonistinnen mit sich individuell reizvoll voneinander unterscheidenden und exakt zum jeweiligen Rollencharakter passenden Stimmfarben. Daneben treten die wenigen und nicht übermäßig umfangreichen Männerrollen naturgemäß in den Hintergrund. Der in Frankfurt als Gast bewährte Bariton Davide Damiani und das junge Ensemblemitglied Jonathan Abernathy mit frischem Tenor sind gleich in mehreren dieser kleinen Partien zu erleben und runden das Bild einer ausgezeichneten Besetzung ab.
Die Inszenierung ist typisch für Claus Guth, sieht aber auf den ersten Blick gar nicht wie eine Guth-Inszenierung aus. Das liegt vor allem daran, daß das Bühnenbild dieses Mal nicht wie in den zahlreichen vorangegangenen Guth-Arbeiten für Frankfurt (angefangen beim Maskenball über Trittico, Daphne, Pelléas, Rosenkavalier, Rodelinda bis zur Lustigen Witwe) von Christian Schmidt gestaltet wurde, sondern von Martina Segna. Auffälligster Unterschied: die Schmidt-typische Treppe fehlt. Und es fehlen die hohen, hellen Räume. Stattdessen wird die Bühne in den Schlüsselszenen von einem dunklen Kubus bestimmt, dessen Formelemente immer wieder variiert werden. Wo Schmidts Räume historisch verortbar sind, setzt Segna auf zeitlose Abstraktion.
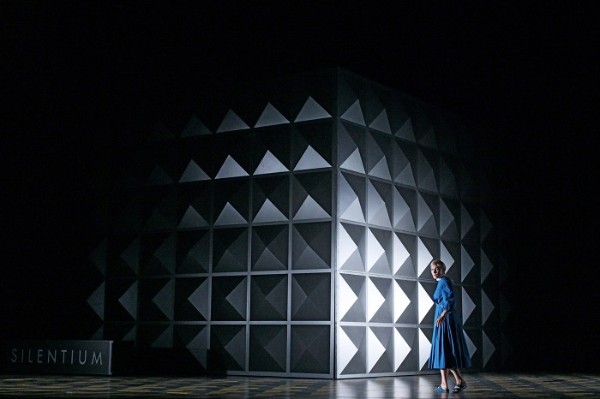
Nichts lenkt also von den Darstellerinnen ab, die Guth in gewohnt ausgefeilter Personenführung psychologisch profiliert. Daß der Regisseur mit Poulencs in ungebrochen gläubigem Katholizismus dargestelltem Martyrium von Klosterfrauen, bei dem die vermeintlich fortschrittlichen Revolutionäre als totalitäre Finsterlinge gezeichnet werden, wenig würde anfangen können, war zu erwarten. Spürbar erleichtert hat Guth daher die zu Beginn erzählte Geschichte von der bei der Geburt der Blanche verstorbenen Mutter aufgenommen, läßt die Verstorbene Guth-typisch als stumme Rolle durch diverse Szenen geistern und deutet das reale Martyrium als „psychotische Zuspitzung der Lebenssituation“ einer von Ängsten zerfressenen Frau. Die in die Partitur einkomponierten Schläge der Guillotine, die im Originaltextbuch unerbittlich die Klostergemeinschaft mit jakobinischer Brutalität immer weiter dezimieren, bis keine Nonne mehr übrig ist, deutet er als „Schicksalsschläge“, durch welche „Dinge“ von der Protagonistin abfallen. Man mag diese Psychologisierung schätzen oder nicht: zu dieser finalen Exekutionsszene ist dem Regisseur ein sehr schlüssiges Bild eingefallen, das sich wie wenige Bilder sonst dieser schnörkellosen Inszenierung einprägt. Wie so oft bei Guth wird eine Figur vervielfacht. Hier führen Doubles der Blanche einen Ringelrein zum Sterbegesang der Karmeltinnen auf. Mit jedem orchestralen Guillotinenschlag tut sich der Bühnenboden auf und die „echte“ Blanche stößt eines der Doubles in das Loch.

Die Inszenierung reicht an Brillanz und Originalität nicht an andere Frankfurter Guth-Arbeiten heran, man denke nur an Daphne, Rodelinda oder zuletzt die Lustige Witwe, präsentiert aber trotz der notorischen (Über-)Psychologisierung eine eindringliche Umsetzung dieses Konversationsstückes. Den Glanz des Außergewöhnlichen erhält diese Produktion jedoch durch die musikalische Qualität auf der Bühne und im Orchestergraben. Möge sie einen festen Platz im Repertoire erhalten!
Michael Demel, 20. Juli 2021
Bilder: Barbara Aumüller
Gian Carlo Menotti: THE MEDIUM
ergänzt um Chöre von Schubert und Brahms sowie die TRAUERMUSIK von Lutoslawski
Teaser
Besuchte Vorstellung: 17. September 2020
(Premiere von The Medium im Bockenheimer Depot am 15. Juni 2019)
Not macht erfinderisch
Die neue Saison an der Oper Frankfurt sollte mit einem Paukenschlag beginnen: Ligetis schrill-bunte Anti-Anti-Oper Le Grand Macabre stand als Eröffnungspremiere auf dem Spielplan. Diesen Kraftakt konnte man unter Corona-Einschränkungen nicht realisieren. Schon der erzwungene Abstand zwischen den Musikern im Orchestergraben machte eine Aufführung dieses Werkes mit seiner riesenhaften Besetzung unmöglich. Also mußte kurzfristiger Ersatz her. Den fand man im eigenen Repertoire mit der Kurzoper The Medium des italo-amerikanischen Komponisten Gian Carlo Menotti aus dem Jahr 1946. Das selten gespielte Werk war zum Ende der vorletzten Spielzeit im Doppelpack mit Bruno Madernas Satyricon im Bockenheimer Depot herausgebracht worden. Eine Wiederaufnahme war nicht vorgesehen. Daß diese Produktion einen zweiten Blick lohnt, ja daß Menottis Gruselgeschichte von Madernas Zirkus-Firlefanz befreit erst angemessen zur Geltung kommt, kann man jetzt auf der Bühne des Großen Hauses erleben.
Menotti hielt zeitlebens nichts von den neutönerischen Experimenten seiner komponierenden Zeitgenossen, sondern blieb wie sein Lebensgefährte Samuel Barber der tradierten Tonalität verpflichtet, die er harmonisch anschärfte und bei Bedarf erweiterte. Das traf den konservativen amerikanischen Zeitgeschmack. The Medium wurde sogar unter der Regie des Komponisten selbst bereits zwei Jahre nach der Uraufführung verfilmt (auf Youtube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=Ni6Ugouya0o). Tatsächlich fühlt man sich immer wieder an Filmmusiken etwa eines Bernard Herrmann erinnert.

Der Plot handelt von einer Scharlatanin, die Leichtgläubigen in Séancen mit allerhand Budenzauber vorgaukelt, mit Verstorbenen in Kontakt zu stehen. Ihre Tochter und ein stummer Waisenjunge gehen ihr dabei zur Hand. Doch der vorgegaukelte Spuk scheint sich selbständig zu machen. Das Medium sieht sich von Geistern verfolgt. Was als Komödie begonnen hat, endet mit einem tragischen Tod.
Kaspar Glarner hat dazu ein Bühnenbild entworfen, welches nach dem Vorbild der Filmkulisse detailverliebt einen plüschig ausgestatteten und etwas heruntergekommenen Salon zeigt. Die Regie von Hans Walter Richter entfaltet darin ein handwerklich sauber inszeniertes, dichtes Kammerspiel, welches auf die darstellerischen Stärken einer ausgezeichneten Besetzung bauen kann. Claire Barnett-Jones als Madame Flora, das titelgebende Medium, steht ihrer Rollenvorgängerin Meredith Arwady in nichts nach und dominiert mit einer starken Präsenz geradezu die Bühne. Sie hat sich die Figur mit Haut und Haaren einverleibt. Sie chargiert in der Séance, daß es eine Freude ist und zeichnet den Weg von aufkeimender Furcht hin zu einem panischen, tödlichen Gewaltausbruch mit unablässiger Intensität. Ihren volltönenden Alt stellt sie in den Dienst der Darstellung und scheut dabei auch keine ordinären Töne. Im stimmlichen Kontrast dazu steht Angela Vallone, die in der Rolle der Monica, der Tochter des falschen Mediums, mit Gloria Rehm alterniert. Mit ihrem runden, jugendlichen Sopran darf sie die fast ein wenig zu nostalgisch-schönen Melodieerfindungen des Komponisten auskosten. Wie schon in der ursprünglichen Produktion überzeugt die junge Mezzosopranistin Kelsey Lauritano in der kleinen Nebenrolle der Mrs. Nolan. Barbara Zechmeister und Dietrich Volle als geistergläubiges Ehepaar runden wie schon in der Bockenheimer Premiere die ausgezeichnete Sängerbesetzung ab. Besonderen Eindruck macht erneut der junge Schauspieler Marek Löcker, welcher der stummen Rolle des Toby große Eindringlichkeit verleiht und diese zur zentralen Figur aufwertet.

Das Orchester in Kammerbesetzung badet unter der Leitung von Generalmusikdirektor Sebastian Weigle im süffigen, mitunter filmmusikhaften Sound.
Um den Abend zu der gewohnten Aufführungslänge von zwei Stunden zu weiten, werden drei konzertante Einheiten vorgeschaltet: Zunächst präsentieren die Männer des Opernchores den Gesang der Geister über den Wassern von Franz Schubert, dann die Chordamen die Vier Gesänge von Johannes Brahms und schließlich die Streicher des Orchesters die Trauermusik von Witold Lutoslawski. Natürlich stand bei dieser Programmgestaltung pragmatisch der Wunsch im Vordergrund, eine angemessene Beschäftigung für die festangestellten Hauskräfte zu finden. Dazu hat eine kluge Dramaturgie Chorwerke mit Texten gefunden, die zu dem Hauptwerk des Abends in einer inhaltlichen Beziehung stehen, einzelne Motive des Kommenden vorwegnehmen, deuten oder transzendieren.
So öffnet sich zu Beginn der Vorhang und gibt den Blick frei auf die schachbrettartig angeordneten Herren des Chores im Frack und mit schwarzer Atemschutzmaske. Synchron klappen sie ihre Notenmappen auf und präsentieren zu Streicherbegleitung ein Chorwerk, das zu den ambitioniertesten Schöpfungen Schuberts gezählt wird, bei zehn Minuten Aufführungsdauer aber gewisse Längen aufweist.

Eine reizvollere und musikalisch dankbarere Aufgabe haben anschließend die Chordamen. Dazu trägt bereits die ungewöhnliche Begleitung der Vier Gesänge von Johannes Brahms mit zwei Hörnern und Harfe bei. Gerade im zweiten der Gesänge – Shakespeares Come away, death in der deutschen Schlegel-Übersetzung – wird der Todeswunsch aus verschmähter Liebe thematisiert, der in der nachfolgenden Operninszenierung eine wesentliche Deutungszutat des Regisseurs sein wird.
Wenn der Vorhang ein drittes Mal aufgeht, haben sich die Streicher des Orchesters auf der leeren Bühne postiert. Sebastian Weigle führt sie konzentriert durch die Trauermusik von Witold Lutoslawski. Weigle entgeht der Gefahr, die Strenge der Komposition durch Sentimentalität oder dramatische Überhitzung zu unterlaufen. Er präsentiert das Werk klar strukturiert und arbeitet mit seinen Musikern den Ton herber Trauer adäquat heraus. In einem gewöhnlichen Konzert hätten Teile des Publikums sich der Herausforderung eines solchen Stückes entzogen, was regelmäßig zu Unruhe im Zuschauerraum führt. Hier aber in corona-bedingter Vereinzelung und nach Monaten des Musikentzugs scheinen die Zuhörer aufnahmebereiter oder jedenfalls disziplinierter zu sein. Die aufmerksame Stille im Publikum ist so vollkommen, daß man beim zweiten Abschnitt – Metamorphosen – zum leisen Beginn mit dem Pizzicato der tiefen Streicher sehr deutlich das Rauschen der Klimaanlage vernimmt. In Corona-Zeiten ein beruhigendes Geräusch: die Raumluft wird ausgetauscht!

Wenn schließlich der Vorhang nach der abschließenden Kurzoper von Menotti gefallen ist, hat man einen kontrastreichen und anregenden Opernabend erlebt. Die Chorwerke haben literarische Horizonte eröffnet, und Lutoslawskis zwölftönige Strenge hat das Gehör geschärft. Vielleicht liegt es auch daran, daß man nun, anders als bei der Premiere 2019, in Menottis Oper mehr als ein süffig komponiertes Schauerstück erkennen kann. Die Wiederbegegnung hat sich gelohnt.
Michael Demel, 1. Oktober 2020
(c) der Bilder (zum Teil mit Alternativbesetzung): Barbara Aumüller
Video mit Werkeinführung
Der komplette RING DES NIBELUNGEN zum Streamen
Mit einem besonderen Feiertagsangebot wartet die Oper Frankfurt auf: Der komplette Ring des Nibelungen wird bis Ende des Monats stückweise online gestellt. Den Anfang macht heute Abend das Rheingold, die weiteren Teile folgen im Zwei-Tages-Rhythmus, so daß man zu Hause private Wagner-Festspiele veranstalten kann. Die einzelnen Videos bleiben dann bis zum 31. Mai abrufbar. Abgerundet wird das Ganze durch ein Making-of und eine Talkrunde. Der Trailer der produzierenden Plattenfirma sieht vielversprechend aus und zeigt eine gute Kameraführung und stimmungsvolle Schnitte.
Es handelt sich um Aufzeichnungen aus der ersten zyklischen Aufführung im Frühsommer 2012. Der OPERNFREUND hatte diesen Zyklus in einer zusammenfassenden Rezension besprochen, die wir hier erneut online verfügbar machen.
Die einzelnen Termine (mit Link zur Seite der Oper Frankfurt):
OPER zuhause - Start mit XERXES
Nun startet auch die Oper Frankfurt auf ihrer Website unter www.oper-frankfurt.de/zuhause ein Programm für ihr Publikum, das in diesen Tagen nicht auf Oper verzichten will: „Oper Frankfurt zuhause“ präsentiert Opernaufführungen, „Wohnzimmerkonzerte“, Talkrunden und Programme für Kinder auf dem digitalen Weg. Anbei erste Termine:
Samstag, 18. April 2020, 20.30 Uhr - TAGESTIPP -
Xerxes
Dieses Werk gehört zu Georg Friedrich Händels beliebtesten Opern und feierte am 8. Januar 2017 in der Sicht von Regisseur Tilmann Köhler Premiere an der Oper Frankfurt. Am Pult des Opern- und Museumsorchesters stand Constantinos Carydis, zu den Solisten gehörten Gaëlle Arquez in der Titelpartie sowie u.a. Lawrence Zazzo (Arsamene), Elizabeth Sutphen (Romilda), Louise Alder (Atalanta) und Tanja Ariane Baumgartner (Amastre). Die vom DVD-Label Unitel aufzeichnete Produktion wird nun über die Website der Oper Frankfurt vom 18. April um 20.30 Uhr bis 20. April um die gleiche Zeit zu sehen sein.
Unser Kritiker war seinerzeit von der Premiere begeistert (Kritik zum Nachlesen und Vorfreuen).
Dienstag, 21. April 2020, 20.30 Uhr
„Wohnzimmerkonzert“ mit Liviu Holender
Seit der Spielzeit 2019/20 gehört der junge österreichische Bariton zum Ensemble der Oper Frankfurt. Live aus seiner Wiener Wohnung gibt er nun ein Konzert mit bekannten und unbekannten Melodien aus den Genres Lied, Oper und Musical. Dabei begleitet er sich selbst am Klavier und wird tatkräftig von seiner Familie unterstützt. Das „Wohnzimmerkonzert“ wird live auf der Facebook-Seite der Oper Frankfurt (https://www.facebook.com/Oper-Frankfurt-107804884207164/?modal=admin_todo_tour ) gestreamt. Im Anschluss ist das Video des Konzerts auch auf der Webseite der Oper Frankfurt sowie auf YouTube und Instagram zu finden.
Donnerstag, 23. April 2020, 20.30 Uhr
Talk zu Inferno
Die Uraufführung der Oper von Lucia Ronchetti war als Koproduktion von Oper und Schauspiel Frankfurt für den kommenden Samstag geplant. Nun ist sie um ein Jahr auf Juni 2021 verschoben worden. In einem Werkstattgespräch geben die Komponistin, der Dirigent Tito Ceccherini sowie die beiden Dramaturg*innen Konrad Kuhn (Oper) und Ursula Thinnes (Schauspiel) Auskunft darüber, was bisher geschah und welche Arbeit noch aussteht, nachdem der Entstehungsprozess seit 10. März unterbrochen wurde.
Sonntag, 26. April 2020, 11.00 Uhr
Oper für Kinder
Diese Reihe ist einer der Dauerbrenner im Programm der Oper Frankfurt. Kaum hat der Vorverkauf begonnen, sind stets (fast) alle Vorstellungen der Reihe ausverkauft. Hier haben nun Kinder ab 6 Jahren und ihre (Groß-) Eltern ohne langes Anstehen an der Kasse die Chance, die Probe zu einer Produktion dieser beliebten, von Dramaturgin Deborah Einspieler und Puppenspieler Thomas Korte entwickelten Serie mitzuerleben.
Nähere Informationen unter www.oper-frankfurt.de/zuhause. Hier werden baldmöglichst auch weitere Termine innerhalb dieses Formats angekündigt.
SALOME
Premiere 01.03.2020
TRAILER

Nach zwei Jahrzehnten hatte die „Salome“ von Richard Strauss in einer Neuinszenierung von Barrie Kosky an der Oper Frankfurt Premiere. Der eiserne Vorhang hob sich, Rabenschwärze, Salome im weißen Glitzerkleid mit Federschmuck auf dem Haupt kehrte uns den Rücken zu, hüpfte, wiegte die Hüften, räkelte sich lasziv am Boden, zu Flattergeräuschen eines Todesvogels (?) akustisch untermalt, danach setzte die Musik ein. Die Idee des Regisseurs war ohne „Gebrauchsanweisung“ im Programm nicht vermerkt.
Barrie Koskys Zitat zum Werk: Salome bedeutet immer eine große musikalische und szenische Herausforderung. Wie bei vielen anderen Stücken hat sich über die Jahre eine dicke Schicht Staub durch Routine angesammelt. Diesen Staub zu entfernen, einen tiefgründigen Blick auf den Text, die Musik zu werfen und zu erkennen, woher die Ideen und Motive stammen, ist das Wichtigste für eine Neuinszenierung. Zu neuen Taten, sodann ging der Staub-Wedel ans Werk.

Der Regisseur beleuchtete konsequent die Psycho-Analyse der Protagonisten akribisch zum Kontext von wenigen (un)freiwillig komischen Momenten abgesehen, schließlich lässt sich die Heimat Koskys an der „Komischen“ Oper Berlin nicht leugnen. Aber Spaß beiseite, kontinuierlich zeichnete der Exzentriker die Verwandlung des verliebten Mädchens zu Jochanaan bis zur rauschhaft erlebten finalen Konsequenz detailliert nach. Salome küsste nicht nur den bluttriefenden Kopf am Fleischerhaken, nein sie saugte, biss wie man in eine reife Frucht beißen kann, steigerte sich mit dessen Kopf zwischen den Schenkeln orgiastisch in Liebesekstase. Der Schleiertanz wurde zum szenischen Fauxpas, Salome zog sitzend meterweise Bänder bis zur Hysterie unter ihrem Kleid vor, waren eigentlich der Interpretin Sexappeal und tänzerische Anmut in hohem Maße zu Eigen, aber …

Das zuvor noch lebende Objekt ihrer sinnlichen Begierden wurde mit seltsamen Gebärden und wenig ansprechender Optik halbnackt im Schlabber-Slip und blonden Haarsträhnen präsentiert. Wie Wachs in den Händen der Regie schien Ambur Braid, ihre Darstellung der Kindfrau kam auch dank ihres persönlichen Engagements hervorragend zum Ausdruck. Unterbelichtet wirkten das Tetrarchen-Paar sowie die weiteren Darsteller. Kosky bediente sich im Kontrast der konstant schwarz verhangenen Bühne, einer kegelförmigen Scheinwerfer-Ausleuchtung (Joachim Klein) zur jeweiligen Personen-Szenerie. Während der orchestralen Intermezzi blieb es dunkel. Katrin Lea Tag kreierte die vier Kostüme der Salome, die Alltagskleidung der restlichen Crew, die Tücher der Juden und den schwarzen Bühnenhintergrund.

Konträr der exzessiven Dramaturgie widerfuhr dieser Produktion eine überragend dargebotene Tonalität wie man sie seltener erleben durfte. Am Pult des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters waltete die Gastdirigentin Joana Mallwitz wartete mit vortrefflicher und homogener Orchesterkultur auf. Nürnbergs Generalmusikdirektorin ließ die Strauss´sche Partitur in völlig neuem Licht erstrahlen, in ausgewogenen Tempi flossen die überwältigenden Passagen ineinander, kammermusikalische Lyrismen, emotionale Momente von elementarer Schönheit, konträre eruptive Konstruktionen verband die umsichtige Dirigentin in prächtiger Klangbalance. Dank des hervorragend in allen Gruppen minutiös präparierten und prächtig aufspielenden Orchesters umwob Mallwitz die Solisten mit einem spannenden symphonischen Klangteppich, beleuchtete den farbschillernden Kosmos dieser Komposition insbesondere und schenkte dem kontrapunktischen Tanz der sieben Schleier den lasziv-sinnlichen, exotisch-ekstatischen Sound. Zu Herodes Worten formuliert: Herrlich, wundervoll – fürwahr!

Gewiss zog die vorteilhafte Optik der kanadischen Sopranistin Ambur Braid zur ambivalenten Darstellung alle Blicke auf sich, jedoch konnte die Sängerin im vokalen Bereich nur zuweilen überzeugen. Stimmlich lotete Braid die kräftezehrende Partie facettenreich aus, fand Töne für trotzige Wut und gezielte Aggressionen, schenkte lyrischen Passagen sehnsüchtige Kantilenen. War die hörbare Überforderung der Stimme während der extremen hohen Lagen, Grund der teils weniger glückhaften Intonation oder lediglich das Resultat langer Proben? Oder erfüllte sich die ehrgeizige Sängerin einfach zu früh den Salome-Wunsch und wurde den Ansprüchen des Rezensenten (zu dessen 46. Interpretin) nicht gerecht?
In guten Phrasierungen der markanten Mittellage umriss Christopher Maltman den Jochanaan, verlieh dem religiösen Fanatiker (regielich eingeschränkt) wenig Präsenz und ließ sein Organ in den mächtigen Aufschwüngen weniger kultiviert erklingen.

Fernab gewohnter Charakterstudien des Herodes sang AJ Glueckert mit schönem Timbre und schier lyrischen tenoralen Attributen einen jüngeren, agilen Tetrarchen zu prägnanter Diktion. In ihrem Chanel-Kostüm wirkte Claudia Mahnke sehr mütterlich, verlieh jedoch ihrer Herodias nachdrückliche eine angenehme Vokalise.
Wunderschön ertönte der volle weichfließende Mezzosopran von Katharina Magiera als warnender Page. Mit strahlendem Tenor kündete Gerard Schneider als verliebter Narraboth von den optischen Reizen der Salome.Klangschön bestens abgestimmt formierten sich Theo Lebow, Michael McCown, Jaeil Kim, Jonathan Abernethy, Alfred Reiter zum Gezeter der tuchverhüllten Schloss-Gespenster, pardon der fünf Juden. Schönstimmig ergänzten Thomas Faulkner, Danylo Matviienko (Nazarener/Cappadocier), Dietrich Volle, Pilgoo Kang, Chiara Bäuml (Soldaten/Sklave) das Solistenensemble.
Das Premieren-Publikum war zufrieden, dankte mit prasselndem Applaus und lautstarken Ovationen allen Beteiligten incl. ohne Contra dem Produktionsteam und rückte insbesondere Mallwitz und Baird in den Focus der Begeisterung.
Bilder (c) Monika Rittershaus
Gerhard Hoffmann, 5.3.2020
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
TRISTAN UND ISOLDE
Bericht von der Premiere am 19. Januar 2020
Trailer
Symphonische Dichtung mit Singstimmen und Neonröhren
Es ist wie so oft bei Tristan-Aufführungen: das Orchester dominiert den Gesamteindruck. Nach tastendem Beginn stellt sich schnell der typische Frankfurter Weigle-Sound ein: klar, stark, unsentimental. Ein satter Streicherklang ohne Larmoyanz bildet die Basis, vorzügliche Holzbläser mischen sich im Tutti ideal und überzeugen in den Solostellen. Das Blech tönt voll, ohne je zu dröhnen. Sebastian Weigle gestattet seinen Musikern kein traumverlorenes Schwelgen, hält die Zügel bei aller Flexibilität in Tempo und Dynamik straff in der Hand. Zu hören ist eine große symphonische Erzählung mit viel Sinn für Wagners Klangfarben. Hellhörig arbeiten die Musiker Details heraus, die sonst allzu oft im großen Rausch untergehen. Nur ein Beispiel: Wenn zu Beginn des zweiten Aufzugs die Hörnerrufe des Fernorchesters nahtlos von den Holzbläsern übernommen werden, gelingt Weigle mit seinen Musikern in wunderbarer Perfektion ein Effekt des organischen Umfärbens, den man so selbst aus den geglücktesten Einspielungen nicht kennt. Man hört geradezu mit Isoldes Ohren, wenn sie dazu singt: „Nicht Hörnerschall tönt so hold, des Quelles sanft rieselnde Welle rauscht so wonnig daher.“ Dabei verliert Weigle aber die Gesamtdisposition nie aus dem Blick. Die Partitur wird hier nicht zum Anlaß eines rauschhaften Klangexzesses genutzt, sondern in ihrer Komplexität und ihrer melancholischen Schönheit ausgeleuchtet.

Rachel Nicholls (Isolde) und Vincent Wolfsteiner (Tristan)
Gegen die Kraft dieser Musik haben es Bühnenbilder immer schwer. Johannes Leiacker nimmt sich bis an die Grenze der Bildverweigerung zurück. Alle drei Akte läßt er in einem hohen, weißen und vollständig schmucklosen Raum spielen, der lediglich auf halber Höhe von einem Fries aus Neonröhren umsäumt wird. Im ersten Akt läßt er darin an dünnen Drahtseilen eine schwarze Plattform herab, welche Isolde als Floß in einer kalten Umwelt dient. Der Kahn, mit dem Tristan einst schwer verwundet zu ihr gefahren kam, um durch ihre Zauberkünste geheilt zu werden, steht als einziges konkret zuordbares Erinnerungszeichen am Rande des abstrakten Gebildes.
Der zweite Aufzug präsentiert die Plattform dann in der Bühnenmitte aufrecht stehend. Sie erinnert in dieser Form ein wenig an den Monolithen aus Kubricks 2001: A Space Odyssee, nur daß ihm hier die geheimnisvolle Aura fehlt, und er schlicht als Raumteiler dient.
Der dritte Aufzug schließlich präsentiert in der Bühnenmitte aufeinander liegende schwarze Trümmerplatten, vor denen der Kahn aus dem ersten Aufzug angedockt hat. Dies ist der stärkste Bildeindruck des Abends. Und es ist der zugleich am wenigsten originelle, wird doch damit auf das allzu oft zitierte Bild Das Eismeer von Caspar David Friedrich angespielt, dessen volkstümliche Bekanntheit als Gescheiterte Hoffnung hier geradezu klischeehaft deutlich in Erinnerung gerufen wird.

Vincent Wolfsteiner (Tristan), Christoph Pohl (Kurwenal) und Romain Curt (Englischhorn)
Auch für die Regie bleibt nur wenig zu tun. Obgleich der Komponist sein Werk als „Handlung“ bezeichnet hat, wird über weite Strecken von den Protagonisten überhaupt nicht gehandelt. Regisseurin Katharina Thoma beschränkt sich im ersten Aufzug zunächst darauf, ihre Protagonisten dezent zu charakterisieren. Dabei kann man in homöopathischen Dosen sogar so etwas wie eine weibliche Regiehandschrift erkennen: Wenn Isolde etwa in wörtlicher Rede Tristan zitiert, wird dies zur gestischen Parodie männlicher Breitbeinigkeit, samt machohaftem Griff in den Schritt. Die Liebestrank-Szene gerät ein wenig albern zur saufseligen Whiskey-Probe. Im zweiten Aufzug vertraut die Regisseurin ganz der Musik und läßt das Liebespaar um den sich langsam drehenden Monolithen herumschleichen.
Im dritten Aufzug immerhin hat sich Katharina Thoma dann doch verpflichtet gefühlt, noch so etwas wie eine Deutung nachzuliefern. Sie läßt Tristans Eltern als schwarze, gesichtslose Schatten auftreten. In Pressegesprächen vor der Premiere hat die Regisseurin dazu bemerkt, daß sie bei Tristan eine Bindungsunfähigkeit entdeckt habe, die aus einer frühkindlichen Traumatisierung, bedingt durch den Verlust beider Eltern, herrühre. Das wolle sie zeigen. Sie zeigt es aber nicht. Wer den gedanklichen Überbau nicht kennt, der mag wohl erraten können, daß die stumme Frau in Schwarz Tristans Mutter ist. Inwiefern sie auf seine Psyche eingewirkt haben mag, kann man der Szene jedoch nicht entnehmen. So dient die Hinzufügung nur einer Unterstreichung des Textes, in dem Tristan beklagt, daß die Mutter bei seiner Geburt verstarb. Drastisch dagegen wird Tristans Todessehnsucht illustriert. Er reißt sich vor Isoldes Ankunft nicht bloß librettogerecht den Verband von der Wunde, sondern sticht mit einem Dolch erneut hinein.

Claudia Mahnke (Brangäne) und Rachel Nicholls (Isolde)
In diesem dritten Aufzug erweist sich nun, daß Vincent Wolfsteiner der Monsterpartie des Tristan vollauf gewachsen ist. Vom Stimmtimbre ist er eher ein Charaktertenor als ein Heldentenor. Er kann einen kopfresonanzbetonten, hellen Klang aber zu kraftvoller Lautstärke führen, mit der er mühelos noch die brausendsten Orchesterwogen durchdringt. Auch verfügt er über eine bombensichere Höhe, allerdings um den Preis einer glanzlosen Mittel- und Tiefenlage. Das alles ist bekannt. Mit welchen Kraftreserven Wolfsteiner aber im Schlußteil aufwarten kann, das nötigt Respekt ab. Bis zum letzten Ton kann er mit musikalischen Mitteln differenziert und leidenschaftlich gestalten, wo andere ausgebrannt mit letzter Mühe die Ziellinie erreichen.
Daß Rachel Nicholls als Isolde beim Schlußapplaus einige saftige Buhs kassieren würde, konnte man ahnen. Gerade der abschließende Liebestod hatte die Schwächen ihrer Stimme gnadenlos bloßgelegt: zu hell und zu schlank für das hochdramatische Fach, durch zu großen Druck mitunter hart, fahl in der Mittellage, bei einigen Spitzentönen sogar regelrecht schrill. Hier hat sich wieder einmal ein Sopran mit lyrischer Grundanlage am schweren Fach vergriffen und betreibt seit Jahren Raubbau an den eigenen stimmlichen Ressourcen. Natürlich sind die Buhrufe im Hinblick auf ihre Gesamtleistung unfair. Gerade in den beiden ersten Aufzügen hatte sie gestalterische Intelligenz gezeigt. Aber der Liebestod ist nun einmal eine Wunschkonzertnummer, die jeder Opernliebhaber in exemplarischen Tonträgerversionen mit Ausnahmesängerinnen (die Flagstad, die Nilson, die Norman, die Price!) im Gedächtnis abgespeichert hat. Da wird kein Pardon gegeben.

oben: Rachel Nicholls (Isolde) und Vincent Wolfsteiner (Tristan), unter dem Podest: Claudia Mahnke (Brangäne; vorne links) und Christoph Pohl (vorne rechts) mit Herrenchor sowie Andreas Bauer Kanabas (König Marke; am rechten Bildrand)
Und weil man es hatte kommen sehen, hatte man sich für einen kurzen Moment gewünscht, daß die wunderbare Claudia Mahnke als Brangäne nach ihren letzten Worten an Isolde einfach mild und leise weitersingt, ihre warme Stimme so fluten und leuchten läßt, wie zuvor in ihrem Wachgesang im zweiten Aufzug. Waren nicht viele große Isolden der Vergangenheit von Martha Mödl bis Waltraud Meier ebenfalls Mezzosoprane? Die Mahnke war bislang klug genug, ihre Grenzen nicht auszuloten. Und so ist sie nun in Frankfurt wie zuletzt in Köln als exemplarische Brangäne zu hören: mit stabiler Mittellage, üppigem, aber gut kontrolliertem Vibrato und einer sicheren, attraktiven Höhe. Dazu kommt eine ausgezeichnete Textverständlichkeit. In dieser Rolle bewegt sich das Frankfurter Ensemblemitglied im internationalen Spitzenfeld.
Dort ist jetzt auch Andreas Bauer Kanabas mit seinem Marke angekommen. Sein sonorer Baß hat zuletzt an Volumen gewonnen, ohne an Differenzierungsmöglichkeiten zu verlieren. Selten hat man dem überlangen Klagegesang des gehörnten Königs am Ende des zweiten Aufzugs so gebannt zugehört.
Christoph Pohl als Gastsänger gibt mit kernigem Bariton einen soliden, aber recht eindimensionalen Kurwenal. Iain MacNeil läßt ihn als Melot mit seinen wenigen Tönen im Vergleich blaß aussehen. Michael Porter als Seemann muß aufpassen, daß er seinen lyrischen Tenor nicht mit zu großem Kraftaufwand zu künstlicher und ungesunder Größe aufbläht. Einen tadellosen Eindruck macht das Opernstudiomitglied Tianji Lin mit leichtem und elegantem Tenor als Hirte.
Sein makelloses und ergreifendes Englischhornsolo darf Romain Curt auf offener Bühne präsentieren.
Insgesamt war es ein guter, aber kein großer Abend, der sich insbesondere wegen der profilierten Orchesterleistung, einer außerordentlichen Brangäne und einem herausragenden Marke gelohnt hat. Die unspektakuläre szenische Umsetzung vermag jedoch nicht zu begründen, warum man ihretwegen die bewährte Regiearbeit von Christof Nel absetzen mußte.
Michael Demel, 20. Januar 2020
Bilder: Barbara Aumüller
Fauré: PÉNÉLOPE
Bericht von der Premiere am 1. Dezember 2019
Ritualisierte Vereinsamung
Gabriel Fauré selbst war mit dem Ergebnis seiner späten Gehversuche auf dem Gebiet der Oper nicht zufrieden: „Der Eindruck am Klavier wirkt jedoch eiskalt, insgesamt erscheint das Ganze steif und statisch.“ Diese Selbstkritik ist berechtigt. Die Musik folgt wie das Libretto einer Antikenrezeption, die im 19. Jahrhundert vorherrschend war. Alles ist edel, ebenmäßig, aber auch von marmorner Blässe – und verfehlt das Wesen der bewunderten Mittelmeerkulturen aus einer fernen Vergangenheit. Daß etwa die als klassisch überhöhten antiken Statuen ursprünglich farbig bemalt waren, ja auf heutige Betrachter regelrecht grell bunt wirken, war noch weitgehend unbekannt. Wer Homers Illias und Odyssee unbefangen liest, wer sich überhaupt mit griechischer Mythologie beschäftigt, dem kann kaum das Archaische, Brutale, ja grotesk Grausame entgehen. Da ist Richard Strauss‘ saftige Vertonung von Hugo von Hofmannsthals bluttriefendem Gewaltexzeß der Psychopathin Elektra aus dem Jahr 1909 tatsächlich wesentlich dichter am Kern, als die in edler Pose erstarrende Pénélope des französischen Komponistenkollegen, die im Jahre 1913 uraufgeführt wurde.

In edler Pose erstarrt: Paula Murrihy als Pénélope
Faurés Librettist René Fauchois hat mit sicherer Hand wesentliche Elemente eliminiert, welche die von ihm verwendeten Abschnitte der Odyssee farbig und interessant machen. Daß er etwa die Figur des Telemachos, des Odysseus Sohn, der dem Vater bei der Racheaktion an den Freiern seiner Ehefrau zur Hand geht, völlig eliminiert hat, wirkt wie eine Amputation der Handlung. Das für antike Dramen konstitutive Element einer in die Geschicke der Menschen eingreifenden und mit diesen verwobenen Götterwelt fehlt ebenfalls völlig. Nicht die Göttin Athene läßt Odysseus hier in fremder Gestalt erscheinen. Die Verfremdung muß ein angeklebter Bart leisten, was bereits Fauré eher unglaubwürdig fand, ohne daraus dramaturgische Konsequenzen zu ziehen (die Frankfurter Inszenierung läßt den falschen Bart gleich ganz weg). Auch die Weise, wie das finale Blutbad an den Besiegten eher beiläufig in das Ende verharmlosend hineinmontiert wird, erscheint wie ein kraftloses Abhaken eines Handlungselements, welches blutig die edle Würde der Protagonisten eintrübt. Wie aus dem Rahmen gefallen wirkt es da, wenn der Librettist die vor sich hinbrütende Pénélope dann doch einmal für einen kurzen Moment Gewaltphantasien entwickeln läßt: Sie wolle „Blut und Gedärme“ der sie belagernden Prinzen an den Wänden der Palastmauern sehen. Das glaubt ihr aber zu diesem Zeitpunkt bereits niemand mehr im Publikum. Und auch Fauré glaubt es ihr nicht, wie die Musik bezeugt. Er webt in seiner Partitur edle Fäden, malt lichte Aquarellbilder, dünnt die Instrumentation immer wieder aus und kombiniert einzelne Instrumente zu exquisiten Klangfarbmischungen. Vorzüglich wird das vom Orchester unter der Leitung von Joana Mallwitz präsentiert. An den Musikern liegt es nicht, daß man keine Melodie, keine musikalische Wendung mit in die Pause nimmt. Wenn man noch im Ohr hat, wie überwältigend farbig Joana Mallwitz Debussys Pelléas mit dem Frankfurter Opernorchester vor einigen Spielzeiten aus dem Orchestergraben fluten ließ, dann erkennt man deutlich, daß Fauré sich bewußt gegen den Hauptvertreter des musikalischen Impressionismus abgrenzen wollte. Hier gibt es kein geheimnisvoll raunendes Ungefähr, kein Schillern, kein Fluten. Alles ist klares, wohltemperiertes Edelmaß. Man hört dem durchaus interessiert zu und fühlt sich intelligent unterhalten. Emotional läßt einen diese Musik allerdings so kalt wie der Torso einer Marmorstatue.

Was Sie nicht sehen: Hier hat gerade ein Massaker stattgefunden (Božidar Smiljanić (Eumée), Paula Murrihy (Pénélope) und Eric Laporte (Ulysse)
Die Inszenierung von Corinna Tetzel versucht erst gar nicht, dem Stück äußere Dramatik abzugewinnen. Gezeigt wird eine selbstbewußte Frau, die ihre Vereinsamung ritualisiert hat. Die Trauer um den vermeintlich vor Troja gefallenen Odysseus ist zu einem Kokon geworden, in den sie sich eingesponnen hat. Bildlich zeigt das die Regie treffend, indem sie Pénélope das Totenhemd ihres verstorbenen Schwiegervaters Laertes, dessen allnächtlich vereitelte Fertigstellung den Zeitpunkt einer neuen Eheschließung hinauszögern soll, selbst tragen läßt. Die Perpetuierung der unbewältigten Vergangenheit hüllt die Königin ein und schirmt sie von der Umwelt ab. Ihre ritualisierte Trauer ist ein Vehikel, das zur Emanzipation durch Absonderung geführt hat. Da ist es konsequent, daß diese selbstbewußt Vereinsamte den nach zwanzig Jahren Irrfahrt überraschend heimkehrenden Gatten zunächst nicht erkennt, wohl auch: nicht erkennen will. Als er sich ihr offenbart, bleibt sie distanziert. Er ist ihr fremd geworden, aber er hat auch in ihrem neuen Leben keinen rechten Platz mehr. Das Schlußbild zeigt sie in sich versunken, während der wiedererlangte Gatte sich ratlos von ihr entfernt.

Paula Murrihy (Pénélope; im Anzug vorne sitzend) und Freier
Paula Murrihy gibt der Titelfigur mit edelherb timbriertem Mezzo angemessen noble Kontur. Sie verkörpert auch glaubhaft das introvertierte Wesen dieser Figur, für das Camille Saint-Saëns seinen Freund und Schüler Fauré nach der Uraufführung getadelt hatte: „Ich sehe nicht ein, warum Pénélope unter dem Vorwand, daß sie ihren Mann vermißt, immer wie eine Schlafwandelnde herumläuft.“ Der heimkehrende Odysseus, der in latinisierter Tradition hier Ulysse heißt, ist mit Eric Laporte typgerecht besetzt. Sein gut fokussierter Tenor verfügt über einen stabilen Kern, der den Kriegshelden beglaubigt. Zugleich prädestiniert ihn eine elegante voix mixte für das französische Repertoire. Auch optisch paßt er gut zur Rolle eines etwas in die Jahre gekommenen, vom Bestehen zahlreicher Abenteuer etwas erschöpften Helden, der ein wenig Zeit benötigt, um seine wiederkehrenden Kräfte zu sammeln und mit einem finalen Kraftakt die tradierte Ordnung in seinem Königreich wieder herzustellen.

Der Gatte bleibt ihr fremd: Joanna Motulewicz (Amme), Paula Murrihy (Pénélope) und Eric Laporte (Ulysse)
Äußerlich gar nicht typgerecht ist Joanna Motulewicz. Die junge Sängerin muß die Amme des Odysseus spielen, wird aber als die junge Frau präsentiert, die sie tatsächlich ist. Man mag von Maskierungen und Theaterschminktricks halten, was man mag: Wenn die Amme etwa halb so alt aussieht wie der erwachsen gewordene einstige Säugling, wenn sie also gut und gerne seine Tochter sein könnte, dann kippt die Dramaturgie in diesem Punkt. Das ist umso störender, als die Motulewicz musikalisch mit ihrem dunkel abgetönten, sich warm verströmenden Alt musikalisch einen ausgezeichneten Eindruck hinterläßt. Ohnehin sind nicht nur die Hauptpartien überzeugend besetzt. In gewohnter Güte profitiert auch die kleinste Nebenrolle von den Qualitäten des Frankfurter Stammensembles. Aus dem Kreis der Prinzen verstehen es Sebastian Geyer und Peter Marsh, die von Fauré einkomponierten Profilierungsmöglichkeiten zu nutzen. Božidar Smiljanić empfiehlt sich mit seinem satten, kernigen Baßbariton als Hirte einmal mehr für größere Aufgaben.

Unter dem Strich ist man geneigt, dem Stück allenfalls eine Zukunft mit gelegentlichen konzertanten Aufführungen vorauszusagen. Rifail Ajdarpasic ist für das Bühnenbild der vorliegenden Produktion jedenfalls nichts eingefallen, was den szenischen Aufwand gerechtfertigt hätte. Er hat den Hof von Ithaka auf das Flachdach eines Wohnhauses mit angerosteter Satellitenschüssel und trostlosen Stuhlskeletten versetzt, welches über teilweise ausgebleichte Terracotta-Fliesen und im Hintergrund herumstehende Zypressen als mediterran gekennzeichnet wird. Die Kostüme von Raphaela Rose zeigen durchweg die üblichen Business-Anzüge, die offenbar irgendeine EU-Richtlinie für Aktualisierungen historischer Stoffe zwingend vorschreibt (anders ist deren inflationäre Verwendung auf deutschen Bühnen nicht zu erklären).
Musikalisch lohnt sich ein Besuch der Produktion, auch wenn die vorzüglichen Sänger und das großartige Orchester nicht vergessen machen können, warum Faurés Spätwerk nie Eingang in das Repertoire gefunden hat.
15.12.2019, Michael Demel
© der Bilder: Barbara Aumüller
Gabriel Faurés
PÉNÉLOPE
06.12.2019
Trailer
Geballte Frauenpower...
...hat die Oper Frankfurt für Gabriel Faurés von den Bühnen arg vernachlässigte singuläre Oper PÉNÉLOPE aufgeboten. Die Partitur lag in den Händen der Dirigentin Joana Mallwitz, Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg, Operndirigentin des Jahres 2019 (Opernwelt), die anspruchsvolle und gewaltig umfangreiche Titelpartie gestaltete Paula Murrihy und inszeniert hat Corinna Tetzel, die Kostüme entwarf Raphaela Rose und die dezent eingesetzten Videoclips kreierte Bibi Abel. Die Produktion wurde zudem von der Dramaturgin Stephanie Schulze betreut.

Die wunderschöne, zwischen Impressionismus und verhallender Spätromantik angesiedelte Farbenpracht von Faurés Musiksprache wurde von Joana Mallwitz und dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester mit feingesponnenem, herrlich austariertem Klang evoziert. Nur schon das Vorspiel war ein Traum: Warmer Streicherklang für das unendliche Warten Pénélopes auf ihren verschollenen Gatten, quintenselig schiebt sich das Motive des Ulysse dazwischen, verwebt sich mit dem ersten Motiv – wunderbar. Und zum Glück vor dem geschlossenen Vorhang, so dass man glückselig und konzentriert in diese Klangwelt eintauchen konnte. Im Verlauf des Abends mischten sich auch mal zarte Orientalismen in die Musik, alles blieb in einem weichen, transparenten Fluss, nie zu dick, nie zu dünn, stets auf Ausdruck und Unterstützung der Sänger bedacht. In der groß angelegten Titelpartie brillierte die Mezzosopranistin Paula Murrihy, die kürzlich als Idamante (IDOMENEO) und zweite Dame (ZAUBERFLÖTE) bei den Salzburger Festspielen begeisterte. Frau Murrihys wunderbar klarer, sauber geführter Mezzosopran war geradezu ideal für diese Partie. Sie führte ihre Stimme schlank, unforciert und passend mit wenig Vibrato. An diesem Abend waren alle Sänger mikrofoniert, da die Vorstellung für eine CD Produktion des Labels OehmsClassics aufgenommen wurde.

Es ist erfreulich, dass die sich die Oper Frankfurt gerne auf Entdeckungsreise nach selten gespielten Werken begibt und diese dann auch einspielt. Selbstverständlich wurden die Stimmen gestern Abend durch die Mikroports nicht verstärkt, diese dienten lediglich der Aufnahmetechnik! Die zweite größere Frauenrolle war die von Ulysses Amme Euryclée, ebenfalls für Mezzosopran gesetzt. Joanna Motulewicz sang die Rolle exzellent, mit warmer, schön gerundeter Tongebung. Ausgezeichnet besetzt waren auch die Mägde mit Nina Tarandek, Angela Vallone, Bianca Andrew, Julia Moorman und Monika Buczkowska. Julia Kathrin Heße sang Eurynome und Anna Spohia Beller, Solistin des Kinderchors, sang mit zarter, lichter Stimme den Hirten, der mit seinen Pfeilen im Köcher ein Art Amor darstellte und die weißen Trauerrosen der Pénélope durch seine Pfeile ersetzen wollte. Allein, es half nichts, denn die Regisseurin traut selbst dem (von Männern entworfenen) Happyend der Geschichte nicht. Sie setzt auf eine moderne, feministische Sicht auf das Werk. Pénélope behält (auch im wortwörtlichen Sinne) fast durchgehend die Hosen an. Der strenge schwarze Hosenanzug weist auf ihre Macht als Königin von Ithaka hin. Gespielt wird aber nicht in einem Palast, sondern auf dem Flachdach eines eher heruntergekommenen Strandhauses (Bühne: Rifail Ajdarpasic), eine Satellitenschüssel, die schon Rost angesetzt hat, steht da (man hat es wohl aufgegeben, Nachrichten – über Überlebende des trojanischen Krieges - zu empfangen). Bilige rote Gartenstühle mit Schnurbespannung stehen rum. Der Horizont wird ab und an mal krisselig, kein Wunder, bei der Qualität dieser Satellitenschüssel. Sehr gelungen ist der Einfall der Regisseurin, dass Pénélope das Tuch an dem sie tagsüber webt und das sie nachts wieder auftrennt, um keinen der Freier heiraten zu müssen, an ihrem Körper trägt. Es ist also nicht wie sie vorgibt, das Leichentuch für den Schiegervater Laertes, sondern es ist quasi ihr eigenes Totenhemd, denn irgendwie ist sie innerlich der Welt bereits abhanden gekommen, da ihre große Liebe, Ulysse, nicht zurückkehrt. Und als er dann nach 20 Jahren des Wartens kommt, erkennt sie ihn lange nicht wieder. Das ist nicht nur seltsam, denn Menschen verändern sich (vor allem durch 10 Jahre traumatischer Kriegserfahrungen und eine ebenso lange Irrfahrt danach) , eine erneute Annäherung kann schwierig werden – darin kann man der Regisseurin Corinna Tetzel nur beipflichten. Allerdings haben die schaffenden Männer (Gabriel Fauré, sein Librettist René Fauchois und der für die Vorlage verantwortliche Homer) ein anderes, für das Liebespaar glücklicheres Ende vorgegeben.

In dieser Aufführung nun öffnet sich ein Spalt auf dem Betonflachdach, Pénélope und Ulysse sind nur kurz zusammen, dann geht Ulysse alleine ab, versinkt im Dunkel des sich öffnenden Spaltes, Pénélope bleibt alleine zurück. Somit ist auch die Reinvestitur des Patriarchats gescheitert. Der Tenor Eric Laporte sang einen ausgezeichneten Ulysse. Sein Tenor traf den manchmal leicht schneidenden Tonfall des etwas gebrochenen Helden perfekt, Phrasierung und Diktion des Kanadiers waren makellos. Er verlieh den vielen im deklamatorischen Stil gehaltenen Passagen herrlichen Glanz. Die Freier lassen es sich gut gehen in diesem Strandbungalow. Sie stecken in schwarzen, smart geschnittenen Anzügen, tragen exquisites Schuhwerk, braune oder schwarze Lederschuhe, weiche Loafers und teure weiße Sneakers. Ihr Benehmen ist allerdings nicht so vornehm, sie urinieren schon mal auf das Dach und stellen unverfroren den Mägden nach und verlangen Oralsex (erstaunlich, dass sich die Damen in den zitronengelben Kostümen dies gefallen lassen, vor allem in der heutigen Zeit, in der das Ganze abläuft – #metoo ist wohl noch nicht auf Ithaka angekommen). Stimmlich bildeten diese Freier ein ganz herausragendes Quintett: Eurymaque (mit herrlich präsentem Bariton, Sebastian Geyer), Aninoüs (Peter Marsh, mit hellem Tenor), Léodès (Ralf Simon), Ctésippe (Dietrich Volle) und Pisandre (Danylo Matviienko). Der Hirte und langjährige Vertraute von Ulysse, Eumée, wurde vom Bassbariton Božidar Smiljanić mit einnehmendem Timbre interpretiert.

Fazit: Wunderbare Musik, die eine intensive Beschäftigung mit diesem Werk überaus lohnt, Dirigat und Besetzung absolut erstklassig, die feministische Sicht auf ein von Männern geschaffenes Werk eher gewöhnungsbedürftig.
Bilder (c) Barbara Aumüller
Kaspar Sannemann 7.12.2019
LADY MACBETH VON MZENSK
Bericht von der Premiere am 3. November 2019
Trailer
Musikalisch überwältigend, szenisch defizitär
Niemand kann eine Aufführung von Dmitri Schostakowitschs bedeutendstem Beitrag zum Musiktheater rezensieren, ohne davon zu erzählen, daß diese Oper den Komponisten seinerzeit in ernste Lebensgefahr gebracht hatte. Entledigen wir uns also dieser Pflicht: Eigentlich lief es gut für den jungen Komponisten. Seine 1934 im damaligen Leningrad uraufgeführte Oper wurde begeistert aufgenommen, schnell von zahlreichen Theatern innerhalb und außerhalb der Sowjetunion nachgespielt und erlebte innerhalb von zwei Jahren allein in Moskau 94 Aufführungen. Bis am 28. Januar 1936 in der Prawda, dem Zentralorgan der kommunistischen Staatspartei, ein vernichtender Artikel unter der Überschrift „Wirrwarr statt Musik“ (in anderen Übersetzungen „Chaos statt Musik“) erschien. Als Autor des anonym veröffentlichten Artikels mußte der Komponist niemand anderen als Stalin persönlich vermuten, hatte dieser doch tags zuvor eine Aufführung der Oper besucht und offenbar aufgebracht vom Dargebotenen vorzeitig die Vorstellung verlassen. In der Prawda war anschließend von „Musiklärm“ die Rede und davon, daß „Geschrei den Gesang“ ersetzt habe. Dieses Verdikt durch den Diktator selbst kam im schlimmsten Fall einem Todesurteil gleich, wenigstens aber drohte dem Erreger des Stalin‘schen Zorns die Verbannung in eines der berüchtigten Straflager. Schostakowitsch jedenfalls lebte seit Erscheinen des Artikels auf gepackten Koffern und rechnete allnächtlich mit seiner Verhaftung. Julian Barnes hat dies in seinem Roman „Der Lärm der Zeit“ eindringlich geschildert.

Anja Kampe in der Titelrolle
Den interessierten Besucher der Frankfurter Neuproduktion erwartet nun weder allzu derber Lärm, noch Geschrei. Es wird im Gegenteil vorzüglich musiziert und herausragend gesungen. Generalmusikdirektor Sebastian Weigle präsentiert mit einem Orchester in Höchstform eine geschliffene und bis in die kleinsten Nuancen ausgeleuchtete Interpretation der vielschichtigen Partitur, wie man sie so zuvor kaum je gehört zu haben meint. Die berüchtigten lauten Passagen werden durchaus lustvoll ausmusiziert. Der „Lärm“ dröhnt aber nicht, er bleibt Musik, bleibt in seiner Form, seiner Struktur, vor allem seiner Klangfarbe erlebbar. Das Derbe wird plastisch ausgespielt, die vielen grotesken Wendungen haben Biß und Schärfe. Daneben gelingen die zurückgenommenen, leisen Passagen in schlichter Klarheit. Immer wieder hat hier der Komponist die Instrumentation ausgedünnt, kombiniert er nur wenige Instrumente zu einem fragilen Klang. Gerade hier zeigt sich die große Gestaltungskunst des Dirigenten, der selbst im leisesten Piano und im zurückgenommensten Tempo nie den Spannungsfaden abreißen läßt.

Alfred Reiter (Pope; oben in der Bildmitte ), darunter Anja Kampe (Katerina Ismailowa) und Dmitry Golovnin (Sergei) sowie Ensemble
Die tragenden Partien sind, ungewöhnlich für Frankfurt, allesamt mit Gästen besetzt, man möchte sagen: geradezu ideal. Anja Kampe lotet als Katerina die Vielschichtigkeit der Titelpartie mit den enormen Möglichkeiten ihrer Prachtstimme aus. Sie zeigt dabei nicht die typischen Nebenerscheinungen eines jahrelangen Einsatzes im hochdramatischen Fach. Es gibt bei ihr kein übermäßiges Vibrato, keine gestemmte Tiefe, keine scharfe Höhe. Diese Stimme ist bei all ihrer Fülle durch alle Register bruchlos intakt, verfügt über ein intensives, tragendes Piano und über eine leuchtende Höhenlage. Vor allem aber ist die Kampe eine phänomenale Stimmschauspielerin. Von der gelangweilten Ehefrau über die skrupellose Mörderin bis zur gebrochenen Betrogenen am Ende beglaubigt sie jede Wendung musikalisch genau und emotional eindringlich.

Dmitry Belosselskij (Boris) und Anja Kampe (Katerina)
Als ihr Schwiegervater und Gegenspieler Boris beeindruckt Dmitry Belosselskij mit seinem fülligen, schwarzen Baß. So herrisch er in der Rolle des despotischen Gewaltmenschen aufzutrumpfen versteht, so eindringlich vermag er im letzten Akt die Partie des Alten Zwangsarbeiters zu gestalten. In Statur und Timbre rollenadäquat sind die beiden Tenöre: Dmitry Golovnin gibt den Verführer Sergei heldentenoral viril und breitbeinig, Evgeny Akimov den gehörnten Gatten Sinowi mit prägnantem Charaktertenor. Das Stammensemble des Opernhauses glänzt in den Nebenrollen. Iain McNeil begeistert als zynisch-brutaler Polizeichef mit seinem kernigen, saftigen Bariton. Zanda Svede gibt Katerinas Nebenbuhlerin Sonjetka mit ihrem satten Mezzosopran die passende Prise Verruchtheit. Alfred Reiter als Pope und Peter Marsh als betrunkener Landstreicher können einmal mehr ihre Buffo-Qualitäten ausspielen. Sie sorgen für die wenigen komödiantischen Momente der Inszenierung.

von oben: Anja Kampe (Katerina Ismailowa) sowie unten v.r.n.l. Dmitry Belosselskiy (Boris Ismailow), Dmitry Golovnin (Sergei) und Ensemble
Obwohl nämlich der Komponist sein Stück eine „tragische Satire“ genannt hat, haben Regisseur Anselm Weber und sein Ausstatter Kaspar Glarner den satirischen Charakter fast vollständig eliminiert und zeichnen schlicht und ernst die Tragödie einer vereinsamten Frau in einer trostlos-brutalen Welt. Das Einheitsbühnenbild zeigt das Innere eines fensterlosen, bunkerartigen Rundbaus in tristem Grau. In der Mitte wird zu passenden Gelegenheiten eine Art Kapsel heruntergelassen, welche als Schlafzimmer dient. Katerina entflieht dieser Ödnis immer wieder mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille. Was sie dort sieht, wird an die Wände des Bunkers projiziert. Es sind bunte Blüten, die in psychedelischen Farbexplosionen sekundenschnell aufblühen und wieder vergehen. Mit den auch schauspielerisch sehr engagierten Sängern gelingt dem Regisseur eine plastische Belebung der äußeren Handlung. Anja Kampe und Dmitry Belosselskij überzeugen besonders durch die auch mimisch eindringliche Gestaltung ihrer wichtigen Monologe. Wollte man es freundlich ausdrücken, könnte man sagen, der Regisseur inszeniere handwerklich sauber am Libretto entlang. Unfreundlich gesagt, inszeniert er damit aber über weite Strecken an der Musik vorbei. All das Groteske, Komische, Schrille, Parodistische, was da in größter Farbigkeit auf den Punkt genau aus dem Orchestergraben tönt, findet auf der Bühne kaum eine Entsprechung. Schostakowitschs beißender Humor bleibt dem Regieteam fremd, genauso wie es mit den durchgehend präsenten Tanzrhythmen wenig anzufangen weiß. Auch daß es eine eigene Blaskapelle als Bühnenmusik gibt, bemerkt der Zuschauer erst, als sich die Blechbläsertruppe beim Schlußapplaus auf der Bühne verbeugt. Zu sehen war von ihr drei Stunden lang nichts. Dieser besondere Effekt eines separaten Orchesters auf der Bühne wird von der Regie verschenkt.

Anja Kampe (Katerina Ismailowa; vorne liegend), Barbara Zechmeister (Zwangsarbeiterin; rechts davon stehend) und Ensemble
Dafür ist die Inszenierung da stark, wo das Stück sein satirisches Kleid ablegt und zur reinen Tragödie wird: Im Schlußbild, dem Zwischenhalt auf dem Weg ins Straflager, kommen endlich Bühne und Musik zusammen. Schostakowitsch hat hier die Möglichkeit geschaffen, Mitleid mit der Mörderin Katerina zu empfinden. Nun entfaltet auch die kalte Tristesse des Bühnenbildes ihre adäquate Wirkung. Durch einen durchaus nicht neuen, einfachen Effekt erreicht die Regie schließlich große Wirkung: Die Mitglieder des Chores kommen in versprengten Gruppen durch die Türen des Parketts und des ersten Ranges in den Zuschauerraum und singen in bewundernswerter Homogenität den abschließenden Klagegesang. Der Klang umhüllt das Publikum leise und eindringlich. Ein emotional packendes Ende.
So ist in Frankfurt eine musikalisch beglückende Produktion zu erleben, welche szenisch einige Wünsche offen läßt.
Michael Demel, 6. November 2019
© der Bilder: Barbara Aumüller
MANON LESCAUT
Bericht von der Premiere am 6. Oktober 2019
Psychologische Tiefenzeichnung mit musikalischen Glanzlichtern
Trailer
Am Ende gibt es einen einsamen Liebestod, den das Libretto in einer Wüste „nahe New Orleans“ verortet. Die aktuelle Frankfurter Produktion von Puccinis Manon Lescaut tut gut daran, diesen Ort so unbestimmt wie abstrakt zu zeichnen. Lediglich eine Skulptur ist auf der leeren Bühne zu sehen: Meterhohe, dreidimensionale Lettern in Waschbetonoptik zeigen das Wort „Love“, zunächst spiegelverkehrt, im Laufe dieses kurzen Schlußaktes durch langsame, kaum merkliche Drehung dann schließlich in richtiger Buchstabenreihenfolge. Die Skulptur wird von der Seite angeleuchtet und wirft seinen gewaltigen, kalten Schatten in eine öde Welt. Dieses Monument der Liebe war vom ersten Akt an präsent. Zunächst hielt es sich im Hintergrund und stützte das Vordach eines Hotels, dann bildete es rot angeleuchtet die Rückfront einer Tabledance-Bar, um dann schließlich freigelegt und isoliert die Trostlosigkeit des Endes zu durchmessen. Gegen diese erstarrte Ödnis glüht aus dem Orchestergraben das Orchester an, tremoliert, bäumt sich auf, während die Titelfigur auf der Bühne in den Armen ihres verzweifelten Geliebten an Erschöpfung stirbt.

Die äußere Leere des Schlußbildes entspricht der inneren Leere der Titelfigur. Zu Beginn wird sie dem Publikum in einer Filmeinspielung als Flüchtling gezeigt, der über einen Grenzzaun illegal einwandert. Wer nun befürchtet hatte, Regisseur Àlex Ollé und sein Team würden nun in schlechter Regisseurstheatertradition eine Oper als Folie für platte politische Botschaften nutzen, sieht sich angenehm überrascht. Der Regisseur nutzt lediglich vordergründig die Chiffren einer sich für engagiert haltenden Inszenierungsmasche und macht damit etwas Erstaunliches: Er formt mit der außerordentlichen Asmik Grigorian in der Titelpartie das tiefenscharfe Porträt einer schillernden Opernfigur. Man sieht in Einspielfilmen, wie die illegal eingewanderte Manon triste Sklavenarbeit in einer Näherei verrichtet, sieht ihren leeren Blick während einer Busfahrt, mit der ihr Bruder sie zurück nach Hause holen will. Dieser jungen Frau ist früh im Leben jede Hoffnung ausgetrieben worden. Man begreift, daß sie zur dauerhaften Beziehung mit dem für sie in Leidenschaft entbrannten Les Grieux nicht fähig ist, erkennt die trostlose Konsequenz, mit der sie sich an den alten Geronte de Ravoir verkauft. Asmik Grigorian ist die ideale Darstellerin für diesen ungeschönten Blick auf eine vielschichtige Figur, die nicht zur Sympathieträgerin taugt. Was diesen Abend dabei zum außerordentlichen Musiktheaterereignis erhebt, ist die völlige Verschmelzung von stimmlichen und darstellerischen Mitteln. Grigorian verfügt über eine der attraktivsten Sopranstimmen im gegenwärtigen Musiktheatergeschäft, technisch makellos, mit der Fähigkeit zu blühender Leuchtkraft und expressiver Eindringlichkeit. Ihre Manon beginnt stimmlich als rotziges Girlie mit aufgesetztem Selbstbewußtsein, weiß mit Männern kokett zu spielen, zeigt im zweiten Akt als Edelprostituierte einen Ton von kalter Selbstgefälligkeit und entwickelt erst am Ende die glühende Emphase der Verzweiflung.

Den armen Tropf Les Grieux, den seine bedingungslose Leidenschaft für diesen schwierigen Charakter ins Verderben stürzt, gibt Joshua Guerrero in einem Rollendebüt als Muster eines Puccinitenors. Der junge Amerikaner verfügt über eine saftige Stimme mit virilem Kern. Zu Beginn scheint er noch nach dem richtigen Ton im operettenhaften ersten Akt zu suchen, zeigt sich dann aber den Anforderungen dieser mit sechs Solonummern umfangreichsten Tenorpartie Puccinis glänzend gewachsen. Die Verismo-typischen angeschluchzten Töne setzt er sparsam und dezent ein. Das Publikum belohnt seinen Einsatz mit Ovationen, die nicht hinter denen für Grigorian zurückstehen.
Dieses Puccini-Traumpaar ist in ein fabelhaftes Ensemble eingebettet. Iurii Samoilov darf seinen cremigen Bariton als Bruder Lescaut zwar nur an wenigen exponierten Stellen vorführen, macht dabei aber wie immer Eindruck. Donato Di Stefano verfügt nach mehreren Jahrzehnten Bühneneinsatzes immer noch über einen eleganten Baß, den er dazu nutzt, den von ihm mimisch mit sichtbarer Spielfreude als schmierigen Zuhälter gezeichneten Geronte stimmlich nicht zur Karikatur verkommen zu lassen. In den übrigen Nebenrollen bewährt sich die vorzügliche Frankfurter Stammbesetzung.

Große Freude bereitet das Dirigat von Lorenzo Viotti, der mit dem glänzend aufgelegten Orchester die Partitur so transparent und farbig entfaltet, daß man dieses Stilamalgam des noch experimentierfreudigen jungen Puccini mit großem Staunen als frühes Meisterwerk erkennt.
Nach der vom Publikum enthusiastisch gefeierten Premiere waren die Folgevorstellungen in wenigen Tagen ausverkauft. Wer sich jetzt noch für einen Besuch der Produktion entscheidet, muß auf Restkarten an der Abendkasse hoffen.
12. Oktober 2019, Michael Demel
© Bilder: Barbara Aumüller
MANON LESCAUT
Pr 06.10.2019
Die Figur der Manon, welche Antoine-François Abbé Prévost d’Exiles in seinen Roman Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut 1731 erschuf, weist zeitlose Züge auf, denn das Streben nach Glück ist in uns allen allgegenwärtig, gehört quasi zur Erbmasse des Menschen. Àlex Ollé, der Regisseur und einer der sechs künstlerischen Leiter des katalanischen Theaterkollektivs La fura dels baus, hat deshalb die Oper Puccinis auf deren Aussagekraft für die Gegenwart befragt und eine stringente, gegen Ende dann auch wirklich beklemmende Lösung gefunden. In einem kurzen Film vor dem Einsetzen der Musik zeigt er eine junge Frau, welche dabei ist, einen Drahtzaun (z.B. an der ungarischen Grenze) zu durchschneiden und illegal in ein (wohlhabenderes ...) Land einzureisen. Kurz sieht man auch, welchem Schicksal sie entflieht: Arbeit an der Nähmaschine, begrapscht vom Aufseher. Armut. Sie macht also das, was sogar die amerikanische Verfassung den Menschen garantiert: The pursuit of happiness. Wenn dann die Musik einsetzt, befinden wir uns im Fast Food Restaurant an einem Bahnhof, Menschen aller Hautfarben begegnen sich, ärmere, reichere, viele Studenten, gesündere und kränkere.

Manon kommt mit ihrem Bruder hier an, erregt Aufmerksamkeit in ihrem billigen Flittchenoutfit (Kostüme: Lluc Castells). Ihr Bruder ist mit dabei, auch er auf der Suche nach Glück (im Spiel). Bei ihm hat der Kostümbildner ebenfalls kein Klischee ausgelassen: Lederjacke, Trainingshose, Markensneakers. So, wie man sich Illegale aus dem Osten halt so vorstellt. Klischeehaft auch der reiche Geronte de Ravoir, fett, widerlich, Sonnenbrille, Glatze mit schwarzem Haarkranz, schlecht sitzender Anzug. Der Schnellimbiss ist überdeckt mit einer Kassettendecke, gestützt von riesigen Betonbuchstaben L O V E. Schnell verguckt sich der Student Des Grieux in Manon, mit Hilfe Edmondos klauen sie den Minivan und hauen zusammen ab Richtung Paris. Später dann finden wir Manon in einem Animierdamenclub, der Geronte gehört. Die offene Verwandlung der Bühne (Alfons Flores hat sie entworfen) ist ein Meisterstück. Die Kassettendecke senkt sich und darauf ist der gigantische Club aufgebaut, mit Treppen, Stangen für die Tänzerinnen, Bar. Und die ehemalige graue Betonpfeiler-Skulptur LOVE leuchtet nun in erotischem Rot. Zwar schleppt sich dieser Akt - trotz viel nackten Fleisches - etwas dahin, das ganze passt jedoch erstaunlich gut zur Musik und zum Text. Aus dem barocken Tanzmeister wird halt ein Instruktor für Stripdance. Manon hat sich also dem Clubbesitzer Geronte an den Hals geworfen – allein das Glück findet sie auch hier nicht, weil sie sich halt doch nach Liebe sehnt und sich erneut Des Grieux zuwendet. Die Gier, beides zu erhalten wird ihr zum Verhängnis, denn sie plündert noch die Clubkassen und wird verhaftet.

Doch dann nach der Pause kommen die beiden Hammerakte: Hier nun gewinnt die Inszenierung eine geradezu unheimliche Dichte. Manon ist in Ausschaffungshaft. Die Menschen sind in Gitterkäfige gesperrt, das erinnert von den Bildern her stark an Guantanmo. Als Überleitung zum Schlussakt sehen wir eine Wellenprojektion, die Fahrt übers Meer – Ausschaffung. Wenn dann das fahle Bühnenlicht angeht, ist die gigantische LOVE-Skulptur gespiegelt. Erschöpft stützen sich die beiden Liebenden an die Buchstaben und so wie die Musik immer stärker ausdünnt, so erlischt auch das Leben Manons. Sehr stark und unter die Haut gehend, gerade auch weil der Dirigent, Lorenzo Viotti, zusammen mit dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester die Modernität, das Impressionistische und Geschärfte in Puccinis Partitur herausstreicht und nicht das Süßlich-Süffisante. Der designierte Chefdirigent des Netherlands Philharmonic Orchestras und der Nationale Opera Amsterdam spürte Puccinis Klangvorstellungen mit feinfühliger Neugier nach und gestaltete eine sehr differenzierte Auslegung der Partitur.

Selbstverständlich braucht es für so eine Inszenierung die geeigneten Sängerdarsteller. Der Oper Frankfurt ist es gelungen, die Sängerin des Jahrs 2019 (Opernwelt), Asmik Grigorian, für die Titelrolle zu verpflichten, die vor einem Jahr als Salome bei den Salzburger Festspielen für Furore gesorgt hatte. So inszeniert scheint ihr auch Puccinis Manon auf den Leib UND in die Kehle geschrieben worden zu sein. Sie bewegt sich mit einer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit sowohl im billigen Outfit am Bahnhof, als auch bloß mit sexy Unterwäsche bekleidet im Club. Stimmlich vermag sie dabei mit leicht verruchtem (im besten Sinne) Timbre zu glänzen, bleibt den dramatischen, leidenschaftlichen Aufschwüngen, aber auch den verhaltenen, nach innen gewandten Passagen (Sola, perduta, abbandonata) nichts an Ausdruckskraft schuldig. Mit Joshua Guerrero hat sie einen jungen, blendend aussehenden Tenorpartner an ihrer Seite, der mit tenoralem Schmelz, Kraft und Leidenschaft, Ungestüm und Empathie restlos überzeugt, dem Bild des Latin Lovers total entspricht. Ganz grandios auch Iurii Samoilov mit schön gerundetem Bariton als leichtlebiger Lescaut, der sich so schnell und glaubhaft in die Halbwelt einfügt, dass man kaum glauben kann, dass er die Rolle nur spielt. Wunderbar schmierig agiert Donato Di Stefano als Geronte und begeistert mit profunden Bassqualitäten.

Michael Porter holt aus der Rolle des Edmondo das Maximum an Charakterzeichnung heraus und überzeugt mit seiner Bühnenpräsenz. Die kleineren Rollen sind ausgezeichnet und glaubhaft besetzt, so Bianca Andrews als Musiker, Santiago Sánchez als Laternenanzünder (hier eine Transe im Gitterkäfig) und Jaeil Kim als Tanzmeister. Ein Kompliment gebührt auch der Statisterie der Oper Frankfurt, welche den ersten drei Akte mit ihren vielfältigen Figuren pralles Leben verleiht. Verdienter und enthusiastischer Applaus des Premierenpublikums für alle Ausführenden und das Inszenierungsteam.
Fazit: Gelungene Aktualisierung des unsterblichen Stoffes, herausragende Protagonisten, exzeptionelles Dirigat.
(c) Barbara Aumüller
Kaspar Sannemann 7.10.2019
Zum Zweiten
Rossini: OTELLO
Bericht von der Premiere am 8. September 2019
Trailer
Fulminanter Saisonauftakt mit einer Belcanto-Rarität
In der Vorberichterstattung zur ersten Premiere der neuen Saison an der Oper Frankfurt war ein Hang zum Superlativ zu beobachten. Eine "Oper mit fünf Tenören" wollte die BILD-Zeitung als kleine Sensation verkaufen. Im aktuellen Produktionsvideo spricht der Intendant sogar von sechs Tenören. BILD hat trotzdem richtig gezählt: zwei (winzige) Nebenrollen wurden zusammengelegt und einem einzigen Sänger anvertraut. Nüchtern betrachtet kann man von immerhin drei tragenden Tenorpartien sprechen, was außergewöhnlich genug ist. Diese drei Partien sind in der Neuproduktion ausgezeichnet besetzt. Da ist zunächst Enea Scala in der Titelpartie. Gleich bei seinem ersten Einsatz trumpft er derart imponierend auf, daß man meint, er wolle sich mit Rossinis Otello gleich noch für die Titelpartie in Verdis gleichnamigem und erheblich populärerem Spätwerk bewerben. Virile Spintoqualitäten und ein raumgreifendes Volumen hinterlassen einen starken Eindruck. Die belcantotypischen akrobatischen Koloraturen und Auszierungen werden mit großem Aplomb serviert. Scala packt den Stier gleichsam bei den Hörnern und schleudert seine Töne unerschrocken in den Zuschauerraum.

Theo Lebow (Jago) und Enea Scala (Otello)
Rossini hat seinen Rivalen Rodrigo musikalisch ebenbürtig ausgestattet. Wenn der junge amerikanische Tenor Jack Swanson in dieser Partie zum ersten Mal die Bühne betritt, ahnt man noch nicht, daß dieser unscheinbare Collegeboy es locker mit dem Sänger der Titelpartie aufnehmen kann. Seine Stimme ist heller und klingt zunächst weniger individuell. Bei der ersten Arie jedoch läuft Swanson zu einer Form auf, daß einem der Mund offen stehen bleibt. Zu hören ist eine geradezu ideale Belcantostimme, leichtgängig, perfekt fokussiert, mit einer unfaßbaren Geläufigkeit und einem silbernen Timbre ausgestattet. Man greift kaum zu hoch, wenn man ihn mit den besten seines Faches, etwa Juan Diego Flórez, vergleicht und ihm eine glänzende internationale Karriere voraussagt. Zusammen mit dem dritten im Bunde, Theo Lebow als intriganter Jago, lösen sie ein Versprechen ein, welches Intendant Bernd Loebe bei der Vorstellung des neuen Spielplanes abgegeben hatte: Sie schleudern sich die Koloraturen um die Ohren, daß es eine Lust ist. Man freut sich für das Ensemblemitglied Lebow, daß er endlich einmal in einer tragenden Partie besetzt ist, die sein Potenzial ausschöpft. Seine Stimme verfügt über eine charakteristische edel-herbe Färbung, die in den üblichen lyrischen Tenorpartien nur unzureichend zur Geltung kommt. Daß er über eine ausgezeichnete Technik gerade für Koloraturen verfügt, weiß man seit seinem Einsatz in Mozarts frühem Oratorium Betulia liberata. In einer Schlüsselszene schmiegt sich seine Stimme derart perfekt an die vokalen Höhenflüge von Jack Swanson an, daß man das Ganze für ein Liebesduett zweier Männer halten könnte. Und prompt läßt der Regisseur die Arie mit einem Kuß der beiden Tenöre enden. Abgerundet wird diese Boygroup von der ausgezeichneten Mezzosopranistin Nino Machaizde in der Rolle der Desdemona. Hat man bei den ersten Tönen noch die Befürchtung, die Stimme könnte zu reif und zu fruchtig sein, wird man bald eines Besseren belehrt. Die Sängerin verfügt nicht nur über eine geläufige Gurgel, sondern auch über eine große Bandbreite an Zwischentönen. Wunderbar innig gerät ihr im dritten Akt das Lied von der Weide. In dieser Art der Darbietung möchte man Rossinis Version des Liedes der berühmteren Fassung von Verdi mindestens für ebenbürtig halten.

Jack Swanson (Rodrigo), Enea Scala (Otello) und Nino Machaidze (Desdemona)
Nach der ersten Talentprobe in Menottis Medium macht erneut Kelsey Lauritano mit ihrem samtig-warmen und dabei jugendlich-blühenden Mezzosopran in der kleinen Rolle der Emilia auf sich aufmerksam. Kaum zu glauben, daß sie gerade erst ins Opernstudio aufgenommen wurde. Diesem scheint sie bereits jetzt entwachsen zu sein. Thomas Faulkner überzeugt mit seinem wohlklingenden Baßbariton in der Rolle des Elmiro. Die beiden restlichen der fünf Tenöre sind rollenadäquat besetzt mit dem Charaktertenor Hans-Jürgen Lazar als greisenhaftem Doge und dem sanften lyrischen Tenor Michael Petrucceli als Lucio.
Gastdirigent Sesto Quatrini hat in einem Pressegespräch vor der Premiere tiefgestapelt, was die Rolle des Orchesters angeht. Zu hören ist unter seiner Leitung eine ausgefeilte Komposition mit interessanten Klangfarben und einer durchaus individuellen Textur. Das Opernorchester ist in guter Form und setzt die Partitur schwungvoll und mit geradezu vibrierender Lebendigkeit um. Ausgedehnte Orchestervorspiele geraten zu Glanzstücken mit delikaten Instrumentalsoli.
Die szenische Umsetzung dieser Rarität durch den jungen Regisseur Damiano Michieletto am Theater an der Wien im Jahr 2016 hatte Intendant Loebe derart überzeugt, daß er die Produktion kaufte und an die Bedingungen seines Hauses anpassen ließ. Zu diesem Einkauf kann man die Oper Frankfurt nur beglückwünschen. Sie paßt ausgezeichnet in das Portfolio eines Repertoires, das von Regisseuren wie Christof Loy und Claus Guth geprägt wird. Wie bei diesen zeichnen sich die Arbeiten des Italieners durch eine intelligente Durchdringung eines Stoffes, die Freilegung seines Kerns, sinnfällige optische Lösungen und eine ausgefeilte, psychologisch erhellende Personenregie aus. Dabei geht das hohe intellektuelle Niveau nie zulasten der Bühnenwirksamkeit.

Theo Lebow (Jago), Enea Scala (Otello; auf dem Tisch liegend), Kelsey Lauritano (Emilia), Jack Swanson (Rodrigo) und Thomas Faulkner (Elmiro Barberigo) sowie im Hintergrund Ensemble
In der vorliegenden Regiearbeit hat Michieletto mehrere Probleme der Vorlage umschifft. Da ist zunächst die banale Dramaturgie des Librettos, welches statt der spannenden Disposition von Shakespeares Tragödie bloß Eifersuchts-Dutzendware aus dem Librettisten-Baukasten des frühen 19. Jahrhunderts liefert. Der Regisseur korrigiert die Fehlentscheidung des Librettos, die Figur des Jago zu banalisieren, und reaktiviert das Urbild von Shakespeares diabolischem Intriganten und Strippenzieher. In Theo Lebow hat er dafür den idealen Darsteller gefunden, der durch sein intensives Spiel und eine enorme Bühnenpräsenz diesen Charakter zur Hauptrolle erhöht. Sodann nimmt der Regisseur eine leichte Transformation der Grundkonstellation vor. Aus dem Feldherrn Otello ist ein Geschäftsmann geworden, aus dem Farbigen ein arabischer Muslim. Damit entgeht der Regisseur der Peinlichkeit des Blackfacings, bei dem ein Weißer mit Schminke zum Farbigen gemacht werden muß. Letztlich geht es nämlich um kulturelles Außenseitertum. Da ist die Präsentation eines arabischen Muslims in einer westlichen Gesellschaft mindestens so plausibel wie die eines Mohren in Venedig. Raffiniert greift die Regie aber das Schwarzmachen am Ende des ersten Aktes auf, in dem auf einem Festbankett Otello sich zunächst mit einer braunen Masse die Kleidung beschmiert und schließlich auch die anwesende Festgesellschaft nach und nach besuldet wird, bis die Szene in einer regelrechten Schlammschlacht endet. Bis zur überraschenden Schlußwendung im letzten Akt (die hier nicht verraten werden soll) erzeugt der Regisseur eine nicht nachlassende Spannung, die diesen Abend auch zu einem szenischen Genuß macht.
Mit der Übernahme dieser glänzenden Produktion in einer fabelhaften Sängerbesetzung ist der Einstieg in die neue Saison fulminant gelungen.
Weitere Vorstellungen gibt es am 21. und 29. September sowie am 3., 12. und 20. Oktober.
Michael Demel, 15. September 2019
© der Bilder: Barbara Aumüller
Rossinis
OTELLO
08.09.2019 (Übernahme Wien TadW 2016)
Rossini und Shakespeare?
Geht das? Schnarrende Räderwerk-Musik zu tiefgründigem Drama? Es geht – und wie! Die Frankfurter Produktion von Rossinis opera seria ist der Hammer und beweist einmal mehr, wie wichtig es ist, Vorurteile immer wieder schnell über Bord zu werfen, Augen, Ohren und Geist unvoreingenommen zu öffnen. Sicher, Verdis späte Oper OTELLO ist ein unangefochtenes Meisterwerk, dank Boitos Libretto viel näher bei Shakespeare als Rossinis 1816 uraufgeführte Oper. Doch es gilt zu bedenken, dass Rossini zur Zeit der Komposition 24 Jahre alt war, am Laufband produzieren musste (deshalb übernahm er auch immer wieder Nummern und Passagen aus anderen Werken und fügte sie in neue Stücke ein, so z.B. ist die Ouvertüre zu OTELLO mit Passagen aus IL TURCO IN ITALIA und SIGISMONDO bestückt). Zudem waren Shakespears Werke zur damaligen Zeit einem breiteren Publikum nur in sehr stark veränderten Fassungen bekannt, auf die sich auch Rossinis Librettist Francesco Maria Berio berief. Verdi hingegen hatte zur Zeit der Komposition seines OTELLO keinerlei Druck mehr, hatte die Galeerenjahre weit hinter sich, war ein ausgesprochener Shakespeare Kenner und hatte mit Arrigo Boito einen ausgewiesenen Literaten (und Komponisten!) zur Seite. Somit sind die beiden Kompositionen dieser Giganten der italienischen Oper eigenständige Werke, die zwar den Titel gemeinsam haben, ansonsten aber nicht verglichen zu werden brauchen.

Der Regisseur Damiano Michieletto hatte Rossinis OTELLO im Bühnenbild von Paolo Fantin und mit den Kostümen von Carla Teti 2016 im Theater an der Wien vorgestellt und diese Produktion nun für die Oper Frankfurt neu einstudieren lassen (Marcin Lakomicki). Michieletto hat dabei den Text ganz genau untersucht und daraus auf sinnige Art eine leicht veränderte Figurenkonstellation geschaffen, welche während der Ouvertüre auf dem Gazevorhang präsentiert wird, während die Personen eine nach der anderen in den mit blassrosa Marmorwänden und mit Kristalllüster ausgestatteten Salon treten. Das hat ein bisschen was von einem Vorspann zu einer TV Serie à la Dynasty oder Dallas, zumal Michieletto aus dem Stoff ein familiäres Generationendrama (bei den Reichen und Mächtigen) gestaltet. Emilia (ganz hervorragend gesungen und gespielt von Kelsey Lauritano) ist nicht mehr die Freundin und Vertraute Desdemonas, sondern wird zur kleinen, fiesen und falsch spielenden Schwester – und tatsächlich gibt der Text das her!

Jago wird als verhaltensauffälliger (ADHS?) Cousin Rodrigos eingeführt, ein Außenseiter in dieser Business-Schickimicki-Gesellschaft, genau wie Otello, der hier als geschäftstüchtiger Muslim zwar von der Gesellschaft umworben, nicht aber geachtet wird. Somit haben wir also zwei Familienstränge (einige Szenen sind gar streng symmetrisch gespiegelt gestaltet!), in denen je ein Vater-Kind Konflikt aufbricht, nämlich auf der einen Seite der Doge (hier ein Minister im Rollstuhl) und sein Heulsusen-Sohn Rodrigo, auf der anderen Seite den reichen Industriellen Elmiro mit seinen beiden Töchtern Desdemona und Emilia. Desdemona ist die Träumerin, die von der großen Liebe schwärmt (mehr davon später) und Emilia eben die selbstbezogene, ambitionierte, hinterfotzige Speichelleckerin. Dazu die beiden Außenseiter Otello und Jago, welche ihren Platz in diesen Familien nicht finden können (dürfen). Das alles setzt Michieletto mit bezwingender Subtilität und gekonnter Personenführung um, die Handlung wirkt glaubhaft, vom Anfang bis zum Schluss spannend, was auch daran zu spüren war, dass das Publikum mit größter Konzentration (und Ruhe!!!) dem Geschehen auf der Bühne folgte!

Zur stimmigen Umsetzung dieses Regieansatzes benötigt man natürlich exzellente Sängerdarsteller*innen – und die standen hier an der Oper Frankfurt wahrhaftig zur Verfügung. Rossini hat es ja den heutigen Intendanten mit seinen Besetzungsanforderungen wahrlich nicht leicht gemacht, denn welches Theater kann schon mal auf Anhieb drei Tenöre für die musikalisch anspruchsvollen Rollen des Otello, des Rodrigo und des Jago aufbieten? Dazu fordert Rossini noch zwei Tenöre für den Dogen und den Lucio/Gondoliere. Die Besetzung all dieser Partien in Frankfurt lässt mehr als aufhorchen: Enea Scala gestaltet die Titelrolle großartig. Sein geschmeidiger Tenor überwindet alle Klippen, ist von der Mittellage an abwärts wie gefordert baritonal gefärbt und verfügt aber auch über eine unbelastete, mühelose Höhe. Dazu kommt sein erfrischendes Spiel, man nimmt ihm den etwas naiven Muslim und Strahlemann, der er zu Beginn ist, ab. Dabei zeichnet Michieletto ihn nicht nur als Gutmenschen, der den Fremdenhassern ins Messer läuft. Auch Otello wird übergriffig, wenn er Desdemona einfach so mal das Kopftuch aufzwingt, was natürlich die westliche Gesellschaft zu Recht erbosen lässt. Theo Lebow macht aus dem Jago eine gekonnte Persönlichkeitsstudie eines verhaltensauffälligen Kindes, das nie seinen Platz in der Gesellschaft finden wird und deshalb zu ganz fiesen Mitteln greift, stets auf der Suche nach Opfern, die er noch mehr demütigen kann, als er selbst wohl in seinem Leben gedemütigt worden war. Überwältigend gemacht ist das Finale I, wo Jago den Otello sinnbildich mit der schwarzen Farbe des Misstrauens infiziert. Diese Farbe (oder ist es das berüchtigte Schwarze Gold, welches man sich von Otello verspricht und um das sich nun alle gierige blagen?) breitet sich dann nach und nach über sämtliche Anwesenden auf der Bühne aus, alle beschmieren sich gegenseitig, baden quasi im verheissungsvollen Öl und kündigen so den unheilvollen Verlauf der Akte II und III an. Im zweiten Akt lernt man dann endlich auch den dritten Tenor näher kennen, den Rodrigo. Schon im ersten Akt ließ ein a parte gesungener Einwurf aufhorchen. In seiner großen Szene im zweiten Akt dann wurde dieser Eindruck bestätigt: Welch ein fantastischer Tenore di grazia, eine Anmut, eine Biegsamkeit und eine stupende Höhensicherheit gepaart mit weicher Linienführung, Eleganz in Phrasierung und jugendlichem Aplomb. Brillant setzt er Koloraturenketten, setzt subtile Fiorituren ein, alles kontrolliert, nie exaltiert: Zum Niederknien, diesen Jack Swanson gilt es im Auge und im Ohr zu behalten!!! Hier in diesem zweiten Akt kommt es zu einem wahren Festival der Tenöre, wenn Jago und Rodrigo aufeinandertreffen und sich später dann Rodrigo und Otello die hohen Töne nur so um die Ohren schmeißen. Klasse, das ist Oper, deshalb lieben wir sie doch so!

Eine ganz große schauspielerische Leistung vollbringt der vierte Tenor, Hans-Jürgen Lazar, als an den Rollstuhl gefesselter Doge. Trotz oder gerade wegen seiner Behinderung strahlt dieser Doge von Herrn Lazar eine enorme Bühnenpräsenz und Autorität aus, auch wenn niemand seinen Herzanfall im Finale I beachtet. Die andere Vaterfigur, Elmiro, wird von Thomas Faulkner mit sauber geführtem, wohlklingendem Bass gesungen. Zwar ein Unsympath, wie er seine Tochter Desdemona behandelt und Emilia bevorzugt, doch mit balsamischer Stimme ausgestattet.
Die vorgesehene Sängerin der Desdemona musste leider die ersten vier Vorstellungen krankheitsbedingt absagen. Eingesprungen ist keine geringere als Starsopranistin Nino Machaidze. Die Georgierin sang die Partie bereits 2016 im Theater an der Wien. Sie verfügt über eine hoch interessant gefärbte, ausdrucksstarke Stimme und ist natürlich für die Rolle dieser sich in Träume und Visionen flüchtende Desdemona eine umwerfende Idealbesetzung. An der Wand im Vorzimmer zum Salon hängt ja in dieser Inszenierung das Gemälde von Gaetano Previati Der Tod von Paolo und Francesca, welches die Episode über Francesca da Rimini aus Dantes Göttlicher Komödie illustriert, wo die beiden Liebenden Francesca und Paolo vom Schwert des Ehemannes der Francesca, Malatesta, gemeinsam durchbohrt werden. Desdemona nun imaginiert immer wieder, dass die Figuren aus dem Bild lebendig werden, ihr zur Seit stehen oder sie ihr Schicksal teilen muss. Desdemona ist also hier eine Frau am Rande des Wahnsinns und der Depression dahinschrammend, unverstanden von Familie und Gesellschaft. So ist es am Ende nur folgerichtig, dass sie nicht dem eifersüchtigen Otello zum Opfer fällt, sondern sich selbst richtet. Davor aber singt sie noch das so traumhaft subtil intonierte Lied von der Weide (inspiriert vom schönen Gesang des Familienarztes Lucio alias Michael Petruccelli, dem fünften der exzellenten Tenöre, der ihr einen Medikamentencocktail überreicht).

Sesto Quatrini dirigiert einen farbenreichen, wunderbar austarierten Rossini, spritzig, aber auch melancholisch, mit federnden Tempi. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester glänzt mit herrlich sauberen und virtuosen Passagen in den Bläsern und kultiviertem Streicherklang. Der sehr eindrücklich singende Chor der Oper Frankfurt wurde von Carla Teti mit den üblichen dunklen Businessanzügen für die Männer eingekleidet, aber bei den Kostümen für die Damen durfte die Kostümdesignerin dafür die Augen des Publikums mit eleganten, fantasie- und geschmackvoll konzipierten Kleidern belohnen.
Wenn man bei Rossinis Werk eine Schwachstelle erwähnen müsste, dann wäre es der Schluss. Das wird irgendwie alles zu schnell und zu oberflächlich abgehandelt, wie wenn Rossini keine Zeit mehr gehabt hätte, um das genauer auszuführen. Michieletto hat verdienstvollerweise wenigstens versucht, durch den Suizid Desdemonas dem Ganzen eine interessante und schlüssige Wendung zu geben.
Fazit: Spannend, intelligent, fantastische Sänger = HINGEHEN!!!
Kaspar Sannemann 12.9.2019
(c) Barbara Aumüller
KRÓL ROGER
Bericht von den Aufführungen am 9. und 15. Juni 2019
(Premiere: 2. Juni 2019)
Klang und Rausch
Trailer
Am Anfang steht der pure Klang. Der eiserne Vorhang ist noch heruntergelassen und verdeckt auch den Orchestergraben. Kaum hört man, wie sich die Instrumente dahinter einstimmen. Dann verlischt das Saallicht. In völliger Dunkelheit vernimmt man hinter dem Vorhang einen Gongschlag. Der Chor setzt von Ferne ein. Noch ist auch die Übertitelanlage verborgen, so daß man den Sinn der in einer fremden Sprache gesungenen Worte nicht erfassen kann. Es sind jedenfalls Klänge aus der orthodoxen Liturgie, die nun mit ihrem erhabenen Ernst und ihrer strengen Schönheit den Raum erfüllen. Ein ungemein starker Beginn.
Die Faszination des Klanges wird auch den restlichen Abend über die Aufführung bestimmen. Karol Szymanowski hatte in seiner Partitur spätestromantisch und hochexpressiv die großen musikalischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts aufgenommen, mit Orientalismen gewürzt und zu einer charakteristischen eigenen Klangsprache geformt. Sylvain Cambreling, der vor über 20 Jahren im Zorn aus seinem Amt als Frankfurter Generalmusikdirektor geschiedene Dirigent, ist für den Król Roger erstmals wieder an das Pult des Opernorchesters zurückgekehrt, und es ist eine triumphale Rückkehr geworden. Die komplexe Partitur wird mit dem ganzen Reichtum ihrer Klangfarben nuanciert aufgefächert, zugleich wird ihre Sinnlichkeit entfaltet. Cambreling läßt das ausgezeichnet vorbereitete Orchester funkeln und rauschen, daß es eine Lust ist. Der stark geforderte Chor fügt sich machtvoll ein.

vorne v.l.n.r. AJ Glueckert (Edrisi), Alfred Reiter (Der Erzbischof), Łukasz Goliński (König Roger), Judita Nagyová (Die Diakonissin) und Sydney Mancasola (Roxana; in der Hocke) sowie im Hintergrund Ensemble
Dem Klangrausch setzt das Inszenierungsteam visuelle Klarheit und Strenge entgegen. Das Bühnenbild von Johannes Leiacker ist maximal abstrakt. Es zeigt eine den Bühnenboden bedeckende weiße Plattform, an die sich spitzwinklig eine ebenso weiße Rückfront anschließt, die sich weit nach oben erstreckt. In der Mitte klafft ein dunkler Spalt. Nichts erinnert im ersten Akt an die im Libretto vorgesehene „byzantinische Kirche", nichts an den „Innenhof des Königspalasts" im zweiten Akt und nichts an die „Ruine eines antiken Theaters" als Handlungsort des dritten Aktes. Regisseur Johannes Erath geht es ersichtlich nicht um die Illustration des Geschehensablaufs, sondern um die Visualisierung einer inneren Entwicklung der Titelfigur. Wenn der Vorhang sich nach dem Beginn in Dunkelheit schließlich hebt, sieht man einen verzweifelt mit sich ringenden König inmitten einer Volksmenge. Seine Beziehung zur Gattin Roxana scheint ebenso gestört zu sein, wie sein Verhältnis zu den ihn umgebenden Untertanen und der in Gestalt eines Erzbischofs und einer Diakonissin präsenten Kirche. Das Erscheinen eines mysteriösen Hirten, der Volk und Gattin mit der Verlockung von Freiheit und Lust verführt, löst in ihm einen quälenden Entwicklungsprozeß aus, der am Ende in Hinwendung zu einem apollinischen Sonnenkult mündet, dessen abstrakte Reinheit im Kontrast zur triebhaften Lust steht, die der Hirte verkörpert.

Filip Niewiadomski (Kind) und Gerard Schneider (Der Hirte) sowie Ensemble
So sehr sich der Regisseur von einer Handlung im eigentlichen Sinne entfernt, so plastisch zeichnet er das Eindringen des Fremden in eine Welt erdrückender Erstarrung. Während das Volk streng in schwarz gekleidet ist, erscheint der Hirte in einem luftigen weißen Leinenanzug. Gerard Schneider erweist sich als ideale Verkörperung des ebenso attraktiven wie unheimlichen Verführers. Sein Lächeln hat etwa gefährlich Gleisnerisches. Mit unter dem weit aufgeknöpften Hemd ausgestellter Brust demonstriert er virile Potenz. Geradezu lasziv wirkt es, wenn er genüßlich seine Beine mit den nackten Füßen räkelt. Seine jugendlich-blühende Stimme setzt er dazu verschwenderisch ein, ja man kann sagen: hemmungslos. Dieses leidenschaftliche Sich-Verströmen ist faszinierend anzuhören. Gleichwohl fragt man sich, ob das attraktive Stimmmaterial durch ein solches Singen unter Dauerhochdruck nicht beschädigt werden könnte. Schon jetzt ist bei wenigen exponierten Tönen zu merken, daß ihre Höhe nur mit zusätzlicher Kraftanstrengung bewältigt wird. Das war aufmerksamen Hörern schon vor einigen Monaten bei Schneiders Rudolfo in der Bohème an der Komischen Oper Berlin aufgefallen.
Die Titelrolle könnte man nicht besser besetzen als mit Łukasz Goliński. Er verfügt über einen kernigen Bariton mit unangestrengter Höhe und vermag es, seine Erfahrung mit dieser Partie zu differenzierter Gestaltung umzusetzen. Es ist keine geringe Aufgabe, den Regieansatz von der Zerrissenheit und inneren Entwicklung des sizilianischen Herrschers stimmschauspielerisch zu beglaubigen. Goliński gelingt das glänzend. AJ Glueckert ist ihm als sein Berater Edrisi mit charaktervollem Tenor ein ebenbürtiger Partner.

v.l.n.r. Alfred Reiter (Der Erzbischof; zur Wand gedreht), AJ Glueckert (Edrisi; vorne sitzend), Łukasz Goliński (König Roger), Sydney Mancasola (Roxana), Judita Nagyová (Die Diakonissin; zur Wand gedreht), Filip Niewiadomski
Sehr wirkungsvoll bringt Sidney Mancasola als Roxana ihren lyrischen Sopran in den orientalischen Melismen zur Geltung, mit denen der Komponist ihre Partie reichlich ausgestattet hat. Mit einem Schlaflied darf sie die einzige echte Arie der Oper singen, ein Stück, das Szymanowski für die isolierte Aufführung später sogar mit einem Konzertschluß versehen hat und das im innigen Vortrag durch Mancasola nicht seine Wirkung verfehlt. Alfred Reiter als knorriger Erzbischof und Juditha Nagiová als sonore Diakonissin runden das vorzügliche Ensemble ab.
Nach dem faszinierend opulent musizierten Fernen Klang hat das Orchester mit der ausgezeichneten Sängerbesetzung die Schraube des Klangrausches noch eine Windung weiter gedreht. In den beiden vom Kritiker besuchten Aufführungen war das Publikum derart in den Bann der Musik geraten und gleichsam narkotisiert worden, daß es nach dem abrupten Schlußakkord einige Sekunden benötigte, um zu erfassen, daß es tatsächlich vorbei war. Dann erst setzte zögerlich der Applaus ein, der sich schnell zu allgemeinem Jubel steigerte.
Weitere Vorstellungen gibt es am 19., 22., 27. und 29. Juni.
17.06.2019 Michael Demel
© der Bilder: Monika Rittershaus
Georg Friedrich Händel
RODELINDA, REGINA DE‘ LONGOBARDI
Bericht von der Premiere am 12. Mai 2019
Trailer
Von Monstern und Menschen
Die meisten großen Künstler haben einen unverwechselbaren Stil. Man hört wenige Takte und weiß: das ist Mozart, man sieht ein Porträt und weiß: das ist Picasso. Und wenn man es banal formulieren möchte, dann ist der Kern eines Stils die Wiederholung von Formen, Motiven und Techniken. So ist es auch möglich, daß andere „im Stile von“ komponieren oder malen. Die in einem bestimmten Stil gehaltenen Werke haben dadurch im Hinblick auf Grundparameter immer auch ein Moment von Vorhersagbarkeit. Wenn man nun also auf dem Besetzungszettel liest, daß zur von der Oper Frankfurt koproduzierten Rodelinda Claus Guth die Inszenierung besorgt und Christian Schmidt Bühnenbild samt Kostümen entworfen hat, dann lassen sich sichere Vorhersagen treffen: Im Bühnenbild wird eine Treppe einen zentralen Raum einnehmen, der Baustil wird klassizistisch anmuten, die beherrschenden Grundfarben werden weiß oder Pastelltöne sein. Außerdem wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens eine stumme Rolle geben, die dem Geschehen ein zweite Erzählebene oder einen doppelten Boden verleiht. Womöglich werden auch einzelne Figuren vervielfacht werden. So ist es nun in der aktuellen Neuproduktion gekommen. Und trotzdem ist, was große Künstler eben auszeichnet, ein Unikat zu bestaunen. Die bewährten Stilelemente werden reflektiert und punktgenau dem neuen Stoff angepaßt, variiert, erweitert. Es gibt Wiedererkennungseffekte, aber auch Überraschungen. Tatsächlich ist nämlich die Anwendung des bewährten Handwerkszeugs keineswegs im Detail vorhersagbar.
Es gibt also wieder ein Schmidt-typisches Herrenhaus mit zwei Geschossen, welches an drei Seiten aufgeschnitten ist, wodurch sich eine Vielzahl von Zimmern bespielen läßt. Und selbstverständlich gibt es eine auslandende Treppe, die vom Erdgeschoß in das obere Stockwerk führt. Dieses Mal läßt sich das Haus einmal um die eigene Achse drehen. So ergeben sich immer wieder neue Raumeindrücke. Ganz nebenbei ist das Drehen auch ein beliebtes und wirksames Mittel, den Eindruck von Statik zu vermeiden.

Daß zumindest die Außenfassade den „Georgianischen Baustil“ des 18. Jahrhunderts zitiert, erfährt man aus dem Programmheft. Einige Kritikerkollegen haben das naseweis abgeschrieben und ihren Lesern ohne Quellenangabe unter Vortäuschung eigener Kennerschaft präsentiert. Daß der Bühnenbildner sein Stilvorbild in einem Interview mit dem Frankfurter Hausdramaturgen überhaupt erwähnt, zeigt aber, wie genau und reflektiert er vorgeht. Es ist dabei gar nicht entscheidend, ob diese bauhistorische Einordnung erkennbar ist. Es teilt sich dem Opernbesucher nämlich stets unbewußt mit, wenn selbst in Details keine Willkür waltet.
Die Guth-typische stumme Figur mußte der Regisseur dieses Mal nicht hinzuerfinden. Im Libretto ist von ihr immer wieder die Rede: Es ist Flavio, der halbwüchsige Sohn des Herrscherpaares Bertarido und Rodelinda. Dieses Kind mußte erleben, wie sein Vater in einem Streit um die langobardische Königsherrschaft den eigenen Bruder tötete, floh, dabei Frau und Kind zurückließ, wo sie nun einem Usurpator, Herzog Grimoaldo, ausgesetzt sind, der den Thron an sich gerissen hat und Rodelinda Avancen macht. Bertarido läßt sich für tot erklären, kehrt jedoch heimlich zurück, um Frau und Sohn zu retten, wird entdeckt, eingekerkert und erneut fälschlich für tot erklärt. Der Regisseur stellt sich nun die Frage, was diese aufwühlenden Ereignisse wohl in einer Kinderseele bewirken. Und so erleben wir als zentrale Figur den kleinen Flavio, stumm und verängstigt, wie er seine Erlebnisse in Kinderzeichnungen zu Papier kritzelt. Seine wilden Skizzen werden auf das Mauerwerk projiziert. So zeigt sich, daß er alle Erwachsenen um ihn herum als Monster sieht, übergroß und bedrohlich, mit zu Fratzen verzerrten Gesichtern. Schlimmer noch: Diese Monster nehmen Gestalt an und spuken durch das Haus. Natürlich kann nur er sie wahrnehmen.

Flavio bewegt sich in dieser Welt der Erwachsenen, deren Handeln er nicht versteht, und der Monster, die ihn bedrohen, wie in einer alptraumhaften Choreographie. Diese Choreographie ist derart ausgefeilt und nuanciert, daß ein Kind als Darsteller damit überfordert wäre. Claus Guth hat mit dem kleinwüchsigen Schauspieler Fabián Augusto Gómez Bohórquez den idealen Darsteller dafür gefunden. Äußerlich erscheint er als Kind, zumal aus der Entfernung eines Zuschauerraumes, verfügt aber über das mimische Repertoire und die Souveränität eines Erwachsenen. Tatsächlich ist die Inszenierung derart stark auf ihn fokussiert, daß die singenden Protagonisten gelegentlich zu szenischen Randerscheinungen werden. Dabei führt der Regisseur sein Personal in bewährter Weise lebendig und glaubwürdig durch das verwickelte Bühnengeschehen.
Die Titelfigur wird von Lucy Crowe gesungen, welche die Partie bereits aus der Aufführungsserie dieser Produktion am Teatro Real Madrid kennt. Zu erleben ist ein tadellos durchgeformter lyrischer Sopran mit souveräner Koloratursicherheit. Ihre Rollengestaltung ist reflektiert und differenziert. Sie verfügt über ein breites Spektrum an Klangfarben, mit dem sie Trauer und Verzweiflung ebenso musikalisch beglaubigen kann wie Zorn und Entschlossenheit.

Lucy Crowe (Rodelinda)
Ihren totgeglaubten Gatten Bertarido gibt der arrivierte Countertenor Andreas Scholl. Seiner sehr weichen, sanften Stimme kommt es entgegen, daß Händel die Figur musikalisch als Anti-Helden gezeichnet hat, der sich mit einer getragenen und melancholischen Arie einführt. Weniger überzeugen kann Scholl in Momenten, in denen er Aufgewühltheit oder Entschlossenheit musikalisch vermittelt muß. Da fehlt es ihm dann doch an Kernigkeit und auch an Volumen. Traumhaft schön gerät dann wieder sein Duett mit Lucy Crowe am Ende des zweiten Aktes, in dem die beiden Stimmen sich umschmiegen und schließlich zu einer Einheit verschmelzen. Es ist einer der musikalischen Höhepunkte des Abends.
Der zweite Countertenor der aktuellen Besetzung, Jakub Józef Orliński in der Rolle des Dieners Unulfo, ist seit seinen fulminanten Auftritten als Rinaldo im Bockenheimer Depot der Liebling des Frankfurter Publikums. Seine Stimme ist im Vergleich zu Andreas Scholl weniger abgerundet, wirkt dafür aber frischer und markanter. Seine Doppelbegabung als athletischer Breakdancer kommt in dieser Inszenierung nicht zum Tragen (gegen Ende kann er es sich aber nicht verkneifen, unter dem Beifall des Publikums ein Rad zu schlagen). Dafür offenbart er großes komödiantisches Talent. Optisch erinnert seine Figur an den frühen Charlie Chaplin. Diese Vorgabe nutzt Orliński, um mimisch und gestisch auch dann präsent zu sein, wenn er gerade nichts zu singen hat.

Jakub Józef Orliński (Unulfo)
Als Usurpator Grimoaldo macht das ehemalige Frankfurter Ensemblemitglied Martin Mitterrutzner eine ausgezeichnete Figur. Sein heller und elegant geführter Tenor kommt fabelhaft mit Händels Koloraturen zurecht und hat mit den Jahren nun auch genügend Kraft und Volumen entwickelt, um einen großen Zuschauerraum zu füllen. Einen Bariton-Bösewicht wie aus dem Bilderbuch gibt Božidar Smiljanić als Intrigant Garibaldo, kernig und mit angemessener Schwärze. Abgerundet wird die ausgezeichnete Besetzung durch Katharina Magiera in der Rolle von Bertaridos Schwester Eduige, deren dunkel timbrierter Mezzo in einem reizvollen Kontrast zu den beiden hellstimmigen Countertenören steht.

v.l.n.r. Jakub Józef Orliński (Unulfo), Fabián Augusto Gómez Bohórquez (Flavio), Božidar Smiljanić (Garibaldo), Martin Mitterrutzner (Grimoaldo) und Statist der Oper Frankfurt (Wache) sowie oben Lucy Crowe (Rodelinda)
Nach langer Abwesenheit ist Barockspezialist Andrea Marcon zum Opernorchester zurückgekehrt, das er in gewohnter Weise vom Cembalo aus leitet. Die Frankfurter Musiker haben sich im Laufe der Jahre zu Spezialisten der historisch informierten Aufführungspraxis entwickelt. Insbesondere die Streicher können scheinbar mühelos von spätromantischer Üppigkeit bei Schreker und Wagner auf vibratoloses Spiel und beredte Phrasierung mit Barockbögen umsteigen. So ist ein lebendiger Barock-Sound zu hören, der bei bewegteren Stellen einen unwiderstehlichen rhythmischen Drive entwickeln kann. Zumindest im Parkett vermißt man aber gelegentlich die Intimität und klangliche Direktheit des Bockenheimer Depots, welches für Musik des 18. Jahrhunderts akustisch geeigneter erscheint. Allerdings haben Premierenbesucher aus den Rängen berichtet, daß insbesondere der Klang des Orchesters dort präsent und packend wahrzunehmen ist. Womöglich sollte, wer sich noch um einige der wenigen Restkarten in Folgevorstellungen bemühen will, das berücksichtigen.
Weitere Vorstellungen gibt es am 25. und 30. Mai sowie am 1. und 8. Juni.
Michael Demel, 22. Mai. 2019
© der Bilder: Monika Rittershaus
DER FERNE KLANG
Bericht von der Premiere am 31. März 2019
Trailer
Ein Himmel voller Harfen
Die Handlung dieser Oper ist schlicht: Zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, kommen nicht zusammen. Der eine, der Komponist Fritz, jagt der Idee eines fernen Klanges hinterher und läßt die ihn liebende Grete dafür links liegen. Diese will sich darob zunächst das Leben nehmen, überlegt es sich jedoch anders, verdingt sich zunächst als Edelkurtisane in Italien und steigt schließlich zur Straßendirne ab. Nach vielen Jahren findet das Paar wieder zueinander, doch es ist zu spät für ihre Liebe. Er ist krank, zu Tode erschöpft, gezeichnet vom Mißerfolg seines Opus magnum, der Oper Die Harfe. Das Wiedersehen wird zum Liebestod. Er stirbt in ihren Armen.

Ian Koziara (Fritz) und Jennifer Holloway (Grete Graumann)
Diese Rührgeschichte wäre nicht der Rede wert, wenn Franz Schreker sie in seinem selbst verfaßten Libretto zur Oper Der ferne Klang nicht mit den Ingredienzien eines symbolisch aufgeladenen Naturalismus getränkt hätte. Das gilt für den großen Rahmen – der mystische Klang ist eine Chiffre für die unerfüllte Liebe – wie für einzelne Szenen. So erlebt etwa am Ende des ersten Aufzugs Grete beim Versuch, sich in einem See zu ertränken, in einer überromantisch gezeichneten Waldszene mit Mondaufgang eine innere Verwandlung. Verstärkt und gesteigert wird diese das Stück prägende Überromantik durch einen in unendlich vielen Klangfarben schimmernden Orchesterrausch. Sebastian Weigle entfaltet diese Klangpracht mit seinem Orchester, wie man es von seinen Strauss-Interpretationen kennt: sehr differenziert, detailreich und gut ausgehört. Schrekers Harmonik mit angeschärfter Tonalität und ausgiebig genutzten Ganztonleitern kann wie schweres Parfüm wirken, das dem Zuhörer auf die Dauer den Atem nimmt. Bei Weigle jedoch wird dieses Parfüm gut dosiert und so zerstäubt, daß man seine Komplexität genießen kann. Zu hören ist eine kulinarisch-elegante Interpretation. Sängerfreundlich ist sie obendrein. So kann sich ein exzellentes Ensemble geradezu ideal entfalten. Insbesondere die Besetzung der beiden Hauptpartien mit zwei jungen US-Amerikanern darf man als sensationell bezeichnen.

Jennifer Holloway präsentiert in der Rolle der Grete einen jugendlich-dramatischen Sopran, wie wir ihn schon lange auf keiner Bühne mehr erlebt haben. Ihr kommt zugute, daß sie auch in Mezzo-Partien zu Hause ist und damit über eine samtig-cremige Mittellage verfügt. Daß eine Sängerin, die nebenbei auch als Rosenkavalier-Oktavian und Ariadne-Komponist gebucht wird, dazu noch über eine derart leuchtende Höhe verfügt, ist ein kleines Wunder. Man mag sich gar nicht satt hören an dieser ohne Schärfen und Brüche über den Orchestergraben flutenden Stimmpracht.
Eine Entdeckung ist auch ihr Landsmann Ian Koziara, der mit dem Fritz sein Europadebüt gibt. Sein lyrisch grundierter Tenor hat seine Basis ebenfalls in einer satten Mittellage. Er ist zu jugendlich-dramatischer Emphase fähig. Beeindruckend ist sein differenzierter Einsatz von genau auf den Text bezogenen Stimmfarben. Selbst die bei vielen Tenören so heikle Integration des Kopfregisters gelingt ihm mit unangestrengter Eleganz. Keine Frage, daß hier eine der größten Hoffnungen der letzten Jahre für das jugendlich-dramatische Fach seine überzeugende Visitenkarte abgegeben hat. Man darf ihm wünschen, daß er die Klugheit besitzt, sein Stimmmaterial nicht zu früh zu verschleißen.

Jennifer Holloway (Grete Graumann; auf dem Boden liegend) und Ensemble
In den vielen mittleren und kleinen Rollen bewähren sich wie üblich die Frankfurter Stammkräfte. So macht Gordon Bintner als Graf in einer ausgedehnten Ballade auf seinen eleganten Bariton aufmerksam. In guter Form und mit nuancierter Diktion präsentiert sich Dietrich Volle in der Rolle des Dr. Vigelius. Theo Lebow kann seinen hellen und höhensicheren Tenor als Chevalier zur Geltung bringen. Iurii Samoilov ist mit seinem saftigen Bariton eine Luxusbesetzung für die kleine Rolle des Schmierenschauspielers. Verheißungsvoll ist die erste Begegnung mit dem Baß Anthony Robin Schneider als Wirt, der ab der kommenden Spielzeit das Ensemble verstärken wird.
Das für die Szene verantwortliche Produktionsteam um Regisseur Damiano Michieletto hat die kluge Entscheidung getroffen, den musikalischen Farbenrausch optisch nicht zu verdoppeln. Das Bühnenbild (Paolo Fantin) ist schlicht, von transparenten weißen Schleiern gesäumt, die mal als Projektionsflächen dienen, mal reale oder surreale Hintergrundszenen durchscheinen lassen. Schon hierin findet die Flüchtigkeit von Klang eine visuelle Umsetzung. Verstärkt wird dies durch Projektionen abstrakter Gebilde, wie sie in Lehrfilmen zur Darstellung von Schallwellen gebraucht werden. Der See in der Waldszene wird durch sich ausbreitende konzentrische Kreise dargestellt. Zu diesem eher dekorativ-abstrakten Symbolismus kommen noch immer wieder von der Decke herabgelassene Musikinstrumente. Der Himmel hängt hier weniger voller sprichwörtlicher Geigen als voller Harfen.

Der Regisseur arrangiert in dieser Kulisse die Handlung recht ansehnlich und lebendig, erfindet dabei aber das Rad nicht neu. Verdopplung von Hauptfiguren, die in unterschiedlichen Altersstadien gezeigt werden, Traumsequenzen in Videofilmen, Surrealismus, Textprojektionen – es gibt kaum ein Werkzeug zeitgenössischen Musiktheaters, das ausgelassen wird. Was die Produktion aber von Regietheater-Dutzendware unterscheidet, ist ihre souveräne Unangestrengtheit im Einsatz dieser Mittel. Es gibt keine erhobenen Zeigefinger und keine Ausrufezeichen. Sparsam eingesetzte Texteinblendungen zu Beginn jedes Aufzugs dienen der Gliederung. Sie führen mit sanfter Poesie und der überzeugenden Metapher der Jahreszeiten durch das Leben des tragisch scheiternden Paares, vom verheißungsvollen Aufbruch im Frühling bis zum allmählichen Verlöschen im Winter. Im Kontrast zu den beiden vorangegangenen Frankfurter Premieren besticht der Inszenierungsansatz durch seine Werkimmanenz. Da wird keine Idee aufgepfropft oder die Substanz zu vorgeblicher (horribile dictu) politischer Tagesaktualität umgebogen.
Die sanfte Poesie der Szene balanciert die rauschhafte Üppigkeit des Klanges aus. So rundet sich der Abend zu einem überzeugenden Gesamtbild. Das Publikum zeigt sich begeistert.
Michael Demel, 4. April 2019
Bilder: Barbara Aumüller
Bedřich Smetana: DALIBOR
Bericht von der Premiere am 24. Februar 2019
Trailer
Irgendwas mit Medien
Das Resümee dieses Premierenabends kann man am besten mit einem Bonmot des Wiesbadener Intendanten Laufenberg zusammenfassen: „Danke, daß ich diese Oper erleben durfte. Jetzt weiß ich, warum sie nicht gespielt wird.“ Laufenberg hatte sich seinerzeit im Gespräch mit dem OPERNFREUND skeptisch zur Lebensfähigkeit sogenannter Ausgrabungen geäußert und seinen Ausspruch am Beispiel von Korngolds Wunder der Heliane verdeutlicht. Auch auf die jüngste Ausgrabung durch die Oper Frankfurt, Smetanas Dalibor, paßt er genau. Dabei ist das Bonmot bei näherer Betrachtung gar nicht so vernichtend, wie es auf den ersten Blick scheint. Es hat nämlich zwei Teile.
1. Danke, daß ich diese Oper erleben durfte
Nicht nur Smetana war der Meinung, daß es sich bei Dalibor um einen seiner besten Beiträge zum Musiktheater handelt, bedeutender jedenfalls als sein Erfolgsstück Die verkaufte Braut. Auch in der Musikwissenschaft wird die Qualität jedenfalls der Komposition mit Anerkennung behandelt. Ulrich Schreiber widmet ihr in seiner monumentalen Geschichte des Musiktheaters gleich mehrere Seiten. Im wie stets materialreichen Programmheft hat die Oper Frankfurt einen Beitrag des kürzlich verstorbenen Musikkritikers Hans-Klaus Jungheinrich veröffentlicht, in dem dieser überzeugend die Besonderheiten der Partitur herausarbeitet: ihre Anverwandlung von Wagners Leitmotivtechnik, die hier doch ihr eigenes Gepräge erhält, ihre genau kalkulierte Harmonik zwischen konstruierter Dreiklangs-Einfachheit und Tristan-Modernität. All das ist auch an diesem Premierenabend zu hören. Dafür steht das gut aufgelegte Orchester unter der Leitung von Altmeister Stefan Soltesz. Er sorgt für einen sehr feinen, schlackelosen und transparenten Klang, der einem Solistenensemble ohne Ausfälle gleichsam den roten Teppich ausbreitet. Dies ist ein außerordentlich sängerfreundliches Dirigat, welches es den Protagonisten erlaubt, in ihren fordernden Partien nie zu forcieren.

In der Titelrolle überzeugt Aleš Briscein. Er verfügt über einen hell timbrierten Tenor, der sehr ausgiebig das Kopfregister nutzt. Damit kann er ein beeindruckendes Volumen erreichen. Im Gegensatz zu anderen Sängern mit dieser Technik gelingt es Briscein jedoch, seinen hellen Tönen mit gut dosiertem Vibrato Farbe und Lebendigkeit zu verleihen. Wenn die Oper Frankfurt auf ihrer Homepage und im Programmheft auf Parallelen zu Wagners Lohengrin hinweist, so kann man sich jedenfalls Briscein auch gut als Wagners Schwanenritter vorstellen. Ein großartiges Hausdebüt legt Izabela Matuła in der weiblichen Hauptrolle der Milada hin. Zu hören ist ein sicher geführter jugendlich-dramatischer Sopran mit großer Leuchtkraft. Der musikalische Höhepunkt des Abends ist ihr gemeinsames Liebesduett mit Briscein im zweiten Akt. Die beiden machen nachvollziehbar, warum Ulrich Schreiber hier „tristaneske Ekstatik“ erkannt hatte. Als einzige weitere weibliche Solistin hebt sich Angela Vallone in der Rolle der Jitka mit frischem, jugendlich-leichtem Sopran von der dramatischeren Stimme der Matuła ab. Dazu fügt sich gut Theo Lebow als ihr Liebhaber Vitek mit seinem schlanken Tenor.

Izabela Matuła (Milada; in blauem Mantel), Thomas Faulkner (Beneš; auf dem Boden liegend) und Aleš Briscein (Dalibor; auf den Bildschirmen)
Die tiefen Männerstimmen sind rollendeckend und charakteristisch mit Frankfurter Eigengewächsen besetzt. Gordon Bintner zeichnet mit seinem saftigen Bariton einen jugendlichen König Vladislav. In ausgezeichneter Form präsentiert sich das ehemalige Ensemblemitglied Simon Bailey in der Rolle des Kanzlers Budivoj. Mit kerniger Stimme und präziser Diktion zieht er in seinen kurzen Einsätzen die Aufmerksamkeit auf sich. Einen fabelhaften Eindruck hinterläßt Thomas Faulkner als Gefängniswärter Beneš. Sein runder Baß hat seit der Übernahme vom Opernstudio ins Ensemble an Fülle und Sonorität gewonnen.
Smetana gönnt allen wichtigen Figuren mindestens einen großen Soloauftritt. Und alle Sänger des Abends wissen diese Vorlagen zu nutzen. Dabei hat es sich als kluge Entscheidung erwiesen, die Oper auf Deutsch zu spielen statt auf Tschechisch. Das Libretto nämlich hatte Josef Wenzig in deutscher Sprache verfaßt, und Smetana hatte den ersten Gesangstakten der Partitur auch den deutschen Text unterlegt. Zwar wechselte er im Verlauf der Komposition zu einer tschechischen Übersetzung, hatte aber bei der Behandlung von Rhythmus und Betonungen weiter den deutschen Text vor Augen, wie Ulrich Schreiber nachgewiesen hat. Das Frankfurter Produktionsteam hat sich nach Auskunft der Regisseurin für die Verwendung einer deutschen Textfassung entschieden, die sehr nahe am Originaltext ist. So erlebt man einen natürlichen Sprachduktus und kann sehr gut die Wort-Ton-Beziehungen nachverfolgen.
Wegen dieser geglückten musikalischen Umsetzung gilt: Danke, daß wir das erleben durften!
2. Jetzt weiß ich, warum die Oper nicht gespielt wird.
Das Stück funktioniert aber wohl nur als tschechische Nationaloper. Deswegen ist es in Tschechien weltberühmt und im Rest der Welt unbekannt. Nach diesem Premierenabend darf man die Prognose wagen: Das wird auch so bleiben.
Ritter Dalibor hat den Grafen Ploskovic ermordet, aus Rache für den Mord an seinem Freund Zdenek. Nun wird ihm unter dem Vorsitz von König Vladislav der Prozeß gemacht. Milada, die Schwester des ermordeten Grafen, tritt als Zeugin auf. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Aussage wird Dalibor zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt. Allerdings hat sie sich in den Mörder ihres Bruders während des Prozesses spontan verliebt. So sucht sie ihn als Mann verkleidet im Kerker auf, um ihn zu befreien. Der Fluchtversuch mißlingt und beide finden den Tod.

Dieser Plot strotzt vor dramaturgischen Schwächen. Er imitiert ungeschickt Beethovens Fidelio, amputiert aber dessen Grundkonstellation in mehreren wichtigen Punkten. Es gibt keinen Bösewicht, der als Gegenspieler den nötigen Kontrast zum Titelhelden bilden könnte, der angebliche Freiheitsheld ist ein (zu Recht) verurteilter Mörder. Als Mordmotiv überlagert die Rache für den Tod eines Freundes den Kampf für die Freiheit. Die spontan im Gerichtssaal entflammte Liebe Miladas ist völlig unglaubwürdig. Ein Liebesduett im Kerker wirkt aufgepfropft. Kurz zuvor hatte sich der Titelheld noch in schmachtender Erinnerung an den getöteten Freund ergangen.
Regisseurin Florentine Klepper hat erst gar nicht versucht, etwa durch tiefenscharfe Persönlichkeitszeichnungen die Motivation der Protagonisten zu plausibilisieren. Ihr geht es um eine Aktualisierung des mittelalterlichen Stoffes durch etwas, das sie für politisch hält. Der Einstieg gelingt dabei noch vielversprechend, indem die Gerichtsszene als Court-TV-Show in einem Fernsehstudio präsentiert wird. Der König erscheint als Moderator, sein Kanzler als Produzent. Das Urteil wird vom Publikum per Knopfdruck gefällt. Hier überzeugen einige Momente von ironischer Medienkritik.

Allerdings vermag Klepper es nicht, daraus eine schlüssige, durchgearbeitete Sicht auf den Handlungsablauf abzuleiten. Es scheint überhaupt so, als sei der Regisseurin die Substanz des Stückes gleichgültig. Das Programmheft denunziert hier in einem wichtigen Punkt die Regie. Im eigens anläßlich dieser Produktion erstellten Beitrag „So schön wie nie ertönt dein Freiheitslied“ heißt es:
„Smetana verarbeitet in seiner Oper diese Legende, indem er das Motiv der Geige in ein Sinnbild der Sehnsucht nach Freiheit und der übermächtigen Wirkungsmacht von Musik verwandelt. Denn das Instrument ist nicht bloßes Requisit, sein Klang ist vielmehr integraler Bestandteil der Handlung dieser ungewöhnlichen Freiheitsoper.“

Schön gesagt und überzeugend dargelegt. Leider hat sich das Produktionsteam dafür entschieden, ausgerechnet auf dieses zentrale Requisit zu verzichten. Die Geige wird ersetzt von einem Paar Kopfhörer. Dalibor trägt sie, wenn er zum Prozeß geführt wird. Milada schmuggelt sie ihm später ins Gefängnis. Da es um die geistige Kraft der Musik geht, haut das gerade so noch hin. Als „Sinnbild der Sehnsucht nach Freiheit“ wirken Kopfhörer jedoch ziemlich matt. Diese Mattheit bestimmt den Gesamteindruck, und sie paart sich mit Unentschlossenheit. Es wird nicht klar, wofür dieser Dalibor eigentlich kämpft. Eine als linksautonomer Mob gekennzeichnete Menge von Aufständischen sprüht an die Wand:
Fuck the system. Aber warum bloß? Wenn dies eine Freiheitsoper sein soll, müßte doch deutlich werden, wer hier wovon befreit werden soll.
Der FAZ hat die Regisseurin verraten, sie habe bei ihrem Vorhaben der Aktualisierung des Stoffes die Titelfigur zunächst als Anhänger der Identitären Bewegung gesehen. Im Programmheft nennt sie als weitere Assoziationen die G-20-Krawalle von Linksextremisten, den Überfall auf den AfD-Politiker Magnitz, Hacker-Angriffe auf Politiker und – etwas kurios – einen „medialen Schlag gegen den Grünen-Politiker Robert Habeck“. Das alles ist für sie unterschiedslos „Gewalt“. So rührt sie eine indifferente Politiksoße an und bemerkt die inhärenten Unschärfen und Widersprüche bei ihrem Herumstochern im trüben Aktualisierungsungefähr nicht. Da spricht sie mit dem Brustton der Überzeugung von „offenkundig angewachsenen Ungerechtigkeiten“, hat aber noch einen Satz zuvor zu Recht gefragt: „Wer bestimmt überhaupt, was Gerechtigkeit ist?“ Ist wohl nicht so wichtig. Man wird ja mal fragen dürfen.

Matter Liebestod: Aleš Briscein (Dalibor) und Izabela Matuła (Milada)
Als „Mittelpunkt meiner Überlegungen zu diesem Werk“ benennt sie dagegen einen Ausspruch Dalibors: „Macht gegen Macht ist das Weltgesetz. … Und stündet Ihr mir, König, dann im Weg, so richt‘ die Waffe ich gegen Euch.“ Es wird kaum je klar, wer denn wodurch welche Macht ausübt. Die allgegenwärtigen Kameras und Monitore geben darauf auch keine einleuchtende Antwort. Irgendwas mit Medien eben. Weil die Regisseurin sich aber nicht für die Motivation ihrer Hauptfigur interessiert, bleibt dieser angebliche Mittelpunkt blutleer. Dalibor ist so weder Held noch Schurke. Dem Stück fehlt es damit an einer Identitätsfigur. Was bleibt, ist eine unglaubwürdige, tragisch endende Liebesgeschichte unter widrigen Bedingungen. Leider berührt sie nicht. An keiner Stelle fühlt, hofft oder bangt man mit einem der Beteiligten. Entsprechend matt, ja geradezu schütter gerät der Applaus bei den Aktschlüssen. Diese Teilnahmslosigkeit stellt der Regie ein viel vernichtenderes Zeugnis aus als das Buhgewitter, mit dem das Regieteam am Ende überzogen wird. Kein Zweifel: Diese Produktion ist beim Premierenpublikum durchgefallen.
Michael Demel, 25. Februar 2019
Bilder (c) Monika Rittershaus
Die Premiere wurde vom Hessischen Rundfunk in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet. Sendetermine sind der 9. März 2019, 20.04 Uhr auf hr2-kultur und der 13. April 2019, 19.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur.
LA FORZA DEL DESTINO
Bericht von der Premiere am 27. Januar 2019
Trailer
Es war einmal in Amerika
Als beim Schlußapplaus das Inszenierungsteam auftritt, bläst ihm ein Buh-Orkan mittlerer Stärke entgegen, wie man ihn in solcher Heftigkeit in Frankfurt selten erlebt hat. Nur wenige finden sich, mit Bravorufen in gleicher Lautstärke dagegen zu halten. Wie es dazu kam, ist eine längere Geschichte.
Erzählen wir zunächst die kürzere: die von einem musikalisch starken Abend. Er beruht nicht zuletzt auf einer herausragenden Leistung des Orchesters. Die Frankfurter Musiker stehen im Ruf, sich unter ihrem Generalmusikdirektor Sebastian Weigle zu einem erstklassigen Wagner- und Strauss-Orchester entwickelt zu haben. Zahlreiche Tonaufnahmen aus den letzten Jahren können das bezeugen. Daß der Klangkörper daneben über einen besonderen Sinn für das italienische Repertoire verfügt, hat noch keine ausreichende Beachtung gefunden. Dabei ist es spätestens seit Carlo Montanaros Dirigat des Rigoletto vor zwei Jahren gerade auch das Orchester, das Premieren italienischer Opern in Frankfurt zum besonderen Erlebnis macht. In der aktuellen Neuproduktion erreichen die Musiker unter der Leitung von Jader Bignamini dabei einen vorläufigen Höhepunkt. Schon die Ouvertüre, ein zu Tode gespieltes Wunschkonzertstück, erklingt in einer kaum zuvor gehörten Beseeltheit. Bignamini kultiviert im weiteren Verlauf mit den glänzend aufgelegten Musikern einen intensiven Klang, der selbst im zurückgenommensten Piano noch leuchtet. Standardwendungen aus dem Werkzeugkasten des Komponisten erscheinen auf einmal wie kleine Wunderwerke. Das immer wieder verwendete Streichertremolo etwa, welches Verdis Melodieeinfälle oft grundiert, erfüllt den Zuschauerraum mit ahnungsvollem Flirren. Selbst in den repetierenden Begleitfiguren ist nichts zu hören vom berüchtigten Umtata. Organisch umfassen die Instrumente die Gesangslinien. Es gibt berückende Holzbläsersoli (die Klarinette!) und saftige Einsätze des Blechs, das aber bei aller Kraft niemals ordinär wird, niemals plärrt. Dieser Orchesterklang macht glücklich.
Die Sänger der Hauptpartien werden auf Händen getragen und können ihre Prachtstimmen zur vollen Entfaltung bringen. Mit Michelle Bradley in der fordernden Rolle der Leonora ist ein Sopran zu entdecken, der sich in allen Stimmregistern gleichermaßen verströmen kann und gerade in der bei Verdi so wichtigen tiefen Lage einen satten Klang entfaltet. Die Stimme kann von dieser Basis aus bruchlos in eine cremige Höhenlage emporsteigen. Sie verfügt über ein saftiges Forte ebenso wie über die Fähigkeit zu schwebenden und leuchtenden Piani. Gelegentlich geraten einzelne Spitzentöne zu tief, was aber den Genuß an dieser Ausnahmestimme kaum trübt.

Michelle Bradley als Leonora
Einen ausgezeichneten Eindruck hinterläßt Hovhannes Ayvazyan als Don Alvaro. Sein viriler Tenor mit bronzener Tönung und bombensicherer Höhe fügt sich ausgezeichnet zu seiner Sopranpartnerin. Mit sonoren Baßtönen darf der ansonsten überwiegend für Wagnerpartien gebuchte Franz-Josef Selig in der Doppelrolle als Marchese und Padre Guardiano seine Verdikompetenz unter Beweis stellen. Als Gegenspieler des Tenorhelden zeichnet Christopher Maltman mit enormer Stimmmuskelkraft den Don Carlo als geradezu brutalen Charakter. Unter den Sängern ist er der lauteste und bekommt am Ende dafür den lautesten Beifall. Trotz der tadellosen musikalischen Bewältigung erschien uns seine Herangehensweise zu ungeschlacht. Mit weniger Lautstärke und mehr Zwischentönen hätten er uns stärker überzeugt.
Tanja Ariane Baumgartner besticht als Preziosilla mit eleganter Stimmführung und beeindruckender Höhensicherheit. Die Regie hat ihre Rolle von der Zigeunerin zur Animierdame umgedeutet. Passend dazu bleibt die Baumgartner selbst im saftigsten musikalischen Überschwang noch kontrolliert und präsentiert eine selbstbewußte Frau, die ihre Wirkung auf Männer genau kalkuliert. Ausgezeichnet paßt der markante Baßbariton von Craig Colclough zum Fra Melitone, der sich rollenadäquat kernig von Franz-Josef Seligs balsamischen Tönen abhebt.
Der von Tilman Michael vorbereitete Chor spiegelt im Vokalen die Klangcharakteristika des Orchesters mit vollem, gut gestaffeltem Klang, rhythmischer Präzision und guter Diktion. Daß im Eifer des Premierengefechts ausgerechnet das berühmte Rataplan ein wenig klappert, schmälert die ausgezeichnete Gesamtleistung nicht.

Vom Winde verweht: auf der Bühne v.l.n.r. Michelle Bradley (Donna Leonora), Nina Tarandek (Curra) und Hovhannes Ayvazyan (Don Alvaro) sowie im Film Dela Dabulamanzi (Curra) und Thesele Kemane (Don Alvaro)
Nun zur Regie, die so heftige Abwehrreaktionen ausgelöst hat. Tobias Kratzer wählt einen naheliegenden Ausgangspunkt: den Rassismus. Im Originallibretto sieht sich der Tenorheld wegen seiner indianischen Abstammung rassistisch motivierter Ablehnung durch den Vater seiner Geliebten ausgesetzt. Regisseur Kratzer will aber das ganz große Rad drehen und ein historisches Panorama des Rassismus entwerfen. Dazu macht er den Mestizen zum Afroamerikaner und verlegt die Szene in die USA. Er verwendet dabei einen Ansatz, den Stefan Herheim vor zehn Jahren erfolgreich am Parsifal in Bayreuth ausprobiert hat: Man geht Szene für Szene einigermaßen chronologisch durch die Geschichte, bei Herheim durch die jüngere deutsche Geschichte, bei Kratzer nun von der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs bis zur Präsidentschaft Barack Obamas.
Es beginnt, recht vielversprechend, im 19. Jahrhundert in einem Landhaus, offenbar in den Südstaaten. Es treten auf: ein farbiges Zimmermädchen, ein weißer Gutsherr, seine weiße Tochter und ihr farbiger Liebhaber. Der so ausgestellte Rassenkonflikt ist für ein heutiges Publikum verständlicher als der Rassismus gegenüber dem Halbindianer aus dem Libretto. Warum ist das so? Weil eben auch und gerade die Europäer, die Nachkriegsdeutschen zumal, in ihrem ikonographischen Repertoire von nichts anderem so sehr geprägt sind wie von amerikanischen Filmen. Also bietet die erste Szene eine Reminiszenz an Vom Winde verweht. Die Vorgegebenheit der Premierenbesetzung, daß der Darsteller des Farbigen von weißer Hautfarbe ist, die Darstellerin seiner weißen Geliebten jedoch eine Afroamerikanerin, hat den Regisseur zu dem Einfall gebracht, auf den Rückprospekt einen Film zu projizieren, in dem das Bühnengeschehen noch einmal stumm mit der umgekehrten Hautfarbenzuordnung abläuft. Auch wenn Bühnenaktion und Filmhandlung nicht völlig synchron verlaufen, was auch albern gewesen wäre, finden doch die markanten Ereignisse im vorproduzierten Film wundersamer Weise punktgenau zur Musik statt. Und weil die Filmschauspieler wesentlich lebendiger und glaubwürdiger agieren als das Bühnenpersonal, konzentriert man sich ganz auf das Filmgeschehen. Auf diese Weise wird kaschiert, daß dem Regisseur in punkto Personenregie bei den Sängern außer Allerweltsgesten nichts eingefallen ist.

Kasperletheater: eine Wirtshausszene auf Amerikanisch
Nach einer kurzen Umbaupause findet man sich in einem Westernsaloon wieder, in dem nun die Wirtshausszene spielt. Die Protagonisten tragen Schwellköpfe. Die Einrichtung ist bewußt vergröbert und hat die Anmutung von zu groß geratenem Kinderspielzeug. Aha, denkt man sich, da hat jemand seinen Ulrich Schreiber (Die Kunst der Oper) gelesen, von wegen Verdis „Kasperle- und Welttheater“. Das geht ebenfalls in Ordnung. Die nachfolgende Szene vor dem Kloster springt dann unversehens ins 20. Jahrhundert. Die Klosterbrüder sind biedere evangelikale Langeweiler mit Hemd und Pullunder. Man ahnt bei der Textzeile „die Brüder sollen sich mit brennenden Kerzen am Altar versammeln“, wohin das führen wird und tatsächlich: die Biedermännern ziehen sich weiße Kapuzen über und fackeln ein Kreuz ab. Willkommen beim Ku Klux Klan. Mit diesen Eindrücken geht man in die Pause.
Im Original-Libretto ist dann die Feldlager-Szene dran. Verdi springt dafür von Spanien nach Italien. Tobias Kratzer holt aus dem Fundus der Filmikonen die Hubschrauber-Szene aus Apocalyse now hervor. Was das mit dem Rassismus gegen Afroamerikaner zu tun hat? Nichts. Nachdem er aber in der vorigen Szene bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts angekommen war, ist nun Vietnam der chronologisch nächste größere Kriegsschauplatz. Hier kämpfen aber weiße und farbige Soldaten Seit an Seit. Um doch noch einen Bezug zum Rassismus herzustellen, werden asiatisch aussehende Komparsen auf die Bühne getrieben und schikaniert. Ein afroamerikanischer Soldat erschießt dann einen dieser Vietnamesen. Immerhin zeigt er anschließend Trauer über seine Tat. Kratzer muß gespürt haben, daß diese Randepisode allein die Wahl des Sujets nicht trägt. So liefert er gleichsam den gedanklichen Überbau nach, und das mit einem cleveren Kniff: Die Feldpredigt des Fra Melitone wird mit der berühmten Rede Beyond Vietnam von Martin Luther King überblendet. Gesungen wird der italienische Originaltext, während ein historisches Video die Rede des Bürgerrechtlers zeigt. Dieser bewegt zwar lediglich stumm die Lippen, sein Redetext erscheint jedoch in Form von Untertiteln, zugleich bleibt der Schirm mit den Übertiteln zur Übersetzung des italienischen Operntextes schwarz. Also liest das Publikum: „Somehow this madness must cease. We must stop now. I speak as a child of God and brother to the suffering poor of Vietnam.“ Es wird damit der Moment heraufbeschworen, in dem die Bürgerrechtsbewegung eine Wendung zur Friedensbewegung nahm.

Was folgt daraus für den Gang der Handlung? Nichts, denn man muß ja weiter zur nächsten Szene mit der Armenspeisung. Sie findet vor schmucklosen weißen Wänden statt. Eine lebensgroße Statue von Barack und Michelle Obama markiert die Ankunft im 21. Jahrhundert. Wo ist der Bezug zum Rassismus? Der kommt erst wieder in der Schlußszene. Wieder wird sie von einem Film auf dem Rückprospekt gedoppelt. Wieder treten die Darsteller aus der Vom-Winde-verweht-Szene des Beginns auf. Dieses Mal ist der Schauplatz ein Hotelzimmer. Hier spielt sich die tödliche finale Konfrontation von Alvaro und Carlo ab. Zwei weiße Polizisten erscheinen und erschießen Carlo. Die Kamera zoomt auf den Fernseher im Hotelzimmer. Zu sehen sind Bilder von einer Demonstration: „Black lives matter.“ Vorhang.

Das alles ist durchaus unterhaltsam, aber mitunter auch ziemlich platt. Im Programmheft und im Video-Trailer zur Produktion gibt der Regisseur Auskunft über seine Absichten. Er verkauft sich und seine Ideen sehr gut. Daß ihm keine zwingende szenische Umsetzung aus einem Guß gelungen ist, daß seine bunten Bilder episodisch bleiben und allzu offensichtlich auf äußere Reize setzen, hält er für werkimmanent: disparate Vorlage, disparate Umsetzung. Kratzer macht es sich damit ein wenig zu leicht. Müssen sich die Defizite des Librettos denn unbedingt auch in der Regie widerspiegeln? Will man das am Ende als höhere Form der Werktreue ausgeben? All die bunten Bilder und die klugen Assoziationen können über eines nicht hinwegtäuschen: Kratzer kümmert sich zu wenig um seine Figuren. Individuelle Psychologie? Plausibilisierung der Motivation der Handelnden? Fehlanzeige. Lediglich in den Rahmenszenen, zu Beginn und zum Schluß also, gelingt es dem Regieteam in Ansätzen, das übergeordnete Thema auf die individuellen Schicksale der Protagonisten herunterzubrechen, bezeichnender Weise aber mehr in den vorproduzierten Einspielfilmen als in der Bühnenhandlung. Ansonsten hat man je länger der Abend dauert umso mehr den Eindruck, daß hier mit einer allzu cleveren Regie ein krudes Libretto auf das Prokrustesbett eines wohlfeilen politischen Überbaus gespannt wird. Vielleicht geht mehr auch nicht. Vielleicht aber wäre weniger sogar mehr gewesen.
Gesprächsstoff bietet diese Produktion allemal. Wer sich auf die bunte Bilderwelt des Regieteams nicht einlassen will, schließt eben die Augen und genießt eine musikalische Darbietung auf herausragendem Niveau.
Michael Demel, 31. Januar 2019
Bilder (c) Monika Rittershaus
I PURITANI
Bericht von der Premiere am 2. Dezember 2018
Trailer
Gepflegte Langeweile beim Belcantofest
Das Libretto von Bellinis letzter Oper I puritani ist ein Muster zur Beglaubigung von Klischees, wonach Opernhandlungen so verworren wie unlogisch sind und haarsträubende Handlungsverläufe bieten, letztlich aber ohnehin nur dazu dienen, den Sängern einen Anlaß zur Präsentation von vokalen Kunststückchen zu verschaffen. Das Produktionsteam hat sich in Frankfurt dazu entschieden, sich davon elegant zu distanzieren, in dem es den vielfach bewährten Kniff des Theaters im Theater anwendet. Zitat aus dem Programmheft: „Paris 1835. Trauerfeier von Vincenzo Bellini. … Man erinnert sich des skandalumwitterten Komponisten im Rahmen eines Balls der Schwarzen Romantik nach Motiven seiner letzten Oper I puritani. Die Gesellschaft erlebt und erleidet die Extremsituationen einer Liebesgeschichte, welche sich im englischen Bürgerkrieg um 1650 über die beiden feindlichen Lager hinweg abspielt.“
Dazu hat man das Ganze in ein ausgebranntes, schwarz verrußtes Theater verlegt und die Darsteller in Kostüme des 19. Jahrhunderts gesteckt. Und weil Johannes Leiacker das Bühnenbild und Christian Lacroix die Kostüme entworfen haben, sieht das fabelhaft aus. Das aber, was Regisseur Vincent Boussard damit veranstaltet, ist phasenweise von einer konzertanten Aufführung nicht weit entfernt. Insbesondere der sehr präsente Chor wird einfach in den Rängen der Theaterruine aufgereiht und bleibt da eben stehen. Unten im Erdgeschoß können Allerweltsgesten den Eindruck von Statik kaum zerstreuen. Wenn das Bühnenbild nicht die Möglichkeit geboten hätte, immer wieder einzelne Darsteller über Leitern in den ersten Rang des ausgebrannten Theaters klettern zu lassen (und wieder zurück), hätte es über weite Strecken gar keine erwähnenswerten Aktionen gegeben. Die zu den Vor- und Zwischenspielen auf einen Gazevorhang projizierten Videofilmchen (Isabel Robson) sind hübsch anzusehen, aber nichtssagend.

Je länger der Abend im dreieinhalb Stunden lang unveränderten Einheitsbühnenbild dauert, umso zäher wirkt das. Das Regieteam holt sich am Ende dafür einige wohlverdiente, saftige Buhrufe ab.
Das Publikum tut, was ein Publikum immer tut, wenn es sich langweilt: Es horcht in sich hinein und entdeckt einen unwiderstehlichen Hustenreiz. Hat der erste dem Kitzeln im Hals nachgegeben, dann gibt es für die anderen kein Halten mehr. Und so bollert, krächzt, rasselt und röchelt es unaufhörlich von allen Seiten, bis der Schleim von der letzten Bronchie sorgfältig und lautstark abgehustet ist, um dann wieder von vorne zu beginnen. Das ist sehr ärgerlich, denn musikalisch ist es ein großartiger Abend.
Schon bei der Ouvertüre kann man ins Schwärmen geraten über die wunderbar weich und samtig intonierenden Hörner, die hier so oft und exponiert zum Einsatz kommen, als wär’s eine Oper der deutschen Romantik. Locker und duftig setzen dann die Streicher ein, die Holzbläser mischen delikate Farben bei. Tito Ceccherini knüpft mit dem gut aufgelegten Opernorchester an dessen herausragende Leistung in Norma zum Ende der vergangenen Spielzeit an. Es ist ein eleganter, aber beseelter Klang, der aus dem Orchestergraben strömt, mit einer Fülle an Dynamikabstufungen vom zartesten Pianissimo bis zu knallenden Aktschlüssen und mit nie nachlassender Intensität. Der stark geforderte Chor spiegelt dies im Vokalen mit Lockerheit, Präzision und genau ausgehorchter Fülle. So stellen die beiden Kollektive die eigentlichen Kulissen bereit, die akustischen nämlich, vor welchen sich ein wahres Sängerfest entfalten kann.

Brenda Rae (Elvira), Thomas Faulkner (Lord Gualtiero Valton), Michael Porter (Sir Bruno Roberton; mit dem Rücken zum Betrachter) und John Osborn (Lord Arturo Talbo) sowie oben Chor der Oper Frankfurt
Man muß beim schwärmerischen Lob für die außerordentlich starke Besetzung dieses Mal mit den tiefen Stimmen beginnen, denn Bellini hat ihnen wichtige Aufgaben und weit auslandende Arien und Duette zugedacht. Hier präsentiert die Oper Frankfurt die Stars aus der jungen Truppe, die Intendant Loebe in den letzten Jahren an sein Haus gebunden und systematisch aufgebaut hat. So kann man Iurii Samoilov erleben, wie er mit seinem saftigen Bariton die mitunter exponierten Höhen des Riccardo Forth so sicher und leuchtend bewältigt, wie es auch ein Tenor nicht besser hinbekäme. Kihwan Sim löst in der Rolle des Sir Giorgio das Versprechen ein, welches er als fieser Bürgermeister in Rossinis La gazza ladra und als Gottardo in La Sonnambula vor vier Jahren gegeben hatte. Schon damals präsentierte er einen schlanken, aber dunkel und voll tönenden Baßbariton mit großer Beweglichkeit. Inzwischen hat seine Stimme weiter an Fülle gewonnen, ohne ihre Eleganz zu verlieren. Das große und ausgedehnte Duett der beiden ist einer der musikalischen Höhepunkte des Abends.

Kihwan Sim mit Brenda Rae
Neben diesen beiden jugendlich-virilen Prachtstimmen wirkt zumindest im ersten Teil vor der Pause der international hoch gehandelte Tenor John Osborn als Lord Arturo Talbo wie ein Fremdkörper. Bellini hat seine Partie in zum Teil schwindelnder Höhe angelegt, so daß Osborn über weite Strecken zu starkem Gebrauch der Kopfstimme gezwungen ist. Er macht das technisch tadellos und verblendet die Register recht geschickt. Sein Tenor klingt dabei aber gerade in der exponierten oberen Lage mitunter wie ein Countertenor, der versucht, wie ein Tenor zu klingen. Das erzeugt ein etwas androgynes Timbre, an das man sich gewöhnen muß. Im zweiten Teil nach der Pause wirkt seine Stimme entspannter und sonorer, von wenigen schneidend grellen Spitzentönen abgesehen.
Eine Klasse für sich ist das ehemalige Ensemblemitglied Brenda Rae in der weiblichen Hauptrolle der Elvira. Sie befindet sich derzeit auf dem Gipfelpunkt ihrer enormen vokalen Möglichkeiten. Das konnte man vor wenigen Wochen bereits bei ihrer atemberaubenden Violetta in Verdis La Traviata erkennen (s. u.). Erneut bewältigt sie die ausufernden Koloraturen und Verzierungen ihrer Partie nicht nur technisch in staunenswerter Perfektion, sondern präsentiert sie als Mittel der Gestaltung. Selten erlebt man diese Virtuosennummern so beseelt, so mit Bedeutung und Sinn erfüllt. Vor Staunen und vor Verzückung vergißt man das dämliche Libretto, die Längen der unglaubhaften Handlung und die edle Langeweile der Inszenierung.

Brenda Rae als Elvira
Die Nebenrollen sind allesamt aus dem Stammensemble vorzüglich besetzt, mit dem sonoren Baß Thomas Faulkner als Lord Gualtiero Valton, dem eleganten Tenor Michael Porter als Sir Bruno Roberton und der warmstimmigen Mezzosopranistin Bianca Andrew als Enrichetta di Francia.
Womöglich hätte auch ein ambitionierterer Regieansatz dieses mißglückte Libretto mit seiner ungeschickten Dramaturgie nicht retten können. Die außerordentliche musikalische Qualität der Produktion entschädigt aber für manchen szenischen Leerlauf.
Michael Demel, 5. Dezember 2018
Bilder (c) Barbara Aumüller
LA TRAVIATA
Bericht von der konzertanten Premiere am 7. November 2018
Sie kam, sang und siegte
Was rechtfertigt eine konzertante Aufführung, also Musiktheater ohne Theater?
In Frankfurt in fernerer Vergangenheit etwa das fehlende Budget für ein Bühnenbild (Parsifal) oder die Präsentation eines Stars in der Titelrolle (Otello), in jüngerer Vergangenheit aber lediglich die Präsentation von Raritäten, denen man keine szenische Wirksamkeit, keine inhaltliche Substanz oder jedenfalls kein für eine szenische Aufführungsserie ausreichendes Publikumsinteresse zuschreibt. So hatte man zunächst das Frühwerk von Richard Wagner präsentiert, um sich seit einigen Spielzeiten immer wieder vergessenen Opern aus der Frühzeit von Giuseppe Verdi zu widmen. Nun stand der Korsar für zwei Aufführungen auf dem Spielplan. Zwei der Sänger von tragenden Partien mußten jedoch so kurzfristig absagen, daß kein Ersatz organisiert werden konnte. So suchte man nach einer Verdi-Oper, welche die verbliebenen Sänger auch nachts um drei im Schlaf auswendig singen können, und kam auf La Traviata. Die Titelpartie wurde ad hoc von der ohnehin gerade am Haus probenden Brenda Rae übernommen. Sie kam, sang und siegte. Das Publikum dürfte das wohl differenzierteste und eindringlichste Porträt dieser Rolle präsentiert bekommen haben, das seit langem an einem Opernhaus zu hören war. Jede Nuance präsentierte das ehemalige Frankfurter Ensemblemitglied mit technischer Makellosigkeit und einer emotionalen Intensität, die ihresgleichen sucht. Selbst Koloraturen erschienen hier als selbstverständliches Mittel der Rollengestaltung. Brenda Rae befindet sich ohne Zweifel auf dem Gipfelpunkt ihrer enormen Möglichkeiten. Und ließ das Publikum in keiner Sekunde ein Bühnenbild vermissen. Was hätte uns ein Regisseur zu dieser Figur noch sagen können, was die Rae nicht schon mit Mimik und gut dosierter Gestik zum Ausdruck gebracht hatte?

Die beiden aus der ursprünglichen Besetzung übrig gebliebenen Sänger der beiden männlichen Hauptpartien rundeten den Abend zum Belcantofest ab. Dabei schien es mitunter so, als ob Zeljko Lucic als Vater Germont trotzdem gerne als Korsar aufgetreten wäre und daher seiner Figur regelrecht gewalttätig grobe Züge verlieh. Wenn er etwa Violetta zusprach: „weine nur“, dann erschien dies wie ein machtvoller Befehl, dem man sich besser nicht widersetzen sollte. Mario Chang gab dagegen genau die Rolle, mit der er in Frankfurt bereits im Rosenkavalier betraut war: ein italienischer Tenor. Dieses Mal hörte der Tenor eben auf den Namen Alfredo. Tat aber nichts zur Sache. Die Stimme ist samtig und wohlklingend, verfügt über stabile Spintoqualitäten und kann als idealtypisch für dieses Rollenfach bezeichnet werden.

Ein gut gelaunter Chor und ein unter der Leitung von Francesco Lanzillotta knackig und energiegeladen aufspielendes Orchester taten das ihre, das Publikum in Jubelstimmung zu versetzen.
Michael Demel, 9. November 2018
Bilder (c) Barbara Aumüller
Doppelabend
OEDIPUS REX / IOLANTA
Bericht von der Premiere am 28. Oktober 2018
Trailer
Verweigerte Archaik und vergiftetes Märchen
Zwei Kurzopern russischer Komponisten, die beide um das Thema der Blindheit kreisen: Was könnte näher liegen, als diese beiden Stücke zu einem Abend zu verbinden? Und doch sind in dieser Neuproduktion zwei völlig unterschiedliche Werke zu erleben, die mehr als nur eine Umbaupause trennt. Die Regisseurin Lydia Steier liefert zwei eigenständige Inszenierungen mit je eigenem, profiliertem Bühnenbild ab. Es gibt keinerlei szenische Querbezüge. Jeder Teil könnte auch ohne den anderen bestehen. Selbst die Abfolge erscheint beliebig. Im Jahresprogramm und den Vorankündigungen stand Tschaikowskis Iolanta immer an erster Stelle, Strawinskis Oedipus Rex an zweiter. Plötzlich aber ist es am Premierenabend umgekehrt. Nun steht das spätromantische Märchenstück um eine blinde Prinzessin, die auf wundersame Weise geheilt wird, im Mittelpunkt. Strawinskis kantig-neoklassizistisches Opernoratorium mit seiner stilisierten Archaik gerät zum Vorprogramm. Fast hat man seine Wucht am Ende schon wieder vergessen. Und das ist schade, denn das Produktionsteam macht gerade hier vieles richtig.
Das Bühnenbild von Barbara Ehnes zitiert in Oedipus Rex detailgetreu den Plenarsaal des Deutschen Reichstags vor der Zerstörung durch den Brand 1933. Die Szene wird also vom antiken Griechenland in die Entstehungszeit des Stückes, die 1920er Jahre versetzt. König Oedipus ist ein Politiker in Zeiten des aufkommenden Faschismus. In den Bänken der Reichstagsabgeordneten haben neben den Honoratioren bedrohlich viele Offiziere und einfache Soldaten Platz genommen.

Peter Marsh (Oedipus; auf dem Tisch stehend) und Ensemble
Zur Einordnung der in lateinischer Sprache deklamierten Tragödie hatte der Librettist Jean Cocteau erläuternde Texte in der jeweiligen Landessprache vorgesehen, mit denen ein Sprecher das Publikum durch die archaische Handlung führt. Diese Texte werden in Frankfurt von flüsternden Kinderstimmen gesprochen, die mit stereophonen Raumeffekten über Lautsprecher eingespielt werden. Diese Idee ist nicht ganz neu (Barrie Kosky hatte das hier schon in Herzog Blaubarts Burg erfolgreich vorgeführt), aber unverändert wirkungsvoll. Zum Standard gehören mittlerweile auch Videoeinblendungen, die hier zu den Zwischentexten plastisch die Vorgeschichte vom Mord an König Laios und den unerkannten Inzest des Oedipus mit seiner Mutter und Ehefrau Iokaste illustrieren. Regisseurin Lydia Steier mag es deutlich, überdeutlich mitunter. Und sie versteht sich auf flüssige Personenregie. Damit unterläuft sie aber die in Text und Musik angelegte oratorienhafte Statik und das Blockhafte der Tableaus. Letztlich hebt sie die durch Verwendung der lateinischen Sprache und von archaischen Formen beabsichtigte Verfremdung und Distanz auf und präsentiert ein saftiges Stück handwerklich sauber gearbeitetes, aber weitgehend überraschungsfreies Regietheater, als wär’s eine herkömmliche Oper.
Peter Marsh hat sich der Herausforderung angenommen, die Titelpartie zu gestalten. Sein heller, das Kopfregister bevorzugender Tenor entspricht dem Stimmtyp großer Rollenvorgänger wie Peter Pears und Peter Schreier. In den ersten Takten seines Auftritts versucht er noch, die Selbstbehauptung des Politikers mit Volumen zu illustrieren. Dabei setzt er seine Stimmbänder derart unter Druck, daß sie ein für ihn ungewöhnlich expansives Vibrato erzeugen. Das legt sich aber sehr schnell, und der Sänger formt vokal und mimisch ein differenziertes Porträt dieses Verblendeten, der allmählich die schreckliche Wahrheit erkennt, um sich dann selbst durch Ausstechen der Augen tatsächlich physisch zu blenden.

Tanja Ariane Baumgartner (Iokaste; im roten Kleid), Peter Marsh (Oedipus; rechts) und Gary Griffiths (Kreon; dahinter) sowie Ensemble
Den vokalen Glanzpunkt dieses ersten Teils setzt jedoch Tanja Ariane Baumgartner als Iokaste. Ihr reifer Mezzosopran verbreitet zunächst orientalisch-exotisches Flair, durchmißt exaltierte Höhen und raunende Tiefen und vermag es mit spöttischer Verachtung, sich über mißliebige Weissagungen lustig zu machen. Eindruck macht der Auftritt von Andreas Bauer, der dem blinden Seher Teiresias mit seinem volltönenden Baß große Autorität verleiht. Hörenswert sind auch Matthew Swensen mit hellem, jugendlichem Tenor als Hirte und der markante Baßbariton von Brandon Cedel als Bote.
Der von Tilmann Michael vorbereitete Männerchor ist stark gefordert und bewältigt seine Einsätze mit fülligem Klang und präziser Diktion. Generalmusikdirektor Sebastian Weigle präsentiert den Neoklassizismus der Partitur farbig, aber unsentimental, klar ausgeleuchtet, aber nicht trocken, und erzeugt mitunter einen unwiderstehlichen rhythmischen Drive.
Als der Vorhang fällt, gibt sich das Publikum von der archaischen Wucht der Musik und dem drastisch ausgestellten Schicksal der Hauptfiguren erschlagen (aus Oedipus‘ leeren Augenhöhlen rinnt das Blut, vom ersten Stock baumelt die Leiche der erhängten Iokaste) und verharrt einige Sekunden in Stille, spendet dann aber anerkennenden Beifall für alle Beteiligten.

Heiteren und spontanen Applaus erhält dann nach der Pause direkt nach dem Heben des Vorhangs das Bühnenbild der zweiten Oper. In einem bis zur Decke aufragenden Regal sind unzählige, rosafarben gekleidete, blonde Puppen aufgereiht. Als lebensgroße Puppe sitzt darunter die Protagonistin, ebenfalls rosa gekleidet und mit blonder Perücke ausgestattet. Mit diesem bonbonfarbenen Alptraum hat das Produktionsteam die zuvor von Strawinski ordentlich durchgeschüttelten Premierengäste offenbar für sich eingenommen.
Und nun verschiebt sich die Aufmerksamkeit ganz auf die vokalen Leistungen. Das Publikum hängt den Sängern förmlich an den Lippen und spendiert immer wieder Zwischenapplaus. Schon mit ihren ersten Tönen zeigt Asmik Grigorian in der Titelrolle der Iolanta, warum sie aktuell zu den begehrtesten Sopranistinnen weltweit gehört. Ihre reiche, dabei jugendlich frische Stimme ergießt sich in vollen Strömen in den Zuschauerraum. Momente der Trauer teilen sich unmittelbar mit, in Momenten der Leidenschaft entwickelt sie atemberaubende Glut. Man badet im Strom dieser Stimme. Daß sie die übrige Besetzung nicht völlig an die Wand singt, zeugt von deren bemerkenswerter Qualität. So präsentiert sich AJ Glueckert als ihr Tenorpartner in der Rolle des Graf Vaudémont mit strahlenden Höhen und tadellosem Stimmsitz. Das Frankfurter Ensemblemitglied liefert dabei keinen glatten Schöngesang, sondern nutzt seinen charakteristisch timbrierten Tenor, bei dem eine lyrische Grundierung mit einer Prise Spinto-Fähigkeit gewürzt ist, zur Rollenprofilierung. Klanggesättigt, aber in der Höhenlage erstaunlich elegant weiß Robert Pomakov als Iolantas Vater König René für sich einzunehmen. Lediglich bei den tiefsten Tönen macht sich das Fehlen der nötigen Baßschwärze bemerkbar. Immerhin hebt er sich so von Andreas Bauers dunklerer Stimme ab, mit der er im zweiten Teil nun in der Rolle des arabischen Arztes Ibn-Hakia wiederum überzeugt. Auch versteht man jetzt, warum die Oper Frankfurt Gary Griffiths als Gast engagiert hat. Blieb er im ersten Teil als Kreon noch unscheinbar und blaß, ist er im zweiten Teil als Robert stimmlich kaum wiederzuerkennen. Nun ist ein kerniger Bariton zu hören, der sich gut in das übrige Ensemble einfügt.

Asmik Grigorian (Iolanta)
Das Orchester zeigt seine Wandelbarkeit und läßt zu Beginn einen delikaten, duftigen Holzbläserklang aus dem Orchestergraben entschweben, der vom Einsatz der Streicher wunderbar abgerundet wird. Sebastian Weigle achtet darauf, der bei Tschaikowski immer vorhandenen Kitschgefahr zu entgehen. Zudem erweist er sich einmal mehr als aufmerksamer Begleiter, der seine Sänger nie in Klangwogen untergehen läßt.
Man ist von all der musikalischen Pracht und dem hübsch-skurrilen Bühnenbild derart abgelenkt, daß man beinahe übersehen hätte, wie die Regisseurin das Gift des Kindesmißbrauchs in die Märchenidylle einträufelt. Neben der Blindheit hat sie nämlich ein zweites inhaltliches Band zwischen den disparaten Teilen dieses Doppelabends gespannt: den Inzest. Bei Oedipus liegt der Inzest als Thema offen zu Tage. Bei Iolanta ist er eine Zutat des Produktionsteams. Im Libretto isoliert der König seine blinde Tochter und läßt sie im Unklaren darüber, daß ihr ein Sinnesorgan fehlt. Erst durch den Eindringling Vaudemónt erfährt sie von ihrem Defizit und überwindet es wunderbarer Weise durch Liebe. Die Regisseurin deutet die Blindheit aber psychologisch als hysterische Folge eines Mißbrauchs durch den Vater. Schließlich unterläuft Steier auch das vorgesehene Happy End, indem Iolanta zu den Klängen des Jubelfinales ihren sie liebenden Retter von sich stößt und sich dem Vater zuwendet, der gerade dabei ist, sich wegen der Schande des aufgedeckten Inzest eine Pistole an den Kopf zu setzen. Wir halten das für reichlich konstruiert. Das Publikum hat es aber nicht gestört. Es jubelt am Ende den Sängern zu, feiert insbesondere Asmik Grigorian enthusiastisch und verschont das Produktionsteam mit Unmutsbekundungen.
Michael Demel, 30. Oktober 2018
Bilder (c) Barbara Aumüller
TRI SESTRY
Bericht von der Premiere am 9. September 2018
Trailer
Ein Klassiker der Postmoderne
Péter Eötvös‘ „Tri Sestry“ nach einem Drama von Anton Tschechow ist eines der wenigen zeitgenössischen Musiktheaterwerke, die es ins Repertoire der Opernhäuser geschafft haben. Seit der Uraufführung an der Oper Lyon im Jahr 1998 stand das Werk bereits in drei Dutzend Städten auf dem Spielplan. Die Liste der Aufführungsorte umfaßt große wie kleinere Häuser. Zuletzt hatte es sogar die konservative und risikoscheue Wiener Staatsoper im Jahr 2016 herausgebracht – ein untrügliches Zeichen dafür, daß ein Stück zum Klassiker geworden ist.
Dabei handelt es sich keineswegs um ein gefälliges Werk. Schon die Vorlage von Tschechow ist sperrig. Sie schildert die Trostlosigkeit des Lebens in der russischen Provinz und das dumpfe Seelenleid von vier Geschwistern, den titelgebenden Schwestern und ihrem Bruder Andrei, die es fernab ihrer Heimatstadt Moskau dorthin verschlagen hat. Wer von ihnen nicht unglücklich verheiratet sind, ist wenigstens unglücklich verliebt. Sie haben ihre Träume aufgegeben und müssen sich mühsam mit ihren Schicksalen arrangieren. Abwechslung bringen lediglich die dort stationierten Soldaten. Bei Tschechow wird eine Zeitspanne von vier Jahren chronologisch erzählt. Eötvös hat aus der Vorlage zusammen mit seinem Librettisten Claus Henneberg wenige Momente herausdestilliert, die er zu insgesamt drei „Sequenzen“ neu zusammengesetzt hat, in denen die Grundgegebenheiten jeweils aus der Perspektive von einem der vier Geschwister beleuchtet werden. Die erste Sequenz ist der Schwester Irina gewidmet, welche sich dem Werben des Barons Tusenbach ausgesetzt sieht, dessen Liebe sie nicht erwidert, dem sie aber schließlich nachgibt, was jedoch folgenlos bleibt, weil er von seinem Widersacher Soljony im Duell getötet wird. Die zweite Sequenz nimmt die Perspektive des Bruders Andrei ein, der seine Hoffnungen auf eine Karriere als Professor zugunsten eines Verwaltungspostens aufgegeben hat und unter der Fuchtel seiner biestigen Ehefrau Natascha steht. Die dritte Sequenz widmet sich der Schwester Mascha, die unglücklich mit einem Lehrer verheiratet ist und noch unglücklicher in den ebenfalls verheirateten Offizier Werschinin verliebt ist.

In den drei Sequenzen gibt es wiederkehrende szenische Motive wie etwa das Zerbrechen einer Sanduhr und das somnambule Erscheinen von Andreis Frau Natascha mit einer Kerze, das an die Wahnsinnsszene von Lady Macbeth bei Verdi erinnert.
Musikalisch ist das Werk einer entspannten Postmoderne zuzuordnen. Es gibt mit einem zwischen Dur und Moll changierenden Dreiklang sogar einen wiederkehrenden tonalen Bezugspunkt, ohne daß es sich dadurch um eine tonale Komposition handeln würde. Teile des Textes werden gesprochen, andere in einem Parlandostil zwischen Sprechen und Singen bewältigt. Immer wieder aber gibt es längere ariose Passagen. Das eröffnende Terzett der drei Schwestern erinnert an Renaissance-Vorbilder. Eötvös’ Tonsprache überfordert den Zuhörer trotz ihrer Elaboriertheit nicht, weil sie ihm einen intuitiven Zugang ermöglicht. Originell gibt sich die Besetzung der Vokalpartien: Die drei Schwestern und Andreis Frau Natascha werden von Countertenören gesungen. Dies ist ein Moment der Verfremdung, das eine Abstrahierungen der gezeigten Schicksale aus ihrem Geschlechterrollenkontext bewirkt und zudem durchaus beabsichtigte Komik in sich birgt.
Das Orchester ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Im Orchestergraben finden sich lediglich 18 Musiker. Ihre Soloinstrumente sind jeweils einer Figur zugeordnet, so die Holzbläser und Solostreicher einzelnen Familienmitgliedern, die Blechbläser den Soldaten und eine ganze Batterie von Schlaginstrumenten dem fiesen Hauptmann Soljony. Der Klang wird so sängerfreundlich transparent gehalten. Eine zweite, deutlich größer besetzte Orchestergruppe soll eigentlich hinter der Bühne Aufstellung finden. In Frankfurt hat man hierfür eine Empore gebaut, die sich über dem eigentlichen Bühnenbild erhebt. Dieses zweite Orchester sorgt in dramatischeren Momenten für größere Klangfülle.

Ray Chenez (Irina), David DQ Lee (Mascha), Mikołaj Trąbka (Andrei) und Dmitry Egorov (Olga)
Eötvös ist es insgesamt weniger um melodische oder motivische Arbeit gelegen als vielmehr um die raffinierte punktuelle Ausreizung von Klangfarben. Wie es sich für einen zeitgenössischen Komponisten gehört, spielen dabei Schlaginstrumente eine dominante Rolle. Die Partitur führt eine kaum überschaubare Fülle an Schlagwerk auf, neben Pauken, Becken und Triangeln auch Trommeln und Tomtoms in allen Größen, Templeblocks, Tamtams, Gongs, Röhrenglocken etc., und zeigt den Humor des Komponisten bei der Verwendung von rhythmisch klappernden Teetassen oder dem Einsatz von Kuhglocken (wenn der Zuhörer gerade den Eindruck gewonnen hat, was für eine dumme Kuh doch diese Natascha ist). Eine markante Klangfarbe steuert zudem ein elektronisch verstärktes Akkordeon bei, das zu Beginn jeder der drei Sequenzen zu hören ist.
Ausstatter Ashley Martin-Davis läßt das Stück in einer modernen Wohnküche spielen, in der auch ein paar Polstermöbel herumstehen. Zur Linken schließt sich ein Innenhof an, in dem sich ein Sandkasten und Klettergerüste befinden - Erinnerungen an eine glücklichere Kindheit. Die zweite Sequenz nach der Pause zeigt das gleiche Bühnenbild, jedoch an der Mittelachse gespiegelt. Dieser einfache Kniff macht die Änderung der Erzählperspektive auch optisch deutlich. Regisseurin Dorothea Kirschbaum bespielt diesen unspektakulären Raum mit einem darstellerisch hochengagierten Ensemble in traumwandlerischer Sicherheit. Jede Figur wird unaufdringlich, aber prägnant charakterisiert. Aktionen und Interaktionen befinden sich stets im Einklang mit der von der Musik vorgegebenen Erzählstruktur. Der inhärente Humor des Stückes wird dezent ausgespielt, ohne in Slapstick umzukippen. Die tragischen Momente werden ohne Pathos dargeboten und erreichen damit eine stille Eindringlichkeit. Sehr dezent kommen drei kurze Comicfilm-Einblendungen zum Einsatz, die in jeder der drei Sequenzen jeweils die unerfüllten Lebensträume der Protagonisten zeigen.

Die Sängerbesetzung läßt keine Wünsche offen. Die titelgebenden Schwestern sind mit drei Countertenören besetzt, die sich in ihrer Stimmfarbe gut voneinander abgrenzen und jeweils ausgezeichnet zur betreffenden Figur passen. So singt Ray Chenez die jüngste Schwester „Irina“ mit einem geradezu betörend schönen Mezzosopran, der sich in der ersten Sequenz regelrecht verströmen darf. Dimitry Egorov als älteste Schwester „Olga“ klingt dagegen herber und gereifter. David DQ Lee als „Mascha“ entspricht am ehesten dem von Countertenören erwarteten androgynen Klangbild, während man bei Chenez mit geschlossenen Augen nicht erraten würde, daß diese honigsüßen Töne von einem Mann stammen. Umso stärker wirkt der beabsichtigte Verfremdungseffekt, wenn die drei Sänger in den Sprechpassagen ihre natürliche, männliche Stimme gebrauchen. Wunderbar gelingt es Eric Jurenas, dem vierten Countertenor, die ordinäre „Natascha“ in ihrer Zickigkeit und Dominanz zu zeichnen. Alle vier sind von Kostümbildnerin Michaela Barth in jeweils charakteristische Frauenkleider gesteckt worden. Daß dies nicht zur Travestienummer gerät, ist keine geringe Leistung.
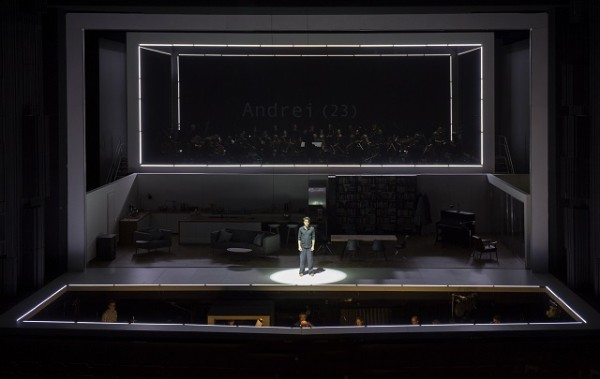
Mikołaj Trąbka (Andrei) und Orchester
Die männliche Hauptrolle des „Andrei“ ist mit Mikołaj Trąbka geradezu ideal besetzt. Er stellt optisch genau den schüchternen, jungenhaften Mann dar, der unter der Fuchtel seiner Frau steht. Umso erstaunlicher, ja geradezu überwältigend ist es dann, mit welch saftigem und kraftvollem Bariton er seinen großen Monolog in der zweiten Sequenz gestalten kann. Zuvor hatte bereits Barnaby Rea als „Soljony“ auf sich aufmerksam gemacht und dem Fiesling fast zu schöne Baßkantilenen spendiert. Als dritter Bariton zeigt schließlich Iain McNeil in der Rolle des von Mascha angehimmelten „Werschinin“, daß er mit seiner kernigen, gut durchgeformten Stimme dem Opernstudio eigentlich längst entwachsen ist. Aus der übrigen Besetzung sind noch hervorzuheben Mark Milhofer, der den „Doktor“ mit hellem, scharf konturiertem Tenor Profil verleiht, Thomas Faulkner als sonor-steifer Schulmeister „Kulygin“ sowie Alfred Reiter, der mit wenigen grummelnden Tönen als senile Dienerin „Anfisa“ seine Buffo-Qualitäten ausspielen kann.
Das Ensemble der Instrumentalsolisten im Orchestergraben wird von Dennis Russel Davies mit überlegener Souveränität mit dem Bühnengeschehen verzahnt. Die Koordination mit dem Bühnenorchester unter Nikolai Petersen gelingt bruchlos.
Der Oper Frankfurt ist eine mustergültige Aufführung gelungen, die in souveräner Selbstverständlichkeit den Rang dieses herausragenden Beitrags zum zeitgenössischen Musiktheater unterstreicht.
Am Ende nimmt ein glücklicher Komponist gemeinsam mit dem Ensemble den für alle Beteiligten ungeteilten und kräftigen Applaus entgegen.
Weitere Vorstellungen gibt es am 12., 14., 20., 23. und 30. September sowie am 3. Oktober.
Michael Demel, 10. September 2018
Bilder © Monika Rittershaus
NORMA
Bericht von der Premiere am 10. Juni 2018
Trailer
Da werden Weiber zu Hyänen
Mit den Koproduktionen hatte die Oper Frankfurt in dieser Saison kein Glück. Zu Beginn der Spielzeit stand ein belangloser „Troubadour“, der zwar zuvor immerhin an „Covent Garden“ in London herausgebracht worden war und dessen Vorstellungen in Frankfurt nahezu vollständig ausverkauft waren, über dessen mediokre szenische Qualität der Frankfurter Intendant Bernd Loebe aber derart verärgert war, daß er seinen Mißmut öffentlich zum Ausdruck brachte. Zum krönenden Abschluß der Spielzeit war nun erneut eine Koproduktion geplant, dieses Mal mit der Oper Oslo. Was dort bei der Premiere im Januar dieses Jahres zu sehen war, ließ Loebe sofort die Notbremse ziehen. Das Produktionsteam wurde ausgetauscht. Regisseur Christof Loy erwies sich als Retter in der Not und sprang kurzfristig ein. An der Oper Frankfurt gehört er zu den prägenden Künstlern und hat in den vergangenen Jahren eine Serie von mustergültigen Inszenierungen präsentiert, so daß die Erwartungen hoch waren. Was man bei Loy wie selbstverständlich voraussetzt, ist eine psychologisch ausgefeilte Personenregie und eine zwingende Führung von Kollektiven. So ist es nun auch in der neuen „Norma“ zu erleben. Insbesondere die beiden Protagonistinnen werden konturenstark individualisiert, ihre inneren Nöte und äußeren Konflikte plastisch herausgearbeitet. Interaktionen haben die Qualität fein ausgeleuchteter Kammerspiele.

Das Loy-typische Einheitsbühnenbild (Raimund Orfeo Voigt) ist dieses Mal ein kahler, schmucklos aus dunklem Holz gezimmerter Kasten, der düster vor sich hinbrütet, und der im Laufe der Aufführung durch eine sich immer weiter absenkende Decke eine zunehmend klaustrophobische Wirkung verbreitet. Links befindet sich ein Fenster, durch dessen trübe Scheiben das Mondlicht dringt. Am Boden gibt es eine Luke, unter der die gallische Druidin Norma ihre beiden Kinder verbirgt. Sie stammen aus einer heimlichen Beziehung mit dem römischen Anführer Pollione. Mit seinen Truppen ist er der Repräsentant einer grausamen Besatzungsmacht. Durch die verbotene Liebe zum Feind übt Norma Verrat an ihrem Volk, dessen spirituelle Anführerin sie ist. Loy nimmt diesen Kern und transformiert ihn in eine in den 1940er Jahren angesiedelte Geschichte eines Widerstandskampfes. Dabei standen ihm die von den Nazis besetzten Niederlande vor Augen. Er geht dabei jedoch sehr dezent vor, zeigt keine NS-Uniformen, Hakenkreuze, Maschinengewehre oder sonstigen Plattheiten, sondern beläßt es dabei, über die schlichten Kostüme (Ursula Renzenbrink) eine zeitliche Verortung mehr anzudeuten, als sie vorzuführen. Letztlich kommt es darauf auch nicht an, denn die Geschichte einer zwischen der Liebe zu den eigenen Kindern, zum heimlichen Geliebten und zum eigenen Volk verzweifelt zerrissenen Frau erhält durch die Konzentration auf innere Konflikte etwas Zeitloses. Was in dieser Produktion jedoch zu selten gelingt, ist das Erzeugen nachhaltiger Bildeindrücke. Der schwach beleuchtete Holzkasten brütet trostlos vor sich hin, und trostlos agieren darin die grau gekleideten Darsteller. Wenn nicht ein paar Stühle und ein Tisch herumstünden, hätte man das Ganze auch ohne Kulissen spielen können. Und mitunter geschieht genau das. Immer wieder nämlich geht ein schwarzer Vorhang herunter und verbirgt das Bühnenbild, während vor dieser dunklen Wand auf dem schmalen Streifen bis zum Orchestergraben die Handlung weitergeht. Am Ende, wenn Norma in einem Akt der Selbstopferung laut Libretto einen Scheiterhaufen besteigen soll, züngeln ein paar mickrige Flammen um die Stuhlbeine herum. Das ist dann doch ein recht kraftloser Schluß.

Elza van den Heever als Norma
Eine derart starke Reduktion des szenischen Beiwerks bedarf außerordentlicher schauspielerischer Leistungen. Sie werden insbesondere von Elza van den Heever in der Titelpartie aufgeboten. Sie formt das Bild einer handfesten, mitunter geradezu derben Frau, die auch einmal bloßfüßig und breitbeinig über die Bühne stapft. Ihre enormen stimmlichen Mittel stellt sie schonungslos in den Dienst einer totalen Einverleibung einer vom inneren Zwiespalt aufgeriebenen Figur. Über weite Strecken nimmt sie ihre an sich recht kräftige Stimme zurück, dünnt sie geradezu auf Bindfadenstärke aus. Doch hat diese Zurückgenommenheit nichts Verzärteltes. Stets ist die eingehegte Kraft dahinter präsent, ist die Anstrengung hörbar, welche die Bändigung der Stimme erfordert. Der so geformte Charakter hat etwas Animalisches. Besonders sinnfällig wird das, als Norma in Adalgisa eine Rivalin um Pollione erkennt und ihre zunächst freundlich zugeneigte Stimmung in Wut umschlägt. Hier läßt der Regisseur sie auf allen Vieren zu Boden gehen und dort regelrecht zum sprungbereiten Raubtier mutieren. „Da werden Weiber zu Hyänen.“ Wenn sie voll aussingt, offenbart die Stimme ein herbes Timbre mit einer gewissen Schärfe in exponierten Lagen. „Belcanto“, Schöngesang im schlichten Wortsinne, ist das nicht. Gleichwohl packt diese darstellerische und musikalische Entgrenzung das Premierenpublikum und reißt es am Ende zu Beifallsstürmen hin.

Stefano La Colla als Pollione mit Elza van den Heever
Ihr zur Seite steht Stefano La Colla, dessen robuster Tenor mit guter Mittellage und allzu protzig aufgesetzten Spitzentönen sich gut zum Porträt eines etwas eindimensionalen Karrierebeamten Pollione fügt. Für Robert Pomakov scheint die Tessitur des „Oroveso“, Normas Vater, mitunter unbequem hoch zu liegen, so daß sein solider Einsatz hier deutlich hinter dem fabelhaften Eindruck zurückbleibt, den er in Frankfurt zuletzt als „Fürst Gremin“ in „Eugen Onegin“ gemacht hat.
Das Gegenbild der bis zum Wahnsinn zerrissenen Titelfigur liefert Gaëlle Arquez in der Rolle der „Adalgisa“. Ihr runder, schöner Mezzo darf sich in Schwärmerei verströmen und in Terzen an die Stimme der van den Heever anschmiegen. Dieser stimmliche Kontrast der weiblichen Hauptfiguren zueinander bei jeweils exemplarischer musikalischer Ausleuchtung ist der musikalische Coup der Besetzung, der diese Produktion in den Rang des Außerordentlichen hebt.

Gaëlle Arquez als Adalgisa
Im Orchestergraben waltet mit Antonio Fogliani ein idealer Bellini-Dirigent, der kapellmeisterliche Qualitäten mit italienischem Esprit verbindet. Bei den Tempi ist er flexibel und verwirklicht mit dem aufmerksam folgenden Orchester organisch wirkende Rubati. Der Klang ist nicht zu dick, wirkt gut ausgehört und farbig. Es sind schöne Kantilenen von Flöte und Cello zu hören. Sehr wirkungsvoll machen die prasselnden Pauken mit harten Schlegeln auf sich aufmerksam. Vor allem aber ist Fogliani ein aufmerksamer Begleiter, der die Sänger nie zudeckt, mit ihnen atmet und sie behutsam zu führen versteht.
Wie gewohnt überzeugt der von Tilman Michael vorbereitete Chor mit homogenem Klang und dynamisch gut abgestuften Einsätzen.

Die Produktion ist derart auf Elza van den Heever in der Titelrolle zugeschnitten, daß eine Umbesetzung bei künftigen Wiederaufnahmen den Charakter der Inszenierung verändern wird. So trifft es sich, daß die Oper Frankfurt ihr ehemaliges Ensemblemitglied für die Reprise in einem Jahr bereits gebucht hat. Wer nicht auf Restkarten spekuliert, wird sich so lange gedulden müssen, denn alle Vorstellungen des Premierenzyklus sind bereits ausverkauft.
Michael Demel, 12. Juni 2018
Bilder (c) Barbara Aumüller
PS
Eine instruktive Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie ist online verfügbar.
DIE LUSTIGE WITWE
Premiere am 13. Mai 2018
Trailer
Hanna Glawari auf Naxos
Am Ende ist es dann doch eine große Operettensause geworden. Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Wenn Regisseur Claus Guth inszeniert, darf niemand erwarten, daß einfach nur die Handlung bebildert wird. Ohne doppelten Boden, ohne weitere Deutungsebenen geht es bei ihm nicht. Da Guth aber, wie er als Gast bei der Spielzeitpressekonferenz verraten hatte, Geschmack am Operettenhumor gefunden hat und die Qualitäten gerade der „Lustigen Witwe“ besonders schätzt, hat er sich einen Trick ausgedacht: Er bedient lustvoll sämtliche Klischees von falscher Folklore über schmissige Tanzeinlagen bis zu schenkelklopfender Komik samt Slapstick und dreht insbesondere die Klamaukschraube noch ein paar Windungen weiter. Aber er stellt durch eine Rahmenhandlung eine Fallhöhe her, die Tiefgang erlaubt und der Operettensüße gerade soviel Bitterkeit beimischt, daß sie die Intelligenz der Zuschauer nicht beleidigt, ohne ihnen den Spaß zu verderben. Die Methode dazu ist nicht völlig neu und bei zahlreichen anderen Stücken bereits erfolgreich erprobt worden: Man stellt das eigentliche Stück als Handlung in der Handlung vor und läßt die Darsteller in der Rolle von „Darstellern“ gleichsam aus dem Rahmen treten. Man mag dabei zunächst an Cole Porters „Kiss me, Kate“ denken.

Bei näherem Hinsehen erweist sich Guths „Witwe“ aber als Verwandte der „Ariadne auf Naxos“. Hier wie da wird das Porträt einer verlassenen Frau präsentiert. Die „wüste Insel“ der Ariadne ist für die Darstellerin der „Witwe“ die Garderobe, in der ein aufdringlich lärmendes Metronom ihre trostlose Einsamkeit vermißt. Wie bei Hoffmannsthal-Strauss in einem Vorspiel als Rahmen für die eigentliche Oper die Protagonisten als Darsteller und kapriziöse Opernsänger präsentiert werden und diese erste Ebene schließlich mit der zweiten Ebene der Opernaufführung verschmilzt, so daß am Ende nicht einmal mehr die Darsteller wissen, ob die Stimmungen und Gefühle ihrer Figuren nicht doch ihre eigenen sind, so hat sich Guth ein Filmset für den Dreh der Operette ausgedacht, bei dem die Schauspieler mit den von ihnen dargestellten Figuren verschwimmen. Den gesamten ersten Akt bis zur Pause läßt sich Guth damit Zeit, diese Idee auszubreiten. Er verweigert zunächst die Ouvertüre, sondern zeigt Marlis Petersen in der Titelrolle, wie sie in ihrer Garderobe gelangweilt Einsingübungen vollführt. Man erfährt, daß die Sängerin mit dem männlichen Hauptdarsteller Iurii Samoilov eine vergangene Beziehung verbindet, der die Petersen noch immer nachtrauert, während Samoilov die Erinnerung mit Alkohol und leichten Mädchen zu vertreiben sucht. Die beiden sprechen sich immer wieder als „Marlis“ und „Iurii“ an, um dann unvermittelt zu „Hanna Glawari“ und „Graf Danilo Danilowitsch“ zu werden. Dabei werden dann wie nebenbei die ersten Operettenschlager abgearbeitet, so daß etwa das berühmte „Heut geh‘ ich ins Maxim“ in der Künstlergarderobe erklingt. Man wechselt von Garderobe zu Filmkulisse, chargiert in die Filmkameras hinein, tritt dann wieder aus den Kulissen heraus und mimt den Mimen. So entsteht ein zunächst etwas anstrengendes Stop-and-Go. Kaum ist mal eine Operettennummer in Gang geraten, unterbricht ein Regisseur-Darsteller („Studiolicht!“) und reißt den Zuschauer aus der schwelgenden Gemütlichkeit. Das zieht sich mitunter. Die Kritik daran hat Claus Guth gleich mitinszeniert, indem er den Regisseur-Darsteller (großartig mit blasiertem Wiener Akzent:
Klaus Harderer) ausrufen läßt: „Das ist hier nicht ‚Die Entdeckung der Langsamkeit‘, sondern ‚Die lustige Witwe!‘“ Schöner hätten wir es nicht sagen können, und so gehen wir gut unterhalten, aber nicht restlos überzeugt in die Pause.

Danach aber fackelt der Regisseur ein wahres Feuerwerk ab. Der erste Aufzug diente lediglich als notwendige Exposition, um nun die fein herausgearbeiteten und deutlich präsentierten Stränge kunstvoll zu verweben und durcheinander zu wirbeln, daß es eine Freude ist. Zu sehen sind von Ramses Sigl schwungvoll choreographierte Tanzszenen, deren Schmiß und genau an der Musik orientierte Präzision Claus Guth in seiner lebendigen Personenregie fortführt. Zu sehen ist das perfekte Timing, welches Komödien benötigen, und das so schwer zu verwirklichen ist. Zu sehen sind aber auch fein dosierte tragikomische Momente, die noch nachhallen, wenn der überdrehte Operettentrubel verklungen ist. Da ist zum Beispiel der schöne Einfall, im ersten Aufzug einen Klavierbegleiter (Mariusz Klubczuk) auftreten zu lassen, der mit der Operndiva deren Partie einstudiert. Man sieht ihn später schüchtern zwischen den Kulissen herumstehen. Er hält eine rote Rose in der Hand, die er der heimlich von ihm verehrten Hauptdarstellerin überreichen will. Beinahe hätte man ihn übersehen. Zum kleinen Theatercoup wird später seine unerwartete stille Solonummer während des Vorspiels zum letzten Akt. Da tritt er vor den heruntergelassenen Zwischenvorhang, hält wieder eine einzelne rote Rose in der Hand und übt deren Übergabe. Dann geht er ab, um gleich wieder an der selben Stelle zu erscheinen, dieses Mal mit einem kleinen Rosenstrauß. Wieder verschwindet er unverrichteter Dinge, noch einmal kehrt er zurück, und nun trägt er einen üppigeren Rosenstrauß vor sich her. Die kleine heiter-melancholische Caprice von unerfüllter Sehnsucht findet am Ende ihre große tragische Entsprechung. Nach dem vor den Filmkameras zelebrierten Operetten-Happy-End glaubt Hanna/Marlis, nun auch ihre Beziehung zum Darsteller des „Danilo“ glücklich wiederhergestellt zu haben. „Iurii!“, schmachtet sie ihn mit seinem tatsächlichen Namen an. Er aber antwortet mit „Hanna“. Ein Operetten-Ende gibt es nur im Film. Die Sehnsucht von „Marlis“ bleibt unerfüllt.

Marlis Petersen (Hanna Glawari) und Iurii Samoilov (Graf Danilo)
Die musikalische Umsetzung verbindet sich perfekt mit der ambitionierten Regie. Joana Mallwitz animiert das Opernorchester zu Schmelz und Präzision, läßt die Tanzrhythmen luftig und – wo nötig – knackig schwingen und bereitet den Sängern für die beiden musikalischen Höhepunkte des Abends einen wunderbar zart gewebten Teppich. So gelingt Marlis Petersen und Iurii Samoilov das unverhoffte Kunststück, das Duett „Lippen schweigen“ mit zarter Innigkeit von süßlichem Kitsch zu befreien, so daß man es ohne Peinlichkeit genießen kann. Noch stärker aber wirkt das „Vilja-Lied“, bei dem die Dirigentin Tempo und Lautstärke zurücknimmt und Marlis Petersen melancholische Silberfäden spinnt. Das Publikum lauscht mit angehaltenem Atem.
Überhaupt bleiben vokal und darstellerisch keine Wünsche offen. Neben der außerordentlichen Petersen erweist sich Iurii Samoilov als Idealbesetzung für den Danilo. Er verfügt über einen jugendlich-saftigen Bariton mit geradezu tenoral-cremiger Höhe. Sogar sein slawischer Akzent (er ist gebürtiger Ukrainer) paßt perfekt zur Rolle eines Diplomaten aus einem Balkanstaat. Barnaby Rea kann als „Baron Zeta“ sein komödiantisches Talent einmal mehr unter Beweis stellen. Martin Mitterrutzner ist mit schmelzendem Tenor ein fabelhafter „Rosillon“. Besonders muß man die Leistung von Elisabeth Reiter bewundern. Sie ist kurzfristig in der Rolle der „Valencienne“ eingesprungen, zeigt jedoch keinerlei Unsicherheiten und belebt die Szene mit ihrem spritzigen Sopran und ansteckender Spiellaune. Die übrigen Rollen sind aus dem Ensemble tadellos besetzt. Der von Tilman Michael in gewohnter Güte präparierte Chor bewältigt auch seine choreographischen Aufgaben mit Hingabe.

Bühnenbildner Christian Schmidt nutzt die große Frankfurter Drehbühne, um gleich drei unterschiedliche Spielorte in geschmeidigen Übergängen zu präsentieren. Künstlergarderoben, Ballsaal und Außenfassade des Filmstudios stehen nebst Kulissenzwischenräumen zur Verfügung und werden von Olaf Winter punktgenau in das passende Licht gesetzt.
Ein kritisches Wort muß hier noch zur Akustik gesagt werden. Zwar hat die Oper Frankfurt endlich eingesehen, daß Sprechtexte in den Weiten ihres Zuschauerraumes untergehen, und hat die Darsteller mit kleinen Mikrophonen zur elektronischen Verstärkung der Sprechpassagen (nicht des Gesanges) ausgestattet. Jedoch erweist sich die Qualität der Lautsprecher einmal mehr als unbefriedigend. Unnatürlich klingt das, leicht blechern und leider ohne hinreichend gute Trennschärfe. Immerhin gehen so die Pointen nicht völlig verloren, und irgendwann im Laufe des Abends hat man sich schließlich daran gewöhnt. Die Gesangstexte jedoch bleiben zu einem großen Teil unverständlich, und das liegt offenbar nicht am mangelhaften Artikulationswillen der Sänger, sondern wieder einmal daran, daß die Kulissen zwar prima aussehen, aber nach oben offen sind und jedenfalls in den Ballsaalszenen eine zu große räumliche Tiefe ohne ausreichende Reflexionsflächen aufweisen. Gut, daß es Übertitel gibt.

Insgesamt: Die neue Frankfurter Operettenproduktion ist klug ausgetüftelt, lebendig inszeniert und üppig ausgestattet. Da nicht zuletzt hinreißend musiziert wird, endet diese Premiere in begeistertem, ungebrochenem Applaus für alle Beteiligten.
Michael Demel, 16. Mai 2018
Bilder (c) Monika Rittershaus
PS
Eine vorzügliche Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie ist online verfügbar. Weitere Vorstellungen gibt es am 18., 20. und 27. Mai sowie am 3., 13., 16., 22. und 25. Juni.
Zweite OPERNFREUND-Kritik
Aus einem Totenhaus
27. April 2018
Kränzles Seele
In den letzten gut vierzig Jahren gab es an der Oper Frankfurt im Intervall eines Jahrzehntes eine Modellinszenierung des mährischen Komponisten Leos Janaceks. In den 1970ziger Jahren begeisterte Volker Schlöndorf mit einer kammerspielartigen Katja Kabanowa mit der außergewöhnlichen Hildegard Behrens in der Titelpartie. Alfred Kirchner folgte 1980 mit einer perfekten unvergesslichen Inszenierung der Jenufa mit unerreichbaren Sängerdarstellern (June Card, William Cochran, Danica Mastilovic und Anny Schlemm). Schließlich dann 1994 der nächste große Wurf, diesmal Janaceks letztes Werk „Aus einem Totenhaus“ in einer Übernahme aus Brüssel. Regisseur Peter Mussbach vertraute seinerzeit ganz der überwältigenden Kraft der collagenhaften Musik und siedelte dieses Endzeitspiel in einem erdfarbenen Nirgendwo, aus der sich die einzelnen Protagonisten lemurenhaft herausschälten. Wer diese Inszenierung gesehen hat, wird sie kaum vergessen können.
Nun nach 24 Jahren wieder eine Neuproduktion, diesmal inszeniert von David Hermann. Spannend dabei die Besetzung des Bühnenbildners Johannes Schütz, der bereits die letzte „Totenhaus“-Produktion in Frankfurt ausstattete. Hermanns Inszenierung ist kein großer Wurf und siedelt das Geschehen gegenwärtig an. Gorjancikov ist hier ein Journalist, der bei der Arbeit überfallen und ins Lager abgeführt wird. An seiner Seite eine Frau, die hier wohl den Freiheitsgedanken verkörpert. Janacek hatte hierfür als Figur einen verletzten Adler vorgesehen, der am Ende der Handlung die Freiheit erblickt. Der Regisseur klammert dies jedoch aus. Hermann erzählt in labyrintischen Räumen auf beiden reichlich genutzten Drehbühnen konkret die Handlung. So gibt es mitunter zu viel Aktionismus. viel Grausamkeit und Folteraktion, was auf die Dauer dann doch reichlich „dekorativ“ wirkt. Da hilft es auch nichts, wenn aus den Protagonisten neue Charaktere gebildet werden. So ist hier z.B. Filka ein sadistisch operierender Arzt. Aha......erhellend für die Handlung? Nein! Vor allem auch deshalb nicht, da er als Widersacher von Shiskov während dessen Erzählung versterben sollte. In dieser Inszenierung ist das so nicht zu sehen. Als zynischer Arzt sind seine ursprünglichen Schmerzensschreie nonverbale Kommentare zu Shiskovs Monolog. Dazu positioniert er sich in der Attitüde des „Herren-Menschen“ breitbeinig hinter ihm. Das ergibt alles keinen Sinn und beraubt diese zentrale Szene um ein wesentliches Handlungselement.
Handwerklich wirkt die Inszenierung oft unschlüssig. Einerseits wird vieles überdeutlich ausgespielt, andererseits, wirken die Gefangenen in ihren sauberen Kleidern unwirklich. Wer Janaceks finales Werk erstmals hört, wird vielleicht überrascht sein, wieviel Seelenton und auch lichte Momente diese Musik beinhaltet. Diese Musik berührt tief und sie stellt an die Protagonisten höchste Ansprüche.
In Frankfurt war ein spielfreudig agierendes Ensemble zu erleben mit einer spektakulären Einzelleistung. Weder szenisch noch musikalisch, waren die Charaktere deutlich von einander abgesetzt. Gordon Bintner als Gorijancikov gefiel mit seinem gehaltvollen Bariton und war darstellerisch intensiv gefordert. Als sadistischer Lagerarzt Filka Morozov agierte Vincent Wolfsteiner mit stimmlich schneidender Schärfe. In seiner Erzählung blieb er hingegen zu blass im Ausdruck. Auch AJ Glueckert als Skuratov agierte gestalterisch eindimensional, gefiel hingegen mit sicherem Tenorklang. Auch hier war die Erinnerung an die Vorgänger-Inszenierung sehr präsent, gab es doch mit dem großen Menschengestalter William Cochran eine perfekte Besetzung des Skuratovs! Peter Marsh berührte als Shabkin. Die übrigen kleineren Partien waren überzeugend besetzt.
Großartig und unvergesslich war Johannes Martin Kränzle, der als Shiskov den größten Monolog zu durchleiden hatte. Die stimmliche und ausdrucksbezogene Farbpalette war außergewöhnlich. Die Verschmelzung mit seinem Rollencharakter geriet zutiefst erschütternd. Selten gewährt ein Künstler einen solchen tiefen Einblick in die Seele einer Rolle! Dazu begeisterte Kränzle mit glutvollem Gesang. Jederzeit war zu spüren, dass Kränzle den Text versteht und fühlt. Ein großer, herausragener Künstler, der zeigt, wie lebendig, aufrüttelnd bis ins Mark eine Erzählung geraten kann, wenn sie durchlebt wird und der Ausdruck ungehemmt fließt. Wunderbar!
Am Pult des gut einstudierten Frankfurter Museumsorchesters stand Gast-Dirigent Tito Ceccherini. Seine Interpretation erschien unausgewogen. Bereits im Vorspiel irritierten seltsame Kontraste in den Tempi. Zäh fließend und läppisch im Tonfall hier, dann wieder Tempobeschleunigungen die sehr aufgesetzt, unorganisch wirkten. Im weiteren Verlauf fand Ceccherini dann doch zu einer klareren Vorstellung, meiselte vor allem die Effekte im Schlagzeug heraus. Hingegen fehlte ihm der Mut, die Ruhepunkte in der Musik deutlicher herauszustellen. Großartig einmal mehr, wie souverän das famose Frankfurter Museumsorchester diese schwierige Partitur realisierte!
Das überschaubare Publikum spendete anhaltenden Beifall. Große Ovationen für Johannes-Martin Kränzle.
Dirk Schauß 28.4.2019
Bilder siehe Premierenbesprechung unten!
AUS EINEM TOTENHAUS
Bericht von der Premiere am 1. April 2018
Schonungsloser Blick auf die menschliche Rohheit
David Herrmann ist ein Geschichtenerzähler, der gerne große Bögen spannt. Wo es keine allesumspannende Geschichte gibt, da denkt er sich eine aus. Nun hat sich der Regisseur Leos Janaceks letztes Bühnenwerk „Aus einem Totenhaus“ vorgenommen, das in der Vorlage mehr einem episodenhaften Oratorium als einer klassischen Handlungsoper gleicht. Der Komponist hatte Dostojewskis Bericht aus einem sibirischen Straflager drei Monologe entnommen, in denen Häftlinge von ihren Mordtaten erzählen. Eingepackt sind diese Erzählungen in skizzenhafte Schilderungen eines brutalen und rohen Lageralltags. Mitgefühl mit den Sträflingen ist nicht beabsichtigt. Allenfalls die Figur eines politischen Gefangenen, der zu Beginn der Oper eingeliefert, mißhandelt und schließlich unverhofft am Ende wieder entlassen wird, bietet einen Ankerpunkt für das Identifikationsbedürfnis des Publikums. Hier setzt David Herrmann an. Der politische Gefangene Gorjancikov ist bei ihm ein Journalist aus unserer Gegenwart. Die letzten Takte des Orchestervorspiels zeigen ihn bei der Arbeit am Laptop. Er wird verhaftet und in ein Straflager verschleppt, dessen genaue Verortung Regie und Bühnenbild (Johannes Schütz) vermeiden. Wie leicht und wie billig wäre es gewesen, hier aktuelle Bezüge etwa zu Guantanamo oder historische zu den Konzentrationslagern und Gulags des 20. Jahrhunderts herzustellen. Immerhin deuten einige Kostüme (Michaela Barth) an, daß wir uns in Rußland befinden: Der Lagerkommandant etwa trägt eine Uschanka, und später taucht ein orthodoxer Pope auf. Das Bühnenbild nutzt die Doppeldrehbühne des Frankfurter Opernhauses, um mit einigem Aufwand eine unwirtliche, trostlose Leere plastisch werden zu lassen. Halbtransparente Wandfragmente wandern wie überdimensionale, weit gespreizte Lamellen vorüber und deuten Räume mehr an, als daß sie diese umgrenzen.

Gordon Bintner (Alexandr Petrovič Gorjančikov) und Ensemble
Schon wieder müssen wir das Adjektiv „surreal“ für eine Operninszenierung gebrauchen, denn was sich in den knapp 90 Minuten nun vor den Augen der Premierenbesucher ausbreitet, ist ein Horrortrip durch eine disparate Vorhölle, in die sich der verhaftete Journalist unvermittelt geworfen sieht. Statt der Auspeitschung zu Beginn zertrümmert man ihm mit einem Hammer die Knochen beider Hände. Zur Behandlung der Verletzungen wird er auf einer Pritsche festgebunden. Die Figur des „Filka Mozorov“ interpretiert Regisseur Herrmann als Lagerarzt, der gefährlich mit einer Knochensäge herumhantiert, und von dem deswegen zunächst nicht klar ist, ob er den Neuankömmling foltern oder kurieren will. Nebenbei erzählt er die Geschichte des Mordes, dessentwegen er in das Lager gesteckt wurde. Vincent Wolfsteiner zeichnet diese Figur durch seinen schneidenden Charaktertenor mit latentem Hang zum hinterhältigen Wahnsinn.

Samuel Levine (Der ganz alte Sträfling), Karen Vuong (Aljeja), Gordon Bintner (Alexandr Petrovič Gorjančikov; liegend) und Vincent Wolfsteiner (Filka Morozov)
Die zweite Mordgeschichte erzählt AJ Glueckert als „Skuratov“ mit gut fokussiertem Tenor, dem er den Ton verzweifelter Leidenschaft abzugewinnen weiß. Er hatte den Zwangsverlobten seiner großen Liebe Luisa erschossen. Schon sieht man in einem der vorüberziehenden Raumfragmente den Erschossenen tot über einem Eßtisch hängen, während ein emsiger Beamter im Schutzanzug die Spuren des Tatorts sichert. Im Mittelteil der Oper hat Janacek zwei kurze Theaterspiele platziert, welche die Häftlinge zur eigenen Belustigung aufführen. In der Frankfurter Neuproduktion geraten sie zu Demonstrationen sinnloser Grausamkeit eines bösartigen Mobs an einem Außenseiter. Szenisch profilieren kann sich hier besonders Brandon Cedel, der als namenloser „Sträfling 1“ zwar wenig zu singen hat, dafür aber mit beeindruckender Bühnenpräsenz den Handlungsverlauf des zweiten Hauptteils entscheidend prägt. Geradezu beängstigend ist die Überzeugungskraft, mit der er einen hinterhältig-sadistischen Drahtzieher spielen kann.
Der dritte Teil ist ganz auf Johannes Martin Kränzle als „Siskov“ zugeschnitten. Auch er schildert, dabei zunehmend irrer werdend und sich in eine regelrechte Raserei hineinsteigernd, ein Gewaltverbrechen, den Eifersuchtsmord an seiner Ehefrau. In seiner langen Erzählung nimmt er mit unterschiedlicher Stimmfärbung verschiedene Rollen ein und nutzt die dankbare Vorlage weidlich zur Profilierung als gar nicht so heimlicher Hauptdarsteller.

Johannes Martin Kränzle (Šiškov) und Vincent Wolfsteiner (Filka Morozov)
Ein wenig stellt er damit Gordon Bintner in den Schatten, der als eine der wenigen nicht vom Wahnsinn angefressenen Figuren Qualen, Verzweiflung und Aufbäumen des Journalisten Gorjancikov sehr eindrücklich mit seinem kernigen Bariton beglaubigt. Was der Zuschauer zu sehen bekommt, ist sein Alptraum. Gemeinsam mit ihm durchmißt das Publikum diesen Kreis der Hölle, von dem der Regisseur nicht zu viel versprochen hat, wenn er in ihm einen Widerschein von Dantes Inferno erblickt. Als weiterer Sympathieträger steht ihm Karen Vuong in der Hosenrolle des „Aljeja“ zur Seite, die ihrem runden Sopran anrührende Töne des Mitgefühls abzugewinnen weiß. Die zahlreichen weiteren Klein- und Kleinstrollen sind trefflich aus dem Ensemble besetzt. Mit einem feinen, profilierten Auftritt macht der bewährte Peter Marsh als „fröhlicher Sträfling“ auf sich aufmerksam.
Besonders heikel ist die Aufgabe des Orchesters. Immer wieder hatte man bei Aufführungen und Einspielungen des Werkes den Eindruck, hier habe jemand einen Film mit der falschen Tonspur unterlegt. Mal klang es zu perfekt und poliert, mal zu folkloristisch. Tito Ceccherini läßt nun das Frankfurter Opernorchester derb und mit geradezu ungeschlachter Brutalität aufspielen. Janaceks Expressionismus erklingt roh und unbehauen, Intonationstrübungen der Streicher in den exponierten Lagen eingeschlossen. Was man zunächst für technische Schwäche halten wollte, hat Methode. Sehr bald gewinnt man die Gewißheit, daß diese rohe Derbheit genau den der Textvorlage angemessenen Ton trifft.

Das Frankfurter Produktionsteam pfropft dem Stück keine Moral, noch nicht einmal eine Botschaft auf. Es präpariert einfach nur Janaceks schonungslosen Blick auf die menschliche Grausamkeit und Boshaftigkeit schmerzhaft frei. Das ausgestellte Leiden des Journalisten ist so sinnlos wie seine unverdiente Freilassung am Ende. Es gelingt dem engagiert spielenden und vorzüglich singenden Ensemble, einen immer stärker werdenden Aufmerksamkeitssog zu erzeugen, der das Publikum packt und erschüttert. Die dadurch hervorgerufene Beklommenheit wirkt im zunächst langsam und schütter einsetzenden Schlußapplaus nach, der erst in der Bewertung der Einzelleistungen zu angemessener Stärke findet, die Rückkehr des Publikumslieblings Kränzle nach krankheitsbedingter Abwesenheit feiert und auch dem Regieteam schließlich ungeteilte Anerkennung zukommen läßt.
Weitere Vorstellungen gibt es am 6., 8., 12., 15., 21., 27. und 29. April.
Eine vorzügliche Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie ist online verfügbar.
Michael Demel, 2. April 2018
© Bilder: Barbara Aumüller
Giacomo Meyerbeer
L’AFRICAINE – VASCO DA GAMA
Bericht von der Premiere am 25. Februar 2018
Grand opéra überzeugt als Weltraummärchen
TRAILER
Der Weltraum – unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Vasco da Gama, der viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Sein Schiff dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat…
Nein, diesen Vorspann gibt es nicht bei der Neuinszenierung von Meyerbeers letztem Bühnenwerk an der Oper Frankfurt. Er würde aber gut passen. Das Produktionsteam um den Regisseur Tobias Kratzer hat sich nämlich entschieden, eine etwas haarsträubende Seefahrergeschichte von der Nautik in die Astro-Nautik zu verlegen. Die spannende Frage ist bei solchen Ansätzen immer, ob das Konzept bruchlos aufgeht, ob sich der Text des Librettos auch zu einem andersartigen Sujet fügt. Nach viereinhalb unterhaltsamen und spannenden Stunden kann man sagen: Er fügt sich erstaunlich gut, und das insbesondere deswegen, weil das Sujet gar nicht so andersartig ist.
Worum geht es in dem Stück? Der Seefahrer Vasco da Gama ist als einziger Überlebender von einer Expedition zu unentdeckten Kontinenten zurückgekehrt. Er präsentiert am portugiesischen Hof seinen Auftraggebern zwei Sklaven, darunter die attraktive Selika, die er zwar in Afrika erworben hat, die aber offenbar aus einem anderen, unbekannten Land stammen. Er bittet um das Kommando für eine neue Expedition, um dieses Land zu entdecken. Das Kommando bekommt aber sein Rivale, Don Pedro, der obendrein auch noch die Verlobte da Gamas, Ines, zur Frau erhält. Die Mission des Rivalen droht aber zu scheitern, da der als Lotse eingesetzte Sklave Nelusko das Schiff in gefährliche Gewässer leitet. Da Gama ist mit eigenem Schiff seinem Rivalen hinterhergeeilt und trifft gerade noch rechtzeitig ein, um ihn vor dem drohenden Untergang zu warnen. Don Pedro will davon nichts hören und befiehlt die Hinrichtung da Gamas. Da zieht ein Unwetter auf und das Schiff kentert. Zufällig sind gerade die Landsleute der Sklaven in der Nähe, die das Schiff entern, den Großteil der portugiesischen Mannschaft massakrieren und die Überlebenden gefangen nehmen. Die Sklavin Selika entpuppt sich als Herrscherin dieses exotischen Volkes. Da sie sich in da Gama verliebt hat, versucht sie, ihn mit einer Lüge vor einer den Gefangenen drohenden rituellen Hinrichtung durch die giftigen Ausdünstungen des Manzanillo-Baumes zu retten: Er sei in Wahrheit ihr Gemahl. Der Held spielt mit und beginnt, die Gefühle Selikas zu erwidern. Seine Ex-Verlobte Ines, die sich unter den übrigen Gefangenen befindet, überlebt auf wundersame Weise die Hinrichtung, trifft auf Da Gama, wird dabei von Selika überrascht, die sich nach anfänglichen Eifersuchts- und Rachephantasien entschließt, zugunsten der Rivalin von ihrem Geliebten abzulassen und selbst den Freitod unter den Dünsten des giftigen Baumes zu wählen.
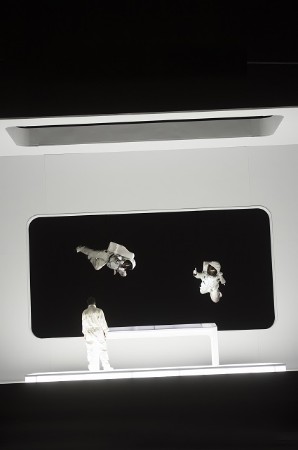
Diese Geschichte ist also eine nur äußerlich an historischen Gegebenheiten grob und willkürlich entwickelte Fantasy- und Liebesstory. Regisseur Kratzer transponiert sie zu seinen Zwecken in zwei Schritten. Zunächst knüpft er an die Figur des Entdeckers ferner Welten an. Da ist die Wahl einer Weltraummission völlig plausibel. Der erste Akt spielt noch auf der Erde im NASA-Hauptquartier. Zur Ouvertüre wird auf den Vorhang die berühmte vergoldete Pioneer-Plakette projiziert, die 1972 der interstellaren Raumsonde als Botschaft an Außerirdische mitgegeben wurde. Vasco da Gama tritt dann in Astronautenkluft vor ein Komitee von Entscheidungsträgern, die ihm eine weitere Mission verweigern. In einem zweiten Schritt werden dann die vom Textbuch vorgesehenen Exotismen und Unwahrscheinlichkeiten mit Anklängen an Meilensteine des Science-Fiction-Kinos eingekleidet und so genießbar gemacht, nicht selten mit einem Schuß Ironie und Humor. Es gibt Referenzen an „2001“, „Star Trek“, „Avatar“, „Gravity“ und natürlich „Star Wars“, dessen alle Filme eröffnende Laufschrift über einem Sternenmeer gekonnt imitiert wird (mit einem klug reflektierenden Text von Claude Lévi-Strauss). Hier haben Bühnenbildner Rainer Sellmaier und Videokünstler
Manuel Braun ein großartiges Setting bereitgestellt, das von der Regie geradlinig bespielt wird. Ein besonderes Wagnis war es dabei, das Volk der Wilden als Aliens zu interpretieren. Sie sind nach dem Vorbild der Bewohner des Mondes „Pandora“ in dem Spielfilm „Avatar“ gestaltet, also mit blauer, fein geäderter Haut ausgestattet. Die Kopfform hat etwas Reptiloides. So etwas kann furchtbar lächerlich wirken. Rainer Sellmaier, der auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet, ist es jedoch gelungen, die Haut der blauen Aliens mit perfekt sitzenden Ganzkörperanzügen wie selbstverständlich wirken zu lassen, so daß die phantastische Gestalt der Wilden eine Glaubhaftigkeit eigener Art entfaltet. Flugartisten in Raumanzügen simulieren Ausflüge in die Schwerelosigkeit, die vor dem Hintergrund von Weltallprojektionen einen großartigen Anblick bieten.

Claudia Mahnke (Selika), Brian Mulligan (Nelusko), Magnus Baldvinsson (Brahma-Priester) und Chor
Das Produktionsteam bleibt mit dieser Herangehensweise dem Wesen der Grand opéra treu, die ja als Blockbuster des 19. Jahrhunderts auf Schauwerte, Exotismen und spektakuläre Kulissen setzte.
Spektakulär gelungen ist auch die musikalische Seite dieses Abends. Antonella Manacorda hat mit dem Opernorchester ein Klangbild erarbeitet, das von französischer Clarté durchdrungen ist. Alles ist licht und transparent, deutlich und durchhörbar. Wir haben dieses Werk zuletzt an der Deutschen Oper Berlin gehört, wo man nacheinander drei große Opern von Meyerbeer in den Sand gesetzt hat. Effekthascherisch und ordinär klang es da. Man war geneigt, der boshaften Bemerkung Richard Wagners zu folgen, daß das Wesensmerkmal dieser Partituren „Wirkung ohne Ursache“ sei. In Frankfurt nun meint man eine völlig andere Musik zu hören. Wie beseelt und elegant zugleich doch die stark geforderten Holzbläser spielen! Wie fokussiert und schlackenlos die Streicher mit ihrem stark reduzierten Vibrato klingen! Wie unaufdringlich sich das Blech in raffinierten Registermischungen einfügt! Und wie apart das Schlagwerk eingesetzt wird! Manacorda erweist sich als Klangmagier mit kühlem Kopf, der Meyerbeer historisch genau verortet. Dieser Orchesterklang bereitet großen Genuß.
Mit Lautstärke hält sich das Orchester abgesehen von einigen exponierten Stellen, an denen es angemessen krachen darf, sehr zurück und webt einen feinen Klangteppich, auf dem sich die Gesangskunst der Protagonisten unangestrengt entfalten kann. Für die männliche Titelrolle hat die Oper Frankfurt einen der derzeit international begehrtesten Belcanto-Tenöre gewonnen: Michael Spyres. Der junge Amerikaner verfügt über eine gut fokussierte Stimme mit einem attraktiven Kern. Sie vereint Eleganz und Strahlkraft bis in die unangestrengte Höhenlage. Er ist in dieser Partie nicht weniger als eine Idealbesetzung.

Die weibliche Hauptrolle der Selika ist mit dem Ensemblemitglied Claudia Mahnke besetzt. Sie erfüllt diese Rolle durch ihren glutvollen Mezzosopran mit Leben. Ihr üppiges Vibrato hegt sie gut ein, kann ihre Stimme zu fein schwebenden Phrasen zurücknehmen und ebenso mit nie nachlassender Energie zu expressiven Ausbrüchen führen. Darstellerisch beglaubigt sie die Rolle des Aliens mit reptilienhaft-tänzerischen Bewegungen. Zugleich gelingt es ihr, die einzige Figur des Abends zu zeichnen, mit der das Publikum mitfühlen kann. Großartig ist auch Brian Mulligan mit seinem prächtigen Bariton als ihr Begleiter Nelusko. Auch er hat die Kostümierung als bulliger Alien mit beiläufiger Selbstverständlichkeit angenommen.
In der Rolle der Iris stellt sich das künftige Ensemblemitglied Kirsten MacKinnon vor, die über einen jugendlich-dramatischen Sopran mit großer Durchsetzungskraft verfügt. Aus dem Ensemble sehr charakteristisch besetzt sind auch die drei Baßbariton-Partien des Don Pedro mit Andreas Bauer (sonor, aber leicht gaumig), Don Diego mit Thomas Faulkner (mit schlankerem Ton und für das jugendliche Alter des Sängers erstaunlich reif) sowie die als Doppelrolle begriffene Partie des Großinquisitors und später des Brahma-Priesters mit Magnus Baldvinsson (der seiner zuletzt sehr knorrig gewordenen Stimme dieses Mal einen erstaunlich fülligen Klang mit ordentlich bewältigter Höhe abtrotzt).

Liebestod im Weltall
Immer wieder vereint Meyerbeer die Solisten zu Duetten und Ensembles, oft a capella ausgeführt oder nur von wenigen Instrumenten begleitet. In diesen Momenten erlebt man auf der Bühne ein wunderbar abgerundetes, gut ausgehorchtes und leuchtendes Klangbild ohne Dominanz einer Einzelstimme. Zusammen mit dem von Tilman Michael gut vorbereiteten, auf den Punkt musizierenden Chor bietet sich ein Fest der Stimmen, das vom Premierenpublikum einhellig mit großem Beifall gefeiert wird.
Der Regieansatz jedoch spaltet die Premierenbesucher. Eine lautstarke Minderheit scheint ihn gehaßt zu haben und provoziert mit ihren kräftigen Buhrufen noch kräftigere „Bravi“ als Gegenreaktion.
Weitere Vorstellungen gibt es am 2., 11., 16., 23. und 31. März sowie am 2. April
Michael Demel, 27. Januar 2018
© Bilder: Monika Rittershaus
P.S.
Vorzügliche Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie:
CAPRICCIO
Bericht von der Premiere am 14. Januar 2018
TRAILER
Ein unerwartetes Geschenk für Opernfreunde
Seien wir ehrlich: Einen derart beglückenden Opernabend hatten wir nicht erwartet. „Ein Konversationsstück für Musik“ hat Richard Strauss sein letztes Bühnenwerk überschrieben. Zu seinem Wesen hatte er ausgeführt: „Keine Lyrik, keine Poesie, keine Gefühlsduselei. Verstandestheater, Kopfgrütze, trockenen Witz!“ Mitten im Zweiten Weltkrieg schien sich der greise Komponist in einen Elfenbeinturm zurückgezogen zu haben. Nicht einmal mehr „Oper“ wollte er es nennen, wenn sich im spätabsolutistischen Frankreich ein Dichter und ein Komponist um die Gunst einer Gräfin streiten und dabei wortreich einen Disput um das Verhältnis von Dichtung und Musik in der Bühnenkunst führen. Gespickt hatte Strauss die Partitur mit raffinierten musikalischen Anspiellungen, Rück- und Selbstbezügen und machte sich keine Illusionen über die Publikumswirksamkeit seiner Kopfgrütze. „Vielleicht nur ein Leckerbissen für kulturelle Feinschmecker“ sei das. Immerhin hatte er den Ehrgeiz, in diesem erklärtermaßen letzten Bühnenwerk eine Art musikalisches Testament zu hinterlassen.
Man hatte sich vor dieser Frankfurter Premiere also auf einen Abend gepflegter Langeweile eingestellt, war aber zuletzt dadurch beunruhigt worden, daß die Produktionsregisseurin in der Vorberichterstattung verbreiten ließ, sie werde die Zeitbezüge aufzeigen und die vom Stück scheinbar verdrängte Entstehung inmitten der Nazi-Barbarei kenntlich machen. Wir sahen schon die notorischen SS-Uniformierten aufmarschieren und saßen entsprechend mißmutig im Zuschauerraum – um dort sofort vom Anblick eines üppig wallenden, kunstvoll-beiläufig gerafften roten Brokatvorhangs besänftigt zu werden, der wie ein Barockgemälde auf den eigentlichen Bühnenvorhang aufgebracht ist.

Clairon (Tanja Ariane Baumgartner) und Graf (Gordon Bintner) vor Barockvorhang
Das einleitende Streichsextett beginnt vor diesem verschlossenen Vorhang, der sich zum bewegteren Mittelteil des Vorspiels hebt. Es erscheint ein von Wänden aus Glasbausteinen gesäumter und mit wenigen Korbmöbeln wintergartenhaft ausgestatteter Salon, an dessen Rückseite sich eine kleine Theaterbühne mit einer Kopie von eben jenem Vorhang in leicht abgewetztem Zustand befindet. Theater im Theater soll hier also gespielt werden, doppelbödig erscheint das alles schon zu Beginn. Außerdem sieht dieses von Johannes Leiacker entworfene Bühnenbild fabelhaft aus. Man befindet sich in den 1940er Jahren, machen Kulissen und Kostüme deutlich. Und doch bleibt man in Paris, bleibt im Umfeld hochgestellter Persönlichkeiten mit zahlreicher Dienerschaft. Die Vorlage wird nicht übermalt, sondern lediglich vom behaupteten Rokoko in die Gegenwart der Entstehungszeit transferiert. Die Glaswände sind vereist, zeigen so auch symbolisch den Winter des Schreckens, der vor den Mauern herrscht. Zudem lassen die halbtransparenten Wände schemenhafte szenische Kontrapunkte von außen zum vordergründig sorglosen Kunstdiskurs im Innern zu.

Was Brigitte Fassbaender nun in diesen Kulissen präsentiert, ist nichts weniger als eine Meisterleistung. Das Komödienhafte des Stückes zeigt sie mit viel Sinn für Humor, einige Albernheiten und Mut zum Slapstick inbegriffen. Das alles ist in dem durchweg intelligenten Libretto bereits angelegt, und die Regisseurin vermag es, mit einem zugleich präzise und locker agierenden Ensemble Witz und Charme der Vorlage leuchten zu lassen. „Kopfgrütze“ und trockener Witz werden launig wie prickelnder Champagner serviert. Langeweile kommt da in keiner Minute auf.
Heikler ist dagegen das Offenlegen der Zeitbezogenheit. Hier gilt es, feinste Andeutungen aufzuspüren und Ungesagtes bildlich zu verdeutlichen. Daß auch dies gelingt, macht diese Regiearbeit zur Maßstäbe setzenden Großtat. Fassbaender denunziert das Werk nicht, und sie überfrachtet es auch nicht plump mit Nazi-Uniformen, Soldatenstiefeln oder Bombenangriffen (denen sich schließlich das Münchener Uraufführungspublikum im Jahre 1942 allnächtlich ausgesetzt sah). Sie folgt zunächst der Spruchweisheit, daß Kinder und Narren die Wahrheit sprechen. So ist es hier der hinzugefügten stummen Rolle eines Kindes überlassen, die Abgründe der Entstehungszeit anzudeuten. Gleich zu Anfang stellt das Kind sich breitbeinig am Bühnenrand auf und salutiert spielerisch mit einem Hitlergruß. Dann erscheint es immer wieder mit Kriegsspielzeug beiläufig im Salon, wo die Erwachsenen ihre feinsinnigen Kunstdiskussionen führen. Daß dies eine dem Werk innewohnende, untergründige Schicht ist, präpariert Fassbaender überzeugend aus der großen Rede des Theaterdirektors La Roche heraus. Vordergründig entwickelt er die Vision eines Bühnenstücks über den Untergang Karthagos. Dabei fallen Sätze wie: „Seht hin auf die niederen Possen, an denen unsre Hauptstadt sich ergötzt! … Die Masken zwar sind gefallen, doch Fratzen seht ihr statt Menschenantlitze!“

Die Gräfin (Camilla Nylund) mit Schauspieldirektor La Roche (Alfred Reiter)
Dazu läßt die Regisseurin den Schauspieldirektor Diaprojektionen vorführen, die vorgeblich Entwürfe für die Kulissen des fiktiven Karthago-Stücks zeigen sollen. Gleich die ersten Bilder aber präsentieren, was das Textbuch mit „unsre Hauptstadt“ meint: nicht Paris, sondern die berüchtigten Modelle von Albert Speer zu Hitlers größenwahnsinnigen Umbauplänen Berlins in eine Hauptstadt „Germania“ werden gezeigt. In immer schnellerer Folge sieht man Kriegszerstörungen und verwüstete Städte, die gleichsam aus der Leinwand ausbrechen und als Projektionen schließlich den gesamten Bühnenraum ausfüllen. Wohin der Wahnsinn des Dritten Reiches führen wird, darf der Dichter Olivier als Resümee zum Ende des Vortrags verkünden: „Zum Schluß auf den Trümmern großes Ballett!“ Da hatte die Nazi-Zensur wohl geschlafen, als sie dieses Libretto freigab.
Das Werk ist eben nicht bloß feinsinnig gesponnener Schwanengesang, sondern zugleich diskreter Zeitkommentar. Fassbaender verhilft beidem zu seinem Recht. Gerade weil die Aufgabe so heikel war, kann man ihre glückliche Bewältigung triumphal nennen.
Dazu hat ihr die Opernintendanz eine exzellente Sängerbesetzung bereitgestellt, die wie in Frankfurt üblich aus den üppigen Reserven des Stammensembles schöpfen kann. So straft etwa AJ Glueckert in der Rolle des Komponisten Flamand die Behauptung Lügen, Strauss habe Tenöre nicht leiden können und ihnen hinterhältig unattraktive, dabei viel zu hohe Partien geschrieben. Nichts davon läßt der Sänger sich mit seinem baritonal grundierten, elegant bis in sichere Höhen geführten Tenor anmerken. Seine Darbietung des Sonetts ist ein erster musikalischer Höhepunkt. Nahezu tadellos präsentiert sich auch Daniel Schmutzhard als dessen Gegenspieler Olivier. Schon lange hat man seinen kernigen Bariton nicht mehr so unangestrengt fließen gehört.

Komponist (AJ Glueckert) und Dichter (Daniel Schmutzhard) buhlen um die Gräfin
Die wunderbare Tanja Ariane Baumgartner erfreut mit ihrem noblen Mezzo in der Rolle der Schauspielerin Clairon, die vom Bruder der Gräfin den Hof gemacht bekommt. Diesen Grafen gibt Gordon Bintner mit saftigem Kavaliersbariton, den man gerne auch in Frankfurt endlich einmal in einer Mozartrolle hören möchte. Alfred Reiter singt in der Rolle des Schauspieldirektors La Roche: „Ich sehe mich schon als Baßbuffo umherirren.“ Nun, da besteht bei Reiter keine Gefahr. Dazu ist seine Stimme inzwischen zu spröde. Den Mangel an sonorer Stimmesfülle gleicht er jedoch durch nuancierte Artikulation aus, mit der er seiner Figur scharfkantiges Profil und ironische Würze verleiht. Sydney Mancasola und Mario Chang markieren als italienische Sänger genau jene volltönenden Fremdkörper, als die sie vom Libretto konzipiert wurden. Selbst die Kleinstrollen der acht Diener sind mit jungen Sängern so vorzüglich besetzt, daß ihr gemeinsamer Einsatz kurz vor dem großen Schlußgesang zu einem perfekt abgemischten Ohrenschmaus gerät. Der Bayreuth-Veteran Graham Clark hat mit seinem durchdringenden Charaktertenor einen kurzen, aber prägnanten Auftritt als Souffleur.
In dieses exquisite Sängerensemble fügt sich als Gast Camilla Nylund in der tragenden Rolle der Gräfin perfekt ein. Nachdem sie in letzter Zeit vermehrt Ausflüge ins dramatische Fach unternommen hat, stellte sich die Frage, ob ihre Stimme noch zu den Silbertönen fähig ist, die eine Strauss-Partie von einem Sopran verlangt. Das ist sie, und sie klingt dabei lebendig, eben weil die Erkundungen jenseits der Grenzen eines lyrischen Soprans ihrem Gesang Reife und Farbe verliehen haben. In den Konversationspassagen der ersten beiden Drittel macht sich das außer in einem ausgeprägten, aber sicher eingehegten Vibrato noch kaum bemerkbar. Zur vollen Geltung kommt die Gestaltungskunst der Nylund aber in dem berühmten langen Schlußgesang, den sie hinreißend gestaltet.

Schlußgesang der Gräfin
Das Strauss-erfahrene Opernorchester hält sich unter der Leitung von Sebastian Weigle lange Zeit sehr zurück und zeigt einen klaren und transparenten Klang, der außerordentlich sängerfreundlich ist und es über weite Strecken erlaubt, dem Text ohne allzu häufigen Blick auf die Übertitel zu folgen. Aufblühen darf das Orchester im Vorspiel zum Schlußmonolog der Gräfin. Dabei scheint das die Melodie tragende Solo-Horn ein wenig zu sehr auf Sicherheit bedacht zu sein, wodurch dem Klang ein letzter Rest an abgeklärter Innigkeit fehlt. Im Übrigen paßt die hellwache und unpathetische Musizierhaltung perfekt zu den Intentionen der Inszenierung. Die Musik läßt sich so durchaus genießen, ohne daß man in die Gefahr gerät, vom Strauss‘schen Klangrausch überflutet zu werden.
Der Schlußapplaus ist ungeteilt zustimmend und kräftig, mit Bravi für die Nylund. Dem Frankfurter Produktionsteam ist es gelungen, das selten gespielte Stück von seinem Nimbus als intellektuelle Spielerei für Spezialisten zu befreien und es als unerwartetes Geschenk für jeden Opernfreund zu präsentieren.
Weitere Vorstellungen gibt es am 18., 20., 24., 26., 28. Januar sowie am 1., 10. und 18. Februar.
Eine vorzügliche Audio-Einführung der Frankfurter Opern-Dramaturgie ist online verfügbar.
Michael Demel, 17. Januar 2018
© Bilder: Monika Rittershaus
Arnulf Herrmann
DER MIETER
Bericht von der Uraufführung am 12. November 2017
TRAILER
Vorsicht, wachsame Nachbarn!
Mit Uraufführungskritiken ist das so eine Sache. Man erlebt – angeblich – Neues, noch nie Dagewesenes, und sucht doch nach Orientierung durch Vergleiche. Die Frankfurter Oper hat unter Einsatz ihrer immensen künstlerischen Potenz ein Auftragswerk herausgebracht, bei dem das Vergleichen sich geradezu aufdrängt. Der Stoff nämlich folgt dem symbolistisch-surrealen Roman „Le Locataire chimérique“ des Zeichners, Schriftstellers und Schauspielers Roland Topor, den bereits Roman Polanski als Vorlage für seinen Film „Le locataire“ (bekannt auch unter dem englischen Titel „The Tenant“) genutzt hat. Wer sich den Film in Vorbereitung auf den Opernabend noch einmal angesehen hat, wird den Stoff darin mühelos wiederfinden: Ein junger Mann, in der Oper heißt er „Georg“, mietet ein möbliertes Zimmer. Die Vormieterin hatte sich aus dem Fenster gestürzt. Gleichwohl ist sie auf unheimliche Weise noch immer präsent. Die Nachbarn zeigen sich lärmempfindlich, lauernd, verschlagen. Haben sie die junge Frau in den Tod getrieben? Schnell entwickelt Georg paranoide Züge, identifiziert sich mit der Vormieterin. Wahn und Wirklichkeit, Innen- und Außenwelt verschwimmen. Der junge Mann fühlt sich verfolgt, getrieben, nimmt immer mehr die Persönlichkeit der Vormieterin an, trägt schließlich sogar deren zurückgelassenes Kleid und ergibt sich endlich in deren Schicksal, indem auch er sich aus dem Fenster des Zimmers stürzt.

Björn Bürger (Der Mieter) mit Chor
Eine alptraumhafte Geschichte, ein Psychothriller mit kafkaesken Wendungen. Und so vergleicht man im Laufe des Abends nicht nur die Oper mit dem Film, sondern entdeckt freudig weitere Referenzen an die Literatur- und Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Gerade als der Kritiker sich vorgenommen hat, auf Parallelen zum Schicksal von Kafkas „Gregor Samsa“ hinzuweisen, wird auf der Bühne auf einen Zwischenvorhang mit großen Lettern „Die Verwandlung“ eingeblendet. Als Überschrift dieses Premierenberichts war bereits Sartres „Die Hölle, das sind die anderen“ gesetzt. Dann schlug der Kritiker die Zeitung auf und mußte zu seiner Enttäuschung entdecken, daß bereits der Kollege von der FAZ seine Besprechung der Uraufführung mit diesem Zitat eingeleitet hatte. Das war wohl allzu naheliegend.
Gleichwohl besitzt das neue Werk künstlerische Eigenständigkeit und ist kein bloßer Abklatsch eines Kinofilmes oder ein müder Aufguß hinlänglich bekannter surrealistischer oder kafkaesker Klischees. Dafür sorgt bereits die szenische Umsetzung, die in ihrer suggestiven Verbindung von Bühnenbild, Videoeinblendungen und Regie schon von der ersten Minute an derart überzeugt und regelrecht überwältigt, daß sich ein Besuch der Produktion alleine dafür bereits lohnt. Mit den von Bibi Abel produzierten Videos gelingt es dem Produktionsteam gleich zu Beginn, mehrdeutige Raumeindrücke zu vermitteln. Auf einen Zwischenvorhang wird eine realistische Ansicht eines abgenutzten, schäbigen Zimmers projiziert, die Szene der Zimmervermittlung an den Mieter erscheint als Stummfilm, die Sänger stehen hinter der halb transparenten Leinwand. Der Vorhang wird zur Seite geschoben, und zum Vorschein kommen kleine, auf der Drehbühne rotierende Inseln, die Räume andeuten. Kaspar Glarner hat das Bühnenbild entworfen. Unsichere Standorte schlingern in einem spukhaften Reigen durch ein schwarzes Nichts. Das für die Handlung zentrale Zimmer des Mieters erscheint wie ein unwirtliches Floß in diesem surrealen Meer. Zum Höhepunkt des Wahnsinns im dritten Akt kippt dieses Floß in einem bedrohlich steilen Winkel und reckt seine kalt leuchtende Oberfläche mitsamt seinem Bewohner dem Publikum entgegen, sodaß der Eindruck entsteht, man blicke von oben auf den Raum herab.

Schließlich wird ein Video auf den Zwischenvorhang projiziert, in welchem der Protagonist sich wie Alice im Wunderland als Riese in einem viel zu kleinen Raum klaustrophobisch windet. Durchgängig werden die Szenen von derart starken und fesselnden Bilderfindungen geprägt, daß man sie gar nicht alle aufzählen kann. Die Darsteller bewegt Regisseur Johannes Erath in diesem Geflecht von Schein und Sein mit großer Plausibilität. Vorproduzierte Filmeinblendungen und Bühnengeschehen greifen in einer Perfektion ineinander, die Staunen macht. Dabei erweisen sich die Sängerinnen und Sänger als ausgezeichnete Darsteller. Die Krone gebührt, wie sollte es anders sein,
Björn Bürger in der Titelpartie. Seinen Weg in den Wahnsinn zeichnet er mit plastischer Eindringlichkeit, die trotzdem nichts Chargierendes hat. Nie läßt er seine Figur zur Karikatur werden.
Die suggestive Stärke des Visuellen führt zu einem Effekt, den man bei zeitgenössischem Musiktheater oft beobachten kann: Die Musik wird über weite Strecken lediglich als elaborierter Soundtrack wahrgenommen. Hier tritt sie immerhin in vier längeren Passagen in den Vordergrund: Im ersten Sologesang des Protagonisten und in drei „Gesängen am offenen Fenster“ der geisterhaft präsenten Vormieterin. In seinem ersten Sologesang zeigt sich Björn Bürger auch musikalisch in herausragender Form. Über weite Strecken ungestützt, nur von elektronisch zugespielten Tropfgeräuschen eines Wasserhahns begleitet, absolviert der junge Bariton aberwitzige Intervallsprünge zwischen tiefem Baßregister und Falsett. Über die reine Stimmakrobatik hinaus vermag er es zudem, die Töne unter Nutzung einer großen Farbpalette klanglich nuanciert abzustufen. Daß er dabei intonatorisch offenkundig staunenswert präzise bleibt, zeigt sich, als gegen Ende des Gesanges ein Instrumentalklang sich dem gerade erreichten Falsett-Ton auf exakt gleicher Tonhöhe beimischt. Die drei „Gesänge am offenen Fenster“ hat Arnulf Herrmann der Sopranistin Anja Petersen auf den Leib geschrieben. Sie wurden als Extrakt aus der Oper bereits vor einiger Zeit mit Petersen in München uraufgeführt. Es handelt sich um sirenenhafte Klänge, bei denen Orchester, Live-Elektronik und Stimme zu einem hypnotischen Ganzen verschmelzen. In diesen reflektierenden Momenten wird die Eigenständigkeit der Musiksprache von Arnulf Herrmann plastisch erlebbar, während in den Szenen, welche die Handlung vorantreiben, Neue-Musik-Mainstream mit Clustern und verfremdeten traditionellen Formen und Rhythmen vorherrscht. Wenn dann aber zum Kulminationspunkt im dritten und abschließenden Teil eine nicht enden wollende Abfolge von dissonanten Akkorden in infernalischer Lautstärke regelrecht auf die Hörnerven des Publikums einstampft, ist man geneigt, sich einfach die Ohren zuzuhalten und zu hoffen, daß es endlich aufhören möge.

Die von Händl Klaus aus der Romanvorlage herausdestillierten Textfetzen wirken arg manieriert. Das in seiner Informationsfülle wie immer vorzügliche Programmheft gibt den Text vollständig wieder. Man erkennt optisch Reminiszenzen an konkrete Poesie, teilweise kippt auch das Spielen mit Silben und Lauten ins Dadaistische. Als Sprachkunstwerk erscheint das Libretto überambitioniert. Als kreativer Ausgangspunkt hat es beim Komponisten aber offenbar schöpferische Energie freigesetzt und somit seinen Zweck erfüllt.
Die Nebenrollen sind mit einer Ausnahme aus dem Ensemble besetzt. Ausnahmslos alle bewältigen ihre Partien mit erkennbarer Lust und unangestrengt wirkender Selbstverständlichkeit. Alfred Reiter als Vermieter „Herr Zenk“ steht die knorrige Schwärze der tief liegenden Baßpartie sehr gut, Claudia Mahnke zeichnet mit ihrem satten Mezzo als „Frau Greiner“ das Bild eines Mobbingopfers zwischen tiefer Verängstigung und verzweifelter Hoffnung, Michael Porter und Theo Lebow führen mit ihren klaren Tenorstimmen groteske Satzergänzungsspiele auf, Sebastian Geyer gibt maliziös einen Kellner. Für die kleine Rolle der „Frau Bach“ hat man die große Hanna Schwarz gewonnen, die sich uneitel in das Ensemble einfügt. Große Bedeutung kommt den Choreinsätzen zu, in denen eine zwielichtige Masse sich mehr und mehr als zum tödlichen Ende drängender Mob erweist. Hier hat die Oper Frankfurt auf den „Philharmonia Chor Wien“ als Gastensemble zurückgegriffen, weil wohl die parallele Vorbereitung der Choroper „Peter Grimes“ und der Chöre im „Troubadour“ zusätzlich zu der Uraufführung selbst die Kräfte des leistungsstarken Hauschores überfordert hätte.

Anja Petersen (Johanna) und Ensemble
Ohne Mitlesen der Partitur läßt sich immerhin feststellen, daß Gastdirigent Kasushi Ono sich als zuverlässiger Organisator und Koordinator des Klanggeschehens erweist. Zu der staunenswert perfekten Verschmelzung von optischen und akustischen Eindrücken zu einem Gesamtkunstwerk leistet der Dirigent einen erheblichen, wenn nicht den entscheidenden Beitrag.
Dicht, intensiv, visuell überwältigend, musikalisch durchaus reizvoll: So läßt sich der Eindruck von der Uraufführung zusammenfassen. Ein Besuch der Produktion kann empfohlen werden. Gelegenheit dazu besteht dazu noch am 16., 18., 24. und 29. November sowie am 2. und 7. Dezember.
Michael Demel, 14. November 2017
Bilder: Barbara Aumüller