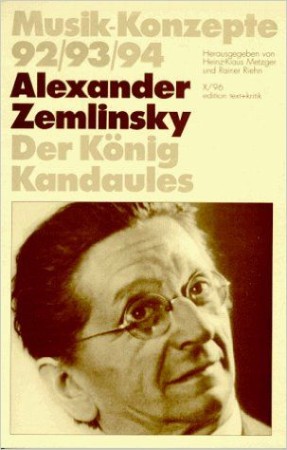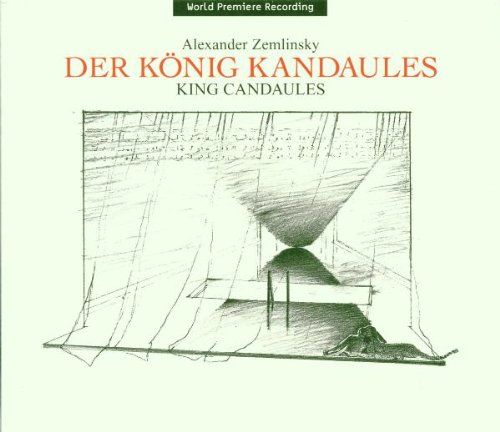Intendant André Bücker




http://www.theater-augsburg.de/
LA CLEMENZA DI TITO
Premiere am 23. Oktober 2021
Theatralisch über ein an sich interessantes Ziel hinausgeschossen
Das Staatstheater Augsburg spielt seit Jahren in seinem Ausweichquartier Martinipark - ein recht schlichter Theaterraum mit guter Akustik und relativ großer Bühne - im Schatten der legendären Renovierungsverzögerungen großer Häuser wie der Staatsoper Berlin, mittlerweile ja fertig, und der Oper Köln, wo manche kaum noch an eine Fertigstellung glauben. So bekommt nicht jeder in der Opernszene mit, dass sich auch die Renovierung der schönen alten Oper Augsburg mittlerweile über alle Gebühr verzögert. Man denkt nun an 2025/26…
 Natürlich sind in einem solchen Provisorium nicht alle szenischen Dimensionen einer „normalen“ Opernaufführung möglich. So war es ein prinzipiell verständlicher Griff der Intendanz, den jungen polnischen Schauspielregisseur Wojtek Klemm für die Regie zu engagieren, der auch noch nie Oper inszeniert hatte. Mit Patrice Chéreau und seinem Bayreuther „Jahrhundert-Ring“ 1976 gibt es ja das wohl prominenteste Beispiel, dass so etwas durchaus gut gehen kann. Nun ist Mozarts Werk „La clemenza di Tito“, parallel zur „Zauberflöte“ anlässlich der Krönung Leopolds II. mit dem Libretto von Caterino Mazzolà nach Pietro Metastasio geschrieben, nicht gerade das beste Beispiel für Operndramatik, sodass ein unbefangener Schauspielregisseur im Opernstoff natürlich nach Anhaltspunkten sucht, das Ganze etwas aufregender und vielleicht auch anspruchsvoller zu machen.
Natürlich sind in einem solchen Provisorium nicht alle szenischen Dimensionen einer „normalen“ Opernaufführung möglich. So war es ein prinzipiell verständlicher Griff der Intendanz, den jungen polnischen Schauspielregisseur Wojtek Klemm für die Regie zu engagieren, der auch noch nie Oper inszeniert hatte. Mit Patrice Chéreau und seinem Bayreuther „Jahrhundert-Ring“ 1976 gibt es ja das wohl prominenteste Beispiel, dass so etwas durchaus gut gehen kann. Nun ist Mozarts Werk „La clemenza di Tito“, parallel zur „Zauberflöte“ anlässlich der Krönung Leopolds II. mit dem Libretto von Caterino Mazzolà nach Pietro Metastasio geschrieben, nicht gerade das beste Beispiel für Operndramatik, sodass ein unbefangener Schauspielregisseur im Opernstoff natürlich nach Anhaltspunkten sucht, das Ganze etwas aufregender und vielleicht auch anspruchsvoller zu machen.
Dabei leistete ihm die Dramaturgin Vera Gertz offenbar signifikante Helfe. Im schlichten, aber inhaltsvollen Programmheft, (in dem nach Gender-Überfluss in jenem zu „Orpheus und Euridice“ im Oktober 2020 nur noch einmal ein - ebenfalls nicht zielführendes und ebenso unangebrachtes - „Mitarbeiter:innen“ erscheint), werden mit Zitaten von Elias Canetti zu „Masse und Macht“ (1960), Niccolò Machiavelli zu „Der Fürst“ (1513) und Cesare Beccaria zu „Über Verbrechen und Strafen“ (1766) am Wert der Güte des Herrschers dezidierte Zweifel geäußert, also der Clemenza, wie sie in der Geschichte und in Metastasios und Mozarts Werk verherrlicht wird. Bei Canetti vergeben Machthaber nur zum Schein, nie wirklich. De facto sinnen Herrscher nach Unterwerfung alles dessen, was ihnen entgegensteht.  Machiavelli sagt zwar, dass der Fürst danach trachten solle, für barmherzig zu gelten und nicht für grausam. Er solle aber die Nachrede der Grausamkeit nicht scheuen, um seine Untertanen in Treue und Einigkeit zu erhalten und nicht durch übertriebene Nachsicht Unordnung eintreten zu lassen. Beccaria wiederum warnt bei einer vollkommenen Gesetzgebung mit milden Strafen und geregelten Gerichtsverfahren vor diskretionären Begnadigungen durch den Fürsten als Akte unaufgeklärten Wohltuns durch einen öffentlichen Erlass der Straflosigkeit.
Machiavelli sagt zwar, dass der Fürst danach trachten solle, für barmherzig zu gelten und nicht für grausam. Er solle aber die Nachrede der Grausamkeit nicht scheuen, um seine Untertanen in Treue und Einigkeit zu erhalten und nicht durch übertriebene Nachsicht Unordnung eintreten zu lassen. Beccaria wiederum warnt bei einer vollkommenen Gesetzgebung mit milden Strafen und geregelten Gerichtsverfahren vor diskretionären Begnadigungen durch den Fürsten als Akte unaufgeklärten Wohltuns durch einen öffentlichen Erlass der Straflosigkeit.
Vor diesem Hintergrund muss mal wohl die Augsburger Inszenierung durch Wojtek Klemm sehen, für deren volles Verständnis man eben wieder einmal das Programmheft benötigt. Sonst würde man selbst bei gediegener Werkkenntnis einige Regieeinfälle nicht verstehen, wie beispielsweise die Erschießung Titos und Vitellias durch Annio am Schluss, als bekanntlich alle der Güte des Herrschers ultimativ huldigen und ihm ein langes Leben wünschen, sowie einiges mehr. Das gradlinige Bühnenbild von Magdalena Gut, eine bühnenbreite graue Wand mit mehreren Türöffnungen, die durch Lichtstreifen abgesetzt sind, verrichtet durchaus praktische Dienste bei Auf- und Abtritten der Protagonisten und des Chores. Von Rom oder auch nur dezenten Andeutungen der Ewigen Stadt natürlich keine Spur! Die dezente Lichtregie von Marco Vitale passt zu dieser szenischen Nüchternheit. Eine fast ständig vorhandene Schaukel dient, nicht ganz schlüssig, dem Hervorheben einiger der darauf Platz nehmenden Protagonisten. Sollte sie etwa das Schaukeln ihrer jeweiligen Schicksale symbolisieren?! Es wäre wohl eine etwas zu profane Möglichkeit.

Was aber einer stringenten Dramaturgie im Hinblick auf eine solchermaßen kritischere Betrachtung der Figur Tito Vespasiano und ihrer - behauptet - nur vermeintlichen Güte vor allem entgegensteht, ist eine Banalisierung der Optik und Szene insbesondere durch endlose Videosequenzen (Natan Berkowicz) auf der breiten Bühnenwand, die in der Regel nur wenig mit der zu sehenden Handlung zu tun haben, aber ständig für Bewegung sorgen. Auch dann, wenn man gern einmal die Aktion auf die wirklich sehr gut spielenden Protagonisten konzentriert erleben würde. Besonders heftig geht es damit ausgerechnet zu Mozarts wundervoller Ouvertüre los, bei der man eine Gartengesellschaft bei Tito erleben muss, die sich genüsslich einer Spaghetti Bolognese-Mampferei hingibt. Denn anders kann man die das Ganze auf die Spitze treibenden Versuche, sich die Pasta gegenseitig in den Mund zu schieben, wohl kaum charakterisieren. Kann denn eine Ouvertüre nicht endlich mal wieder unbespielt erklingen, einfach um dem Zuhörer die Chance zu geben, wie übrigens vom Komponisten auch gewollt, langsam in die Atmosphäre der Oper einzutauchen, bevor die Handlung beginnt? Leider reißt diese Sitte immer mehr ein, als könnten die Regisseure ihre Botschaften nicht in der normalen Spielzeit loswerden.

Wenig erfreulich geht es gleich weiter, als Sesto sich bis auf die Unterwäsche, ein mittlerweile immer beliebter werdendes postmodernes Stereotyp, auszieht und Vitellia und Annio sich einen Spaß daraus machen, ihm die Sachen Stück für Stück nur nach langem und albernem Hin und Her wiederzugeben. Auch hier geht die inhaltliche Bedeutung des wichtigen Zwiegesprächs, in dem immerhin ein Mord an Tito verhandelt wird, weitgehend verloren, zu Gunsten einer oberflächlichen und sinnentleerten Visualität. Der Herrscher selbst kommt dann zeitgeistgemäß mit weißen Turnschuhen (zeitgenössische Kostüme Julia Kornacka) herein, während Annio das ganze Stück über eine Zigarette rauchen muss - warum nur?! Später wird zum Ausdruck der Begeisterung Tito vom optisch gleichgeschalteten Chor mit allerhand Stofftierchen und anderem bunten Zeugs aus der Kinderstube beworfen. Es muss dann von vier Polizisten mit den Körpern vorher festgenommener Freiheitskämpfer wieder mühsam zur Seite gewischt werden, um die Spielfläche ohne Putzfrau zu reinigen - die allerdings in solchen Inszenierungen gern bemüht wird. Es ließe sich noch einiges mehr an zweifelhaften Regieeinfällen nennen, wie eine offenbar homoerotische Annäherung Titos an Publio und sein kurzer Pirouetten-Tanz gegen Ende. Vor dem Hintergrund des Anspruchs, die vermeintliche Güte des Herrschers und damit seine Person und Regierungsführung ganz anders als „normal“ in einem anderen Lichte zu zeigen, sind sie nicht zielführend, ja bisweilen verwirrend oder gar irritierend. Hier sind offenbar die Phantasien des Schauspiel-Regisseurs über das Ziel hinausgeschossen und ließen einen an sich interessanten und anspruchsvollen Interpretationsgedanken dieser Mozart-Oper in der Vordergründigkeit verpuffen. Weniger wäre wieder einmal mehr gewesen.

Allerdings sorgte die musikalische Seite dafür, dass es dann doch nicht ganz dazu kam und die Aufführung eine Reihe starker Momente hatte, die von den guten Sängern und dem Orchester vermittelt wurden. Natalya Boeva, die den 67. Internationalen Gesangswettbewerb der ARD München 2018 gewann, ist ein nahezu idealer Sesto mit ihrem ebenso kraftvollen wie klangschönen und ausdrucksstarken Mezzo. Hinzu kommt eine intensive Durchdringung der Rolle mit stets guter situationsbezogener Mimik. Sie ist wohl eines der besten Pferde im Sängerstall des Staatstheaters Augsburg! Sally du Randt, die ich vor vielen Jahre hier als sehr einnehmende Salome und später als ebenso gute „Tannhäuser“-Elisabeth erlebte, ist vokal mit der schwierigen Rolle der Vitellia nicht ganz zu Hause. Die Stimme weist einige Unsauberkeiten auf und zeigt Brüche ins tiefe Register. Darstellerisch ist sie ein gutes Bühnentalent und bildet mit Boeva ein spannendes Duo. Ekaterina Aleksandrova a.G. besticht ebenfalls durch einen klangschönen Mezzo in der Hosenrolle des Annio, behält dramaturgisch stets die Fäden in der Hand und ist ein weiteres sängerisches Highlight des Abends. Mirko Roschkowski a.G. konnte mich in der Titelrolle nicht ganz überzeugen. Sein durchaus schöner Mozart-Tenor lässt es doch in einigen relevanten Momenten noch an Intensität und dramatischem Ausdruck missen. Von der Regie nicht zu allzu gut behandelt zeigt er doch darstellerisches Talent. Jihyun Cecilia Lee, die 2020 hier eine sehr gute Euridice sang, kann auch an diesem Abend mit ihrem perfekt geführten und zur Rolle passenden etwas mädchenhaften Sopran glänzen. Torben Jürgens a.G. gibt einen wirschen und auch vokal etwas rauen Publio.

Der Augsburger GMD Domonkos Héja dirigiert die Ausburger Philharmoniker und den stimmstarken Opernchor des Staatstheaters Augsburg mit offenbar sehr Mozart-erfahrener Hand. Angesichts des allzu visuell orientierten Geschehens aus der Bühne hätte man dem guten Orchester gern eine größere Rolle zugestanden. Schon in der sehr akzentuiert gespielten Ouvertüre erklingen die Streicher brillant. Es gibt stets gute Transparenz der einzelnen Gruppen. Die Holzbläser sorgen für warme Tongebung, während Héja es bestens versteht, die Akzente richtig zu setzen und damit von der musikalischen Seite her dieser „Clemenza di Tito“ doch noch Gewicht zugeben. Großer Applaus für ihn und das Orchester sowie vor allem für Natalya Boeva und Ekaterina Aleksandrova. Applaus ohne Buhs auch für das Regieteam.
Fotos: 1-5 Jan-Pieter Fuhr, 6 K. Billand
Klaus Billand /31.10.2021
www.klaus-billand.com
Gluck: ORFEO ED EURIDICE
Premiere am 10. Oktober 2020
Virtual Reality in der Oper – ein Experiment
Wenn man über eine lila Leuchtspur in den Saal der Ausweichspielstätte des Staatstheaters Augsburg im martini-Park kommt und auf die schon offene, mit einer gelben Leiste umrandete Bühne sieht, erinnert man sich sofort an die „Trovatore“-Inszenierung von Alvis Hermanis bei den Salzburger Festspielen 2014/15, wo man - wie nun in Augsburg - in einen farbenfrohen Museumsraum von Jan Steigert voller alter Meister sieht (Wolfgang Buchner, Leiter des Malsaals, war für die beeindruckend detailgetreue Umsetzung der Caravaggios verantwortlich) und das neugierig einströmende Publikum bei seinen teilweise skurril anmutenden Bildbetrachtungen bewundern kann. Während Anna Netrebko als Leonora in Salzburg Museumsaufseherin war, liegt die Hauptdarstellerin in Glucks „Orfeo ed Euridice“ in Augsburg von Beginn an regungslos hinten in einem abgesperrten Knautschkissen – erst später stellt sich heraus, dass es Euridice ist. Bei Gluck ist sie ja tatsächlich tot, sonst wäre die ganze Oper sinnlos.
In der Augsburger Inszenierung von André Bücker mit dramaturgischer Unterstützung von Sophie Walz und Sarah Schnoor sowie in den Virtual Reality (VR – Abkürzung muss in diesem Gewerbe sein!) -Welten von Senior Art Director Christian Schläffer und dem Verantwortlichen für Regie&Dramaturgie eben dieser VR-Welten, Christian Felder, ist die Schöne allerdings nur virtuell tot. Euridice lebt ja noch in ihrer virtuellen Welt, ihrer Virtual Reality, weiter, mit der klobigen 3D-Brille auf der Nase. Davon kann der im Diesseits agierende Orfeo natürlich nichts ahnen. Er ist eher darum bemüht, sich vom kapriziös herumstolzierenden Amor nicht den Ausstellungskatalog klauen zu lassen, profane Gegenwärtigkeit also… Das heißt, sie, denn das Regieteam lässt Orfeo mit der russischen Mezzosopranistin Natalya Boeva auch optisch als Frau auftreten, mit langen Haaren, Damenschuhen und einem leichten Hosenanzug. Übrigens genau in den Farben Gelb-Blau-Grau des Logos der Heimspiel GmbH, die für das Staatstheater Augsburg das VR-Repertoire des #digitaltheaters technisch umsetzt und natürlich auch bei „Orfeo“ maßgeblich mitwirkt (Produkt Placement?!). Für die auch sonst oft eigenwilligen Kostüme zeichnet Lili Wanner und für das Licht Andreas Rehfeld verantwortlich.

Warum nun Orfeo als Frau?! Die ursprünglich für einen Countertenor (Haut-Contre) geschriebene Pariser Fassung wird heutzutage in der Regel mit einem Alt oder Mezzo besetzt, und zwar in einer Hosenrolle - ein Rollenkonzept, welches sich nach einer Bearbeitung von Hector Berlioz für das Pariser Théâtre-Lyrique (1859) eingebürgert hat. Sollte mit zwei Damen vielleicht ein anderes Konzept der Liebe der beiden angedeutet werden?! Wenn man ins Programmheft schaut, wimmelt es nur so von „Gendersternchen“, die ein flüssiges Lesen erschweren. Da ist also für alles und alle Platz; zum ersten Mal sah ich nun auch ein Sternchen zwischen die*der Betrachter*in… Die mangelnde Akzentuierung eines männlichen Orfeo, aus welchem Grund auch immer, nahm jedenfalls einige Spannung aus dem dramatischen Ablauf des Geschehens auf der „diesseitigen“ Bühne. Für mich war es nicht mehr als ein feministischer Regie-Gag.
Aber hier ging es ja in erster Linie um ein Jenseits, eine andere Welt und Realität, eben die Virtual Reality, die, wenn man einem gleich zu Beginn des Programmheftes von der Dramaturgin Walz unterbreiteten Zitat des „Second Life“-Gründers Philip Rosedal folgen mag, bald jene sein wird, in der wir uns hauptsächlich bewegen: „In einigen Jahren werden wir die reale Welt als Museum betrachten. Wir werden nur zurückkehren, um zu essen und zu lieben.“ Nun gut, da kann man bei aller Liebe zum Cyberspace und zum Internet mit seinen vielfältigen Ramifikationen nur sagen „Wehret den Anfängen!“ Denn das kann es ja wohl nicht sein, das entspräche nicht der Natur des Menschen und seiner Evolution als Homo sapiens, also eines wissenden Lebewesens. Ein Leben ohne physischen Sport, ohne Fußball, ohne Theater und Oper…?!  In Augsburg musste aber die Virtual Reality derzeit noch verordnet werden: Schon vor Beginn wird das Publikum detailliert auf die Verwendung der klobigen 3D-Brillen, die wie Schwimmwesten in der economy class von Flugzeugen unter dem Sitz ruhen, eingeschworen und instruiert. Probeweise tanzen gleich mal drei tief tiefdekolletierte fesche Damen von der linken und rechten Seite auf 3D an. Man vermisst einen Herrn zur gender equality, etwas inkonsequent - wenn schon, denn schon…
In Augsburg musste aber die Virtual Reality derzeit noch verordnet werden: Schon vor Beginn wird das Publikum detailliert auf die Verwendung der klobigen 3D-Brillen, die wie Schwimmwesten in der economy class von Flugzeugen unter dem Sitz ruhen, eingeschworen und instruiert. Probeweise tanzen gleich mal drei tief tiefdekolletierte fesche Damen von der linken und rechten Seite auf 3D an. Man vermisst einen Herrn zur gender equality, etwas inkonsequent - wenn schon, denn schon…
Also, es ging hier in Augsburg um eine neue Sicht auf die und in der Oper, um die Nutzbarmachung der Virtual Reality, wobei sich Kunst und Technik gegenseitig inspirieren, wie Walz schreibt, ein „immersives Gesamtkunstwerk“. Man erlebe mit der VR die Möglichkeit zu einem Perspektivwechsel durch die Versetzung in einen künstlichen Körper. In einem Ersatzkörper – einem Avatar – erlebe man eine „alternative Wirklichkeit“. Sofort kommt mir der Spruch von Kellyanne Conway über die „alternativen Fakten“ anlässlich der Inauguration von Präsident Trump in den Sinn… Das Thema ist allerdings nicht ganz so neu wie es die „alternativen Fakten“ in Washington D.C. im Januar 2017 waren. Denn schon 2004 versuchte sich das Brucknerhaus Linz mit einer 3D-Animation an einem „Rheingold“ von Richard Wagner – die Brillen mussten allerdings durchgehend aufgesetzt bleiben. Der mit Spannung erwartete Versuch kam aber nicht sonderlich an. Im Jahr darauf ging der ursprünglich ganz in 3D geplante „Ring“ konzertant weiter und so auch mit der „Götterdämmerung“ zu Ende.
Das Konzept ist aber dennoch einer tieferen Betrachtung wert, zumal in Abgrenzung zum ohnehin immer mehr grassierenden Video und Film auf der Opernbühne und der Kunstform Film an sich. Um den ihrer Meinung nach zwischen Virtual Reality und dem Film bestehenden Unterschied zu verdeutlichen, zitiert Walz Randal Walser mit „Elements of a Cyberspace Playhouse“. Dieser meint, dass man den Film benutzt, um dem Publikum eine Wirklichkeit zu zeigen, während der Cyberspace dem Anwender einen virtuellen Körper und eine Rolle zuweist und versucht, die Erfahrung selbst zu vermitteln. Dramatiker und Filmregisseure versuchten stattdessen, die Idee einer Erfahrung plastisch zu machen. „Das Publikum stellt sich also nicht nur vor, es erlebe eine interessante Wirklichkeit, sondern es kann sie direkt erfahren.“ Allein, ich glaube nicht, dass das so klar voneinander zu trennen ist und der Virtual Reality eine solche Andersartigkeit gegenüber dem Film zugeschrieben werden kann, sie damit also so sensationell neu oder gar ganz anders ist. Ich denke nur an den US-amerikanischen Science-Fiction-Film „Independence Day“ von Roland Emmerich 1996. Die Welt, die sich vor dem ins Herz des Mutterschiffes der Aliens geschossenen Vietnam-Veteranen Russell Casse auftut, hat einiges gemeinsam mit jener, die sich vor den „Orfeo“-Besuchern in Augsburg auftut, wenn ihnen auf eins, zwei, drei von der Bühne aus das Signal zum Aufsetzen der 3D-Brillen gegeben worden ist. Man fliegt hinunter in eine düstere Stadt mit Lichtreklame, am Boden ringelt sich die dunkle Schlange, die wohl Euridice totgebissen haben könnte, inmitten von unzähligen schwarzgefärbten plastifizierten und geschlechtslosen menschenartigen Wesen in ständiger Bewegung. Über ihnen kreisen angsteinflößend drei riesige chinesische Drachen – Bückers und Schläffers Welt der berühmten Furien, die Orfeo bekanntlich mit seinem Gesang befrieden muss.

Das gelingt ihm ja auch, und so tauchen wir wenig später, nachdem nochmal diesseitig Luft geholt werden konnte, zum zweiten Virtual Reality Einsatz in das Elysium ein und erleben eine Welt, in der wirklich fast nichts an vermeintlich Angenehmem vergessen wurde: Natürlich geht es unter einem kitschig rosa leuchtenden Himmel und über saftig grüne Wiesen in einen altgriechischen Wellness-Park mit klassischer Architektur und Ornamentik, über eine herrschaftliche Treppe in ein luftig elegantes Badehaus mit einer Decke, die assoziativ auch einen Sprung ins Pantheon nach Rom erlaubt. Für ständige Frischwasserversorgung der Badebecken sorgen unterdessen munter vor sich hin sprudelnde Springbrunnen aus Vagina-Quellen. Wenn man aber durch das Badehaus mit seinen überall herumliegenden und platonisch liebenden Neutren durch ist, wird’s echt tierisch. Unter allerlei Paradiesgetier überraschen besonders eine Gruppe von Galapagos-Schildkröten und eine Riesenhornisse, fraglos friedlich. Wenn dann später Orfeo im Diesseits doch der Geliebten in die Augen gesehen und sie sich hinter ihrer 3D-Brille wieder ins Knautschkissen im Museum verzogen hat, kommt 3D-Gang No. 3, in dessen Verlauf all diese schönen Dinge kompromisslos in die Mülltonne wandern. Zwei ferngesteuerte Arme machen’s möglich. In der Folge wird den beiden schließlich ein Null-Acht-Fünfzehn-Wohnzimmer eingerichtet, in dem sie künftig ihrer nun neu entstandenen und besungenen Liebe ein geregeltes und sich von ihren Zeitgenossen immerhin noch positiv absetzendes Miteinander fristen können. Denn diese, und dazu gehört ein Ersatz-Jesus, zwei Nonnen, eine Doppelgängerin von Marina Abramovic, eine asiatische Touristin, ein etwas undisziplinierter US-Amerikaner aus dem Wilden Westen, einige übermotivierte Sicherheitsbeamte und einige andere, die alle auch den Chor stellen, haben sich des Museums zur Absteige bemächtigt wie bei einer Hausbesetzung, mit Wäscheleinen, Schlafsäcken und sogar einer EU-Fahne! Die Erde hat uns alle wieder.

Natalya Boeva war die Erstbesetzung des Orfeo, oder besser, der Orfea. Sie brachte viel Emphase in die Rolle ein, bei gutem Mienenspiel eines die im allgemeinen überzeugende Personenregie stringent umsetzenden Protagonisten. Ich erlebte sie schon bei ihrem Gewinn des 67. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD München 2018, wo sie mir durch ihre hohe Musikalität und ihren charaktervollen Mezzo bei bester Diktion auffiel. Auch Boevas erste Arie gelang sehr schön und wurde hörbar getragen vom großen Schmerz über Euridices Verlust. Bei der berühmten Arie im 2. Akt „Ach, ich habe sie verloren“ fehlte es aber etwas an gesanglicher Dichte und Intensität. Ein Glanzpunkt wurde sie nicht und blieb auch ohne Applaus. Hervorragend dagegen der leuchtende und bestens artikulierende Sopran von Jiyhyun Cecilia Lee als Euridice, von der man gern etwas mehr gehört hätte. Sie konnte alle Facetten der stimmlichen Anforderungen der Rolle ausloten und dabei auch noch durch ihr emotionales Spiel überzeugen. Olena Sloia beeindruckte als leicht sexy dargestellter Amor mehr durch ihre zum Teil kunstvollen Bewegungen bis hin zur Pantomime. Mit einem leichten Sopran fügte sie sich aber gut in die Dreiergruppe ein.

Schade nur, dass sie alle verstärkt wurden, angesichts der Raumverhältnisse der Behelfsbühne nicht nachvollziehbar. Damit wirkten die Stimmen des Öfteren zu laut, wie auch das Staatsorchester Augsburg, welches nicht im selben Raum saß und also zugespielt wurde. Wolfgang Katschner hatte die musikalische Leitung, und manches hätte vielleicht inniger und gefühlvoller musiziert werden können, wenn es den direkten Blickkontakt mit den Sängern gegeben hätte. Bei den 3D-Szenen war es aber ohnehin egal. Man merkte Katschners Dirigat an, dass er sich sehr für eine lebendige Alte Musik engagiert. Zusammen mit Hans-Werner Apel gründete er 1984 die lautten compagney BERLIN. Er ist ein Kenner dieses Fachs.
So bleibt die große Frage, ob das Konzept der Virtual Reality mit den offenbar unabdingbaren klobigen 3D-Brillen so, wie es hier - streckenweise durchaus interessant und auch spannend - vorgestellt wurde, ein Weg für das weitere Gedeihen der Oper als Kunstform ist. Ich bin dieser Meinung nicht. Der „Orfeo“ in Augsburg hat gezeigt, dass die eigentliche Oper, so wie sie komponiert und mit Regieanweisungen versehen wurde, und die Szenen der VR so stark auseinanderfallen, dass die dramaturgische Einheit und die dramatische Stringenz zerfallen. Gluck war ja bekanntlich ein großer Reformer der Oper. Aber sollte man ihm nicht vertrauen als kompetentem Komponisten, sein Werk aus sich selbst heraus leben und ganz authentisch beeindrucken zu lassen, sicher mit guter darstellerischer Phantasie erfahrener Regisseure. Es hat doch alle Ingredienzien eines Universal-Werkes, sodass es einer zweiten Erlebnisebene nicht bedarf, die außerdem zu Unterbrechungen im Erleben der Oper selbst führt. Durch die Frage: Wann muss ich die Brille wieder aufsetzen? geht viel an Konzentration verloren. Ich könnte mir überhaupt nicht und nie vorstellen, dass vor dem Liebesduett von Tristan und Isolde im 2. Aufzug des gleichnamigen Werkes von R. Wagner jemand auf der Bühne oder ein Licht-Signal ein Zeichen gibt, nun die 3D-Brille aufzusetzen. Das wäre dann das vorzeitige Ende von „Tristan und Isolde“…
(Weitere Aufführungen 16.5. bis 14.6.2021 im martini-Park Augsburg).
Fotos: Jan-Pieter Fuhr und Christian Schläffer (Bild 3)
Klaus Billand/19.10.2020
www.klaus-billand.com
ARIADNE AUF NAXOS
Premiere: 29.9. 2019. Besuchte Vorstellung: 25.1. 2020
Gefragt, was ihn an der Oper so interessiere, antwortete der Regisseur, dass es erst mal wahrscheinlich (!) die Musik sei, die er „so schätze“. Und weiter: „Dann habe ich so ein bisschen ein Faible für, sagen wir mal, sportliche Herausforderungen für die Regie. Ariadne, das ist ja nun ein Stück, an dem ganz regelmäßig die Regie scheitert. Oder vielleicht, sagen wir es gern noch ein bisschen fatalistischer, regelrecht scheitern muss. Und das nehme ich erst mal als sportliche Herausforderung.“
All das, was Dirk Schmeding über die Beweggründe, Strauss' und Hofmannsthals Meisterstück zu inszenieren, sagte, findet ein Abbild auf der Bühne des Theaters, auf dem bekanntlich Theater auf dem Theater gespielt wird. Denn inhaltlich motiviert erscheint hier nur das, was, überspitzt ausgedrückt, zum einen richtig scheint – und zum anderen gerade deshalb szenisch platt ist. Vermutlich kommt das (apokopierte) Verbum „platt“ von „Palette“ - aber dazu später.
Sprechen wir zunächst über die Hauptsache, also die Musik. Am Abend der letzten Vorstellung dieser Produktion klingt die Partitur unter der Leitung des GMD Domonkos Héja, man kann es kaum anders sagen, seltsam unstraussisch, einige Takte eher wie Strawinsky, also seltsam trocken. Wenig blüht hier auf, manches wackelt hier zwischen dem Graben und den teils allzu lärmigen Aktionen auf der Bühne. Zwar passt diese Ästhetik hervorragend zur nüchternen Ästhetik der Behelfsbühne im martini-Park, der sich die von Martina Segna entworfene Garagendeko von Vorspiel und Oper ideal anpasst. Nur wird an diesem Abend leider nur ein Strauss mit angezogener Notbremse gespielt, die phasenweise eher die schnarrenden Begleitstimmen als eine Violinmelodie nach oben bringt. Pianissimi werden vielleicht zu ernst genommen; weniger – zu Gunsten der Verständlichkeit der Sänger - ist nicht immer mehr, weniger ist oft eben nur weniger. Man kann das so machen, indem man den Klang als „kammermusikalische Durchhörbarkeit“ lobpreist – aber muss man es summo et unico loco machen?

Die Sänger aber versteht man auch dann nicht immer, wenn unten die Kammermusik sich zurückzieht. Schade, hat doch Hofmannsthal, mit besten Gründen, Wert darauf gelegt, dass jedes Wort begriffen wird. Sally du Rhandt aber ist darüber hinaus, mit ihrem metallischen, denkbar mozartfernen Sopran eine Ariadne machen zu können. Ihre Lady Macbeth war ideal, weil Verdi einmal bemerkte, dass die Lady „nicht singen“ dürfe. Diese Ariadne aber ist, das passt zur strengen Stimme, eher eine ältliche Diva vom optischen Typus „Draculina“ als eine jugendlich beseelte Verlassene. Zugeben: das Argument ist subjektiv, aber ich glaube nicht, dass sich Strauss und Hofmannsthal diesen Stimmtypus vorstellten, als sie die Figur der todessüchtigen Frau imaginierten. Ariadne ist kein Lady Macbeth, wenn auch eine Lady. Mal völlig von der szenischen Idee abgesehen, dass diese Ariadne ihren nächsten Liebhaber – wie Zerbinetta maliziös anmerkt – förmlich zu erwarten scheint, was dem von Hofmannsthal intendierten „Wunder der Verwandlung“ völlig widerspricht. Ein Grund mehr, eine Produktion zu kritisieren, die in diesem wesentlichen Punkt das Stück ins Gegenteil verkehrt und dadurch auch – das ist das eigentlich Dumme dieser Arbeit, die eine Interpretation sein will – die Musik verfälscht. Keine Frage: „Ariadne“ lässt sich nur schwer, vermutlich gar nicht „aktualisieren“, wenn man sie mit den Interessen und Erfahrungen eines Regisseurs und einer Dramaturgin von Anno 2019 vermengt, die eher Lacan als Hofmannsthal vertrauen. Dabei wäre eine konsequente Inszenierung im Sinne der zeitgenössischen Theorien Sigmunds Freud vermutlich spannender, ja selbst im Licht der spekulativen Psychoanalyse und Traumtheorie logischer, also weniger zufällig gewesen, was ein schönes Detail wie ein von Jean Starobinski inspiriertes Bild, aus dem schwarzer Teer ausfliesst, ja nicht ausschliessen muss.

Als Einspringer für den Tenor fungierte diesmal Michael Siemon. Sein körniger Einstand ließ im Vorspiel noch nichts Gutes erwarten, bevor er sich in der Oper vokal derrappelte und am Ende annähernd den Straussglanz seiner Kehle entließ, der für Bacchus reserviert wurde. Freilich widersprach dem sein Auftritt: der „Flüchtling“ - wie ihn die Dramaturgie im Aktualisierungswahn benennt – entert mit einem Schlauchboot und Schwimmweste die Bühne. Kein Kommentar, auch nicht zur Tatsache, dass die Regie hier aus der Hosenrolle des Komponisten eine Komponistin machte, was zumindest die sexuelle Präferenz in der Interaktion mit Zerbinetta verschob. Einziger Pluspunkt der Interpretation: Zerbinetta hat hier tatsächlich eine kurze Minute lang unironisch und stumm über ihre eigene Desorientiertheit nachgedacht. Der Rest ist eine gegenderte Werkveränderung. Man kann das so machen, aber… Zerbinetta heißt in Augsburg Olena Sloia, sie spielt kapriziös und vital, also ausgesprochen zerbinettesk, und bewältigt die gefürchtete wie geliebte Arie mit Anstand.
Und der Komponist, wie die Rolle noch bei Hofmannsthal und Strauss heißt? Natalya Boevas Stimme, die unten wie in der Mitte das Potenzial zur weiteren Kultivierung besitzt, detoniert regelmäßig und hässlich, wenn es an die Spitzentöne geht. Gleiche Unart hört man beim Tintenfisch: Jihyun Cecilia Lee zerstört das Terzett der drei Damen, wenn sie zu ihren Passagen ansetzt. Man sollte ihr vielleicht mitteilen, dass die Bühne im martini-Park nicht die Größe der Scala besitzt.

Tintenfisch? E vero: Najade, Echo und Dryde, das sind hier eine Motte, das Meerestier und ein Wiedehopf, also Wasser, Erde und Luft. Leider klingen Najade, Echo und Dryde bei Strauss und Hofmannsthal nicht eklig, absurd oder tierisch, sondern stets balsamisch. Freilich inszeniert Schmeding mit seinem Kostümgestalter Valentin Köhler die Oper „Ariadne auf Naxos“ als absurde Farce, die von einem Kunsteingreiftrupp (grotesk herausragend: der Tanzmeister mit seinem ungewöhnlich untanzmeisterischen Embonpoint und der riesenhändige Harlekin, der an die abstrusen Gestalten in der Augsburger „Kandaules“-Inszenierung von 2015 erinnerte) optisch in die surreale Ecke gestellt wird, wobei die Idee, Ariadne in einem Sarg hausen zu lassen, noch als assoziative Pointe durchgeht. Der Rest ist, woran die Aktionen des Komikerquartetts ihren Anteil haben, bei Schmeding eine Nach-68er-Performance, in der der Komponist – pardon: die Komponistin – auf der Bühne steht oder durch den Orchestergraben geht. Wer gerade dort hinschaut, verpasst freilich das, was auf der Bühne passiert; schade ist das allerdings selten.
Vermutlich wollte uns Schmeding darauf aufmerksam machen, dass das Verhältnis und die Diskrepanz zwischen dem Vorspiel und der Oper bzw. zwischen der sog. Realität und der Theater-Kunstwelt hier so offen liegen, dass man nichts Böses tut, wenn man es noch offener macht, doch auch der Umgang mit dem Terminus des „Traums“ erklärt hier zu wenig. Aus diesem Grund lässt Schmeding auch zu den Schlusstakten der Oper jenes Publikum, das im Vorspiel noch im hinteren Saal saß und seine Partie feierte, auf die Bühne kommen, wo es sich, fremdgeleitet von einer allzu durchsichtigen Regie, die Ausstattung anschaut. Und zack: die musikalische Wirkung dieses grandiosen, bewegenden Schlusses ist beim Teufel. Strauss und Hofmannsthal aber haben bewusst (und klugerweise) auf eine Widerkehr der Gestalten des Vorspiels verzichtet.
Soviel zur angeblichen Liebe des Regisseurs zur Partitur.

Stichwort „Palette“: werden die Sänger der Oper während des Vorspiels zum Vorspiel in großen Holzkisten, Zerbinetta in einem Pappkarton auf Paletten in die kahle Garage geliefert (natürlich: denn die Künstler sind für den reichen Herren ja nichts als Befehlsempfänger), so ist die Idee so richtig wie platt. Man könnte es verschmerzen, würde ein Musikmeister auf der Bühne stehen, der wenigstens ein wenig über den Wiener Charme verfügen würde, den der Haushofmeister des Erik Völker schon deshalb vermissen lässt, weil er sich vergeblich und peinlich um so etwas wie einen Wiener Zungenschlag bemüht. Man hört die Absicht und man ist verstimmt. In dieser Garage (jaja, bei Hofmannsthal ist auch nur von einem „kaum möblierten“ Raum die Rede: eine großartige Steilvorlage für absolute szenische Ödnis) ist es allerdings völlig gleichgültig, wie man spricht und singt und rezitiert; Alejandro Marco-Buhrmester bringt den graujackettigen Musikmeister insgesamt grau, an diesem Abend auch stimmlich charmelos.
Man könne an der „Ariadne“ nur scheitern? Schmeding hat es gesagt – und leider Recht behalten, weil er dem Stück fast allen Witz und fast alle Poesie austrieb. Lediglich der Sarg und Zerbinettas einsame Minute vermochten zumindest mir zu zeigen, dass es sich vielleicht lohnte, diese Inszenierung anzuschauen, die leider auch den Witz, den Charme und die pathetische Kraft der unvergleichlichen Straussschen Musik bagatellisierte. Und sage keiner, dass man im Ersatzbau des martini-Parks die vielleicht schönste aller Strauss-Opern genau so ironisch sein wollend inszenieren und trocken musizieren müsse. In diesem Fall würde jede Inszenierung jeder Oper am Ort aussehen wie diese: mit Pappkarton, Paletten und absurden Figuren, die das Wichtigste – die Musik – zu einem unverständlichen Krautsalat machen.
Frank Piontek
Fotos: © Jan-Pieter Fuhr
JESUS CHRIST SUPERSTAR
22. Juli 2019
Held wider Willen
Die ins deutsche übertragene Rockoper setzt den Fokus auf das ewig Menschliche. Wer heute eine Aufführung von „Jesus Christ Superstar“ besucht, den treiben wohl kaum religiöse Motive dazu. Seit 1971, als das Stück vom damals noch unbekannten, erst 22-jährigen Komponisten Andrew Lloyd Webber in Töne gesetzt wurde, hat sich die westliche Welt weitgehend vom Glauben an einen allgegenwärtigen, hilfsbereiten Gott abgewendet. Und dennoch schafft es dieses Musikstück auch nach fast einem halben Jahrhundert immer noch, dem säkularisierten Menschen der Gegenwart die Person Jesu nahezubringen. Denn das ist die eigentliche Intention dieser dramatischen zweieinviertel Stunden, in denen von den letzten sieben Tagen aus dem Leben des christlichen Erlösers erzählt wird. Zwölf Jahre hat es gedauert, bis das Stück auf der Freilichtbühne am roten Tor erneut zum Leben erweckt wurde. Das Augsburger Publikum erfreut sich an einer farbenprächtigen, mit viel Engagement präsentierten Inszenierung.

Ganz anders vor fast 50 Jahren – vielleicht weil Widerstände sowohl zum Christentum wie auch zu mutigen Textbüchern gehören: In den 1970ern hatten sich zahlreiche traditionelle Katholiken empört, weil Webber und Rice den Unsympath der Bibel, Judas, in ihren Augen zu positiv dargestellt hatten. Außerdem sahen viele es als Blasphemie an, die ihnen heiligen Abläufe der Bibel in ein rein weltliches Drama zu fassen. Damit haben heutige Besucher des Musicals sicher keine Probleme mehr. Jüngere stören sich eventuell an der leichten Patina, welche schon über dem Begriff „Rockoper“ liegt. In der Tat: So zeitlos „Jesus Christ Superstar“ auch sein mag – das Stück kann nicht verleugnen, aus welchem Jahrzehnt es stammt. Einige mögen gerade das.
 So findet der Wiener Schauspieler Markus Neugebauer unter anderem auch die historische Dimension so packend an diesem Stück. Neugebauer versucht, der Figur des leidenden und gekreuzigten Jesus so viel Menschlichkeit und Größe zu geben, wie nur möglich. Sein Heiland ist ein vollbärtiger Stürmer und Dränger, der sich nie in die erste Position drängt, aber auch nicht zur unbeachteten Randfigur verkommt. Damit nähert er sich überraschend genau der Mentalität der 70er Jahre wie der Absicht des prominenten Autoren-Duos. Wie die meisten seiner Kollegen bringt der Österreicher eine gute Portion Bühnenroutine mit: Neugebauer hat in „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“, in „Les misérables“ sowie in „Jekyll & Hyde“ bereits hinreichend Musical-Erfahrung gesammelt. Seine Darstellung auf der Freilichtbühne ist zwar nicht charismatisch, aber jederzeit ausdrucksstark. Man nimmt diesem Jesus ab, dass er sich für die Allgemeinheit opfern würde.
So findet der Wiener Schauspieler Markus Neugebauer unter anderem auch die historische Dimension so packend an diesem Stück. Neugebauer versucht, der Figur des leidenden und gekreuzigten Jesus so viel Menschlichkeit und Größe zu geben, wie nur möglich. Sein Heiland ist ein vollbärtiger Stürmer und Dränger, der sich nie in die erste Position drängt, aber auch nicht zur unbeachteten Randfigur verkommt. Damit nähert er sich überraschend genau der Mentalität der 70er Jahre wie der Absicht des prominenten Autoren-Duos. Wie die meisten seiner Kollegen bringt der Österreicher eine gute Portion Bühnenroutine mit: Neugebauer hat in „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“, in „Les misérables“ sowie in „Jekyll & Hyde“ bereits hinreichend Musical-Erfahrung gesammelt. Seine Darstellung auf der Freilichtbühne ist zwar nicht charismatisch, aber jederzeit ausdrucksstark. Man nimmt diesem Jesus ab, dass er sich für die Allgemeinheit opfern würde.
Flankiert wird der 38-Jährige Star der Aufführung in erster Linie von seinem Widersacher wider Willen, Judas Ischariot (David-Michael Johnson), dessen Kommentare immer wieder den Ablauf der Handlung begleiten. Johnson, der aus Ohio stammt, bereicherte – wie übrigens auch Markus Neugebauer – schon zahlreiche Inszenierungen der Rockoper rund um Christus. Seine stimmlichen Fähigkeiten kamen bei den Besuchern in der Freilichtbühne gut an. Ebenfalls machte Johnsons Interpretation deutlich, wie zerrissen diese Figur aus dem Neuen Testament war und wie wenig Judas oft von den eigenen Handlungen überzeugt war. An einigen Stellen gewinnt die Freude des Darstellers am Gesang allerdings die Überhand, und Johnsons Darbietung wirkt zu enthusiastisch. Auch dieser Judas drängt sich an keiner Stelle vor, und so gerät „Jesus Christ Superstar“ in der Lechstadt geradezu zum Ausdruck eines demokratischen Miteinanders.

Es ist kaum zu ignorieren, dass sich die Darsteller auch hinter den Kulissen sehr sympathisch sind – ein Eindruck, den Sidonie Smith, die Augsburger „Maria Magdalena“, noch verstärkt. Gelegentlich hätte sich Smith ruhig mehr in den Vordergrund drängen dürfen, schließlich eignet der von ihr verkörperten Figur jede Menge Dramatik. Mit ihrer Aussprache kann diese Darstellerin der „Maria Magdalena“ auf jeden Fall punkten: Während man Johnson den amerikanischen Hintergrund durchaus anhört, ist das Deutsch dieses auch noch als Violistin und Bratschistin aktiven Multitalents makellos.
Was für ein Vorteil, schließlich kommt „Jesus Christ Superstar“ am roten Tor im heimischen Idiom daher – eine etwas gewöhnungsbedürftige Eigenheit, für welche Regisseur Cusch Jung verantwortlich zeichnet: „Die deutsche Sprache eignet sich wunderbar zum Singen, Spielen und Sprechen.“ Diese Überzeugung trieb Jung – der in seiner eigenen Inszenierung übrigens auch die Partie des Pilatus übernimmt – dazu, sich für die Übertragung des Werks aus dem Englischen zu entscheiden. Wobei der 61-jährige, ebenfalls Musical-erfahrene Regisseur einräumt, dass die Geschichten aus der Bibel sowieso jedem gut bekannt seien, ebenso übrigens wie viele der Songs in „Jesus Christ Superstar“.

Für die durchaus hörenswerte Musik, welche diese „Rockoper“ begleitet, sorgen die Augsburger Philharmoniker – (M.L.: Ivan Demidov) – im Verein mit der Rockband „Abyss“. Das scheinbar nicht Vereinbare fand hier zu einem harmonischen Gleichklang. Ein weiterer Pluspunkt: Das schlichte, relativ monotone Bühnenbild (Karel Spanhak) verzichtete auf Dominanz, und verlieh dadurch dem Geschehen mehr Gewicht. So entfaltete sich das Musical vor der Kulisse eines gemauerten Amphitheaters mit einem riesigen Kreuz in der Mitte. Besonders hervorzuheben sind darüber hinaus die tänzerischen Leistungen, welche vom Ballett Augsburg (Choreografie Ricardo Fernando) erbracht wurden und der Opernchor des Staatstheaters Augsburg (Einstudierung Carl Philipp Fromherz).
Bilder (c) Foto: Jan-Pieter Fuhr
Daniela Egert, 30.7.2019
David T. Little
JFK
24.03.2019 Premiere / Europäische Erstaufführung
Ausweichquartier wg. Umbau: Staatstheater im Martinipark
Zu berichten ist von einem interessanten, vielschichtigen, man ist versucht zu sagen: fulminanten Premierenabend mit begeisterter Aufnahme beim Publikum in Augsburg, wiederum mit einem Werk, das wir bisher nicht kannten: JFK, Oper in 31 Momenten und einem Prolog von David T. Little (Musik) und Royce Vavrek (Libretto), ein Auftragswerk der Fort Worth Opera, der Opéra Montréal und dem American Lyric Theater, das am 23. April 2016 in der Fort Worth Opera in Texas uraufgeführt wurde.
Inhaltlich beschäftigt sich das Werk nicht mit dem Attentat auf John F. Kennedy, sondern führt uns am Abend vor demselben in ein Hotelzimmer, in dem der Präsident und seine Frau die letzte Nacht vor dem Attentat verbringen. Die Autoren versuchen, dem Mythos Kennedy näher zu kommen und bemühen dazu verschiedene Ebenen, die ineinander oder auch nebeneinander zum Tragen kommen. Das ist interessant – aber auch schwierig. Das Werk wurde nicht eindeutig als Erfolg verbucht und von der Kritik eher negativ besprochen; schon bei der Uraufführung hat eine offensichtlich sich verselbständigende Inszenierung den Abend gerettet.

Auch in Augsburg ist der Erfolg der Inszenierung, für die Roman Hovenbitzer verantwortlich zeichnet, unbestritten. Ihm und seinem Team (Natalia Orendain del Castillo & Paul Zoller verantwortlich für Bühne & Video, Bernhard Niechotz– Kostüme, Marco Vitale – Licht und Sophie Walz – Dramaturgie) ist ein Abend gelungen, der durch die Üppigkeit der Einfälle, die Opulenz der theatralischen Mittel und die nahezu bewundernswerte Balance zwischen Realität und Traum überwältigend, stellenweise überrumpelndfür sich sprechen. Ein Abend, der viele Fragen stellt, gewiss, aber eben auch ein Abend, der in Bann zieht, nie langweilig ist und gewissermaßen eine Variante des amerikanischen Traumes auf die Bühne bringt, der man sich nicht verschließen kann. Dazu kommt eine musikalische Breite – fast möchte man von Epik sprechen – die durch die Vielfalt der stilistischen Mittel überzeugt und der Lancelot Fuhryan der Spitze der wieder bestens disponierten und in großer Besetzung spielendenAugsburger Philharmoniker zu nachhaltigen Eindrücken verhilft; eine Musik, die von subtilen lyrischen Momenten bis zu absoluten Gewaltausbrüchen fähig ist, dabei immer anhörenswert, nie das Ohr beleidigend, ohne – und das ist fast ein Phänomen! – im eigentlichen Sinne einprägsam oder gar szenisch konkret zu sein. Diese grandiose Umsetzung des Werkes nimmt gefangen, lässt viele Fragen, die natürlich offen bleiben, vergessen. Man war Zeuge eines großen theatralischen Augen-blickes, der den „Machern“ zu danken ist.

Und mit „Machern“ sind hier nicht nur die bereits genannten Verantwortlichen gemeint, sondern das bezieht sich auf das gesamte Team, ein Solistenensemble des Hauses, das mit nur einem einzigen Gast auskommt, alle Partien konnten – wenn auch unterschiedlich in der Leistungsfähigkeit – mit eigenen Kräften besetzt werden. Alejandro Marco-Buhrmester bringt für die Titelpartie nicht nur seinen kräftigen, modulationsfähigen Bariton ein, sondern erreicht als Figur auch eine außerordentlich glaubwürdige Annäherung an das historische Original. Kate Allen hat als Jackie Kennedy sicher die umfangreichste, wohl auch schwierigste Partie zu meistern, für die sie schon beachtliche stimmliche Möglichkeiten aufbietet, der es allerdings noch an Differenzierungsmöglichkeiten – sowohl stimmlich als auch darstellerisch mangelt. Sally du Randt ist als Clara geradezu eine Luxusbesetzung. Welches Haus kann es sich schon leisten, die vielfach bewährte und immer großartige Sängerin mit einer so vergleichsweise bescheidenen Partie zu besetzen. Darstellerisch wie immer zuverlässig und präzise, gelingen ihr stimmliche Momente, dieim ersten Teil u.a. durch Schlichtheit und Lyrik zu Herzen gehen, im zweiten Teil lässt sie das Terzett dreier Frauenstimmen im oberen Register mit Silberglanz erblühen (der „Rosenkavalier“ lässt, wenn auch leicht verfremdet, grüßen). Als einziger Gast stellt sich Wolfgang Schwaninger der komplizierten, eher undankbaren Partie des Rathbone mit vollem Einsatz. Ein kleines Kabinettstück gelingt der Sopranistin Olena Sloia mit der komplizierten Rolle der Rosemary Kennedy, Jacks Schwester, die anfangs als kecker Teenager brilliert und später als tragische Figur nach der vom Vater verordneten Gehirnoperation zum tragischen Vehikel verfällt, eine sehr gute Studie. Roman Poboinyidarf als Nikita Chruschschow bis hart an die Grenze der Karikatur gehen, während IrakliGorgoshidzeals Lyndon B. Johnson leider etwas blass bleibt, ebenso Natalya Boevaals die spätere Jackie Onassis, allerdings auch eine Szene, die meines Erachtens nicht ins Stück gehört (siehe unten). Großartig wie so oft der von Carl Philipp Fromherzglänzend studierte Opernchor und Extrachor des Staatstheaters Augsburg, klangschön und mit vollem Einsatz sowohl in den „realen“ Szenen als auch in den kommentierenden Beiträgen. Aus ihm rekrutieren sich auch die Texanischen Politiker mit Kraft und vollem körperlichen Einsatz (Gabor Molnar, Gerhard Werlitz, László Papp, André Wölkner und John Dalke). Aus dem großen Aufgebot der Statisterie sei stellvertretend Jan Plausteinerals The Cutter hervorgehoben. Die Augsburger Domsingknaben (in der Einstudierung von Stefan Steinemann) haben ebenso wesentlichen Anteil am Erfolg des Abends wie die vielen fleißigen Hände hinter der Bühne, die den effektvollen Abend auf der Behelfsbühne des Martiniparks überhaupt erst möglich machen. Allen ein großes Lob!

Natürlich hat das Werk Tücken und Unschärfen: eigentlich ein Zweipersonenstück, eine Auseinandersetzung eines nicht eben recht glücklichen Ehepaares mit familiären und vor allem gesundheitlichen Problemen, ein „einsamer“ Abend, der durch Träume und Alpträume die private Sphäre recht schnell sprengt. Augsburg hat sich nicht sklavisch an die Vorlage gehalten, hat – vielleicht zu vorschnell? – die Vorgaben des Werkes frei überlesen. Das beginnt schon beim Personenzettel: das Werk geht von drei Gruppen an Charakteren aus: es unterscheidet „die Sterblichen“ (Jack und Jackie Kennedy und einen Reporter); „die Schicksale“ (Clara Harris [Cloto, die Spinnerin], als Hotelmädchen anwesend; Henry Rathbone [Lachesis, der Allotter], anwesend als Geheimdienst; und „der mit drei Namen benannte Schauspieler [Atropos, der Cutter]; schließlich drittens „die Erscheinungen“ (Rosemarie Kennedy, Nikita Chruschtschow, Jackie Onassis, Lyndon B. Johnson u.a.). „Die Schicksale“, die letztendlich das Leben bestimmen, sind in der ursprünglichen Anlage sicher am schwierigsten darstellbar, ihre Reduzierung auf mythische Gestalten scheint logisch, ist aber natürlich in der theatralischen Umsetzung kompliziert. Es hatte schon einen Reiz, dass in der ursprünglichen Werkgestalt zwei historische Personen bemüht wurden, Henry Rathbone und seine damalige Verlobte Clara Harris, die beide beim Mord an Abraham Lincoln zugegen gewesen sind.

Natürlich hat das nichts unmittelbar mit Kennedy zu tun,Licoln wurde 1865 ermordet. Die Tatsache, dass diese beiden nun als Geheimdienstmitarbeiter bzw. Hotelmädchen „agierend“ zur Stelle sind ist nur zu erklären aus der „mythischen“ Komponente, die die Autoren ihnen zuteilen: „Cloto, die Spinnerin“, die den Lebensfaden „spinnt“ und „Lachesis, der Alloter“, der ihn bemisst, sind zwei der drei Schicksale, die das Leben bestimmen; „Atropos“ schließlich schneidet den Lebensfaden durch. Man hat das vereinfacht durch Eliminierung der historischen Komponente (den Bezug zu Lincolns Ermordung) und die beiden als eine Art „Spielordner“ an ein Regiepult mitten in die beiden ersten Zuschauerreihen gesetzt, woher sie das Spiel leiten und führen, es auch „aufzeichnen“ und letztendlich „cuttern“; gelegentlich verlassen sie ihr Pult und greifen auf der Szene in das Spiel ein. Am Ende haben sie ihre Filmrollen fertig. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das für unvoreingenommene Zuschauer nachvollziehbar ist, wüsste allerdings auch keine plausiblere Möglichkeit der Darstellung. Die im Werk vorhandene Rolle des „Reporters“ wurde eliminiert und der entsprechende Text an Rathbone delegiert, was mir unverständlich war. Die beiden Autoren äußerten in einem früheren Interview in Amerika, dass sie bewusst auf Kennedys Vater und Bruder Robert als Figuren verzichtet hätten, ebenso auf die Episode mit Marilyn Monroe – in Augsburg erscheint die gesamte Kennedy-Familie auf der Bühne, ebenso am Schluss die Monroe.
Sei es drum: Hovenbitzer hat die Geschichte bereichert, hat auch das Fernsehen, das ja von Kennedy als erstem Präsidenten optimal genutzt wurde und seinen „Mythos“ wesentlich begründete, einbezogen und so eine Show geschaffen, die allein schon dadurch fasziniert, weil sie hervorragend funktioniert. Es gibt schwache Momente im Stück, wie z. B. die völlig unverständliche und eigentlich überflüssige Begegnung zwischen Jackie Kennedy und Jackie Onassis (ein Vorgriff auf die Biographie der First Lady der nicht nur unverständlich sondern geradezu spekulativ ist!), es gibt Szenen, wo man sich auf Messers Kante bewegt, was den guten Geschmack betrifft (die Begegnung mit Chruschtschow hatte ja sicher nicht nur etwas mit „unter den Tisch saufen“ zu tun, schließlich wurde damals – und eindeutig durch die konsequente Haltung Kennedys! – ein 3. Weltkrieg verhindert). Ebenso wäre die Art und Weise, wie Vizepräsident Johnson mit seinem Präsidenten umgeht geeignet, Gerüchte über die Drahtzieher des Attentates erneut anzufeuern…

„Hätte die Nation gewusst, wie krank John F. Kennedy wirklich ist, wäre er nie Präsident geworden“ urteilte einst einer der Biographen des Präsidenten. Und diese gesundheitlichen Probleme spielen eine zentrale Rolle im Werk. Sie können natürlich auch seine Träume wesentlich geprägt haben, in Träumen ist vieles möglich, auch Übertreibungen und Verzerrungen. Ob das Werk, das man durchaus als große Oper bezeichnen darf, alle Erwartungen erfüllt, bleibe dahingestellt. Ich fand den Abend interessant und fesselnd, das Publikum offensichtlich auch, davon zeugte der starke und ausnahmslos alle einbeziehende, lange Applaus. Leider sind wir immer schnell dabei, wenn es darum geht, eine Sache abzuqualifizieren. Wie viele moderne Werke gibt es denn, die das Publikum erreichen? Wie viele Werke sind erst durch Interpretationen zu Leben erweckt worden? Ist es nicht gut, wenn man in Zeiten der allgemeinen Regie-Schelte auch mal einen Abend erleben kann, der seine Qualität der Regie verdankt? Ich altmodischer Mensch habe mich wie immer mit Hilfe des Klavierauszuges und anderer Hintergrundinformationen auf den Abend vorbereitet – vielleicht hätte ich es lassen sollen. Jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass mir durch diese Aufführung ein Werk erschlossen wurde, das mich sogar ohne Vorbereitung erreicht hätte. Und es stört mich überhaupt nicht, wenn Andere es anders sehen.
Werner P. Seiferth 27.3.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Fotos (c) Jan-Pieter Fuhr
Bedrich Smetana
DALIBOR
Vorstellung am 8.12.2018
Premierendatum war der 14.10.2018
Über den Tod und das Leben Smetanas Freiheitsoper „Dalibor“ wird in Augsburg aus dem Dornröschenschlaf erweckt
Es sind keine schönen Themen, die dem Theaterzuschauer begegnen, wenn er oder sie sich in eine der seltenen Aufführungen der Oper „Dalibor“ verirrt: Kerker, Folter, Tod oder dunkel auf ihm lastende Einsamkeit. Außerdem (notgedrungen unterdrückte) Homosexualität, Scham, Nacht in und um die Handelnden. Aber auch: Menschlicher Heldenmut, aufrechter Gang, gelebte Treue bis in den Tod. „Dalibor“, ein bislang schamvoll verstecktes Stiefkind der nicht-tschechischen Bühnen, wird vom Augsburger Staatstheater - seit Oktober im Martinipark dargeboten.

Kurioses vorweg: Ausgerechnet dieser eher grauen Wundertüte von Oper gab ihr „Vater“ den Vorzug gegenüber dem allgemeinen Publikumsliebling, welchen er geschaffen hatte: Der Tscheche Smetana bekannte zeit seines Lebens, dass er dem schwermütig-romanischen Werk weit mehr abgewinnen könne als der „Verkauften Braut“. Dieses Werk kennt — fast - jeder, das andere kennt man nun zumindest in Augsburg. Die Handlung jedenfalls hat das Zeug zum großen Freiheitsdrama -— etwa wie die Stoffe, welche von Guiseppe Verdi, ebenfalls im 19. Jahrhundert, vertont wurden: Ritter Dalibor (Scott MacAlister) muss im Krieg zusehen, wie sein bester Freund und Seelengefährte Zdenek von Soldaten umgebracht wird. Dieser Schock lässt in ihm den Plan reifen, Zdeneks Tod zu vergelten und sein unterjochtes Volk zu befreien. Unter anderem bringt der Held bei einem seiner Rachezüge den Grafen Ploskovic um. Allerdings mit schwerwiegenden Folgen für sich selbst: Der todesmutige Dalibor wird gefasst und vor Gericht gestellt.

Selbst König Vladislav (Alejandro Marco-Buhrmester) ist während der Verhandlung anwesend, welche mit dem Urteil endet, dass der Angeklagte lebenslänglich in den Kerker muss. Immerhin (noch) kein Todesurteil! Maßgeblich an Dalibors Richtspruch beteiligt ist die schöne Milada (Sally du Randt), die Schwester Graf Ploskovics. Milada ist übrigens eine Figur, die im Verlauf dieser sehr unkomischen Oper eine interessante Wandlung erfährt. Zunächst eine glühende Anklägerin, mutiert sie schon kurz nach Beginn der drei hier musikalisch sehr interessant inszenierten Akte ins Gegenteil. Die junge Frau verliebt sich in Dalibor, der allem Widerstand zum Trotz gnadenlos in den Kerker geworfen wird.
Nun bleibt der verzweifelten Milada nichts anderes übrig, als einen Befreiungsschlag des von ihr Umschwärmten zu versuchen. Dalibors Ziehtochter Jitka (Jihyun cecilia Lee) und ihr Verlobter Vitek (Roman Poboinyi) führen die Aufrührer an.

Jitka überlistet mit Glück den Gefängniswärter (Stanislav Serveev) und dringt ins Verlies Dalibors vor. Der stolze Ritter hängt angeketter und mit einem durchaus doppeldeutigen „Ecce Homo“-Schild um den Hals an den düsteren Wänden. Jitka bringt ihm die Geige, um die er gebeten hatte: Fin betontes Symbol ja auch der literarischen Romantik, etwa in Eichendorffs „Leben eines Taugenichts“. Beide träumen zwischen den Gefängnismauern von einer Zukunft in Freiheit und Würde; ungeachtet der Realität, die sie umgiebt. Im dritten Akt erweist sich, wie brüchig diese Visionen in der Tat sind. Denn König: Vladislav wird vor den Verbündeten gewarnt. Dalibor soll nun ohne Nachsicht hingerichtet werden. Als Milada eingreifen will, wird sie tödlich verwundet. Daraufhin dreht sich das Geschehen in einer gewissen Analogie zu „Romeo und Julia“ dem Ende zu: Der Ritter ohne Aussicht auf Freiheit und Liebe tötet sich neben Miladas leblosem Körper, im grauen Keller-Nichts.

Überhaupt findet die gesamte Handlung in dieser einen, tristen Umgebung statt, was den Augsburger Bühnenbildner Alfred Peter wohl vor eine lösbare Aufgabe gestallt hat. Auch die Kostüme — verantwortet von Renee Listerdal — korrespondieren mit dem Einheitsgrau des nachgestellten Gefängnisses. Licht (Marco Vitale) und Ton (Thomas Rembt) sowie gelegentlich - wohl nach Bayreuther Vorbild - eingestreute Videoszenen auf einem Fernsehschirm (Dennis Böck) tun ihr Übriges, um das Gesamtbild stimmig wirken zu lassen. All diese Details tragen dazu bei, dass diese schwere Theaterkost, angerichtet von Regisseur Roland Schwab, verdaulich bleibt. Hinzu kommt die Leistung des Dirigenten Domonkos Heja, der Augsburger Philharmoniker und des Opern- sowie Extrachors des hiesigen Staatstheaters. In der Martinistraße wird das Gemeinschaftswerk Smetanas und des Librettisten Josef Wenzig aufwendig und mit Hingabe auf die Bühne gebracht. Bei der Kritik wie bei den Zuschauer erfreut sich das mit Leidenschaft inszenierte Werk beachtlicher Beliebtheit. Man könnte auch sagen, dieses Dornröschen von Oper wurde:150 Jahre nach seiner Uraufführung für die deutschen Bühnen wachgeküsst.
Daniela Egert 9.1.2019
Bilder (c) Theater Augsburg / Jan-Pieter Fuhr
DER FREISCHÜTZ
Premiere am 1.10.2017
Ein „hoffmannesker“ Freischütz ohne Samiel…

Es war ein verheißungsvoller, vielleicht sogar ein „großer“ Abend, den das Theater Augsburg mit einem neu formierten Ensemble unter seinem neuen Intendanten André Bücker in der neuen „Spielstätte“ im Martini-Park, die das vorübergehend stillgelegte „Große Haus“ nun wird für einige Jahre ersetzen müssen, an den Anfang der Spielzeit setzte. Ein Abend, der die Schwierigkeiten, in denen sich die Augsburger Theaterszene zur Zeit befindet, nicht nur deutlich machte, sondern sie auch mit – im besten Sinne! – Lust und Liebe, mit Begeisterung anging und folgerichtig auch beim Publikum bestens ins „Schwarze“ traf. Das muss zuerst gesagt werden, denn die Situation, in der Bücker seine Amtszeit begann, war alles andere als rosig. Sie s o zu beginnen, mit Verve und – im guten Sinne! – Trotz, spricht für den Intendanten und all seine Mitarbeiter, die bis kurz vor Beginn noch damit beschäftigt waren, aus dem „Interregnum“ einen Ort der lebendigen Auseinandersetzung zu machen, nicht zu „kleckern“ sondern zu „klotzen“ – nach vorn zu schauen, es hilft ja nichts. Mit Richard Wagner könnte man sagen: „Sie haben gesehen, was wir können, und wenn sie wollen, dann haben wir eine Kunst!“ – Augsburg wird ohne „Großes Haus“ leben lernen müssen und wird im Martini-Park interessantes Theater bieten, das kann man schon erst einmal mit voller Überzeugung so in den Raum stellen, ungeachtet der Tatsache, dass es – wie bei jeder lebendigen Theaterarbeit – auch kritische Einwände im Detail gibt.

In jenem „Martini-Park“ wurden zwei leer stehende ehemalige Fabrik- oder Messehallen in kürzester Zeit zu einem „Theater“ umgestaltet, das natürlich ein Interregnum bleibt. Die nicht sehr hohe, dafür aber „lange“ Halle wurde zu einem Theaterraum mit steil ansteigenden Sitzreihen, die Beinfreiheit bieten, auch wenn es sich nur um bescheidene Sessel handelt (die Rückenlehnen sind jedenfalls weniger strapaziös als jene im viel bewunderten Bayreuther Festspielhaus – um bei Wagner zu bleiben!). Die kolossale Länge des Raumes wird natürlich in den oberen Reihen nicht nur ein Sicht-, sondern möglicherweise auch, besonders bei den gesprochenen Dialogen – ein Hörproblem, der Raum ist glücklicherweise nicht überakustisch, eher vielleicht etwas zu trocken in seiner Akustik. Auch das lässt sich durch Erfahrung verbessern, man wird von Werk zu Werk besser damit umgehen können. Auch hier hilft nicht das Jammern, sondern die Auseinandersetzung. Augsburg ist auf einem guten Weg – und im Nachkriegsdeutschland gab es solch „bescheidene“ Räume zu Hauf, ich erinnere mich noch sehr gut an die Leipziger „Dreilinden-Oper“, die uns 15 Jahre lang in dieser Weise dienen musste; heute spricht man von einer „Ära“, jedenfalls gab es dort mehr überdurchschnittliche Aufführungen als uns die offizielle Leipziger „Theatergeschichtsschreibung“ glauben machen will. Also – ich kann die Augsburger nur ermutigen, in jeder „Beschränkung“ liegt auch eine Chance…

Der letzte „Freischütz“ wurde in Augsburg vor 35 Jahren gespielt – das ist Anspruch und Chance zugleich, übrigens macht es deutlich, dass es wenigstens zwei Generationen Besucher geben wird, die das Stück überhaupt nicht kennen! Bei einer „Oper“, noch dazu einer mit romantischer Orchesterbesetzung, interessiert natürlich zunächst die klangliche Wirkung. Dort kann man Gutes berichten, das Orchester, ebenerdig und „breit“ vor dem gelegen, was man sich zunächst geniert „Bühne“ zu nennen, klingt voll und homogen, die hervorragenden Augsburger Philharmoniker unter der sehr engagierten Leitung ihres GMD Domonkos Héja stellten nicht nur ihrer Qualität, sondern auch der Qualität des Raumes ein denkbar gutes Zeugnis aus. Man hörte keine „Klangmasse“, sondern ein sehr differenziert aufeinander eingespieltes Ensemble mit großer Homogenität, bestens disponiert in den einzelnen Gruppen, beim FREISCHÜTZ natürlich zuerst die klanglich attraktiven Hörner, aber ebenso eine sehr ausgewogene, oft schön klingende Künstlerschar mit vielen instrumentalen Details, die man gern hervorheben möchte, z. B. die wunderschöne Soloklarinette schon in der Ouvertüre, den samtenen Klang des Solocellos und besonders das gefürchtete Bratschen-Solo in der zweiten „Ännchen“-Arie, das meine außerordentliche Bewunderung verdient.

(Leider waren die Instrumental-Solisten, besonders eben jene Bratsche, nicht namentlich auf dem Personenzettel erwähnt, was ich zu korrigieren empfehle!) Der Saal ist sehr geeignet, jedenfalls geeigneter als die überakustische Kongresshalle, die mir beim OTELLO letztes Jahr besonders missfiel. Dieses Orchester und sein Dirigent schufen die Grundlage einer Opernvorstellung, von der man im musikalischen Bereich nur in Tönen höchsten Lobes sprechen kann. Dazu kamen Solisten, die – unterschiedlich im Einzelnen – ihre Partien in bewundernswerter Frische und mitoft rollendeckender Intensität und Erfahrung gestalteten, was nichts damit zu tun hat, dass sie dies schon oft taten (ich konnte nicht genau recherchieren, meine aber, dass sie fast alle diese Partien zum ersten Male sangen), was die Angelegenheit noch mehr ins Positive steigert. Mit „Erfahrung“ meine ich hier besonders, dass es einer Aufführung eben zugutekommt, wenn ein Sänger eine große sängerische Erfahrung einbringen kann; ein Max, der den Stolzing längst anerkannt gut gesungen, eine Agathe, die mit Elsa und Senta bestens vertraut ist und ein Kaspar, den die gesangliche Aufgabe nicht überfordert, weil er längst beste Erfahrungen mit Amfortas und Gunther (und dazu an großen Bühnen) hat – das kommt dem FREISCHÜTZ dann eben nicht nur zugute, sondern es macht die besondere „Klasse“ dieses Ensembles aus, zudem ich in dieser Qualität auch einen Kuno zähle, der Holländer- und Kurwenal-Erfahrungen mitbringt; ausdrücklich einschließen möchte ich eine junge Stimme, neu im Ensemble, mit einem profunden Bass als Eremit – man darf sich schon jetzt mit diesen Stimmen (Leonora, Carlos und Guardian – wenn es bei der Vorausbesetzung auf „operabase“ bleibt) auf die FORZA DEL DESTINO freuen, die Intendant Bücker im Laufe der Spielzeit inszenieren wird, ein Regisseur, der auf dem Gebiet der Oper mindestens mit seinem weithin beachteten RING in Dessau Furore gemacht hat.

Hinrich Horstkotte hat als Regisseur gar nicht erst versucht, uns einen „deutschen Wald“ und eine „Wolfsschlucht“ mit allen Finessen vorzugaukeln – auf einer Bühne, die man besser als nicht eben großräumiges Podium bezeichnen muss, der es an Ober- und Untermaschinerie mangelt und auf der man das Stück eigentlich nicht spielen kann. Horstkotte ist ein viel zu er-fahrener und oft erprobter Regisseur, der übrigens vom Kostüm- und Bühnenbild kommt, der weiß, was er will und respektiert, was das Theater, für das er arbeitet, ihm an Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und er besinnt sich auf gute alte theatralische Mittel, auf das Kulissen-Schieben beispielsweise, das er benutzt und mit Hilfe der technischen Mitarbeiter souverän meistert, geradezu mühelos werden da Wände verschoben, neue Bilder geschaffen und ein szenischer Ablauf garantiert, der immer wieder fesselnd ist. Mit der ihm eigenen Trick- Zeichenkunst und der alten Projektionstechnik (heutzutage natürlich als Video) schafft er zudem Abwechslung und das besondere „Flair“, das dieses Stück braucht. Es muss zwangsläufig im „Alten Forsthause“ spielen, weil der Platz für Landschaft und großflächige Dorfplätze ganz einfach fehlt.

Aber er schafft mit seinem Ideen- und Phantasiereichtum eine neue, andere Sichtweise, indem er uns die Geschichte in „Innenräumen“ erzählt, ohne dem Werk Gewalt anzutun oder den Zuschauer das der Romantik eigene „Gruseln“ vorzuenthalten. (Bühnenbild Siegfried Meyer, nach Entwürfen vom Nicolas Bovey; Kostüme Hinrich Horstkotte). Ich gehe nicht konform mit der Veränderung der Figuren-Konstellationen, die freilich auf eindeutigen Quellen basieren, das Verständnis aber leider auch erschweren. Wer, wie unsereiner, sich in der Oper auskennt, hat keine Schwierigkeiten, die „hoffmannesken“ Anklänge zu orten, die Frage mit dem Spiegelbild zu verstehen – aber: wenn Max nicht nur die eine Seite der Figur, sondern gleichermaßen als „zweite Seite“ seiner selbst auch Kaspar ist, dementsprechend der Samiel eliminiert und – mittels des Spiegelbildes –ebenfalls ein Teil von Max wird, ist das nicht nur auf den ersten Blick verwirrend, es verändert auch die dramaturgische Struktur der Personen zueinander in sehr ernster Weise. Kaspar im Übrigen leidet darunter in erster Linie, sein Motiv (im Originaltext des Werkes), Max aus Eifersucht und Missgunst ins Verderben zu stürzen, fällt weg (im Originaltext spricht Kaspar – Dialog vor der fünften Szene – vom „Wachspüppchen, das mich um deinetwillen verwarf“, meint damit Agathe und seinen „Anspruch“, als „erster Jägerbursche“, Braut und Amt erwerben zu können: das ist seine Motivation fürs Handeln an und mit Max!).

Das fällt weg, weil Max „allein“ meint, handeln zu müssen und selbst den Entschluss fasst, „das Böse“ (als seine zweite Seite) heraufzubeschwören. Ich brauchte einige Zeit, bis mir das klar wurde – versteht es der Besucher, der Zusammenhänge und Hintergründe des Originals nicht kennt? Ich hege da einige Zweifel, die aber in erster Linie dadurch bestärkt werden, weil sie die „Figur“ des Kaspar abwerten, ihn zum zweiten Ich des Max degradieren – was besonders missverständlich in seiner Arie („Schweig, damit dich niemand warnt“) wurde, wo beide im Bett liegen und man zunächst überhaupt nicht weiß, was es soll – konsequent durchgeführt bis zum Schluss, wo zunächst eine scheinbar gedoubelte Agathe herein stürzt, sich dann, als die echte Agathe erwacht, der „getroffene“ Kaspar auf die Seite des vermeintlichen Doubles robbt, um sterben zu können. Also – dort ist die Phantasie ein wenig zu weit gegangen, die ursprüngliche Fassung scheint mir überzeugender (wie immer, bei echten Meisterwerken – und der FREISCHÜTZ gehört noch immer dazu!) Das ist mein grundlegender Einwand gegen eine Aufführung, die ansonsten das Stück durchaus gut bediente und die bei den Zuschauern auch ankam. Und – des Nachdenkens wert: Heja spielt die gesamte Partitur (von Kleinigkeiten der Wiederholungen beim Brautjungfern-Abgang abgesehen – und der volle Erfolg stellt sich ein. Weshalb denken Regisseure immer, dass, wenn sie die Texte der Stücke ändern, etwas Besseres draus wird – es klappt nie!)

Für Wolfgang Schwaninger (a. G.) als Max bedeutete es eigentlich eine völlig neue Rollensicht. Er spielte das mit großer Geste und versuchte, die Angelegenheit in dieser Weise zu übersetzen. Seine hervorragende musikalische Gestaltung der Partie half ihm dabei, auch wenn ich mir die Bemerkung nicht verkneifen kann, dass es schwer vorstellbar ist, Agathe wäre auf diesen Max „versessen, kann nicht ohne [ihn] leben“ – einen intellektuellen Eigenbrötler, der (auch im Kostüm) dem E. Th. A. Hoffmann mehr gleicht, als dem „schlanken Bursch“, der da angeblich gegangen kommt… Alejandro Marco-Buhrmester stattet den Kaspar mit allen hintergründigen Mitteln im gesanglichen Part aus, bleibt szenisch unter diesen gegebenen Umständen leider – ich laste dies nicht dem Sänger an – recht im Hintergrund. Sally du Randt versteht es als Agathe einmal mehr, die Grenze zwischen Anmut und der Gefahr ins Triviale abzugleiten, zu ziehen; sie ist sachlich, wohl auch ängstlich, sicher zurückhaltend – aber so ist Agathe eben, und es ist die größte Schwierigkeit, diese Grenze dabei nicht zu überschreiten. Sie wurde vorbildlich gemeistert! Dass sie die Partie mit der Mühelosigkeit und Legatokultur, die wir seit langem von ihr gewohnt sind, meistert, versteht sich fast von selbst, dass sie ein wundervolles piano in ein sehr kerniges Forte umzuwandeln versteht (besonders in ihrer zweiten Arie) – macht sie musikalisch-sängerischzu einer erstklassigen Besetzung.

Ob der alte Cuno so Methusalem-artig erscheinen muss, wie hier, bleibe dahingestellt: Stephen Owen (a.G.) bringt stimmliche Größe ein und wäre sicher auch in der Lage, einen nicht ganz so alten Cuno zu spielen, Agathe ist immerhin seine Tochter, nicht die Enkelin! Dass ein Ännchen im FREISCHÜTZ besonders reüssiert, ist nicht neu; neu im Ensemble ist Jihyun Cecilia Lee, ausgestattet mit einer großen und technisch gut geführten Stimme, der es allerdings noch etwas an Geschmeidigkeit und edlem Glanz fehlt. Jedenfalls ist sie gut zu verstehen und hatte das Publikum zuvörderst auf ihrer Seite. Endlich hat Augsburg einen profunden Bass: Stanislav Sergeev war im Stimmlichen ein überwältigender Eremit; weshalb er gekleidet sein musste wie ein Abgesandter des Ku-Klux-Klan und warum sein Gesicht schwarz beschmiert war, hat sich mir nicht erschlossen. Der Eremit ist ganz gewiss kein Bösewicht, wer so singt, kann das gar nicht sein! Sehr sympathisch in Stimme und Gestalt war Thaisen Rusch als Kilian. An der Würde und Macht eines regierenden Fürsten etwas oberflächlich und leichtfüßig vorbeischreitend empfand ich WiardWitholt als Ottokar.

Opernchor und Extrachor des Theaters Augsburg, wie immer von Katsiaryna Ihnatsyeva–Cadek sicher vor- und klangvoll aufbereitet, hatte mit dem neuen Wirkungsort zunächst kleinere Probleme; schon im ersten Akt gab es kleinere Ungenauigkeiten, die im späteren – und sehr klangschön musizierten – Jägerchor dann allerdings doch ins Gewicht fielen. Ob man alle vier Strophen des „Jungfernkranzes“ spielen muss, mag entscheiden, wer dazu befugt ist; jedenfalls habe ich die 2. Strophe textlich so gut wie nicht verstanden. (Da das Programmheft acht Namen nennt, möchte ich nicht der falschen Dame nahetreten…)
Anzumerken wäre unbedingt, und das laste ich den Umständen mit dem neuen Raum an und will es deshalb gern verzeihen, dass die Dialoge schwer zu verstehen sind (ich saß im vorderen Teil des Saales, hinten wird es sicher noch schwerer.) Hier gilt es Erfahrungen zu sammeln und noch besser zu werden (erst recht, wenn es sich um Texteinfügungen handelt, die im Sinne der Konzeption existenziell sind; nicht jeder Zuschauer studiert anschließend das Programmheft, wo vieles nachzulesen ist.)
Meine kritischen Anmerkungen dürfen nicht meine grundsätzliche Zustimmung zu dieser Aufführung in Frage stellen. Das Augsburger Ensemble hat an diesem Abend bewiesen, dass es mit der vor ihm liegenden Herausforderung wird leben können, die Zuschauer der aus-verkauften Premiere haben das nachdrücklich nicht nur mit Szenenbeifall nach jeder Arie, sondern mit einem herzlichen, langanhaltenden Schluss-Applaus bewiesen.
Fotos (c) Jan-Pieter Fuhr / Theater Augsburg
Werner P. Seiferth 4.10.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
LADY MACBETH VON MZENSK
Premiere: 16. April 2016

In früheren Jahren arbeitete Peter Konwitschny an den ganz großen deutschen Häusern und galt als origineller Stücke-Neudeuter. Zur Zeit sind Konwitschnys Neuinszenierungen eher an mittleren Häusern zu finden. Trotzdem darf man bei ihm immer gespannt sein, wie er bekannte Werke neu auf die Bühne bringt.
Die Inszenierung von „Lady Macbeth von Mzensk“ entstand schon 2014 für das Opernhaus in Kopenhagen. Konwitschnys Regie ist genau gearbeitet, verspielt und ironisch. Dominiert wird die Aufführung aber von Timo Dentlers und Okarina Peters Ausstattung. Das Stück spielt hier in einem geschlossenen Raum, mit einer weiß gekachelten Rückwand, an deren Seiten zwei Spiegelwände anschließen. Im Vordergrund fährt ein Laufband die Personen meist von rechts ins Geschehen und links wieder von der Bühne ab.

Das Personal wird so zu Gefangenen der „Macht des Schicksals“, der sie ohnmächtig ausgeliefert sind. Das Konzept funktioniert, lässt sich aber genauso gut auf jede andere Oper übertragen. Konwitschnys Personenführung betont ebenfalls die Ausgeliefertsein der Figuren, in dem er die Figuren sich oft puppenartig bewegen lässt, was an die englische „Punch and Judy“-Puppenspiel erinnert.
Originell ist die Farbgebung der Kostüme: Der Chor ist in Grau- und Schwarztöne gekleidet, während jeder der Solisten eine eigene Farbe hat: Katerina (gelb), Sergej (blau), Boris (rot), Sinowi (grün) und Sonjetka (rosa). Jedoch ist diese Idee ebenso beliebig wie die Raumlösung.

Musikalisch überzeugen am stärksten Chor und Orchester des Theaters Augsburg: Generalmusikdirektor Domonkos Hejá lässt die Augsburger Philharmoniker mit großer Energie aufspielen, kostet die Brutalität dieser packenden Partitur voll aus. Für zusätzliche Klangeffekte sorgt noch die Banda, die in verschiedenen Szenen im Zuschauerraum postiert wird und der Aufführung zusätzliche Kraft verleiht.
Die beste sängerische Leistung der Produktion vollbringt Sally du Randt in der Titelpartie: Sie braucht etwas, bis sie sich warm gesungen hat, doch dann liefert sie ein zuverlässiges Rollenporträt. Mathias Schulz als Liebhaber Sergej klingt zu eng und gepresst. In der Höhe, wirkt weniger wie ein Helden-, sondern mehr wie ein Charaktertenor. Die beiden Koreaner Young Kwon und Ji-Won Kim als Ismailow junior und senior haben oft Probleme mit der rhythmischen Genauigkeit der deutschen Textübersetzung.

Sängerisch ist in Augsburg nur eine mittelmäßige Aufführung zu erleben und auch inszenatorisch kann Konwitschny nicht die hohen Maßstäbe erfüllen, die er mit seinen früheren Arbeiten gesetzt hat.
Rudolf Hermes 21.4.16
Bilder (c) THeater Augsburg / A.T. Schäfer
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN
Besuchte Aufführung: 3.12.2015 (Premiere: 28.11.2015)
Der bildende Künstler im Theater
Zu einer beachtlichen Angelegenheit geriet die Neuproduktion von Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ am Theater Augsburg. Die Rezeptionsgeschichte dieser Oper ist reichlich verworren. Der Komponist hatte sie noch nicht abgeschlossen, als er am 5.10.1880 von dieser Welt schied. Die Orchestrierung war noch nicht beendet und der fünfte Akt lag nur in Skizzen vor. Demgemäß konnte das Stück am 10.2.1881 lediglich in einer sehr fragmentarischen, von Ernest Guirand erstellten Bearbeitung an der Opéra comique in Paris zur Uraufführung gelangen. Diese Fassung hielt sich über viele Jahrzehnte hinweg auf den Spielplänen der Opernhäuser. Es dürfte kein anderes Werk des Musiktheaters existieren, das in einer derart zerstückelten und fragwürdigen Form seinen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat. Seit den Siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam indes sukzessive immer mehr von dem verschollenen Material ans Tageslicht, sodass schließlich eine kritische Neuedition der Partitur möglich wurde. Diese war aber ebenfalls noch unvollkommen. Da fortan bis zum heutigen Tage immer mehr Originalquellen Offenbachs entdeckt wurden, existieren bis heute allein vier Fassungen des Stückes, unter denen sich die das Werk zur Aufführung bringenden Opernhäuser eine aussuchen können. Am authentischsten dürfte die Bearbeitung von Michael Kaye und Jean-Christophe Keck sein, die auch der Augsburger Aufführung zugrunde liegt.

Ji-Woon Kim (Hoffmann)
Gelungen war die Inszenierung von Jim Lucassen, der in Kooperation mit Marc Weeger (Bühnenbild) und Silke Willrett (Kostüme) das dramatische Geschehen in etwas anderer Form auf die Bühne brachte, als man es bisher gewohnt ist. Er hat das Stück behutsam modernisiert, gleichzeitig aber auch die zeitlosen Elemente der Handlung geschickt herausgearbeitet. Entgegen der Tradition ist Hoffmann bei ihm kein Dichter, sondern ein bildender Künstler, der im Foyer eines Opernhauses eine Ausstellung eigener Werke vorbereitet. Strenggenommen huldigt Hoffmann bei Lucassen nicht nur der bildenden Kunst, er ist vielmehr ein Allround-Künstler, der sich mehr oder weniger erfolgreich in den unterschiedlichsten Sparten versucht. Auch Lindorf erweist sich zu Beginn als Angehöriger der bildenden Kunst, der aber dann doch noch seinen Malerkittel ab- und einen Anzug anlegen darf. Es ist das erklärte Anliegen des Regisseurs, die Nähe des Titelhelden zu dessen historischem Vorbild E. T. A. Hoffmann aufzuzeigen, einem der besten Vertreter der schwarzen Romantik, der ja ebenfalls in den verschiedensten Metiers tätig war. So übte er nicht nur den Beruf eines Dichters aus, sondern zeigte sich auch als Komponist, Dirigent, Maler und Jurist versiert.

Ji-Woon Kim (Hoffmann), Cathrin Lange (Olympia)
Im Paris Offenbachs wurde die Kunst ganz groß geschrieben. Der Kampf um den ersten Platz fand nicht nur innerhalb der einzelnen Kunstrichtungen, sondern oft auch spartenübergreifend statt- genau wie in dieser Inszenierung, in der Hoffmann seine Ausstellung im Foyer desselben Operntheaters auf die Beine zu stellen versucht, auf dessen Bühne Stella gleichzeitig die Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“ singt. Schnell wird offenkundig, dass die Sängerin ihrem Anbeter in künstlerischer Hinsicht haushoch überlegen und demzufolge als im künstlerischen Wettbewerb ernstzunehmende Kontrahenten für ihn anzusehen ist. Aus dieser Auseinandersetzung geht Stella als Siegerin hervor, denn Hoffmann befindet sich in einer ausgemachten Schaffenskrise, die ihn an seinem eigenen Werk zweifeln lässt. Er weiß nicht, ob ihm mit seiner Ausstellung Erfolg beschieden sein wird, und hat Angst, die Produkte seiner Kreativität dem Publikum zu präsentieren. Nicht aus noch ein wissend kürt er seine Abgöttin Stella, deren stilles, rückwärtsgewandtes Bild im Hintergrund aufragt und sich irgendwann auch einmal umdrehen darf, zum allgemeingültigen künstlerischen Maßstab, wobei er sich der eigenen Unvollkommenheit durchaus bewusst ist.

Andréana Kraschewski (Antonia), Dr. Miracle
Nachdrücklich versucht Hoffmann, aus dieser Schaffenskrise auszubrechen. Als Mittel dazu dient ihm seine Geschichte von den drei Geliebten. Diese sind in Lucassens Interpretation lediglich Ausfluss seiner Phantasie. Drei von Beginn an auf der Bühne befindlichen, aber zuerst noch verhüllten Skulpturen haucht er gleichsam Leben ein und nennt sie in seinen fiktiven Erzählungen Olympia, Antonia und Giulietta. Dabei begibt er sich in ganz verschiedene Welten. Olympia ist das Erzeugnis des Oberarztes einer Schönheitsklinik Spalanzani, der bei der Herstellung der Puppe auf die Mithilfe des Schönheitschirurgen Coppélius angewiesen ist. Olympia erscheint bei ihrem ersten Auftritt in einem aufreizenden Nacktkostüm, bevor ihr schließlich immer mehr Kleider umgeworfen werden. An der Figur der kurz vor ihrem Tod noch ein Flitterkleidchen anlegenden Antonia handelt Lucassen gekonnt die Unvereinbarkeit von Liebe und Kunst ab. Als einziges Mittel, um gänzlich in der Kunst aufzugehen, erscheint ihr der Tod - eine Option, die durch den boshaften Agenten Dr. Miracle Wirklichkeit wird.

Sally du Randt (Giulietta)
Sehr interessant geriet dem Regisseur auch der Venedig-Akt. Die Problematik von Hoffmanns verlorenem Spiegelbild hat er ausgezeichnet und mit hohem innovativem Können gelöst. Das reflektierte Abbild des Protagonisten erscheint als dessen im Kunstwerk manifestiertes Ich. Indem Giulietta, die dem berauschten Künstler gleich in dreifacher Ausfertigung erscheint, ihm dieses abringt, zerstört sie nicht nur seine künstlerischen Erzeugnisse, sondern gleichzeitig auch sein innerstes Wesen und damit auch ihn selbst. Nur gut, dass es noch die Muse gibt, die den Prozess rückhängig machen und bewirken kann, dass Hoffmann seine Kunst als Mittel der Identifikation am Ende doch erhalten bleibt. Die Erlösung von seinen Qualen durch die Kunst ist und bleibt seine Bestimmung. Der von allen Beteiligten gesungenen grandiosen Schlussapotheose schließt sich auch Stella an. Das war alles trefflich durchdacht und mit einer logischen, stringenten Personenregie auch einfühlsam umgesetzt.
Insgesamt ansprechend waren die gesanglichen Leistungen. Ji-Woon Kim brachte einen virilen, ausdrucksstarken Spinto-Tenor mit kraftvollem Bariton-Fundament für den Hoffmann mit, den er differenziert und farbenreich einzusetzen wusste. Indes neigte er im oberen Stimmbereich dazu, die Luft zu stauen, was nicht sein sollte. In der hohen Tessitura sollte er etwas weniger auf reine Stimmkraft setzen als vielmehr auf ein ebenmäßiges Dahinfliessen des Klanges. In dieser Produktion durfte die Stella, sonst meistens eine stumme Rolle, auch singen. Sandra Schütt tat das mit gut fundiertem, solidem Sopran. Man hätte gerne etwas mehr Solo-Gesang von ihr gehört. Mit brillantem, flexiblem und koloraturgewandtem Sopran stattete Cathrin Lange die Olympia aus. Wunderbare lyrische Eleganz bei bester Fokussierung ihres kostbaren Stimm-Materials verlieh Andréana Kraschewski der Antonia.

Christiane Bélanger (Muse/Niklausse), Ju-Woon Kim (Hoffmann)
Ihren Kolleginnen in nichts nach stand Sally du Randt, die mit tadellosem, gut sitzendem und sonorem Sopran die Giulietta sang. Eine solide Stimme der Mutter war Kerstin Descher. Sie und Frau Lange waren außerdem als Erscheinungen der Giulietta zu erleben. Mit volltönendem Mezzosopran und intensivem Spiel machte Christiane Bélanger die treue Anhänglichkeit der Muse/Niklausse an Hoffmann glaubhaft. Demgegenüber fiel Ricardo López etwas ab, der mit seinem an diesem Abend etwas trocken klingenden Bariton den Figuren von Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto kein sonderliches dämonisches Gepräge zu verleihen wusste. Sehr flach und maskig sang Christopher Busietta die drei Rollen Cochenille, Frantz und Pitichinaccio. Da war es um Mathias Schulz’ Nathanael und Spalanzani schon besser bestellt, aber auch er sang mit etwas zu hoher vokaler Stütze. Ansprechend waren der Hermann und der Schlemihl von Giulio Alvise Caselli. Mit den Partien von Luther und Crespel empfahl sich der voluminös und rund singende Georg Festl für größere Aufgaben. Eine ordentliche Leistung erbrachte der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Chor.
Am Pult arbeitete Lancelot Fuhry die verschiedenen musikalischen Stimmungen einfühlsam heraus. Unter seiner Leitung spielten die Augsburger Philharmoniker recht differenziert und mit großem Esprit, wobei das emotionale Moment groß geschrieben wurde.
Ludwig Steinbach, 4.12.2015
Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
DER KÖNIG KANDAULES
Zum Dritten
Premiere: 27.9. 2015. Besuchte Aufführung: 25.10. 2015
Kraftvolle Figuren in einem starken Drama
Zwei Tage nach dem Macbeth, der beim Opernfreund – rein stimmlich betrachtet – eher gemischte Gefühle hinterließ, stand der König Kandaules unter einem weit besseren Stern. Nun wurde auch klar, dass es auch räumliche Gründe waren, die dafür sorgten, dass Sally du Randt als Lady Macbeth weniger dominierte, als es eine Lady Macbeth ansonsten zu tun pflegt: vom rein Sexuellen mal abgesehen.
Sally du Randt ersingt sich nämlich als Nyssia, die Frau des König Kandaules, einen enormen Erfolg. Nun dringt sie sogar (meist) durch die Klangmassen durch, die ihr gelegentlich das Zemlinskysche Orchester entgegenschleudert (die Augsburger Philharmoniker unter Lancelot Fuhry tun ihr Bestes, um Zemlinskys Oper samt Antony Beaumonts Instrumentation elegant und kraftvoll aus dem Orchestergraben zu deuten: zwischen den reizendsten Fin-de-siécle-Glitzereien und gleichsam antikischer Wucht). Nun liegt ihre Stimme sicher auf den Höhen; das Drama der Königin, der vom Gemahl der Fischer Gyges ins Bett gelegt wird, und die daraufhin eben diesen Gemahl vom neuen Geliebten stracks töten lässt – dieses Drama findet in der Augsburger Aufführung seine Höhepunkte in den Solisten der drei Hauptpartien. Sie findet Gipfelpunkte (man höre nur das „tragische“ Vorspiel zum dritten Aufzug) im faszinierenden Orchesterpart: einer Wiener Mischung aus dem Schönberg der Gurre-Lieder, einem deutlichen Schuss Korngold, einer Prise Schreker – und einem unnachahmlichen Bodensatz Zemlinsky. Und es findet seine totale Steigerung im zweiten Teil: dank des zugeschnürten Konflikts, dank der Solisten.
Mathias Schulz ist ein glänzender König: hysterisch, lyrisch, selbstgefällig, selbstmitleidig, dominant, vor allem aber: stimmschön noch im Ton eines Kraftkerls, dessen Präpotenz nur behauptet wird. Großartig, wie er die Festgesänge des ersten und die Zerstörungsmonologe des letzten Akts auskostet. Wenn diese Oper, die nach 20 Jahren (die posthume Uraufführung der komplettierten Oper fand 1996 in Hamburg statt) erst zum vierten oder fünften Mal inszeniert wurde, auf den Bühnen eine Chance hat, dann nur dank Sängern wie Mathias Schulz.
Gyges ist mit dem Bassbariton Oliver Zwarg ebenso glänzend besetzt: vom Prolog an, den er allein macht, bis zur Enthüllung – die Enthüllung eines Mannes, der der Königin die schönste Liebesnacht ihres Lebens verschaffte, weil der eigene Mann vor lauter Ästhetizismus und Nihilismus längst nicht mehr in der Lage ist, die Schönheit mit einem nichtdekadenten Sinn für die gesunde Wollust zu genießen. Zwarg spielt gleichermassen einen Kraftkerl: aber einen ernsthaft Wütenden, dessen Fundamentalismus es nicht zulässt, dass die Ehefrau es mit einem der Hofleute nächtens in der Küche treibt. Eine dramatisch packende Figur: keine, die zur Identifikation auffordern würde (das tut keine der Figuren dieses Zemlinskyschen Spätwerks aus dem Geist des Andre Gideschen Symbolismus) – aber eine, die den Zuschauer und –hörer zusehends interessiert. Sie lässt vergessen, dass die Kostümierung der höfischen Nassauer, die sich als 7 Zwerge auszugeben haben, schon schnell den Opernfreund anödet. Wie gesagt: erst mit der doppelten Verführung: der Verführung des Fischers durch den König und der Verführung der Königin durch den Fischer, gewinnt das Drama an jener Fahrt, die auch uns heute noch zu interessieren vermag.
Bleiben die Vertreter des Hofs, unter denen Giulio Alvise Caselli (als Phedros) und Joel Annmo vertretungsweise genannt werden müssen. „Bella Figura“, so hieß vor Kurzem eine Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum, die den Münchner und Augsburger Bronzeplastiken der Renaissance und des Barock gewidmet wurde. Als Zwerge machen die seltsamen Figuren in der Inszenierung Sören Schuhmachers, die nach deutlich sichtbaren Ideen Lorenzo Fioronis (der nach kurzer Probenzeit aus Gesundheitsgründen die Arbeit abbrechen musste) entstand, keine schönen, sondern bewusst lächerliche Figuren. Als Sänger repräsentieren sie den guten Querschnitt durch ein Ensemble, dass massive Brocken wie den Kandaules schadlos und relativ souverän aufführen kann. Der Beifall für dieses anspruchsvolle Werk und dessen Interpretation war denn auch einhellig: einhellig jubelnd.
Frank Piontek, 26.10. 2015
Bilder bei den Erstbesprechungen siehe weiter unten !
MACBETH
zum zweiten
Premiere: 30.5.2015
Besuchte Aufführung: 23.10. 2015
Grotesk und bewegend
Macbeth in Augsburg – seltsamerweise ist es keiner der Sänger der Titelpartien, der beim Opernfreund den intensivsten vokalen Eindruck hinterlässt. Es ist ein profunder Bass, der nicht (wie man es häufig erleben kann) als Mickerbass, sondern als authentischer Vertreter dieser Stimmgattung auf der Bühne steht: Vladislav Solodyagin. Als Banquo hat er „nur“ eine große Szene und Arie, doch reicht sie aus, um beim Hörer an Thomas Manns Wort von der „Fülle des Wohllauts“ zu provozieren. Solodyagin muss nicht forcieren, er rödelt nicht, er macht nicht den Eindruck, dass er ein Bariton ist, der sich ins falsche Fach verirrt hat. Er singt einfach souverän seine Leiden heraus, die der Komponist im Kreuzungsfeld von reinem Musikdrama und ebenso purem, freilich koloraturlosem Belcanto verortet hat.
Nicht, dass der Königsmörder und seine Gattin dagegen abschmieren würden. Auch bei den beiden Hauptrollen hält das Theater Augsburg sein Niveau: Ricardo López ist das, was man im abgenutzten Jargon als „ansprechend“ bezeichnet – doch wünscht der Hörer sich meist mehr Kraft. Auf der gefährlich offenen, von Ralf Käselau entworfenen Bühne – sie besteht im Prinzip aus einem großen hohen und einem intimen, breiten und nicht sehr tiefen Raum – geht seine Stimme in den Ensembles meist verloren. Hat López die Chance, die wütenden und depressiven Attacken im zusehends zerstörten Hotelzimmer zu reiten, ohne vom Orchester oder vom Chor – der unter der Einstudierung von Katsyarina Ihnatsyeva-Cadek seinerseits im Raum dynamische Probleme hat - erdrückt zu werden. Wäre allein die Dynamik das Beurteilungskriterium für gelungenen Operngesang, hätte López wenig Chancen auf einen Preis – als Ausdruckskünstler ersingt und erspielt er sich einen Macbeth, der noch in den Exzessen seiner Psyche zwischen Verdis Forderung nach totaler Dramatik und dem, was der „normale“ Opernbesucher als Schöngesang akzeptiert, noch schön vermittelt. Dass er nicht den entscheidenden Eindruck hinterlässt: es liegt denn doch an der fehlenden Lautstärke, die selbst dann von Nöten ist, wenn das Orchester (in diesem Fall die guten Augsburger Philharmoniker) derart differenziert und ohrenöffnend spielt wie hier: unter der Leitung Samuele Sgambaros. Es ist, noch vor den Hexen, das erste Kollektiv, das uns Verdis Drama in all seinen Zügen erzählt und eher genau als pauschal operiert. Nicht in jeder Aufführung hört man ja wirklich, wie modern Verdis Partitur ist, wie sie mit haarscharfer Kammermusik, betörenden Dissonanzen und einem für die italienische Oper von 1847 (vermutlich) unbekannten Farbreichtum Shakespeares Drama kaum den Konventionen der zeitgenössischen Oper, mehr noch Verdis Willen zum Shakespeare-Nachvollzug gehorcht.
Und die Lady? Sally du Randt singt sie, als sei sie schon vom ersten Wort an gefährdet. Das erste Wort kommt allerdings nicht aus ihrem Mund, sondern – da wird der Brieftext verlesen, der den Aufstieg des Gatten mitteilt – aus der Tonkonserve (wie der Soundtrack der Aufführung auch sonst gelegentlich mit Spezialeffekten arbeitet). Nein, ihre Stimme ist nicht zerbrochen, aber zerbrechlich. Dieser in der Höge doch fragile Ton verleiht der Figur eine Authentizität, die weit über das Maß dessen hinausgeht, was ein auf eine „schöne Stimme“ gepolter Opernbesucher erwartet – aber genau in diesem Spektrum, in dieser Farbei einer nervösen Zerbrechlichkeit stellt Sally du Randt eine Lady auf die Bühne, die seltsam authentisch anmutet. Wieder mag man dynamische Durchschlagskraft vermissen, aber sie ist nicht alles. Was wir in Augsburg hören, ist ein seltsames Paart: beide sind nicht auf der Höhe dessen, was gewöhnlich vom Opernsänger verlangt wird – aber beide überzeugen durch Charakterzeichnung und Stimmklang. Wie gesagt: wenn man einige Momente vergisst, dass sie „eigentlich“ stärker sein müssten, um das Letzte an Drama herauszuholen, denn die Gewalt ist, gerade in dieser Oper, eine nicht zu unterschätzende Kategorie. Es muss also nicht überraschen – und ist selbstverständlich – dass Thorsten Büttner den längsten Arienapplaus einsackt: als Macduff hat er ja auch, nach dem ergreifenden Patria-Chor, eine ergreifende, einfach eine „schöne“ Arie zu singen.
Dabei ist Macbeth bekanntlich kein „schönes“ Stück. Lorenzo Fioroni bietet zwar diesmal keine vollkommene Neudeutung - worin er ein wahrer Meister ist -, sondern eine Variation des Stücks. Dieser Macbeth spielt zwar immer noch in einem Krieg, doch hat sich, was grausig und grotesk genug ist, das Gefecht aufs Terrain des Kinderzimmers und des Volksfests verlagert. Endet diese Inszenierung auch in einem völlig zerstörten Hotelzimmer, in dem wir auf die Skelette des Titelhelden und seiner Gattin schauen, so ist durchaus nicht klar, wo Wahnsinn, Phantasie und sog. Wirklichkeit beginnen. Das versteht sich: für Fiorino sind die Machtbestrebungen des seltsamen Paars, das ab dem dritten Akt systematisch zugrunde geht, die Fantasien von Menschen, die ein gebrochenes Verhältnis zur Realität haben – denn die Macht zu bekommen, mag ein Kinderspiel sein. Sie zu bewahren, ist der pure Krieg. Und so marschieren in der Königsparade und auf dem Volksfest – durchaus passend zur Musik einer italienischen Banda, die Fiorino auch als solche auf die Bühne bringt – die groteskesten Puppen und Figuren herein: Chuckie, die Killerpuppe, der sprechende Käse, Alice im Wunderland... Am schrecklichsten aber sieht der monströse Teddybär mit seinen Hauern aus, der sich, gleichsam mit einer Abendlatte, ins Hotelbett der beiden Macbeth’ legt, um gemeuchelt zu werden.
Natürlich ist das lächerlich, ja „unangemessen“ – aber wo die Oper, in der es um politische Morde und seelische Verkrüppelungen, auch um das Kampfmittel der Erotik und des puren Sex geht (die Lady und ihr abhängiges Opfer) geht, auf die Gegenwart trifft, müssen auch mal Grenzüberschreitungen erlaubt sein. Fioroni aber belässt es nicht bei der Persiflage der grausigen Puppen. Er macht aus den Hexen zunächst ein Corps von Huren, die den Krieg zu begleiten pflegen und ihrerseits zu Opfern des Krieges und der allfälligen Gewalt werden können – doch ab dem dritten Akt, der Macbeth’ Abstieg einleitet (analog zu Richard Wagners zweigeteiltem „Rienzi“ könnte man auch von „Rienzis Aufstieg“ und „Rienzis Untergang“ sprechen), wendet sich das Blatt: systematisch und symbolisch. Macbeth trägt da plötzlich die Klamotten seiner Frau, während diese im Königsmantel vor sich hin visioniert. In dieser Verkleidung trifft er zum zweiten Mal auf die Hexen, die die Gewandschneiderei unter der Leitung der Kostümbildnerin Annette Braun in Herrenkostüme gesteckt hat. Nun ist es Macbeth, der von den Hexen brutal und sexuell gedemütigt wird. Auch dies ist grotesk, ja lächerlich. Nein, Fioronis Theater ist niemals „realistisch“ – aber es enthält einen Abglanz der Wirklichkeit, der in diesem Fall durch symbolische Übertreibungen überzeugt. So wie sich die Handlung der vier Akte von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Macbeth’ Frühling zu Macbeth’ Winter begibt, so setzt Fioroni auf eindeutige Bilder, die Macbeth’, vor allem aber der Lady Macbeth’ Machtstreben als kindliche, von Heroin und Aufputschmitteln befeuerte Fantasien enthüllt.
Gibt es in diesem Theater der Grausamkeit, in dem die kleine Welt der Macbeth’, das Hotelzimmer, zusehends vernichtet wird, und in dem Banquo seine letzte TV-Botschaft an die Welt richtet, bevor er auf die Giftkapsel beißt – gibt es hier auch Bilder der Schönheit? Es gibt sie. Wunderbar der eine zauberhafte Moment während des gestörten Fests, in dem sich die Lady und ihr Mann im vernebelten Gegenlicht vor dem mit vielen Glühlampen ausgestatteten Rummelplatzrad begegnen. Rührend der Patria-Chor, in dem „das Volk“ seine „getöteten Kinder“ buchstäblich auf die Bühne bringt, bevor die Lady mit einem toten Knaben ein letztes Weihnachten feiert.
Dass die Kammerfrau und der Arzt zwei Weihnachtsmänner persönlich sind, muss natürlich nicht verwundern – und wem’s nicht gefällt, dem sei gesagt: es muss einem nicht gefallen. Fioroni liebt es eben, alles anders zu machen: mal mehr, mal weniger.
Es gab andere Inzenierungen des Meisterregisseurs, in denen die Umdeutungen besser geklappt haben. Dass diesmal die nicht ganz einfach zu deutende Groteske das Bild beherrscht und das Publikum, wenn nicht alles täuscht, mit dieser Bildwelt seine Probleme haben könnte: es sollte zu denken geben. Andererseits: ist Verdis Macbeth nicht ein außergewöhnlich konzentriertes Musikdrama im Gewand einer italienischen Oper der Verdi-Zeit, das besondere Anstrengungen geradezu provozieren sollte?
Was bleibt, ist, so gesehen, vielleicht weder ein Monsterbär noch ein nach allen Regeln der neueren Opernkunst zerstörter Raum (in dem übrigens nicht besonders stark mit Kunstblut gesudelt wird). Was bleibt, ist sicherlich ein Damenchor in Herrenkostümen, eine sekundenkurze, eindringliche Begegnung im Nebellicht, eine fragile Stimme, ein besonders stark wirkender Trauerchor.
Was ganz am Ende aber auch bleiben wird, ist ein Abschied der besonderen Art. Nach den ersten Vorhängen wurde, umringt vom gesamten Ensemble, ein Mann, der 40 Jahre lang zumeist im Verborgenen arbeitete und den Ablauf von Aberhunderten von Aufführungen koordinierte. An diesem Abend wurde der Inspizient Hans Obels nach vier Jahrzehnten Theaterzugehörigkeit von der Intendantin (und Dramaturgin) Juliane Votteler warmherzig und bewegend – bewegend selbst für den Zufallsbesucher - verabschiedet.
Ein Mann im Verborgenen, aber ehrlich, beliebt und geehrt – wer weiß: wenn Macbeth und seine Lady sich angestrengt hätten, wären sie vielleicht auch zu „netten Menschen“ geworden. Nur hätte Shakespeare dann kein Drama über sie geschrieben – und wir würden heute, nach 168 Jahren, nicht mehr in der Oper sitzen, um uns das Werk eines oberitalienischen Maestro anzuschauen.
Frank Piontek, 25.10. 2015
Bilder siehe unten !
Skurriles ohne Schottenrock
MACBETH
Wiederaufnahmepremiere am 18.10.2015

Lieber Opernfreund-Freund,
normalerweise kann ich mit radikal modernisierten Inszenierungen wenig anfangen. Aida im Raumschiff, Gespräche der Karmeliterinnen im Irrenhaus oder Norma im KZ haben mir selten einen neuen Zugang zum Werk erschlossen, oft sieht es nach Modernisierung mit der Brechstange, nach Provokation um der Provkation willen aus. Deshalb bin ich selbst überrascht, wie sehr mich die Augsburger Inszenierung von Verdis "Macbeth" begeistert hat, die erstmals ind er vergangenen Spielzeit zu sehen war und nun am gestrigen Sonntag Wiederaufnahmepremiere hatte. Den Schweizer Regisseur Lorenzo Fioroni scheint nicht zu interessieren, was Verdis Librettisten Francesco Maria Piave und Andrea Maffei da nach Shakespeares Drama singen lassen, sondern er nutzt das Grundkonstrukt und die wunderbaren Melodien gewissermassen als Bühne, erzählt seine eigene Geschichte vom nahezu symbiotisch verbundenen, machtbesessenen, von Ehrgeiz zerfressenen Herrscherpaar.

Da werden aus dem Hexenchor Nutten, Banquo begeht Selbstmord, weil er die Skrupellosigkeit des einstigen Gefährten nicht mehr erträgt, die Lady feiert in der Nachtwandelszene mit toten Kindern Weihnachten und am Schluss werden Gesangsparts direkt ganz gestrichen und nur die Orchestermusik erklingt. Und doch funktioniert alles aufs Vortrefflichste. Die Bühne von Ralf Käselau ist ständig von so vielen Eindrücken nahezu überfrachtet, daß man eigentlich mehrere Vorstellungen besuchen muss, um alles zu erfassen. Die Bilder gleichen Traumbildern und Visionen, teils verspielt träumerisch und fast kindlich mit Spongebob und Konsorten, und werden zum auch jahreszeitlich immer kälter werdenden Schluss hin immer skurriler, alptraumhafter und verstörender. Wenn man sich darauf einlässt und bei "Macbeth" keinen Schottenrock sehen muss - sondern sich an Groteskem und den traumhaften und farbenreichen Kostümen von Anette Braun und dem effektvollen Licht von Kai Luczak freuen kann, erwartet einen ein kurzweiliger, bewegender und spannender Opernabend.

Dessen musikalischer Schwachpunkt ist leider die Besetzung der Titelfigur. Ricardo López verfügt über einen weichen Bariton, allein fehlt ihm Volumen, um einen Mann der ein ganzes Volk unterjocht und für seinen Machterhalt im wahrsten Wortsinn über Leichen geht, glaubhaft zu verkörpern. Er singt oft zu leise und recht zaghaft, hat deshhalb seine überzeugendsten Momente da, wo die Figur des Macbeth zaudert - also beispielsweise in der Szene des Duncanmordes - oder in der Schlussarie, für die er sich ein wenig aufgespart zu haben scheint. Das wird um so offensichtlicher, als ihm als Lady eine echte Sängerdarstellerin zur Seite steht. Die Lady Macbeth von Sally du Randt ist schlichtweg eine Offenbarung.

Verdi wollte für diese Rolle etwas Teufliches in der Stimme. Und die Südafrikanerin hat nicht nur das: sie betört mit kaum wahrnehmenden Pianissimi, verstört mit gewaltigen Ausbrüchen und lebt die Rolle mit all ihren Facetten. Schon das "La luce langue..." im zweiten Akt macht Gänsehaut und am Ende der Wahnsinnsszene hätte es mich kaum verwundert, hätte sie sich - tatsächlich wahnsinnig geworden - in den Orchestergraben gestürzt. Vladislav Solodyagin überzeugt mit dunklem Bass und lässt mich erneut bedauern, dass die Partie des Banquo so vergleichsweise kurz ist, dem Koreaner Ji-Woon Kim gelingt ein so anrührender wie kampfeslustiger Macduff. Christopher Busietta, Andrea Berlet-Scherer, Eckehard Gerboth, Oliver Scherer und Georg Festl komplettieren das Ensemble allesamt bestens disponiert in den kleineren Rollen.

Samuele Sgambaro führt furios durch den Abend, übertönt aber in seiner offensichtlichen Begeisterung für Verdis Musik bisweilen die Sänger ein wenig. Der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Chor überzeugt schrill und gespenstisch als Hexen und berührt im "Patria oppressa".
Das Augsburger Publikum ist außerordentlich klatschfaul, trotz teils grandioser Leistungen in den Arien hebt sich während des ganzen Abends kaum ein Händchen zu einem Szenenapplaus. Am Schluss wird der für einen Verdi am Sonntagabend recht spärlich besuchte Zuschauerraum dann doch noch wach und beklatscht neben der Lady Macbeth vor allem Dirigent und Orchester. Man hat die Qualität also doch wahrgenommen - das könnte man ruhig, so finde ich, auch zwischendurch schon mal zeigen.
Ihr
Jochen Rüth aus Köln 19.10.2015
Fotos A.T. Schaefer zeigen die Mitwirkenden der Spielzeit 2014/15
DER KÖNIG KANDAULES
Zum Zweiten
Besuchte Aufführung: 14.10.2015 (Premiere: 27.9.2015)
Bizarre Märchengroteske
Das Theater Augsburg war wieder einmal eine Reise wert. Dieses Mal lockte die Aufführung von Alexander Zemlinskys selten gespielter Oper „Der König Kandaules“ - eine echte Rarität, deren Ausgrabung der Augsburger Theaterleitung zur großen Ehre gereicht. Hier haben wir es wieder einmal mit spannendem Musiktheater auf ausgezeichnetem Niveau zu tun.

Mathias Schulz (Kandaules)
Entstanden ist das reizvolle Werk in großen Teilen in den Jahren 1935 bis 1939. Zu einer Aufführung im deutschsprachigen Raum kam es aber nicht mehr, da der von den Nazis verfolgte jüdische Komponist Zemlinsky in die USA fliehen musste. Er hoffte dann seine Oper, für die er auch selbst das Libretto verfasste, in New York beenden und zur Aufführung bringen zu können. Aber auch dies sollte ihm nicht gelingen, da der Stoff dem amerikanischen Publikum zu gewagt war. Die am Ende des zweiten Aktes vorgesehene Nacktszene der Nyssia war an der Metropolitan Opera damals ein Ding der Unmöglichkeit. Der Chefdirigent dieses renommierten Opernhauses Artur Bodanzky weigerte sich dann auch, das Werk aufzuführen, weswegen Zemlinsky die Komposition nicht beendete. Der „König Kandaules“ blieb demzufolge Fragment. Nach Zemlinskys Tod im Jahre 1942 verschwand er für Jahrzehnte in der Versenkung. Erst in den 1990er Jahren wurde die Oper von Anthony Beaumont zu Ende geführt und an der Hamburger Staatsoper zur Uraufführung gebracht. Trotz des immensen thematischen und musikalischen Gehalts der Oper ist die Augsburger Produktion erst die zehnte. Sie setzt die Pause im zweiten Akt genau an der Stelle, an der Zemlinsky die Komposition abbrach und Beaumont später die Arbeit fortsetzte.

Ensemble
Die Handlung geht auf André Gides Drama „Le roi Candaule“ zurück. Bereits Herodot hatte den Sagenstoff bearbeitet. Geschildert wird die Geschichte des Königs Kandaules, der es nicht ertragen kann, dass keiner außer ihm selbst seine schöne Frau Nyssia zu Gesicht bekommt. Daher zwingt er sie, sich vor seinem Hof und seinen Freunden zu entschleiern. Den armen Fischer Gyges kennt er seit seiner Kindheit. Inzwischen haben sie sich indes entfremdet. Als Gyges einen Fisch an den Hof bringt, in dem man einen Zauber-Ring findet, sehen sie sich wieder. Der Fischer erscheint dem König bedürfnislos. Das provoziert Kandaules. Er bestimmt Gyges dazu, mit Hilfe des magischen Rings, der seinen Träger unsichtbar macht, seiner Frau Nyssia beizuwohnen. In der Nacht liegt Gyges anstelle von Kandaules bei der völlig nackten Königin. Als diese am nächsten Morgen den Betrug entdeckt, fordert sie Gyges auf, Kandaules zu töten. Der Fischer entspricht ihrem Willen und wird von ihr anschließend zum neuen König gekrönt.

Oliver Zwarg (Gyges), Sally du Randt (Nyssia)
Die Regie sollte ursprünglich Lorenzo Fioroni übernehmen. Eine Erkrankung zwang ihn aber bereits in einem sehr frühen Stadium der Arbeit, die Produktion abzugeben. Diese wurde dann von Soren Schuhmacher übernommen und auf der Grundlage konzeptioneller Ideen Fioronis zu Ende gebracht. Mit im Boot saßen Paul Zoller (Bühnenbild) und Annette Braun (Kostüme). Das Ergebnis ist sehr überzeugender Natur. Das halb in Trümmern liegende Bühnenbild weist Aspekte verschiedener Glaubensrichtungen auf. Da finden sich unter einer Anhäufung von Müll sowohl christliche, aber auch antike und islamische Elemente, die wohl aus Beutezügen des hier offenbar auch kriegerischen Königs Kandaules stammen. In erster Linie wird er von der Regie aber als Künstler gezeigt, der aufgrund des materiellen Überflusses, in dem er lebt, seine Schaffenskraft verloren hat. Seine Produktivität ist bei Null angelangt und seine Inspiration erschöpft. So sinnlos wie die ganze ihn umgebende Hofpracht ist auch sein Leben geworden. Das Haus Kandaules ist gleichsam in Dekadenz erstarrt und zudem in hohem Maße entartet.

Oliver Zwarg (Gyges), Mathias Schulz (Kandaules)
Das zeigt sich insbesondere bei den mit missgebildeten, übergroßen Händen und Ohren ausgestatteten Höflingen, die zu Beginn ihre modernen Anzüge mit reichlich bizarr anmutenden Kostümen vertauschen. Da drängt sich einem nachhaltig der Eindruck auf, dass es sich bei dieser bunten, komischen Schar um die sieben Zwerge aus dem Märchen „Schneewittchen“ handelt. Dass diese Impression nicht trügt, bestätigt sich spätestens im zweiten Akt, wenn Nyssia sich in ihrem unterirdischen Gemach, das eher wie ein Keller wirkt, zusätzlich zu ihrer roten Haarschleife auch noch das blaue Kleid Schneewittchens aus dem gleichnamigen Film von Walt Disney anzieht, wobei man sie für einen kurze Augenblick oben ohne, wenn auch mit dem Rücken zum Publikum, sieht. Gleich einer Lulu wird die Königin zum puren Objekt degradiert. Sie gewinnt aber zunehmend an Eigenständigkeit und entwickelt einen eigenen Willen, der schließlich in dem Mordauftrag an ihrem Mann mündet.

Sally du Randt (Nyssia), Oliver Zwarg (Gyges), Mathias Schulz (Kandaules)
Schuhmacher macht aus der Geschichte eine recht kurios anmutende Märchengroteske. Hier haben wir es mit einer künstlichen Welt zu tun, die der Imagination des vom Überfluss übersättigten Kandaules entspringt. Er hat sich dieses Märchenambiente geschaffen, weil er aus einer gewissen Beschränktheit heraus die Realität nicht mehr ertragen kann und sich demgemäß als Ersatz in eine Scheinwelt geflüchtet. Erst in dem Augenblick, als er glaubt alles, auch seine schöne Gemahlin, mit dem Fundamentalisten Gyges - dessen von ihm ermordete Frau stellt eine Marien-Statue dar - und seinem Hofstaat geteilt zu haben, findet er in die Wirklichkeit zurück und nimmt den Höflingen nun ihre übergroßen Hände ab. Aus den Zwergen werden wieder Menschen, die Realitätsflucht des Herrschers hat ein Ende. Die absurde Märchenwelt weicht der Gegenwart. Und die Herstellung von Bezügen zur Moderne ist ein gewichtiges Ziel des Regisseurs.

Mathias Schulz (Kandaules), Oliver Zwarg (Gyges)
Auf insgesamt hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Matthias Schulz hatte sich die Anlage des Regisseurs vom Kandaules trefflich zu eigen gemacht und sie darstellerisch überzeugend ausgefüllt. Stimmlich war er nicht in gleichem Maße überzeugend. Zwar verfügt er über schönes Tenor-Material, das indes zu wenig italienisch geschult ist. Ganz anders dagegen Sally du Randt, die mit intensivem Spiel die Nyssia aus der ihr vom Komponisten aufgezwungenen Passivität befreite und ihrer Rolle mit wunderbar warm und gefühlvoll klingendem, bestens focussiertem und in jeder Lage gleichermaßen sicher ansprechendem Sopran auch stimmlich voll und ganz entsprach. Als Gyges bewährte sich Gastsänger Oliver Zwarg, den man schon von größeren Bühnen her kennt. Schauspielerisch stets präsent und sehr charismatisch auftretend gelang ihm auch vokal mit eindrucksvollem, markantem Bariton ein eindringliches Rollenportrait. Unter den Höflingen ragten insbesondere Ji Woon Kim (Syphax, Simias), Young Kwon (Philebos, Koch) und der junge Eleve des Augsburger Theaters Georg Festl (Pharnaces) heraus. Aber auch Giulio Alvise Caselli (Phedros), Fabian Langguth (Nicomedes), Joel Annmo (Sebas) und Markus Hauser (Archelaos) zeigten sich stimmlich versiert.
In Hochform präsentierten sich auch Lancelot Fuhry und die bestens disponierten Augsburger Philharmoniker. In dem aufwühlenden, reißerischen Klangteppich waren Vorbilder Zemlinskys wie Wagner, Strauss und Mahler gut auszumachen. Der expressive Charakter der Musik wurde hervorragend herausgestellt, aber genauso gut die impressionistischen Charakterzüge der vielschichtigen Partitur betont. Dazu gesellten sich eine ausgewogene Skala von einfühlsamen dynamischen Abstufungen sowie eine schöne Farbpalette.
Eine regelrecht preisverdächtige Aufführung, deren Besuch sehr zu empfehlen ist!
Ludwig Steinbach, 16.10.2015
Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
weiteres Interessantes
Gespräch mit Anthony Beaumont über Zemslinsky
Zemlinsky Biografie von Beaumont
weiterer Buchtipp zur Oper (Bid unten)
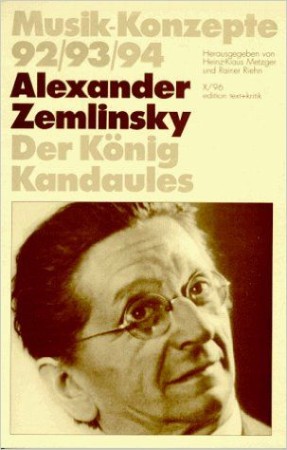
DER KÖNIG KANDAULES
Oper von Alexander Zemlinsk
Premierenkritik vom 27. 09. 2015
Als Richard Wagner im Jahre 1841, in tiefster persönlicher Not, in Paris gezwungen war, seinen ersten Entwurf zur Oper „Der fliegende Holländer“ an die Pariser Oper zu verkaufen, damit das Werk anschließend von einem anderen Librettisten ausgefertigt und von einem anderen Komponisten komponiert werden konnte, war das sicher die schwerste Niederlage, die einem jungen, aufstrebenden Dichterkomponisten bereitet werden konnte. Gleichwohl war Wagner von sich und seinem Werk so überzeugt, dass er es anschließend doch selbst noch ausführte (ohne Aussicht auf eine Aufführung!) – sein Ergebnis wurde ein Welterfolg, der heute noch die Spielpläne rings um den Globus beherrscht. Als Alexander Zemlinsky knapp hundert Jahre später in einer unvergleichlich größeren Not steckte und sein Werk für eine Aufführung in Amerika ins Gespräch brachte, reichte ihm ein Hinweis auf evtl. auftretende Schwierigkeiten, um es ad acta zu legen. Und nun streitet die Musikwissenschaft, ob die posthume „Vervollständigung“ eine Großtat sei, oder ob das Werk nicht vielleicht doch Rätsel und Schwächen (vor allem aber: Längen!) bietet, die eben – trotz inzwischen erfolgter Inszenierungen an neun Theatern und zwei CD-Produktionen (die ihrerseits Mitschnitte von Theateraufführungen sind) – nicht zu einem globalen Erfolg geführt haben…
Zemlinsky, davon überzeugt, dass seine erste Opernproduktion in Amerika ein Erfolg werden müsse, legte das Werk selbst beiseite und schuf andere Kompositionen. Beabsichtigte Änderungen (insbesondere im 1. Akt) verwarf er, bzw. sind nicht erhalten. Aus einer sehr komplizierten Quellenlage hat Antony Beaumont das Werk „rekonstruiert“ und zu großen Teilen instrumentiert. Bei aller Anerkennung dieser Fleißarbeit, ist ein „Originalwerk“ auf diesem Wege freilich nicht entstanden. Ich glaube auch nicht, dass die Ursache der Abwendung des Komponisten von seinem Werk die angebliche Fragwürdigkeit der „Bett-Szene“ im 2. Akt gewesen sein kann, dann hätte er ja am 1. Akt nichts ändern wollen müssen. Vielmehr scheint das Werk in seiner inhaltlichen Struktur sich einem Erfolg auf der Opernbühne zu widersetzen…
König Kandaules, am eigenen Überfluss förmlich erstickend, will seine „Schätze“ mit anderen teilen, ausgerechnet gehört seine eigene Frau in erster Linie dazu, die er zunächst einmal zwingt, etwas zu tun, was sie nicht tun will – sich vor anderen zu entschleiern. (Das wird bei dieser Geschichte billigend in Kauf genommen, während man dem Wagner vorwirft, dass er seine Senta vom Vater „verschachern“ lässt.) Der Gegenspieler Gyges, ein armer Fischer, bringt erst einmal seine Frau aus Eifersucht um (dass ihr wegen Trunkenheit zufälligerweise die Hütte abbrannte, bleibt ungesühnt!), was allgemeinen Beifall findet (bis auf Nyssia, des Kandaules Frau, finden es alle völlig in Ordnung!) Als ein geheimnisvoller Ring ins Spiel kommt, der seinen Träger unsichtbar macht, und Kandaules Interesse am Fischer findet, entsteht die Idee, diesem seine Frau Nyssia „in voller Schönheit“ zu präsentieren, was auch stattfindet; Nyssia glaubt, die schönste aller Nächte mit ihrem Mann verbracht zu haben – in Wahrheit war es der Fischer, der nun, von Gewissensbissen geplagt, seinen Tod von ihr einfordert. Diese allerdings wechselt folgerichtig die Fronten: sie verlangt vom Helden der Liebesnacht den Tod des Königs – widerstrebend wird dem entsprochen – und ruft anschließend Gyges zum neuen König und ihren Herren aus. Diese Dreiecksgeschichte ließe sich in zehn Minuten wiedergeben, alles andere – die Freunde des Gyges, die sein Glück mit ihm teilen sollen – sind Staffage, wenig charakterisiert, nicht individualisiert, keine Gelegenheit bietend, theatralisches Kapital aus ihnen zu schlagen. Schon bei meiner, in diesem Fall sehr umfangreichen Vorbereitung auf das Werk, war mir das immer das größte Rätsel: die Langeweile, die sich ausbreitet, bevor das Stück im letzten Drittel des Abends endlich mal losgeht (Und der Abend ist mit einer Spieldauer von fast drei Stunden eindeutig überdehnt!)
Die Augsburger Aufführung konnte diese Schwächen schon deshalb nicht beseitigen, weil man von ausnahmslos allen Beteiligten den Text meist nicht verstehen konnte, obwohl das Werk in der Originalsprache – deutsch – gesungen wurde. Daran war sicherlich zu einem großen Teil auch das sehr auftrumpfende Orchester schuld, das die Leute an vielen Stellen erbarmungslos zudeckte. Das ist mein einziger Einwand gegen diese Aufführung.
Die Inszenierung hat in verblüffender Weise einen anfangs amüsanten und kurzweiligen Abend aus diesem Material gemacht, indem es ihr gelang, es als Vorlage für eine Groteske zu nutzen, die es eben auch sein kann und indem sie bestimmte Vorgänge „entschärfte“ (z.B. bringt der Fischer seine Frau wohl um, allerdings ist das keine reale Person, sondern nur eine Puppe und Nyssia lüftet tatsächlich nur ihren Gesichtsschleier, steht also nicht entblößt vor den „Freunden“, wie auch die einst so anrüchige Bettszene mit viel Geschmack und bewundernswerter Dezenz dargeboten wurde, Voyeure kamen mit Recht nicht auf ihre Kosten!). Trotzdem gelingt der Aufführung die Kurve in den Ernst der Geschichte – als es im zweiten Teil in den Keller der Lüste geht, beginnt wirklich eine spannende Auseinandersetzung, die bis zum Schluss anhält. Insofern verneige ich mich mit großem Respekt vor Søren Schuhmacher, der die Inszenierung auf der „Grundlage konzeptioneller Ideen“ vom erkrankten Lorenzo Fioroni übernommen hat und dem es gelang, die Gratwanderung zwischen Groteske und Krimi zu meistern. Paul Zoller hatte ihm dafür einen adäquaten Bühnenrahmen geschaffen und besonders die Kostüme von Annette Braun unterstrichen die Absicht, Groteske und Ernsthaftigkeit nebeneinander zu stellen.
Daran sind freilich in dominierender Weise die drei Protagonisten beteiligt, die den Abend dann doch noch zum Erlebnis werden lassen. Insbesondere Oliver Zwarg kann als Fischer Gyges nicht nur mit seiner darstellerischen Glaubhaftigkeit, sondern vor allem mit einer gesunden und großen Baritonstimme überzeugen, die man – in dieser Qualität – in Augsburg in den beiden vorausgegangenen großen Opernproduktionen leider vermissen musste. Matthias Schulz hätte möglicherweise seine Leistung noch steigern können, wäre ihm der Übergang vom Karikierenden des Anfangs zur heldischen Ernsthaftigkeit besser geglückt; auf dieser Strecke blieben leider Wünsche offen. Bleibt Sally du Randt, die als Nyssia anfangs sehr verhalten in Aktion tritt, sich gegen Schluss hin immens steigert, bewundernswert, wie sie auch in dieser Partie das „Singen“ nie aus der Kontrolle verliert, selbst als besonders gegen Schluss das Orchester erbarmungslos zuschlägt. Von den sieben kleineren Partien hat sich mir lediglich der neu verpflichtete Bass Young Kwon seiner auffallend schönen Stimme wegen eingeprägt, der die beiden Partien des Philebos und des Kochs übernahm, wohl deshalb, damit die „Freunde“ des Kandaules die Zahl „sieben“ erreichen, denn die „gnomenhaften Zwerge der Disneywelt“ sind als Anspielung im Kostümbild der Aufführung ausdrücklich gewollt.
Domonkos Héja stand erstmals als GMD am Pult einer Augsburger Opernpremiere und er kostete die Vielschichtigkeiten der Zemlinskyschen Musik bzw. der Instrumentation von Beaumont voll aus, auch merkte man ihm die Freude an, mit einem so kompetenten Orchester wie den Augsburger Philharmonikern zu arbeiten – leider mit wenig Rücksicht auf die Szene, was anfangs zu völliger Unverständlichkeit führte, später, als die drei Hauptprotagonisten ins Spiel kamen aber eben auch dem Verständnis hinderlich war. Da gibt es noch viel Arbeit – übrigens auch im Hinblick auf die Sanierung des Hauses: an der Akustik müsste dringend sehr intensiv gearbeitet werden, sie erwies sich nicht nur bei „Tristan“ und „Elektra“ als schwierig, sondern behinderte auch bereits das Verständnis von Rezniceks „Blaubart“ und Korngolds „Ring des Polykrates“.
Das Publikum folgte der Aufführung mit Disziplin und spendete am Ende einen wohlwollenden, aber dennoch verhaltenen Applaus. Dass dem Werk der „Durchbruch“ in Augsburg gelingt, glaube ich nicht. (Der Computer der Deutschen Bahn „verfügte“ mir eine Rückfahrt mit zwei Stunden Wartezeit auf dem nächtlichen Münchner Hauptbahnhof, wo immer noch Flüchtlinge auf dem Fußboden campieren – was hätten die wohl gemeint, hätte man ihnen diese „Abendunterhaltung“ vorgeführt – – – so viel nur zur vor Ort beschworenen Aktualität des Werkes in der gegenwärtigen Flüchtlingssituation…)
Werner P. Seiferth 30.9.15
besonderer Dank an MERKER-online
Bilder A.T. Schäfer
OPERNFREUND CD Tipp
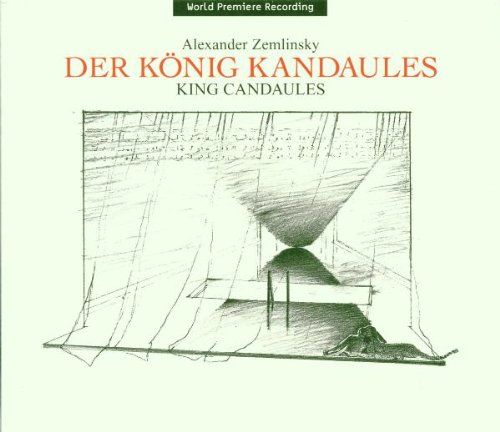
Im Gegensatz zur geradezu unverschämt teuren Aufnahme mit Nagano und den Berlinern ist diese hier ein Schnäppchen für Zemlinsky-Fans. Red.
LA FINTA GIADINIERA
Besuchte Aufführung: 12.6.2015 (Premiere: 18.4.2015)
Die künstliche Natur der Glamourwelt Hollywoods
Es sind nicht nur Mozarts sieben letzte Opern, die regelmäßig aufgeführt gehören. Auch sein für den Münchner Fasching 1775 geschriebenes Frühwerk „La finta giardiniera“, zu deutsch „Die Gärtnerin aus Liebe“, hat sich einen ständigen Platz im Repertoire der Opernhäuser verdient - jedenfalls wenn man sich die gelungene Produktion am Theater Augsburg vor Augen führt.

Cathrin Lange (Violante/Sandrina)
Hier haben wir es mit einer ausgesprochenen Rarität zu tun, für deren Ausgrabung dem Augsburger Theater sehr zu danken ist. Ursprünglich eine Opera buffa, weist sie aber auch Anklänge an die herkömmliche Opera seria auf. Das daraus entstehende Stilgemisch ist recht reizvoll. Ins Auge springt, dass bereits in diesem frühen Stück des 18jährigen Mozart viele Charakteristika seiner späteren Opern bereits angelegt sind. Wenn man genau hinhört, vernimmt man bereits Anklänge an so manches später zu Berühmtheit gelangte Motiv. Und auch die musikalische Charakterisierungskunst des jungen Mozart war in diesem noch frühen Stadium seines Wirkens bereits trefflich entwickelt.

Giulio Alvise Caselli (Nardo), Matthias Schulz (Don Anchise), Samantha Gaul (Serpetta), Stephanie Hampl (Ramiro)
In der Herausarbeitung und Wiedergabe dieser Feinheiten besteht auch eine unbestreitbare Stärke von Carolyn Nordmeyer, der zweiten Kapellmeisterin des Theaters Augsburg, bei der sich Mozarts Partitur in besten Händen befand. Sie ging die Sache zusammen mit den gut gelaunt und versiert aufspielenden Augsburger Philharmonikern tempomäßig und von der Dynamik her sehr differenziert und abgestuft an und bewies zudem ein ausgezeichnetes Gespür für Klangfarben und deren Auffächerungen. Dabei verstand sie es hervorragend, die Spannung zu halten. Wo sie sich mit Blick auf Mozarts Vorgaben mal etwas zurückhielt, wartete sie dafür mit um so prägnanteren Akzenten auf. Den großen Bogen behielt sie stets im Auge, schenkte aber auch den mannigfaltigen Details ihre Aufmerksamkeit. Das war Mozart vom Feinsten!

Cathrin Lange (Violante/Sandrina)
Einfach entzückend und größtenteils ausgesprochen kurzweilig und unterhaltsam war die Inszenierung von Roland Schwab, der sich dem Stück mit viel Liebe und einem trefflichen Gespür für Situationskomik angenommen hat. Er war sich im Klaren darüber, dass Mozarts Werk in seinem traditionellen Kontext keine sonderliche Wirkung entfalten würde und hat es demzufolge gekonnt in die Gegenwart transferiert, und zwar in die Schicki-Micki-Welt der High Society Hollywoods. Von der von David Hohmann entworfenen, auf einer Anhöhe verorteten Villa des Podestà mit Lamellenwänden, Swimmingpool, Fitnessgeräten und Massageliege sieht man auf das erleuchtete Los Angeles hinunter - ein hübscher Anblick. Sämtliche der von Renée Listerdal in sommerliche Frische atmende Pastellfarben eingekleideten Handlungsträger fügen sich bestens in dieses Ambiente der insgesamt reichlich dekadent wirkenden Schönen und Reichen ein. Der Podestà mit Namen Don Anchise ist offenbar ein reicher Filmproduzent, Arminda stellt eine ausgediente Schauspielerin dar und die sich ständig auf Rollschuhen fortbewegende Serpetta wird als weiblicher Emporkömmling vorgeführt. Belfiore ist Johnny Depp nachempfunden und die hier von der ursprünglichen Gärtnerin zur Poolreinigerin gewordene Violante alias Sandrina deutet der Regisseur als eine zielstrebig vorgehende Newcomerin im Filmgeschäft, die mit ihren weiblichen Reizen nicht geizt und sich dem Filmboss Anchise auch mal in einem knappen Bikini zeigt. Das ist schon ein ausgemachtes Luder, das sich nur deswegen entblättert, um eine Rolle zu bekommen.

Christopher Busietta (Belfiore), Cathrin Lange (Violante/Sandrina)
Auch sonst weiß diese kühl berechnende Frau ganz genau, was sie will. Nämlich Rache nehmen an ihrem Ex-Geliebten Belfiore, der sie in der Vorgeschichte im Verlauf eines Streits mitten in der Wüste aus einem fahrenden Auto gestoßen und dann einfach liegengelassen hat. Dieses Erlebnis, dem Schwab eine ganz zentrale Relevanz zumisst, und das zu Beginn in Form eines Films über den Vorhang flimmert, hat bei Violante eine Psychose ausgelöst. Als Sandrina setzt sie nun alles daran, es Belfiore gehörig heimzuzahlen, dem die Herzen der Frauen nur so zufliegen, obwohl ihm an seinem äußeren Erscheinungsbild, das immer nur aus Lederjacke und einfachen Jeans besteht, im Gegensatz zu den anderen Protagonisten nicht viel gelegen zu sein scheint. Er ist schon ein etwas verlotteter Charakter, der von der angeblichen Sandrina hart angegangen und zu einem regelrechten Psychoduell auf Augenhöhe gefordert wird. Mit dieser Frau, die sich von der traditionellen Opferrolle weit entfernt, ist nicht zu spaßen, die hat ihren ganz eigenen Kopf, der eigentlich auf nichts weiter als Vergeltung aus ist - schon deshalb, weil sie ihr Trauma noch immer nicht überwunden hat. Im Lauf des Abends wird sie zunehmend von in Form von Flashbacks ablaufenden Erinnerungen an die fatale Autofahrt heimgesucht, die ihre Rachegelüste vorerst aber nur noch steigern. Sie ist eine ernstzunehmende Gegnerin für ihren Ex-Geliebten. Dem Psychoduell entspricht sinnbildlich der aus wilden Ranken bestehende Garten, zu dem der Swimmingpool am Ende des zweiten Aktes geworden ist. Man kann ihn als Auswuchs der menschlichen Psyche auffassen, der zunehmend auch die anderen Handlungsträger ergreift und ein totales Verwirrspiel in Sinne von Shakespeares „Sommernachtstraum“ auslöst, bevor sich im dritten Akt nach einem Autounfall, den Sandrina und Belfiore besser überstanden haben als ihr auf dem Rücken liegender Luxusschlitten, alles in Wohlgefallen auflöst. Durch das neue schlimme Ereignis gelingt es Sandrina, ihrer Psychose endlich Herr zu werden. So ganz überzeugend ist Mozarts Stückdramaturgie indes nicht - ein Fakt, dem Schwab dadurch Rechnung trägt, dass er dem Ganzem gekonnt den Anstrich des Künstlichen verleiht. Hier scheint alles nicht echt, sondern nur gemacht zu sein. Aber genau das macht die Filmwelt Hollywoods ja gerade aus. Insoweit geht der Ansatz des Regisseurs voll und ganz auf.

Cathrin Lange (Violante/Sandrina), Christopher Busietta (Belfiore)
Von den Sängern ist an erster Stelle die junge Cathrin Lange zu nennen, die mit hervorragend italienisch geschultem, warm und emotional geführtem lyrischem Sopran eine wunderbare Violante/Sandrina sang, die sie auch überzeugend spielte. Die Partie des Podestà Don Anchise, sonst eine Domäne der flachen, maskigen Tenöre, hat der über sonores, fast schon baritonal wirkendes, gut fokussiertes Stimmmaterial verfügende Mathias Schulz vokal erheblich aufgewertet. Auch darstellerisch hat er dem protzigen Film-Boss gut entsprochen. Mit einer hervorragenden schauspielerischen Ader, immenser Spiellust und einer herrlichen Turneinlage stattete Giulio Alvise Caselli den Nardo aus, den er mit solide verankertem, frisch und flexibel klingendem Bariton auch ansprechend sang. In der Hosenrolle des Ramiro bewährte sich mit voll und rund klingendem Mezzosopran Stephanie Hampl. Elegant und tiefgründig sang Andréana Kraschewski die Arminda. Weniger ansprechend schnitten Christopher Busietta als Belfiore und Samantha Gaul als Serpetta ab, die beide ohne schönes appoggiare la voce und zudem sehr kopfig klangen.

Fazit: Ein heiter-vergnüglicher Abend auf insgesamt hohem Niveau, der die Fahrt nach Augsburg wieder einmal voll gelohnt hat. Diese reizvolle Rarität sollte auch von anderen Opernhäusern zur Aufführung gebracht werden.
Ludwig Steinbach, 14.6.2015
Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
MACBETH
Besuchte Aufführung: 4.6.2015 (Premiere: 30.5.2015)
Der ewige Kreislauf von Sex and Crime
Man muss schon sagen: Es ist in hohem Maße bemerkenswert, wie schnell sich das Theater Augsburg von dem ursprünglich sehr konventionell geprägten Haus zu einem führenden Verfechter spannenden modernen Musiktheaters entwickelt hat. Das hat es in erster Linie Georg Heckel, dem künstlerischen Leiter dieser Sparte, zu verdanken, dem es immer wieder gelingt, bedeutende, auch internatonal gefragte Regisseure mit hohem künstlerischen Anspruch und interessanten neuen Regieansätzen nach Augsburg zu locken, denen es nicht nur um eine simple Nacherzählung des in Szene zu setzenden Werkes geht, sondern vielmehr um die Aufzeigung von dessen Relevanz für die Gegenwart und um eine Hinterfragung des Inhaltes.

Hexenchor
Zu diesen Regiemeistern gehört sicher Lorenzo Fioroni, der bereits zum wiederholten Male in Augsburg am Regiepult Platz genommen hat und dem eine recht außergewöhnliche, spektakuläre, zeitgemäße, wenn auch manchmal etwas überfrachtete Inszenierung von Verdis „Macbeth“ zu bescheinigen ist. Er hat die Handlung trefflich in die Gegenwart transferiert und gekonnt Bezüge zu aktuellen Krisenherden wie der Ukraine und dem Irak hergestellt. Macbeth und Banco sind moderne Soldaten in zeitgenössischen Uniformen und mit Stahlhelmen ausgestattet. Sie campieren in einem von Ralf Käselau entworfenen, von einem Zaun umgebenen riesigen Heereslager, dessen Erscheinungsbild durch einen der jeweiligen Jahreszeit - Frühling bis Winter - entsprechenden Baum dominiert wird. Zunächst in voller Blüte stehend, wird er am Ende, nun gänzlich kahl und dürr, von einer weihnachtlichen Lichterkette umgeben. Die Hexen erscheinen als von Annette Braun eingekleidete Prostituierte, deren Aufgabe wohl die Truppenbetreuung ist.

Macbeth, Sally du Randt (Lady Macbeth)
Es ist eine knallbunt zusammengewürfelte Gesellschaft, die Fioroni hier genüsslich aufmarschieren lässt. Das Ganze atmet den Charakter einer groß angelegten bizarren Show mit Adel und Geistlichkeit einerseits und knalligen Figuren aus Comics, Science-Fiction- und Horror-Filmen andererseits, die sich hier ein Stelldichein geben und ihrem als überdimensional-riesiger Teddybär gezeichneten König Duncan huldigen, der später logischerweise auch einen entsprechend großen Sarg benötigt. Derartig skurrile, absurde und überdrehte Bilder rücken das ursprünglich nachtschwarze Geschehen in die Nähe einer Groteske. Fioroni scheut sich nicht, das tragische Geschehen mit mannigfaltigen heiteren und amüsanten Elementen anzureichern und aus dem aufgefahrenen Personal mit Supermann, King-Kong und Darth Vader, dem sich im letzten Akt auch noch der Arzt und die Kammerfrau als Weihnachtsmänner hinzugesellen, eine ziemlich überdreht wirkende Jahrmarktsgesellschaft zu machen. Das verbrecherische Paar an der Spitze des Staats tut wirklich alles, um das Volk mit derartigen Lustbarkeiten von ihren Verbrechen abzulenken - nicht zuletzt deshalb, weil sie politisch eigentlich in den Kinderschuhen stecken geblieben sind und sich von den Staatsgeschäften mehr oder weniger überfordert fühlen. Dieser Ansatzpunkt ist durchaus legitim, birgt im konkreten Fall aber die Gefahr von Überzeichnung in sich, der Fioroni dann auch nicht entgeht. Weniger wäre mehr gewesen.

Martin Seeger (Duncan), Sally du Randt (Lady Macbeth), Macbeth, Chor
In der Bankettszene tritt Macbeth als konventioneller König mit Krone und rotem Purpurmantel auf, während die Lady ihr Outfit den Kostümen des Volkes angleicht. Dass sie den Film „Das fünfte Element“ liebt, macht das diesem entlehnte blaue Latexkleid offensichtlich, das sie hier trägt, das aber genauso einmalig bleibt wie ein elegantes, schickes Kostüm der gehobenen Gesellschaft, in dem sie vor einem öffentlichen Auftritt noch einmal vor den Schminkspiegel tritt. Meistens erscheint sie in sexy Unterwäsche, die sie als ebenso leichtes Mädchen erscheinen lässt wie die Zauberinnen und sie gleichsam zur Oberhexe macht. Dieser Ansatzpunkt ist nicht mehr neu, aber durchaus effektiv und im Gesamtzusammenhang der Inszenierung auch schlüssig. Das Ehepaar Macbeth residiert während des Krieges in der Nähe des Schlachtfeldes in einem schicken Hotelzimmer - ein Bild ihrer mittelalterlichen Burg prangt an der Wand - mit Doppelbett, Schreibtisch und Fernseher, in dem sich der Titel-Antiheld die aktuelle Kriegsberichterstattung ansieht. Eine offene Tür führt ins Badezimmer. In diesem Ambiente pflegen die Eheleute oft sehr heftigen, ausgelassenen Sex, der den beiden Darstellern sicher viel Mut abverlangte.
Durch die Krassheit dieser Bilder offenbart sich, dass die Liebe zwischen Macbeth und seiner Lady bereits an ausgemachte Hörigkeit grenzt. Während in den meisten anderen Produktionen des Stücks die Beziehung zwischen den beiden längst erkaltet ist und sie nur noch in einer Zweckgemeinschaft zusammenleben, lieben sie sich hier immer noch, und das mit ganzer Kraft. Diese große Liebe zwischen den beiden ist es auch, die Macbeth und seine Gattin bei Fioroni nicht als durch und durch böse erscheinen lässt. Die hier weniger machtbesessen als in sonstigen Deutungen der Oper vorgeführte Lady, der die Grundfesten eines christlichen Humanismus nicht fremd zu sein scheinen - sie nimmt auch mal eine Hotel-Bibel zur Hand - beteiligt sich zwar am Königsmord, ist hier aber durchaus keine durch und durch verdorbene Machtpolitikerin und hat letztlich genauso viel Skrupel wie ihr Mann, dessen Wahnvorstellungen von Bancos Geist am Ende des ersten Aktes wohl Ausfluss einer übermäßigen Einnahme von Rauschgift sind - noch ein überzeugender aktueller Bezug. Das ausschweifende Sexleben des Paares dient als Gegenstück ihrer Verbrechen. Gleichzeitig geilen sie sich aber auch an der Macht auf - ein ewiger, sich immer wieder neu beflügelnder Kreislauf von Sex and Crime, der die Protagonisten langsam, aber sicher zu seelischen Wracks erstarren lässt. Das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis, in dem sie zueinander stehen, bewirkt, dass die Lady sich Charaktereigenschaften von Macbeth zueignet und er wiederum Züge von ihr annimmt. Zu Beginn des dritten Aktes erscheint er als Transvestit in ihrem Kleid, um gleich darauf von der nun sehr männlich anmutenden, in schicke Anzüge gekleideten Hexenschar vergewaltigt zu werden. Die Psychen des Ehepaares beginnen allmählich verrückt zu spielen. Klar wird, dass ihr schlechtes Gewissen sie zu sehr belastet. Dass sich die Lady einen Funken Gutes bewahrt hat, erweist sich während ihrer großen Wahnsinns-Szene, in der sie, total wirr geworden, Geschenke an von den Weihnachtsmännern auf den Boden gelegte tote Kinder verteilt. Wenn sie sich schließlich ins Hotelzimmer zurückzieht und sterbend auf das Bett legt, setzt sich Macbeth gerade wieder eine Spritze an. Nach seiner letzten verlorenen Schlacht, bei der der Wald von Birnam in Form von Weihnachtsbäumen vorrückt, hatte man fast den Eindruck, als ob er gerne in den Tod ginge. Er kann ohne seine Frau nicht leben. Schließlich finden ihre Seelen - durch ein Photo versinnbildlicht - im Jenseits zueinander, während sich die Hexen auf ihre mumifizierten Leichen stürzen - ein gleichermaßen makabres wie romantisches Ende. Insgesamt haben wir es hier trotz der aufgezeigten Überzeichnung mit einer durchaus sehenswerten Produktion zu tun, die auch treffliche Brecht’sche Elemente in sich birgt, so wenn die Mörder durch den Zuschauerraum auftreten.

Macbeth, Hexenchor
Auf insgesamt hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Hier ist an erster Stelle Sally du Randt zu erwähnen, die in der Lady Macbeth eine erstklassige Rolle für sich gefunden hat. Die Partie kam genau zur rechten Zeit für ihren immer fülliger und ausdrucksstärker werdenden und in riesigen Schritten in das dramatische Fach hineinwachsenden Sopran, mit dem sie alle Facetten der Lady auf geradezu bravouröse Weise meisterte. Herrlich blühte ihre prachtvolle Stimme insbesondere in der sicher erreichten Höhe auf. Im oberen Bereich und bei den wunderbaren, bestens fokussierten Piani und Pianissimi hatte sie ihre stärksten Momente. Hier wartete sie mit einer sehr seelenvollen, emotionalen Tongebung auf, was eigentlich gar nicht zu der Lady passt, aber in der konkreten Konzeption Fioronis ausgezeichnet zur Geltung kam. Seine sicher nicht immer einfach zu bewältigenden Regieanweisungen hat sie trefflich umgesetzt und sowohl die Liebe der Lady zu ihrem Ehemann als auch ihre Skrupel darstellerisch überzeugend umgesetzt. Die Rolle des Macbeth war an diesem Abend zweigeteilt. Der ursprünglich vorgesehene Sänger Matias Tosi war erkrankt. Da der Ersatz zeitbedingt nicht mehr in die Inszenierung eingewiesen werden konnte, verfiel man auf folgende Lösung: Regieassistent Benjamin David spielte den Part, während Ricardo Lopez, der die Partie sowieso in der nächsten Saison übernehmen wird, diese von der Seite aus sang und dabei ein Versprechen für die Zukunft abgab. Er singt durchaus kräftig und mit guter Stütze, was schon viel ist. Was ihm im Augenblick aber noch fehlt, sind eine größere Farbpalette und etwas mehr Nuancen. Übertroffen wurde er von Ji-Woon Kim, der mit prachtvollem, hervorragend fokussiertem, sonorem und ausdrucksstarkem Spinto-Tenor als Macduff eine ausgemachte Glanzleistung erbrachte. Einen ausgezeichneten Eindruck hinterließ auch Vladislav Solodyagin, der den Banquo mit edler, profunder, farbenreicher Klangkultur und ansprechender Linieführung ausstattete. Eckehard Gerboth (Arzt) und Andrea Berlet-Scherer (Kammerfrau) machten aus ihrem kurzen Auftritt mit tadellosen, gut verankerten Stimmen viel, während es dem ziemlich dünn singenden Malcolm von Christopher Busietta noch erheblich an einer tiefen Verankerung seines Tenors fehlt. Als Diener/Herold und Mörder waren solide André Wölkner und Lászlo Papp zu erleben. Papp gehörte auch zu den Erscheinungen im dritten Akt, zu denen noch Valentin Meyer und Julius Gerheuser zählten. Köstlich präsentierte sich Martin Seeger als Teddybär Duncan. Jakob Lohrum spielte ansprechend Banquos Sohn Fleance. Der hervorragend singende Chor wurde von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudiert.

Sally du Randt (Lady Macbeth), Kinderstatisterie
Zu Recht über großen Applaus freuen konnten sich Lancelot Fuhry und die glänzend disponierten Augsburger Philharmoniker. Es ist bezeichnend für die Musiker, dass sie selbst noch die schwierigsten Stellen der Partitur mit hohem technischem Können und großer Noblesse der Tongebung meisterten und dabei die Intentionen des Dirigenten perfekt umsetzten. Fuhry setzte bei seinem Dirigat auf große Transparenz und vielfältige dramatische Akzente und wartete obendrein mit schöner Italianita auf.
Fazit: Trotz einiger kleiner Abstriche eine insgesamt ansprechende Aufführung, die die Fahrt nach Augsburg durchaus gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 8.6.2015
Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
WOZZECK
Besuchte Aufführung: 12.4.2015 (Premiere: 7.3.2015)
Das Spiel kann von neuem beginnen
Mit der Neuproduktion von Bergs „Wozzeck“ hat der seit einiger Zeit zunehmend moderne szenische Kurs des Theaters Augsburg erneut eine eindrucksvolle Bestätigung erfahren. Was an diesem gelungenen Abend geboten wurde, war packendes zeitgenössisches Musiktheater vom Feinsten.

Sally du Randt (Marie), Robin Adams (Wozzeck), Marcel Philippin (Mariens Knabe)
Regisseur Ludger Engels, der dem Augsburger Publikum noch von seiner letztjährigen „Intolleranza 1960“-Produktion ein Begriff sein dürfte, hat die Handlung in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts transferiert und mit einer intensiven, schlüssigen Personenregie einfühlsam vor den Augen des Zuschauers ausgebreitet. Immer neue, von Ric Schachtebeck kreierte Räume - er zeichnete auch für die gelungenen Kostüme verantwortlich - ziehen mit Hilfe der emsig rotierenden Drehbühne vorbei. Es manifestiert sich ein Stationendrama, wobei das soldatische Element völlig ausgeblendet wird. So entstammen der Hauptmann und der Tambourmajor dem Bürgertum. Ausgehend von der Erkenntnis, dass die mit enormem sozialem Sprengstoff aufgeladene Geschichte heute in einem militärischen Ambiente nicht mehr funktionieren würde, hat er das dramatische Geschehen kurzerhand in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt. Diesen hat er mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln kritisch hinterfragt und dabei klargestellt, dass die Art und Weise, wie einzelne Menschen gemobbt und schikaniert werden, zu jeder Zeit dieselbe ist. Nur der sich den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinschaft anpassende äußere Rahmen ist von Ära zu Ära zeitspezifischen Wandlungen unterworfen.

Robin Adams (Wozzeck), Sally du Randt (Marie), Carlos Aguirre (Tambourmajor)
Wozzeck fügt sich in die Gemeinschaft nur schwer ein. Als geknechtetes, gedemütigtes und schikaniertes Individuum hat der dem Kollektiv nichts entgegenzusetzen. Was auf den ersten Blick noch harmlos aussieht, wie beispielsweise die Spritze, die ihm der Doktor in den Allerwertesten gibt, oder der Kniff ins Hinterteil, den ihm der Hauptmann - am Anfang verabreicht Wozzeck ihm eine Maniküre - verpasst, kann in der Summe schließlich schlimme Resultate nach sich ziehen. Mit ungeschönter Krassheit zeigt Engels die Folgen auf, die es haben kann, wenn ein Einzelner von den anderen nicht als das akzeptiert wird, was er ist, sondern stets nur ausgenutzt wird. Da kann ein Opfer auch mal zum Täter werden.

Carlos Aguirre (Tambourmajor), Sally du Randt (Marie), Statisterie
Die immer wieder die Bühne überquerenden Mitglieder der Gesellschaft nehmen von Wozzeck, der irritiert um sich schaut und um Aufmerksamkeit fleht, keine Kenntnis. Auch seine Liebe zu Marie bringt ihm keine Befriedigung. Er lebt mit ihr und seinem kleinen Sohn zusammen in einer nicht wirklichen Idylle. Hier wird heile Familie gespielt, aber der Schuss geht nach hinten los. Teilnahmslos beobachtet Wozzeck, wie Marie sich um das Kind kümmert, und zwar an einer Stelle, wo Berg ihm eigentlich gar keinen Auftritt zugebilligt hat. Man merkt, mit Tschechow’schen Elementen kann der Regisseur umgehen. Immer stärker stößt er den Protagonisten ins gesellschaftliche Abseits und lässt ihn zum Außenseiter werden. Sein existentielles Problem besteht indes nicht nur in den Schikanen der Gesellschaft, sondern auch in seiner von Engels dezent angedeuteten Homosexualität, die ja in den 1950er Jahren noch unter Strafe gestellt war. Marie und das Kind haben für ihn jedenfalls auch eine Alibifunktion, die ihn schützen soll, wegen seiner sexuellen Neigungen belangt zu werden. Manchmal kann er es in der Nähe von Menschen nicht mehr aushalten und zieht sich in einen aus hölzernen Latten bestehenden Kubus als Schutzraum zurück, den er mit Zellophanfolie umwickelt. Nachdem er Marie getötet und sie in dem Kubus auf den Boden gebettet hat, stirbt er einen symbolischen Tod und hüllt sich selbst in Folie ein. Das Gleiche tut der Sohn mit seinem Schaukelpferd. Gleich seinem Vater wird nun auch er von den anderen Kindern schikaniert. Ihm wird es genauso ergehen wie Wozzeck. Auch er wird ein Opfer der Gesellschaft werden und vielleicht ebenfalls als Mörder enden. Das ist in einem ewigen Kreislauf der Welt, wie er von der Drehbühne versinnbildlicht wird, so angelegt, Das Spiel kann von vorne beginnen - ein eindringliches, sehr pessimistisches Ende.

Robin Adams (Wozzeck), Sally du Randt (Marie)
Auf insgesamt hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Allen voran Robin Adams, der sich als ausgezeichneter Vertreter des Wozzeck erwies. Das Getriebene, Gehetzte der unter der gesellschaftlichen Acht stark leidenden Titelfigur hat er mit intensivem Spiel und großer darstellerischer Energie trefflich vermittelt. Auch stimmlich vermochte er mit seinem bestens italienisch geführten, edel timbrierten und nuancenreich eingesetzten hellen Bariton zu begeistern. In nichts nach stand ihm Sally du Randt, die der Marie schon schauspielerisch voll entsprach. Auch vokal vermochte sie mit bestens fokussiertem jugendlich-dramatischem Sopran, der zudem über viele Nuancen und Farben verfügt, für sich einzunehmen. Mit sauber durchgebildetem, kräftig und prägnant eingesetztem Tenor sang Carlos Aguirre den Tambourmajor. Mit tieferer Stütze, als man es bei dieser Charakterrolle sonst gewohnt ist, gab Mathias Schulz den Hauptmann. Vladislav Solodyagin brachte einen ebenmäßig geführten, solide ansprechenden Bass für den Doktor mit. Ein tiefgründig geführter Mezzosopran zeichnete die Margret von Kerstin Descher aus. Ziemlich klanglos und stark im Hals sang Eckehard Gerboth den ersten Handwerksburschen. Da war ihm der voll und rund singende zweite Handwerksbursche von Giulio Alvise Caselli um einiges überlegen. Lediglich mittelmäßig schnitt Oliver Scherer als als Transvestit gezeichneter Narr und 1. Tenor ab. In der kleinen Rolle des Soldaten war Oliver Marc Gilfert zu erleben. Ein Extralob geht an den jungen Marcel Philippin, der Mariens Knaben gut verkörperte. Gute Leistungen erbrachten der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Chor und Extrachor des Theaters Augsburg und die Augsburger Domsingknaben.

Robin Adams (Wozzeck)
Gut vermochte Roland Techet am Pult zu gefallen, der Bergs Musik zusammen mit den versiert aufspielenden Augsburger Philharmonikern in klangfarblicher und dynamischer Hinsicht trefflich aufbereitete und im Verlauf des Abends mit immer mehr Facetten aufwartete. Die Leitmotive wurden gut herausgearbeitet und das Ganze mit enormem dramatischem Impetus dargebracht.
Fazit: Wieder einmal eine Aufführung, die die Fahrt nach Augsburg voll gelohnt hat und deren Besuch durchaus zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 14.4.2014
Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
Märchenzauber und Sozialstudie
HÄNSEL UND GRETEL
Besuchte Aufführung: 3.12.2014 (Premiere: 25.10.2014)
Risiken übermäßigen Konsumgenusses
Gleich vielen anderen Opernhäusern hat auch das Theater Augsburg rechtzeitig zur Adventszeit Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ neu herausgebracht. Die Rezeptionsgeschichte des im Jahre 1893 am Hoftheater Weimar unter der musikalischen Leitung von Richard Strauss uraufgeführten Werkes war lange Zeit von märchenhaften Zuckerguß-Inszenierungen geprägt. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich indes immer mehr moderne, sozialkritische und manchmal auch pädophil angehauchte Interpretationen dazugesellt.

Stephanie Hampl (Hänsel), Cathrin Lange (Gretel)
Mit Blick auf das teilweise noch recht junge Publikum dieser Oper stellt sich für Regisseure hier in verstärktem Maße die Frage, ob sie die Geschichte traditionell in schönen Bildern erzählen oder ihr einen zeitgenössischen Anstrich geben sollen. In Augsburg ist Aron Stiehl das Kunststück gelungen, beide Deutungsmuster geschickt unter einen Hut zu bringen. Den Spagat zwischen farbenprächtigem Märchenzauber und eindringlicher Sozialstudie haben er und seinem Team Simon Holdsworth (Bühnenbild) und Dietlind Konold (Kostüme) hervorragend bewältigt. Dem Auge wird in gleichem Maße etwas geboten wie dem neugierigen Intellekt. Diese Produktion schafft einen perfekten Ausgleich zwischen den verschiedenen Regiestilen und hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Bedürfnisse des Kindes werden genauso befriedigt wie die des modernem Musiktheater anhängenden Erwachsenen. In der Beleuchtung der unterschiedlichen Aspekte findet Stiehl ebenfalls einen guten Mittelweg. Wenn er und Holdsworth beispielsweise im konventionell dargestellten zweiten Akt in erster Linie auf ein naturalistisches Akanthus-Dickicht setzen, wirkt das im Gegensatz zu so manch älterer Produktion in keiner Weise betulich. Durch einige fleischfressende Pflanzen als Sinnbilder des ständigen Hungers der Hexe auf Kinder wird zudem eine symbolische Komponente mit eingebracht. Auch bei der Durchleuchtung des tiefschürfenden gesellschaftskritischen Subtextes kommt er ohne Übertreibungen und Provokationen aus. Hier findet ein visueller Bilderzauber statt, der gleichzeitig zum Denken anregt und jegliche Art von Klischees vermeidet.

Cathrin Lange (Gretel), Stephanie Hampl (Hänsel)
Die Lehren des gebürtigen Augsburgers Bertolt Brecht sind Stiehl gleichermaßen vertraut wie Tschechow’sche Elemente, durch die die Spannung seiner temporeichen Personenregie noch verstärkt wird. Das wird im Zwischenspiel zum zweiten Aufzug offenkundig, wenn er den Zuschauerraum in das Spiel einbezieht und einigen Handlungsträgern Auftritte zubilligt, die vom Komponisten an dieser Stelle gar nicht vorgesehen waren. So wandeln Hänsel und Gretel in gemäßigt modernen Kleidern durch die Zuschauerreihen und bitten um Almosen, wobei sie auch vor der sich gestört fühlenden Dirigentin nicht halt machen. Die Eltern erscheinen ebenfalls im Auditorium, vermögen ihre Kinder aber nicht zu finden. Die Gefahr ist nahe, denn die Hexe in Gestalt einer liebevollen alten Oma - später präsentiert sie sich im BH und mit starker Bauchbehaarung sehr androgyn - streift auf der Suche nach neuen Opfern ebenfalls durch das Parkett und erscheint einige Zeit später außerdem bei der Pantomime. Hier hat auch das stumm durch die Luft schwebende Taumännchen in der Maske von Mary Poppins, das zu Beginn des dritten Aktes das Licht im Saal auspustet und im Orchestergraben angehen lässt, seinen ersten Auftritt.

Stephanie Hampl (Hänsel), Christopher Busietta (Hexe), Cathrin Lange (Gretel)
Der Traum der Geschwister ist gleichzeitig der Schlüssel zum Kern der Inszenierung. Stiehl zeigt ihn nicht als beschauliche Engels-Idylle, sondern als Wunschdenken der Kinder, die in der realen Welt in einem ärmlichen Wohnwagen hausen, dessen Kühlschrank immer leer ist. In dem Ausmaß wie sie in der Realität hungern müssen, eröffnet ihre Phantasie ihnen in besagter Szene den Weg in eine Konsumwelt, die sie wohl aus den Medien kennen, aber nicht an ihr teilhaben können. Hier werden ihnen alle ihrer Wünsche erfüllt. Zu Weihnachten schenken die Eltern Gretel ein Ballettkleidchen und Hänsel ein Fussball-T-Shirt. Sie träumen sich in ein 5-Sterne-Hotel, in dem zahlreiche Dienstmädchen und Pagen an die Stelle der herkömmlichen Himmelswesen treten. Von Darben kann keine Rede sein, denn die riesige Speisetafel im Hintergrund ist schon reich gedeckt. Ausgiebiger Völlerei ist Tür und Tor geöffnet. Und hier liegt der Knackpunkt.

Cathrin Lange (Gretel), Stephanie Hampl (Hänsel), Christopher Busietta (Hexe)
Denn darüber, dass mit den Verlockungen der Konsumwelt am besten reiche Beute zu machen ist, ist sich auch die Hexe im Klaren. Bei Stiehl lebt sie nicht in einem Lebkuchenhäuschen, sondern in einem putzigen, pilzförmigen Kiosk mit LED-Beleuchtung und der Aufschrift „Omas Kuchen“, in der sie die verschiedensten Süßigkeiten verkauft. Walt Disney lässt grüßen. Obwohl der Regisseur von einer Eins-zu-Eins-Übersetzung des Knusperhäuschens Abstand nimmt, trifft dieses stimmungsvolle Bild die Essenz der Handlung voll und ganz. Dem Zauber der fertigen Süßwaren korrespondiert der Schrecken des industriellen Herstellungsprozesses. Mit Hilfe des zum Zauberstab mutierten Kochlöffels lässt die Hexe aus dem Kiosk rasch eine schreckenerregende Backfabrik entstehen, die von einem überdimensionalem Sahnespender, den sie Hänsel in den Mund steckt, und einer riesigen Mikrowelle, die hier an die Stelle des Backofens tritt, dominiert wird. Der kunstvolle Anstrich der fertigen Süßwaren erfährt eine Relativierung durch die grausamen Produktionsbedingungen. Es ist eben nicht immer Gold, was glänzt. Das Entsetzliche unter der Oberfläche spricht eine andere Sprache und ist durchaus dazu geeignet, einem den Appetit auf Leckereien zu verderben. Da bedient man sich schon lieber an den normalen Lebensmitteln, die der Besenbinder im ersten Aufzug in seinen Discountertüten mit nach Hause bringt. Dass sich im dritten Akt Phantasie und Wirklichkeit derart effektiv die Hand reichen, macht den großen Reiz des Hexen-Bildes aus. Insgesamt wurde deutlich, dass übermäßiger Konsumgenuss nicht berechenbare Risiken mit sich bringt und dass Vorsicht geboten ist. Insoweit ist das Konzept von Stiehl voll aufgegangen.

Dong-Hwan Lee (Peter), Stephanie Hampl (Hänsel), Gertrud, Cathrin Lange (Gretel), Kinderchor
Gemischte Gefühle hinterließen die Sänger/innen. Positiv an erster Stelle ist hier die über eine immense Spiellust verfügende, fetzig und aufgedreht agierende Gretel von Cathrin Lange zu nennen, die ihrem Part mit gut fokussiertem, frischem und ein schönes appoggiare la voce aufweisendem Sopran auch stimmlich voll entsprach. Mit nicht ganz so stark ausgeprägtem darstellerischem Elan, vokal aber mit einem vollen, runden Mezzosopran aufwartend, präsentierte sich Stephanie Hampl in der Rolle des Hänsel. Christopher Busietta erwies sich als schauspielerisch durchaus überzeugende Hexe, der er mit seinem sehr dünnen, kopfigen Tenor gesanglich aber keine Konturen verleihen konnte. Aus dem gleichen Grund vermochte Samantha Gauls Sand- und Taumännchen zumindest vom Gesang her nicht für sich einzunehmen. Einen sonoren, obertonreichen Bariton brachte Dong-Hwan Lee für den Besenbinder Peter mit. In der Partie der Gertrud ging Kerstin Descher zu oft vom Körper weg, was insbesondere in der Höhe eine recht keifende Tongebung nach sich zog. Das ist man von der sonst guten Sängerin nicht gewohnt. Hübsch sang der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek und Günther Sailer einstudierte Kinderchor.
Nach einigen kleinen Unebenheiten bei den Hörnern im Vorspiel liefen die Augsburger Philharmoniker im Lauf des Abends zu großer Form auf. Kapellmeisterin Carolin Nordmeyer betonte weder die Wagner’schen Aspekte der Partitur noch stellte sie deren volksliedhafte Aspekte in den Vordergrund. Der Mittelweg, den sie fand, war durchaus ansprechender Natur, weder zu schwer und wuchtig noch zu kammermusikalisch leicht. Insgesamt war ihr von zügigen Tempi bestimmtes Dirigat mehr analytischer als romantischer Prägung.
Ludwig Steinbach, 4.12.2014 Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
JENUFA
Premiere: 20. September 2014
Besuchte Vorstellung: 3. Oktober 2014
Nach dem Ende seiner Operndirektion in Leipzig (2012) hatte Peter Konwitschny seine Regietätigkeit etwas reduziert, in dieser Saison ist er nun wieder voll da. Gleich drei Neuinszenierungen bringt er in dieser Spielzeit heraus. Aber auch um die Übernahmen seiner Inszenierungen an andere Häuser kümmert er sich. So auch bei der „Jenufa“, die bereits im März Premiere in Graz hatte und nun in Augsburg gezeigt wird.
In früheren Jahren hat Konwitschny Stücke auch schon mal radikal umgedeutet und sie ganz neu erzählt, nun ist er versöhnlicher geworden. Seine starke „Jenufa“-Inszenierung erzählt die Geschichte so, wie man das Stück kennt, besticht aber durch die Sorgfalt und Genauigkeit der Personenführung. Mit den Solisten und dem Chor hat Konwitschny an jeder Geste, jedem Blick gearbeitet. Das ist so spannend, dass man sogar schon mal den Blick auf die Übertitel vergisst.
Zusätzlich zu der starken Regie gibt es einige Besonderheiten, wie sie für Konwitschny typisch sind:
Die Reduktion: Ähnlich wie in „La Traviata“ (2011, Graz/ London/ Nürnberg/ Wien) hat Johannes Leiacker ein total reduziertes Bühnenbild entworfen. Waren es damals nur Vorhänge und Stühle, befinden sich nun lediglich ein Bett, ein Tisch und ein paar Stühle auf der leicht ansteigenden Bühne. Die Gestaltung des Bühnenbodens spiegelt den Lauf der Jahreszeiten: Im ersten Akt ist er mit Gras bedeckt, im zweiten mit Schnee und im dritten Akt mit Krokusblüten. Das ist sehr atmosphärisch.
Musiker auf der Bühne: Konwitschny lässt seine Darsteller gerne mit Musikern interagieren. So war es im „Freischütz“ (1983, Altenburg/Hamburg) oder im Titus (2005, Hamburg/Tokio/Oslo), so ist es auch in der „Jenufa“. Wenn die Titeldarstellerin im zweiten Akt von Ängsten gepeinigt wird und die Konzertmeisterin im schwarzen Kleid auf der Bühne erscheint und mit einem großen Solo Trost spendet, ist das ein sehr schöner Moment.
Heraustreten aus der Handlung: In seinem Münchener „Tristan und Isolde“ (1998) erfindet Konwitschny ein Happy-End für die Titelfiguren, in dem er die Isolde ihren Schlussgesang in Tristans Armen singen lässt. In der „Jenufa“ hinterfragt er nun das Happy End mit dem gleichen Mittel. Nachdem die Küsterin verhaftet wird, fällt der Vorhang langsam und erst nach einer langen Fermate setzt die Schlussszene von Jenufa und Laca an, die hier vor dem Vorhang gespielt wird: In der Realität des Stückes endet das Stück offen, das glückliche Ende ist nur eine Utopie.
Gesungen wird in Augsburg auf weitgehend hohen Niveau: Kerstin Descher ist zwar als indisponiert angekündigt, singt aber eine dramatisch-intensive Küsterin. Sally du Randt ist eine anrührende Jenufa, die auch die nötige Dramatik für diese Partie in der Stimme hat. Mathias Schulz als Laca klingt in der Höhe zu eng und kann nicht immer überzeugen, während Ji-Woon Kim ein kerniger Stewa ist. Überzeugende Rollenporträts gestalten Elisabeth Hornung als alte Burya und Dong-Hwan Lee als Altgesell. Großartig ist Christoph Stephinger, der als Gast von der Bayerischen Staatsoper den Dorfrichter singt.
Die Augsburger Philharmoniker lassen unter der Leitung von Lancelot Fuhry viele Momente überraschend leicht und durchsichtig klingen. Wo notwendig lässt Fuhry auch kantig, dramatisch und düster aufspielen. Die Sänger führt er gut und auch die Balance zwischen Graben und Bühne gelingt vorzüglich.
Das Augsburger Theater ist bei der fünften Aufführung dieser Produktion zwar nur mittelmäßig besucht, das Publikum ist aber aus dem Häuschen und spendet geradezu frenetischen Beifall.
Rudolf Hermes 9.10.14 Bilder siehe unten
Gemäßigter Konwitschny
JENUFA
Premiere: 20. 9. 2014
Auf das Wesentliche reduziertes psychologisches Kammerspiel
Eine Co-Produktion mit der Oper Graz, wo am 29. 3. 2014 Premiere war, stellt die Neuinszenierung von Janaceks „Jenufa“ am Theater Augsburg dar. Um es vorwegzunehmen: In szenischer Hinsicht war es ein in jeder Hinsicht gelungener Abend. Das ist indes kein Wunder, denn am Regiepult hatte kein Geringerer als Peter Konwitschny Platz genommen. Dass es dem kleinen Theater Augsburg gelungen ist, diesen hochkarätigen Regisseur, der sonst an den größten Opernmetropolen seine herausragenden Deutungen präsentiert, in die Fugger-und Brecht- Stadt zu locken, ist erstaunlich. Offenbar ist der neue Geschäftsführende Leiter des Musiktheaters Georg Heckel, der aus Darmstadt nach Augsburg gewechselt ist, darauf bedacht, seinem neuen Haus, das bisher eher konventionell geprägt war, einen modernen Anstrich zu geben, was sehr zu begrüßen ist. So hat er für diese Saison neben Konwitschny beispielsweise mit Lorenzo Fioroni noch einen weiteren erstklassigen Vertreter zeitgenössischer Regiekunst gewinnen können. Auf den weiteren szenischen Kurs des Augsburger Theaters in den folgenden Jahren kann man schon gespannt sein.

Elisabeth Hornung (Alte Buryja), Kerstin Descher (Küsterin), Sally du Randt (Jenufa)
Wie immer ist Konwitschny voll in seinem Element. Indes wartet man auf die von ihm gewohnten radikalen Verfremdungen und sonstigen Provokationen dieses Mal vergeblich. Er aktualisiert nichts, sondern siedelt die Handlung zusammen mit seinem Bühnen- und Kostümbildner Johannes Leiacker in der Entstehungszeit des Werkes an. Die Kleider der Handlungsträger sind jedenfalls dieser Epoche zuzuordnen. Man möchte es fast nicht glauben, aber Konwitschny hat sich eine Mäßigung auferlegt. Er inszeniert das Werk gänzlich ohne irgendwie geartete Verfälschungen, wobei er gekonnt eine Reduktion auf das Wesentliche vornimmt. Ein Tisch, mehrere Stühle und ein Bett genügen ihm. An, in und um diese Stätten der Begegnung herum spielt sich das gesamte Geschehen ab. Die Enge dörflicher Begrenzt- und Beschränktheit weicht bei Konwitschny einer einnehmenden Weite, die von Akt zu Akt anders gestaltet ist. Den ersten Aufzug siedelt er auf einer Wiese an, den zweiten auf einem Schneeboden. Das Frühlingserwachen im dritten Akt schließlich wird durch zahlreiche gelbe Krokusse versinnbildlicht. Dieses Verfahren Konwitschnys kennt man schon. Bei seiner Interpretation von Verdis „La Traviata“, die in Graz, Nürnberg und Wien zu sehen war, ging er in puncto Ausstattung sogar noch knapper vor.

Ji-Woon Kim (Steva), Kerstin Descher (Küsterin)
Auch bei der „Jenufa“ bewährt sich diese Vorgehensweise. Kein überflüssiger Pomp lenkt von den zwischenmenschlichen Beziehungen ab, die vom Regisseur mit ungeheurer Stringenz herausgearbeitet werden. In Sachen ausgefeilter spannender Personenführung ist Kontwitschny schon immer ein Meister seines Fachs gewesen. Er formt die verschiedenen Charaktere mit ungeheurer Brillanz stark und eindringlich. Um die Hauptcharaktereigenschaften der beteiligten Personen herauszustellen, benötigt er nicht einmal viel Zeit. So wird einem gleich im ersten Bild klar, dass es sich bei Laca um einen recht aggressiven Typ handelt, der reichlich grimmig mit seinem Messer einen Stock nicht eben sanft bearbeitet. Seine guten Seiten werden später aber ebenso überzeugend vorgeführt. Ebenso weiß man auch beim erstmaligen Auftritt der mit einem hochgeschossenen schwarzen Kleid auftretenden, streng puritanisch wirkenden Küsterin gleich, dass man es hier mit einer Person zu tun hat, deren hartes, strenges Wesen von der Lieblosigkeit ihres verstorbenen Mannes und den von ihr ersehnten, von ihm aber verweigerten Streicheleinheiten herrührt. Sie ist eindeutig die stärkste Figur des Stückes. Da kann Jenufa mit ihrem schlichten, verhaltenen Wesen nicht ganz mithalten, auch wenn sie im Laufe des Abends durch ihre Entwicklung zu einer großen Verzeihenden noch stark an Konturen gewinnt. Etwas angeheitert wird der dramatische Kontext im dritten Aufzug durch die komische Elemente einbringende Frau des Richters.

Sally du Randt (Jenufa), Kerstin Descher (Küsterin)
Bei Konwitschny gerät Janaceks Oper zu einem dramatischen psychologischen Kammerspiel, das ganz auf die Handlungsträger zugeschnitten ist. Das Damoklesschwert gesellschaftlicher Ächtung schwebt indes über sämtlichen Beteiligten. Es ist die Furcht, die alle beherrscht, die Küsterin, aber insbesondere auch die alte Buryja, die die von ihr verinnerlichten Werte einer aus dem Katholizismus herrührenden fragwürdigen Doppelmoral an ihre Nachfahren weitergegeben hat und deren Übertretung sie nicht duldet. Sie erscheint als Vertreterin einer bigotten Gemeinschaft, die in traditionellen Verhaltensmustern erstarrt und unfähig zur Weiterentwicklung ist. Auch Mitgefühl scheint hier keinen Platz zu haben. Wenn Jenufa am Ende des ersten Aktes verwundet am Boden liegt, ist keiner der Umstehenden bereit, ihr zu Hilfe zu kommen - ein starkes Bild. Hier haben wir es augenscheinlich mit einem Generationenproblem zu tun.

Ensemble, Chor
Nicht die Titelfigur ist es aber, die unter den Verhältnissen am meisten zu leiden hat, sondern die Küsterin, deren Lebensfundament zusammenbricht. Konwitschny zeichnet sie sehr eindringlich: furchteinflößend, aber auch menschlich. Sie sehnt sich danach, aus den vorgegebenen Verhaltensmustern ausbrechen zu können. Für ihr Enkelkind, dem sie die Flasche gibt, scheint sie Gefühle zu entwickeln - genau wie Steva, der, seinen Sohn im Arm haltend, emotional sehr betroffen ist und schließlich sogar zu weinen beginnt. Wenn sich die Küsterin am Ende des zweiten Aktes schließlich verzweifelt das Kleid vom Leib reißt und bei einsetzendem Schneetreiben auf dem Tisch zusammenbricht, ist das einer der stärksten Momente der Produktion. Konwitschny hat schon immer gewusst, wie er das Publikum fesseln kann. Das wird auch bei Jenufas Arie im zweiten Akt deutlich, in der er die Geigerin Jehye Lee auf der Bühne erscheinen und in ein eindringliches Wechselspiel zu der Protagonistin treten lässt. Während ihres Violinsolos, das sie mit wunderbar gefühlvollem, innigem Ausdruck spielt, wird sie für Jenufa zu einer warmherzigen Trösterin, die sich ihrer annimmt und ein offenes Ohr für ihre Sehnsüchte und Nöte hat. Diese Szene erinnert stark an den dritten Aufzug von Konwitschnys Münchner „Tristan“-Inszenierung, wo der sterbende Held während seines Deliriums Besuch von zwei Musikern beiderlei Geschlechts aus dem Orchestergraben erhält, die sich schließlich als seine Eltern entpuppen. Es gehört nicht viel dazu, in der sich liebevoll um Jenufa kümmernde Geigenspielerin ihre verstorbene Mutter zu erkennen, die die Gefilde des Jenseits verlässt, um ihrer verzweifelten Tochter beizustehen - ein ungemein stimmiger und tief berührender Einfall, der Konwitschny alle Ehre macht. Das war der Höhepunkt des Abends, der mit einer für den Regisseur typischen Überraschung endete. Nachdem die Küsterin abgeführt wurde, sinkt auf einmal der Vorhang. Hier ist das Stück für Konwitschny zu Ende. Das abschließende Duett des durch einen schmalen Spalt des Vorhangs noch einmal hervortretenden Liebespaares deutet er als Epilog, den er mit einem Fragezeichen versieht. Während Jenufa hoffnungsvoll einer gemeinsamen Zukunft entgegenblickt, bleibt Laca skeptisch. Sein fragender Gesichtsausdruck belegt, dass er an eine Besserung der Verhältnisse nichts so recht glaubt. Ob die Gesellschaft aus dem Geschehen etwas gelernt hat, bleibt offen. Da die Krokusse jetzt symbolhaft zertreten sind, ist das eher nicht anzunehmen.

Ensemble, Chor
Gespielt wird in Augsburg die Brünner Originalfassung von 1908. Das war eine gute Entscheidung, denn die der Spätromantik verhafteten Glättungen, die der Prager Dirigent Karel Kovarovic an der Partitur vornahm, haben diese nicht unerheblich verfälscht. Gegenüber der das Schwelgerische der Musik betonenden Bearbeitung wirkt das Original ungleich härter. Konsequenterweise setzt auch Dirk Kaftan am Pult zusammen mit den gut disponierten Augsburger Philharmonikern vorwiegend auf einen markanten, schroffen Klang, den er mit ausgeprägten Spannungsbögen und einer Vielfalt an spezifischen Coleurs anreichert. Dabei geht er sehr differenziert und nuancenreich ans Werk und schenkt auch untergeordneten Stimmen mehr Aufmerksamkeit, als es andere Pultmeister bei dieser Oper zu tun pflegen.
Gesanglich konnte man insgesamt zufrieden sein. Sally du Randt hat die Entwicklung der Jenufa darstellerisch glaubhaft aufgezeigt und sowohl das Naive als auch das Erschütternde ihrer Rolle gleichermaßen intensiv ausgespielt. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem gut sitzenden, emotional und höhensicher geführten jugendlich-dramatischen Sopran zu überzeugen. Zumindest in schauspielerischer Hinsicht übertroffen wurde sie von Kerstin Descher, die die expressiven Ausbrüche der Küsterin mit einer ungeheuren Intensität und großer darstellerischer Kraft bewältigte. Stimmlich hat sie mit ihrem ansprechenden, ausdrucksstarken und expansionsfähigen Mezzosopran den Anforderungen der Rolle ebenfalls voll entsprochen. Schönes, weiches und dunkel gefärbtes Tenormaterial brachte Mathias Schulz für den Laca mit. Als Steva war Ju-Woon Kim manchmal kaum zu hören, was sich wohl seiner nicht allzu großen, meistens flach geführten Stimme verdankt. Bei seinem Ausbruch gegenüber der von Cathrin Lange mit schönem appoggiare la voce kraftvoll gesungenen Karolka im dritten Akt gelang ihm indes auch mal eine schön im Körper gestützte Phrase. Elisabeth Hornung hatte als alte Buryja ihre besten Zeiten hinter sich. Nur einen Hauch von dünner Stimme wies der Jano Samantha Gauls auf. Solide sang Stephen Owen den Altgesell. An Sonorität seines Basses war ihm Daniel Henriks in der kleinen Partie des Richters überlegen. Aus seiner Frau machte Stephanie Hampl mit köstlichem Spiel und angenehmem Mezzosopran ein echtes Kabinettstückchen. Tadellos entledigten sich Jutta Lehner (Schäferin) und Andrea Berlet (Barena) ihrer nicht sehr umfangreichen Aufgaben. Susanne Simenec (Tante/Erste Stimme) und André Wölkner (Zweite Stimme) rundeten das Ensemble ab. Ordentlich schnitt der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Chor und Extrachor ab.
Fazit: Nicht nur für Konwitschny-Fans eine empfehlenswerte Aufführung. Die Fahrt nach Augsburg lohnt sich.
Ludwig Steinbach, 22. 9. 2014 Die Bilder stammen von A. T. Schaefer
Revolution und Theater
LOHENGRIN
Premiere: 3. 5. 2014
Vergänglichkeit von Utopien
Einen verspäteten Beitrag zum vergangenen Wagner-Jahr stellt die Neuproduktion des „Lohengrin“ am Theater Augsburg dar. Wohl bewusst hatte die Theaterleitung den 3. 5. für die Premiere ausgewählt. Nicht nur, dass Wagner in diesem Monat Geburtstag hat, speziell der 3. Mai hatte für ihn im Jahre 1864 eine schicksalhafte Bedeutung: An diesem Tag erreichte ihn in Stuttgart die Berufung von Ludwig II nach München, die ihn aus höchster materieller Not errettete. Der bayerische König stellte ihn fest an und bezahlte zudem alle seine Schulden. Von jetzt auf gleich aller finanzieller Sorgen ledig, sollte Wagner sich nur noch seiner Kunst widmen. Und der „Lohengrin“ war die Lieblingsoper Ludwigs. Gerade dieses Werk an exakt diesem Datum neu herauszubringen, ist eine würdige Begehung dieses Gedenktages.

Chor
Die Regie lag in den Händen von Thorleifur Örn Arnarsson, dessen gelungene „Bohème“-Inszenierung in Augsburg man noch in bester Erinnerung hat. Auch hier wartet er mit einer gut durchdachten, in sich stimmigen und überzeugenden Regiearbeit auf, wobei er gekonnt mehrere Stile mischt. Ausgangspunkt sind für ihn die Entstehungszeit des Werkes und die Biographie des Bayreuther Meisters Ende der 1840er Jahre. Wagner hatte sich damals am Dresdener Maiaufstand - eine weitere zeitliche Parallele zum gewählten Premierendatum - beteiligt und sich auf die Barrikaden begeben - ein Unterfangen, das ihn ins Exil zwang und an der Uraufführung des „Lohengrin“ in Weimar nicht teilnehmen ließ. Der Komponist war Zeit seines Lebens ein Revolutionär und hat aus dieser Gesinnung eigentlich auch nie ein Geheimnis gemacht. Und genau an dieser Mentalität Wagners und ihrer Bedeutung für seine Kunst setzt der Regisseur an.

Gerhard Siegel (Lohengrin), Sally du Randt (Elsa), Jaco Venter (Telramund)
Wenn sich der Vorhang bereits während des Vorspiels öffnet, fällt der Blick auf einen von Jósef Halldórsson entworfenen, marode und heruntergekommen Theaterraum, der augenscheinlich schon bessere Tage gesehen hat. Von der alten Pracht zeugt nur noch ein vom Schnürboden herabhängender Kronleuchter. Die Revolution hat deutliche Spuren hinterlassen, auch bei dem von Filippia Elisdóttir mit Kostümen aus dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart ausgestatteten Bühnenpublikum, das geisterhaft geschminkt und wie zu Salzsäulen erstarrt auf seinen Stühlen verharrt. Es scheint von nichts mehr Notiz zu nehmen, auch nicht von der von Anfang an aus ihrem Kreis ausgestoßenen Elsa und von Gottfried, die durch die Reihen wandeln und festzustellen versuchen, ob noch Leben in der Schar von Zombies ist. Diese Menschen sind nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich erstarrt. Sie haben den Halt und alle Hoffnung verloren. Sie glauben an nichts mehr und sehnen eine neue Kunst- und Gesellschaftsordnung herbei, gleichsam die Wiedergeburt der bereits von Wagner nachhaltig beschworenen Volksgenossenschaft. Mit dem Meister erhoffen sie sich ein durch Kunst erfüllten Leben und eine Reform des Theaterbetriebs, die indes nur durch eine neue Revolution erfolgen kann.

Sally du Randt (Elsa), Gerhard Siegel (Lohengrin)
Diese ist hier geistiger Natur und resultiert ganz aus dem Wunsch des Kollektivs nach etwas Neuem. Ohne neue Impulse, ohne etwas, was ihr wieder Auftrieb gibt, ist die Gemeinschaft zum Untergang verdammt. Sich dessen vollauf bewusst, hinterfragt sie ihre alten Werte und gebiert aus sich selbst heraus eine neue Kunstfigur, die den Namen Lohengrin trägt und dem Volk den Weg aus der Misere zeigen soll. Der Gralsritter erscheint als Ausdruck eine Heilssehnsucht, die die Brabanter beherrscht. Zunächst schwören sie ihm begeistert Gefolgschaft, nur um ihn später gnadenlos wieder fallen zu lassen. Die Situation ist vergleichbar mit der eines Film- oder Medienstars, der aufs Abstellgleis geschoben wird, sobald er seine Attraktivität verloren hat und deshalb für die Menschen nicht mehr interessant ist.

Sally du Randt (Elsa)
Das ist ein Punkt von zeitloser Relevanz. Dementsprechend nimmt auch das Bühnenbild ab dem zweiten Aufzug einen abstrakten Charakter an. Die in einzelne verschiebbare Segmente aufgeteilte weiße Wand symbolisiert eine letztlich nicht zu verwirklichende politische Utopie, die Lohengrin verkörpert. Dabei ist das große Verlangen der Gesellschaft nach einer neuen Führungsperson nicht an ein bestimmtes Individuum gebunden. Lohengrin ist austauschbar, nicht subjektgebunden. Entscheidend ist der frische Wind, den der von der Regie bewusst nicht gerade als Strahlemann und etwas ältlich gezeichnete Titelheld mit sich bringt und das Kollektiv anregt, sich mit den neuen Aspekten auseinanderzusetzen und auf diese Weise weiterzuentwickeln. Damit verbunden ist aber ein kritischer Blick auf den Titelhelden, der einigen Personen mehr zu eigen ist als anderen. Viele Brabanter sind aufgeklärter als die anderen und tragen dementsprechend sichtbar modernere Kleider als ihre Mitbürger. Die zuerst im weißen Unterkleid auftretende Elsa bekommt von Lohengrin später ein helles Kleid mit prächtigen Schwanenfedern und wird dergestalt rein äußerlich an ihn gebunden. Schließlich geht aber auch ihr die Erkenntnis auf, dass ihr Held durchaus zu hinterfragen ist. Indem sie schließlich im Brautgemach die verbotene Frage doch stellt und sich dabei das Kleid vom Leib reißt und ihm vor die Füße wirft, zerstört sie die von ihm verkörperte Utopie. Dass sie es ist, die gleich im Anschluss den hier durchaus nicht angrifflustigen Telramund mit einer simplen Schwanenfeder ersticht, ist ein Überraschungseffekt der besonderen Art. Indes scheint sie dem Grafen nicht immer feindlich gegenübergestanden zu haben. Jedenfalls sitzt sie den größten Teil des letzten Bildes trauernd an seiner Leiche. Das lässt auf eine durchaus positive Beziehung zwischen den beiden in früherer Zeit schließen. Mit dem Abgang Lohengrins kann eine neue Utopie beginnen. Wenn am Ende dann ein doppelter Gottfried erscheint, belegt das das Vorhandensein von gleich zwei utopischen Zukunftsmöglichkeiten, zwischen denen das Volk wählen kann. Die Brabanter glauben aber nicht mehr an Utopien und verlasen die Bühne. Elsas als kleiner konventioneller Lohengrin vorgeführter Bruder bleibt einsam zurück - ein sehr pessimistisches Ende. Die Quintessenz des Ganzen besteht in der Aufzeigung der Zeitlosigkeit von immer neuen politischen Utopien und deren Verwerfungen.

Gerhard Siegel (Lohengrin), Sally du Randt (Elsa), Jaco Venter (Telramund), Kerstin Descher (Ortrud)
Gesanglich hinterließ die Premiere gemischte Gefühle. Obwohl er manchmal etwas zum Forcieren neigte, sang Gerhard Siegel den Lohengrin insgesamt viel besser im Körper als man es bisher von ihm gewohnt war. Bei seinem gleichermaßen kraftvollen und auch emotional eingefärbten Vortrag konnte größtenteils wirklich von Glanz und Wonne die Rede sein. Ebenfalls eine gute Leistung erbrachte Sally du Randt, die sich mit großer darstellerischer Energie in die Rolle der Elsa stürzte. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem gut gestützten, durch alle Lagen ausgeglichen geführten und eine schöne Pianokultur aufweisenden Sopran für sich einzunehmen. Als Telramund gefiel mit markantem, intensiv eingesetztem und eine hohe Ausdrucksintensität aufweisendem Heldenbariton Jaco Venter vom Badischen Staatstheater Karlsruhe. Die beste Leistung des Abends erbrachte Dong-Hwan Lee, der einen wunderbar italienisch focussierten, frischen und sonoren Bariton von edelster Klangqualität für den Heerrufer mitbrachte. Kerstin Descher sang die Ortrud in Mittellage und Tiefe solide. Indes weist ihre Stimme zur Höhe hin einen Registerbruch auf. Im oberen Bereich ging sie durchweg vom Körper weg und verlegte sich auf eine nicht gerade gefällige, sehr kopfige Tongebung. Mit dem König Heinrich, der für ihn viel zu hoch lag, kam Vladislav Solodyagin mehr schlecht als recht zurecht. In der oberen Lage wirkte sein Bass reichlich halsig und klangarm. Obendrein neigte er in diesem Bereich zum Distonieren. Diesen Sänger hat man schon besser gehört. Ziemlich dünnstimmig klangen auch die vier brabantischen Edlen von Eckehard Gerboth, Gabor Molnar, André Wölkner und Alexander Yagudin. In der kleinen stummen Partie des Herzogs Gottfried waren David Mayr und Gregor Richter zu erleben. Den trefflich singenden Chor hatte Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudiert.
Eine beeindruckende Leistung erbrachte Dirk Kaftan am Pult. Er hat die beiden entgegengesetzten Welten hervorragend voneinander abgegrenzt. Herrlich bereits zu Beginn die flirrenden Violinen. Noch beeindruckender gelangen dem Dirigenten indes die düsteren Stimmungen in der Szene zwischen Ortrud und Telramund im zweiten Aufzug. Er setzte vornehmlich auf zügige Tempi und auf eine klare Abgrenzung der Konturen. Die eine oder andere Generalpause geriet ihm aber etwas zu lang. Die meisten Instrumentengruppen der Augsburger Philharmoniker waren in blendender Form. Lediglich die Holzbläser ließen zeitweilig intonationsmäßig zu wünschen übrig.
Ludwig Steinbach, 6. 5. 2014 Die Bilder stammen von A. T. Schaefer.
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Besuchte Aufführung: 19. 4. 2014 (Premiere: 15. 3. 2014)
Frauenemanzipation in einer dekadenten Familie
Sie ist nicht gerade ein Publikumsmagnet, aber eines der eindrucksvollsten Erzeugnisse des Musiktheater-Repertoires: Claude Debussys auf einem Drama des belgischen Literaturnobelpreisträgers Maurice Maeterlinck beruhende Oper „Pelléas et Mélisande“. In den vergangenen Jahren war das Werk u. a. in Frankfurt und Stuttgart zu sehen gewesen. Jetzt hat sich das kleine Theater Augsburg diesem selten gespielten Stück angenommen und konnte damit in jeder Beziehung einen Volltreffer landen. Wieder einmal wurde deutlich, dass gerade an den sog. kleinen Häusern oft die besten Aufführungen stattfinden.

Yona Kim geht es in ihrer gelungenen Inszenierung nicht um vordergründige konventionelle Schauerromantik. Sie deutet das Geschehen ganz aus dem Inneren der Handlungsträger heraus und nimmt deren Handlungen und Befindlichkeiten gekonnt unter die psychoanalytische Lupe. Demgemäß setzt sie nicht auf pure Action, sondern auf die gewissenhafte Herausarbeitung von Seelenzuständen unter Berücksichtigung Freud’scher Erkenntnisse. Dabei geht sie sehr präzise vor. Die Personenregie ist insgesamt ausgefeilt und überzeugend und wird dem innovativen Gehalt des Ganzen voll gerecht. Freuds Analyse des Unterbewussten misst sie bei ihrer Regiearbeit zentrale Relevanz zu. Das ist durchaus stückimmanent und schon von Debussy und Maeterlinck in dieser Form angelegt. Damit entsprachen sie ganz dem Geist des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Immerhin breiteten sich gerade zur Entstehungszeit des 1902 an der Opéra-Comique in Paris aus der Taufe gehobenen „Pelléas“ die bahnbrechenden Lehren des Wiener Psychoanalytikers überall aus. Ist er vielleicht der Arzt, der bereits zu Beginn zu sehen ist? Angesichts des großen Interesses, mit dem seine Theorien überall aufgesogen wurden, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie auch bald den Weg auf die Opernbühne fanden.

Insofern kann man Frau Kims Ansatzpunkt trotz eines modernen, die 1960er Jahre abbildenden Rahmens als ausgesprochen werktreu bezeichnen. Mit ihrer klug durchdachten, tiefschürfenden Interpretation hat sie den Kern des Stoffes messerscharf getroffen. Auf eindringliche Art und Weise zeichnet sie das Bild einer dekadenten, von Saskia Rettig modern eingekleidete Adels-Familie, die nur noch beim gemeinsamen Mahl eine ihrem Stand angemessene Haltung bewahrt, ansonsten aber sehr fragwürdige Züge aufweist. Allemonde ist ein Haus des Todes, das schon bessere Zeiten gesehen hat. Der von Christian Schmidt entworfene Einheitsbühnenraum nach Art des Fin de siècle wirkt heruntergekommen, kalt und schmutzig. An den einstigen Glanz der altehrwürdigen Familienresidenz, die dringend renovierungsbedürftig ist, erinnert nicht mehr viel. Man wartet auf das Ende. Alles atmet Tod und Untergang, was nicht zuletzt durch eine absterbende Zimmerpflanze trefflich versinnbildlicht wird. Die Bewohner sind allesamt treffliche Kandidaten für die Psycho-Couch. Ihr Schicksal ahnend haben sie sich ein entsprechendes Möbelstück auch schon zugelegt. Alle leiden sie unter tiefen psychischen Wunden. Der betagte König Arkel, von der Regie in seiner Altersschwachheit bewusst etwas überzeichnet, kann seiner Führungsposition, debil wie er ist, strenggenommen überhaupt nicht mehr gerecht werden. Er hat die Macht an seinen Enkel Golaud abgegeben, der wohl aufgrund eigener unangenehmer Erfahrungen als Kind im Umgang mit seinem Vater und Großvater Freude daran hat, seinen Sohn aus erster Ehe Yniold psychisch zu drangsalieren. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass er seinen Sprössling auch missbraucht hat. Dieser ist kein gewöhnliches, sondern ein ausgesprochen verhaltensgestörtes Kind. Gewaltsam in die Opferrolle gedrängt, hat der kleine Prinz bereits in jungen Jahren einen ziemlich verschlagenen Charakter entwickelt. Mit einer goldenen Kugel huldigt er seinem Lieblingsmärchen „Der Froschkönig“. Geneviève entspricht ebenfalls nur noch äußerlich einer feinen Lady. Innerlich kann sie den Schein wenig gut aufrechterhalten. Es ist nicht nur die durch Schneetreiben verursachte äußere, sondern auch die verbreitete innere Kälte unter den Angehörigen der Allemonde-Dynastie, die sie stark frösteln lässt. Die zwischenmenschlichen Beziehungen haben stark gelitten und sind nur noch rudimentär vorhanden.

Es ist schon eine ausgeprägte Familienhölle, die die Regisseurin dem Zuschauer hier nachhaltig vor Augen führt. Das einzige Clanmitglied, das es in diesem Inferno nicht mehr aushält, ist der reichlich infantil und ängstlich wirkende Pelléas, der mit Rucksack und in Reisekleidung ständig auf Flucht bedacht ist. Er ist genauso ein Außenseiter wie das Zigaretten rauchende Partygirl Mélisande, die ihre zu Beginn noch recht legere Kleidung samt Sonnenbrille zwar rasch mit einem ihrer neuen Stellung als Golauds Frau eher entsprechenden schicken Outfit vertauscht und auch mal eine braune Perücke über ihr blondes Haar streift, sich in ihre neue Lebenswelt aber in keinster Weise einfinden kann. Diese Messaliance kann nicht gut gehen. Das wird zunehmend auch Golaud bewusst, dem es nicht gelingt, seine Frau innerlich an sich zu binden und seine Zuflucht deshalb in Gewalttätigkeiten sucht. Neben solchen Freud’schen Ersatzhandlungen ist er zunehmend auch auf äußere Bindungszeichen fixiert, wie beispielsweise den dramaturgisch wichtigen Ehering. Er ist ein Musterbeispiel seines Standes.

Die femme fragile Mélisande passt nicht in das System. Sie ist und bleibt eine Außenstehende. Und genau dieser Aspekt ist es, der sie sich schließlich ihrem Schwager und Leidensgenossen Pelléas zuwenden lässt. Sie weiß, was sie will, und hat nicht die Absicht, sich dem familiären Joch unterzuordnen. Dem sie einengenden gesellschaftlichen Zwang begegnet Mélisande mit trotziger, unablässiger Selbstbehauptung. Sie will sich partout nicht in die familiäre Zwangsjacke stecken lassen und geht nachhaltig auf Konfrontationskurs. Als Sinnbild ihres Widerstandes fungiert das blaue Kleid, das sie bis zuletzt trägt. Hier bringt Yona Kim auf treffliche Art und Weise die Emanzipation der Frau mit ins Spiel, die ja ebenfalls um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ihren Anfang nahm - noch ein Regieaspekt, der ganz aus der Zeit Debussys heraus begründet ist und großen Sinn macht, auch wenn die Königsfamilie dieses aufmüpfige Verhalten Mélisandes natürlich alles andere als positiv beurteilt. Da prallen oftmals Perspektiven, die sich nicht miteinander vereinbaren lasen, mit großer Rasanz aufeinander. Es sind aber gerade die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung, aus denen die Inszenierung rein visuell ihren großen Reiz zieht. Immer wieder verschmelzen Wirklichkeit und Traum miteinander. Wenn sich der Raum immer wieder nach hinten hin öffnet und erweitert, tut sich eine zweite, den Köpfen der beteiligten Personen entspringende surreale Handlungsebene auf, die das genaue Gegenteil der Realität ist. In diesem neu entstandenen Psychoraum offenbaren sich in oft von Doubles ausgeführten Parallelhandlungen die geheimsten Wünsche und Sehnsüchte der Protagonisten. Teilweise mimen aber auch die Sänger mehrere Gestalten. So gibt es beispielsweise eine innere, echoartig aus dem Off ertönende Stimme Mèlisandes, die sich aber auch durch den Mund von Yniold artikuliert. Desweiteren träumt sich Arkel einmal in die kleine Rolle des Schäfers. Die verschlungenen seelischen Irrwege werden durch diese Vorgehensweise der Regisseurin gut versinnbildlicht. Die Sehnsucht der Liebenden nach einem anderen, besseren Leben, wird offenkundig. Der Weg dahin wird aber nicht gewiesen. Dem entspricht es, dass Frau Kim der hier an den Tag gelegten Gratwanderung zwischen Traum und Wachen ganz im Einklang mit den Intentionen Debussys ihren symbolhaften Charakter belässt. Insgesamt geht es bei ihr wenig eindeutig zu. Vielmehr kommt es ihr auf die Eröffnung weiter Assoziationsfelder an, die dem Zuschauer Raum für eine eigene Auslegung des Gesehenen lassen. Dieses Konzept ist voll aufgegangen und stellt einen wesentlichen Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des Werkes dar.

Gesanglich bewegte sich die Aufführung auf hohem Niveau. Erneut wurde offenkundig, über was für ein erstklassiges Sängerensemble das Theater Augsburg doch verfügt. Das begann schon bei Cathrin Lange, die sich als in jeder Beziehung ideale Mélisande erwies. Bereits darstellerisch durch ihr intensives Spiel sehr ansprechend, war es aber in erster Linie ihr makelloser, hervorragend italienisch fundierter und in jeder Lage einfühlsam und geschmeidig geführter Sopran, mit dem sie sich nachhaltig in die Herzen des Publikums sang, dass dann auch mit Applaus nicht geizte. Neben ihr vermochte insbesondere Dong-Hwan Lee zu begeistern, der den Golaud nicht nur ausdrucksstark spielte, sondern mit einem ausgesprochen sonoren, voll und rund klingenden, ebenfalls bestens italienisch gestützten Stimmklang auch vokal ein glaubhaftes Profil verlieh. Das hohe Niveau dieser beiden erreichte Giulio Alvise Caselli als Pelléas nicht ganz. Zwar sang er solide im Körper und erreichte auch die bis zum hohen ‚a’ reichenden Spitzentöne. Im Augenblick fehlt es seinem lyrischen Bariton aber noch etwas an vokaler Durchschlagskraft und Intensität. Das wird aber schon noch kommen. Einen profunden Bass, der nur in der Höhe etwas gewichtiger hätte klingen können, brachte Vladislav Solodyagin für den Arkel und den Hirten mit. Mit ausgeglichenem, sonorem Mezzosopran gestaltete Jennifer Arnold die Geneviève. Nicht ganz glücklich war ich über die Idee der Theaterleitung, den Yniold mit einer Kinderstimme zu besetzen. Der junge Nicolas Schwandner schlug sich zwar recht wacker, klang aber ziemlich dünn. Die Teile seiner Partie, die regiebedingt der Sängerin Stephanie Hampl anvertraut waren, die auch die 2. Melisande sang, machten aufgrund deren tiefgründigen Soprantöne erheblich mehr Eindruck. Solide war der Arzt von Stephen Owen. Vorzüglich schnitt der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek gewissenhaft einstudierte Chor ab.

Vollauf zufrieden sein konnte man auch mit der Leistung von Roland Techet am Pult. Er präsentierte zusammen mit den bestens disponierten Augsburger Philharmonikern Debussys Musik in all ihrer Bandbreite und Vielschichtigkeit mit ausgeprägter Raffinesse und kammermusikalischem Feinschliff. Es gelang ihm vortrefflich, die Konturen von Debussys Klangkosmos differenziert und farbenreich aufzufächern und dem Ganzen eine schöne Transparenz zu geben, was dem Gesamtcharakter des Werkes sehr entgegenkam. Im Laufe des Abends gewann sein Dirigat zunehmend an Spannung und wies zudem markante Akzente auf.
Fazit: Eine in jeder Beziehung hochkarätige Aufführung, die als Aushängeschild für das Theater Augsburg dienen kann und deren Besuch jedem Opernfreund sehr ans Herz gelegt wird.
Ludwig Steinbach, 23. 4. 2014 Die Bilder stammen von A. T. Schaefer.
Brillante Inszenierung
LA BOHÈME
Vorstellung vom 8. 1. 2014 (Premiere: 19. 1. 2013)
Schimäre für ein verschenktes Leben
Um es vorwegzunehmen: Diese Produktion von Puccinis „La Bohème“ stellt einen absoluten Glanzpunkt im Repertoire des Theaters Augsburg dar. Der Besuch der Aufführung ist jedem Opernfreund dringendst zu empfehlen! Regie, gesangliche und musikalische Leistungen vereinten sich an diesem gelungenen Abend zu einer glanzvollen Symbiose, die geeignet war, Begeisterung hervorzurufen. Wieder einmal hat sich mein Wahlspruch „Verachtet mit die kleinen Häuser nicht“ voll und ganz bestätigt.

Rodolfo, Mimi
Ein Volltreffer war bereits die Inszenierung, mit der das eher konventionell ausgerichtete Theater Augsburg in die Sphären von modernem, spannendem Musiktheater vordrang - ein szenischer Kurs, der auch für die Zukunft sehr wünschenswert wäre. Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, dessen geniale, ungewöhnliche „Fledermaus“ in der letzten Spielzeit die Augsburger Gemüter ganz schön erhitzt hatte, hat das Stück hervorragend durchdacht und mit seiner auch technisch versierten Umsetzung den neugierigen Intellekt voll und ganz befriedigt. Weit entfernt von jeder traditionellen, oberflächlichen Süßlichkeit und kitschiger Herzschmerzromantik rückt er das Ganze gekonnt auf eine überzeugende geistig-innovative Ebene. Es sind ihn erster Linie die psychologischen und sozialkritischen Aspekte der Handlung, die ihn interessieren und die er in Zusammenarbeit mit Jósef Halldórsson (Bühnenbild) und Filippia Elísdóttir (Kostüme) einer tiefschürfenden Beleuchtung unterzieht. Es ist ein gelungener Spagat zwischen innerer und äußerer Handlung, die Arnarsson hier vorführt, wobei er das Geschehen immer mehr ins Surreale abdriften lässt. Zunehmend verschmelzen Realität und Imagination miteinander. Grotesk anmutenden Elementen, die im Gesamtgefüge der Inszenierung durchaus logisch platziert sind, wird Tür und Tor geöffnet. Dabei ist der Regisseur nicht auf Provokation bedacht, sondern auf eine Interpretation von innen heraus. Ihm ist das Kunststück gelungen, das Werk zu modernisieren und seine Aussage dabei auf eindringliche Art und Weise zu intensivieren. Das Ergebnis ist sehr stimmiger Natur.

Cathrin Lange (Musetta), Chor
Arnarsson setzt bei seiner Interpretation in der Entstehungszeit der Oper an und deutet das Ganze aus dem allgemeinen Lebensgefühl des damaligen Künstler-Proletariats heraus, das die Lehren seines Götzen Karl Marx begierig aufgesaugt hat und auf die karitativen Wohltätigkeitsprogramme eines Steve Jobs wartet. Diese beiden Namen stehen für das Überzeitliche einer Mentalität, die damals wie heute dekadente Züge aufweist und deren vordergründiger Frohsinn nur Fassade ist. Die Welt hat sich den Bohèmiens verschlossen. Gefangen in ihrer öden kargen Mansarde leben sie als Außenseiter. Von der Öffentlichkeit abgegrenzt, suchen sie Wege, ihrem inneren Kerker zu entfliehen. Der hier zum bildenden Künstler umgedeutete Marcello kreiert in einer Vitrine die Puppe Mimi, die der Dichter Rodolfo mit seiner Liebe zum Leben erweckt. Hier nimmt die Inszenierung mythische Züge an. Pygmalion lässt grüssen. Mimi erscheint im weißen Brautkleid als lebendig gewordenes Sehnsuchtsbild der männlichen Phantasie, als Schimäre eines nicht wirklich gelebten Lebens der männlichen Mansardenbewohner, das Ausfluss einer inneren Abwehrhaltung gegen die Verhältnisse ihrer Zeit ist.

Cathrin Lange (Musetta), Marcello, Mimi, Rodolfo, Vladislav Solodyagin (Colline), Giulio Alvise Caselli (Schaunard)
Nachdrücklich prangert Arnarsson die Missstände einer Ära an, die nur auf oberflächliches Vergnügen bedacht war und in der Kunstschaffende wie die Bohèmiens vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen waren. Einem tiefen künstlerischen Bedürfnis der Beteiligten korrespondiert ein Rummelplatz, der zum Vorschein kommt, wenn sich die Bühne dreht. Er wird auf allen Seiten von einem stählernen Gerüst begrenzt, auf dem die Protagonisten wie in einem Amphitheater sogar noch die intimsten Momente ihrer Mitspieler neugierig beobachten. Eine Privatsphäre gibt es in diesem Ambiente nicht. Hier schaffen sich die Handlungsträger ihre eigene Welt mit einer bunt gemischten Gesellschaft aus Intellektuellen, Bücherwürmern, Chordirigenten, Weihnachtsmännern und Transvestiten. Aber auch dieser Ort ist nicht realer Natur, sondern lediglich schöner Schein. Er existiert nur in den Köpfen der Bohèmiens, die strenggenommen aus ihrer Mansarde niemals herauskommen und somit das Leben verpassen, vielleicht sich diesem sogar bewusst verweigern. Es erscheint in allen seinen Ausprägungen allegorisch überhöht in acht jungen Frauen, die zu Beginn den im Rollstuhl sitzenden Rotweinliebhaber Benoit begleiten und sich später in etwas anderer Aufmachung auch auf dem Rummelplatz einfinden. Die von den Freunden gepflegte Negation eines erfüllten Daseins wirkt sich negativ auf die Liebe von Mimi und Rodolfo aus. Während er unfähig ist, den desolaten Umständen beherzt Paroli zu bieten, geht sie voll im Leben auf und verselbständigt sich immer mehr. Aus der Puppe wird ein Mensch. Indem sie ihre ursprüngliche Rolle ablegt, wird sie für die anderen unnütz. Marcello beginnt im vierten Bild eine neue Puppe zu bauen und Rodolfo nötigt Mimi zu guter Letzt in die Vitrine zurück. Im Gegensatz zu allen anderen ist sie aber die einzige, die wirklich gelebt hat. Demgemäß darf sie dann auch auf dem Karussell des Rummelplatzes als Inbegriff des prallen Lebens sterben, wenn auch allein.

Mimi, Rodolfo
Ein Hochgenuss war es, den Vertretern der Hauptpartien zuzuhören. Von diesen famosen jungen Sängern/innen, auf die das Theater Augsburg stolz sein kann, hat jede(r) das Zeug zu einer großen Karriere. Nachdem sie neulich bereits als Donna Anna einen guten Eindruck hinterließ, vermochte Gastsängerin Natalie Karl, die man noch aus Stuttgart in guter Erinnerung hat, an diesem Abend noch stärker für sich einzunehmen. Mit hervorragender italienischer Technik, wunderbarer Linienführung und beseeltem Ausdruck zeichnete sie ein sehr berührendes, emotionales Rollenportrait der Mimi, der sie auch darstellerisch ein anrührendes Profil gab. Ebenfalls Gast war Joel Montero, der für den Rodolfo eine gute Wahl war. Mit angenehmem, rundem und farbenreichem lyrischem Tenor, den er nuancenreich und mit großem Schmelz einzusetzen wusste, entsprach er dem Dichter voll und ganz. An das hohe vokale Niveau des Liebespaares vermochte Seung-Gi Jungs sonor und obertonreich singender Marcello problemlos anzuknüpfen. In puncto Ausdrucksintensität war er Montero sogar überlegen. Als ideale Musetta erwies sich Cathrin Lange. Trefflich war schon ihr aufgewecktes, kokettes Spiel. Und was sie mit ihrem wunderbar italienisch geschulten, klangvollen und flexiblen Sopran stimmlich bot, legt den Schluss nach, dass hier eine vorzügliche Mimi nachwächst. Giulio Alvise Caselli gab mit bestens sitzendem hellem Bariton einen guten Schaunard und Vladislav Solodyagin überzeugte als profund intonierender Colline. Greg Ryerson legte den Benoit stimmlich zu karikativ an. Da schnitt Eckehard Gerboth als Alcindoro und Sergeant schon besser ab. Sehr dünnstimmig präsentierte sich der Parpignol von Gabor Molnar. André Wölkners Zöllner rundete das homogene Ensemble ab. Der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Chor und Kinderchor hinterließ einen gefälligen Eindruck.

Mimi
Ebenfalls gastweise erschien Elias Grandy am Pult des Augsburger Orchestergrabens und erwies sich als erstklassiger Vertreter von Puccinis Musik, deren veristische Prägung er voll auskostete. Insgesamt fiel sein Dirigat sehr mitreißend und gefühlvoll aus, ohne dabei je sentimental zu wirken. Die Augsburger Philharmoniker setzten die Intentionen des Dirigenten intensiv und klangschön um.
Ludwig Steinbach, 10. 1. 2014
Die Bilder stammen von Nik Schölzel (teilweise andere Sänger aus der Premierenserie)
Handwerklich gut - musikalisch hochstehend
DON GIOVANNI
Besuchte Aufführung: 18. 12. 2013 (Premiere: 30. 9. 2012)
Im Angesicht des Todes
Der Augsburger „Don Giovanni“ genießt seit seiner Premiere im Herbst 2012 einen guten Ruf. Mit entsprechend hohen Erwartungen ging man in die Aufführung, wurde dann aber zumindest in szenischer Hinsicht enttäuscht. Die Inszenierung von Patrick Kinmonth, von dem auch das Bühnenbild und die historischen Kostüme stammen, erwies sich als reichlich altbacken und vermochte in ihrer Gesamtheit nicht zu überzeugen.

Dong-Hwan Lee (Leporello), Giulio Alvise Caselli (Don Giovanni)
Was Kinmonth hier auf die Bühne gebracht hat, wird die Rezeptionsgeschichte des Werkes kaum vorantreiben. Handwerklich ist ihm zwar nichts anzulasten; auf die Führung von Personen versteht er sich gut. Nicht zu überzeugen vermochte indes seine grundsätzlichen Herangehensweise an Mozarts Oper. Dem modern eingestellten Intellekt wurde hier rein gar nichts geboten. Allzu sehr blieb die zwar durchaus schön anzusehende, aber zu harmlose Inszenierung in herkömmlichen Konventionen stecken und geriet demzufolge alles andere als aufregend. Kinmonth siedelt das Stück im durch oftmaligen Sprühregen, einem Wasserbassin auf dem Bühnenboden sowie einer Gondel versinnbildlichten Venedig des 18. Jahrhunderts an und identifiziert den Titelhelden mit einem berühmten Einwohner der Stadt: Casanova. An und für sich ein Einfall, der durchaus Sinn hat. Auch die Idee, die Frauen sehr selbstbewusst und emanzipiert vorzuführen, war gefällig, ebenso der missglückte Selbstmordversuch der darob in hysterisches Lachen ausbrechenden Elvira mit Hilfe einer Pistole. Überzeugend war die Quintessenz des Ganzen: Das Prinzip Don Giovanni stirbt nie aus, sondern lebt ständig fort. Dementsprechend fährt der Protagonist nicht zur Hölle, sondern nähert sich am Schluss erneut den Damen. Mit der Andeutung dessen, was vor und was nach der eigentlichen Handlung liegt, kann man ebenfalls leben.

Dong-Hwan Lee (Leporello), Giulio Alvise Caselli (Don Giovanni), Erich Payer (Tod)
So weit so gut. Vereinzelt konnte man Kinmonths Ideen sogar bescheinigen, dass sie in jedes Zeitalter passen. Leider sind das aber nur Eintagsfliegen. Das große Problem der Inszenierung besteht darin, dass mit der Verankerung des Geschehens in der Entstehungszeit der Oper - hier sei noch erwähnt, dass Casanova am 29. 10. 1787 in Prag im Uraufführungspublikum saß - eine Mentalität beschworen wurde, die längst veraltet und von der heutigen Warte aus in keiner Weise mehr nachzuvollziehen ist. Der Tod war damals in Form von Seuchen und Krankheiten allgegenwärtig und mit dem allgemeinen Lebensgefühl untrennbar verbunden. Damals existierten noch zur Genüge bildliche Vorstellungen des Sensenmannes und das Übernatürliche war noch nicht aus der Gedankenwelt der Menschen verbannt. Dem trägt Kinmonth Rechnung, indem er den Tod, lebendig geworden, fast stets präsent sein und zum Zeuge der Handlung werden lässt. In unserer von Vernunft bestimmten Wirklichkeit vermag diese Vorgehensweise wenig zu überzeugen, genau wie die Idee, den Commendatore äußerst traditionell als Reiterstandbild auf einer Gruft vorzuführen. Nicht nur hier wurde letztlich belanglos am Libretto entlang inszeniert, ohne dem Geschehen eine übergeordnete moderne Aussage zu geben. Dass der Zuschauerraum an diesem Abend allenfalls zur Hälfte gefüllt war, war aus szenischer Sicht gut nachzuvollziehen.

Dong-Hwan Lee (Leporello), Giulio Alvise Caselli (Don Giovanni), Vladislav Solodyagin (Commendatore)
Nicht aber aus gesanglicher. Die stimmlichen Leistungen waren bis auf eine Ausnahme ganz vorzüglich. Wieder einmal wurde deutlich, dass heutzutage auch kleine Häuser über hervorragende Ensembles verfügen, die es mit denen großer Bühnen gut aufnehmen können. Giulio Alvise Caselli kann man getrost als idealen Don Giovanni bezeichnen. Nicht nur äußerlich wurde der junge, blendend aussehende und bewegliche Bariton seinem Part voll gerecht. Auch vokal erbrachte er mit seinem prachtvoll focussierten, leicht und geschmeidig ansprechenden wohlklingenden lyrischen Bariton eine Glanzleistung. Man möchte ihn gerne einmal mit Verdi oder Puccini hören. Nicht minder überzeugend war der über ebenfalls bestens gestütztes Bassmaterial verfügende Dong-Hwan Lee, der dem Leporello eine Vielzahl von Facetten abgewann, wobei er indes um des Ausdrucks willen bewusst manchmal etwas seinen guten Stimmsitz aufgab. Das hätte nicht sein müssen. Eine gute Leistung erbrachte auch Natalie Kerl, deren Stuttgarter Ännchen man noch in bester Erinnerung hat. An diesem Abend stellte sie eindrucksvoll unter Beweis, dass sie auch für die Donna Anna eine treffliche Wahl darstellt. Die großen dramatischen Ausbrüche standen ihr in demselben Maße zu Gebote wie einfühlsame lyrische Passagen und Koloraturgewandtheit. In Nichts nach stand ihr Stephanie Hampl, die die Verzweiflung der Elvira, ihre Gefühlsstürme und auch Rachegelüste darstellerisch mit hoher Intensität auskostete und auch stimmlich mit tiefgründigem, emotional eingefärbtem Stimmklang stark für sich einzunehmen wusste. Eine vokal recht kräftige und mit trefflicher Stütze singende Zerlina war Cathrin Lange. Neben ihr präsentierte sich Simon Tischler als ebenfalls mit ansprechender italienischer Technik singender Stadtbürger Masetto. Wunderbares sonores Bassmaterial brachte Vladislav Solodyagin für den Commendatore mit, der hier aber eher der Bruder als der Vater Annas war. Gegenüber seinen Kollegen/innen fiel der Don Ottavio von Christopher Busietta erheblich ab. Mit seinem dünnen, kopfig und bar jeder soliden stimmlichen Anlehnung gegen das Brustbein geführten Tenor bildete er den einzigen Schwachpunkt in dem ansonsten ausgezeichneten Ensemble. Als Tod geisterte Erich Payer stumm über die Bühne.

Dong-Hwan Lee (Leporello), Stephanie Hampl (Donna Elvira)
Roland Techet am Pult setzte zusammen mit den Augsburger Philharmonikern auf einen flüssigen, transparenten und geschmeidigen Klang, der an der einen oder anderen Stelle aber etwas dramatischer hätte ausfallen können. Den Sängern war der Dirigent ein umsichtiger Partner.
Fazit: Eine zwiespältige Aufführung. Gesanglich ist der Abend sehr empfehlenswert, szenisch eher entbehrlich. Worauf er mehr Wert legt, mag jeder Opernfreund für sich selber entscheiden.
Ludwig Steinbach, 22.12. 2013 Die Bilder stammen von A. T. Schaefer.
Bezaubernde Gilda
RIGOLETTO
Premiere: 26. 10. 2013
Der Narr im Wilden Westen
Einen zwiespältigen Eindruck hinterließ die Neuproduktion des „Rigoletto“, mit dem das Theater Augsburg seinen Beitrag zum 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi zur Diskussion stellte. Patrick Kinmonth hat sich des Stücks angenommen und eine Deutung präsentiert, die ihm beim Schlussapplaus von dem verstörten, eher konventionell eingestellten Publikum zahlreiche Buhrufe einbrachte. Dabei war seine Herangehensweise an Verdis Oper eher harm- und belangloser Natur.

Chor
Es war schon eine Überraschung, als sich der Vorhang öffnete und man sich jäh in den Wilden Westens Nordamerikas versetzt sah. Rigoletto unter Cowboys und Indianern? Ergibt das Sinn? Das Auditorium meinte fast einstimmig „nein“. Vom Äußeren her mag das sicher stimmen. Da hätte „Un ballo in maschera“, der von Verdi aus Zensurgründen gerade in dieses Land verlegt wurde, besser hingepasst. Die Antwort für diese recht extravagante Vorgehensweise des Regisseurs, der auch die Kostüme schuf und dem Darko Petrovic (Bühnenbild) zur Seite stand, liefert gerade das Genre des Wildwest-Films - oder genauer: der Italo-Western. Der ursprüngliche, in den USA über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich weiterentwickelte und zur Blüte gebrachte Westernfilm mit seinen stets im Vordergrund stehenden edlen Helden und Indianern kann hier nicht viel zum besseren Verständnis beitragen. Sehr wohl aber der in Italien ab den 1960er Jahren entstandene Western, der von seinem Wesensgehalt her mit dem „Rigoletto“ durchaus vergleichbar sind. Im Italo-Western waren die guten Kämpfer für Recht und Ordnung eher zweitrangig. Meistens waren es die dunklen, zwiespältigen und bösen Charaktere, die im Zentrum dieser Filme standen und mit aller Macht ihre wenig hehren Ziele verfolgten. Und genau darin liegt die geistige Parallele zu Verdis Rigoletto, dessen Personal einschließlich der Titelfigur sich ebenfalls aus recht fragwürdigen Spezies der Gattung Mensch zusammensetzt. Hier wie dort geht es nicht um den Kampf des Guten gegen das Böse, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen ziemlich anrüchigen Gestalten.

Jacek Strauch (Rigoletto)
So weit erscheint der Ansatz des Regisseurs also begründet. Indes ist sein Versuch, modern sein zu wollen und etwas gänzlich Neues zu präsentieren, gescheitert. Natürlich war der äußere Rahmen, den er und sein Team der Oper verpassten, neu. Nicht aber der geistige Gehalt. Der bewegte sich größtenteils in ausgetretenen konventionellen Pfaden, ohne vom geistig-intellektuellen Standpunkt aus etwas Neues zu bieten. Dieser Aspekt wird von ihm in seiner Interpretation leider gänzlich ausgeklammert. Dabei war der Beginn noch vielversprechend. Die Handlung wird von Kinmonth gleichsam von hinten aufgerollt. Bei Gildas während des Vorspiels stattfindender Trauerfeier klammert sich der Duca verzweifelt an die Leiche der Geliebten. Das kann Rigoletto nicht ertragen und erschießt seinen ehemaligen Dienstherrn kurzerhand. Die aus Cowboys bestehende Trauergemeinde reagiert prompt und befördert nun ihrerseits ihn ins Jenseits, so dass zu guter Letzt drei Leichen nebeneinanderliegen - wahrlich ein starker Beginn, der auf das Kommende neugierig machte. Leider wurden die Erwartungen in der Folge vom Regisseur nicht erfüllt. Die Kraft des Eingangsbildes wurde später an keiner Stelle mehr erreicht.

Jacek Strauch (Rigoletto), Sophia Christine Brommer (Gilda)
Kinmonth beschränkte sich darauf, die Geschichte in herkömmlichen Deutungsmustern geradlinig und solide, wenn auch ohne echten Tiefgang zu erzählen. Wenn man von dem außergewöhnlichen Rahmen und der Szene auf Gildas Beerdigung einmal absieht, ist ihm zu Verdis Werk gar nichts Neues eingefallen. Eine innere Stellungnahme zu dem Geschehen und eine Auseinandersetzung mit dem Subtext des Librettos werden von ihm nicht geliefert. Die Saloongesellschaft des Anfangs, zu der sich der Duca als äußerlich nicht sehr herausragender Sheriff gesellt und unverhohlen die zur Salondame umgedeutete Gräfin Ceprano anmacht, waren eigentlich nur Staffage. Eine junge Indianerin fungiert als Serviermädchen und Rigoletto selber erscheint als alter Fuzzy mit Rückenwunde, der sich in seinem Duett mit Gilda als Bruder von Donizettis Dulcamara erweist. Zusammen mit seiner Tochter haust er in einem Planwagen und preist auf einer großen Werbetafel „Rigolettos Elixier“ an. Dass sich Gilda während „Caro nome“ in die ihr noch unbekannte Männergesellschaft begibt und einem der Cowboys den Hut vom Kopf reißt und diesen sich selber aufsetzt, hat man im benachbarten München ähnlich gesehen. Sparafucile und Maddalena, die in einem einfachen Tipi leben, gehören der indianischen Urbevölkerung des Landes an. Das war alles wenig originell und riss einen nicht gerade vom Sitz.

Sophia Christine Brommer (Gilda)
Eine Glanzleistung erbrachte dagegen Lancelot Fuhry am Pult. Er dirigierte die Augsburger Philharmoniker mit enormer Intensität und Fulminanz. Er verstand sich trefflich darauf, Spannung aufzubauen, wobei er die durchgehende musikalische Linie kontinuierlich immer mehr zu steigern wusste und das konzentriert und versiert aufspielende Orchester bei den Höhepunkten der Partitur mächtig auftrumpfen ließ. Darüber hinaus fand er genau den richtigen Spagat zwischen dramatischem Aplomb und lyrischer Eleganz und wartete den ganzen Abend über mit einer hervorragenden Italianita auf. Von diesem vielversprechenden Dirigenten wird man in Zukunft wohl noch viel erwarten dürfen.

Kerstin Descher (Maddalena), Ji-Woon Kim (Duca)
Auf insgesamt glänzendem Niveau bewegten sich auch die sängerischen Leistungen. Dabei stand die Premiere unter keinem guten Stern. Der ursprünglich für den Duca vorgesehene Ji-Woon Kim konnte aufgrund einer fiebrigen Erkältung nicht singen. Ursprünglich bereit, seinen Part wenigstens zu spielen, weil Einspringer Andrea Shin vom Badischen Staatstheater Karlsruhe erst zwei Stunden vor Beginn in Augsburg eingetroffen war und demgemäß szenisch nicht mehr eingewiesen konnte, hatte sich sein Zustand 20 Minuten vor Beginn derart verschlechtert, dass er nach Hause geschickt werden musste. Die Lösung sah folgendermaßen aus: Während Regieassistent Dominik Kastl den Duca spielte, steuerte Herr Shin den vokalen Part von der linken Bühnenseite aus bei. Der große tenorale Glanz, den er dabei verbreitete, die fein gesponnene italienische Linienführung sowie die hohe Ausdrucksintensität und Frische seines prächtigen Tenors ließen den herzlichen Schlussapplaus des begeisterten Publikums nur zu berechtigt erscheinen. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Schin, den man noch von seinen Duca-Auftritten in Heidelberg und Karlsruhe in bester Erinnerung hat, für sein beherztes Einspringen, das die Premiere gerettet hat. Ein weiterer Glanzpunkt der Aufführung war Sophia Christine Brommer, die sich als Gilda die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberte. Und das zurecht. Diese junge Sopranistin, die letzte Saison noch zum Ensemble des Augsburger Theaters gehörte und jetzt an dieses als Gast zurückkehrte, hat alles, was eine gute Vertreterin dieser Rolle braucht. Ausgeprägte lyrische Eleganz und einfühlsame Legatofähigkeiten stehen ihr in demselben Maße zur Verfügung wie Koloraturgewandtheit, Flexibilität und Ausdrucksstärke. Dabei klang ihr perfekt italienisch fundierter Sopran bis in höchsten Höhen des Stimmbereichs voll und rund. Dazu gesellte sich eine sehr gefühlvolle Tongebung und Beseeltheit des Ausdrucks, womit sie besonders bei dem wunderbar gesungenen „Caro nome“ punkten konnte. Diese Gilda hatte Festspielformat. An das hohe Niveau seiner beiden Kollegen vermochte Jacek Strauch in der Partie des Rigoletto nahtlos anzuknüpfen. Mit herrlich sonorem, expansionsfähigem und höhensicherem sowie ebenfalls vorbildlich italienisch geschultem Bariton zog er alle Register seiner Rolle, in der er gänzlich aufging und in der auch darstellerisch sehr glaubhaft war. Vladislav Solodyagin war ein profund singender Sparafucile, der leider beim tiefen ‚f’ am Ende seines Duetts mit Rigoletto im ersten Akt auf die Stimme drückte. Dieser Ton hätte besser auf dem Atem geführt und freier ausschwingen müssen. Das war indes nur eine Kleinigkeit, die dem insgesamt positiven Eindruck keinen Abbruch tat. Kerstin Descher brachte für die Maddalena einen sinnigen, verführerischen Mezzosopran mit. Tadellos auch die Giovanna von Wilhelmine Busch. Stephen Owen gab einen autoritär und recht bestimmt singenden Monterone. Schönes Baritonmaterial brachte Giulio Alvise Caselli für den Marullo mit. Mit tiefgründiger Tongebung wertete Jutta Lehner die kleine Rolle der Gräfin von Ceprano auf. Das gilt auch für den vokal kräftigen Pagen von Constanze Friederich. Stimmlich nicht sehr auffällig waren Christopher Busietta (Borsa) und Daniel Holzhauser (Graf von Ceprano). Den Gerichtsdiener gab Eckehard Gerboth. Als Schamane rundete Erich Payer das Ensemble ab. Einen gefälligen Eindruck hinterließ der von Katsiaryna Ihnatsyeva-Cadek einstudierte Herren-Chor.
Fazit: Von der szenischen Seite her nicht gerade aufregend, war die Aufführung in musikalischer und stimmlicher Hinsicht voll gelungen. Der Besuch kann durchaus empfohlen werden.
Ludwig Steinbach, 30. 10. 2013 Die Bilder stammen von Nik Schölzel.
VIOLANTA / DER RING DES POLYKRATES
Premiere: 31. Mai 2013
Wenn Opernhäuser Korngold spielen, dann fast immer „Die tote Stadt“. Dass das Augsburger Theater jetzt zwei Korngold-Einakter miteinander koppelt, ist an sich schon eine Besonderheit. Die Aufführung selbst ist ein starkes Plädoyer für Korngolds heiteren „Der Ring des Polykrates“, besonders aber für die dramatisch-schwerblütige „Violanta“.

Beide Opern, die in direkter Folge in den Jahren 1913 bis 1915 entstanden und 1916 in München unter Bruno Walter uraufgeführt wurden, sind Ehegeschichten: Im „Ring des Polykrates“ wird die glückliche Beziehung zwischen dem Hofkapellmeister Wilhelm Arndt und seine Frau Laura durch den Besuch des alten Freundes Peter Vogel auf die Probe gestellt. In „Violanta“ will die titelgebende venezianische Kaufmannsgattin den Selbstmord ihrer Schwester rächen und bittet deren Verführer zu einem tödlichen Rendezvous.
Der kompositorische Sprung, den der junge Erich Wolfgang Korngold zwischen beiden Stücken macht, ist gigantisch: „Polykrates“ klingt wie ein Lortzing mit den Mitteln der Spätromantik, „Violanta“ ist dagegen ein hochromantisches Werk im Stile der „Elektra“, das in der Harmonik und Instrumentationskunst wie ein Schwesterwerk der „Toten Stadt“ wirkt.

Schon im „Polykrates“ spielen die Augsburger Philharmoniker unter der Leitung des zukünftigen 1. koordinierten Kapellmeisters Roland Techet farbenreich auf. Immer wieder sind die Bläser mit solistischen Partien gefordert und können in geistreicher Korrespondenz zur Bühne treten. Die „Violanta“ gerät den Augsburger Philharmonikern dann geradezu sensationell. Techet lässt die Philharmoniker in der Musik schwelgen, kostet ihre harmonische Sinnlichkeit und Leidenschaft grandios aus.
Dem Augsburger Schauspielchef Markus Trabusch gelingt eine gediegene Inszenierung, in der die Sänger-Darsteller glaubhafte Charaktere verkörpern. Bühnenbildner Volker Hintermeier hat zwei goldene Käfige konstruiert: Im „Polykrates“ ist es das goldene Gebälk eines Hauses, in dem der gutbürgerliche Ehestreit für Turbulenzen sorgt. Die Video-Einspielungen mit Bildern des 1. Weltkriegs erinnern an die weltpolitische Situation der Entstehungszeit, bieten aber für die kleine harmlose Komödie keine tieferen Einsichten.

Wesentlich besser hätte man diesen Aspekt mit der blutigen „Violanta“ verknüpfen können, dort werden die Anspielungen auf den Weltkrieg aber komplett ausgespart. Die Bühne zeigt nun eine achteckige Goldkonstruktion, die einen Brunnen und eine große goldene Kugel umgibt, was an das Märchen vom „Froschkönig“ erinnert. Will Trabusch so darauf hinweisen, dass sich Violantas Bild des Prinzen Alfonso verändert, dass er sich vom Frosch, den sie ermorden will, in den Prinzen, den sie liebt, verwandelt? Hier hätte die Regie die Symbolik des Bühnenbildes aufgreifen müssen.
Die weibliche Hauptrollen in beiden Werken werden von der Haus-Primadonna Sally du Randt gesungen. Im „Polykrates“ gefällt sie als Laura mit eleganter Erscheinung und flotten Parlando, als Violanta wird von der lyrischen Sopranistin aber hochdramatischer Einsatz gefordert. Für die wilde Rächerin fehlt ihrer Stimme die dunkel grundierte Mittellage, im Liebesduett mit Alfonso kann sie aber puren Wohlklang verströmen. In diesen Momenten ist Sally du Randt ganz bei sich.

Als Hofkapellmeister Arndt gefällt Niclas Oettermann im „Polykrates“ mit kräftigem und durchsetzungsfähigem Tenor, in Violanta hat er noch einen kleinen aber treffenden Auftritt als Maler Giovanna Bracca. Sehr großen Eindruck macht Ji-Woon Kim als Violantas todessehnsüchtiger Liebhaber Alfonso, der mit warmem und gut fundiertem Tenor die dunkle Leidenschaft dieser Figur auf die Bühne bringt.
Von ihrer besten Seite kann sich Sophia Christine Brommer als komödiantisch-pfiffiges Hausmädchen Lieschen präsentieren. Sie bietet darstellerisch und sängerisch eine pointierte Darstellung, während Christopher Busietta als ihr Freund Florian oft Probleme mit den Korngoldschen Orchestermassen hat. Zuverlässig gestaltet Bariton Giulio Alvise Caselli seine Auftritte in beiden Opern, einmal als Peter Vogel, dann als Matteo.
Auch wenn man bei den Sängern und der szenischen Umsetzung kleine Abstriche machen muss, ist diese Korngold-Doppelabend dank der Leistung der Augsburger Philharmoniker unter Roland Techet eine fulminante Ausgrabung.
Rudolf Hermes (c) Theater Augsburg
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich weiter unten auf der Seite Augsburg des Archivs










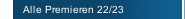




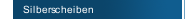
















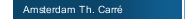













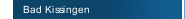




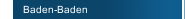





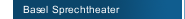




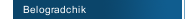

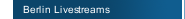





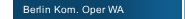



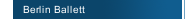





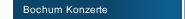



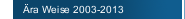





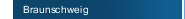

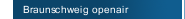




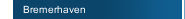




















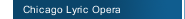


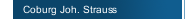





















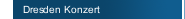



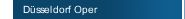



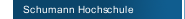









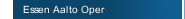




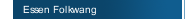










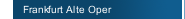
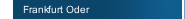





















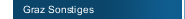








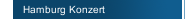
















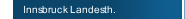

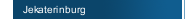

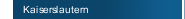











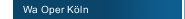


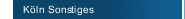
















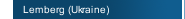





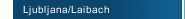





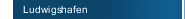























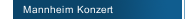













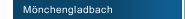





















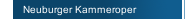
















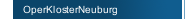


























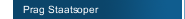
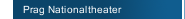

















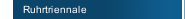

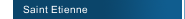







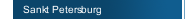



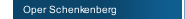
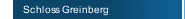














































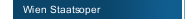

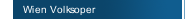

















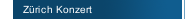
















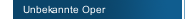




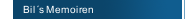





 Natürlich sind in einem solchen Provisorium nicht alle szenischen Dimensionen einer „normalen“ Opernaufführung möglich. So war es ein prinzipiell verständlicher Griff der Intendanz, den jungen polnischen Schauspielregisseur Wojtek Klemm für die Regie zu engagieren, der auch noch nie Oper inszeniert hatte. Mit Patrice Chéreau und seinem Bayreuther „Jahrhundert-Ring“ 1976 gibt es ja das wohl prominenteste Beispiel, dass so etwas durchaus gut gehen kann. Nun ist Mozarts Werk „La clemenza di Tito“, parallel zur „Zauberflöte“ anlässlich der Krönung Leopolds II. mit dem Libretto von Caterino Mazzolà nach Pietro Metastasio geschrieben, nicht gerade das beste Beispiel für Operndramatik, sodass ein unbefangener Schauspielregisseur im Opernstoff natürlich nach Anhaltspunkten sucht, das Ganze etwas aufregender und vielleicht auch anspruchsvoller zu machen.
Natürlich sind in einem solchen Provisorium nicht alle szenischen Dimensionen einer „normalen“ Opernaufführung möglich. So war es ein prinzipiell verständlicher Griff der Intendanz, den jungen polnischen Schauspielregisseur Wojtek Klemm für die Regie zu engagieren, der auch noch nie Oper inszeniert hatte. Mit Patrice Chéreau und seinem Bayreuther „Jahrhundert-Ring“ 1976 gibt es ja das wohl prominenteste Beispiel, dass so etwas durchaus gut gehen kann. Nun ist Mozarts Werk „La clemenza di Tito“, parallel zur „Zauberflöte“ anlässlich der Krönung Leopolds II. mit dem Libretto von Caterino Mazzolà nach Pietro Metastasio geschrieben, nicht gerade das beste Beispiel für Operndramatik, sodass ein unbefangener Schauspielregisseur im Opernstoff natürlich nach Anhaltspunkten sucht, das Ganze etwas aufregender und vielleicht auch anspruchsvoller zu machen. Machiavelli sagt zwar, dass der Fürst danach trachten solle, für barmherzig zu gelten und nicht für grausam. Er solle aber die Nachrede der Grausamkeit nicht scheuen, um seine Untertanen in Treue und Einigkeit zu erhalten und nicht durch übertriebene Nachsicht Unordnung eintreten zu lassen. Beccaria wiederum warnt bei einer vollkommenen Gesetzgebung mit milden Strafen und geregelten Gerichtsverfahren vor diskretionären Begnadigungen durch den Fürsten als Akte unaufgeklärten Wohltuns durch einen öffentlichen Erlass der Straflosigkeit.
Machiavelli sagt zwar, dass der Fürst danach trachten solle, für barmherzig zu gelten und nicht für grausam. Er solle aber die Nachrede der Grausamkeit nicht scheuen, um seine Untertanen in Treue und Einigkeit zu erhalten und nicht durch übertriebene Nachsicht Unordnung eintreten zu lassen. Beccaria wiederum warnt bei einer vollkommenen Gesetzgebung mit milden Strafen und geregelten Gerichtsverfahren vor diskretionären Begnadigungen durch den Fürsten als Akte unaufgeklärten Wohltuns durch einen öffentlichen Erlass der Straflosigkeit.




 In Augsburg musste aber die Virtual Reality derzeit noch verordnet werden: Schon vor Beginn wird das Publikum detailliert auf die Verwendung der klobigen 3D-Brillen, die wie Schwimmwesten in der economy class von Flugzeugen unter dem Sitz ruhen, eingeschworen und instruiert. Probeweise tanzen gleich mal drei tief tiefdekolletierte fesche Damen von der linken und rechten Seite auf 3D an. Man vermisst einen Herrn zur gender equality, etwas inkonsequent - wenn schon, denn schon…
In Augsburg musste aber die Virtual Reality derzeit noch verordnet werden: Schon vor Beginn wird das Publikum detailliert auf die Verwendung der klobigen 3D-Brillen, die wie Schwimmwesten in der economy class von Flugzeugen unter dem Sitz ruhen, eingeschworen und instruiert. Probeweise tanzen gleich mal drei tief tiefdekolletierte fesche Damen von der linken und rechten Seite auf 3D an. Man vermisst einen Herrn zur gender equality, etwas inkonsequent - wenn schon, denn schon…







 So findet der Wiener Schauspieler Markus Neugebauer unter anderem auch die historische Dimension so packend an diesem Stück. Neugebauer versucht, der Figur des leidenden und gekreuzigten Jesus so viel Menschlichkeit und Größe zu geben, wie nur möglich. Sein Heiland ist ein vollbärtiger Stürmer und Dränger, der sich nie in die erste Position drängt, aber auch nicht zur unbeachteten Randfigur verkommt. Damit nähert er sich überraschend genau der Mentalität der 70er Jahre wie der Absicht des prominenten Autoren-Duos. Wie die meisten seiner Kollegen bringt der Österreicher eine gute Portion Bühnenroutine mit: Neugebauer hat in „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“, in „Les misérables“ sowie in „Jekyll & Hyde“ bereits hinreichend Musical-Erfahrung gesammelt. Seine Darstellung auf der Freilichtbühne ist zwar nicht charismatisch, aber jederzeit ausdrucksstark. Man nimmt diesem Jesus ab, dass er sich für die Allgemeinheit opfern würde.
So findet der Wiener Schauspieler Markus Neugebauer unter anderem auch die historische Dimension so packend an diesem Stück. Neugebauer versucht, der Figur des leidenden und gekreuzigten Jesus so viel Menschlichkeit und Größe zu geben, wie nur möglich. Sein Heiland ist ein vollbärtiger Stürmer und Dränger, der sich nie in die erste Position drängt, aber auch nicht zur unbeachteten Randfigur verkommt. Damit nähert er sich überraschend genau der Mentalität der 70er Jahre wie der Absicht des prominenten Autoren-Duos. Wie die meisten seiner Kollegen bringt der Österreicher eine gute Portion Bühnenroutine mit: Neugebauer hat in „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“, in „Les misérables“ sowie in „Jekyll & Hyde“ bereits hinreichend Musical-Erfahrung gesammelt. Seine Darstellung auf der Freilichtbühne ist zwar nicht charismatisch, aber jederzeit ausdrucksstark. Man nimmt diesem Jesus ab, dass er sich für die Allgemeinheit opfern würde.