Theater Bonn
EIN FELDLAGER IN SCHLESIEN
Kann man das spielen?
Es gibt Opern mit deren Wiederaufführung man nicht gerechnet hätte, weil sie innerhalb ihrer Rezeption so sehr speziell sind, wie zum Beispiel Giacomo Meyerbeers "Ein Feldlager in Schlesien" (Singspiel in drei Akten in Lebensbildern aus der Zeit Friedrichs des Großen). Dieses patriotische Singspiel wurde 1844 zur feierlichen Wiedereröffnung der Berliner Hofoper, nach ihrem Brand, mit lebenden Bildern des preussischen Staates uraufgeführt. 1847 als "Vielka" zu einer durchkomponierten Oper in Wien wiederbelebt, 1854 werden für Paris große Teile in "L étoile du Nord" übernommen. Keines davon gehört zu den ganz großen Erfolgen Meyerbeers, doch bei Aufführungen hört man aus zeitgenössischen Quellen von Begeisterung reden. Immerhin stammt das Werk aus der großen Schaffenszeit des Komponisten, und befindet sich zeitlich zwischen den "Hugenotten" und dem "Propheten". Auch in Berlin stand das eigentliche Singspiel, manchmal auch nur in Teilen, über mehrere Dekaden auf dem Spielplan, und war besonders für Staatsbesuche ein Vorführspektakel. Als Librettist galt offiziell der Literat Ludwig Rellstab, der doch lediglich das Libretto von Eugene Scribe übersetzte, man wollte bei einem patriotischen Anlass halt keine "Ausländer" beteiligt sehen. Meyerbeer übernahm den ehrenvollen Auftrag zum einen, weil er der preussische Generalmusikdirektor war, zum anderen, weil der Stammsitz der Familie Meyer Beer in Berlin war. Amüsante Randnotiz: das Libretto wurde sogar dem preussischen König unterstellt. Man sollte also meinen, das eine Wiederaufführung an der Berliner Staatsoper unter den Linden passiert; doch weit gefehlt die Bonner Oper hat das Werk im Rahmen von "Fokus`33" auf den Spielplan genommen. Hier sei allerdings auch die Frage gestellt, was die Oper mit dem Jahr 1933 verbindet? Schließlich, was überhaupt für das Oeuvre Meyerbeers gilt, verschwanden die Werke schon um 1900 aus dem eigentlichen Repertoire, was erst recht für das "Feldlager" gilt. Am ehesten vielleicht das Verbot Meyerbeers als jüdisch stämmigem Komponisten durch die Nazis.
Das Singspiel hat nicht die zeitlichen Dimensionen von Meyerbeers Grand Operas, sondern drei nicht überlange Bilder; auf die patriotischen Traumbilder hatte man in Bonn dann doch verzichtet. In einem Landhaus in der Nähe des Krieges lebt der emeritierte Hauptmann Saldorf mit seiner Nichte Therese und seiner romastämmigen Pflegetochter Vielka, deren Verlobte Leopold (Therese) und der Musiker Conrad (Vielka), ersterer ist preussischer Offizier und taucht szenisch nicht auf, zweiter will nach Berlin arbeiten. Als Conrad durch das Schlachtgebiet will, trifft er, unter einer Brücke versteckt, einen preussischen Offizier mit Windhund, der von seiner Truppe abgeschnitten wurde. Ja, Sie vermuten richtig, es ist der preussische König, der mit einem Kleidertausch durch die Linien gerettet wird, während Conrad als Friedrich II. von den feindlichen Soldaten verhaftet wird. Vielka darf die , es sind ungarische Panduren, Soldaten noch durch Wein, Wahrsagerei und Koloraturen ablenken. Friedrich der Große, darf als preussischer Nationalheros nicht auf der Bühne erscheinen, so hört man ihn nur "offstage" Flöte spielen.
Das zweite Bild gilt dem Titel der Oper: lustiges Lagerleben mit Tanz und Gesang, bis die vermeintliche Saga des gefangenen Friedrich, durch Saldorf verraten, demoralisierend, alle verwirrt. Als Saldorf auch noch eintrifft droht ihm Lynchjustiz, doch die Gerüchte werden entkräftet. Der alte Soldat befeuert durch eine herzhafte Ansprache die mannhaften Krieger gegen den Feind.
Das dritte Bild spielt nach der für Preussen erfolgreichen Schlacht im Schloss Sanssouci in Potsdam, dorthin wurde die Familie Saldorf bestellt. Es gibt noch etliches zögerliches Hin und Her mit dem zu belohnenden Conrad, so wird der fälschlicherweise bezichtigte Leopold (, der nie auftaucht,) vom Tode gerettet werden, Conrad selbst erhält eine Anstellung bei der Hofmusik, Vielka darf (mit Koloraturen) und zwei Flöten (eine dabei von Alten Fritz selbstmündig "offstage" geblasen) konzertieren und prophezeit (Wahrsagerei!) Preussen eine rosige Zukunft. Soweit meine etwas flapsige Inhaltsangabe.
Kann man in unserer Zeit noch so ein patriotisches Zeug spielen, mit unserer Zeit, meint die Zeit des Ukraine-Krieges, in der von allen Seiten, sei es gerechtfertigt oder nicht, wieder patriotisch mit dem Säbel gerasselt wird. Diese Frage stellt sich natürlich auch das Produktionsteam um den Regisseur Jakob Peters-Messer. Das Ergebnis mag ein bißchen schockieren, denn man spielt das Stück einfach vom Blatt, natürlich nicht im realistischen Set, sondern Sebastian Hannak baut eine verfremdete Bühnenszenerie und der Schauspieler Michael Ihnow spricht den Großteil der Texte, bei einem Singspiel gibt es schließlich Sprechtexte, als eine Art Chronist, der auch Scheinwerfer einrichtet oder mit einer Videokamera die Bühnensituation verfremdet. Sanssouci schwebt im dritten Bild, wie ein barocker Traum, auf der Bühne. Sven Bindseils Kostüme verankern in der historischen Zeit. Inmitten der patriotischen Vorgänge wird der Brief eines Soldaten aus dem schlesischen Krieg vorgelesen, der das Schlachtengrauen auf Realitätsbezug bringt und damit den patriotischen Pomp gegen die Mauer fährt. Überhaupt bildet das zweite Bild eine Zäsur, denn das Feldlager findet mitten im Zuschauerraum statt, nach der ersten Pause wird ein Teil des Publikums auf die Bühne gesetzt. So befindet man sich auch akustisch mitten im Geschehen. Meyerbeer hat hier absolut überrumpende Qaudrupelchöre geschrieben und die räumlichen Möglichkeiten von Bühnen- und Fernmusik werden in dieser Aufführung auf`s Beste ausgeschöpft..
Überhaupt, die Musik, Meyerbeer hat das Singspiel in einem, für ihn, sehr kurzem Zeitrahmen von etwa einem Jahr komponiert, dabei kam eine sehr abwechslungsreiche Musik auf kompositorisch sehr hohem Niveau zustande, über den patriotischen Teil, außer den finalen Traumbildern, habe ich schon geschrieben, doch die beiden Rahmenakte unterlaufen den preussischen Prunk nahezu: denn sie haben die damals sehr populäre Opera Comique a la Auber oder Boieldieu zum Vorbild, das bürgerliche Rührstück steht Pate. Unterhaltung bleibt der Garant, sei es die bezaubernde Ensemblekunst, der semikomische Zuschnitt mancher Szene, die pittoresken Chortableaus oder das bekannteste Stück: Vielkas Koloraturszene aus dem dritten Akt mit den zwei konzertierenden Flöten;übrigens ein Paradestück solcher Sangesdiven wie Jenny Lind oder Henriette Sonntag. So werden gleichsam zwei Genres bedient. Zum zweiten ist die eigentliche Heldin keine Preussin, sondern das "Zigeuner-"mädchen Vielka, die durch Charme, Gewitztheit und gesunden Menschenverstand die preussischen Felle ins Trockene bringt und ihrem etwas dümmlichen Bräutigam die rechten Entscheidungen eingibt.
Auch in Musikalischen zeigen sich die Kollektive der Oper Bonn an erster Stelle der Beteiligten, der Chor in den komplexen Quadrupelchören und szenischen Positionierungen des Feldlagers, das Orchester mit seinen wunderbaren Soloflötistinnen (Mariska van der Sande und Julia Bremm). Hermes Helfricht hatte die Derniere von GMD Dirk Kaftan übernommen und sicher durch sämtliche musikalischen Klippen gesteuert, lediglich die französischen Opera-Comique-Anteile hätten noch etwas mehr Leichtigkeit und Esprit benötigt. Meyerbeer hatte für die großen Bühnen und besten Sänger seiner Zeit komponiert; die finden wir an der Oper Bonn nicht, aber zumindest ein gutes Gesamtniveau. Elena Gorshunova bestreitet die Hauptpartie der Vielka sauber und ordentlich, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ihr nicht allzu großes Sopranvolumen geht in der unteren und mittleren Lage etwas unter, der hohe Koloraturteil ist solide, mir persönlich fehlt es für die Partie einfach an der nötigen vokalen Brillianz. Barbara Senators Therese punktet da schon allein durch sattes, lyrisches Soprantimbre . Tobias Schabel singt mit etwas knorrigem Bassbariton passend den liebenswerten, alten Krieger Saldorf. Jussi Myllys hat die schwierige Aufgabe einen , für mich, unangenehmsten Charaktere zu geben, denn der Verlobte Conrad hat nicht nur seine Dummheit und unangenehme Egozentrik gegen sich, eine übermäßige Furchtsamkeit verbunden mit zögerlichem Zaudern, macht es auch nicht besser. Gesanglich leistet Myllys Beachtliches, denn die Partie hat eine recht hohe Tessitur, halt französische Comique wie der "Postillion von Lonjumeau". Der Tenor hat zudem noch ein leicht heroisches Timbre, was die Figur eher aufwertet. Martin Tzonev als Tronk gefällt durch seinen charakteristischen Bass zunächst als Ulanenhauptmann, dann vom König als Bedienter nach Potsdam übernommen. Die Nebenfiguren gestalten auf Augenhöhe des Ensembles.
Für mich hat sich der kurzweilige Abend(vier Stunden mit zwei Pausen) sehr gelohnt. Meyerbeers beachtliche Musik rechtfertigt eine Aufführung, zumal sich die Szene gut aus der schwierigen Affaire rettet. Die Publikumsreaktion sagte `d accord. Mein persönlicher Wunsch nach einer Aufnahme des auf Tonträger nicht vorhandenen Werkes bleibt vorhanden. Besondere Erwähnung noch des ausgezeichneten, umfangreichen Programmheftes, wie auch bei Franckensteins "Li-Tai-Pe". Eine wirklich bereichernde Lektüre bei diesen wirklich unglaublichen Raritäten. Nächste Saison kann man in Bonn dann im "Fokus `33" dann Weills "Mahagonny", Franchettis "Asrael" und Schrekers "Der singende Teufel" erleben, dazu kommt noch eine Übernahme von Giordanos "Siberia" von den Bregenzer Festspielen; ich hoffe, ich kriege das in meinem Terminkalender unter.
Martin Freitag, 31.5.22
ERNANI
Besuchte Aufführung am 20.05,22 (Premiere am 10.04.22)
Musikalische Erfüllung
Warum gehört der "Ernani" eigentlich zu den unbekannten Opern Verdis? An der Musik kann es nicht liegen, denn die liegt auf der gleichen Höhe wie bei Verdis Meisterwerken, klingt abwechslungsreich und den dramatischen Situationen stets angemessen. So stellt man sich italienische Oper pas excellence vor. Nun gut, es braucht wirklich hervorragende Sänger, aber das benötigt ein "Troubadour" auch, mit dem das dramaturgische Gerüst irgendwie Ähnlichkeit hat. Trotzdem wirkt das Libretto von Francesco Maria Piave etwas hausbackener, so eine romantische Räuberpistole mit überdimensionierten Gefühlen und Blut und Ehre; und einem "Hah!".Meines Erachtens ein perfekter Kandidat für eine konzertante Aufführung. Trotzdem: Oper ist eine dramatische Kunst, die auf die Bühne gehört . Insofern kann man die Oper Bonn nicht genug loben, das Wagnis dieser selten auftauchenden Oper szenisch auf sich genommen zu haben.
Roland Schwab ist sich seiner prekären Aufgabe durchaus bewußt (, das erfährt man aus seinem Programmheftbeitrag,) und nimmt sich in seiner Inszenierung der Verdioper respektvoll an, ohne zu denunzieren, schon dafür Dank daraus irgendeine Quatschnummer zu machen, wie es einige der jungen Regisseure tun. Alfred Peters Bühne setzt ein etwas traumhaft schwebendes Umfeld, das den übersteigerten Gefühlsspannungen der Protagonisten entgegenkommt. Renee Listerdals Kostüme setzen über die Zeiten hinweg das Milieu gut um und scheuen nicht die Portion Romantik bei den weiblichen Figuren. Schwab setzt dazu auf empathischen Überschwang der Emotionen, erzählt dazu schlüssig und klar die Handlung; was ein Maß an Bescheidenheit und Können voraussetzt. Die Konzentration bleibt im Fokus auf Verdis grandiose Musik und seine Protagonisten.
War es Enrico Caruso oder Leo Slezak, von dem das Bonmot stammt, daß man, um den "Troubadour" erfolgreich aufzuführen, einfach nur die vier besten Sänger der Welt braucht. Den Satz kann man für "Ernani" getrost unterschreiben. Nun,die vier weltbesten Sänger werden wir vielleicht nicht an der Oper Bonn finden, doch gerade das Solistenquartett ist vielleicht nicht perfekt, doch weit mehr als respektabel: Manches andere Haus hätte gerne einem italienischen Tenor wie George Oniani. Einen Tenore robusto mit bombensicherer Höhe und Stamina in der Art eines Mario del Monaco, der sich nötigenfalls zurückzunehmen weiß, wie in den Liebesszenen mit Elvira, die wenigen Schluchzer werden geschmackvoll eingesetzt. Yannick-Muriel Noah ist ihm eine adäquate Elvira von Format eines dramatischen Koloratursoprans mit gutem Legato und virtuoser Technik für die Fiorituren. Leider hat sich der Registerbruch vergrößert; Sprünge von unten finden sich leicht unter der Intonation wieder. Federico Longhis Bariton klingt im ersten Moment etwas trocken, doch findet sein Kaiser Karl zu schlüssiger Würde. Die Arie in der Kaisergruft ist sicherlich einer der Höhepunkte des Abends, überhaupt fasziniert der dritte Akt durch die beeindruckende Lichtchoreographie von Boris Kahnert. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten singt auch der Basso cantando auf Ohrenhöhe, Pavel Kudinov darf als, herrlich senil gespielt, unversöhnlicher Silva den Titelhelden mit Hornsignal in den Suizid treiben. Tae-Hwan Yun und Michael Krinner zeigen in den Partien des Don Riccardo und Jago, wie man in Nebenrollen gesanglich und szenisch herausragen kann. Die szenisch präsente Giovanna von Ingrid Bartz klingt etwas matt.
Kommen wir zu den wahren Helden der Aufführung: Will Humburg mit dem Beethoven Orchester Bonn und den Chören und Extrachören unter Marco Medved bezaubern mit ihrer Leistung auf einem Niveau, das man gerne öfters an den großen Bühnen der Welt erleben würde. Humburgs Verdi lodert leidenschaftlich und glutvoll, trotzdem ist er stets am Puls der Sänger, um ein Ritardando zu ermöglichen. Für mich einer der besten Verdi-Dirigenten überhaupt. Die Chöre klingen auf der Höhe von Berlin oder Mailand. In Bonn erlebt m,an echte Klasse! Begeisterter, berechtigter Schlussapplaus.
Martin Freitag, 26.5.22
Leider keine Bilder
LI-TAI-PE
Besuchte Premiere am 22.05.22
Möglichkeiten des Repertoires
TRAILER
Die Oper Bonn untersucht in ihrer Reihe "Fokus `33" Werke des Musiktheaters, deren Verschwinden oder Verbleiben auf den Opernbühnen wohl in irgendeiner Weise mit dem Jahr 1933 in einem Fokus steht, sei es das der Komponist dem Judenhass der Nazis zum Opfer fiel oder politisch missliebig war, oder die jüngere Deutsche Geschichte erst Anlass des Werkes war (,so Liebermanns "Leonore 45"). Zur Probe gestellt wurde jetzt die Oper "Li-Tai-Pe" von Clemens von Franckenstein, die 1920 uraufgeführt, ihren Weg erfolgreich über einige Bühnen machte. Clemens von Franckenstein dürfte heute kaum noch jemandem ein Begriff sein, doch zu seiner Zeit(1875-1942) war ein gut vernetzter Künstler aus adligem, in der Diplomatie tätigem Hause. Ein ernsthafter Komponist (Schüler von Ludwig Thuille), bekannt und befreundet mit vielen Zelebritäten seiner Zeit, als Dirigent tätig und zweimal sehr erfolgreicher Intendant des heutigen Nationaltheater München (Staatsoper), wo er von den Nazis aus dem Amt gedrängt wurde, er verblieb und starb in Deutschland (1942).
Die Oper in drei Akten von kurzweiligen einer Stunde und vielleicht vierzig Minuten Spieldauer handelt in einem historischen, aber auch etwas märchenhaften China um den Dichter Li-Tai-Pe. Gustav Mahler hatte Übersetzungen von zwei seiner Gedichte im "Lied von der Erde" vertont. Im ersten Akt befinden wir uns mitten im Volkstreiben, Li-Tai-Pe kommt von der Akademie abgewiesen volltrunken an, wir erfahren von Yang-Gui-Fehs (ein Mädchen aus dem Volke) Liebe zu ihm .Ein Gönner schickt ihn an den kaiserlichen Hof, wo der Kaiser verliebt in ein Bild der Prinzessin Fei-Yen eine Hochzeitswerbung an sie verfassen lassen will. Das klingt erst einmal nicht nach viel Handlung, doch die Musik verblüfft in ihrem klangmalerischem Rausch, ihrer kleinteiligen Süffigkeit; und dann gibt es da zwei Lieder, das Lied vom Kormoran und "Ich fahr auf meinem Schiffe", die einfach von unmittelbarerer Wirkung sind. Die Musik changiert zwischen tonal mehrdeutigen Wendungen, leicht pentatonischer Würze und "asiatisch trippelnden" Rhythmen. Es ist handwerklich hervorragend gemachte Musik, die immer wieder "operettige" Klicheès streift. Der zweite Akt findet am Hof statt, der Kaiser verwirft sehr schnell die Vorschläge der Minister Yang-Kwei-Tschung und Kao-Li-Tse, die bereits für die Akademieabweisung des Dichters zuständig waren und sich als dessen Feinde positionieren, während Li-Tai-Pe in höchste Gnaden gerät und zur Brautwerbung ausgeschickt wird. Die Musik weiß auch hier zu bezaubern und stuft in ein großes Chorensemble. Nach der Pause schüren die Intriganten beim Kaiser die Eifersucht, da der Dichter mit seiner Gabe angeblich die Braut unziemlich angegangen ist. Doch in einer kleinen Gegenintrige kann die als Page verkleidete Yang-Gui Fe wieder alles ins Lot bringen; sie bekommt den Dichter, der Kaiser die Braut, die Minister die Strafe. Dichter und Frau lehnen die große Belohnung ab, sondern sind mit dem einfachen Leben zufrieden. Der dritte Akt kühlt mich musikalisch etwas ab, ohne das ich es an etwas festmachen könnte.Irgendwie fehlt mir die Verve der vorausgegangenen Akte, doch die ruhige Finalabrundung mit dem "Schiff-Lied" fängt noch einmal den letztendlich positiven Eindruck auf. Allein durch die Wahl des exotischen Themas, was in der damaligen Epoche durchaus auf der Hand lag, als auch durch die geschickte Handwerklichkeit seiner Mittel, gelang es Franckenstein einen Publikumserfolg zu sichern, wenngleich der Ausführung auch ein Ruch an Kunstgewerblichkeit anhängig gemacht werden kann. Vielleicht kein Meisterwerk, doch man versteht, warum es gut ankommt.
Diese Kunstgewerblichkeit findet sich auch in Regie (Adriana Altaras) und Ausstattung(Christoph Schubinger /Bühne und Nina Lepilina/Kostüme) wieder: der erste Akt gleicht einem Wimmelbild der chinesischen Klischees von Heute;unter einer modernen Hochhaussilouette finden sich Suppenküchen,Chinaoper, gendernde Geisha-Prostituierte,Mao-Uniformen, Fahrräder,Glücksdrache, Manga-Mandarine und vieles andere,da kann man sich gar nicht satt sehen.Die Akte am kaiserlichen Hofe in reduzierter Märchenhaftigkeit mit einzelner riesenhafter Feng-Shui-Keramik. Die Aufführung entlarvt damit das exotische Asienbild der europäischen Betrachter, was sich auch in Franckensteins Musik findet. Altaras inszeniert ansonsten recht gerade und verständlich die Handlung ab, was dem Betrachter vielleicht etwas einfach anmuten mag, doch auch den Raum für die Rezeption zulässt, was ich bei einer unbekannten Oper für nicht gerade unwichtig halte. So werden die Mandarine des ersten Aktes szenisch durchgängig als "running gag" a la Ping/Pong/Pang (aus Puccinis "Turandot"), sehr präsent von Tae-Hwan Yun,Alexander Kalina,Juhwan Cho und Ricardo Llamas Marquez gegeben. Ein exotisches Schaustück wird bühnenwirksam präsentiert.
Musikalisch ist die Oper sicherlich genauso fordernd wie Strauss`etwa gleichlange "Salome" und sängerisch sehr anspruchsvoll. Bonn kann das. Hermes Helfricht läßt die opulente Partitur mit dem Beethoven Orchester Bonn sinnlich aufschimmern und meistenteils gelingt es, die Balance zwischen Bühne und Graben zu wahren. Enormes leistet Mirko Roschkowski in der Titelpartie in Sang und Darstellung: stimmlich wird ein Tenor für Schreker, Korngold oder Krenek gefordert, der die gewaltig aufbrausenden Chor-und Orchesterstellen überstrahlt, aber auch die lyrische Aura des Dichters entfaltet, mit geschickten Ausflügen in die Kopfstimme gelingt ihm das. Szenisch schafft er, den bedenkenlosen Trunkenbold über den Abend als positive Figur darzustellen. Anna Princeva stellt ihm mit warmstimmigen Sopran die liebende Yang-Gui Fe an die Seite; die beiden Lieder des ersten Aktes trifft sie ergreifend auf den Punkt; über das schreckliche untergeordnete Frauenbild der Figur möchte ich hier nicht eingehen. Joachim Goltz hat die anspruchsvolle Partie des Kaisers Hüan-Tsung, am Beginn mit recht hoher Tessitur sich quasi erst später als Heldenbariton zu erkennen gebend, meistert er auch die eifersüchtigen Ausfälle des dritten Aktes. Prinzessin Fei-Yen hält mit klarem Sopran dagegen, Ava Gesells wirkt frisch und jung, wohin sich diese interessante Stimme entwickelt, macht neugierig. Giorgos Kanaris Gönner Ho-Tschi Tschang gefällt mit ausgereiftem Bariton, wie Tobias Schabel und Johannes Mertes charaktervoll und angemessen die beiden Widersacher geben. Martin Tzonev ist als Herold eine sichere Bank des Bonner Ensembles. Kieran Carrel und Pavel Kudinov wissen als Wirt und Soldat in den Nebenrollen positiv aufzufallen. Zur sicheren Bank der Bonner Oper gehören ebenso Chor und Extrachor, die in der unbekannten Oper ordentlich zu tun haben.
Wieder einmal Erstaunliches leistet die Oper Bonn, der Besuch lohnt. Eine Oper, der man durchaus gerne wiederbegegnen würde. Da der WDR aufgezeichnet hat (Übertragung am 19.06.22 um 20.00 Uhr auf WDR 3), bleibt die Hoffnung auf eine CD, schön wär`s.
Martin Freitag, 25.5.22
Giuseppe Verdi
"Ernani"
Premiere: 10.04.2022
Früher Verdi - exzellent musiziert
Es ist eine Crux mit den unbekannten Frühwerken großer Komponisten! Mal hapert es an der musikalischen Reife, mal an der dramaturgischen Dichte, mal hat man sich einfach beim Sujet vergriffen - bei Verdis "Ernani", der nun an der Oper Bonn eine beglückende Premiere feierte schlägt eben auch eins dieser Probleme durch.
Verdi hat für sein 1844 uraufgeführtes eine funkelnde, sprühende Musik geschrieben, die leicht ins Ohr geht, die gefällig daherkommt und mitreißt. Hier ist die Dramaturgie das Problem: Die Vorlage für das Werk lieferte Viktor Hugo mit seinem "Hernani", der, 1830 in Paris uraufgeführt und aufgrund seiner heftigen Publikumsreaktionen, die in der ästhetischen Kontroverse zwischen Klassik und Romantik fußten, mit der "Schlacht um Hernani" in die Theatergeschichte eingegangen ist. Hugos Werk wird heute noch weniger gespielt als Verdis Opern-Adaption.

Verdi hat trotz brillanter Musik leider keine wirklich plastischen Figuren geschaffen, vieles bleibt holzschnittartig und berührt bei weitem nicht so wie die ausgefeilten Charaktere seines Spätwerks. Es fehlt an Raum für Entfaltung - in knapp zweieinhalb Stunden rauscht das Werk am Zuschauer vorbei. Die Geschichte des Banditen Ernani, der in den Wirren von falschen Hochzeitplänen und Intrigen, zwischen Kaiserkrönung und Todesschwur um das Herz von Elvira kämpft fällt leider im Vergleich zu anderen Verdi-Opern ab. Aber nichtsdestotrotz ist der Bonner Abend absolut sehens- und hörenswert und ist ein Plädoyer für das Werk. Das ist zum einen der musikalischen Seite geschuldet, aber auch die Inszenierung von Roland Schwab betont die düstere Seites des Werks und entfaltet so eine mitreißende Dramatik.

Die vier Hauptpartien sind in Bonn exzellent besetzt und es ist ein wahrer Verdi-Genuss, diesen Sängerinnen und Sängern zuzuhören. In der Titelpartie glänzt George Oniani, der sich am Anfang noch etwas zurückhaltend präsentiert, aber schon bald aufblüht und seinen lupenreinen Tenor mit viel Strahlkraft erklingen lässt. Szenisch etwas verhalten konzentriert sich Oniani auf eine feine und sehr wohl timbrierte Stimmführung und vermag rundum zu überzeugen. Als Elvira begeistert Yannick-Muriel Noah. Sie wirft sich mit bemerkenswerter Spielfreude in die Partie und lotet deren Gefühlswelt sehr genau aus. Stimmlich brilliert sie vor allen Dingen in den tiefen Lagen mit lodernden Mezzo-Klängen, formt ihre Töne mal zart, mal kraftvoll. Kritisch wird es einzig, wenn Koloraturen sie kurz in die Höhe peitschen, da wirkt die ansonsten so exakt sitzende Stimme in Nuancen angestrengt und büßt ein wenig ihrer ansonsten vortrefflichen Klangschönheit ein. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau: Noah singt die Partie exzellent.

Als Don Carlos überzeugt Federico Longhi. Was für eine Wucht in der Stimme, welche Majestät! Sonor und kraftvoll gibt er den König und Kaiser, führt seine Stimme mit großer Akkuratesse und wird für seine Leistung mit Bravos belohnt. Etwas chargig kommt der Silva des Pavel Kudinov daher - mal fuchtelnd mit der Krücke, mal leicht grimassierend gibt er den Fiesling. Stimmlich absolut solide, manchmal vielleicht ein wenig verhalten in der Dynamik fügt er sich aber dennoch in ein großartiges Solistenensemble.
Die kleinen Partien werden von Ingrid Bartz (Giovanna), Tae-Hwan Yun (Don Riccardo) und Michael Krinner (Jago) souverän gemeistert. Besonders feiert das Publikum aber Chor und Extrachor des Bonner Hauses, denn diese Klangkörper sind hervorragend disponiert und überzeugen auf ganzer Linie. Marco Medved hat seine Sängerinnen und Sänger auf einen absolut stimmigen Verdi-Klang vorbereitet - zwischen heroischem Pathos und mysteriösem piano glänzt der Chor in seinem sehr umfangreichen Part.

Will Humburg - als ausgewiesener Verdi-Experte - ist eine exzellente Personalie für diesen Abend - peitscht mit flotten Tempi durch den Abend. Teilweise so, dass seine Sängerinnen und Sänger mit Energie aufwenden, um am Ball zu bleiben und gerade der so perfekt klingende Chor hat hier dann eben doch Mühe dem Dirigat zu folgen. Humburg und das Bonner Beethoven-Orchester musizieren einen luftigen, leichten Verdi, der aber nichts an seiner Dramatik einbüßt. Es ist fast schon überraschend, wie locker Humburg in einige Nummern einsteigt, wie walzerseelig er die Dreiertakte nimmt und welch interessanten Kontrast er so zu der Düsternis des Bühnengeschehens liefert.
Roland Schwabs Inszenierung löst das Werk aus dem konkreten historischen Kontext, auch wenn im dritten Akt der Aachener Kaiserthron auf der Bühne steht. Ansonsten bleibt es im Abstrakten. Alfred Peter hat eine Bühne geschaffen, deren bestimmendes Element der ersten zwei Akte ein Scheins kriegszerstörter Kubus ist, der gleichermaßen Elviras heile Welt, aber auch ihr Gefängnis inmitten einer düsteren, sie umgebenden Welt ist. Nach der Pause ist dieser Kubus verschwunden, hier bestimmt nun eine bemerkenswerte atmosphärische Lichtregie (Boris Kahnert) die Szenerie, bevor wir die Grundmauern des Kubus im Finale sehen: Elviras Gefängnis scheint aufgebrochen, doch bleibt dies ob des dramatischen Endes nur der Trugschluss einer offenen heilen Welt – das Dämonische triumphiert.
Am Ende jubelt das Publikum einem famosen Ensemble zu und bedenkt auch das Orchester mit reichlich Bravos. Bei der Regie bleibt etwas verhaltener im Saal. Wer das Werk nicht kennt, der sollte es sich in jedem Fall anschauen und wer es kennt, der darf sich in Bonn auf einen wunderbaren Verdi-Abend freuen.
Sebastian Jacobs, 13.4.22
Die Fotos stammen von Thilo Beu
Rolf Liebermann
Leonore 40/45
Premiere am 10.10.21
So kontrovers und turbulent wie bei der Uraufführung und bei den nachfolgenden Produktionen ging es am Sonntag im Bonner Opernhaus nicht zu – im Gegenteil: Euphorischer Beifall für Sänger und Orchester und spürbare Begeisterung für den Mut des Hauses sich an ein solches Werk zu wagen rissen die Bonner wahrhaft von den Stühlen. Rolf Liebermanns "Leonore 40/45" wurde das letzte Mal 1959 in Oldenburg auf die Bühne gebracht, bevor das Werk in der Versenkung verschwand. Vielleicht war die Zeit damals noch nicht reif, vielleicht die klaffenden gesellschaftlichen Wunden der Nazi-Zeit und des Zweiten Weltkrieges noch zu frisch, als dass man ein Drama, dass die Beziehung eines deutschen Wehrmachtssoldaten zu einer jungen Französin schildert, hätte würdigen wollen und können. Die Aufführungsgeschichte ist daher auch kurz: 1952 hatte das Stück im neutralen Basel seine Uraufführung und wurde danach wenige Male nachgespielt. Immer gleich war die Empörung über das Werk, immer gleich der Unwille sich auf diese Art und Weise mit der Zeit auseinanderzusetzen.

Aber worum geht es eigentlich: Die musikbegeisterte Französin Yvette und der deutsche Oboist Albert lernen sich während des zweiten Weltkriegs in Paris bei einem Konzert kennen und im Anschluss auch lieben. Yvette, der von da an der Makel der Kollaborateurin anhaftet verzweifelt, als Albert weiterziehen muss. Sie fleht ihren Schutzengel Monsieur Emile an, sie wieder zu Albert zu bringen, der nach dem Krieg bei einem Instrumentenbauer in Epernay Arbeit gefunden hat. Sie findet dort dank der glücklichen Hilfestellung des Engels ebenfalls Anstellung als Sekretärin und will ihren Albert nun heiraten. Ein mysteriöses Tribunal versucht dies zu verhindert, muss sich aber hinterher der Einsicht beugen, dass auch ehemalige Feinde sich lieben können. Soweit die - zugegebenermaßen - sehr verknappte Handlung. In Kenntnis dieser, mag man aber verstehen, was das Stück seinerzeit für ein Aufreger war. Heute, rund 70 Jahre später, kann man der universellen Botschaft, die die Abkehr von Gewalt und Krieg fordert und die Liebe als höchstes Gut ansieht nur zustimmen. Letztlichist dieser Gedanke und auch der entscheidende Link zum Titel des Werkes und der Verweis auf Beethovens „Fidelio“ – die Emanzipation über die Gewaltherrschaft zu Gunsten der Liebe.

In Bonn hat Jürgen R. Weber sich des Werkes angenommen und tut mit einer Sache etwas enorm Gutes: Er lässt die Oper in ihrer Zeit. So allgemeingültig die Aussage ist, so konkret ist das Werk eben doch in den 1940/50er Jahren verortet. Webe umrandet die Handlung aber mit einer bissigen, satirischen Ebene, die das Geschehen auf der Bühne mal ergänzt oder kommentiert. Eine große Videowand, die als verzerrter Bilderrahmen vor, der an die windschiefe Guckkastenbühne eines Varietés erinnernden Bühnenaufbau hängt, wird hierzu permanent bedient. Hank Irwin Kittel zeichnet hier für eine herrlich marode wirkende und raffiniert verzerrte Bühne verantwortlich. Das ist manchmal vergnüglich, manchmal aber auch ein wenig viel des Guten. So wird immer wieder der „Circus Hitler“, der auf Europa-Tournee sei als illustrierte Überschrift gewählt, überhaupt sind es immer wieder revuehafte Momente, die das durchaus auch Komische (Liebermann selbst nennt das Werk eine opera semiseria!), bedienen. Der Zuschauer erlebt immer wieder grelle Zerrbilder einer Wirklichkeit, die eine verbindendes Element zwischen ihm und der ansonsten historisch bedingt nicht so einfach zugänglichen Handlung darstellen. Comichaft, überzeichnet und nicht frei von Slapstick entlarvt Weber die Spießigkeiten der Zeit, zeigt auf der anderen Seite aber auch dramaturgische Schwächen des Stücks. Die Figuren bekommen wenig Tiefe, Beziehungen entwickeln sich sehr abrupt und eigentlich ist der Kontext fast das Spannendere als das, was da auf der Bühne passiert.

Der Komponist des Werkes, Rolf Liebermann, war in den 1960er Jahren gerade in seiner Position als Intendant der Hamburgischen Staatsoper (deren Intendant er in den 1980er Jahren ein zweites Mal war), eine treibende Kraft neues Musiktheater auf die Bühne zu bringen. Werke von Henze, Kagel, Menotti und Penderecki erlebten in seiner Ära ihre Uraufführung. So progressiv er im Amt wirkte, so sehr erstaunt dies, wenn man nun seine Oper hört. Liebermann ist dem Dodekaphonen zugewandt, nutzt diese oft als spröde und unsinnlich verurteilte Kompositionsmethode aber in einer sehr weit gefassten Auslegung. Seine Musik klingt nicht selten, als würde sie die Szenerie nur begleiten, gleich einer Filmmusik, die den Hintergrund zum Geschehen liefert. Es ist eine ganz eigene Musik, die trotz einer atonalen Grundhaltung immer wieder in die Gefilde spätromantischer Tonsprache abgleitet, die die Komik nicht scheut, manchmal scheinbar einfach nur dahinplätschert und den Singenden dann doch wieder einiges abverlangt.

Gesungen wird in Bonn auf höchstem Niveau. Allen voran Barbara Senator in der Partie der Yvette und Santiago Sanchez als Albert agieren mit immenser Spielfreude und arbeiten sich mit großer Akuratesse durch die ganz verschiedenen Anforderungen der Partien: Mal große Oper, dann rezitativisch im Parlando, mal lyrisch-melodisch, dann wieder schroff atonal – hier stimmt alles. Joachim Goltz als Schutzengel Monsieur Emile leitet charmant und mit viel Witz durch den Abend und überzeugt auch stimmlich. In kleineren Partien sind Susanne Blattert als Germaine, Pavel Kudinov als Hermann und Martin Tzonev als Musikalienhändler Lejeune exzellente Besetzungen. Auch der Chor überzeugt in seinen wenigen kleinen Einsätzen. Das Beethoven-Orchester ist in dieser Produktion hinter der Bühne postiert, was dem Klangerlebnis einen kleinen Abstrich tut. Daniel Johannes Mayer lenkt die Musiker aber sicher durch die teils knifflige Partitur und schafft – trotz der ungünstigen Positionierung - ein ausgezeichnetes Zusammenspiel zwischen Bühne und Orchester. Mayer zeigt wunderbar, welch effektreiche und teils überraschend klangschöne Musik Liebermann geschrieben hat.

Die Bonner Produktion, die im Kontext des Projekts "Fokus '33" vom Land NRW gefördert wird ist Bestandteil einer Reihe von insgesamt acht Produktionen, die mit teils Bekanntem (wie unlängst mit Strauss „Arabella“) aber auch absoluten Raritäten aufwartet, wie eben der Lierbermannschen „Leonore“. Dem interessierten Opernfreund sei dringend ein Besuch auf der Homepage des Theater Bonn empfohlen, denn hier warten Opern, die man vielleicht lange nicht hat hören können und bei denen es fraglich ist, ob Ihnen ein fester Platz im Repertoire der Häuser beschieden ist: https://www.theater-bonn.de/de/fokus-33. Ergänzt wird das Programm durch Begleitveranstaltungen und im Fall der „Leonore“ ein absolut lesenswertes, umfangreiches Programmheft.
Ob es die „Leonore 40/45“ in der Zukunft leichter hat, wird sich zeigen. Die Bonner Produktion ist jedenfalls ein hoch interessantes Experiment, das zeigt, dass dieses Werk durchaus etwas zu sagen hat. Schwierig ist letztlich die Handlung, denn diese bietet doch allzu viel Bezüge zur Zeit der Entstehung und wirkt heute eher wie ein mehr oder weniger charmanter Blick in die Vergangenheit. Musikalisch ist sie aber in jedem Fall hörenswert und es lohnt die Chance zu nutzen, dieses Werk live zu erleben.
Sebastian Jacobs, 12.1021
Dank für die schönen Bilder an © Thilo Beu
Chicago
Premiere: 29.08.2021
Begeisternder Spielzeitauftakt am Theater Bonn
Zugegeben, im Vorfeld der gestrigen Premiere am Opernhaus Bonn war es schon ein etwas mulmiges Gefühl nach fast genau 1 ½ Jahren erstmals wieder in einem nahezu komplett gefüllten Theatersaal Platz zu nehmen, insbesondere mit dem Hintergedanken, dass die Corona-Schnelltests nicht wirklich überzeugen können, wenn man sich nur mal näher anschaut, wie einige (natürlich nicht alle) Teststellen diese Tests durchführen. Schöner wäre hier angesichts der hohen Inzidenzwerte im Land wohl eine 2G-Reglung oder eine 3G-Regelung mit entsprechend sicheren PCR-Tests, aber diese Entscheidung liegt im Ermessen der Landesregierung, dem Theater Bonn ist hier also kein Vorwurf zu machen. Im Gegenteil, die Überprüfung der Daten beim Einlass war sehr vorbildlich. Doch damit genug der persönlichen Vorworte und vor allem genug zum Thema Corona, welches uns nun über die letzten Monate überall begleitet hat. Vorhang auf für die neue Spielzeit am Theater Bonn, die am 29. August 2021 mit dem Musical Chicago fulminant eingeläutet wurde.

Auch wenn die Uraufführung im Juni 1975 in New York zunächst noch verhalten aufgenommen wurde, sollte spätestens das Revival aus dem Jahr 1996 dem Musical Chicago zu großem Ruhm verhelfen. Insgesamt gewann diese Produktion sechs der renommierten Tony Awards. Die Verfilmung aus dem Jahr 2002 unter der Regie von Rob Marshall in der u. a. Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones und Richard Gere mitwirkten gewann sechs Oscars bei dreizehn Nominierungen und wurde ein weltweiter Erfolg. Grund hierfür ist nicht zuletzt auch die schwungvolle Musik von John Kander, die in Bonn von einer großen Band unter der musikalischen Leitung von Jürgen Grimm erstklassig wiedergegeben wurde. Hierbei nehmen die Musiker rechts und links auf der Bühne Platz, ganz so, wie man es von einer großen Big Band in alten TV-Shows gewohnt ist. Doch vorab kurz zur Story des Musicals. Erzählt wird die Geschichte der Nachtclubsängerin Roxie Hart, die ihren Geliebten Fred Casely kaltblütig erschießt, da er ihrer Karriere nicht wie erhofft zuträglich ist. Im Gegenteil, um Roxie ins Bett zu bekommen, hatte er seine Beziehungen ins Show-Business nur vorgetäuscht. Im Gefängnis trifft Roxie auf Velma Kelly, eine bekannte Vaudeville-Sängerin, die ebenfalls zur Mörderin wurde, nachdem sie ihren Mann mit ihrer Schwester in flagranti erwischte. Hier im Frauenblock des Cook Country Gefängnis hält Mama Morton die Fäden in der Hand und organisiert gegen gute Bezahlung so ziemlich alles. Sie war es auch, die Velma als "Top Mörderin der Woche" zum Medienstar machte. Großen Anteil hieran hatte und hat auch der charismatische Staranwalt Billy Flynn, der sich nun auch der Geschichte von Roxie Hart annimmt. Es entbrennt eine große Rivalität um die größere Medienaufmerksamkeit der beiden Mörderinnen, da die großen Zeitungen, stets gierig nach den neuesten Sensationen, bereitwillig die von Billy Flynn frei erfundenen tragischen Geschichten abdrucken. Hierbei schreckt er auch nicht davor zurück, Roxies Ehemann Amos, der seine kaltblütige Gattin noch immer liebt, in seine eigene "Wahrheit" zu integrieren.

In Zeiten, in denen die BILD in Deutschland einen eigenen Fernsehsender startet, vielleicht ein ganz passendes Musical, welches von Regisseur Gil Mehmert mit schönem Witz umgesetzt wurde. Kleiner Spoileralarm, auch der gute „Uncle Sam“ wird in dieser Inszenierung entlarvt werden. Die Autoren Fred Ebb und Bob Fosse entwickelten das Musical 1975 bereits als eine Abfolge von Varieté-Nummern, einen Aspekt den Mehmert in seiner Regie besonders würdigt und der Geschichte so einen gelungenen Rahmen setzt. Durch diese Inszenierung gelingt es, dass nahezu alle Songs gut zur Geltung kommen und fast wie in einem Varieté-Programm ein Highlight das nächste jagt. Die Bühne von Jens Kilian ist hierbei dank einer zentralen Drehscheibe zweckdienlich und mit einer großen Showtreppe zudem nett anzusehen. Vorteil hierbei auch, dass der Abend ohne größere Umbauten flüssig abläuft. Nett anzusehen sind auch die vielen prächtigen Kostüme von Falk Bauer und die wunderbaren Choreografien von Jonathan Huor.

Großen Respekt muss man dem Theater Bonn für die Auswahl der Besetzung zollen, bis in die letzte Rolle bringt das Ensemble eine ebenso sehens- wie auch hörenswerte Vorstellung auf die Bühne. Der gleiche Respekt gebührt den Darstellern selbst, denen man die Spielfreunde nach monatelangem Stillstand förmlich ansieht. Als mörderisches Duo stehen in Bonn Bettina Mönch als Velma Kelly und Elisabeth Hübert als Roxie Hart auf der Bühne, die Gefängnisaufseherin Mamma Morton wird von Dionne Wudu verkörpert. Ein Genuss den drei Damen rund 2 ½ Stunden zuzuhören. Wie Anton Zetterholm dem Anwalt Billy Flynn immer wieder eine besondere Mimik gibt, selbst wenn er nur als beobachtende Person am Bühnenrand steht, ist wirklich spannend zu beobachten. Enrico de Pieri verkörpert den armen Amos Hart so, dass man permanent Mitleid mit ihm hat. Und dann wird ihm auch noch im Gegensatz Velma Kelly oder Billy Flynn seine Abtrittsmusik verwehrt, so dass er lieber seitlich von der Bühne schleicht, statt die große Showtreppe zu benutzen. Erfahren in der Darstellung der Mary Sunshine ist Victor Petersen, der diese Rolle bereits mehrfach übernahm und dem es auch in Bonn wieder gelingt, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Zu Beginn der Vorstellung gleich nach „All that Jazz“ hat man sich noch gefragt, ob dies vielleicht in all den vielen Jahren als Theaterbesucher eine der lautesten Beifallsbekundungen nach einer ersten Nummer war und alle Zuschauer froh sind, dass es wieder losgeht oder ob man einen solchen Beifall einfach nur nicht mehr gewohnt ist. Im Laufe des Abends wurde der Applaus aber nicht leiser und nach einem langen und verdienten Schlussapplaus war klar, dass dem Theater Bonn hier ein großer Erfolg gelungen ist. Auch die Darsteller schienen allesamt sichtlich gerührt und am Ende des Abends steht die Erkenntnis, dass man einen solchen Abend viel zu lange vermisst hat.
Markus Lamers, 30.08.2021
Fotos: © Thilo Beu
Theater Bonn - Spielplan Oper 2021/22
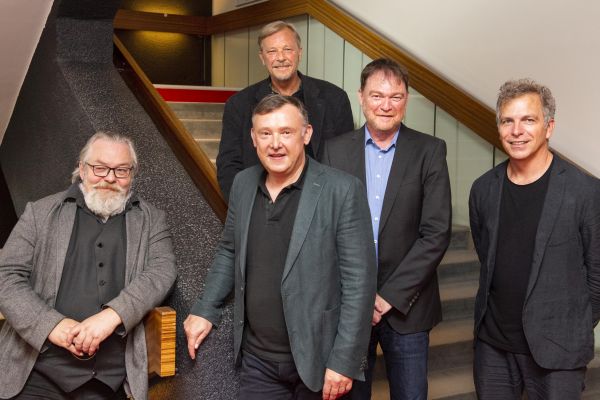
Kurz bevor das Theater Bonn am morgigen Sonntag mit der Premiere des Musicals „Chicago“ in die neue Spielzeit startet, wurde nun auch der komplette Opernspielplan für die kommenden Monate veröffentlicht. Bisher standen neben dem Musicalklassiker von John Kander und Fred Ebb bekanntlich nur die der Opernklassiker „Arabella“ von Richard Strauss und das selten gespielte Werk „Leonore 40/45“ von Rolf Liebermann fest. Doch während der letzten Monate waren hinter den Kulissen viele Menschen aktiv und produktiv, so dass etliche Produktionen im Schauspiel und in der Oper zur Aufführung bereitstehen, weiß Generalintendant Dr. Bernhard Helmich zu berichten. Im Musiktheater, bei dem ein Schwerpunkt auf Werken des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts liegen wird, sind hierbei die folgenden Produktionen geplant:
CHICAGO
Musical von John Kander und Fred Ebb
Premiere: 29. August 2021
Inszenierung: Gil Mehmert
ARABELLA
Oper von Richard Strauss
Premiere: 02. Oktober 2021
Inszenierung: Marco Arturo Marelli
LEONORE 40/45
Oper von Rolf Liebermann
Premiere: 10. Oktober 2021
Inszenierung: Jürgen R. Weber
LA CENERENTOLA
Oper von Gioachino Rossini
Premiere: 07. November 2021
Inszenierung: Leo Muscato
HÄNSEL UND GRETEL
Oper von Engelbert Humperdinck
Premiere: 13. November 2021
Inszenierung: Momme Hinrichs (fett-Film)
DON CARLO
Oper von Giuseppe Verdi
Premiere: 12. Dezember 2021
Inszenierung: Mark Daniel Hirsch
IWEIN LÖWENRITTER (Junge Oper Rhein-Ruhr)
Oper von Moritz Eggert
Premiere: 30. Januar 2022
Inszenierung: Aron Stiehl
EIN FELDLAGER IN SCHLESIEN
Singspiel von Giacomo Meyerbeer
Premiere: 13. März 2022
Inszenierung: Jakob Peters-Messer
ERNANI
Oper von Giuseppe Verdi
Premiere: 10. April 2022
Inszenierung: Roland Schwab
LI-TAI-PE
Oper von Clemens von Franckenstein
Premiere: 22. Mai 2022
Inszenierung: Adriana Altaras
Darüber hinaus stehen mit „Die Feldermaus“ ab 06. Februar 2022 und „Don Giovanni“ ab 30. April 2022 zwei Wiederaufnahmen auf dem Spielplan der neuen Spielzeit. Insgesamt ein ausgesprochen spannendes Programm, auf das sich die Opernfreunde in Bonn freuen dürfen.
Markus Lamers, 28.08.2021
Foto: © Thilo Beu
„Staatstheater“
Mauricio Kagel
Premiere: 13.09.2020
Besuchte Vorstellung: 27.09.2020
Eine Oper für diese Zeiten
Nichts gegen Mauricio Kagel. Er ist sicherlich einer der ganz großen Revolutionäre im Bereich der Neuen Musik und hat mit seinen Werken Maßstäbe gesetzt. 1971 wurde an der Hamburgischen Staatsoper sein „Staatstheater“ uraufgeführt, ein Werk, dass jegliche Grenzen eines normalen Opernabends sprengen sollte. Keine Handlung, kein (verständliches) Libretto, dafür aber bis ins kleinste Detail in der Partitur vermerkte Abläufe, Bewegungen, ja, sogar selbst entwickelte Instrumente. Eine präzise Monstrosität für den ganzen Theaterapparat, bei der dem Komponisten klar war, dass es niemals eine komplett umfassende Aufführung wird geben können. Aber das muss auch nicht sein, denn das, was das Werk stark macht ist das Sezieren der Oper an sich und des dahinterstehenden Betriebs. Das Theater wird bis auf die Knochen abgenagt und neu sortiert - eigentlich spannend. Gerade in diesen absurden Zeiten, in denen ein vor einem Jahr noch beinahe unbekannter Virus uns mühelos aufzeigt, in welch paradiesischen Zeiten wir gelebt haben, der in unser tägliches Leben so massiv eingreift und der gerade die Theater und vor allem die Opernhäuser so hart getroffen hat. Da scheint Kagels „Staatstheater“ dessen so simpler Titel doch so viel bedeuten kann, der Soundtrack zur Zeit zu sein. Absurditäten finden in der Partitur statt, weil der Komponist es will, aber auch der Bühne, wo behördliche Gesundheitsvorgaben es erzwingen und geben dem Titel eine weitere Dimension. Wer macht hier Theater? Das Werk an sich? Der Komponist? Ein Virus? Der Staat, der uns mittels gravierender Vorgaben vor dem Virus schützen will?
Aus der Not wird in Bonn eine Tugend: Der Absurdität des Werkes geben die Maßnahmen des Hygienekonzeptes eine weitere Dimension. Eine kleine, auf rollbaren Paletten montierte Orchesterbesetzung löst bekannte Strukturen auf und kann so immer Abstand halten. Dabei musizieren die sieben Musiker des Beethoven-Orchesters (in der Besetzung Violine, Viola, Cello, Flöte, Horn, Tuba und Schlagwerk), teilweise durch Plexiglas abgeschirmt, unter der Leitung von Daniel Johannes Meyer mit unglaublichem Verve und Einsatz. Jedem Sänger zugeordnete kleine Plastikgreifarme ermöglichen das virusfreie Übergeben von Requisiten und zeigen ein erschreckendes Bild menschlicher Nähe, wenn die Protagonisten mit diesen Greifern versuchen sich bei der Hand zu nehmen. Und natürlich der Mundschutz – ja, auch ohne diesen geht es auf der Bühne nicht. Wären diese Maßnahmen aus unserem alltäglichen Leben nicht bekannt – man würde über die Skurrilität der Szenerie staunen.
Regisseur Jürgen R. Weber wiederum schafft es aus dem Staatstheater ein Stadttheater zu machen und stülpt Kagels Klang- und Bildermaschinerie eine so platte, wie gezwungene Handlung über. Da kämpfen dann – wie es auf lokalpolitischer Ebene schon mal üblich ist – Sport und Kultur um ihren Erhalt und die Steuermillionen. In Bonn wurden diese beiden wichtigen Pole öffentlichen Lebens bereits auch schon gegeneinander ausgespielt. Weber erfindet nun Rollen wie „Die Intendantin“, die, hinreißend gespielt von Yannick-Muriel Noah, in roter Festrobe zeigt, wie fein nuanciert man die so brachiale Musik Kagels musizieren kann. Ihr Widerpart ist – ja, und da schüttelt man den Kopf – der „Oberbademeister“. In den durch die Bank weg großartigen Kostümen Kristopher Kempfs zeigt dieser Oberbademeister (Tobias Schabel) in neonfarbener Badebekleidung wo der Hammer hängt. Die Regie müht sich hier redlich ab, Bilder zu erschaffen, Handlung zu produzieren und lässt dann den Bademeister im überdimensionierten Papierbötchen mit Schlagzeilen der Bonner Lokalpresse zu genanntem Konflikt mit der Intendantin in den Kampf ziehen. Dazwischen – wir sind ja in Bonn – darf Beethoven natürlich nicht fehlen und die eingangs noch zerstörte Beethovenbüste, wird am Ende doch wieder geflickt und alle haben sich lieb. Ja, das ist schon arg platt und man mag die Verzweiflung eines Regisseurs verstehen, wer sich mit diesem Konvolut an Anweisungen und Klängen konfrontiert sieht, die scheinbar ins Nichts führen, aber dennoch – diese Story ist an den Haaren herbeigezogen.
Aber dennoch macht der Abend Laune und dies liegt an allen Beteiligten. Der Jugendchor des Theaters zeigt sein szenisches Können und allen Solisten scheint man die unbändige Freude anzumerken, wieder auf einer Bühne stehen zu können. Wenn man etwas als einen spürbaren, aber dennoch gelungenen Kraftakt betrachten will, dann ist es dieser Abend. Angst vor Neuer Musik ist hier unangebracht, denn die Musik Kagels ist so bunt und abwechslungsreich, die Sänger spielen mit einer Freude und einer Begeisterung, wie man es lange nicht erlebt hat.
Ja, auch das ist Corona: erst der Verlust des Gewohnten zeigt uns, wie wichtig uns etwas ist und lässt neues Entstehen. Und auch das ist „Staatstheater“ – erst der Verlust des Gewohnten lässt uns Neues entdecken und Oper vielleicht auch neu denken.
Sebastian Jacobs, 28.09.2020
(Bilder siehe unten)
STAATSTHEATER
12.09.2020 - Voraufführung
Manahmanah - Ditdibidibi
Was für ein wunderschöner Abend!!!
Diese Farben! Diese Kostüme! Das Bühnenbild!
Und gesungen haben sie, als wenn es sich um Mozart gehandelt hätte!
Egal was man sich in Bonn anschaut, es ist immer traumhaft schön! - Und zwar unabhängig davon, ob es zum Stück passt, oder nicht.
Aus zwei Gründen lag es nahe, ein Stück von Kagel im Beethoven-Jahr 2020 in Bonn auf die Bühne zu bringen: Ebenso wie Beethoven war auch Kagel ein großer Neuerer, der genau wie der berühmte Sohn der Stadt eigene und neue Maßstäbe im Bereich der Musik/des Musiktheaters gesetzt hat. Und außerdem hatte Kagel mit seinem neunzigminütigen Schwarzweiß-Film Ludwig van zum 200. Geburtstag Ludwig van Beethovens (Ausstrahlung 1970) Beethoven in seine Heimatstadt, Bonn in den 1960er Jahren zurück geholt, und ihn durch die Stadt und sein Geburtshaus wandern lassen.

Mauricio Raúl Kagel (* 1931 Buenos Aires, + 2008 Köln) gilt als der wichtigste Vertreter des „Instrumentalen Theaters“, einer Art ritualisierten Konzert-Akts, in den auch die sichtbaren Begleiterscheinungen des Musizierens (Mimik, Gestik, Aktionen) mit einbezogen werden. Er leistete einen wichtigen Beitrag zur Neuen Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Verwendung von Elektronik und Tonbandzuspiel, aber auch Verweise auf traditionelle Musik, waren für den Kosmos von Kagels Musik selbstverständlich.
Als eindrucksvollstes Beispiel seiner Musiktheaterwerke ist das 1971 in der Hamburgischen Staatsoper uraufgeführte Werk Staatstheater, das aufgrund von Drohbriefen unter Polizeischutz aufgeführt werden musste. Eine Aktionsgemeinschaft junger Freunde deutscher Opernkunst hatte mit einer Bombe gedroht, falls das Stück zur Aufführung käme.
In seiner 500 Seiten starken Partitur des 110 minütigen Stückes, zu der Kagel drei Jahre lang das Material auf Karteikarten sammelte, hat er nicht nur mit Klängen und Geräuschen, sondern mit allen Bühnenmitteln wie Figuren, Dekorationen, Requisiten, Beleuchtung sowie mit Bewegungsabläufen von Personen und Gegenständen komponiert.
Kagels für freie Aktionen notierte Partitur besteht aus den neun Teilen: „Repertoire. Szenisches Konzertstück“, „Einspielungen. Musik für Lautsprecher“, „Ensemble für 16 Stimmen“, „Debüt für 60 Stimmen“, „Saison. Sing-Spiel in 65 Bildern“, „Spielplan. Instrumentalmusik in Aktion“, „Kontra –> Danse“, „Freifahrt. Gleitende Kammermusik“ und „Parkett. Konzertante Massenszenen“.

Staatstheater ist der Versuch, das traditionelle Reservoir an Gesten und Gängen, an Mimik, Interieur und Haltungen zu analysieren. Dabei besteht Repertoire. Szenisches Konzertstück aus 100 oft nur sekundenlangen Aktionen (Kagel: Das Avancierteste, was ich je geschrieben habe). Später betreten Sänger die Bühne und singen Unverständliches. Mana Ana Nanan, Nama, Mana Takapu oder Pong Ping Sching, Xon Tschin Xing oder Za Za Pum Zaza, Za Za Za Za Za. Kagel hat in seinem Staatstheater die Sprache abgeschafft.
Von Heinz Josef Herbort 1971 noch als eines der wichtigsten Werke des musikalischen Theaters der Nachkriegszeit, eines der notwendigsten vor allem eingeschätzt, wird das Werk von Kagel, das seinerzeit zu einem veritablen Theaterskandal geführt hatte, in Bonn systematisch zu Pischipaschi-Kacke verarbeitet und zur völligen Bedeutungslosigkeit reduziert.
Den Schwimmbädern der Stadt droht die Schließung. Bonn feiert das Beethoven-Jahr. Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Aus diesen drei Bausteinen erschafft der Regisseur Jürgen R. Weber Welten, in denen sehr viel Wasser, ein angezogenes Beethoven- und ein nackiges Frauenpüppchen und Abstandsgreifer sowie Mundschutze zentrale Elemente sind. Am Ende werden die beiden Püppchen sogar zerschnitten! Der mutig zu Beginn der Aufführung zerschlagene Beethoven-Kopf wird jedoch kurz vor dem Ende wieder zusammen geklebt. - Ganz so weit wollte man offensichtlich doch nicht gehen...
Von den vielhundert Instrumenten, die Kagel eigens für dieses Stück entworfen hat, ist in Bonn nichts zu sehen. Ein paar Metronome und mit Steinchen gefüllte Styroporkugeln, die von einer ans Triadische Ballett erinnernden Personengruppe vorgeführt werden, die auf einer Hubbühne erscheint, müssen reichen. Zu ihnen gehört auch der berühmte Trommelmann, als einzige Reminiszenz an Kagels Ursprungsidee.

Solisten betreten die Bühne in traditionellen Rollenkostümen, ohne jedoch singen zu dürfen. In dieser Inszenierung sind es Kostüme des Kindertheaters, die den infantilen Eindruck der Inszenierung noch unterstreichen.
Neben den Einspielungen vom Band erleben wir drei Streicher und drei Bläser. Jedoch nicht alle Kratzgeräusche stammen von den Streichern auf der Bühne. Eines dieser Geräusche war sicherlich Kagel selbst, der sich im Grabe herum gedreht hat. Wollte er damals mit seinem Theateropus den Theaterbetrieb verunsichern und das Publikum schockieren, war hier eine Teletabbisierung des Kulturbetriebs zu erleben. Freisprachliche Vokalisen werden zu vorsprachlichem Kleinkindgebrabbel umgedeutet und virtuos ausgesungen. Einzelne Szenen klingen wie das bekannte Manahmanah - Ditdibidibi aus der Muppetshow. Es wirkt alles durchgehend albern. Ob es sich hier wirklich um Staatstheater handelt, das uns hier vorgeführt wird, oder doch nur um Kleinstadttheater, mag jeder für sich selbst entscheiden.
Mit etwas mehr als 1 1/2 Stunden ein bunter und kurzweiliger Abend für die gesamte Familie, jenseits jeder Provokation. Interessierten sei der angstfreie Besuch der Veranstaltung nachdrücklich empfohlen. Mit so etwas lockt man keinen Bombenbauer mehr hinter dem Ofen hervor.
Ingo Hamacher 13.08.2020
Bilder (c) Thilo Beu
Credits
Besetzung
Yannick-Muriel Noah, Marie Heeschen, Giorgos Kanaris, Tobis Schabel, Kieran Carrel, Anjara I Bartz, Ludwig Grubert, Jugendchor des Theater Bonn, Beethoven Orchester Bonn.
Musikalische Leitung: Daniel Johannes Mayr
Inszenierung: Jürgen R. Weber
Bühne: Hank Irwin Kittel
Kostüme: Kristopher Kempf
Licht: Friedel Grass
Einstudierung Jugendchor: Ekaterina Klewitz
Zum Zweiten
Manfred Trojahn: Ein Brief (Uraufführung)
Ludwig van Beethoven: Christus an Ölberg
Premiere: 8. Februar 2020
Zum Beethoven-Jubiläum beschäftigt sich die Oper Bonn intensiv mit dem größten Sohn der Stadt. Nach der Fidelio-Neuinszenierung von Volker Lösch kommt jetzt schon die zweite Premiere heraus. Da Beethoven keine weiteren Opern komponiert hat, gibt es nun eine szenische Umsetzung des Oratoriums „Christus am Ölberg“. Als Prolog beginnt der Abend mit der Uraufführung von Manfred Trojahns „Ein Brief“.
Manfred Trojahn nennt sein gut vierzigminütiges Stück eine „reflexive Szene“. Naheliegend wäre eine Vertonung des „Heiligenstädter Testaments“, stattdessen greift Trojahn auf den fiktiven Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal zurück. Der Schreiber entschuldigt sich hier für das Ausbleiben weiterer literarischer Tätigkeiten und äußert abschließend Zweifel, ob die ihm die bekannten Sprachen das ausdrücken können, was er sagen möchte. Bariton Holger Falk, der in Frankfurt die Titelpartie in Trojahns „Enrico“ sang, gestaltet den Chandos mit leichtem und sauber geführtem Bariton
Trojahn hat den Text sehr feinsinnig und kammermusikalisch komponiert, schließlich werden viele Abschnitte nur vom Streichquartett begleitet. Immer wieder setzt er kluge Pausen, die das nach Worten-Suchen des Erzählers deutlich machen. Klangliche Höhepunkte setzt Trojahn nur sehr sparsam ein und oft fragt man sich, ob dieses Stück überhaupt ein großes Orchester benötigt? Auf der großen Bonner Bühne verpufft viel von der intimen Wirkung der Musik. Vielleicht würde dieses Stück als Kammeroper in einem kleinen Saal, gekoppelt mit einer anderen Solo-Oper wie Poulencs „Die menschliche Stimme“ oder Rihms „Proserpina“, viel besser zur Geltung kommen.
Regisseurin und Bühnenbildnerin Reinhild Hoffmann ist zu diesem Stück wenig eingefallen. Der Erzähler steht, sitzt, läuft umher. Zu einer Verdichtung der Spannung kommt es nur in den Momenten, in denen auf den großen gebogenen Rückwänden und auf den aufgeschlagenen Seiten eines großen Buches, welches das zentrale Bühnenbildelement ist, Gemälde projiziert werden und ineinander überblenden.
In „Christus am Ölberg“ kann die Regisseurin, die eigentlich vom Tanz kommt, ihre Kunst dann wesentlich besser entfalten. Die drei Gesangssolisten stehen im Zentrum, werden von je fünf Tänzerinnen und Tänzern des Folkwang-Tanzstudios choreografisch begleitet, welche eine kraftvolle Ausstrahlung besitzen, während der Chor weitgehend im Hintergrund oder am Rand der Bühne bleibt. Reinhild Hoffmanns Choreografie ist streng gehalten, meist wird synchron getanzt. Die Regie versteht es das Stück klug zu bebildern, ohne dabei platt oder kitschig zu werden.
Sängerisch herausragend interpretiert Kai Kluge die Jesus-Partie. Er besitzt einen schön gefärbten runden Tenor und singt seine Rolle mit einem Maximum an Textverständlichkeit. Diesen Sänger würde man gerne als Interpreten von Schubert-Liedern erleben. Mit klarem und hellem Sopran singt Ilse Eerens den Seraph, der ebenso wie die Tänzer dem Buch entsteigen, das schon in „Ein Brief“ im optischen Zentrum des Geschehens lag oder stand.
Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan kitzelt aus Beethoven Oratorium das dramatische Potenzial heraus. Starke Kontraste und Akzente machen diese Kirchenmusik tatsächlich zum Musikdrama. Trojahns „Ein Brief“ dirigiert er mit viel Gespür für die Feinheiten der Musik. Dennoch: „Ein Brief“ hat nichts mit Beethoven und seinem Oratorium „Christus am Ölberg“ zu tun und ist hier überflüssig.
Die Oper Bonn setzt ihre Reihe zum Beethoven-Jahr mit weiteren interessanten Werken fort: Von Mauricio Kagel, der einst die „Ludwig van“-Collage entwickelte, gibt es das selten gespielte „Staatstheater“ (25. April). In der nächsten Spielzeit folgt Rolf Liebermanns moderner „Fidelio“ in Form von „Leonore 40/45“ (13. September), und Param Vir schreibt „Awakening“ (13.Dezember) über eine buddhistische Friedens- und Freiheitslehre.
Rudolph Hermes, 25.2.2020
Bilder siehe unten!
EIN BRIEF / CHRISTUS AM ÖLBERGE
Besuchte Vorstellung: Premiere am 8.2.20
Lebhafter Beifall im nahezu ausverkauften Haus für einen Abend in Festspielqualität mit dem Beethovenorchester unter Dirk Kaftan und dem Bonner Opernchor und Extrachor unter Marco Medved mit der Welturaufführung „Ein Brief“ von Manfred Trojahn und Beethovens Oratorium „Christus am Ölberge“.
Eigentlich sollte Manfred Trojahn als Einleitung zu Beethovens „Christus am Ölberge“ das „Heiligenstädter Testament“ vertonen, denn Beethovens einziges Oratorium ist mit der Aufführungsdauer von einer knappen Stunde allein zu kurz für einen Opernabend. Es wurde bei seiner Uraufführung am 5. April 1803 im Theater an der Wien mit Beethovens drittem Klavierkonzert und seinen ersten beiden Sinfonien kombiniert.
Diesmal stellt Dirk Kaftan dem Oratorium eine Welturaufführung voran, die reflexive Szene „Ein Brief“, Auftragskomposition der Oper Bonn von Manfred Trojahn, die eine vergleichbare persönliche Krise thematisiert. Die sehr aufwändige Produktion wurde gefördert aus den Mitteln der BTHVN2020-Projektgesellschaft. Sie wird übrigens am 29. Februar 2020 im Theater an der Wien konzertant aufgeführt.

„Warum wird dieses Oratorium nicht häufiger gespielt?“ so fragt der junge Tenor Kai Kluge bei der Premierenfeier: „Christus wird hier so wunderbar menschlich dargestellt!“ Die Frage beantwortet der Intendant in seiner Laudatio: die Partie des Christus erfordert einen lyrischen Tenor mit Anlagen zum Spinto-Fach, der in der Lage ist, die Zerrissenheit des mit der Erlösung der Menschheit nahezu überforderten Menschen Christus adäquat auszudrücken. Kluge hat dies mit seinem unfassbar schönen lyrischen Tenor in anrührender Weise geleistet.
Auch die von Ilse Eerens mit erlesenem lyrischem Koloratursopran gestaltete Partie des Seraphen stellt enorme Anforderungen, ganz abgesehen von der Chorpartie drei verschiedenen Männerchören, die absolut professionelle Sänger verlangt.
Zu Beethovens Zeit war man außerdem mit der Darstellung Christi als leidenden Menschen aus Fleisch und Blut und dem Bruch mit den Konventionen des Oratoriums offenbar überfordert. „Christus als Sohn Gottes und als Menschen aufzufassen bedeutete für nicht wenige Gläubige im frühen 19. Jahrhundert eine theologische Verwirrung; seine menschliche Seite dann auch noch szenisch darzustellen war ganz einfach Blasphemie“, so der Beethoven-Biograph Jan Cayers, zitiert im Programmheft. „Jeder Ton spricht von der Betroffenheit des Komponisten. Denn das Oratorium handelt auch von Beethoven selbst, der tief berührt war von den Parallelen zwischen dieser Christus-Geschichte und seinem eigenen Schicksal“, so Cayers.
Beethoven wäre nicht Beethoven, wenn er nicht mit einem Handstreich die Gattung Oratorium neu definiert hätte. Es gibt – im Gegensatz zu den damals bekannten Oratorien Haydns und Händels – keinen Evangelisten und keinen durchgehenden Bibeltext als Grundlage. Das Libretto stammt vom Wiener Literaten Franz Xaver Huber (1760-1810), der Matthäus 26, 36-56, Markus 14, 32-52, Lukas 22, 39-53, Johannes 17 und Johannes 18, 1-11 einbezieht. Die Passionsgeschichte wird auf die Reflektion des bevorstehenden Opfertods Christi und die dramatische Ergreifung reduziert.

Direkt nach der Ouvertüre drückt Kai Kluge als Christus in der großen Arie: „Meine Seele ist erschüttert von den Qualen, die mir dräu´n …“ seine menschlichen Ängste angesichts der Überforderung, durch seinen Opfertod am Kreuz die Menschheit zu retten aus: „… nimm den Leidenskelch von mir“. Ausgesprochen beeindruckend ist die Szene, in der der Seraph auf einem aus den Körpern einiger Tänzer geformten Podest, gestützt von zwei Tänzerinnen, die Arie „Preist des Erlösers Güte …“ singt.
Das Duett Seraph / Christus: „Groß sind die Qual, die Angst, die Schrecken, die Gottes Hand auf mich/ihn ergießt, doch größer noch sind meine/seine Liebe, mit der mein/sein Herz die Welt umschließt“, kann als Essenz des christlichen Erlösungsmythos gesehen werden.
Danach überschlagen sich die dramatischen Ereignisse: der Chor der Krieger, die Christus suchen und ergreifen, der Versuch des Petrus, „In meinen Adern wühlen gerechter Zorn und Wut“, Jesus Christus zu retten, der Abschluss „… bald ist gänzlich überwunden und besiegt der Hölle Macht“ mit dem triumphierenden Chor der Engel ist ganz großes Musikdrama und verlangt nach einer szenischen Realisation.
Hier kommen die zehn hervorragenden Tänzerinnen des Folkwang Tanzstudios in der Choreographie von Reinhild Hoffmann ins Spiel, die das Oratorium szenisch interpretieren und dabei auch den Chor in seinen Bewegungen einbeziehen. Während sie am Anfang eher im Hintergrund bleiben gestalten sie zusammen mit dem Chor eine hochdramatische Verhaftungsszene.
John Neumeier hat in Hamburg vorgemacht, wie man Bachs Oratorien tanzen kann, aber hier steht eindeutig die Musik Beethovens im Vordergrund, gesungen von den drei hochkarätigen Solisten Kai Kluge als Christus, Ilse Eerens als Seraph und Seokhoon Moon als Petrus, dem von Marco Medved bestens einstudierten Chor und Extrachor der Oper Bonn und begleitet vom Beethoven-Orchester unter Dirk Kaftan. Das Bewegungstheater hat hier eindeutig dienende Funktion.

Die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer mit langen japanischen Hakamas, einer Art weite Hosenröcke für die Tänzer, Petrus und Christus, Brustpanzer und Helmen für die Krieger, einem strahlend blauen Samtkleid für den Seraph und Alltagskleidung in Grau-Tönen für den Chor stellen einen zeitlosen Bezug her.
Wichtiges Bühnenelement ist das Buch, etwa 2 m breit und 3 m hoch, aus dessen Seiten Seraph und Petrus erscheinen. Es liegt zu Beginn geschlossen auf der Bühne, wird dann aber von den Tänzerinnen und Tänzern aufgerichtet und aufgeblättert.
Ein Satz aus dem Heiligenstädter Testament wird übrigens zur Ouvertüre eingeblendet: „Dauernd hoffe ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen“, und ein weiterer Auszug wird vor dem triumphierenden Schlusschor „Welten singen Dank und Ehre dem erhab´nen Gottessohn…“ von Holger Falk gelesen.
Im so genannten „Chandos-Brief“ formuliert Hugo von Hofmannsthal 1902 den Verlust seiner Fähigkeit, mit Sprache, vor allem mit Lyrik, seine Gefühle auszudrücken und die Welt zu beschreiben. Der Komponist Manfred Trojahn hat diesen zentralen Text zur Sprachkrise des 20. Jahrhunderts vertont.
Es sind drei Zeitebenen, die Schmidt-Futterer auch im Kostüm verdeutlicht: nämlich der Autor Hugo von Hofmannsthal am Beginn des 20. Jahrhunderts im schwarzen Anzug, der sich außer Stande sieht, weiter Lyrik zu schreiben, der fiktive Autor Lord Chandos mit einem Renaissance-Wams, der im 17. Jahrhundert an seinen älteren Freund Francis Bacon eine Brief über eine eben solche Krise schreibt und der Sänger, der heute auf der Bühne steht und die Gefühle der Kunstfigur zum Ausdruck bringt.
Die szenische Umsetzung ist denkbar schlicht, abgesehen von dem liegenden Buch mit einem purpurnen Leseband, das von Chandos auch mal aufgeklappt wird, hereingewehten Blättern, der Projektion barocker Aktgemälde und Licht- und Schatteneffekten steht der Sänger die ganzen 40 Minuten alleine auf der Bühne.
Trojahn hat den Monolog weitgehend kammermusikalisch instrumentiert, macht aber auch in Form von schrillen Einwürfen vom großen Orchester Gebrauch. Die Textverständlichkeit ist hervorragend, weil Trojahn die Singstimme, die am Schluss in einer kritischen Phase zur Sprechstimme wird, nie zudeckt. Das Streichquartett der Stimmführer des Beethovenorchesters, das in wesentlichen Phasen den Gesang begleitet, wird vom Intendanten bei der Premierenfeier ganz besonders gelobt. Das Beethoven-Orchester zeigt unter der straffen Leitung seines GMD Dirk Kaftan in beeindruckender Weise, dass es auch Musik der Zeit interpretieren kann.
Inhaltlich ist der Text sehr anspruchsvoll, er erinnert in seinen Metaphern an den Monolog der Klytämnestra „Ich habe keine guten Nächte …“ aus „Elektra“, dem Theaterstück Hugo von Hofmannsthals, das Richard Strauss vertonte. Tatsächlich hat Hofmannsthal kurz nach dem Chandos-Brief die Kooperation mit Richard Strauss begonnen, mit dem er unter anderem „Elektra“, den „Rosenkavalier“, „Arabella“, „Ariadne auf Naxos“ und „Die Frau ohne Schatten“ schuf, Lyrik hat er nie wieder publiziert.
Vor allem Germanisten, die mit der literarischen Vorlage vertraut sind, bemerken, dass die Erweiterung durch Trojahns Vertonung und durch die szenische Realisierung im Bühnenbild und in der Personenführung von Reinhild Hoffmann die Aussagen schärft und besser verständlich macht. „Ich sehe diesen Menschen vor mir, wie er sich windet, um in diesen verschnörkelten, hochkomplexen Wortkaskaden sein Problem zu formulieren“, so der Komponist Manfred Trojahn. Großes Lob verdient der als Liedsänger neuer Musik profilierte Holger Falk, der diesen 40 Minuten langen Monolog souverän und mit großer Spannung gestaltet, auch, indem er seine Kleidung immer mehr derangiert und scheinbar orientierungslos im Halboval der Bühne herumtigert.
Phasenweise nutzt Trojahn auch das große Orchester, und in der Tonsprache bleibt er sich treu. Der beeindruckenden Liste seiner Kompositionen, besonders den Opern „Enrico“ und „Orest“ hat er die längste Briefszene der Musikgeschichte hinzugefügt.
Reinhild Hoffmann und Dirk Kaftan haben hier ein neues Gesamtkunstwerk geschaffen, das die Ertaubung Beethovens, konkretisiert im Heiligenstädter Testament, die Sprachkrise des 20. Jahrhunderts, konkretisiert in „Ein Brief“, und das Oratorium „Christus am Ölberge“, das Christus als Mensch in einer existenzielle Lebenskrise zeigt, zu einem beeindruckenden Theaterabend macht.
---------
Die Premiere wurde aufgezeichnet und wird vom Deutschlandfunk Kultur am 15. Februar 2020 um 19.05 Uhr gesendet. Eine weitere Ausstrahlung gibt es am 8.April 2020 um 20.04 Uhr im SWR2 Abendkonzert.
Ursula Hartlapp-Lindemeyer, 11.2.2020
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
Bilder © Thilo Beu
FIDELIO
01.01.20
Halt! Aufhören! Ich will hier raus!
Mit einem Festakt am 16. Dezember 2019 haben in Bonn offiziell die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven begonnen. Im Rahmen des ausgerufenen Beethoven-Jahres finden bundesweit eine große Zahl von Veranstaltungen statt, um das Werk dieses großen Komponisten zu würdigen. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Zusammenhang der ersten Fidelio-Inszenierung des Kalenderjahres 2020, die am 01.01.20 in der Geburtsstadt des Komponisten ihre Premiere feierte.
Eine Gruppe von kurdischen Männern und Frauen steht vor dem Eingang der Oper und hält Plakate mit Portraits von Familienangehörigen hoch, die sich als Gefangene in türkischen Gefängnissen befinden, und für deren Solidarität und Freilassung sie sich einsetzen. Vor dem Hintergrund, dass in wenigen Minuten eine Oper Premiere hat, die Freiheit und Treue als Hauptthemen hat, ein denkwürdiger Anlass. Zu allen Zeiten scheint es Menschen zu bedürfen, die sich für die Befreiung Inhaftierter einsetzen; in der folgenden Oper wird es Leonore sein - als Mann Fidelio verkleidet - die ihren Gatten Florestan aus dem Gefängnis befreit. Dabei wird mit dem sprechenden Namen Fidelio wird auf die unerschütterliche Treue (lat. „fidelis“) Leonores angespielt.

Fidelio ist die einzige Oper von Ludwig van Beethoven in zwei – bzw. in der Urfassung unter dem Titel Leonore drei – Akten, die er auf Anregung des Textdichter der Zauberflöte, Schikaneder, komponiert hat. Das Libretto schrieben Joseph Sonnleithner, Stephan von Breuning und Georg Friedrich Treitschke; als Vorlage diente ihnen die Oper Léonore, ou L‘amour conjugal (1798; Libretto: Jean Nicolas Bouilly, Musik: Pierre Gaveaux). Die Uraufführung der ersten Fassung des Fidelio fand am 20. November 1805 am Theater an der Wien statt, wie auch die der zweiten Fassung am 29. März 1806; die der endgültigen Fassung am 23. Mai 1814 im Wiener Kärntnertortheater. Schikaneder hatte bereits früher versucht, Beethoven zur Komposition einer Oper zu motivieren, aber die damals in Wien verbreiteten Zauber- und Maschinenpossen interessierten den Komponisten nicht. Erst die klugen und kunstsinnigen französichen Opern der Revolutionsepoche konnten seine Aufmerksamkeit wecken. Die Botschaft von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fiel bei Beethoven auf fruchtbaren Boden.
Die im Jahrzehnt der Französischen Revolution aufkommenden Rettungs- und Befreiungsopern spiegeln die gesellschaftliche Unsicherheit während der Revolutionswirren im unerfüllten Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit. In ihr sah Beethoven die Möglichkeit, die gegen jede Tyrannei gerichteten Prinzipien durch die Rettung eines unschuldigen Helden aus höchster Not zum Ausdruck zu bringen. Damit war Beethoven der erste wirklich politische Komponist der Musikgeschichte.
Aber auch die Entstehungs- und Aufführungsgeschichte des Werkes stand unter den politischen Bedingungen der Zeitläufe. Die Uraufführung hatte sich aufgrund von Schwierigkeiten mit der Zensur verzögert, so dass sie erst eine Woche nach dem Einzug französischer Truppen in Wien erfolgen konnte. Der Adel und Teile des Bürgertums waren aus Wien auf Land geflüchtet, so dass vor allem französische Soldaten im Publikum sassen. Dadurch fehlte Beethoven ein verständiges Publikum.

Erst nach dem Preßburger Vertrag von 1806, als sich das Leben in Wien wieder normalisierte, konnte die Oper revidiert werden. Die Grundidee des Werkes wurde stärker verdeutlich, nämlich die Überhöhung der konkreten edlen Tat Leonores ins Allgemein-Menschliche.
Die modellhafte Welt von Fidelio ist ein einziges, großes Gefängnis. Das Theater Bonn und das Inszenierungsteam um Regisseur Volker Lösch greift vor allem den politischen Aspekt der Oper auf, und exemplifiziert in am Beispiel von aktuellen Geschichten von politischen Gefangenen in der Türkei und deren Angehörigen. Fidelio ist eine Nummernoper mit gesprochenen Dialogen. Schon Wieland Wagner beispielsweise brachte 1954 in Stuttgart eine Fassung heraus, in der sämtliche Dialoge bis auf das Melodram in der Kerkerszene gestrichen und durch neue Texte ersetzt worden waren.
In der bonner Inszenierung ist die Türkei das aktuelle, europäische Beispiel für einen Staat, in dem Regimegegner verhaftet werden und durch eine Willkürjustiz im Gefängnis verschwinden. Mit dieser Inszenierung wird sich konkret für die Freilassung von Ahmet Altan, Hozan Canê, Gönül Örs, Soydan Akay und Selahattin Demirtaş eingesetzt. Als Zeitzeugen treten u.a. Dogan Akhanli, der drei Mal in türkischen Gefängnissen war und mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde, sowie Hakan Akay auf, dessen Bruder Selahattin als wichtigster politischer Herausforderer des türkischen Staatspräsidenten Erdoğan gilt und wegen angeblicher Terrorunterstützung seit über drei Jahren im Hochsicherheitstrakt in Edirne unrechtmäßig, so 2018 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, inhaftiert ist.
Das Publikum findet beim Betreten des Zuschauersaals einen offenen Bühnenraum mit ungewöhnlichem Setting vor. Das Orchester ist am vorderen Bühnenrand platziert, als handele es sich um eine konzertante Aufführung. Dahinter befindet sich ein großer leerer Raum ganz in hellgrüner Farbe strahlend. Die zahlreich über die Bühne getragenen Kammeras lassen vermuten, dass es sich um ein Studioset handelt, in dem mit Greenscreen-Technik gearbeitet wird. Hektischen Probengeschehen auf der Bühne vermittelt den Eindruck eines work-in-progres. Am rechten Bühnenrand ein Tisch mit ca. 10 Stühlen. Später senkt sich eine Projektionsfläche vom Schnürboden herab.

Dirk Kaftan, in dessen Händen die musikalische Leitung des Abends liegt, dirigiert die Ouvertüre mit einer Kraft und einer Wut, als wolle er jede Note aus dem Beethoven Orchester Bonn herausprügeln. Nach der Ouvertüre wird das Orchester in den Orchestergraben abgesenkt, und wir bekommen einen freien Blick auf das Bühnengeschehen. Kaftan beruhigt sich ein wenig, und wir erkennen, dass das Orchester auch ohne Gewaltandrohung zu spielen bereit ist, und zwar auf höchstem Niveau.
Es ist viel, was dem Publikum geboten wird. Manchmal ist es etwas zu viel. Auf der herabgesenkten Leinwand werden teils vorgefertigte Filmsequenzen gezeigt, die das Leben der Kurden in der Türkei, Auftritte des Diktators Recep Tayyip Erdoğan, Freiheitsdemonstrationen kurdischen Friedensaktivisten, Militärparaden, Machtdemonstrationen und andere Szenen zeigen. Zu anderen Zeiten wird das Bühnengeschehen im Greenscreen-Bereich oder am Gemeinschaftstisch gefilmt und projiziert. Im Bereich der Green-Box werden die gesanglichen Passagen aufgeführt, und in die verschiedensten Handlungswelten eingefügt. In den Passagen der gesprochenen Dialoge sprechen Zeitzeugen über die Erfahrungen und Hintergründe ihrer eigenen Verhaftungen in der Türkei sowie über das Leben ihrer Angehörigen, die sich immer noch in türkischer Geiselhaft befinden. Auch die deutsche Haltung zu verschiedenen politischen Fragen, so z.B. dem türkischen Völkermord an den Armeniern, dem vorgeblichen Staatsputsch, der immer wieder als von Erdogan inszeniertes Geschehen diskutiert wird, und der im die Möglichkeit gab, jede Form der Opposition zu unterdrücken. Ganz aktuell auch die die völkerrechtswidrige Annexion kurdischer Gebiete im Irak, auf die es von europäischer Seite keine ausreichende Resonanz gab. Im Gegenteil: Es entsteht weiterhin der Eindruck, Erdogan könne mit seinen Drohungen in der Flüchtlingsfrage seine Interessen entgegen jeder Rechtsstaatlichkeit auch gegenüber der Europäischen Union durchsetzen.
Vier Ebenen werden dem Publikum angeboten, die teilweise weit über Beethovens Opern-Aussagen hinaus gehen, ihnen andererseits aber immer verpflichtet bleiben:
⁃ Die Ebene der Leinwandprojektionen
⁃ Die Handlungsebene der Green-Box
⁃ Das Geschehen am Tisch
⁃ und nicht zuletzt das musikalische Geschehen aus dem Orchestergraben. Hier hören wir - ohne Wenn und Aber: Beethoven.
Ein Moderator, Matthias Kelle, verwebt und verbindet die verschiedenen Ebenen miteinander. Jeder Zuschauer entscheidet sich für seine eigenen Sicht der Dinge - muss sich sogar entscheiden, da ein Gesamtbild der Vielzahl der unterschiedlichen Bild- und Handlungsebenen kaum auf einmal zu erfassen sind - oder schließt einfach die Augen. Und dann bleibt die Musik Beethovens.
Thematisch ist diese Verknüpfung von Beethovens Politik-Oper und tagesaktuellen politischen Zusammenhängen hoch spannend. Sehr zu loben, dass das Produktionsteam, dass sich von eingehenden und starken Bildern nicht scheut, keiner Tendenz einer einseitigen und gefühlsbetonten Vereinfachung nachgibt. Die Komplexität der individuellen Erfahrungen, die von den verschiedenen Zeitzeugen berichtet wird, kann jedoch auch vereinzelt zu Längen und Ermüdungen führen. Aber auch wenn die Sprecher um Präzision und Emotionsfreiheit ihrer Schilderungen bemüht sind, können die Inhalte die Zuhörer doch vereinzelt emotional überfordern. Als Süleyman Demirtaş von den an ihm verübten Folterungen berichtet, schreit eine ältere Dame im vorderen Publikumsbereich verzweifelt auf: Halt! Aufhören! Ich will hier raus! Wenig später verlässt sie zusammen mit ihrem Mann kopfschüttelnd den Saal. Es darf einem auch einmal zu viel werden. Jeder hat das Recht, ja regelrecht die Pflicht, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Wir und die Dame sollen glücklich sein, dass wir alle die Möglichkeit zur freien Entscheidung haben. Wir hören im Laufe des Abends von vielen Menschen, die diese Freiheit nicht haben.

Süleyman Demirtaş berichtet im Verlauf des Abends, dass er nach seiner Haftentlassung nach Deutschland gekommen sei. 50 mal sei er inzwischen umgezogen. In Köln allein, wo er inzwischen lebe, seien es 30 Umzüge gewesen. Wohin auch immer er gezogen sei, er habe nie eine Heimat gefunden. Bis heute fände er keine Ruhe. Hier schließt sich dann der Kreis zu Beethoven, der bekanntermaßen in Wien ebenfalls in 30 verschiedenen Wohnungen gelebt hatte, bis dass der Tod seiner unruhigen Seele heilenden Balsam gab. Erstaunlich, wie groß auch nach 200 Jahren die Parallelen sind...
Großartig die musikalische Besetzung des Premierenabends, nach den musikalischen Partien immer wieder reichlich mit Szenenapplaus bedacht.
Aufgrund der Menge der Inhalte und der Bilderflut wird der Abend aber eher als politisch hochinteressantes, zeitgenössisches Musiktheater in Erinnerung bleiben, als ein musikalisches Sängerfest. Tosender, langanhaltender Beifall, Standing Ovations und großer Beifall für eine herausragende Leistung aller Beteiligten. In der Pause hatten sich die Reihen der ausverkauften Reihen bereits ein wenig gelichtet; aber auch unter den standhaften Besuchern brach im laufenden zweiten Akt bereits ein kurzer Streit im Publikum über die Inszenierung aus. Eine lebhafte Auseinandersetzung, die sicherlich auch in den Folgevorstellungen nicht beendet sein wird. Dementsprechend mischten sich in den Abschlussapplaus auch vereinzelte Buh-Rufe
Ingo Hamacher, 3.1.2019
Fotos (c) Thilo Beu
Credits
Rocco, Kerkermeister: Karl-Heinz Lehner
Don Fernando, Minister: Martin Tzonev
Don Pizarro, Gouverneur eines Staatsgefängnisses: Mark Morouse
Florestan, ein Gefangener: Thomas Mohr
Leonore, seine Gemahlin unter dem Namen "Fidelio": Martina Welschenbach
Marzelline, Roccos Tochter: Marie Heeschen
Jaquino, Pförtner: Kieran Carrel
1. Gefangener: Jonghoon You
2. Gefangener: Enrico Döring
Chor des Theater Bonn, Extrachor des Theater Bonn, Statisterie des Theater Bonn, Beethoven Orchester Bonn
Moderator: Matthias Kelle
Kamera: Krzysztof Honowski
Zeitzeugen: Hakan Akay, Dogan Akhanli, Süleyman Demirtas, Agit Keser, Dilan Yazicioglu
Musikalische Leitung: Dirk Kaftan
Inszenierung: Volker Lösch
Bühne: Carola Reuther
Kostüme: Alissa Kolbusch
Videodesign: Christopher Kondek
Licht: Max Karbe
Dramaturgie: Stefan Schnabel
Choreinstudierung: Marco Medved
Weitere Termine:
04.01.; 16.01.; 24.01.; 02.02.; 09.02. (16:00); 15.02.; 14.03.; 27.03.2020
CAVALLERIA RUSTICANA & I PAGLIACCI
Premiere Bonn 9.11.2019
Ein meisterlicher, ein perfekter Verismo- Opernabend

Wenn der leidgeprüfter Kritiker durch die NRW-Lande - immerhin die dichteste Theaterlandschaft der Welt - streift, dann ist er mehr als glücklich, wenn er nach einer Tschernobyl-Pique Dame (Essen) und einer Pappkarton-Boheme (Wuppertal) - die Düsseldorfer Boheme spielt sogar im Bunker - endlich wieder schöne, große, wahre Oper erleben darf. Es erfreut mein Herz, daß es noch Regisseure gibt, die das Werk ernst nehmen, fachkundig, partiturgenau und mit Liebe zum Musiktheater inszenieren und auch an die Sänger denken.
Ein solcher Fachmann mit Herz für Oper ist Erfurts Generalintendant Guy Montavon. Ein Meister seines Faches. Immerhin den älteren Bonnern noch aus der del Monaco-Ära (als Oberspielleiter) bekannt. Daß so eine tolle Inszenierung - ich nehme bewusst eine Bewertung schon vorweg ohne zu spoilern ;-) - nicht in Bonn alleine blühen wird, sondern weiter nach Erfurt und Seattle gereicht wird, ist nicht nur vernünftig zeitgemäß, sondern auch ganz großartig im künstlerischen Sinn. Die nicht störenden, zeitgenössischen Kostüme von Bianca Deigner passen ausgezeichnet zur Ästhetik des Gesamtbühnenbildes.

Zwei riesige Totenmasken der Komponisten Leoncavallo und Mascagni bilden das Zentrum des Bühnenbildes von Hank Irwin Kittel in einem riesigen Mausoleum. Im Verlauf der Cavalleria werden sie dann niedergelegt und dienen als unebene Spielfläche, die bestiegen und teilweise erklettert werden muss. Keine einfach Sache für die Darsteller, denen man schon fast artistisches Balancegefühl abverlangt, denn der Boden dreht sich auch noch zusätzlich. Die Beleuchtung von Max Karbe spielt perfekt mit den musikalischen Stimmungen und passt zu den jeweiligen Situationen. Auch hier höchste Lobestöne.
Zu den Pagliacci wandelt sich die Bühne zu einer Art Amphitheater, in dessen Zentrum die kleine Gauklertruppe unter einer jetzt umgedrehten Maske hausiert. Schöne Idee, schönes Symbol für das Innere des Kopfes, für die wirren Gedanken der Liebe, Rache und Eifersucht bzw. Mordlust, die ja diesen Reißer prägen. Wenn sich dann am Ende zum Schlußakkord und zum Ruf "la commedia e finita!" die riesigen Totenmasken aus der Cavalleria langsam wie gigantische Monolithe wieder herabsenken, ist das ein toller Theatercoup und ein beeindruckendes Finale, welches man noch lange in Erinnerung behalten wird.

Die Aufführung liegt in den Händen des begnadeten Dirigent Will Humburg - eine Einschätzung, die nicht nur der Rezensent, sondern auch große Teile des Publikums teilten, was der riesige Jubel schon zu Beginn des zweiten Teils (Pagliacci) bewies. Humburg ist letztlich das I-Tüpfelchen auf der Sahnetorte, oder nennen wir es die Marzipanfigur. Die Musiker des Beethoven Orchesters spielen auf, als säßen die Orchestermeister der legendären Academia di Santa Cecilia vor uns. Feuer, Tragik, Schmelz, herzergreifende Celli und ein im Blech- und Streicherklang beinah überirdisches Klangerlebnis.
Das war Italianita vom Feinsten - man hat, insbesondere bei den Vor- und Zwischenspielen Tränen in den Augen. Jede Note wird zelebriert bis zum ätherischen Verhauchen, auch die Sänger trägt Humburg auf Engelsflügeln. Man hat das Gefühl - besonders wenn man ihn beobachten kann - er lebt, er liebt und er stirbt mit ihnen. Ein Maestro, der alles gibt und der am Ende beim Schlußvorhang den Eindruck eines Marathonläufers nach dem Zieleinlauf erweckt. Bravo, bravissmo! Daß er den Jubel direkt an die Orchestermitglieder weiterleitet, ehrt ihn besonders. Ein ganz, großer hoch musiksensibler Orchesterchef - kurzum: Weiterhin, auch mit 62 Jahren, einer der besten Dirigenten der deutschen Opernszene.

Großer Jubel und berechtigte Anerkennung auch für Chor und Extrachor des Theaters Bonn unter der tadellosen Leitung von Marco Medved, sowie dem Kinder- und Jugendchor des Bonner Theaters, den Ekaterina Klewitz nicht nur zu gesanglicher Perfektion, sondern auch zu einem Klangkörper mit großem schauspielerischen Einsatz motiviert hat. Selten sah ich auf einer Bühne so viel begeisternde Spielfreude, veristisches Engagement und überragenden Einsatz. Die Choristen wurden zu Recht als eine große weitere Säule dieses brillanten Gesamtkunstwerkes gefeiert.
Da es auch auf der sängerischen Seite keinerlei Einschränkungen gab - wann hat man als Kritiker mal nichts zu bemäkeln? - ist hier ein Abend von internationalem Format zu bescheinigen. Heraus zu heben aus den in jeder Beziehung trefflich besetzten Comprimarii, sind allerdings die Santuzza von Dashamilja Kaiser und die Nedda von Anna Princeva.

Während erstere einfach ein gesangliches Monument darstellt, welches alle Facetten der hochschwierigen Partie klaglos meistert und über eine stimmliche Tragfähigkeit verfügt, die jedes größere Haus vor Neid erblassen lässt, ist die Princeva eine perfekte Musiktheater-Darstellerin, von der man sofort in den Bann gezogen wird. Sie präsentiert den Charakter Nedda so hautnah, berührend und herzergreifend lebensecht - das ist Verismo in Perfektion! - daß es den Zuschauer bewegt und man fasziniert, wie bei einem großen Krimi, die Luft anhält. Was für eine Darstellerin ! - und auch der Kunstgesang kommt so ehrlich über die Bühne, daß man sich im echten Leben wähnt und nicht in der Oper.
Zum Schluss eine Lobeshymne über den Haustenor der Bonner Oper, den stets großartig singenden George Oniani (Turridu/Canio). Ich habe Oniani in den letzten zehn Jahren am Haus in vielen Monster-Partien erlebt, in denen er stets mit Bravour und stimmsicher auftrumpfte. Ein Tenor für die härtesten, für die schwierigsten Rollen, der nie enttäuschte.

Er war immer, vor allem bei Verdi und Puccini eine sichere Besetzung. Oniani hat sich stets mit großem Mut und Einsatz in regelrechte Mörderpartien geworfen und nicht nur bei den Premieren seine Arien furios bis zum Da-Capo geschmettert. Ein Künstler, der nie enttäuschte. Er hat sein gutes Niveau über die Jahre gehalten und ist nun auch darstellerisch aufgestiegen. Insbesondere der Canio schien ihm, dank guter Regiearbeit, auf den Leib geschnitten. Kurzum: Ich habe ihn nie besser erlebt.
Fünf Sterne für diesen herausragenden Opernabend. Buchen Sie sich, liebe letzte romantische Opernfreunde, unbedingt in Bonn bitte ein. Sie werden nicht enttäuscht und bekommen den Glauben an das wunderbare Erlebnis einer großen Oper wieder zurück.
Peter Bilsing, 10.11.2019
(c) Thilo Beu
Credits
Santuzza - Dshamilja Kaiser
Turridu - George Oniani
Lucia - Anjara I. Bartz
Alfio - Mark Morouse
Lola - Ava Gesell
Nedda - Anna Princeva
Canio - George Oniani
Tonio - Mark Morouse
Peppe - Kieran Luke Carrel
Silvio - Giorgos Kanaris
Un altro contadino - Jeongmyeong Lee
Meisterjongleur - Maximilian Koch
Weitere Termine
SA 30 NOV
DO 05 DEZ
MI 25 DEZ
DO 09 JAN
SA 25 JAN
DO 13 FEB
SA 07 MÄR
(immer 19 30 h - 22 30 h
Der Rosenkavalier
Premiere: 06.10.2019
Angestaubtes aus dem Spiegelkabinett
Spricht man über Richard Strauss' Rosenkavalier, so gehen die Meinungen oft auseinander. Dem einen zu seicht, für den anderen ein Meisterwerk, für die einen eine Perle Strauss'scher Tonkunst, für die anderen ein deutlicher Rückschritt nach der Elektra, für die einen einfach eine walzerselige Komödie und für die anderen tiefsinniges Beziehungsportrait. Nun hat sich nach langer Zeit die Oper Bonn diesem Werk wieder angenommen (übrigens in Kooperation mit der Volksoper Wien) und einen Abend auf die Bühne gebracht, der musikalisch von vorne bis hinten überzeugt, in seiner Inszenierung aber leider wenig zu bieten hat.
Dass die Vergänglichkeit und das Sinnen des Menschen über die (eigene) Zeit ein großes Thema im Rosenkavalier ist, wird niemand in Frage stellen. Auch Regisseur Josef Ernst Köpplinger arbeitet sich emsig an diesem Thema ab. Hierzu lässt er sich von Bühnenbildner Johannes Leiacker ein Bühnenbild kreieren, das dieses Thema so erschöpfend, wie holzhammerartig über den gesamten Abend relativ langweilig visualisiert. Zur linken und rechten Seite der Bühne finden sich jeweils vier drehbare Elemente, die mit höchst vergilbten und matten Spiegeln verkleidet sind und die, werden sie gedreht, auf jeder Seite ein Gemälde mit barocker Anmutung ergeben. Sind es im Schlafgemacht der Feldmarschallin Schmetterling und Blüte, wird es auf der anderen Seite am Ende des Abends wirklich eine Vanitas samt Totenkopf, in der Kunstgeschichte das Zeichen für menschliche Vergänglichkeit. Hier sollte dann wirklich auch dem letzten klargeworden sein, was man uns sagen will - ja, der Blick in den Spiegel zeigt uns: Wir sind alle vergänglich.
Natürlich ist das eine Aussage und natürlich regt diese Aussage auch zum Nachdenken an, aber: Die Penetranz mit der der Blick auf die Bühne uns das näherbringen will, ist bereits nach kurzer Zeit erschöpft und so simpel, dass man sich fragt: Ist da nicht noch mehr? Und so will auch die gesamte Inszenierung irgendwie keine Fahrt aufnehmen. Köpplinger zeigt immer wieder, dass er gewillt ist mit der Musik zu arbeiten, setzt immer wieder die ein oder andere Pointe, aber es bleibt alles sehr verhalten, sehr unentschlossen, sehr simpel. Die Personen stehen nur allzu oft herum, schauen in den Spiegel, schauen ins Publikum... und allzu oft war es das dann auch und das ist leider nicht immer eine Freude. Das Defilee der Bittsteller am Ende des ersten Aktes setzt beispielsweise zu Turbulenzen an, aber es gelingt nicht so, dass es den ihm innewohnenden Humor transportiert, auch an anderen Stellen bleibt es spröde und platt. Kitsch wird es gar, wenn am Ende der Oper in der Szene in der Sophie und Octavian endlich zueinander gefunden haben, die Spiegel endlich ein wenig zur Seite fahren und es zu schneien beginnt und die beiden jungen Liebenden im Schnee tanzen, flankiert von einem ungeschickten Abgang des Herrn von Faninal und der Feldmarschallin, der so geschieht, dass man fast denken könnte, hier bahnt sich ein weiteres junges Glück an. Das ist unterm Strich alles recht eintönig und der zu Recht tosende Beifall am Ende für Sänger und Orchester ebbt hörbar ab, wenn sich das Produktionsteam verbeugt. Man hätte sich hier viel spannendere Personenstudien gewünscht, die die Fallhöhen, die (inneren) Konflikte mehr beleuchten, die mehr Spannung in den Abend bringen. So bleibt es arg bieder und angestaubt.
Musikalisch hat dieser Abend aber eine Menge zu bieten und hier kann man die exzellente Leistung der Bonner Oper nicht genug loben. Dirk Kaftan leitet ein brillant aufspielendes Beethoven-Orchester. Kaftan geht zügig an die Tempi und lässt kraftvoll aufspielen – in den ersten Minuten vielleicht ein bisschen zu kraftvoll, aber in summa vermag er es mit einer unglaublichen Leichtigkeit einen Strauss zu musizieren, der die Vielschichtigkeit des Werkes zwischen Walzer und klanglichen Modernismen auslotet. Akkurat im Blech, feinsinnig in den solistischen Passagen bleiben hier keine Wünsche offen. Auch das Ensemble leistet durch die Bank weg Großes: Franz Hawlata ist ein Ochs wie er im Buche steht. Voller Verve schmeißt er sich in die Rolle, dass es eine Freude ist. Mit einem von der ersten Sekunde erkennbaren Toupet ausstaffiert (und es ist natürlich nicht minder vorhersehbar, dass er im Laufe des Abends diese Haarpracht auch noch verlieren wird), gibt er den Schwerenöter mit Wiener Schmäh perfekt. Stimmlich in den Randlagen ein kleines bisschen schwächer als vor Jahren (Hawlata sang die Partie u.a. in Essen), aber immer noch sonor, mit großer Textverständlichkeit und viel Wiener Schmäh. Martina Welschenbach ist eine ausgesprochen junge Feldmarschallin. Das kann man ihr freilich überhaupt nicht zum Vorwurf machen und sie interpretiert die Partie auch herrlich mit ihrer wunderschönen Stimme, der stimmliche Kontrast zu Octavian und Sophie bleibt aber offen und das ist ein bisschen schade. Regie und Kostüm (Dagmar Morell) helfen hier auch wenig und so scheint der Anfang der Oper unter fast Gleichaltrigen zu spielen. Erst im Finale unterstütz das Kostüm die Reife der Figur, was aber dem so misslungenen Anfang auch nicht mehr hilft. Aber das ist eben eines der Probleme der Inszenierung: Auf Fallhöhen, Unterschiede und mögliche Konflikte wird nicht eingegangen, sie werden wenig oder gar nicht erzählt. Das ist bedauerlich.
Als Ocatavian ist die junge schwedische Mezzosopranistin Emma Sventelius verpflichtet und was hier zu hören ist, das ist wirklich sensationell. Sventelius überzeugt im Spiel und ist vielleicht die schlüssigste Figur das Abends mit burschikosem Gehabe, mit kleinen Machoallüren und großen emotionalen Momenten. Ihre Stimme bietet zwischen lodernden Mezzo-Farben und zartem, lyrischen Gesang alle Nuancen in höchster Perfektion – was für eine Sängerin! Als Sophie ist Louise Kemény besetzt, die mit Welschenbach und Sventelius ein wirklich perfektes Terzett abliefert. Gerade im pianissimo ist Kemenys Stimme so zart und fein und doch klar und verständlich – das ist beeindruckend.
Als Herr von Faninal überzeugt Giorgos Kanaris mit klangschöner Stimme und energischem Spiel. Yannick-Muriel Noah ist eine wahre Luxus-Besetzung für die im Verhältnis zu den sonst von Noah gesungenen Partien eher kleine Rolle der Jungfer Leitmetzerin. Noah singt diese Partie souverän und tadellos. Johannes Mertes und Anjara I. Bartz liefern ein solides und vergnügliches Rollenportrait der Intriganten ab. Die höllisch schwere Arie des Sängers interpretiert George Onani mit großer Strahlkraft in der Stimme und gönnt sich im Spiel tenorale Allüren, die beim Publikum für Schmunzeln sorgen. Die zahlreichen weiteren kleinen Partien runden ein absolut stimmiges und musikalisch homogenes Gesamtbild ab. Der Chor (Leitung Marco Medved) und der Kinderchor (Ekaterina Klewitz) absolvieren ihre kleinen Partien ebenfalls absolut einwandfrei. Am Ende des Abends bricht über die Sänger tosender Beifall einher und man kann nur zustimmen. Die Oper Bonn hat mit diesem Rosenkavalier wirklich eine musikalisch überzeugende Produktion geschaffen. Szenisch bleibt es verhalten und bieder, ja fast etwas angestaubt. Ein Rosenkavalier hat mehr zu bieten, als es uns diese Lesart glauben lassen will. So sei ein Besuch der Produktion aber dennoch empfohlen, denn unterm Strich ist das ein toller Opernabend.
Sebastian Jacobs, 09.10.2019
Bilder siehe unten!
DER ROSENKAVALIER
Premiere am 8. Oktober 2019
Auf höchstem gesanglichen Niveau
Der Bonner Generalmusikdirektor Dirk Kaftan eröffnet die Spielzeit 2019/20 mit einer szenisch und musikalisch absolut gelungenen Produktion des „Rosenkavalier“. Operndirektor Andreas K. Meyer hat gewagt – drei Rollendebüts von jungen Sängerinnen – und gewonnen. Martina Welschenbach als Marschallin, Louise Kemény als Sophie und vor allem Emma Sventelius als Octavian liefern hinreißende Charakterstudien und agieren auf höchstem Niveau, der international gefeierte Franz Hawlata gestaltet die Rolle des Ochs, und die anderen Partien sind aus dem Ensemble hochkarätig besetzt. Großartige Ensembleleistung!

Gutes Regietheater geht der Idee des Stückes auf den Grund, und das sind bei diesem 1910 entstandenen Stück (Uraufführung am 26. Januar 1911 in Dresden) die Vergänglichkeit und die Eitelkeit (Vanitas), verpackt in eine deftige Komödie über erotische Eskapaden mit scharfen Karikaturen des Adelsdünkels und der Geltungssucht des aufstrebenden Bürgertums. Richard Strauss und Hugo von Hofmannstahl wollten eine Mozart-Oper im Stil der Comedia dell´arte schreiben wie „Le nozze di Figaro“, haben aber darüber hinaus authentische Charaktere geschaffen und die Endzeitstimmung des Wiener Kaiserreichs kurz vor Ausbruch des ersten Weltkriegs eingefangen.
Regisseur Josef Ernst Köpplinger, Intendant des Münchener Gärtnerplatztheaters, siedelt diese „Komödie für Musik“, seine erste Regie in Bonn, in der Entstehungszeit an. Die Personenführung ist vorbildlich, jedes Detail ist durchdacht, auch dank der Dramaturgie von Christian Wagner-Trenkwitz. Diese Inszenierung ist ein echter Beitrag zur Me-too-Debatte, denn es geht darum, dass der übergriffige notorische Weiberheld Ochs auf Lerchenau von seiner Zukünftigen abgewiesen wird, und dass es schließlich mit Hilfe der Marschallin und des jungen Grafen Octavian gelingt, ihn vom Platz zu verweisen.

In den Momenten, in denen die Zeit stehen bleibt, hält GMD Dirk Kaftan die Musik an und gestattet lange Generalpausen, nach denen die reflektierenden Monologe der Marschallin und die Ensembles der drei Frauenstimmen umso stärker wahrgenommen werden. Hier entsteht große emotionale Tiefe.
Die Bühne von Johannes Leiacker ist ein Traum von halbblinden Spiegeln, einem Rosengemälde und Vanitas-Motiven, zitiert aus barocken Stillleben. Er hat zwei rechtwinklig zueinander stehende Rahmen mit je vier raumhohen drehbaren dreiseitigen Säulen, die die ganze Wand abdecken und Durchgänge freigeben können, aufgestellt. Im ersten Akt dominiert ein riesiges Rosenbild über dem Bett und eine Spiegelwand. Dazu im zweiten Akt ein bürgerliches Bücherregal mit Sesselgruppe, im dritten Akt eine Bar und ein paar Wirtshaustische.
Die Wiener Atmosphäre entsteht in erster Linie durch die Wiener Walzer und durch Franz Hawlata, der mit authentischem Wiener Tonfall den Schwerenöter Ochs auf Lerchenau gibt. Er hat die Partie nach eigenen Angaben ungefähr 650 mal gesungen. Unter anderem hat er damit an der Metropolitan Opera New York debütiert. Dieser Baron Ochs ist von keinerlei Selbstkritik angefochten und stellt sich in Knickerbockern als notorischer Schürzenjäger dar, der die blutjunge Sophie nur aus finanziellen Gründen heiraten will und ungeniert allen jungen Damen an die Wäsche geht.

Die junge schwedische Mezzosopranistin Emma Sventelius mit ihrem blonden Herrenschnitt und der androgynen Erscheinung ist in jeder Beziehung eine Idealbesetzung des Octavian. Als junger Liebhaber der Marschallin verkleidet sie sich als Zofe Mariandl, um sie nicht zu kompromittieren. Als Ochs ihr im Beisein der Marschallin nachstellt weist sie als Zofe den alten Schäker in seine Schranken, indem sie seinen Klaps auf den Po erwidert.
Als Octavian, Graf von Rofrano, ist sie ein würdiger Gegenspieler des Ochs. Die Szene, in der Octavian Ochs Paroli bietet: „Die Fräulein mag Ihn net“ ist ganz großes Theater. Hier wird ein junger Mann erwachsen und setzt sich gegen einen viel älteren durch. Es ist Magie, wie sie es schafft, diese lange Partie, in der sie fast ununterbrochen auf der Bühne steht und nicht nur in einer fremden Sprache, sondern auch in einem fremden Dialekt singt, so souverän zu bewältigen. Als Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt wirkt sie absolut überzeugend in ihrer Körpersprache, ganz angesehen davon, dass sie in den Ensembles perfekt mit ihren Partnern und Partnerinnen harmoniert.
Die Kostüme von Dagmar Morell, Kostümbildnerin am Münchener Gärterplatztheater, drücken den sozialen Status der Personen sehr genau aus. Für Octavian hat sie zum Beispiel zwei zeitlose Herrenanzüge, einen silbernen Gehrock mit Kniehosen, ein Dienstmädchenkleid und ein Ausgehkleid für eine junge Frau im Stil des Art Deco geschaffen.

Martina Welschenbach als Feldmarschallin Fürstin Werdenberg ist genau das, was dem Komponisten und dem Librettisten vermutlich vorschwebte: eine schlanke junge blonde Frau, die in der Ehe mit dem Feldmarschall eingekerkert und als Fürstin vielerlei Verpflichtungen unterworfen ist. Die Affäre mit dem 17-jährigen Octavian ist weder die erste noch wird sie die letzte sein.
Schon in der Ouvertüre brennt die Luft: ein Liebesakt ist selten so suggestiv komponiert worden wie hier, und das Beethoven-Orchester unter Dirk Kaftan läuft zu Höchstform auf. Wenn sich der Vorhang öffnet sieht man dem attraktiven Paar beim Aufwachen zu – eine Augenweide! Die Marschallin hat die komplexeste Rolle, denn sie empört sich über das Verhalten ihres Vetters Lerchenau: „Da geht er hin, der alte eitle Kerl und kriegt das hübsche junge Ding und einen Pinkel Geld dazu“, und erkennt, dass sich bei Sophie ihr eigenes Schicksal wiederholen wird. Ihr wird plötzlich klar, dass sie altert und dass sie die Zeit nicht aufhalten kann. Sie ist jederzeit Herrin der Lage, denn sie jagt den düpierten Ochs schließlich vom Feld, und sie reift als Persönlichkeit, indem sie ihren jungen Liebhaber, den sie „recht lieb“ hat, der 15-jährigen hübschen Sophie überlässt. Die Endzeitstimmung ist in ihrem Monolog „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding …“ und dem Schlussterzett trefflich eingefangen.
Der einzige, der in der Inszenierung schlagartig altert, ist Ochs. Als er im Wirtshaus bei seinem Rendezvous mit Mariandl seine schöne brünette Perücke mit der Stirnlocke verliert, die ihn wie Mitte 30 aussehen lässt, ist er plötzlich kahlköpfig und wirkt wie 65. Gedemütigt lässt er sich schließlich von der Marschallin abservieren. Selten hat die Demontage eines Weiberhelden so viel Freude gemacht. Hier zeigt sich die Aktualität des Stücks.
Louise Kemény verkörpert die blutjunge Sophie, Tochter des Herrn von Faninal, die Empfängerin der silbernen Rose, die sich auf der Stelle in den Brautwerber Octavian verliebt. Gegen den viel älteren übergriffigen Ochs wehrt sie sich in kindlichem Trotz. Sie ekelt sich vor den Unverschämtheiten ihres Bräutigams, der sie taxiert wie ein junges Pferd, und das drückt sie in ihrer Körpersprache aus. Die Stimmen von Louise Kemény (silberheller Sopran), Martina Welschenbach (lyrischer Sopran) und Emma Sventelius (Mezzosopran) harmonieren perfekt. Die Monologe und Ensembles der drei Frauenstimmen sind überirdisch schön und werden subtil vom Beethoven-Orchester begleitet.

Die Partie des italienischen Sängers ist mit George Oniani opulent besetzt. Die gefürchtete Tenorpartie dauert zwar nur drei Minuten, ist aber sehr anspruchsvoll, weil der Sänger aus dem Stand extreme Höhen und schwere Koloraturen bewältigen muss. Er wird richtig ungehalten, als Ochs während seines Gesangs mit dem Notar die peinlichen Details seines Ehevertrags diskutiert. Ensemblemitglied Giorgos Kanaris verkörpert den kürzlich geadelten reichen Kaufmann Faninal, der um jeden Preis seine Tochter mit einem Baron verheiraten will, mit noblem Bariton. Er ist mit der Situation offensichtlich überfordert und stellt sich sogar gegen seine Tochter, der er zumuten will, den viel älteren und übergriffigen Ochs zu ehelichen. Sichtlich erleichtert, dass Octavian Ochs entlarvt hat, lässt er sich davon überzeugen, dass dieser die bessere Wahl ist.
Anjara Bartz lockt als Annina den arglosen Ochs in das abendliche Rendezvous, bei dem er vorgeführt wird: eine köstliche Charakterstudie! Yannick-Muriel Noah als Jungfer Leitmetznerin schildert die Ankunft des „Rosenkavaliers“ mit strahlendem Sopran, Johannes Mertes gibt mit wunderbarem italienischem Akzent den Valzacci, und Martin Tzonev als Komissar verkörpert die Staatsmacht. Der Chor unter der Leitung von Marco Medved und der Kinderchor unter der Leitung von Ekaterina Klewitz agieren wie immer auf hohem Niveau.
Weitere Rollen sind typgerecht aus dem Ensemble und aus dem hervorragenden Opernchor besetzt. Aus dem Chor kommt zum Beispiel Egbert Herold, der den Notar singt und der aussieht wie Richard Strauss.
Dirk Kaftan lässt das Beethoven-Orchester in Walzer-Seligkeit strahlen und ziseliert die filigrane Begleitung der Monologe der Marschallin und der Ensembles der drei Frauenstimmen sorgfältig. Einige Besucher meinten, das Orchester sei zu laut, aber das passiert eigentlich nur bei den suggestiv choreografierten komplexen Chorszenen, und da muss es laut sein.
Die so gut wie ausverkaufte Premiere wurde enthusiastisch gefeiert.
Ursula Hartlapp-Lindemeyer 8.10.2019
Besonderer Dank an unsre Freunde vom OPERNMAGAGZIN
(c) Thilo Beu
West Side Story
Premiere: 15.09.2019
There is a place for us
Zur Geschichte der West Side Story sind an dieser Stelle sicherlich keine weiteren einführenden Worte nötig, zählt das Musical von Leonard Bernstein (Musik) und Stephen Sondheim (Gesangstexte) doch auch heute noch zu einem der bekanntesten und beliebtesten Werke des amerikanischen Musiktheaters. So verwundert es auch nicht, dass die West Side Story immer wieder auf den Spielplänen der verschiedenen Theater auftaucht, gerade erst in der letzten Spielzeit zum Beispiel am Dortmunder Opernhaus. Stichwort Dortmund, in den vergangenen Jahren hat man am Theater Bonn gerne mal die gelungenen Musical-Inszenierungen aus dem Ruhrgebiet übernommen, nicht so bei der diesjährigen West Side Story. Hierbei setzt man auf eine komplette Neuinszenierung durch Erik Petersen, was sich als echter Glücksgriff entpuppt.

Natürlich bleibt auch in dieser Inszenierung die Handlung des modernen Romeo- und Julia-Stoffes komplett erhalten, allerdings verlegt Petersen die Geschichte geschickt aus den 50er-Jahren in die Gegenwart. Die Gangs der Sharks, bestehend aus puerto-ricanischen Einwanderern, und der „einheimischen“ Jets sind viel rauer und härter und die einzelnen Gangmitglieder sind oft wahrlich keine „Sympathieträger“. Besonders trifft dies auf Riff zu, den Anführer der Jets, der vor lauter Langeweile auch mal einen in der U-Bahn-Station schlafenden Obdachlosen übel angeht. Lucas Baier spielt diese intensive Rolle ganz hervorragend, sowohl gesanglich wie auch in den verschiedenen Kampfszenen. Besagte U-Bahn-Station ist auch der zentrale Platz der Geschichte. Hier treffen sich die Gangs. Hier hat Doc seinen Kiosk in dem Tony Cola und Zeitschriften an die vorbeieilende Menge verkauft. Und hier befindet sich auf einer oberen Ebene auch das Modegeschäft in dem Maria und Anita arbeiten. Für die Ausstattung zuständig ist Dirk Hofacker, der hier ein Bühnenbild geschaffen hat, welches selbst einige große Musicalproduktionen in den Schatten stellt.

Auf drei Ebenen erstreckt sich die New-Yorker-Subway-Station in der immer wieder die Züge ein- und ausfahren. Dies sieht nicht nur beeindruckend aus, es ermöglicht zudem schnelle Szenenwechsel. Weitere Handlungsorte wie die beiden Geschäftslokale oder auch eine kleine Polizeidienststelle sind geschickt eingearbeitet. Lediglich für Marias Wohnung fährt ein Bühnenprospekt herunter, auf dem die allseits bekannten und für dieses Stück so typischen Feuertreppen zu sehen sind, die zu Marias Wohnung heraufführen. Dass diese natürlich in dieser Form nicht begehbar sind, ist dann auch der einzige kleine Wehmutstropfen dieser fabelhaften Ausstattung. Auf Grund der Höhe des Bühnenbildes sind aus produktionstechnischen Gründen keine Übertitel verfügbar, was aber kein Problem darstellt. Die Dialoge werden in der deutschen Fassung vorgetragen, während alle Songtexte (inclusive Gee, Officer Krupke) im englischen Original verbleiben. Die Kostüme bieten bei den Gangs die typische moderne Kleidung, weiteren Rollen sind teilweise in Anlehnung an Karl Lagerfeld oder Elton John sehr phantasievoll gestaltet. Ob Lieutenant Schrank nun eher Sozialarbeiter oder cooler Undercover-Bulle sein soll, ist dem Alt-68er-Outfit allerdings nicht wirklich zu entnehmen.

Insgesamt 30 Darsteller sorgen in den sehenswerten Choreografien von Sabine Arthold für viel Schwung auf der Bühne. Und auch gesanglich bleiben hier keine Wünsche offen. Jan Rekeszus gibt als Tony mit schönem Musical-Tenor einen passenden Partner für Marie Heeschen, die als Maria mit einem detaillierten Sopran überzeugt. Auch Andreas Wolfram kann als Bernardo, Anführer der Sharks, mit Stimme und Schauspiel glänzen. Bleibenden Eindruck hinterlässt aber vor allem Dorina Garuci als Bernardos Freundin Anita. Diese Rolle verkörperte sie bereits in Dortmund, bei der Premiere am vergangenen Wochenende gelang ihr allerdings eine wahre Glanzleistung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass man ihr bei dieser Neuinszenierung auch den Song „There is a place for us“ übertragen hat. Nachdem sie vom Tod Ihres Freundes erfahren hat, lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Schade nur, dass man ihr hier ein paar „Showgirls“ zur Seite gestellt hat und nicht den Mut hatte, die Bühne allein durch ihre Stimme zu erfüllen. Dies hätte dem berührenden Moment nochmal eine Extraportion Gänsehaut verliehen. Highlight des Abends, wenn man dies bei einem so runden Gesamtpaket überhaupt sagen kann, ist aber das Beethoven Orchester Bonn unter der musikalischen Leitung von Daniel Johannes Mayr. Mit einer solchen Wucht und Intensität hört man die West Side Story selten.

So bleibt am Ende nur noch zu sagen: „There is a place for us“ und dieser Platz befindet sich im Theater Bonn. Bis zum 21.06.2020 stehen insgesamt noch 27 Vorstellungen auf dem Spielplan und ich für meinen Teil, habe bisher nie eine bessere West Side Story gesehen.
Markus Lamers, 18.09.2019
Bilder: © Thilo Beu
Die Sache Makropoulos
Premiere: 7.4.2019
Besuchte Aufführung: 11.4.2019
Trotz leichter Einschränkungen eine großartige Aufführung

„Eine Schönheit, dreihundert Jahre alt - und ewig jung - aber nur ein ausgebranntes Gefühl. Kalt wie Eis. Über sie werde ich eine Oper schreiben.“ So Leos Janacek. „Kalte“ Frauen wie Emilia Marty dominieren auch in anderen Opern des mährischen Komponisten, so die Kabanicha in „Katja Kabanowa“ oder die Küsterin in „Jenufa“, die am Ende freilich Selbstanklage übt und tiefe Reue zeigt.
Das Vorleben dieser beiden Frauen ist nur in Andeutungen bekannt, das von Emilia Marty in „Die Sache Makropoulos“ zunächst auch, jedenfalls für die Menschen, welchen sie auf der Bühne begegnet. 1585 wurde sie geboren und lebt 1922 (Handlungszeit der Oper) noch immer vital und mit derart blühender Weiblichkeit, daß ihr die Männer reihenweise zu Füßen liegen. Was hat es mit dieser körperlichen Konservierung auf sich? Elenas Vater, Hieronymus Makropoulos, Leibarzt von Kaiser Rudolf II., sollte für diesen ein lebensverlängerndes Elixier brauen, es jedoch vorsichtshalber erst an seiner Tochter ausprobieren. Bei dem 16jährigen Mädchen schlägt die Therapie an und läßt sie nun 337 Jahre lang leben.

Diese Umstände sind ist für die Opernhandlung, welche der Komponist nach einer Komödie von Karel Capek selber textierte, von mehr Gewicht als der einen freilich großen Handlungsumfang beanspruchende Erbprozeß zwischen den Familienverbänden Prus und Gregor. In der Bonner Aufführung wird er mit markanten optischen Akzenten bebildert. Gleich zu Beginn fallen massenweise Aktenblätter vom Bühnenhimmel. Prus und Gregor sind lebensbestimmende Namen im stark erotisch geprägten Leben von Emilia Marty, deren weitere Namen bis zu dem ihrer Geburt (Makropoulos) zurückführen. Es scheint kaum sinnvoll, diese komplizierte Vorgeschichte en detail nachzuerzählen, dafür gibt es Opernführer, die man ohnehin vorbereitend zur Hand nehmen sollte. Selbst Regisseur Christopher Alden befindet: „Man kann von keinem Publikum der Welt erwarten, dem Durcheinander der Sachverhalte … zu folgen.“ Alden hat das Werk vor zehn Jahren erfolgreich für die English National Opera inszeniert. Auch die originalsprachliche Übernahme nach Bonn wirkt, von wem auch immer aufgefrischt, stringent und plausibel.

Leichte Defizite sind freilich nicht zu verschweigen. Sie betreffen auch die Protagonistin der Aufführung. Yannick-Muriel Noah, seit 2013 in Bonn in vielen heterogenen Partien erlebt, füllt die anspruchsvolle Partie der Emilia mit ihrem weitgehend lyrisch gebliebenen Sopran intensiv aus und spielt bühnensprengend. Daß diese Emilia eine allseits adorierte Opernprimadonna ist, hätte allerdings durch eine andere Frisur, vor allem jedoch durch ein anderes Kostüm sichtbar gemacht werden sollen. Sue Willmington steckt die Sängerin jedoch in ein graues Alltagskostüm, welches so gar keine Aura erzeugt. Breitkrempiger Hut und Sonnenbrille helfen nicht weiter. Schade, daß die für sich genommen großartige Leistung von Yannick-Muriel Noah visuell so defizitär bleibt.
Aldens Inszenierung wiederum läßt Emilias Umschlag von einer gefühlskalten, Männer niedermähenden Frau zur ein weiteres Leben verweigernden Leidensfigur kaum nachvollziehbar werden. Die Bekenntnisse Emilias über ihre Vergangenheit und der plötzlich aufglühende Wunsch nach erlösendem Tod werden psychologisch allenfalls beiläufig untermauert.

Dabei hat Alden die Situation konzeptionell präzise und sogar über die Privatbelange der Protagonistin hinausreichend beschrieben. „Karel Capek und Leos Janacek lebten in einer Zeit des quälenden Übergangs. Für sie stellte die 327jährige E.M. die Weigerung dar, der Entwicklung einer Gegenwart Platz zu machen.“ Tod zu gegebener Zeit ist nun einmal conditio sine qua non, ohnehin kann dem Sterben selbst mit modernen medizintechnischen Mitteln nicht wirklich begegnet werden und sollte es auch nicht. Daß das wiederaufgefundene lebensverlängernde Rezept in Emilias Hände eingebrannt scheint, daß sie es nur mit äußerster Mühe abzuschütteln imstande ist, ergibt bei Alden zuletzt eine doch noch sehr bestechende Schlußszene.
Eindrucksvoll der hohe, verglaste Bühnenraum von Charles Edwards, von wechselnden Lichtstimmungen (Adam Silverman) suggestiv mitgestaltet. Im zweiten Akt ist die Szene mit Blumensträußen übersät, und vor den Türen warten Verehrer der Primadonna mit weiteren floralen Gebinden. Leichte Ironie prägt auch noch andere Szenen. Skurril per se die Figur des Hauk-Sendorf, welcher mit Emilia verheiratet war, als sie sich noch Eugenia Montez nannte. Jetzt versucht er, geistig schon leicht verwirrt, sie zu einer Reise nach Spanien zu bewegen, wird aber von Wärtern in eine Zwangsjacke gesteckt.

Für die gesehene zweite Vorstellung hatte sich der Rollensänger Johannes Mertes als indisponiert melden müssen, agierte jedoch auf der Bühne. Von der Seite her synchronisierte ihn vokal Clemens Bieber von der Deutschen Oper Berlin, wo „Makropoulos“ zu Beginn dieses Jahres Premiere hatte (Titelpartie: Evelyn Herlitzius). Der 63jährige Sänger imponierte mit bester Kondition.
Gleich zu Beginn macht Christian Georg als Kanzeleigehilfe Vitek mit strahlkräftigem Tenor auf sich aufmerksam. Auf hoher Qualitätshöhe ist auch das restliche Ensemble zu erleben, was gleichermaßen für das Sängerische und das Darstellerische gilt. Auf eine Individualbeschreibung der Figuren darf ebenso verzichtet werden wie zuvor schon auf eine nähere Darlegung der Handlung. Nur die Namen also: Ivan Krutikov (mit kraftvollem Baß als Jaroslav Prus), David Lee (klarstimmig als sein Sohn Janek), Thomas Piffka (mit noch immer beeindruckendem Stimmmaterial als Albert Gregor), Martin Tzonev (prägnant wie immer, jetzt als Kanzeleirat Kolenaty), Kathrin Leidig (fraulich überzeugend als Viteks Tochter Krista) sowie in kleineren Partien Susanne Blattert (Kammerzofe), Anjara I. Bartz (Putzfrau) und Miljan Miloviv (Maschinist).

Die Janacek-typisch heterogene Musik bringt der 27jährige Dirigent Hermes Helfricht mit dem Beethoven Orchester so energisch wie feinfühlig zur Geltung. „Makropoulos“ verzichtet auf Gesangsnummern im engeren Sinne und kommt auch ohne Ensembleszenen aus. Im Orchester leuchtet aber immer wieder Melodisches auf, und über dem Finale breitet sich ein friedvolles, ergreifendes Klangleuchten. In der besuchten zweiten Aufführung war die Bonner Oper allenfalls zur Hälfte gefüllt. Aber mit einer gewissen Publikumsreserviertheit gegenüber weniger vertrauten Werken ist stets zu rechnen. Umso ehrenwerter die Bemühungen des Hauses, den Spielplan immer wieder mit Raritäten zu durchsetzen. Und die Zuschauer des jetzigen Abends reagierten ja auch enthusiastisch.
Christoph Zimmermann 12.4.2019
Dank für die schönen und aussagekräftigen Bilder an (c) Thilo Beu
Elektra
Besuchte Vorstellung: 23.03.2019
Auf dem Müllberg der Geschichte
Man mag es sich kaum vorstellen, dass es Richard Strauss selbst war, der zunächst Bedenken hatte den Elektra-Stoff anzugehen. Viel zu groß war seine Sorge, dass der Furor der weiblichen Hauptfigur zu sehr dem seiner „Salome“ ähneln könne. Hofmannsthal mühte sich immer wieder diese Sorge zu zerstreuen, man arbeitete Szenen der Vorlage um, diskutierte, Strauss sah sich die Bühnenfassung (u.a. mit Getrud Eysoldt) an und war letztendlich überzeugt. Nach einer der ersten Aufführungen konstatierte er: Jedoch der Wunsch, dieses dämonische, ekstatische Griechentum (...) Goethe’scher Humanität entgegenzustellen, gewann das Übergewicht über die Bedenken, und so ist Elektra sogar noch eine Steigerung geworden in der Geschlossenheit des Aufbaus, in der Gewalt der Steigerungen, – und ich möchte fast sagen: sie verhält sich zu Salome wie der vollendete stileinheitlichere Lohengrin zum genialen Erstlingswurf des Tannhäuser.
Heute kann man diese Sorgen fast nicht verstehen, haben doch beide Strauss’schen Werke ihre festen Plätze in de Repertoires der Opernhäuser gefunden: Die Elektra so aktuell auch wieder in Bonn.
Schon beim Betreten des Saals – der Vorhang ist bereits geöffnet – fällt das aufwändige von Etienne Plus entworfene Bühnenbild auf. Wir sehen das Treppenhaus eines Palastes. Massive Säulen, eine ausladende Treppe, Leuchtkörper und Kronleuchter, die in ihrer Ästhetik einen dezenten Hinweis auf das frühe 20. Jahrhundert geben. Ob es wirklich der Palast eines Herrschers ist, oder das Domizil einer Industriellendynastie wie beispielsweise die Villa Hügel der Krupps bleibt offen. Jedoch ist die eigentlich repräsentative Halle von einer Müllhalde übersät. Vermutlich sind es die Habseligkeiten und Hinterlassenschaften Agamemnons. Zwischen ihnen haust Elektra und ist dort, mehr oder weniger dem Wahnsinn verfallen, als schmuddeliger Messi angesiedelt, der im klaren Gegensatz zur Glitzerwelt der Klytemnestra steht, die in der oberen, nicht sichtbaren Etage des Palastes verortet ist. Das Restriktive ihrer Herrschaft spiegelt sich auch in den Kostümen (Bianca Deigner) wieder: Weinroter Kunstlederdress, bei den Mägden kombiniert mit grauen Blusen, bei der Aufseherin komplett in Leder und körperbetont, lassen die Diener zu einer Art Lageraufseher werden.
Der inszenatorische Ansatz, dass Elektra über die Habseligkeiten des Vaters wacht, die für die sie umgebende Welt nur noch Müll sind, ist sicherlich gut gedacht. Das wird einmal sinnfälliger, steht dieses Wegwerfen von menschlichem Hab und Gut im Kontrast zu der Wuchtigkeit und der Beständigkeit des Ortes, in dem sich die Tragödien und somit das Wegwerfen und auf den Müll kippen scheinbar immer wiederholt (so landen auch Klytemnestras und Aegisths Habseligkeiten auf dem Müllberg, in dem Elektra schließlich untergeht). So ist Enrico Lübbes Inszenierung in ihrer Gesamtheit zwar kein Ärgernis, aber ein großer Wurf ist sie auch nicht. Die Personenführung ist solide und nah am Text, die Grundüberlegung und das Setting sind nachvollziehbar, aber dann kommen ein paar wenige Regieeinfälle, wie etwa eine Horde Statisten, die mit Beil über die Bühne laufen und wohl dem Wahn Elektras entstammen, die es einfach nicht braucht.
Der Abend lebt letztendlich durch eine atmosphärische Dichte, die ein phänomenales Ensemble spielerisch, wie musikalisch erschafft. Allen voran ist die estnische Sopranistin Aile Assonyi in der Titelpartie zu nennen, die eine unglaubliche Leistung abliefert. Im Spiel mitreißen, im Gesang eine Wucht meistert sie die Strauss’sche Höllenpartie souverän und in allem so intensiv, dass dem Zuschauer nicht nur einmal ein Schauer über den Rücken läuft. In den Piani vielleicht manchmal ein bisschen zu dezent, vermag sie aber gerade in den groß instrumentierten Passagen mit viel Strahlkraft in der Stimme sich mühelos über das Orchester hinwegzusetzen. Als Elektras Schwester Chrysothemis steht Manuela Uhl auf der Bühne, die diese Partie mit jugendlicher Leichtigkeit, mit einer gewissen Zartheit im Spiel anlegt, stimmlich aber dann doch mit der nötigen Dramatik überzeugt. Als Klytemnestra überzeugt Nicole Piccolomini, die in hautenger goldener Glitzerrobe, eine wirklich menschlich widerwärtige Herrschermörderin gibt (und das sei in diesem Kontext absolut als Kompliment zu verstehen!). Ihre Stimme ist gerade in den Tiefen von einer Glut getragen, die der Partie wunderbar zu Gesicht steht. Die Partie des Orest wird von Martin Tzonev gesungen, der den Heimkehrer mit viel Düsternis in Spiel und Stimme umzusetzen vermag. Als Aegisth überzeugt Johannes Mertes, der mit viel Strahlkraft in der Stimme den szenisch recht schmierig anlegten Geliebten Klytemnestras gibt. Die kleinen Partien sind in ihrer Leistung recht durchwachsen besetzt: So überzeugen die fünf Mägde (Susanne Blattert, Anjara I. Bartz, Rose Weissgerber, Charlotte Quadt und Louise Kemény) mit quirligem Spiel und musikalischer Akkuratesse absolut. Solide Leistungen in ihren kurzen Partien zeigen: Katrin Stösel als Schleppträgerin, Ji Young Mennekes als Vertraute, Algis Lunskis als alter Diener und Egbert Herold als Pfleger des Orest. Jeanette Katzer als Aufseherin bleibt stimmlich sehr dezent und erzeugt so einen Widerspruch zu der durch ihr Kostüm forcierten Brutalität. Jae Hoon Jung als junger Diener war bereits in der sechsten Reihe nicht mehr zu hören und fiel so deutlich aus dem Rahmen eines ansonsten musikalisch umwerfenden Abends.
Dass dieser Abend so eine musikalische Glanzleistung wurde, liegt nicht zuletzt an der exzellenten Leistung des Bonner Beethovenorchesters unter der Leitung von Dirk Kaftan. Der Dirigent musiziert einen wirklich exzellenten Strauss, der zwischen dröhnender Wuchtigkeit und schwelgerischem Musizieren der großen Bögen, zwischen Schroffheit und Lyrischem immer wieder neu differenziert wird. Exaktheit und eine hervorragende Ausgewogenheit zwischen Bühne und Graben machen diese Elektra auf der musikalischen Seite zu einer wahren Freude.
Am Ende des Abends ist das Publikum im nahezu ausverkauften Bonner Opernhaus regelrecht aus dem Häuschen. Phrenetischer Beifall für die Protagonisten, Dirigent und Orchester lassen einen wirklich beeindruckenden Opernabend enden.
Sebastian Jacobs 24.3.2019
Elektra
Premiere: 10.3.2019
Tod unter Müllsäcken

Der Vorhang ist offen, so daß man gleich ausreichend Zeit hat, das fantastische Bühnenbild von Etienne Pluss in Augenschein zu nehmen. Es zeigt einen über Eck führenden Treppenaufgang mit kostbarem Geländer, vorbeiführend an hohen Fenstern, gekrönt von einem Lüster. Die eigentliche Spielfläche ist ein geräumiger Keller, in welchem Müllsäcke und allerlei Zivilschrott gestapelt sind, darunter ein Trichtergrammophon. Die Handlung spielt sich also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Die fünf Mägde, im identischen Outfit eher wie Hostessen wirkend (Kostüme: Bianca Deigner), werfen weitere graue Säcke von oben herunter und erhöhen mit ihnen den Müllberg extrem. Gut, denkt man, ein interessanter interpretatorischer Akzent, der vielleicht noch etwas hergibt. Oben also die vornehme Residenz von Klytämnestra, unten die Absteige, in welcher Elektra ihr beklagenswertes Leben fristet.
Dann holen die Hostessen einen Tisch herein und decken ihn für zwei Personen. Wer mögen diese beiden wohl sein? Zum einen Klytämnestra. In ihrem Goldglitzergewand wirkt Nicole Piccolomini in keinster Weise „verwüstet“, strahlt vielmehr starke Eleganz aus, auch vokal. Sie schreitet die Treppe herab und sieht sich plötzlich mit ihrer ausgestoßenen Tochter konfrontiert. Warum aber ihre Erschrockenheit, fragt man sich und den vor allem in Leipzig wirkenden Regisseur Enrico Lübbe.

Es ist doch für zwei Personen angerichtet. Während Klytämnestra von ihren fürchterlichen Träumen erzählt, gönnt sich Elektra immer wieder mal ein Schluck Wein. Eigentlich ein Affront für ihre doch so giftige Mutter. Auch bei einer Fleischplatte langt sie ordentlich zu, läßt dabei freilich ein Messer blitzen und stößt es dann in den Braten (ob Kalb, Huhn oder Rind ist nicht erkennbar).
Beim Monolog „Allein. Weh ganz allein“ ist Elektra das mitnichten. Vielmehr treten paarweise acht Elektras und Orests auf und steigen die Treppe hinan. Schon klar, das sind Wunschvorstellungen von Rache - aber muß das so massiv bebildert werden? Und dann stehen die Orests auch noch in Reih und Glied und schlagen mit Äxten auf den Boden. Wer jetzt die Situation noch nicht kapiert hat, dem ist nicht zu helfen. Die ganze Statistenriege samt Hostessen unterstützt später auch Klytämnestras Lachen. Der ganze Saal ist dann von Schallexplosionen erfüllt.
Enrico Lübbe neigt dazu, Intimes zu veräußerlichen. Darüber vergißt er mitunter auch Vorgaben des Hofmannsthal-Textes. Beispielsweise entflieht die fünfte Hostesse nach ihrer Anklage in das obere Stockwerk. „Sie schlagen mich“ ruft sie verzweifelt. Aber ihre Kolleginnen sind noch alle auf der Bühne. Vor dem Orest-Auftritt sucht Elektra vergeblich im Müllhaufen nach dem vergrabenen Beil und findet es nicht. Zum Schluß jedoch ein Griff nur, und sie hält es in der Hand. Überhaupt dieses Finale. „Schweig und tanze“ singt Elektra. Die stumme Körpersprache ist also ihr elementares Ausdrucksmittel. Der Regisseur läßt sich die Protagonistin indes mit Müllbeuteln exaltieren, gemeinsam mit den Hostessen, die doch eigentlich ihre Gegnerinnen sind. Zuletzt versinkt sie in dem ganzen Plunder.

Einige positive Aspekte der Inszenierung seien nicht unterschlagen. Das sind die Momente von Elektra mit sich selbst, mit ihrer Schwester Chrysothemis und dann mit ihrem Bruder Orest. Der ist körperlich verkrüppelt, hat nur noch den rechten Arm und hinkt mühsam. Daß ihn der Muttermord für die Zukunft zeichnet, macht Lübbe erfahrbar. Aber in summa wird seine Inszenierung dem komplexen Psychodrama von Strauss/Hofmannsthal höchstens ansatzweise gerecht.
Unter Dirk Kaftan spielt das Beethoven Orchester hochkonzentriert und vibrierend. Man kann in den Klangfluten regelrecht untertauchen, vernimmt aber auch die vielen raffinierten Farbdetails der Partitur. Mit Aile Asszonyi in der Titelpartie wird der Dirigent zu Recht am nachdrücklichsten gefeiert.
Die estonische Sopranistin ist wirklich superb. Selbst in hochdramatischen Passagen bleibt ihre Stimme bei aller vokalen Power weich gerundet: diese Elektra ist keine bloße eine Mänade, sondern ein armes Wesen, welches alle Fraulichkeit in sich unterdrückt hat. Im Zwiegespräch mit Orest wird ihr dieser selbst auferlegte Verzicht wieder schmerzhaft bewußt („Ich glaube, ich war schön“). Man leidet mit dieser Elektra.

Manuela Uhl gibt eine soprankernige Chrysothemis mit viel eigenem Leidpotential, Martin Tzonev einen in sich gekehrten, schicksalsbelasteten Orest. Die Tenöre Johannes Mertes (Ägisth) und David Fischer (Junger Diener) beeindrucken stark. Bei den anderen Ensemblesängern gibt es Licht und Schatten.
Einige waren bereits an der letzten Bonner „Elektra“ vor einem Jahrzehnt beteiligt, so auch Mark Morouse, welcher als Orest diesmal vorerst nur für eine einzige spätere Aufführung angekündigt ist. Das Dirigat oblag 2009 dem damaligen GMD Stefan Blunier, Regie führte Intendant Klaus Weise. Auf Youtube gibt es von der Aufführung Ausschnitte zu sehen.
Christoph Zimmermann (11.3.2019)
Bilder (c) Thilo Beu