


www.theater-osnabrueck.de/
LUCIA DI LAMMERMOOR
Besuchte Vorstellung: 25.01.2022 (Premiere: 22.01.2022)
Düstere Wasserspiele in Osnabrück
Lieber Opernfreund-Freund,
eine musikalisch grandiose Lucia di Lammermoor ist derzeit in Osnabrück zu erleben. Sophia Theodorides präsentiert dem Osnabrücker Publikum dabei eine intensive Interpretation der Titelfigur auf Weltklasseniveau, doch die düstere Lesart von Sam Brown überzeugt nicht ganz.

Bei Sam Brown ist alles schwarz. Mäntel, Stühle, Haare, Kostüme, Schuhe – ohne die ausgefeilte Lichtregie wäre gar nichts von den Kostümen von Sarah Mittenbühler zu erkennen. Wäre da nicht sie, Lucia, die Lichtgestalt, blond und weiß gekleidet – zumindest, bis sie zur Mörderin und verrückt geworden ist, strahlend und Mittelpunkt von allem. Kein schlechter Ansatz, möchte man meinen, der zusammen mit den Videos von Per Rydnert nicht nur Stimmungen erzeugt, sondern die dunklen Abgründe, die Seelenzustände der Protagonisten zeigt. Doch wann ist wer auf die Idee gekommen, ein ungefähr 4 mal 15 Meter großes Wasserbassin auf die Bühne von Bengt Gomér zu stellen und alle permanent darin herumplantschen, umherwaten und sich ins Nass niedersinken zu lassen. Und vor allem: warum? Die Antwort bleibt der Regisseur schuldig, so bleibt das Ding über weite Strecken so sinnlos wie überflüssig. Verstehen Sie mich nicht falsch, lieber Opernfreund-Freund, es sind mitunter stimmungsvolle Bilder, die Sam Brown da gelingen, gerade die Wahnsinnsszene macht Gänsehaut; das hätte sie aber wohl auch ohne das Element Wasser, ohne die zusehends enervierende akustische Beeinträchtigung und das allgegenwärtige Plitschplatsch. Das ist so schade, weil doch sonst alles so schön klingt am gestrigen Abend.

Und da ist vor allem wieder sie, Lucia, die Lichtgestalt, die in Sophia Theodorodes eine temperamentvolle Interpretin findet, aus der scheinbar mühelos halsbrecherische Koloraturen strömen und die höchste Höhen zeigt. Dabei spielt sie hervorragend die zutiefst verzweifelte Frau, legt deren Innenleben offen und berührt durch ihr intensives Spiel ebenso wie durch ihren betörenden Gesang. Auch Oreste Cosimo als Edgardo bleibt nichts schuldig, trumpft mit kraftstrotzendem Tenor ebenso auf wie mit vollem Körpereinsatz und ist optisch wie akustisch purer Genuss – auch wenn ihn Sam Brown die komplette zweite Hälfte des Abends lang die Urne mit der Asche seines Vaters über die Bühne tragen und am Ende, wen wunderts, ins Bassin kippen lässt. Rys Jenkins gibt voller Inbrunst und raumgreifendem Bariton Lord Ashton, den despotischen Bruder Lucias, Erik Rousi steigert sich als Raimondo bis zur letzten Szene stetig hin zu einem ebenso überzeugenden Rollenprofil. James Edgar Knights Stimme ist reichlich nachgedunkelt, seit ich sie vor Jahren in Karlsruhe zuletzt gehört habe, hat zudem enorm an Volumen zugelegt. So gelingt dem Neuensemblemitglied ein durchweg überzeugender Arturo, während der satte, expressive Mezzo von Olga Privalova für die Alisa schlicht eine Luxusbesetzung ist.

Der Chor wirkt zu Beginn noch wenig uneins. Das liegt zum einen an der teils wirren Personenführung in den Ensembleszenen, teils an unsauberen Einsätzen. Nach der Pause hingegen glänzen die von Sierd Quarré betreuten Sängerinnen und Sänger mit wohlabgestimmten Schöngesang und wirken auch in der Szene in jedem Wortsinn besser aufgestellt. Im Graben gefallen Daniel Inbal vor allem die düsteren, schweren Seiten der Partitur. Dabei bleibt bisweilen eine gewisse Leichtigkeit auf der Strecke, die Donizetti in einzelnen Szenen durchaus vorgesehen hat. Das aber ist Jammern auf hohem Niveau. Inbal erweist sich erneut als einfühlsamer, dem Sängerpersonal ergebener Dirigent.

Das FFP2-bemaskte Publikum (ich hatte mir auf den letzten Drücker noch schnell eine aus der Apotheke um die Ecke besorgt – ein Hoch auf den Föderalismus, auch im Kulturbereich) ist am Ende der Aufführung zu Recht aus dem Häuschen, applaudiert begeistert und schier endlos. Ich kann das völlig nachvollziehen, ist doch der Abend musikalisch Belcanto vom Allerfeinsten mit Sophia Theodorides als exzeptioneller Interpretin der Titelfigur. Hoffentlich bleiben ihr nach dem dreistündigen Bad Stimme und Gesundheit erhalten.
Ihr
Jochen Rüth
26.01.2022
Die Fotos stammen von Stephan Glagla.
Zusammen einsam
Trouble in Tahiti
als virtuelle Produktion des Theaters Osnabrück
Online-Premiere: 20.02.2021
Lieber Opernfreund-Freund,
wir haben alle mehr oder weniger unter den Maßnahmen des Lockdown zu leiden. Doch wenn Friseure, Textileinzelhändler und Restaurants bei einer Anpassung der Verordnung binnen Tagen reagieren, die Läden wieder öffnen und die Öfen wieder anheizen können, sieht das im Theaterbetrieb anders aus. Produktionen brauchen hier wochen- oft monatelange Zeit zum Planen, Konzeptionieren, Schneidern und Proben, ehe sie aufführungsreif auf eine Opernbühne gebracht werden können. Deshalb wurde die vom Theater Osnabrück für den 21. Januar geplante Neuproduktion von Leonard Bernsteins Einakter Trouble in Tahiti nicht gestrichen, sondern ins Internet verlegt. Dort ist – gegen Gebühr – eine vorproduzierte Version der Produktion abrufbar und die habe ich mir gerne bei erster Gelegenheit am vergangenen Samstag für Sie angesehen.

Leonard Bernsteins Trouble in Tahiti aus dem Jahr 1952 erzählt von Dinah und Sam, deren Ehe sich totgelaufen hat, auch wenn sich beide nach Geborgenheit sehnen. Sie haben einander nichts mehr zu sagen, leben nebeneinander her, streiten, wann immer sie sich miteinander beschäftigen, und finden ihr kleines Stückchen Glück nur, wenn sie sich in ihre jeweiligen Idealwelten zurück ziehen. Sam findet es als mehr oder weniger erfolgreicher Geschäftsmann, Dinah sieht sich am liebsten Hollywoodschnulzen an und flüchtet sich dabei in eine Traumwelt. Als beide die Schulaufführung des gemeinsamen Sohnes versäumen, weil sie auch dafür zu beschäftigt mit sich selbst sind, besprechen sie den Vorfall keineswegs, sondern gehen zusammen ins Kino, um sich den neuesten Schmachtfetzen anzusehen, der Trouble in Tahiti heißt und der rund 50minütigen Oper ihren Namen gibt.

In Osnabrück sind dem kurzen Einakter insgesamt knapp 15 Minuten aus Bernsteins Arias and Barcarolles als Prolog vorangestellt, die in einer ersten Version 1988 uraufgeführt wurden. Sie erzählen in diesem Kontext die glücklichen Anfänge der Beziehung zwischen Dinah und Sam, die Geburt des Kindes, aber auch, wie sich allmählich der Alltag und das Schweigen in die Ehe der beiden schleicht. Das Orchester hat der junge Regisseur Guillermo Amaya hinter eine Gaze hinter der Szene gestellt, so bekommt das ohnehin schon reichlich verjazzte Werk einen zusätzlichen Swing-Konzert-Touch. Dem hat Amaya aber auch inszenatorisch wenig entgegen zu setzen; dies mag zum einen den coronabedingten Abstandsregeln, die auch auf der Bühne einzuhalten sind, geschuldet sein – mit mehreren Metern Abstand ist Interaktion nicht einfach. Auf der anderen Seite zeigt er so das Erstarren in der eigenen Welt, das Nichtherauskönnen aus der eigenen Haut und damit die verfahrene Beziehung, in der die beiden Eheleute stecken; mir nimmt Amaya aber den Ansatz „Zwei Menschen, zwei Monologe“ über weite Strecken dann doch zu wörtlich. Dabei weiß der gebürtige Spanier durchaus, in Szene zu setzen; zumindest tut er dies vorzüglich, wenn es um die spärlich eingesetzten, symbolträchtigen Requisiten geht, die Jörg Zysik auf der unterteilten Osnabrücker Bühne platziert hat. Der Umgang mit Dinahs Brautschleier (Kostüme: Nathalie Himpel) oder das wiederholte Einblenden eines Kindermobiles verschaffen Gänsehaut. Und rechtzeitig, bevor der Zuschauer vor dem Laptop sich aktionsreicheren Dingen als dem Video zuwendet, rettet der lebendige Schnitt von Maria Rabanus die Szene – oder ein kurzer Auftritt des Jazztrios, das eine Mischung zwischen Erzählerrolle und Sparringspartner einnimmt.

Musikalisch kommt dieser Bernstein wie eine Mischung aus Filmmusik und Musical daher. Die eingängigen Melodien erweckt An-Hoon Song beschwingt und übersprudelnd zum Leben, findet da und dort die nötige Zurückhaltung, um dem Sängerpersonal Raum zu lassen und verleiht seiner präzisen Interpretation den nostalgischen Glanz der 1950er Jahre. Das bereits erwähnte Jazztrio besteht aus Erika Simons, Mario Lee und Mark Hamman, erinnert mich irgendwie an Manhattan Transfer und ist trotz der räumlichen Trennung so perfekt aufeinander abgestimmt, dass man sie von den Brettern am Domhof in Osnabrück direkt auf eine Bühne in Las Vegas stellen könnte. Da macht das Zusehen und -hören ebenso viel Freude, wie bei Jan Friedrich Eggers, dem der dandyhafte Stil des Sam sehr liegt und der Gefühl vermittelt ohne weichzuspülen und als überforderter Geschäftsmann fast so energisch auftreten kann, wie im Streit mit seiner Frau. Die findet in Susann Vent-Wunderlich eine ideale Interpretin, die Zartheit und Emotion mit größter Spielleidenschaft paart, die mich mit schwebenden, zu Herzen gehenden Tönen packt und einmal mehr zeigt, was für eine wandelbare Künstlerin sie ist.

Und wie erging es mir auf der anderen Seite des Bildschirms? Es ist schön und aller Ehren wert, wenn Theater in diesen besonderen Zeiten nach besonderen Lösungen suchen; aber ich hatte das Gefühl, eine DVD anzuschauen, kann vor- oder zurückspulen, die Aufführung anhalten, wann immer es mir passt. Mir fehlt die Abgeschiedenheit des Zuschauerraums, auch wenn es durchaus etwas für sich hat, einer Aufführung mit einem Glas Wein in der Hand und ein wenig Knabberei zu folgen. Und mir fehlte das konzentrierte Zusehen und Zuhören, zu der mich ein Theaterbesuch verpflichtet. Und dennoch habe ich mich sehr auf den Abend gefreut, habe ihn wie einen „echten“ zu genießen versucht – und das rate ich auch Ihnen. Ein Ersatz für ein Liveerlebnis kann das niemals sein – aber ein Besser-als-nichts ist es allemal. Also schauen Sie sich nicht zum xten Mal die Netrebko/Villazon-Traviata auf DVD an, lieber Opernfreund-Freund, sondern sehen Sie sich auf den Seiten des Theater Osnabrück um, auf denen fast 10 Produktionen aus Schauspiel und Konzert, aus Ballett und Musiktheater aufs Entdecktwerden warten. Sie finden diese unter https://www.theater-osnabrueck.de/spielplan/digitales-theater.html
Ihr
Jochen Rüth
22.02.2021
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
Psychogramm einer trauernden Königin
DIDO UND AENEAS
Premiere: 26.09.2020
besuchte Vorstellung: 27.09.2020
Lieber Opernfreund-Freund,
am vergangenen Samstag hatte die Neuproduktion von Henry Purcells Dido and Aeneas im Theater am Domhof in Osnabrück Premiere. Die wollte ich mir nicht entgehen lassen und habe mir deshalb gestern direkt die zweite Vorstellung für Sie angesehen. Der junge Regisseur Dirk Schmeding wählt einen interessanten Regieansatz und der Abend besticht darüber hinaus durch eine schlicht perfekte musikalische Umsetzung.

Wenn man den Zuschauerraum betritt, ist bereits ein großer Rahmen zu sehen, der die Bühne umgibt. DIDO steht rechts oben in der Ecke – und diese Bild beschreibt treffend, was wir in Osnabrück in der kommenden guten Stunde zu sehen bekommen. „Alles ist Dido“ möchte man resümieren, denn Dirk Schmeding nimmt den Titel der Oper, der auf Vergils Aeneis fußt, wörtlich und zeigt nur zwei Figuren: eben Dido, die Gründerin Karthagos und noch vor der Hochzeitsnacht zur Witwe geworden, und Aeneas, trojanischer Sohn der Göttin Aphrodite. Alle anderen Protagonisten sind nur Facetten von Dido selbst: die umsorgende Belinda, der aufmunternde Chor, die böse Zauberin und ihre Hexen sind allesamt nur Teile von Didos Persönlichkeit. Sinnfällig dargestellt ist das sowohl in den türkisenen Kammern, die Martina Segna auf die Osnabrücker Bühne gestellt hat und in denen die einzelnen Figuren – von Plexiglas umschlossen – gefangen sind, aber auch im gleichen schicken Rockmantel, in den Frank Lichtenberg alle Sängerinnen und Sänger hüllt. Dido ist in ihrer Trauer, in ihrer eigenen Welt gefangen, dem stürmischen Womanizer Aeneas gelingt es nicht, zu ihr durchzudringen, auch wenn sie sich nach Nähe sehnt. Die Jagdszene, die bei Schmeding die Jagd von Aeneas nach Dido zeigt, ist sexuell aufgeladen, endet jedoch als erotischer Rohrkrepierer. Intimität zulassen kann Dido nicht – und so sind auch die Videoeinspielungen von Johannes Kulz für den Zuschauer die einzige Möglichkeit, sich Dido zu nähern und ihre Augen, Spiegel zur Seele und wohl deshalb von den Sängerinnen und Sängern über weite Strecken mit Sonnenbrillen bedeckt, und ihr Gesicht in Close-ups zu sehen und Emotionen sehr unmittelbar wahrzunehmen. Ich persönlich bin zwar grundsätzlich kein Freund von offen inszenierten Schlußszenen, wie Schmeding sie gestern zeigt – das aber ist gestern nur ein kleiner Wermutstropfen in einem ansonsten rundum gelungenen, tiefgründigen Psychogramm der weiblichen Titelfigur.

Und auch musikalisch hadere ich allenfalls mit dem sportlichen Tempo des Schlussgesangs, das so gar nichts von Trauer vermittelt. Ansonsten ist das Dirigat von Daniel Inbal schlicht perfekt zu nennen. Er spornt die Musikerinnen und Musiker, die gestern auch Theorbe oder Barockgitarre spielen, in den Instrumentalpassagen grundsätzlich zu lebendigen Tempi an, ermuntert Instrumentalisten wie Sänger zu fantasievollen Verzierungen und lässt so die Partitur selbst Kennern immer wieder frisch und neu erscheinen. Der warme Mezzo von Olga Prilova, die gestern die Titelpartie übernimmt, überzeugt mich durch die reichen Emotionen, die er vermittelt ebenso, wie durch makellose Technik, die der Litauerin schier endlose Melodienbögen ermöglicht. Stimmlicher Gegenpart zur feinen Dido ist nicht der Aeneas, den Daniel Wagner mit schlankem Tenor und viriler Aura gestaltet, sondern die Zauberin von Rhys Jenkins, der seinen imposanten Bariton dazu mit dämonischen Farben schmückt. Marie-Christine Haase ist als Belinda mitfühlend, während Gabriella Guilfoil die Second Woman eher forsch anlegt und dabei die volle Power ihres satten Mezzos zeigt. Beide mischen als Hexen ihren Stimmen jeweils schrille Klänge bei und stellen damit ihre ungeheure Wandlungsfähigkeit unter Beweis.

Der Opernchor singt aus dem Off, doch vier Chorsolisten sind als Alter Egos von Dido nahezu omnipräsent. Der feine Gesang von Elena Soares da Cruz, Kathrin Brauer, Mario Lee und Seokwon Oh fügt sich auch auf der Bühne ideal in das Klangbild der Solisten ein, die präzise Einstudierung von Seird Quarré ist hier deutlich spürbar. Überhaupt merkt man am gestrigen Abend, dass sich Daniel Inbal Gedanken gemacht hat, wie Stimmen zusammen funktionieren. Die Paarung Prilova (Mezzo)/Wagner (Tenor) ist klanglich ebenso interessant wie die der Alternativbesetzung Vent-Wunderlich (Sopran)/Eggers (Bariton) und, dass die androgyne Rolle der Zauberin mit einer Männerstimme besetzt ist, bereichert nicht nur das Klangspektrum (Aeneas und der Seemann wären ansonsten mit ihren vergleichsweise kleinen Partien die einzigen tiefen Register), sondern betont gleichzeitig die dunkle Seite Didos im Zusammenspiel mit dem gelungenen Regieansatz von Dirk Schmeding.
Die Vorstellung ist ausverkauft – auch wenn in diesen Tagen nur einzelne Plätze besetzt sein dürfen und das Osnabrücker Haus hier ein ausgeklügeltes Hygiene- und Zugangskonzept erstellt hat. Pure Begeisterung schlägt sämtlichen Beteiligten am Ende des Abends entgegen – und auch ich kann Ihnen diese interessante Produktion wärmstens ans Herz legen.
Ihr
Jochen Rüth
28.09.2020
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg und zeigen teilweise die Alternativbesetzung.
Märchenstunde mit Licht und Schatten
La Cenerentola
Premiere: 18.01.2020
besuchte Vorstellung: 22.01.2020
Lieber Opernfreund-Freund,
Gioachino Rossinis Aschenputtel-Version La Cenerentola ist derzeit am Theater am Domhof in Osnabrück zu sehen. Die deutsch-französische Regisseurin Béatrice Lachaussée hat eine unterhaltsam-witzige Produktion auf die Bühne gebracht, allerdings überzeugt die musikalische Seite des Abends nicht auf ganzer Linie.

Ensemble-Theater stehen mitunter vor dem Problem, dass sie manche Partien nicht mit eigenen Sängern besetzen können und deshalb auf Gastsolisten zurückgreifen müssen. Von außen betrachtet böte sich damit die Möglichkeit, wirklich rollengerecht zu besetzen – und immer wieder ist zu beobachten, dass Theater diese Gelegenheit nicht nutzen. Das scheint viel weniger nachvollziehbar, da man in so einem Fall ja nicht Herrn X die Rolle Y, die nicht ganz zu Umfang und Farbe passt, singen lassen muss, nur weil er im Ensemble ist, sondern auf dem freien Markt vermeintlicherweise aus dem Vollen schöpfen kann. Deshalb ist es schwer zu erklären, dass die Rolle des Prinzen Don Ramiro in die Hände des Gastsolisten Miloš Bulajić gelegt wurde. Der Spross einer serbischen Musikerfamilie verfügt durchaus über rossinihaft-schlanke Höhe voll großer Klarheit, die Spitzentöne der Partie erreicht er scheinbar mühelos und zeigt dazu gern, über wieviel Kraft er dabei verfügt. Doch sein Brustregister klingt dagegen derart unausgewogen, stark tremolierend und beinahe brüchig, dass der Gesamteindruck doch hinter der Leistung des angestammten Sängerpersonals zurückbleibt. Das mag auch daran liegen, dass seine Bühnenpartnerin Olga Privalova, die am gestrigen Abend die Cenerentola überhaupt erst zum zweiten Mal singt, stimmlich und darstellerisch derart auftrumpft, dass man dagegen nur verlieren kann, wenn man nicht vollends abliefert. Die aus Litauen stammende Mezzosopranistin ist seit dieser Saison im Osnabrücker Ensemble und zeigt neben einer satten Tiefe eine beeindruckende Geläufigkeit und emotionalen Tiefgang und setzt dieser gesanglichen Topleistung mit ihrem schauspielerischen Talent das Sahnehäubchen auf. So verkörpert sie glaubhaft die Verwandlung vom schüchternen, unterdrückten Aschenputtel zur so schönen wie selbstbewussten Frau, die den vermeintlichen Kammerdiener um sich kämpfen lässt.

„Ja bin ich jetzt im falschen Märchen“ mögen Sie denken, lieber Opernfreund-Freund; deshalb sei erwähnt, dass die Vorlage zur Rossini-Oper nicht die Grimm‘sche Version mit Täubchen, verlorenem Glaspantoffel und böser Steifmutter ist, sondern dass das Libretto von Jacopo Ferretti auf dem französischen Cendrillon von Charles Perrault beruht; hier will der Prinz inkognito den Charakter der Heiratskandidatinnen testen, tauscht mit seinem Diener Dandini Kleider und Rolle und schaut sich im Haus des bankrotten Adeligen Don Magnifico um, der neben Clorinda und Tisbe noch eine Stieftochter namens Angelina hat, die von der angeheirateten Verwandtschaft wie eine Magd behandelt und nur Cenerentola (Aschenputtel) genannt wird. Am Ende der Oper gibt es dann ein großes Vergeben und Vergessen der frisch gebackenen Königin, ehe Rossini sein Werk voll eingängiger Melodien mit einer mitreißenden Tutti-Nummer krönt.

Béatrice Lachaussée ersinnt dazu eine spaßig-kurzweilige Inszenierung vor der trotz Goldregen und angedeuteter Sternschnuppen recht simplen Kulisse von Nele Ellegiers, die auch für die schrill-bunten Kostüme und die herrlich wahnwitzigen Perücken verantwortlich zeichnet. Der Herrenchor unter der Leitung von Sierd Quarré gerät dabei beinahe zum heimlichen Star der Inszenierung, setzt immer wieder urkomsiche Akzente wie beispielsweise in der Gewitterszene und singt dazu vortrefflich. Nicht ganz so sauber abgestimmt geht es zwischen Graben und Bühne zu. Zwar geht Daniel Inbal durchaus frech und beschwingt ans Werk, schießt dabei aber das eine oder andere Mal ein wenig übers Ziel hinaus und lässt es an Präzision vermissen, so dass das Osnabrücker Symphonieorchester stellenweise wie eine Blaskapelle aus Rimini klingt. Jan Friedrich Eggers überrascht mich mit seinem komödiantischen Talent, rettet durch seine Bühnenpräsenz so manche Szene und singt dazu einen beachtenswerten Dandini mit bestens verständlichem Rossini-Parlando. Dagegen scheint sich Genadijus Bergorulko bisweilen in eine Art Sprechgesang zu retten, statt die Partie des Don Magnifico voll auszusingen – das macht er aber mit gutem Gespür für Timing und beherztem Spiel wett. Erika Simons und Gabriella Guilfoil sind ein herrlich-fieses Stiefschwesterngespann, dass der Cenerentola von Olga Prilova nicht nur ordentlich zu-, sondern auch stimmlich einen Sopran von feiner Leichtigkeit und einen ausdrucksstarken Mezzo entgegensetzen. José Gallisa wird als Alidoro bei Lachaussée zum Zauberer mit allerhand echten Tricks und zaubert darüber hinaus so stimmungsvolle wie eindringliche Momente mit seinem mächtigen Bass.

Dem Publikum gefällts und auch ich hatte einen unterhaltsamen Abend und habe mich köstlich amüsiert. Ich hätte mir bisweilen nur eine geeignetere Besetzung und ein wenig mehr musikalische Präzision gewünscht – aber letztere kann sich in den folgenden Vorstellungen ja noch einstellen.
Ihr
Jochen Rüth
23.01.2020
Die Bilder stammen von Jörg Landsberg.
FALSTAFF
Premiere: 28.09.2019
besuchte Aufführung: 02.10.2019
Verdis Alterssünde
Lieber Opernfreund-Freund,
nach dem fulminanten Spielzeitabschluss mit der Ausgrabung von Albéric Magnards Guercœur-Epos, die bundesweit für Aufsehen sorgte, startet das Theater Osnabrück vergleichsweise konventionell in die neue Spielzeit. Verdis Spätwerk Falstaff steht auf dem Programm und man setzt dabei in der Friedensstadt die Zusammenarbeit mit Adriana Altaras fort, die mit ihrer tiefgründigen Lesart des Rigoletto in der Spielzeit 2016/17 schon das letzten Verdi-Werk, das man in Osnabrück aufgeführt hat, zu einem lohnenswerten Musiktheaterabend gemacht hat.

Manch einer ist der Ansicht, Giuseppe Verdis Falstaff stelle den Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens dar. Andere meinen, er hätte sich nach dem Erfolg der dichten, vielschichtigen, psychologisch wie musikalisch packenden Umsetzung von Shakespeares Otello auf seinen Alterssitz St. Agata zurückziehen und den Lebensabend genießen sollen, statt der Welt eine Alterssünde in Form einer Komödie, durchkomponiert und ohne eingängige Arien oder wenigstens musikalisches Ohrwurmmotiv zu schenken. Und in der Tat hat es sein letztes Werk schwer im Vergleich zu den meisten übrigen Opern Verdis, die nach wie vor die Spielpläne der Opernhäuser auf der ganzen Welt wesentlich mitbestimmen. Dabei hatte sich Verdi bewusst für eine Komödie entschieden, erstmals seit dem Misserfolg seiner zweiten Oper Un Giorno die Regno im Jahr 1840. Und nicht nur er stand dem komischen Genre skeptisch gegenüber: mit Falstaff dauerte es genau 50 Jahre, bis nach Donizettis Don Pasquale (1843) ein italienischer Komponist wieder mit einer komischen Oper einen Welterfolg hat erringen können. Und doch sprüht seine Partitur zur Shakespeare-Vorlage vor feinem musikalischen Witz. Die Ironie, ja der der schelmische Humor eines alten Mannes, der mit einer gehörigen Portion Gelassenheit auf sein Leben zurückblickt, ist in jedem Takt spürbar.

Adriana Altaras versucht, diesen augenzwinkernden Geist in ihrer Regiearbeit umzusetzen, ist dabei allerdings nicht immer erfolgreich. Zwar gelingen ihr durchaus Momente subtiler Komik, beispielsweise, wenn sie die stumme Rolle des Wirtes, von Andreas Schön göttlich gespielt, als omnipräsente Figur etabliert, doch gleitet die aus Zagrab stammende Regisseurin, Schauspielerin und Autorin immer wieder auf das schenkelklopfende Niveau einer Millowitschtheater-Produktion ab. Dann lässt sie Falstaff wild und Beine schwingend in Unterwäsche umher tänzeln, leitet Ford mit schrecklicher Perücke ausgestattet zum Overacting an oder lässt Meg Page allzu sehr mit den Augen rollen; auch die Personenführung ist bisweilen so turbulent wie bei einer Massenszene in „Klimbim“. Vielleicht es ist aber auch einfach wie bei Verdi: Adriana Altaras hätte einfach dem treu bleiben sollen, was sie am überzeugendsten umsetzen kann: dem musikalischen Drama. Und doch ist die Produktion lebhaft und durchaus witzig, die Geschichte nie langweilig, die Altaras komplett im Gasthaus „Zum Hosenbande“ erzählt, das wie der Titelheld seine besten Jahre hinter sich hat und reichlich abgehalftert daherkommt (gelungene wandelbare Bühne: Etienne Pluss und Sibylle Pfeiffer). Ein richtiges Konzept konnte ich jedoch nicht erkennen, was gleichermaßen für die durchaus schönen, aber wenig erzählenden Kostüme von Nina Lepilina gilt.

Premierenzeit ist auf der Bühne gleich in mehrerlei Hinsicht: nicht nur, dass dieser Falstaff die neue Spielzeit eröffnet, in der das Symphonieorchester Osnabrück, mit dem GMD Andreas Hotz am gestrigen Abend den feinen Esprit und musikalischen Witz des Falstaff in jeder Sekunde hörbar macht, seinen 100. Geburtstag feiert. Neben dem neuen aus Litauen stammenden Ensemblemitglied Olga Privalova, das sich dem Osnabrücker Publikum als Meg Page erstmals präsentiert und dabei ihren klangschönen Mezzo zeigt, stehen mehrere Gäste zum ersten Mal in Osnabrück auf der Bühne: Jessica Rose Cambio ist eine ausgelassene Rose, verfügt über einen in allen Lagen voluminösen Sopran und bringt zu ihrem Rollendebüt eine ansteckende Spielfreude mit, die auf das komplette Ensemble überzuspringen scheint. Der junge Tenor Yohan Kim hingegen bleibt als Bardolfo im Vergleich zu Ensemblemitglied José Gallisa, der als Pistola eine echte Luxusbesetzung ist mit seinem ausdrucksstarken und raumfüllenden Bass, vergleichsweise blass. Ebenfalls Gast am Haus ist Nana Dzidziguri, die schon als Soufffrance in Guercœur nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht hat und auch als Mrs. Quickley mit süchtig machendem, tiefgründigem Mezzoklang begeistert. Da darf man gespannt sein, wie sich die Georgierin im kommenden Jahr bei ihrem Bayreuth-Debüt präsentieren wird. Zur Osnabrücker Stammbesetzung gehören Daniel Wagner und Erika Simons, die mit zarten Klangfarben ein unschuldig verliebtes Paar als Fenton und Nannetta geben und dabei ebenso zu überzeugen wissen wie Jan Friedrich Eggers mit feinem Bariton als eifersüchtiger Ford.

Der Mann für alle Fälle am Theater Osnabrück, zumindest wenn es um vielschichtige und abgründige Figuren wie Rigoletto, Doktor Faust oder Guercœur geht, ist Rhys Jenkins. Deshalb war ich besonders auf seinen Falstaff gespannt. Und auch hier erweist sich de aus Wales stammende Bariton als Allzweckwaffe, reüssiert mit vorzüglichem komödiantischen Talent, sauberer Stimmführung und raumnehmender Darstellung der Titelfigur. Der von Sierd Quarré betreute Chor ist schließlich das Tüpfelchen auf dem i, um den Abend musikalisch rund zu machen. Das Publikum im recht spärlich besetzten Theater – liegts am Werk oder dem bevorstehenden Brückentagswochenende? – applaudiert freundlich, wenn auch nicht überschwänglich. Und genauso möchte ich mein Resümee des gestrigen Abends verstanden wissen.
Ihr Jochen Rüth 03.10.2019
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg
Albéric Magnard
Guercœur
in deutscher EA am Theater Osnabrück
Premiere: 15.06.2019
Schatz erfolgreich gehoben
Lieber Opernfreund-Freund,
bereits in den vergangenen Jahren hat sich das Theater Osnabrück um die Aufführung von Opernraritäten verdient gemacht und widmet sich in dieser Spielzeit der Oper Guercœur des französischen Komponisten Albéric Magnard, die es nicht nur in deutscher Erstaufführung, sondern auch erstmals seit ihrer unter abenteuerlichen Umständen zustande gekommenen Uraufführung 1931 szenisch zeigt. Und – soviel darf ich vorwegschicken – die Ausgrabung des verschüttet gegangenen Werkes ist auf ganzer Linie gelungen.

„Was von wem?“ mögen Sie sich beim Lesen der Überschrift gefragt haben und deshalb will ich Ihnen gerne etwas über Komponist und Werk erzählen, ehe ich von der gestrigen Premiere berichte. Albéric Magnard, 1865 in Paris geboren, hatte bereits das Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen, ehe er sich nach einer Reise nach Bayreuth, bei der er eine Vorstellung von Tristan und Isolde besucht, am Musikkonservatorium einschriebt und bei Jules Massenet und Vincent d’Indy studiert. Er schreibt zwei Sinfonien und eine erste Oper Yolande, ehe er 1901, inspiriert von der Dreyfus-Affaire, seine Hymne á la Justice op. 14 schreibt. 1904 verlässt der eigensinnige Komponist Paris und zieht aufs Land, distanziert sich aber nicht nur räumlich vom dortigen Musikleben, sondern arbeitet fortan auch nicht mehr mit einem Verlag zusammen, lässt seine Werke selbst von einer Druckerei drucken. Dieser Umstand wird ihm und seinem Werk während des Ersten Weltkriegs zum Verhängnis, als er auf einen deutschen Spähtrupp feuert, der daraufhin Magnards Haus in Flammen setzt – und mit ihm seine unverlegten Kompositionen. Ein Großteil seines Œuvres wird wie sein Schöpfer ein Opfer des Feuers – darunter auch der erste und der dritte Akt seiner Oper Guercœur. Sein lebenslanger Freund, der Komponist und Dirigent Guy Ropartz, hatte den dritten Akt als Teiluraufführung 1908 geleitet, 1910 war der erste Akt im Rahmen der Pariser Concerts Colonne zur Aufführung gelangt. So konnte die fehlende Musik von Ropartz rekonstruiert und posthum 1931 in Paris zur szenischen Uraufführung gebracht werden, ehe das Werk – abgesehen von zwei (Teil-)Einspielungen 1958 und 1986 – in der Versenkung verschwand, bis das Theater Osnabrück es nun dem Vergessen entreißt.

So absonderlich wie die Geschichte des Werkes und seines Komponisten mutet auch die Handlung der Oper an. Der Ritter Guercœur ist im Jenseits angelangt, in dem die Allegorien Bonté (Güte), Beauté (Schönheit) und Souffrance (Leiden) unter der Führung von Vérité (Wahrheit) das Regiment führen. Guercœur fleht darum, auf die Erde zu seiner Frau Giselle und seinem Volk, das er aus der Diktatur in die Freiheit geführt hatte, zurückkehren zu dürfen. Die übrigen Allegorien bewegen Vérité dazu, dem Ritter seinen Körper zurück zu geben, weil der in seinem Leben bisher kein Leid kennen gelernt hatte. Zurück auf der Erde erkennt Guercœur, dass sich seine Frau trotz ihres Treueschwurs seinem ehemaligen Schüler Heurtal zugewandt hat. Der wiederum will sich vom Volk zum Alleinherrscher ausrufen lassen, die Unterdrückung droht wieder einzukehren. Das Volk hält Guercœur, der an es appelliert, für einen Betrüger, und erschlägt ihn, ehe es Heurtal als neuen Herrscher proklamiert. Zurück im Jenseits eröffnet Vérité in einem großen Monolog die Vision von einer besseren Welt ohne Rassen- und Nationengrenzen, ohne Armut und Schmerz, ehe Guercœur von den übrigen Seelen des Jenseits‘ gepriesen wird.

Das Regieteam um den jungen Dirk Schmeding präsentiert das Jenseits des ersten Aktes als düsteren Ort, Guercœur und die anderen Seelen sind buchstäblich entleibt, scheinen auf der pechschwarzen Bühne von Martina Segna ebenso umher zu schweben wie die an Heiligenscheine erinnernde elliptische Beleuchtung. Die gelungenen Videoeinspielungen von Roman Kuskowski verstärken den mystisch-sphärischen Eindruck, Frank Lichtenberg hat die Allegorien in fließende schwarze Roben gesteckt, augenfällige Details und ihr jeweiliges Makeup drücken ihr individuelles Wesen aus. Das ist ebenso stimmig und durchdacht wie der Einfall, den Beginn des zweiten Aktes in und um ein Bett auf einem Podest im Hier und Heute stattfinden zu lassen. Schmeding erweist sich als genauer Beobachter, ehe er mir in der zweiten Hälfte des Erden-Aktes ein wenig zu sehr in die billige Ecke der Regietrickkiste greift, den Volksaufstand mit dann eher überflüssigem Videomaterial untermalen und den Zuschauerraum grob bespielen lässt. Auch im Schlussakt wird allerhand Trockeneis bemüht und doch findet Schmeding am Ende wieder stimmigere Bilder, Sanitäter versuchen vergeblich, Guercœur wiederzubeleben, ehe er eingeäschert wird und es zu Vérités nicht enden wollenden Hymnus an Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe zur Apotheose kommt. Und dennoch hätte ich mir hier eher eine deutlichere Klammer zum Himmel des ersten Aktes gewünscht.

Musikalisch kommt dieses Werk wie eine Art französische Wagner daher, Magnard suhlt sich in den reichen, höchst romantischen Melodien, erinnert in seiner Orchestrierung an Chausson, in seinen Harmonien hört man Anklänge an Debussy und Dukas. Das alles scheint aus dem Taktstock von GMD Andreas Hotz förmlich ins Orchester hinein zu fließen, so sehr strömen die wunderbaren Klänge der Komposition aus dem Graben – nicht nur nur während der an kleine Sinfonien erinnernden Vorspiele, sondern auch während der Begleitung der arienlosen und dabei nicht weniger eindringlichen Gesangsstimmen. Der Chor ist leider von der Regie über weite Teile sehr im Off platziert, so dass die harmonischen Wendungen, die Magnard gerade in den Chorpart gewebt hat, und die große Strahlkraft, mit der die Damen und Herren diesen unter Leitung von Sierd Quarré zum Leben erwecken, ein wenig an Effekt verlieren.

Präsent und kraftvoll gestaltet Rhys Jenkins die Titelfigur, singt nuanciert, leidet und kämpft so packend, dass es einen noch in der letzten Reihe rührt. Susann Vent-Wunderlich legt die Giselle als leidenschaftlich-forderndes Vollweib an, gestaltet aber ebenso farbenreich auch die reuevoll-zögernden Facetten ihrer Figur. Gastsänger Costa Latsos präsentiert als Heurtal strahlende Höhe und glänzt darüber hinaus mit enormer Bühnenpräsenz. Lina Lius klarer Sopran lässt sie die Vérité ganz wunderbar interpretieren, während Katarina Morfa mit Wärme verströmendem Mezzo als Bonté und Erika Simons mit funkelnd-reinem Sopran als Beauté überzeugen. Daniel Wagner formt den Schatten eines Poeten alles anderen als überschattet, sondern voller Verve, während die Souffrance von Nana Dzidziguri nur als anbetungswürdig beschrieben werden kann, so trifft einen die kehlige Tiefe der Georgierin bis ins Mark.

Das Publikum ist zu Recht begeistert, feiert anhaltend alle Beteiligten. Und auch ich kann Ihnen nicht erklären, warum dieses wunderbare Werk 88 Jahre in Archiven schlummern musste. Respekt gebührt dem Theater für seinen Mut und höchste Anerkennung dem Produktionsteam, dem hervorragenden Ensemble und den engagierten Gästen, die diesen Schatz ans Licht gezerrt haben. Der Sinn einer Ausgrabung liegt auch in einer vollständigen Präsentation des Werkes – diesem Anspruch stellt man sich in Osnabrück in vorbildlicher Weise. Dennoch empfehlen sich für hoffentlich folgende Produktionen ein paar Striche im Schlussakt, um dem ein wenig die Längen zu nehmen – mir war das dann doch eine Prise zu viel Ethik-Unterricht. Noch fünfmal haben Sie, lieber Opernfreund-Freund, jetzt aber noch die Gelegenheit, diese Ausgrabung ungekürzt zu erleben. Nutzen Sie mindestens eine! Dabei können Sie sich dann auch die informative Ausstellung ansehen, die sich derzeit im Theater Osnabrück mit diesem Werk und seinem Komponisten beschäftigt.
Ihr Jochen Rüth 16.06.2019
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
PREMIEREN 2019/20
Liebe Opernfreunde,
anbei übersende ich Ihnen eine Liste der in der kommenden Spielzeit geplanten Musiktheater-Produktionen im Theater Osnabrück. Es freut mich stets auf's Neue, spannende Rezensionen und Spielplanperspektiven aus vielen Theatern zu lesen. Für viele Opernfans, wie ich es auch bin, erschließen sich dadurch möglicherweise ungeahnte Theaterbesuche. Leider kann ich mich des oberflächlichen Eindrucks nicht ganz erwehren, dass das Theater Osnabrück, ein alles andere als ein belangloses Mehrspartentheater in Deutschlands Nordwesten, im Vergleich zu anderen Bühnen bisweilen etwas kurz bei Ihnen kommt. Als Seviceleistung für Sie und viele Leser verstehe ich daher die o.g. Liste.
Mit freundlichen Grüßen
Hansjörg Donnerberg
28. September 2019, Theater am Domhof
FALSTAFF
Giuseppe Verdi
30. November 2019, Theater am Domhof
EINE NACHT IN VENEDIG
Johann Strauß
18. Januar 2020, Theater am Domhof
LA CENERENTOLA
Gioachino Rossini
29. Februar 2020, Theater am Domhof
DIE COMEDIAN HARMONISTS –
JETZT ODER NIE
Gottfried Greiffenhagen
18. April 2020, Theater am Domhof
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
Richard Wagner
6. Juni2020, Theater am Domhof
GALATHEA
Walter Braunfels
ORLANDO
Funkelndes Barockjuwel in exzellenter Regie
Premiere: 04.05.2019
Lieber Opernfreund-Freund,
Georg Friedrich Händels erste Beschäftigung mit Ariosts Hauptwerk Orlando furioso (auf Deutsch: der rasende Roland), der 1733 uraufgeführte, hatte gestern am Theater Osnabrück. Dabei sorgt nicht nur die beschwingt-originelle Lesart des jungen Regisseurs Felix Schrödinger dafür, dass der Abend in purem Jubel endet.

Seit 1711 hatte Händel die italienische Oper in England verbreitet, internationale Sängerstars wurden eingekauft und präsentierten dem spektakelverliebten Londoner Publikum eine Schöpfung nach der anderen. Doch nach 20 Jahren wurde zunehmend Kritik laut an den durch die teuren Sänger horrend gestiegenen Eintrittspreise. Auch die 1728 uraufgeführte Beggar’s Opera von John Gay und Johann Christoph Pepusch, einer Persiflage auf den überzogenen Opernbetrieb, sorgte mit dem in der Folge gegründeten Ballad Opera, die ein originär englisches Genre förderte, für Konkurrenz zu Händels Unternehmen. Doch statt sich vom Opernbetrieb zurückzuziehen, brach Händel im Orlando mit Traditionen, schrieb Kurzarien ohne Da-Capo, führte orchesterbegleitete Rezitative ein und präsentierte auch in der Handlung einen Zwitter zwischen ernster und heiterer Oper. 1733 konnte das Londoner Publikum diesen Neuerungen noch nicht allzu viel abgewinnen, heute hingegen bietet dieser Mix aus Drama und Komödie ein herrliches Tableau für originelle Regieideen und eignet sich bestens für eine aktualisierte Umsetzung, wie Felix Schrödingers Arbeit zeigt.

Orlando behandelt das Dilemma des Titelhelden, sich zwischen Liebe und Krieg entscheiden zu müssen, so wie heute (nicht nur) Männer zwischen Karriere und Familie wählen, zwischen Stadt und Land, zwischen ursprünglicher Natur und vermeintlicher Zivilisation. Die beiden Gegenpole werden sinnfällig in einer Parklandschaft gezeigt, in der Natur und Urbanes sich vereinen, die Josefine Smid in genialer Weise auf die Drehbühne des Osnabrücker Theaters gestellt hat. Der Zauberer Zoroastro aus der Vorlage wird zum Imbissbudenbesitzer, der alle, die im Park unterwegs sind, genau beobachtet und deshalb – wie ein Seher – Entwicklungen vorausahnt und auch als einer der ersten bemerkt, dass Angelica sich in Medoro – in Osnabrück ein junger Musiker – verliebt und sich zusehends vom Geschäftsmann Orlando distanziert. Der schwört Rache und verliert den Verstand. Auch Medoros Freundin Dorinda, eine schwärmerische Schülerin, ist tief verletzt, erkennt aber, wohin blinde Liebe führen kann, und unterstützt ihren Exfreund gegen Orlando. Das alles hat dermaßen Hand und Fuß, dass es keine Sekunde konstruiert wirkt. Zusätzliche originelle Ideen Schrödingers, der seit vier Jahren Regieassistent am Staatstheater Oldenburg ist, und die liebevoll-individuelle Gestaltung der übrigen Parkbesucher durch Josefine Smids Kostüme machen das Barockspektakel zum rundum unterhaltsamen Musiktheaterabend im Hier und Heute.

Musiziert wird auf beachtlichem Niveau, wobei bedauernswerterweise ausgerechnet der gastierende Countertenor Antonio Giovannini hinter meinen Erwartungen zurückbleibt. Der junge Italiener braucht fast die komplette erste Hälfte des Abends, um sich freizusingen, ist gerne ein wenig zu tief und agiert so manieriert und barock, als hätte er Gérard Corbiauds Farinelli einmal zu oft gesehen. Das wirkt gerade im Vergleich zum ausgesprochen frisch aufspielenden übrigen Ensemble antiquiert. Hervorragend hingegen gelingt ihm seine Wahnsinnsszene im zweiten Akt und auch im Finalbild spielt und singt er wie befreit auf, zeigt perlende Koloraturen und sauberere Intonation. Ähnliches muss ich beim zweiten Gast des Abends, der in Bremen engagierten Marysol Schalit, nicht bemängeln. Die gebürtige Schweizerin kommt mit einem frischen Sopran voller Klarheit und mit unzähligen Nuancen daher, begeistert mit ansteckender Spielfreude, schlafwandlerisch sicherer Höhe und überzeugendem Ausdruck. Das ist ebenso sehr eine Freude, wie die koloraturfreudige Erika Simons, die die Dorinda ganz nach Schrödingers Regieansatz als mädchenhaft-romantische Figur zeichnet und mich erneut mit ihrer Klangschönheit in ihren Bann zieht. Auge und Ohr kann man ebenfalls kaum abwenden, wenn Katarina Morfa an der Reihe ist, so fesselnd ist das Spiel der Mezzosopranistin, die über einen beeindruckenden Stimmumfang voll dunkler Tiefe verfügt und deren scheinbar mühelosen Verzierungen mich in Timbre und Virtuosität an die junge Marilyn Horne erinnern. Die Partie des Zoroastro ist für Genadijus Bergorulko ein Stückchen zu hoch. Deshalb überzeugt das aus Litauen stammende Ensemblemitglied eher in den tiefen Passagen seiner Partie mit eindrucksvollem Bass – und spielt, wie immer, packend und voller Herzblut.

Im geöffneten Graben hält der Erste Kapellmeister Daniel Inbal die Fäden zusammen, glänzt mit barock-schlankem Strich und freut sich an den opulenten Klangfarben und lässt diese Barockjuwel wahrlich funkeln. Dass es dabei immer wieder zur Überlagerung der Sängerinnen und Sänger kommt, ist kein kleiner Wermutstropfen, schmälert aber den Gesamteindruck nicht. Das Orchester setzt sich aus auch solistisch überzeugend aufspielenden Musikerinnen und Musikern zusammen und so ist es nur recht und billig, dass Inbal beim Schlussapplaus immer wieder einzelne Instrumentalisten beklatschen lässt. Der ist frentetisch und will gar nicht mehr enden, als sich das Produktionsteam zeigt. Wie herzerfrischend ist es doch, zu sehen, was ein engagiert agierendes junge Team zu leisten vermag: es entsteht ein großer Musiktheatermoment und die drei Stunden vergehen wie im Flug.
Ihr Jochen Rüth
05.05.2019
Die Fotos stammen von Kerstin Schomburg.
Mel Brooks
The Producers
Premiere: 23. März 2019
Besuchte Vorstellung: 5. April 2019
TRAILER

Zum großen Musicalerfolg haben es „The Producers“ nie gebracht, obwohl das Stück 2008 im Wiener Ronacher und 2009 im Berliner Admiralspalast zu sehen war. Umso erfreulicher ist es, dass das Theater Osnabrück jetzt eine unterhaltsame Aufführung, die mit dem hauseigenen Ensemble besetzt ist, auf die Bühne bringt.
Das Stück beruht auf dem Film „Frühling für Hitler“ von Mel Brooks aus dem Jahr 1968: Die beiden Musicalproduzenten Max Bialystock und Leo Bloom haben rausgefunden, dass sie bei einem Flopp-Musical die Gelder ihrer Förderer und Sponsoren unterschlagen können. Deshalb wollen sie mit dem Nazi-Musical „Frühling für Hitler“ einen Reinfall produzieren, der dann aber zum Kassenschlager wird.
Operntenor Mark Hamman spielt und singt den Altproduzenten Max als schmierig-gewieften Geschäftsmann. Als verklemmt-neurotische Type gibt Schauspieler Oliver Meskendahl den Leo. Dass Meskendahl in Osnabrück sonst auch Schurken wie den Gessler in „Wilhelm Tell“ spielt, spricht für seine Wandlungsfähigkeit, denn hier präsentiert er sich als großartiger Komiker. Zudem singt er seinen Part mit gut geölter Stimme.

Jan Friedrich Eggers spielt als Regisseur Roger De Bris alle Homosexuellenklischees aus, denn nicht nur bei „Frühling für Hitler“ geht es darum „alle Rassen, Religionen und sexuellen Orientierungen vor den Kopf zu stoßen“. Alt-Nazi Franz Liebeskind wird von Stefan Haschke als Psychopath mit Verfolgungswahn gespielt. Monika Vivell als Ulla bleibt zu sehr im Klischee der drallen nordischen Blondine verhaftet, was sich humoristisch recht schnell erschöpft.
Die Drehbühne von Christian Treunert bietet gute Möglichkeiten für die Umbauten, sodass schnelle Wechsel von Bialystocks Büro zum Broadway und diversen anderen Schauplätzen wie die Luxuswohnung des Regisseurs de Bris oder das Schrägdach von Nazi-Autor Franz Liebeskind, wo er sich um seine Stahlhelm-Taubenzucht kümmert, möglich sind. Die Regie von Dominique Schnizer bringt das Stück solide auf die Bühne und man hat viel Spaß an dem absurden Humor des Musicals. Gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, dass die Aufführung deshalb so gut ist, weil das Stück ein echter Knaller ist, und dass die Regie hier ruhig noch das eine oder Sahnehäubchen hätte draufsetzen können.

Die zehn Tänzerinnen und Tänzer der Dance Company des Theaters sorgen nur für begrenzten Schwung, was vor allem an den Choreografien Ricardo De Nigris liegt. Was hier zu sehen ist, wirkt meist nur wie das Pflichtprogramm und nicht wie die Kür. Die Tanzaktivitäten des Chores wirken auch recht müde. Da stellt sich die Frage, wieso man bei dieser Produktion nicht auch Studenten und Absolventen des Osnabrücker Musicalstudiengangs engagiert hat? In der „Addams Family“ vor zwei Jahren sorgten die Tanzeinlagen der jungen Leute für viel Schwung.
Kapellmeister An-Hoon Song hat sich in den letzten Jahren zu seinem echten Musicalspezialisten entwickelt. Auch bei diesem Stück sorgt er dafür, dass Mel Brooks Musik, die sich an den großen Klassikern des Genres orientiert, schön swingt. Da zeigt das Osnabrücker Symphonieorchester seine Vielseitigkeit und beweist, dass es neben der Kernkompetenz in Oper und Konzert auch eine starke Musical-Big-Band ist.
Rudolf Hermes 9.4.2019
Bilder (c) Theater Osnabrück
TOSCA
Premiere: 19.01.2019
besuchte Vorstellung: 08.02.2019
Regieauftrag: Bebilderung
Lieber Opernfreund-Freund,
seit ein paar Wochen ist am Theater Osnabrück Puccinis Opernkrimi Tosca zu erleben. Was sich szenisch eher im Belanglosen verliert, wird nicht zuletzt dank einer souverän auftrumpfenden Titelheldin zum Genuss.

Sicher muss man das Rad nicht immer neu erfinden und vielleicht hat man Scarpias Schergen auch schon irgendwie zu oft in Gestapo-Mänteln oder in der Uniform eines mehr oder minder realen Terrorstaates heutiger Tage gesehen. Wenn man aber einer Aktualisierung nichts anderes abgewinnt als nichts sagende Symbolismen und die heutige Mode, dann kann man Tosca auch gleich ins rote Samtkleid stecken, Cavaradossi mit Plastron und den Polizeichef mit gepuderter Perücke ausstatten. Mascha Pörzgens Ideen zu einer Aktualisierung des Werkes jedenfalls erschöpfen sich in halbgaren Ansätzen. Symbole wie die Körperteile als Wandschmuck, denen keinerlei Bedeutung zukommt, bleiben ebenso überflüssig wie die als Druidenpriesterinnen daherkommenden Jungfrauen, die dem Klerus zum Te Deum die Maschinenpistolen zur Waffenweihe entgegenstrecken. Staat und Kirche scheinen nicht getrennt in diesem Rom, darauf deuten die Polizeiuniformen hin, deren Muster sich in den Messgewändern wiederfindet; doch auch dieser Geistesblitz wird nicht mit Substanz unterfüttert und bleibt Kulisse. Zwar überzeugt die durchaus spannende Personenführung Pörzgens – gerade, wenn nur zwei Handelnde auf der Bühne sind, jedoch wirken Toscas Versuche, den toten Scarpia noch schöner unter die lebensgroße Pferdeleuchte zu drapieren, ebenso grotesk wie die roten Papstschühchen, die Scarpia im zweiten Akt tragen darf. Kostüme und Bühne werden von Frank Fellmann verantwortet, dessen Arbeit dann am stärksten ist, wenn er das macht, was er in dieser Inszenierung wohl machen soll, nämlich eine Bebilderung zu kreieren – so dass der in allen Facetten erstrahlende Petersdom im Hintergrund zum szenischen Höhepunkt gerät.

Dass es nicht gänzlich langweilig wird, dafür sorgt das glänzend disponierte Ensemble. Allen voran lässt die Tosca von Lina Liu keine Wünsche offen. Die Chinesin ist stimmlich und darstellerisch ebenso überzeugend die kokettierende Geliebte, wie sie im zweiten Akt die Kämpferin gibt, die sich ihre Angst nicht anmerken lassen will. Ihr klangschöner, facettenreicher Sopran strahlt in den glühendsten Farben, dass selbst das ansonsten mit Szenenapplaus generell außerordentlich sparsame Osnabrücker Publikum den Musikfluss nach ihrem zu Herzen gehenden Vissi d’arte unterbricht. Der Brasilianer Ricardo Tamura ist als Gast nach Osnabrück zurückgekehrt, wo er bis 2007 im Ensemble war. Seither hat er an vielen großen Bühnen, unter anderem immer wieder an der MET gesungen und man merkt ihm die Routine bei der Gestaltung des Cavaradossi auch ein wenig an. Stimmlich perfekt gestaltet er den Maler, brilliert mit bombensicherer Höhe, die er immer wieder in ein vollendetes Messa di Voce abgleiten lässt. Rhys Jenkins legt den Scarpia vergleichsweise zahm an. Den skrupellosen und brutalen Machtmenschen nimmt man ihm auch im zweiten Akt kaum ab, als er zumindest stimmlich im Vergleich zum Beginn ordentlich zulegt und einen kräftigen, dabei aber immer kultivierten Bariton präsentiert. Da verfügt José Gallisa gestern über wesentlich mehr Durchschlagskraft und es ist vielleicht das erste Mal, dass ich bedaure, dass die Figur des Angelotti nicht mehr zu singen hat. Genadijus Bergorulko habe ich in Osnabrück bisher als vorzüglichen und wandlungsfähigen Komödianten kennen gelernt, deshalb hatte ich mich sehr auf seinen Mesner gefreut. Gestern aber bleibt der aus Litauen stammende Sänger diesbezüglich hinter den Erwartungen zurück. Yohan Kims Spoletta ist hingegen stimmlich und darstellerisch ausgezeichnet ausbalanciert und Daniel Krämer gibt mit seinem Knabensopran einen herzigen Hirtenjungen ab.

Im Graben gibt Daniel Inbal eine wuchtige Interpretation des Puccini-Klassikers, wählt mitunter recht getragene Tempi und verleiht so auch den musikalisch weniger imposanten Momenten viel Gewicht und enormen Puccini’schen Schmelz. Der von Sierd Quarré betreute Chor trumpft zum Finale des ersten Aktes ordentlich auf und überzeugt mit stimmlichem Bombast. So gelingt die musikalische Seite viel überzeugender als die szenische – aber eine Tosca ist ja auch eine Tosca ist eine Tosca…
Das Publikum im voll besetzten Haus applaudiert entsprechend und feiert vor allem Lina Liu, die als Tosca gestern auf ganzer Linie hat abräumen können.
Ihr Jochen Rüth 09.02.2019
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
DOKTOR FAUST
Premiere: 16.06.2018
Wiederaufnahme: 19.12.2018
„… und bin so klug als wie zuvor!“
Lieber Opernfreund-Freund,
als letzte Premiere der vergangenen Spielzeit mit kaum einer Handvoll Aufführung gestartet, hatte Busonis selten aufgeführte Oper Doktor Faust gestern Wiederaufnahmepremiere am Theater Osnabrück. Und ein Besuch lohnt sich nicht nur für Raritätenjäger.

Dass allzu viele Partituren hochgenialer Musikwerke in irgendwelchen Schubladen mehr und mehr dem Vergessen anheimfallen, macht diese Ausgrabung überdeutlich. Ferruccio Busonis Beschäftigung mit dem Faust-Stoff ist eine atmosphärisch dichte, hoch komplexe, höchstexpressionistische Komposition voll klanglicher Wucht, die sich hinter der Salome von Richard Strauss oder Wagners Meisterwerk nicht verstecken muss – denn sie ist genau das – ein Meisterwerk. Klanglicher Bombast verliert sich immer wieder in feinst gesponnenen, gespenstisch, fast sphärisch klingenden Passagen, ausladende instrumentale Passagen ergänzen die Gesangsparts; der psychologisch ohnehin schon komplexe Stoff wird so um eine Facette bereichert, obwohl der Italiener und spätere Wahlberliner Busoni in seiner Komposition nicht nur auf das Drama von Goethe, sondern vielmehr auf die Ursprünge desselben im Mittelalter und eine Puppenspielumsetzung von Karl Simrock aus dem Jahr 1846 Bezug nimmt. Er setzt die Titelfigur mehr oder weniger allein ins Zentrum und nimmt damit eigentlich eine Reduzierung vor. Faust verkauft seine Seele, um Macht zu erhalten, und lädt dadurch Schuld auf sich; Schuld am Tod der Herzogin von Parma, die er nicht nur in ihrer eigenen Hochzeitsnacht verführt, sondern – wie zuvor Gretchen (nach deren Tod beginnt die Oper erst) – auch schwängert. Am Tod des Sohnes, aber auch an der Ermordung von Gretchens Bruder.

Im Libretto gibt es pausenlos Verweise, Andeutungen und Symbole von Busoni, der selbst das Textbuch zu seinem Werk verfasste, das bei seinem Tode unvollendet bleib und durch seinen Schüler Philipp Jarnach vervollständigt wurde. Doch die Regisseurin Andrea Schwalbach scheint keine Ambitionen zu haben, diese für den Zuschauer zu entwirren. Damit folgt sie zwar Busonis These, dass „um ein Kunstwerk zu empfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger selbst verrichtet werden muss“, wie er es 1916 in seinem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst formuliert, doch scheint sie damit einen Teil des Osnabrücker Publikums zu überfordern. Das ist schade, denn es wäre gar nicht nötig gewesen, weitere eigene Symbolismen wie halb heruntergezogene Prospekte, das omnipräsente Kind Fausts, allgegenwärtige, skurril erscheinende Masken und etliche Verweise auf den Ursprung im Puppenspiel einzuflechten, wie Andrea Schwalbach es getan hat. Das Werk an sich bietet bereits genug Projektions- und Interpretationsfläche, die man nur hätte bedienen müssen. Die Bühne von Anne Neuser besteht im Wesentlichen aus Stühlen und herumliegenden Büchern, in denen jedermann immer mal wieder herumblättert, und aus gemalten Kulissen, die, von oben ins Bild gezogen, an Kasperltheater erinnern. Die Kostüme von Stephan von Wedel verweisen eher nichts sagend auf die unbestimmte Gegenwart, auch wenn der Kostümbildner schon einmal mit den Geschlechterrollen spielt. Das Regieteam scheint so viele Ideen umsetzen zu wollen, dass keine recht verfolgt wird, man sich in Symbolen verzettelt und das Zitat aus Fausts Monolog „und bin so klug als wie zuvor“ leider als Resümee stehen muss. So bleibt das wirklich Erlebenswerte am gestrigen Abend, die geniale Musik Busonis – und die überragende musikalische Leistung des Teams.

Busonis Doktor Faust gerät zur Sternstunde des walisischen Baritons Rhys Jenkins, der die Titelfigur dermaßen intensiv verkörpert, dass man als Zuschauer sein Zaudern und Wanken, aber auch seine Jagd nach Glück in jeder Sekunde mitfühlt. Scheinbar ohne jede Anstrengung meistert er auch stimmlich diese Mörderpartie, zeigt das Seelenleben Fausts mit all seinen Facetten und bietet damit gewissermaßen die logische Steigerung zu seinem schon bemerkenswerten Rigoletto aus der vergangenen Spielzeit. Dem Tenor Jürgen Müller bei der Darstellung des Mephistopheles zuzuschauen, ist ein wahrhaft teuflisches Vergnügen. Seinem hellen und klaren Tenor mischt er immer wieder unterschwellig intrigante, bedrohliche Töne bei, präsentiert sich höhensicher und überzeugt auch schauspielerisch auf ganzer Linie. Lina Liu darf als Herzogin von Parma ihren glockenhellen Sopran nur vergleichsweise kurz zeigen (und lässt mich mich umso mehr auf ihre kommende Tosca freuen), glänzt aber mit einer überragenden Bühnenpräsenz. Mark Hamman erfreut mich mit seinem Herzog von Parma, der mich an den Strauss’schen Herodes erinnert, ebenso wie Genadijus Bergorulko als Zeremonienmeister. Aus der Unzahl kleiner Rollen sind zwei Sänger ganz klar primi inter pares: Jan Friedrich Eggers überzeugt mich als von der Regie verstörenderweise als gekreuzigter Jesus dargestellter Soldat und macht mit seinem intensiven Gesang und Spiel förmlich Gänsehaut und Silvio Heil sticht dermaßen klar und präsent aus der Gruppe der Wittenberger Studenten hervor, dass ich ihn gerade noch extra im Internet gegoogelt habe.

Die wuchtige Komposition Busonis wurde in der vergangenen Spielzeit von GMD Andreas Hotz einstudiert, ist auch beim 1. Kapellmeister Daniel Inbal in den besten Händen. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters Osnabrück gestaltet er die Partitur mit ihrer klanglichen Kraft mit hörbarer Freude und findet auch in den feineren Nuancen den richtigen Ton. Doktor Faust kann man darüber hinaus fast als Choroper bezeichnen, so vielbeschäftigt sind die Damen und Herren des Opernchores unter der Leitung von Markus Lafleur, singen Gebete aus dem Off oder glänzen in den Massenszenen. So wird es also klanglich mehr als rund gestern Abend – da ist die konzeptlos erscheinende Regie ein echter Wermutstropfen, besonders, da sie dem einen oder anderen Zuschauer so wenig zu vermitteln scheint, dass der sich trotz der genialen Musik dazu bemüßigt fühlt, das Theater zu verlassen. Ich bin geblieben und kann Ihnen wegen der musikalischen Qualität einen Besuch dieses Busoni in Osnabrück nur empfehlen.
Mit den besten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest bleibe ich
Ihr Jochen Rüth 20.12.2018
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
Carl Millöcker
DER BETTELSTUDENT
Premiere: 1. Dezember 2018
Besuchte Vorstellung: 4. Dezember 2018
TRAILER

Carl Millöckers „Der Bettelstudent“ gehört zwar zu den Klassikern des Genres, wird aber nur noch selten gespielt. Dabei besitzt das Werk mit „Ach, ich hab´ sie ja nur auf die Schulter geküsst“ einen echten Schlager, und der Freiheitskampf der Polen gegen die sächsischen Besatzer, vor dessen Hintergrund das Stück spielt, bietet jedem Regisseur viele Möglichkeiten das Stück auch politisch zu deuten. Am Theater Osnabrück gibt es jetzt ein Wiedersehen mit dem Klassiker.
Regisseur Guillermo Amaya beschränkt sich im ersten Akt auf die Kombination von bunter Ausstattung mit viel Aktion und denkt, damit sei der Abend schon gelaufen. Kostümbildnerin Elisabeth Benning hat sich mit skurril bunten Kostümen mächtig ins Zeug gelegt und auch die Bühnenbilder von Margrit Flagner können sich sehen lassen. Im ersten Akt gibt es ein Gefängnis und einen Marktplatz zu sehen. Im zweiten und dritten Akt werden ein Schlosssaal und der dahinter befindliche Garten geboten.

Die Figuren werden in ihrer Darstellung und Kombination von Kostüm und Perücke jedoch überzogen dargestellt, ohne dass da ein tieferer Sinn oder der virtuose Irrwitz eines Herbert Fritsch entsteht. Zudem zeigt die Regie das Stück hauptsächlich als Intrigenfeldzug des Oberst Ollendorf, der sich an der Grafentochter Laura für eine Ohrfeige rächen will. Daraus ergibt sich eine Liebes- und Täuschungsgeschichte, welche die Politik und Zeitgeschichte der sächsischen Besatzung Polens komplett ausblendet.
Der Oberst Ollendorf wird hier, der Urfassung folgend, vom Tenor Mark Hamman gesungen, der die Rolle intriganter anlegt, als es man es von den Basskollegen kennt. Ollendorf verfügt als Tenor auch über weniger Autorität. Hamman spielt die Rolle mit viel Witz, die Stimme sitzt aber nicht immer richtig. In der Reihe der blau-uniformierten sächsischen Offiziere stört besonders José Gallisa, der seine Dialoge vollkommen unverständlich artikuliert.
Im zweiten Akt rücken die Liebespaare in den Mittelpunkt, und die Regie konzentriert sich auf eine genaue Zeichnung der Figuren, ohne alles zu übertreiben. Erika Simons vereint als Laura mit ihrem klaren Sopran schön lyrische und kecke Elemente. Susann Vent-Wunderlich singt die Rolle der Schwester Bronislawa gut, bleibt aber eher eine Nebenrolle.

Als Bettelstudent Simon gefällt Daniel Wagner mit leichtem und beweglichem Tenor, der aber noch mehr Schmelz vertragen könnte. Mit hellem und kantigem Bariton gibt Jan Friedrich Eggers dessen Freund Jan Janicki. Starke Auftritte hat Katarina Morfa als resolute Mutter der beiden Comtessen.
Daniel Inbal lässt es am Pult des Osnabrücker Symphonieorchesters im ersten Akt zu sehr donnern und auch der von Sierd Quarré einstudierte Chor neigt zu übertriebener Lautstärke. Nach der Pause musiziert das Orchester differenzierter, und der Chor kann in Stücken wie dem Hochzeitschor seine Feinheiten der Gestaltungskunst zeigen.
Diese Aufführung bietet einen unterhaltsam-kurzweiligen Abend ohne tieferen Sinn. So richtig begeistern kann dieser „Bettelstudent“ aber auch nicht.
Rudolf Hermes 6.12.2018
Bilder (c) Kerstin Schomburg
FIDELIO
Premiere: 29.09.2018
besuchte Vorstellung: 24.10.2018
Lieber Opernfreund-Freund,
Beethovens Befreiungsoper ist derzeit in einer Neuproduktion am Theater Osnabrück zu erleben – und das meine ich genau so: die Aufführung gerät aufgrund der intelligenten Lesart von Yona Kim zusammen mit der tadellosen musikalischen Umsetzung durch Andreas Hotz und nicht zuletzt Dank des intensiven Spiels von Susann Vent-Wunderlich zum Erlebnis!

Ein politisch Gefangener gefährdet den Ruf eines Gouverneurs, als der zuständige Minister seinen Besuch ankündigt. Gleichzeit versucht seine Frau, als Mann verkleidet, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Dieser Plot scheint wie gemacht für eine Aktualisierung in unsere Tage hinein, eine Verlegung der Handlung in einen heutigen Terrorstaat und als Anprangerung von Menschenrechtsvergehen aller Art. Die südkoreanische Regisseurin Yona Kim allerdings, in Osnabrück mittlerweile zum vierten Mal mit einer szenischen Umsetzung betraut, legt die Oper eher als Innensicht von Leonore an, thematisiert die politischen Momente nur am Rande und verortet die Handlung in der örtlich nicht näher spezifizierten Gegenwart. Die Titelfigur ist omnipräsent, er-lebt alles im eigentlichen Sinne, so wird sie mit ihren Ängsten und Hoffnungen zum Zentrum der Inszenierung. Dabei arbeitet Kim geschickt mit Videoeinspielungen, die teils von Siegfried Köhn vorgefertigt wurden und einen Blick auf Leonores Gedankenwelt ermöglichen, teils live während der Aufführung gefilmt einen intensiveren Eindruck von der Mimik der Protagonisten widergeben und so eine zusätzliche Dimension eröffnen. Der Einheitsbühnenraum zeigt das Schlafzimmer des Ehepaares, bei dem – so zeigt es die bespielte Ouvertüre – nicht alles im Lot scheint, als Florestan verhaftet wird. Durch raffinierte Verwandlungen, die Bühnenbildner Alexandre Corazzola geschickt ermöglicht, verschwinden Bett und Schminktisch in Sekundenschnelle, öffnet sich hinter dem Schlafzimmervorhang der Bühnenraum zu einer Art Retortenstadt, in der sich alle Häuser und alle Menschen gleichen, tragen sie doch sämtliche Schattierungen von Beige (Kostüme: Falk Bauer). Lediglich Florestan scheint in literweise Theaterblut gewälzt, und bleibt damit auch unter den Gefangenen ein anderer. Yona Kim hat gut daran getan, die Dialoge gänzlich zu streichen und sie durch kurz zusammenfassende Texteinblendungen zu ersetzen. So kann sich Beethovens Musik nahezu ununterbrochen in einen Fluß begeben, was der Wirkung des Werkes letztendlich zuträglich ist und die intensive Wahrnehmung der Inszenierung durch die Zuschauer erst ermöglicht.

Mit Sängerpersonal, das nahezu ausschließlich aus dem hauseigenen Ensemble stammt, stemmt das Theater diese Produktion. Einzige Ausnahme ist Florestan, der mit Andreas Hermann besetzt ist. In der besuchten Vorstellung ersetzte nun Roman Payer den erkrankten Hermann und erweist sich als Glücksgriff. In bester Heldentenormanier gestaltet er den Inhaftierten, spielt dazu vorzüglich und fügt sich mühelos ins restliche Ensemble ein. Seine klaren Höhen sind voller Kraft, seine Piani herzerweichend. Susann Vent-Wunderlich brilliert erneut in der Titelrolle, nachdem sie bereits die Premiere gesundheitlich angeschlagen bravourös gemeistert hatte, spielt den Farbenreichtum ihrer Stimme gekonnt aus und darstellerisch all ihre Kollegen – so direkt darf man das sagen – mühelos an die Wand. In diesen zwei Stunden scheint sie Leonore zu SEIN, lebt die Rolle mit jeder Faser und glänzt mit sicherer Intonation und beeindruckenden Registerwechseln ebenso wie mit intensivstem Spiel, ds Gänsehaut erzeugt. Dass sie dabei in der Höhe mitunter ein wenig zum Tremolieren neigt, ist geschenkt. Susann Vent-Wunderlich in dieser Rolle zu erleben, ist schlicht ein Geschenk! Vielen Dank dafür! Erika Simons überzeugt als Marzelline mit feinsten Höhen und gefühlvollen Gesang, im Zusammenspiel mit Vent-Wunderlich scheinen sich die beiden Damen gegenseitig zu Höchstleistungen anzuspornen. Ein Genuss!

Bei so viel Frauenpower muss die Herrenriege gezwungenermaßen den Kürzeren ziehen. Am ehesten überzeugt mich Rhys Jenkins als Don Pizarro, verströmt seinen nuancenreichen Bariton, zeigt viel Kraft und stimmliche Präsenz. José Gallisa als Rocco führt die Stimme vor allem in der höheren Lage sehr eng und kann nur im mittleren Register wirklich überzeugen. Daniel Wagner ist ein mehr als solider Jaquino, während Jan Friedrich Eggers den Don Fernando wenig imposant anlegt. Vor allem die Herren des Chores jedoch machen nachhaltigen Eindruck, Sierd Quarré hat sie betreut. Ihr stimmiges Auftreten ist höchste Sängerkunst, da macht es richtig Spaß zuzuhören. GMD Andreas Hotz hält im Graben die Zügel fest in der Hand. Das muss er auch, bei dem Esprit, den er zusammen mit den Musikerinnen und Musikern des Osnabrücker Symphonieorchesters an den Tag legt, und der ansteckenden Begeisterung, mit der er sich der Partitur widmet. Da stimmt jede Nuance – so wird’s ein großer Abend! Den kann ich Innen – Sie werden es erraten – uneingeschränkt empfehlen. Von Dialogen entschlackt, intelligent und stimmig gedeutet, intensiv und überzeugend gespielt und gesungen – was kann man beim Fidelio viel besser machen?
Ihr Jochen Rüth / 26.10.2018
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
Tommaso Traetta
ANTIGONA
Premiere 20.1. / besuchte Vorstellung 30.1.18
Müde Rarität
Lieber Opernfreund-Freund,
ein Brüderpaar, letzte Vertreter eines Herrschergeschlechts, hat sich gegenseitig im Kampf getötet. Der neue König stilisiert den einen zum Helden und brandmarkt den anderen als Verräter und verbietet dessen Bestattung. Die Schwester der beiden achtet den Willen Gottes stärker und widersetzt sich dem Verbot. Sie will den Bruder begraben und wird dafür zum Tode verurteilt. Ihr Geliebter, der Sohn des Königs, lässt sich mit ihr lebendig begraben. Der König lässt das Grab aufbrechen. Sein Sohn nimmt sich das Leben und seine Verlobte folgt ihm in den Tod. „Antigone“ heißt das Drama, das Sophokles vor beinahe zweieinhalbtausend Jahren aufgeschrieben hat und die Geschichte bietet auch heute noch genug Zündstoff für eine spannende Aufführung, stehen doch Ehre, Obrigkeitshörigkeit, Machtgier und Liebe im Zentrum der Handlung. Und doch ist das Drama derzeit in einer eher müden Umsetzung am Theater Osnabrück zu erleben.

Die Tragödie mit der Tragödie fängt schon bei der Komposition an. Tomasso Traetta hat den Plot in eine Oper gegossen, die 1772 in Sankt Petersburg uraufgeführt worden war. Dorthin hatte Katharina II. den Komponisten geholt, der zuvor in Venedig tätig gewesen war. „Antigona“ steht an der Schwelle vom Barock zur Klassik und gilt als sein reifstes Bühnenwerk. Und doch erfasst die Komposition das dramatische Potenzial des Stoffes nicht, wirkt ob ihres Zwittercharakters unausgegoren. Endlos erscheinende Rezitative werden von ariosen Passagen unterbrochen, die an die bravourösen barocken Koloraturarien nicht ansatzweise heranreichen und doch unzähligen Wiederholungen durchlaufen – vielleicht hätten hier Kürzungen und Striche nicht geschadet. Musikalisch eher belanglose Ideen werden so über Gebühr ausgebreitet und die Chorszenen, in denen der Komponist immer wieder spannende und interessante rhythmische und harmonische Wendungen findet, erscheinen da fast wie rettende Inseln. Für ein Musiktheaterwerk nicht gerade ein Lob, sind die Passagen ohne Gesang, die Vorspiele zu den Akten und die instrumentalen Einleitungen zu den Szenen und Arien die echten Höhepunkte des Abends. Das mag auch am hervorragenden Dirigat von GMD Andreas Hotz liegen, der beim Osnabrücker Symphonieorchester gewohnt gekonnt die Fäden zusammenhält und versucht, die Partitur im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich zu beleuchten.

Die szenische Interpretation des Niederländers Floris Visser trägt nicht dazu bei, Traettas dröge Umsetzung zu beleben. Vielleicht sind der sandfarbene Einheitsbühnenraum und die mausgrauen Wirkwaren, in die Dieuweke van Reij die Protagonisten gehüllt hat, auch nicht der passende Rahmen, die antike Tragödie auf frische Art und Weise zu erzählen. Da kann auch das stimmungsvolle farbige Licht von Alex Brok nicht viel ausrichten. Beginnt die Oper noch mit einem lebendigen Messerkampf der Brüder, nimmt Visser der Handlung bald den Drive, setzt auf viel Herumgestehe und nur spärliche, wenn auch recht dramatische Interaktionen der Protagonisten. Irgendwie bleibt jeder allein und nur die beiden Liebenden, Antigona und Emone, lassen eine echte Beziehung zueinander erkennen. Unkommentiert erzählt der Intendant von Opera Trionfo, mit der zusammen diese Produktion entstanden ist und die sie ab Februar in den Niederlanden zeigt, die Geschichte, lässt jegliche Deutung außen vor und den Zuschauer damit auch ein Stück weit allein – und das ist heutzutage für ein antikes Drama wie „Antigone“ dann doch ein bisschen wenig.

Dabei wird fast ausnahmslos hervorragend gesungen. Lediglich Christian Damsgaard, der als Gast den Creonte singt, fehlt es an stimmlichem Volumen, um den König glaubhaft als selbstbewussten Herrscher mit tyrannischen Anlagen dazustellen. Sein an sich klangschöner Tenor kann vor allem in den hohen Lagen nicht gegen die beherzt singenden Schwestern Antigona und Ismene bestehen, darstellerisch jedoch liefert der Däne eine tolle Leistung ab. Erika Simons läuft in der Rolle der Titelfigur nicht nur auf diesem Gebiet zu Höchstform auf, sondern begeistert, von ein paar Schärfen in den Höhen abgesehen, als Antigona mit wandlungsfähigem und farbenreichem Sopran. Unterstützt wird sie von Lina Liu, die als ihre Schwester Ismene leider nur wenig von ihrer so kraft- wie gefühlvollen Stimme zeigen darf, während Katarina Morfa in der Hosenrolle des Emone eine intensive Darstellung des Königssohnes gelingt, als der sie die Stärken ihres bewegenden Mezzos voll ausspielt. Daniel Wagner komplettiert das Ensemble mit feinem Tenorgesang als Creontes Berater Adrasto. Angelehnt an die Chorgesänge im antiken Schauspiel hat Tommaso Traetta eine umfangreiche Chorpartie komponiert, der sich die Damen und Herren des Opernchores unter der Leitung von Markus Lafleur unumwunden und auf ganzer Linie überzeugend stellen. Da ist kein Wackler zu hören, wie aus einem Mund klingen beispielsweise die Totenklagen, harmonisch vollkommen und vollkommen harmonisch. Ein Genuss!

Teile des Publikums sind schon zur Pause ermüdet, auch wenn Christian Damsgaard rechtzeitig zuvor die Urne mit Polinices Asche mit beherztem Wurf an der Wand zertrümmert und so dafür sorgt, dass alle wach sind. Manch einer rennt schon zur Garderobe, weil er denkt, das Stück sei vorbei. Wiedergekommen sind dann doch alle, aber der Applaus nach den letztendlich mehr als drei Stunden ist doch recht verhalten. So honorierenswert das Bemühen des Theaters Osnabrück um ein selten gespieltes Werk ist, so ernüchternd ist die Erkenntnis, dass doch nicht jede Oper zu Unrecht vergessen ist.
Ihr Jochen Rüth 31.01.2018
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.

Premiere: 30.09.2017
besuchter Vorstellung: 03.01.2018
Der Narr als kurzsichtiger Jude
Lieber Opernfreund-Freund,
das Opernjahr begann für mich am gestrigen Abend mit einem Besuch des „Rigoletto“ am Theater Osnabrück. Vor nahezu ausverkauftem Haus wurde die Produktion, die im September die erste Premiere der laufenden Spielzeit war, gegeben. Ja, natürlich zeiht Verdi immer reichlich Publikum und ob seiner Beliebtheit bildet das Werk bis heute zusammen mit den zwei Jahre später entstandenen „Il Trovatore“ und „La Traviata“ die triologia popolare des Meisters aus Busseto, doch in diesem Fall mag das auch an der ausnehmend guten Besetzung sowie der interessanten Lesart der Regisseurin gelegen haben.

In die Hände von Adriana Altaras hatte man die szenische Umsetzung gelegt und die ist Ihnen nicht nur renommierte Schauspielerin, Autorin und Regisseurin, sondern vielleicht auch aus Talkshows bekannt, in denen sie gern gesehene Gesprächspartnerin ist, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Insofern verwundert es nicht, dass Altaras, die im Alter von sieben Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland kam, den Religionsaspekt mit in ihre Deutung des Verdi-Dramas einfließen lässt. Fesselnd und spannend erzählt sie die Geschichte des gesellschaftlichen Außenseiters, dessen Behinderung in Osnabrück in einer extremen Kurzsichtigkeit besteht und der sein Jude-Sein nur im privatem Rahmen auslebt. In seinem Beruf, dem er in einer Art Männerclub nachgeht, in dessen holzvertäfeltem Treppenhaus die Herren ihren sexuellen Neigungen frönen, ist er wegen seiner Behinderung und auch wegen seiner Religion Außenseiter und eher Objekt des Spotts als selbst Spötter zu sein.

Dreht sich der Kubus, den Etienne Pluss als genial wandlungsfähigen Aufbau auf die Bühne gestellt hat, erscheint auf dessen Rückseite eine bedeutungsschwanger ganz in Weiß gehaltene Waschküche, in der Gilda sich aufhält – ein Ort so weiß wie die Unschuld, die Rigoletto seiner Tochter zu bewahren versucht, oder zumindest ein Ort, an dem sich eine Art Reinheit wiederherstellen lässt. Der Herzog dringt dort als Student verkleidet ein, mit Parka und Palästinensertuch, das Gilda nach dem ersten Kuss immer bei sich trägt und das Rigoletto nach Gildas Tod blutverschmiert als einziges Überbleibsel seiner Tochter behält. Dass Giovanna sich im letzten Bild als Katholikin outet macht den Ansatz rund und doch überfrachtet Altaras die Produktion nicht mit dem religionspolitischen Aspekt, drängt ihn nicht in den Vordergrund, sondern lässt ihn quasi nebenher mitlaufen. So erreicht sie eine so behutsame wie schlüssige, packende Aktualisierung und beim Zuschauer geschickt mehr Reflektion und Nachhall als sie es wohl mit dem Holzhammer getan hätte.

Die Sängerriege ist von beachtlicher Qualität und trägt wesentlichen Anteil am Gelingen des Abends. In der Titelrolle glänzt Ensemblemitglied Rhys Jenkins, dem mit überragender stimmlicher Präsenz und intensiver Darstellung ein facettenreiches Rollenportrait gelingt. Er ist ein biestiger Narr wider Willen und ein so gefühlvoll liebender wie später von Rachegelüsten getriebener Vater. Seine Tochter Gilda findet in Erika Simons eine einfühlsame Gestalterin, die mit ihrem feinen Sopran die mädchenhafte Unschuld in idealer Weise verkörpert und feinste Piani zaubert. So werden die Duette zwischen Vater und Tochter zu den musikalischen Höhepunkten des Abends. Mit der Auswahl des Einspringers für die Rolle des Herzogs von Mantua hat man da weniger Glück. Yoonki Baek verfügt an sich über einen höhensicheren Tenor, der sich aber eher für das lyrische Fach zu eignen scheint, und den er mit wenig Brillanz und Strahlkraft ausstattet. So bleibt der Südkoreaner vergleichsweise blass.

Gelungener ist da die Besetzung von Malte Roesner, der den ebenfalls erkrankten Jan Friedrich Eggers ersetzt und nach seinem Fachwechsel dem Marullo mit einnehmenden Bass Profil gibt. Katarina Morfa und José Gallisa sind ein teuflisch gutes Geschwisterpaar: Gallisa versieht den Sparafucile mit furchteinflößendem, düsterem Bass und Katarina Morfa macht als betörende und leidenschaftliche Maddalena mit ihrem dunklen Mezzo Eindruck. Leonardo Lee ist ein imposanter und stimmgewaltiger Monterone und auch die Herren des Chores, von Markus Laufer betreut, singen und spielen engagiert und tadellos.
Bei der Bühnenmusik ist die Bläserphilharmonie Osnabrück unter der Leitung von Jens Schröder ein verlässlicher Partner, während im Graben das Osnabrücker Symphonieorchester zu Höchstform aufläuft. Hier hält An-Hoon Song die Fäden zusammen und präsentiert ein energiegeladenes Dirigat, an dem wohl Verdi selbst nichts auszusetzen gehabt hätte. Alles in allem berichte ich Ihnen also von einem gelungenen Musiktheaterabend – so kann das Opernjahr gerne weitergehen.
Ein frohes, glückliches und gesundes 2018 wünscht Ihnen
Ihr Jochen Rüth / 04.01.2018
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.

TRAILER
besuchte Vorstellung: 07.12.2017
Premiere: 25.11.2017
Demontierte Operettenseligkeit
Liebe Opernfreund-Freund,
ein nicht ganz alltägliches Operetten-Juwel steht derzeit in Osnabrück auf dem Spielplan: „Die Zirkusprinzessin“ von Emmerich Kálmán, direkt nach dessen Erfolgsstück „Gräfin Mariza“ entstanden und 1926 im Theater an der Wien uraufgeführt, ist ein wunderbarer Melodienreigen, bei dem der ungarische Komponist gekonnt beschwingte Walzer, traumhafte Romanzen und Anklänge an russische Folklore miteinander verwebt.

Operettenhaft konstruiert ist auch die Handlung, die in Sankt Petersburg spielt: Der junge Fedja hatte sich vor Jahren in die Braut seines Onkels verliebt, der daraufhin seine militärische Karriere torpedierte, so dass er seither beim Zirkus als Magier „Mister X“ sein Dasein fristet. Nach dem Tod des Onkels ist Fedora Palinska ob ihres Vermögens umworbene Witwe und einer der verschmähten Verehrer, Prinz Sergius Wladimir, überredet „Mister X“, sich der Fürstin als vermeintlicher Prinz Korossow zu nähern. Sie verliebt sich in ihn und beide heiraten. Direkt nach der Eheschließung enthüllt Prinz Sergius, dass der Herr Gemahl ein Magier ist und diffamiert die Fürstin als Zirkusprinzessin. Fedora ist gekränkt und verstößt Fedja, doch in Wien treffen sich beide wieder und alles mündet natürlich in einem Happy End. „Ein amüsanter dritter Akt beschließt die immer noch beliebte Kálmán-Operette“, vermerkt der magere Wikipedia-Eintrag dazu.
Nicht so, wenn es nach der jungen Regisseurin Sonja Trebes geht, die man in Osnabrück mit der szenischen Umsetzung betraut hat. Sie traut dem Werk offensichtlich so wenig (zu), dass sie sich an einer Umdeutung versucht.

Von Anfang an hängt eine Spur Morbidität in der Luft, den gelungenen und farbenfrohen Kostümen, die Linda Schnabel für die Zirkuscrew entworfen hat, stehen Kittelschürzen im Zwiebellook und Pelzmützen gegenüber, wie man sie eher im sibirischen Hinterland denn im mondänen Sankt Petersburg erwarten würde. Der intrigante Prinz Sergius ist ein Patriarch der Russenmaffia, wird ständig von finster drein blickenden Gestalten mit Maschinengewehren begleitet und erschießt jeden ohne Vorwarnung, der nicht nach seiner Pfeife tanzt. Spätestens ab dem zweiten Akt demontiert Trebes die Operettenseligkeit, den Gäste des Prinzen, die eine Art Ostblock-Chic ausstrahlen, ist die Feierlaune verordnet. Da wirkt die Blumenwiese die Toni seiner Mabel (das Paar der Nebenhandlung) ausbreitet, wie ein Fremdkörper. In einem Zeitungsinterview erläuterte die Regisseurin vor der Premiere die Notwendigkeit der Umarbeitung des dritten Aktes, vorgeblich sei hier die Sprache besonders veraltet. Mich beschleicht indes der Eindruck, dass hier passend gemacht werden musste, was nicht in das Regiekonzept von Sonja Trebes gepasst hat. Herausgekommen ist ein müder, vor Trostlosigkeit strotzender Akt, da kann auch die wandelbare Bühne von Nanette Zimmermann nichts mehr retten. An dessen Ende verwehrt die Regisseurin dem Liebespaar zudem dadurch das Happy End, dass der Vorhang vorher fällt.

Der müden Umarbeitung des Finalaktes wird nur durch das beherzte Spiel von Johannes Bussler als schrulligem Kellner Pelikan und Cornelia Kempers, die in letzter Sekunde für die erkrankte Eva Gilhofer eingesprungen war, als herrlich grantelnder Wirtin Leben eingehaucht. Die beiden sind ein glänzendes Gespann und Genadijus Bergorulko, der schon zu Beginn des Abends als wunderbar überdrehter Zirkusdirektor und Herr im Kuriositätenballett zwischen bärtiger Frau und einarmiger Tänzerin in Erscheinung getreten war, gelang - von Wladimir Krasmann einfühlsam am Klavier begleitet - ein traumhaft bewegender Moment mit seiner russischen Weise. Gesanglich wird generell allerhand geboten an diesem Abend: Susann Vent-Wunderlich ist eine bühnenpräsente Sängerin, die die Titelfigur als verwöhnte Diva anlegt, die sich insgeheim nach Liebe sehnt. Ihr volle Sopran eignet sich dafür gut, fühlt sich aber in der ausdrucksstarken Mittellage hörbar am wohlsten. Ralph Ertel ist just von einer Erkältung genesen und hatte das sicherheitshalber ansagen lassen. Von stimmlicher Beeinträchtigung allerdings war nicht zu spüren und er konnte mit seinem charaktervollen und voluminösen Tenor dem geheimnisvollen Mister X ungehindert Profil verleihen. Jan Friedrich Eggers fiel hingegen eher durch sein überzeugendes Spiel auf, präsentierte seinen an sich klangschönen Bariton jedoch recht gestelzt. Mark Hamman ist ein grandioser Spieltenor, der sichtlich Freude an der Gestaltung des Toni Schlumberger hat. Seine Liebste Mabel findet in Gabriella Guilfoil eine ideale Gestalterin mit ausdrucksstarkem Mezzo voller dunkler Tiefe.

Die ausgezeichneten Tänzerinnen und Tänzer sorgen zwischendurch immer wieder einmal für Kurzweil (Choreographie: Rachele Pedrocchi) und der oft präsente Chor, von Markus Lafleur betreut, meistert seine umfangreiche Aufgabe glänzend. Aus dem Orchestergraben klingt pures Operettenglück. Daniel Inbal präsentiert Kálmáns Mixtur aus schmachtenden Romanzen, beschwingten Walzern und folkloristischen Einsprengseln gekonnt, mit Witz und voller musikalischer Begeisterung und sorgt so zusammen mit den Darstellern auf der Bühne dafür, dass ich Ihnen den Besuch dieser Produktion trotz handwerklicher Schwächen der Regisseurin dann doch empfehlen kann.
Ihr Jochen Rüth / 9.12.2017
Die Fotos stammen von Jörg Landsberg.
David Fennessy
Sweat of the Sun
Premiere: 2. Juni 2017
Besuchte Aufführung: 3. Juni 2017

Schon bei der Ankündigung dieses Werkes runzelte man erst mal die Stirn und fragte sich: „Wer braucht denn sowas?“ Komponist David Fennessy hat für sein Musiktheater „Sweat of the Sun“, das 2016 bei der Münchener Biennale in der Muffathalle uraufgeführt wurde, auf Werner Herzogs Tagebuch-Aufzeichnungen über die Dreharbeiten zu „Fitzcarraldo“ zurückgegriffen, die unter dem Titel „Eroberung des Nutzlosen“ erschienen sind.
Jedoch wird hier nicht das Verhältnis zwischen Herzog und seinem Hauptdarsteller Klaus Kinski als Psycho-Duell gezeigt, sondern es wird überhaupt keine Geschichte erzählt. Stattdessen soll der Zuschauer „in ein Raumklangkonzept gesetzt werden“, wie Dramaturg Alexander Wunderlich bei der Einführung verrät.
Somit ist schon vorab klar, dass die Musik wichtiger ist als das Bühnengeschehen und tatsächlich hat David Fennessy eine Komposition zwischen Mediation und Aufruhr geschrieben, die eine starke suggestive Kraft besitzt und die 65 Minuten des Stückes trägt. Die Mischung aus Raumklang, Elektronik, gesampelter Caruso-Stimme, klassischen Zitaten, exaltiertem Gesangsstil, der Kombination von gesprochenem und gesungenem Wort sowie dichten Klangflächen erinnert durchaus an Bernd Alois Zimmermanns Werke „Requiem für einen jungen Dichter“ oder „Ich wandte mich um und sah alles Unrecht der Welt“. Ebenso wie diese Werke ist „Sweat oft the Sun“ aber ein Konzertstück und kein Musiktheater.
Die Inszenierung von Marco Storman definiert sich hauptsächlich darüber, dass die Solisten um die Podien herumlaufen, auf denen die Orchestermusiker auf der Bühne positioniert sind oder irgendwo stehen. Ausstatterin Jill Bertermann ist nicht nur für die Positionierung der Podien verantwortlich, sondern hat die Darsteller als Werner-Herzog-Doppelgänger kostümiert: Optisch am überzeugendsten ist Bariton Marco Vassalli und auch Sopranistin Susanne Vent-Wunderlich sieht irgendwie wie Herzog aus, während Bassist Jose Gallisa aufgrund seines dichten Vollbarts keinerlei Ambitionen zeigt, diesen Ähnlichkeitswettbewerb zu gewinnen. Zum bestens aufgelegten Ensemble der inneren Stimmen gehört auch noch Sopranistin Gesche Geier.
Die Mitglieder des Osnabrücker Symphonieorchesters musizieren unter der Leitung von An-Hoon Song mit höchstem Einsatz für dieses zeitgenössische Werk, und auch die Darsteller engagieren sich stark. Jan Friedrich Eggers, eigentlich Bariton, übernimmt als Schauspieler die Sprechrolle, die Werner Herzog und Fitzcarraldo als Urbilder der Besessenheit verkörpern soll. Ist er mit fanatischem Eifer bei der Sache, so wirkt Stephanie Schadeweg als Kinski-Akteurin recht brav. Mit schönem und weichem Alt singt Katarina Morfa ihre Rolle, die wie Molly aus dem Film kostümiert ist.
Opernfreunde aus dem Umfeld von Osnabrück, die „mal was anderes“ auf der Theaterbühne sehen wollen, sollten dieses Stück ruhig mal ausprobieren, zum kulturellen Pflichtprogramm gehört dieses Stück nicht.
Rudolf Hermes 5.6.2017
Keine weiteren Bilder verfügbar.
Hans Gál - der "verbrannte" große Komponist
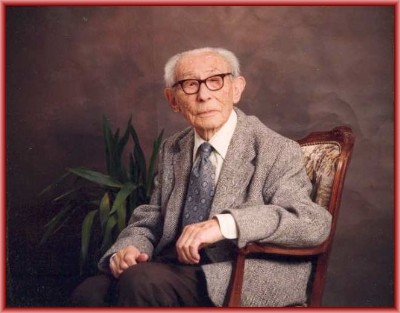
Das Lied der Nacht
Premiere: 29.April 2017
Besuchte Vorstellung: 12. Mai 2017
TRAILER

Diese Oper hat das Zeug, die „Wiederentdeckung des Jahres“ zu werden: Eine märchenhaft-symbolistisch-tiefenpsychologische Handlung, extreme Charaktere und eine Musik, die mit ihrem Farbenreichtum, ihrer Melodienschönheit und Originalität begeistert. 1926 wurde „Das Lied der Nacht“ in Breslau uraufgeführt, danach folgten bis 1930 weitere Produktionen in Düsseldorf, Königsberg und Graz. Daran, dass es zwischen 1933 und 1945 keine weiteren Aufführung gab, sind die Nazis schuld, denn Hans Gál war Jude. Das erklärt aber nicht, dass diese Oper bereits ab 1930 und auch nach Ende des 3. Reiches nie wieder gespielt wurde.
Librettist Karl Michael von Levetzov hat sich vordergründig ein Märchen erdacht, dass den Opern Franz Schrekers inhaltlich nahe steht: Prinzessin Lianora will nicht heiraten, auch nicht ihren Vetter Tankred. Regisseurin Mascha Pörzgen und Ausstatter Frank Fellmann lassen die Auseinandersetzung der Prinzessin in einem großen Saal mit Himmelbett spielen.

Viele bemooste Steine signalisieren, dass die unverheiratete Prinzessin zu versteinern droht, womit wir bei einem Motiv sind, dass sich auch in „Die Frau ohne Schatten“ findet. Wahrscheinlich hat der große Erfolg der Strauss-Oper dem „Lied der Nacht“ bereits in den Jahren 1930 bis 1933 die weitere Bühnenexistenz verwehrt.
Osnabrücks GMD Andreas Hotz feuert sein Orchester mit spürbarer Begeisterung für Gáls Partitur an: Man hört, dass der Komponist ein Zeitgenosse von Mahler, Strauss und Schreker ist, gleichzeitig geht er in vielen Aspekten seine eigenen Wege. Sein melodischer Erfindungsreichtum ist dabei schier unerschöpflich.
Die Prinzessin Lianora wird von Lina Liu mit großerleuchtender und fast schon metallischer Stimme gesungen. Liu liefert ein starkes Porträt dieser zerrissenen Figur, wird dabei aber von Ausstatter Fellmann mit unvorteilhaften Kostümen bedacht. Als Gefährtinnen steht Lianora die Hofdame Hämone zur Seite: Susanne Vent-Wunderlich singt die Rolle mit großer Stimme und gibt der Figur so ein starkes Gewicht. Manche Szene zwischen Prinzessin und Hofdame wirken aber zu ausufernd, so dass bei einer Neuinszenierung hier vielleicht gestrafft werden könnte.

Die Prinzessin sucht sich nun Rat bei der „versteinerten Äbtissin“, die vielleicht in ihrer Jugend das gleiche liebelose Schicksal durchgemacht hat. Gritt Gnauck singt die Partie mit ruhig strömendem Mezzo, der die Figur in die Nähe einer orakelnden Erda rückt. Die Äbtissin empfiehlt, die Prinzessin solle auf die „Stimme der Nacht“ hören.
Dahinter verbirgt sich der Bootsmann Ciullo, der der Prinzessin regelmäßig nächtliche Ständchen bringt („Don Giovanni“ und „Trovatore“ lassen grüßen.), ohne dass sie weiß, wer da singt. Ferdinand von Bothmer gestaltet den Ciullo mit kräftigem Tenor, der in der Höhe aber noch etwas mehr Strahlkraft besitzen könnte. Die Inszenierung macht aus ihm mal einen Gondoliere, der „Hoffmanns Erzählungen“ entsprungen sein könnte, und im Schlussakt kommt er als rächender Zorro daher.

Das ungewöhnliche Ende der Oper soll hier nicht verraten werden. Fahren Sie also selbst nach Osnabrück und lassen Sie sich vom „Lied der Nacht“ betören wie das dortige Publikum. Denn schon in der Pause spürt man den Enthusiasmus des Osnabrücker Publikums für die Musik Hans Gáls: „Das ist ja total romantisch!“ und „Mein Gott, ist diese Musik schön!“ hört man beim Verlassen des Zuschauerraumes. Nach der Aufführung bricht sich die Begeisterung in tosendem Applaus Bahn.
In Osnabrück ist „Das Lied der Nacht“ beim Publikum angekommen. Man kann nur hoffen, das jetzt andere Bühnen nachspielen, denn dieses Werk bietet neben der starken Musik auch viele inszenatorische Deutungsmöglichkeiten.
Rudolf Hermes 18.5.2017
Bilder (c) Theater Osnabrück
Bitte unbedingt in diese tolle vergessene Musik mal reinhören:
Sinfonie Nr.1
Divertimento
Konzert für Klavier und Orchester
OPERNFREUND PLATTEN TIPP
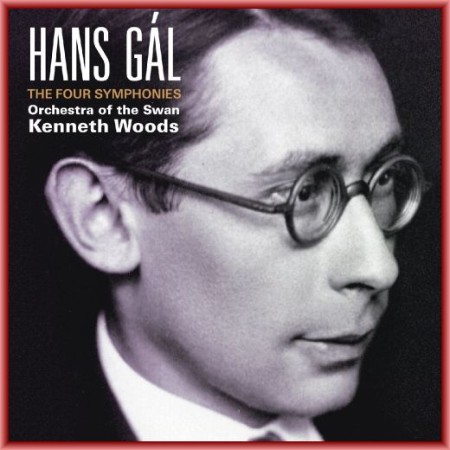
Andrew Lippa
The Addams-Family
Premiere: 11. März 2017
Die Addams-Family hat einen weiten Weg durch alle möglichen Medien hinter sich: In den 1930er Jahren wurde sie als Cartoon erfunden, in den 1960ern folgte eine Fernsehserie und seit den 1990er werden Spielfilme über die skurrile Sippe gedreht. 2009 wurde schließlich in Chicago die Musical-Version von Andrew Lippa uraufgeführt. Das Theater Osnabrück bringt das Stück nun in Koproduktion mit dem dortigen Institut für Musik der Hochschule auf die Bühne.

Die Geschichte, die Marshall Brickmann und Rick Elice sich auch ausgedacht haben, ist simpel gestrickt: Tochter Wednesday Addams hat sich in den Normalo Lucas Beineke verliebt und will ihn und dessen Eltern nun ihrer Familie vorstellen. Beim Antrittsbesuch prallen die Welten aufeinander und über fast drei Stunden erlebt man Liebe, Verstörung, peinliche Situationen und die finale Versöhnung. Das ist inhaltlich gestrickt wie eine Scripted Reality von RTL und SAT1 und hat einige Durchhänger, lebt aber von den ungewöhnlichen Charakteren der Addams-Family.
Allen voran ist da Mezzosopranistin Katarina Morfa zu nennen, welche die Mortica Addams als dominant-elegante Erscheinung mit starker Stimme und großer Bühnenpräsenz spielt. Ihren Ehemann Gomez gibt Jan Friedrich Eggers als Gentleman der alten Schule, der unter dem Pantoffel seiner Frau steht. Seine Partie singt er mit weichem Bariton.

Tochter Wednesday wird von Lasarah Sattler als grelle Göre gespielt, ihren Freund Lucas singt Felix Freund mit geschmeidiger Stimme. Sandra Bitterli gibt den Pugsley Addams als bösen Buben im Max-und-Moritz-Stil. Mit trockenem Humor spielt Mark Hamman den durchgeknallten Onkel Fester. Vollkommen überzogen wird die Addams-Großmutter, die für die Handlung entbehrlich ist, von Tobias Rusnak dargestellt.
Erfreulicherweise ist die Osnabrücker Aufführung besser als das Stück: Bühnenbildner Nikolaus Webern kombiniert düstere schwarz-weiß Projektionen mit realen Bühnenteilen, sodass stimmungsvolle Illusionsräume entstehen, während die Kostüme von Linda Schnabel nostalgisch-gruselige Eleganz verströmen.
Regisseur Felix Seiler beweist, dass er sein Handwerk in der grellbunten Schule von Barrie Koskys Komischer Oper gelernt hat und bringt pointierte Dialoge auf die Bühne. Ein echtes Tanzfeuerwerk liefert Choreografin Kati Farkas ab. Die abwechslungsreiche Musik inspiriert sie zu genauso abwechslungsreichen Choreografien, die von den jungen Leuten der Osnabrücker Hochschule schwungvoll umgesetzt werden. Selbst für die beteiligten Opernsänger findet Farkas immer die richtigen und effektvollen Tanzschritte.

Die 12-köpfige Band wird von Kapellmeister An-Hoon Song inspiriert durch die Partitur von Andrew Lippa geführt, die jedoch noch durchaus ein paar echte Ohrwürmer vertragen hätte. Bis die richtige Koordination zwischen den verstärkten Singstimmen und der Band eingepegelt ist, benötigt die Technik jedoch einige Zeit.
Insgesamt muss man dem Osnabrücker Theater bescheinigen, dass es eine unterhaltsame Aufführung auf die Bühne bringt, der es gelingt, über die Schwächen des Stückes hinweg zu spielen.
Bilder (c) Theater Osnabrück
Rudoph Hermes 16.3.2017
DANSE MACABRE
Choreografien von Mary Wigman, Marco Goecke und Mauro de Candia
Premiere: 11. Februar 2017
Besuchte Vorstellung: 16. Februar 2017
VIDEO
Schon 2013 wagte sich die Dance Company Osnabrück an die Rekonstruktion einer klassischen Mary Wigman-Choreografie. Damals wurde im Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Theater Wigmans Berliner „Sacre de printemps“ von 1957 erarbeitet. Nun geht Osnabrück noch einen Schritt weiter und recherchiert, wie zwei Totentänze, die 1917 und 1926 entstanden sind, ausgesehen haben könnten. Kombiniert werden diese Stücke mit Choreografien von Marco Goecke und Mauro de Candia.

Henrietta Horn hat die Rekonstruktion anhand von alten Tanznotationen, Fotografien und Aufführungsberichten übernommen, wurde dabei von Susan Barnett, Cristine Caradec und Katharine Sehnert unterstützt. Das Ergebnis führt in eine fremde und ungewöhnliche Tanzwelt, die aber gleichzeitig sehr faszinierend ist.
Mary Wigmans „Totentanz I“ zum „Danse macabre“ von Camille Saint-Saens kommt sehr verspielt daher und wirkt, als befänden sich vier Zwerge im Rumpelstilzchen-Modus. Zwischendurch gibt es aber auch Situationen von Bedrohung, Angst und Schutzsuche.

Der „Totentanz II“ ist ein düsteres Ritual, das höchste Spannung erzeugt und auch noch nach 90 Jahren berührt: Ein Dämon, der von sechs Lemuren begleitet wird, beschwört eine weibliche Gestalt. Alle Personen tragen Masken, was dazu führt, dass die Tänzer noch viel mehr Energie in die ausdrucksvolle Körpersprache legen. Keith Chin ist der Dämon, der mit starker Gestik agiert, Marine Sanchez Egasse die weibliche Gestalt, die sich in ihr Schicksal ergibt.
Das Markenzeichen von Marco Goeckes Choreografien sind wild flatternde Hände, die natürlich auch Bestandteil von „Supernova“ sind, das 2009 für das Scapino Ballett Rotterdam entstand: Die acht Tänzerinnen und Tänzer betreten immer wieder mit virtuos-rasanten Arm- und Handbewegungen den Lichtkreis, der die Bühne beleuchtet. Verlassen sie ihn, wirkt es, als würden sie im Raum verglühen.

Goecke lockert den Furor der Aktion durch originelle Bilder auf. Zum Beginn wirbeln die Tänzer Salz umher. Später stehen sie einmal ganz ruhig mit ausgebreiteten Armen da, während sie brennende Streichhölzer halten.
Die Choreografien von Mary Wigman und Marco Goecke werden von der Dance Company Osnabrück auf echtem Festspielniveau präsentiert, doch die abschließende „Sacre“-Choregrafie von Mauro de Candia kann da nicht mithalten. Die Ausführungen des Choreografen im Programmheft über den gesellschaftlichen Druck der Konsumgesellschaft lesen sich plausibel, finden sich aber nicht in der Aufführung wieder.

Die Tänzer agieren in hautengen weißen Kostümen, wodurch man sich am ehesten an eine Situation im Ballettsaal erinnert fühlt. De Candia setzt oft langsame Bewegungen gegen die Wildheit der Musik. Manchmal gibt es Situationen, die an andere Sacre-Choreografie erinnern, wenn sich eine Gruppe um eine einzelne Frau formiert, oder die neun Tänzerinnen und Tänzer in solistische Bewegungen verfallen. Von der angekündigten Gesellschaftskritik ist aber auf der Bühne nichts zu spüren.
Trotz des schwachen Finales lohnt sich ein Besuch dieses dreiteiligen Ballettabends aufgrund der Choreografien von Mary Wigman und Marco Goecke.
Rudolf Hermes 23.2.17
Bilder (c) Theater Osnabrück
ELEKTRA halbszenisch
Premiere 21. Mai 2016
besuchte Aufführung 17. Juni 2016
In altgriechischen Tragödien wird das Schicksal der Betroffenen meist dargestellt in Monologen und Dialogen, später mit Kommentierung durch den Chor. Auf der Bühne, deren Hintergrund häufig eine Fassade darstellt, sind Kämpfe oder Tötungen nicht zu sehen, von diesen wird nur berichtet. Daran hielt sich in etwa auch Hugo von Hofmannsthal in seiner Tragödie in einem Aufzug „Elektra“ nach Sophokles, die von Richard Strauss vertont wurde. Den kommentierenden Chor ersetzt ja bei Wagner und Strauss die Leitmotivtechnik im Orchester. Deshalb eignet sich diese Oper mehr als andere für konzertante oder halbszenische Aufführungen mit dem Orchester hinten auf der Bühne. Das hat zudem den Vorteil, daß nicht abstruse Regieeinfälle den Charakter des Werks verfälschen, bei „Elektra“ etwa grosse Emotionen kleinkariert darstellen können.

Eine solche halbszenische „Elektra“ ist jetzt großartig gelungen dem Theater am Domhof in Osnabrück unter der musikalischen Leitung des jungen GMD Andreas Hotz in der szenischen Einrichtung von Intendant Ralf Waldschmidt.
Letzterer erreichte szenische Wirkungen durch Mimik und Bewegung der Protagonisten, aber auch durch gespielte Szenen. Während nach der Nachricht vom Tode Orests Elektra nach dem Beil grub, sah man bei etwas hellerer Saalbeleuchtung Orest (mit grosser Bariton-Stimme Rhys Jenkins) und seinen Pfleger (Genadijus Bergorulko) aus einem Seiteneingang am Publikum vorbei zur Bühne gehen, später wurde die Erkennungsszene zwischen Elektra und Orest voll ausgespielt. Die Todesschreie Klytämnestras waren hinter der Bühne zu hören. Aegisth – schauspielerisch und mit treffsicherem Tenor dargestellt von Mihkail Agofonov – wurde vor seiner Tötung wie vorgeschrieben zur Bühne und zurück gezerrt. Zum Schluß tanzte Elektra nicht, sondern sank leblos in sich zusammen. Unterstützt wurde dies durch eine zwischen dunkelrot und hellblau je nach Szene wechselnde Beleuchtung von Bühnenhintergrund und -seiten (Licht Uwe Tepe) Die Kostüme von Linda Schnabel wechselten zwischen schwarzen für die düsteren Gestalten wie Elektra, Klytämnestra oder Orest und weissem für die dem Tag zugeneigte Chrysothemis. Die Mägde (Almerija Delic, Gabriella Guilfoil, Kathrin Brauer und Radoslava Yordanova – alle exakt singend) waren schwarz-weiß gekleidet mit Ausnahme der Aufseherin in schwarz(Chihiro Meier-Tejima) und der fünften Magd in weiß, weil sie bewundernde Worte für Elektra findet – Erika Simons mit strahlend hohem Schlußton zum Ende ihres Auftritts.

Für die Titelpartie verfügte Rachael Tovey über die Riesenstimme, wie Strauss sie sich für die „allerhochdramatischste Sängerin“ wohl vorgestellt hat. Ihre Spitzentöne überstrahlten ohne Schwierigkeiten das grosse Orchester, manchmal fast mehr als für das kleine Osnabrücker Haus notwendig. Bewundernswert waren ihre Mittellage und die für die Partie notwendige Tiefe. Gleichzeitig war sie textverständlich, soweit bei dem hochdramatischen Gesang möglich. So war ihr erster Monolog, sich aus Haß zum vorweggenommen Triumph über den Tod der beiden Mörder ihres Vaters steigernd, mit den langen hohen Tönen (bis zum c) „eine archaische Wucht“ Sie konnte ihre Stimme auch zurücknehmen, etwa bei den drei leisen „Orest“-Rufen, beim dritten mit einem crescendo endend. Auch die ironische Stimmfärbung beim Gespräch mit ihrer Mutter oder mit Aegisth wurde deutlich. Von allen Mitwirkende spielte sie ihre Rolle am intensivsten, wohl weil sie sie bereits szenisch dargestellt hat.
Ganz grosse Bewunderung verdiente Lina Liu aus dem Opernensemble Osnabrücks als Chrysothemis. Lyrisch und legato bis zu feuriger Begeisterung gelang ihre Wunscherzählung nach normalem „Weiberschicksal“, gleichzeitig verfügte sie über genügend Stimmkraft und Technik, um sich bis zu Spitzentönen ohne Schärfe gegen das grosse Orchester durchzusetzen. So wurde ihr Schlußduett mit Elektra zum Höhepunkt des Abends.

Für die Rolle der Klytämnestra ließ sich Martina Dike als indisponiert ansagen, das war wirklich überflüssig, man kann sich kaum vorstellen, daß in früheren Aufführungen ihr die Rolle besser gelang. Vor kurzem noch bewundert als Mrs. Sedley in Britten´s „Peter Grimes“ in Dortmund machte sie hier sängerisch ganz entgegengesetzt die abartige Psyche der nach dem Mord an ihrem Mann die Rache des Sohnes fürchtenden Königin deutlich. Erschütternd klang nach der Auseinandersetzung mit Elektra das mehrere Takte zu haltende gis bei „damit ich wieder schlafe“Auch sie war – besonders wichtig für die fast parlando Stellen - weitgehend textverständlich.
Der Hauptakteur des Abends aber war, hinter den Sängern platziert, das Osnabrücker Symphonieorchester in der von Strauss genehmigten verkleinerten Besetzung von ungefähr 60 Musikern unter Leitung von Andreas Hotz. Was brauchte es z. B. einen „Strohwisch“ für Elektra, wenn man seine Schläge im Orchester hören konnte, was brauchte es ein Beil, wenn man sein Herabsausen schaurig vernehmen konnte, was braucht es Talismane am Körper von Klytämnestra baumelnd, wenn man sie im Orchester bei jedem ihrer Schritte klirren hörte.

Besonders in den Zwischenspielen wurden zudem die Schärfen zwischen den polytonalen Akkorden betont. Die fahlen Orchesterfarben beim Auftritt Klytämnestras oder die schon weihevollen p-Akkorde der Wagner-Tuben beim Auftritt Orests, die süffigen Kantilenen bei der Erkennungsszene beeindruckten sichtlich die Zuhörer. Die Soli von Geige, Bratsche und Cello, der beiden Harfen und die vielen Bläsersoli verdienten besonderes Lob.
Bei Sängern, Dirigent und dem Orchester, auch den einzelnen Solisten daraus, bedankte sich das Publikum im fast ausverkauften Haus mit langem Beifall und vielen Bravos.
Sigi Brockmann 18. Juni 2016
Fotos Jörg Landsberg
P.S.
„Habent sua fata libelli“ Dieses lateinische Sprichwort, daß Bücher ihre Schicksale haben, kam mir in den Sinn, als ich in meinem vor langer Zeit antiquarisch erworbenen Klavierauszug der „Elektra“ den Namen „Ks. Brünnhild Friedland Staatsoper Dresden“ las, die offenbar mit diesem Klavierauszug die „Chrysothemis“ studiert hatte. Sie hieß eigentlich Marianne Pietschick, war von 1950 bis 1970 an der Dresdner Staatsoper engagiert, floh nach München, bekam dort kein Engagement, ging zurück in die DDR, bekam auch kein Engagement mehr, reiste legal zurück in die Bundesrepublik, wieder kein Engagement, wieder zurück in die DDR, wieder kein Engagement, dann Abschiebung in die Bundesrepublik als unerwünschte Person, sang noch in Osnabrück als Gast die Mutter in „Hänsel und Gretel“, war dann bis zu ihrem Tod 1986 arbeitslos – ein trauriges innerdeutsches Sängerinnenschicksal!
DON QUICHOTTE AUF DER HOCHZEIT DES CAMACHO
3. 5. 2016
Barockraritätvon Telemann als Kinderopern
 Beim Anblick des Fotos der deutschen Kanzlerin Merkel erleidet Don Quichotte einen Schock
Beim Anblick des Fotos der deutschen Kanzlerin Merkel erleidet Don Quichotte einen Schock
Das Theater am Domhof in Osnabrück brachte am 3.Mai 2016 im Oberen Foyer die Barock-Rarität„Don Quichotte auf der Hochzeit des Comacho“ von Georg Philipp Telemann in Kooperation mit den Hochschulen für Musik Hannover und Bremen als Kinderoper. Der Komponist hatte das Werk im Jahr 1761 als 80-Jähriger sechs Jahre vor seinem Tod geschrieben. Das Libretto verfasste sein um sechzig Jahre jüngerer Schüler Daniel Schiebeler nach einer Episode des Romans von Miguel de Cervantes.
Die Handlung dieser Episode in Kurzfassung: Auf den berühmten Ritter Don Quichotte und seinen Knappen Sancho Pansa wartet ein neues Abenteuer, das sie mitten in eine Hochzeitsgesellschaft führt. Basilio, ein mehr vom Pech als von Glück verfolgter Viehhirte, liebt die wunderschöne Schäferin Quiteria, die aber – gegen ihren Willen und ihr Gefühl – Comacho, dem reichsten Hirten der Gegend, versprochen ist. Als die ausgelassene Feier beginnt, wird der vermeintlich schwer verletzte Basilio auf einer Bahre hereingetragen. Von einem Dolch durchbohrt und dem Tode nahe, hat er den sehnsüchtigen Wunsch, ein letztes Mal die Hand seiner geliebten Quitera zu halten. Als ihm die Bitte gewährt wird, gesundet Basilio – der Dolch steckte bloß in seinen Kleidern. Nachdem der Trick durchschaut wurde, stehen die Zeichen auf Sturm. Doch wieder einmal ist der erfahrene Ritter Don Quichotte gefragt und verhilft den beiden jungen Verliebten zum Glück.
Der jungen deutschen Regisseurin Clara Kalus gelang eine kindergerechte Inszenierung, die die Kleinen in ihren Bann zog. Mit großen Augen und mucksmäuschenstill verfolgten sie, teils auf dem Boden, teils auf Stühlen sitzend, die Handlung und bejubelten am Schluss die Darsteller und Musiker. Eine gute Idee der Regisseurin war, die Sängerinnen und Sänger im ganzen Foyer agieren zu lassen, wodurch auch die Kleinen ein wenig in Bewegung blieben und ihren Hals verrenken mussten, um alles sehen zu können. Mehr als eine Stunde nur ruhig sitzen, wäre den 6- bis 8-Jährigen wohl kaum zuzumuten. Zu Beginn ließ die Regisseurin das Stück im Labor einer Klinik spielen, wo Don Quichotte und Sancho Pansa zum Leben erweckt werden und auf Zimmer-Fahrrädern – als Ersatz für ihre Pferde – Kondition tanken.
Die Ärzte und Krankenschwestern entledigten sich dann ihrer weißen Kleidung (Bühne und Kostüme:Julia Kerk) und mutierten schließlich zur Hochzeitsgesellschaft.
In der Titelrolle konnte der litauische Bassbariton Genadijus Bergorulko sein komisches Talent und seine sportliche Beweglichkeit unter Beweis stellen. Er kämpfte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Utensilien (Holzbrett, Kartonrollen, Lineal etc.), um seine oft unsichtbaren Feinde zu besiegen (Kampfchoreographie: Ulrike Schumann). Ihm zur Seite der junge schlaksige deutsche Bariton Äneas Humm in der Rolle des Sancho Pansa – das genaue Gegenstück: ohne Temperament, dafür mit stetem Hunger nach Essbarem. Eine gute Mischung für die humorvollen und oft komischen Szenen.
Die Rolle des reichen Comacho verkörperte der Countertenor Alexander Masters, der im „Vorspiel“ den Chefarzt mimte, als unsympathisch wirkenden Macho, dem niemand die hübsche Schäferin Quiteria gönnte, die von der jungen Sopranistin Magdalena Hinz anmutig dargestellt wurde. Sie ließ sich vor der Vorstellung als stark verkühlt ansagen und sang dementsprechend nicht mit voller Kraft. Gespielt hat sie ihre Rolle jedenfalls gut. Ebenso der junge österreichische Bariton Max Müllerals Viehhirte, der schließlich seine Geliebte in die Arme schließen konnte. Stimmlich überzeugend waren als Pedrillo die Mezzosopranistin Gabriella Guilfoil und als Grisostomo die ungarische Sopranistin Réka Kristóf, die beide zuerst als Krankenschwestern stumme Rollen zu spielen hatten.
Das Osnabrücker Symphonieorchester, das vom koreanischen Dirigenten An-Hoon Song sehr umsichtig geleitet wurde, brachte die von musikalischem Witz sprühende Partitur Telemanns hervorragend zur Geltung. Laute Beifallskundgebungen für alle Mitwirkenden des zu 90 Prozent sehr jungen Publikums von etwa sechs bis acht Jahren.
Udo Pacolt 4.5.16
Besonderer Dank an unseren Kooparationspartner MERKER-online (Wien)
Foto: Uwe Lewandowski
LOHENGRIN

Premiere: 19. März 2016
Besuchte Vorstellung: 25. März 2016
Auch wenn Wagners Opern auf deutschen Bühnen einen besonderen Status genießen, so wird der „Lohengrin“ immer gekürzt aufgeführt. Die Stelle im 3. Akt, wenn der Titelheld dem König prophezeit, „Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen des Ostens Horden siegreich niemals ziehen!“, wird stets gestrichen. Wahrscheinlich befürchten die Intendanten und Dramaturgen, Hitler könnte durch diese Stelle zum Überfall auf Russland inspiriert worden sein und wollen Wagner so entnazifizieren. In der Osnabrücker Inszenierung von Yona Kim wird dieser Strich aber geöffnet.
Nach einer Inszenierung im Jahr 1963 ist dies erst die zweite Lohengrin-Produktion im Osnabrücker Theater am Domhof. „Lohengrin“ bedeutet für ein Haus dieser Größe einen immensen Kraftakt, was sich auch darin zeigt, dass für die Titelrolle und die Ortrud Gäste engagiert wurden, der Extrachor zum Einsatz kommt und das Orchester auf der Hinterbühne platziert ist, weil im Graben nicht ausreichend Platz wäre. Außerdem hat man sich noch die Königstrompeten bei den Bayreuther Festspielen ausgeliehen.

Regisseurin Yona Kim hat eine Fülle von Ideen, so dass man eine Inszenierung voller Anspielungen und Verweisen erlebt, die sich aber in ihrer Fülle nicht alle erschließen und auch kein logisches Gesamtbild ergeben. Mal wirkt es, als sei Elsa die Insassin einer Psychiatrie und sie erträume sich ihren Lohengrin-Helden nur. Dieser scheint nur ein Ersatz für den verschwundenen Bruder Gottfried zu sein, der immer wieder als Kind in Zwangsjacke mit Blechtrommel auftaucht. Da fühlt man sich ein bisschen an Harry Kupfers Berliner Staatsopern-Inszenierung erinnert.
Manchmal scheint Ortrud keine reale Figur, sondern nur die dunkle Seite von Elsas Charakter darzustellen. Die Auseinandersetzungen zwischen beiden Frauen im 2. Akt werden als ein infantiler Zickenkrieg gezeigt, was wiederum Ideen aus Peter Konwitschnys HamburgerKlassenzimmer-Inszenierung aufgreift.

Das Ausstatter-Team Magrit Flagner und Hugo Holger Schneider siedeln das Stück über die Kostüme im 19. Jahrhundert an. Als Bühne hätte die rechteckige Spielfläche ausgereicht. An den Seitenwänden werden aber immer wieder Bilder aus der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts (Paulskirche, Neuschwanstein, Proklamation des Kaiserreiches in Versailles) projiziert. In der Handlung, die Yona Kim auf der Bühne erzählt, finden die poltischen Ereignisse dieser Zeit dann aber keinen Niederschlag, sondern das psychologische Drama der Elsa, die sich ein Wunder erträumt und mit diesem Wunder nicht umgehen kann, bildet das Zentrum der Aufführung.
Ein beachtliches Rollendebüt liefert der kanadische Tenor Chris Lysack als Gast vom Theater Aachen, wo er erst kürzlich den Tannhäuser gesungen hat. Lysack vereint sowohl Lyrik als auch Kraft und teilt sich seine Rolle klug ein. Bei den Spitzentönen strengt er sich aber hörbar an und diese bleichen aus. Andrea Baker vom Staatstheater Wiesbaden ist als Ortrud eine wahre Furie von Frau. Auch wenn sie die Partie imponierend singt, übertreibt sie es manchmal darstellerisch.

Ein sängerisches Ereignis ist die Elsa von Lina Liu. Die Sopranistin singt mit einer strahlenden und genau ausgewogenen Stimme. Die Artikulation ist genauso perfekt wie der Sitz der Töne und die Gestaltung der Rolle. Dank ihrer und Andrea Baker Leistung ist die Szene der beiden Frauen im zweiten Akt der musikalische Höhepunkt des Abends.
Rhys Jenkins glaubt man den Bösewicht Telramund nicht so richtig. Dafür singt er die Partie zu gemütlich. Der König Heinrich von José Gallisa beeindruckt mit knorriger Kraft, müsste aber noch an der Aussprache feilen. Großartig singt Dennis Sörös den Heerrufer. Er glänzt mit einem hellen Bariton und setzt immer wieder kluge Akzente.

Szenisch wirken die die von Markus Lafleur einstudierten Chöre manchmal unterfordert, aber die Spielfläche ist klein, dass es da schon Gedränge gibt, wenn alle Akteure auf der Bühne sind. Sängerisch trumpft der Opernchor, der hier noch vom Extrachor und Herren des Coruso Opernchores unterstützt werden, aber mächtig auf
Generalmusikdirektor Andreas Holz lässt das Osnabrücker Symphonieorchester großartig aufspielen. Den Facettenreichtum von Wagners Musik und ihren Klangzauber kann er schön entfalten. Die räumliche Positionierung des Orchesters bedeutet auch keinen Nachteil, sondern sorgt dafür, dass die Stimme vom Orchester gut getragen und unterstützt werden.
Rudolf Hermes 27.3.16
Bilder (c) Theater Osnabrück
P.S.
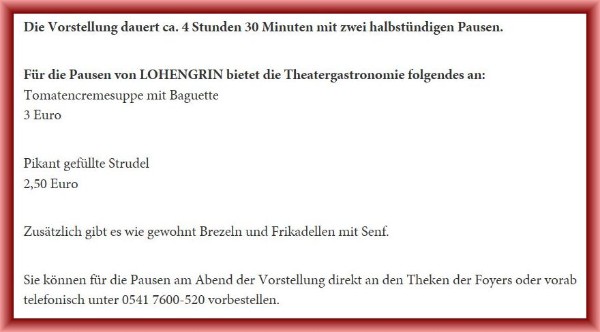
Georg Philipp Telemann
GERMANICUS
Premiere: 20. Juni 2015
Erste Aufführung seit mehr als 300 Jahren

Mit der Premiere diese Oper gelingt dem Theater Osnabrück ein ganz besonderer Coup: Lange Zeit galt dieses 1704 uraufgeführte Werk als verschollen und wahrscheinlich ist hier die erste Aufführung seit mehr als 300 Jahren zu erleben. Außerdem eröffnet am Premierentag im nahegelegenen Kalkriese, dem historischen Schauplatz der Varus-Schlacht, die Ausstellung „Ich Germanicus – Feldherr, Priester, Superstar“, so dass man auch von einer gelungenen Kooperation zweier Kultureinrichtungen sprechen kann.
Erzählt wird eine erfundene Handlung um historische Figuren wie sie im Barock üblich ist: Feldherr Germanicus kehrt siegreich vom Feldzug gegen die Germanen in das heutige Köln zurück, wo Ehefrau Agrippina mit Söhnchen Caligula auf ihn wartet. Als Gefangene bringt Germanicus auch Claudia (die historische Thusnelda) mit, die Ehefrau des Cheruskerfürsten Arminius, der als tot gilt. Arminius hat aber überlebt, schleicht sich verkleidet bei den Römern ein und will sich rächen.
Für weitere Intrigen sorgen der römische Hauptmann Florus, der an die Macht will und der germanische Prinz Lucius, der in Claudia verliebt ist. Während der historische Arminius von verfeindeten Germanenfürsten getötet wurde, gibt es in der Oper ein Happy-End: Germanicus und Arminius werden Freunde.
Möglich ist diese Wiederaufführung nur, weil der Leipziger Musikwissenschaftler Michael Maul in der Frankfurter Universitätsbibliothek eine Sammlung mit Arien aus „Germanicus“ entdeckt hat. Der „Germanicus“ gilt nämlich als verschollen, seit die Originalnoten bei der Bombardierung Hamburgs im 2. Weltkrieg verbrannten. Der Osnabrücker Kapellmeister Daniel Inbal entschloss sich nun für die fehlenden Rezitative auf Telemanns italienische Vorlage „Germanico sul Reno“ von Giovanni Legrenzi zurückzugreifen, ein ebenfalls vergessenes Bühnenwerk, das von Tiziana Legrenzi in Modena editiert wurde.
Ergänzt wird die dreistündige Osnabrücker Aufführung um ein paar weitere Arien aus anderen Telemann-Opern, wobei insgesamt 31 Nummern aus der Original-Partitur erklingen. Die Kombination von Telemann-
Arien mit Legrenzi-Rezitativen fällt gar nicht groß auf, sondern beide Werke harmonieren bestens. Verwirrend er ist eher Telemanns Besonderheit, dass einige Arien auf Italienisch, andere auf Deutsch gesungen werden, was auch zu stilistischen Unterschieden in seiner Musik führt.

Das Osnabrücker Symphonieorchester spielt unter der Leitung von Daniel Inbal drahtig und vorantreibend auf. Diese Musik ist schön anzuhören und trifft sehr gut die Seelenlage der Figuren. Daniel Inbal betont auch die Originalität und Frische dieser Musik. Ein besonderes Lob verdient die Continuo-Gruppe mit Mino Marani am Cembalo, Klaus Mader an der Laute und Susanne Lamke am Barockcello.
Die Sänger finden sich unterschiedlich gut mit Telemann zurecht: Bassist Shadi Torbey singt mit kernigem Bass einen energischen und selbstbewussten Germanicus. Als seine Frau Agrippina profiliert Erika Simons mit ihrer schönen Sopranstimme diese Figur so einfühlsam und ausdrucksstark, dass man denkt, dass diese Oper nach ihr benannt werden müsste.
Für seine virtuosen Höhenflüge in den Koloraturenhimmel wird Countertenor Antonio Giovannini als intriganter Hauptmann Florus gefeiert. Leslie Visco gefällt mit schönem Sopran in der Hosenrolle des Caligula.
Die Germanen können da nicht ganz mithalten: Lina Liu als Claudia und Jan Friedrich Eggers als Arminius gestalten zuverlässig, wirken aber manchmal etwas bieder. Almerija Delic gefällt wiederum mit ihrem schön geführten und gut abgerundeten Mezzosopran als Prinz Lucius.
Bühnenbildner Wolfgang Gutjahr hat ein Labyrinth aus recht wackeligen Gerüsten entworfen, die mit gestanzten Goldfolien verkleidet sind. So soll ein barockes Labyrinth entstehen, in dem sich die Figuren verirren. Da keine konkreten Schauplätze verortet werden, bleibt der Zuschauer manchmal etwas ratlos, wo man sich gerade befindet. Kostümbildnerin Katharina Weissenborn orientiert sich an barocken Vorbildern, setzt den Sängern manchmal aber hässliche Wuschelperücken auf. Die Regie von Alexander May bemüht sich um realistische Figuren, nähert sich aber manchmal arg dem Komödienstadel an. Die Idee, dass der Abend damit beginnt, dass Telemanns Truppe seine neue Oper aufführen will, bringt dem Publikum auch keinen Mehrwert.
Telemanns Musik hätte szenisch eine hochwertigere Umsetzung verdient, vielleicht den Witz eines David Alden oder die historische Rekonstruktion einer Sigrid T´Hooft.
Von Rudolf Hermes 21.6.15
Bilder: Theater Osnabrück / Jörg Landsberg
Manfred Gurlitt
DIE SOLDATEN
Premiere: 17. Januar 2015
Besuchte Vorstellung: 3. Februar 2015
Komponist Manfred Gurlitt hat es auf den Bühnen schwer: Sieben Opern hat er geschrieben, doch sein „Wozzeck“ ist von Alban Bergs Oper verdrängt worden und „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermanns monumentalem Musiktheater. Dabei ist Gurlitts „Soldaten“-Oper wesentlich leichter auf die Bühne zu bringen, wie jetzt in Osnabrück zu erleben ist.
Gurlitts Vertonung wirkt wie ein Schauspiel mit Musik, ist sehr auf die Sprache fokussiert. In den Zwischenspielen atmet das 1930 in Düsseldorf uraufgeführte Stück den Geist der Spätromantik. Am ehesten kann man dieses Werk mit den Konversationsopern von Richard Strauss vergleichen (Intermezzo, Capriccio).
Kennt man Zimmermanns „Soldaten“, ist man bei Gurlitt anfangs etwas verstört von der Leichtigkeit und dem komödiantischen Ton der Musik. Gurlitts Komposition hält viel Distanz zum Geschehen, und berührt den Hörer erst am Ende, wenn Marie im Elend lebt. Das Osnabrücker Symphonieorchester unter dem Dirigat von An-Hoon Song trifft den speziellen Tonfall Gurlitts gut und spielt klangschön auf. Lediglich die Blechbläser haben gelegentlich Probleme mit der Intonation.
Regisseur Florian Lutz versetzt die Geschichte in unsere Gegenwart und spart dabei nicht mit Bundeswehrkritik, die aber oft klischeehaft und platt ist. Alle Figuren sind hier in das Militärwesen eingebunden: Stolzius ist kein Tuchhändler, sondern Chef einer Waffenfabrik, der alte Wesener handelt nicht mit Galanteriewaren, sondern Schusswaffen. Da ist es für Florian Lutz, der die Personenführung sehr genau gearbeitet hat, nur logisch, dass Desportes der Marie zum ersten Rendezvous keine Ziernadel, sondern ein Maschinengewehr als Geschenk mitbringt.
In der Zeichnung der Personen weicht Florian Lutz von dem Bild der Figuren ab, dass die Musik vermittelt: Marie ist kein Opfer der Männergesellschaft, sondern ein Power-Girl, das weiß, wie es mit Hilfe der Männer aufsteigen kann. Dass solch eine starke Person dann unter die Räder der Gesellschaft gerät, kann man nicht so recht glauben. Susann Vent-Wunderlich singt die Marie als selbstbewusste Power-Frau mit jugendlich dramatischem Sopran
Stolzius ist kein schwärmerisches Weichei, sondern ein bloß ein Verliebter Waffenproduzent, den Jan Friedrich Eggers mit klarem und hellem Bariton singt. Desportes ist hier nicht ein geiler Bock, sondern ein angenehm plaudernder Geschäftsmann mit schusssicherer Weste. Per-Hakan Precht singt die Rolle sehr heldentenoral. Ein tolles Kabinettsstückchen legt Joslyn Rechter in der Rolle der Gräfin de la Roche hin. Sie singt die Partie sehr nobel und legt gleichzeitig eine überzeugende Ursula-von-der-Leyen-Parodie als „Mutter der Kompanie“ hin.
Die Zwischenspiele werden mit Werbefilmen der Bundeswehr und der Waffenindustrie sowie Bildern von aktuellen und früheren Kriegsschauplätzen garniert. Zwar kann man über den Sinn und Unsinn von Bundeswehreinsätzen diskutieren, der Armee aber grundsätzlich den Schwarzen Peter zuzuschieben, ist plump und geht an der Realität vorbei. Oft scheint es auch, als würde diese Inszenierung besser zu der Oper und der Musik von Bernd Alois Zimmermann passen als zu Manfred Gurlitt.
Insgesamt kann diese Regie von Florian Lutz nicht so begeistern wie seine Bielefelder (Medée, Cenerentola) und Bonner Arbeiten (Norma). Für Raritätensammler und Kenner der Zimmermann-Oper lohnt sich aber ein Besuch, um eine andere Sichtweise auf den Stoff kennenzulernen.
Rudolf Hermes 5.2.15
Bilder siehe unten
DIE SOLDATEN
zum Zweiten
Vorstellung: 3. 2. 2015

Als Marie bot Susann Vent-Wunderlich eine beeindruckende Leistung. (Foto: Jörg Landsberg)
Am Theater Osnabrück steht zurzeit eine besondere Opernrarität auf dem Spielplan: „Soldaten“ von Manfred Gurlitt. Dieser Stoff nach der Erzählung von Jakob Michael Reinhard Lenz aus dem Jahr 1776 wurde in den letzten Jahren durch die Oper von Bernd Alois Zimmermann mit Aufführungen bei der Ruhrtriennale in Bochum und vor zwei Jahren bei den Salzburger Festspielen bekannt. Das Werk von Gurlitt, im Jahr 1930 in Düsseldorf uraufgeführt, geriet jedoch in Vergessenheit.
Manfred Gurlitt (1890 in Berlin geboren, 1972 in Tokio gestorben) studierte bei Humperdinck in Berlin und zählte bald zu den schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten der Zwischenkriegszeit. Er wurde 1914 Operndirektor in Bremen und 1924 an der Berliner Staatsoper jüngster deutscher Generalmusikdirektor. Während seine ersten beiden Werke durch Bergs „Wozzeck“ und Zimmermanns „Soldaten“ bald in Vergessenheit gerieten, wurde seine dritte Oper „Nana“, die für Mannheim geplant war, von den Nationalsozialisten wegen der jüdischen Abstammung des Librettisten Max Brod abgesetzt. In der Hoffnung auf weitere künstlerische Tätigkeit trat Gurlitt in die NSDAP ein, doch wurde ihm die Mitgliedschaft 1937 aufgrund der jüdischen Abstammung seines Vaters Fritz Gurlitt aberkannt. Er emigrierte 1939 nach Japan, wo er Professor an der Kaiserlichen Akademie wurde und ein eigenes Opernunternehmen aufbaute. 1944 wurde er entlassen und kam als Ausländer bis Kriegsende in ein Evakuierungslager. Im Jahr 1957 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 1969 wurde Gurlitt zum Professor an der Showa-Hochschule in Tokio ernannt. Insgesamt komponierte er acht Opern.
Die Handlung der Oper, deren Libretto der Komponist nach der Erzählung des Sturm-und-Drang-Dichters Lenz selbst verfasste, in Kurzfassung: Marie, die Braut des Tuchhändlers Stolzius, beginnt eine Affäre mit dem Offizier Desportes. Ihr Vater, der Kaufmann Wesener,
billigt diese Verbindung, da er hofft, dass seine Tochter dadurch den Eintritt in höhere Kreise schafft. Als Desportes Marie fallen lässt, interessiert sich bereits ein weiterer Soldat, der Offizier Mary, für sie – und er ist nicht der letzte seines Standes. Marie gerät in einen unheilvollen Reigen, der ihr schließlich den Ruf als Soldatenhure und einen sozialen Abstieg einbringt. – Sie gerät in die Hände von Desportes’ Jäger, der sie vergewaltigt. Danach lebt Marie auf der Straße, wo sie einen Mann anbettelt, den sie dann als ihren Vater erkennt. Er nimmt die Obdachlose auf und versöhnt sich mit ihr. Stolzius kennt nur noch ein Lebensziel: Rache für Marie!

Jan Friedrich Eggers als Stolzius und Per-Håkan Precht als Desportes (Foto: Jörg Landsberg)
Florian Lutz verlegte die Handlung der Oper in die heutige Zeit und zeichnete ein Bild der jetzigen „Soldaten-Welt“, wobei er in seiner Inszenierung die Deutsche Bundeswehr und die Politik aufs Korn nahm. Die Oper wurde zur Karikatur! Denn der Regisseur ließ in den verschiedenen Szenen aus dem Leben der Soldaten kaum etwas aus: es wird gesoffen, gefoltert, gedemütigt, ein Sarg im Marschschritt von Soldaten über die Bühne getragen und noch vieles mehr. Die Crux dabei: die Figuren entstammten dem 20. und 21. Jahrhundert, die Texte spiegelten aber die Welt des 18. und 19. Jahrhunderts wieder, viele Wörter werden heutzutage nicht mehr verwendet (wie beispielsweise „itzt“ für „jetzt“) oder sind der französischen Sprache des Militärs des 18. Jahrhunderts entnommen, die vermutlich nicht einmal mehr die Offiziere der heutigen Zeit kennen. Und wer spricht seine Eltern noch per Sie an? Es passte nichts zusammen! Statt Briefen gab es übrigens SMS-Nachrichten auf Handys und E-Mails auf Laptops.
Die musikalisch wunderbaren, oft romantisch klingenden Zwischenspiele des Komponisten missbraucht der Regisseur für Filmeinspielungen (Videogestaltung: Konrad Kästner) von Einsätzen der Deutschen Bundeswehr in der Welt. Ein Kameramann (Sven Berling) durfte auch nicht fehlen. Er filmte nicht nur Marie beim Gesang, sondern auch Stolzius’ Mutter in Gestalt der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei diversen Auftritten beim Heer (beispielsweise bei einer Lehrstunde für Soldaten zum Thema „Wickeln von Säuglingen“). Dazu passte auch, dass der Offizier Desportes frappierend dem ehemaligen Minister Karl-Theodor zu Guttenberg glich.
Die Bühnen- und Kostümgestaltung für diese Inszenierung oblag Sebastian Hannak. Er nützte die Drehbühne für einen rasanten Ablauf des Geschehens und kam mit wenigen Requisiten aus (ein Sofa, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein Coca-Cola-Automat, der nicht nur Dosen auswarf, sondern sogar Schmuck und Kleidungsstücke für die leichten Mädchen). An Ideen mangelte es dem Regieteam wirklich nicht.
Für die hervorragende Wiedergabe der expressiven Partitur, die oftmals auch romantisch-melodische Sequenzen hatte, sorgte das Osnabrücker Symphonieorchester unter der Leitung des jungen Dirigenten Andreas Hotz. Dass sie am Schluss der Vorstellung vom Publikum mehr Beifall als das Sängerensemble und sogar Bravorufe bekamen, überraschte nicht.
Mit einer exzellenten Leistung wartete die Sopranistin Susann Vent-Wunderlich auf, die als Marie schauspielerisch stark berührte und stimmlich alle Klippen ihrer Partie meisterte, wobei sie auch sehr wortdeutlich sang. Nicht weniger überzeugend agierte die australische Mezzosopranistin Joslyn Rechter in der Doppelrolle als Mutter von Stolzius und Gräfin de la Roche. Dazu kam noch ihre schauspielerische Leistung als Double der Ministerin Ursula von der Leyen. Köstlich!

Joslyn Rechter als Double von Ursula von der Leyen, der „Mutter“ der Deutschen Wehrmacht (Foto: Jörg Landsberg)
Nicht weniger köstlich die witzige Darstellung des schwedischen Tenors Per-Håkan Precht als eiskalter Offizier Desportes in Gestalt von Karl-Theodor zu Guttenberg. Eindrucksvoll sowohl stimmlich wie schauspielerisch. Die weiteren Offiziere waren der Bariton Sungkon Kim als Haudy, der Tenor Silvio Heil als Rammler und der litauische Bassbariton Genadijus Bergorulko als in Marie verliebter Mary.
Mit tiefschwarzer Bassstimme und imposanter Erscheinung gab José Gallisa Maries Vater. Maries Mutter wurde von der Mezzosopranistin Almerija Delic ausdrucksstark gespielt und gesungen, Maries neidische Schwester von der australischen Sopranistin Erika Simons gegeben, die ihre Rolle sehr drastisch ausspielte.
Als tragische Figur spielte und sang der lyrische Bariton Jan Friedrich Eggers den Stolzius, als Muttersöhnchen arg überzeichnet agierte der Tenor Daniel Wagner als Sohn der Gräfin de la Roche. Den Jäger von Desportes gab der polnische Bass Tadeusz Jedras.
Am Ende der Vorstellung Kopfschütteln bei so manchem Besucher und ein paar abfällige Bemerkungen zur Regie. Für das Sängerensemble gab es vom Publikum starken Beifall, der sich für das Orchester und seinen Dirigenten mit Bravorufen mischte.
Udo Pacolt 5.2.15
mfG MERKER-online
DIE VÖGEL
zum Dritten
am 6.7.2014

Alexander Spemann (Hoffegut), Susan Vent (Zaunschlüpfer), Heikki Kilpeläinen (Ratefreund). Foto: Jörg Landsberg
Am Theater Osnabrück, welches unter seinem Intendanten Ralf Waldschmidt schon seit längerem für einen unorthodoxen Spielplan und interessante Ausgrabungen steht, ging zuletzt die insbesondere nach der konzertanten Aufführung der „Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna“ bei den Salzburger Festspielen 2013 immer intensiver werdende Wiederbelebung des Werkes von Walter Braunfels weiter. Mit „Die Vögel“ setzt das Theater Osnabrück seine Beschäftigung mit zu Unrecht vergessenen Werken der 1920er Jahre fort. Braunfels’ im Jahre 1920 unter Bruno Walter an der Münchner Oper uraufgeführtes Werk, das der Komponist als „Lyrisch-phantastisches Spiel in zwei Aufzügen“ bezeichnete, mit einem Libretto vom ihm selbst, welches auf Aristophanes’ Komödie aus dem Jahre 414 v. Chr. zurückgeht, bedarf allerdings keiner Ausgrabung. Es wurde damals enthusiastisch gefeiert und erlebte in nur zwei Jahren über 50 Folgeaufführungen. Viele Wiener Opernfreunde erinnern sich an die erfolgreiche Inszenierung der „Vögel“ vor vielen Jahren an der Volksoper. Vielfach werden „Die Vögel“ als das Hauptwerk Braunfels’ bezeichnet, was aber der Bedeutung anderer ebenfalls in den letzten Jahren an deutschen Opernhäusern wieder aufgeführten Werke nicht ganz gerecht wird, so die spektakuläre Inszenierung von Christoph Schlingensief der „Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna“ an der Deutschen Oper Berlin, die konzertante „Verkündigung“ am Münchner Prinzregententheater, szenisch auch in Kaiserslautern, die erst vor kurzem in Bonn aufgeführte Oper „Der Traum ein Leben“ wie auch „Ulenspiegel“ in Gera vor einigen Jahren, sowie die immer noch ihrer Wiederentdeckung harrende Oper „Don Gil von den grünen Hosen“. „Ulenspiegel“ wird ab dem 10. September beim Brucknerfestival Linz 2014 in einer Neuinszenierung von Georg Schmiedleitner viermal zu sehen sein.
„Die Vögel“ handeln von zwei Menschen, Ratefreund und Hoffegut, die nach ihren Enttäuschungen in der Menschenwelt beschließen, in das Reich der Vögel aufzusteigen. Doch auch die Vögel, obwohl es zuerst nicht den Anschein hat, treiben Politik und sind von Neid und Geltungssucht geplagt, nicht zuletzt aber auch dafür empfänglich durch die Ratschläge Ratefreunds. Für einen Moment aber wird die Utopie einer anderen, mit dem Wesen der Vögel generell in Verbindung gebrachten freien und heiteren Welt Wirklichkeit, als Hoffegut den Kuss der Nachtigall empfängt. Am Ende warnt der den Zorn des Gottes Zeus bedrohlich anmahnende Prometheus vor einem Fortgang des unseligen Treibens der Vögel, die sich dazu nur noch überheblicher und größenwahnsinniger zeigen als zuvor: Sie rufen zum Krieg gegen die Götter auf, und ihre Stadt wird von einem ungeheuren Gewitter zerstört. Am Ende steht ein Bitt- und Lobgesang der Vögel zu Ehren des Gottes. Das Stück endet dennoch wieder so komödiantisch wie es begann – ein Beweis für Braunfels’ Moderne schon zu jener Zeit.
Ähnlich wie sein „Der Traum ein Leben“, der unter großen Nöten in der Nazizeit entstand, enthalten auch „Die Vögel“ in hohem Maße autobiografische Elemente. Walter Braunfels komponierte das Stück zwischen 1913 und 1917, UA 1920 – die Entstehungszeit umfasste also den gesamten I. Weltkrieg. Dieser brachte für Braunfels nicht zuletzt durch seine Verwundung im Jahre 1917 traumatische Erlebnisse mit sich und ließ ihn daraufhin vom Protestantismus zum Katholizismus konvertieren. Ratefreund und Hoffegut wollen der Schlechtigkeit ihrer Umgebung entfliehen in eine vermeintlich bessere Welt, die Welt der Vögel. Nicht zuletzt aufgrund ihrer eigenen Unfähigkeit, ihre stellvertretend für das Verhalten vieler anderer stehenden Eigenschaften – die wie sie schuldig an der gesellschaftlichen Misere sind, der sie entfliehen wollen – zu ändern, bleibt auch die Welt der Vögel, die hier wie eine Metapher zu sehen ist, Utopie. Gleichzeitig stellt aber diese Zeit auch einen Umbruch in der Musikgeschichte dar. Wie der Osnabrücker GMD Andreas Hotz in einem Interview mit dem Dramaturgen Alexander Wunderlich im „Theaterjournal“ feststellt, steht die Spätromantik in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts an ihrem Ende und sieht die kompositorischen Mittel im Rahmen des traditionellen Regelwerks als ausgeschöpft. Als Alternative bleibt der totale Neubeginn mit neuen Musiksprachen wie der Zwölftonmusik, das Festhalten an der noch „intakten“ Klangwelt der wilhelminischen Epoche, oder der progressive Umgang mit dem ernüchternden Gefühl, in dem sich das zerstörte Deutschland am Anfang der 1920er Jahre befindet. Dieser dritten Richtung ist Walter Braunfels mit seiner Oper „Die Vögel“ wohl zuzurechnen.
Die südkoreanische Regisseurin Yona Kim hat diese Thematik in den Bühnenbildern von Evi Wiedemann und mit den überaus phantasievollen Kostümen vor allem der Vögel von Hugo Holger Schneider mit einem hochinteressanten und gelungenen Regiekonzept eindrucksvoll und sinnhaft eingefangen. Sie geht von der Faszination aus, die in der Suche Ratefreunds und Hoffeguts nach einem alternativen Lebensentwurf liegt, sozusagen ein „Motiv der Weltflucht“ und stellt auf die während des I. Weltkriegs in Zeiten großer Unsicherheiten vorhandene Sehnsucht nach einem anderen Leben ab, sowie auf den damit verbundenen Zug ins Private. Dazu sieht der Dramaturg völlig nachvollziehbar auch eine Parallele zur aktuellen Situation in Europa angesichts der Ukraine- und anderer Krisen in der Welt. Mit der Inszenierung versucht das Regieteam angesichts des Scheiterns eines solchen Unterfangens gar nicht erst ein konfliktfreies Naturidyll zu zeigen, sondern man landet direkt wieder in der Zivilisation. Denn der erste Vogel, den die beiden Freunde treffen, Wiedehopf, war selbst einst ein Mensch. Auch der zu jener Zeit sich entwickelnde Jungenstil, mit dem die Menschen im Sinne eines sich zurecht Träumens exotische Ornamentik und Naturmotive in Tapeten und Möbeln in die eigenen vier Wänden holten, passt in diese Thematik, denn auf diese Weise wollte man etwas der traurigen Realität entkommen.
So bildet der Jugendstil die phantasievolle und schillernde Bühnenbild-Ästhetik im 1. Akt der Osnabrücker „Vögel“. Ein absoluter Höhepunkt ist hier der Gesang der Nachtigall von Marie-Christine Haase und ihr Kuss für Hoffegut, der von Alexander Spemann gesungen wird. Hier kommt für einen Moment die ganze Utopie einer besseren Welt in der vielfältigen Symbolik der Bühnenoptik und der intensiven Darstellung beider Protagonisten auf. Dass es Utopie bleiben muss, ist auch an dem goldenen Käfig zu sehen, in dem die Nachtigal immer wieder auftritt. In der großen spätromantischen Musik, die Braunfels nicht nur für diese Szene, sondern auch andere Teile insbesondere des 1. Akts geschrieben hat, kommen Erinnerungen an Richard Wagner, insbesondere an „Tristan und Isolde“ auf. Bestechend die Instrumentierung und der Seelenbezug, der hier in der Musik zum Ausdruck kommt. Lyrik und Dramatik wechseln häufig und werden immer wieder durch einen Konversationsstil abgelöst, der die Handlung befördert. Die Anforderungen an die Nachtigall gehen in Richtung dramatischer Koloratursopran, und Marie-Christine Haase füllt sie eindrucksvoll aus, mit blendenden Spitzentönen und vielen stimmlichen Facetten in der Mittellage. Alexander Spemann als Gast singt den verliebten Hoffegut mit heldentenoralem Aplomb, der für diese Rolle auch erforderlich ist, bei bester Diktion und Phrasierung. Der stets politisch intrigierende Ratefreund findet in Heikki Kilpeläinen als Gast einen mit einem prägnanten und ebenfalls höhensicheren Bariton ausgestatteten Sänger, der in seinen Überredungskünsten der Vögel große schauspielerische Intensität an den Tag legte. Am Ende wird er sich wieder an seinen warmen Ofen zurückziehen, als wenn nichts gewesen wäre…
Zuvor war es aber sowohl optisch wie dramaturgisch mit nun wilhelminischen Uniformen, Pickelhauben und striktem Komisston zu einer martialischen Veränderung in Vogelheim gekommen. Nun ist auch ihr Leben vom preußischen Regelwerk bestimmt, es gibt Drohungen und Strafen für (vermeintliches oder tatsächliches) Fehlverhalten. Eindrucksvoll hat Yona Kim diesen zweiten Teil mit einer sehr guten Personenregie gestaltet, so dass der hochdramatische Auftritt des Prometheus nach Vorankündigung durch den Adler (mit gutem Bass Genadijus Bergorulko) unausweichlich erscheint. Johannes Schwärsky als Gast, in Münster bereits mit den Weihen des Fliegenden Holländers ausgestattet und auch ansonsten recht Wagner-verdächtig, setzt mit dem Prometheus eine unter die Haut gehende Zäsur in Vogelheim, sowohl stimmlich als auch darstellerisch, auch wenn er selbst als von seinem mythischen Schicksal Geschundener gezeigt wird. Eine ganz große Stimme und Talent! In diesem Teil schlägt auch die Stunde von Daniel Moon als Wiedehopf, der mit seinem stimmstarken, nicht immer ganz klangvollen Bariton und großer Autorität den Führer der Vögel gibt, bis er angesichts seines Versagens Selbstmord verübt. Ferner seien erwähnt die mit sicheren Koloraturen aufwartende Susann Vent als Zaunschlüpfer, Almerija Delic als Drossel und Tadeusz Jedars als Rabe. Der Chor und Extrachor des Theaters Osnabrück in der Einstudierung von Markus Lafleur zeigte sich den großen Herausforderungen, die die Partitur an die Chorszenen stellt, bestens gewachsen und agiert stimmstark und transparent.
Andreas Hotz wusste am Pult des Osnabrücker Symphonieorchesters die facettenreiche und oft spätromantisch schillernde Musik von Walter Braunfels auf das Beste zum Leuchten zu bringen. Es herrschte stets große Übereinstimmung zwischen den Bildern, Sängern und dem Graben, sodass diese Produktion wie aus einem Guss erschien. Der relativ große Orchesterapparat deckte nie die Sänger zu, Hotz achtete auf eine gute Balance und kostete die musikalisch herausragenden Momente, wie die flirrend leichten Streicher schon im Vorspiel oder die spätromantische Farben im Vorspiel zur 2. Szene sowie andere Momente mit großer Differenzierung aus. Aber auch die musikalische Dramatik des Zeusschen Gewitters, dramatisch untermalt von Videosequenzen aus dem I. Weltkrieg, wusste Hotz eindrucksvoll zu interpretieren. Die Musik von Walter Braunfels in dieser Oper ist besonders glutvoll und melodisch, wohl einer der Gründe, warum die „Vögel“ bis heute zu seinen beliebtesten Werken zählen.
Klaus Billand 31.8.14
DIE VÖGEL
zum Zweiten
Premiere am 21.06.14 – besuchte Derniere am 11. Juli 2014
Romantik und Grössenwahn
Erfolgreicher Opernkomponist bis 1933, aber damals schon von der musikalischen Avantgarde als altmodisch spätromantisch belächelt, ab 1933 als Musik eines Juden verboten, nach dem Krieg als veraltet vergessen, das ist das Schicksal von etwa Franz Schreker, Wolfgang Korngold oder des katholisch gewordenen„Halbjuden“ Walter Braunfels. Häufig verdanken wir es mittelgrossen Opernhäusern, deren Werke wieder zu entdecken. So wagte sich das Theater Osnabrück jetzt an das „lyrisch-fantastische Spiel“ in zwei Aufzügen „Die Vögel“ von Walter Braunfels auf ein eigenes Libretto, vor allem im ersten Teil inhaltlich angelehnt an die gleichnamigen Komödie des Aristophanes.
Enttäuscht von Kunst und Liebe bei den Menschen suchen der demagogische Politiker Ratefreund und der idealistische Schwärmer Hoffegut (nomina sunt omina) erfüllteres Leben bei den Vögeln. Ratefreund überzeugt die Vögel unter ihrem König Wiedehopf (früher auch ein Mensch), eine Stadt zu bauen, dadurch auf den Transport der Opfergaben von den Menschen zu den Göttern Zoll zu erheben und so beide zu beherrschen. Hoffegut erlebt traumhaft-naturnahe Liebe mit der Nachtigall. Prometheus als einer, dessen Übermut früher durch Zeus bestraft wurde, warnt die Vögel vor dessen Rache. Zur Strafe für Hybris und Kriegsbegeisterung läßt Zeus die Stadt zerstören. Besiegt preisen ihn dann alle ebenso hymnisch. Wie jeder gute Politiker verläßt Ratefreund die Stätte der von ihm verursachten Zerstörung und geht zurück nach Hause zur Gemütlichkeit hinterm warmen Ofen. Hoffegut bleibt der Traum von der Liebe zur Nachtigall.

Inhaltlich paßt das Werk in die Zeit kurz nach dem ersten Weltkrieg (komponiert 1913-1919 UA 1920). Das machte die Inszenierung von Yona Kim dadurch deutlich, daß sie das Stück zu eben dieser Zeit spielen ließ. Im ersten Akt folgte sie der einem Singspiel mit humoristischen Einschüben ähnlichen Handlung und man bewunderte die phantasievollen bunten für jedes Chormitglied anderen Vogel-Kostüme von Hugo Holger Schneider. Im ersten Teil des zweiten Aktes ließ sie die Nachtigall in Anlehnung an die Sage von Prokte – erwähnt in den Metamorphosen des Ovid – als Mutter jetzt ohne Kopfschmuck das Schicksal des verlorenen Sohnes Itys beklagen. Im folgenden Traum von Hoffegut deutete sie dann eine Verbindung zum Schicksal der unglücklichen Mutter in Hans Castorps Traum aus Thomas Manns „Zauberberg“ an – für Teile des Publikums,die das Programmheft nicht gelesen hatten, offenbar zu viel der Andeutungen. Trotzdem fand das hier als Text vertonte Gedicht „Die Nacht“ von Joseph von Eichendorff eine Entsprechung auf der Bühne, dafür sorgte die Projektion von Caspar David Friedrichs Gemälde „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (Bühne Evi Wiedemann und Margrit Flagner) Daß die Naturbegeisterung des Jugendstils artifizieller Art war, wurde dadurch deutlich, daß die Nachtigall immer wieder in einem goldenen Käfig auftrat. Im zweiten Teil des zweiten Aktes wurde sehr gekonnt vor allem durch prachtvolle Uniformen und natürlich Pickelhauben das elitäre und bürokratische Gebaren des Wilhelminischen Deutschland persifliert.. Ohne Videos geht es nicht und so wurden Krieg und Niederlage der Vögel zur gewaltigen Musik passend durch Filmsequenzen von Luftkämpfen des I. Weltkriegs bis hin zum Ende mit Soldatenfriedhof begleitet. Zum Schluß machte Ratefreund wie gewohnt weiter, jetzt in Bierzeltstimmung, mit Braunhemden und statt der Vögel mit Blonden Deutschen Mädels, passend zu kommendem Unheil.
Diese packende Inszenierung wurde fast noch übertroffen vom musikalischen Niveau der Aufführung. Alle erdenklichen sängerischen Schwierigkeiten für einen „hohen Sopran“ wie Triller, riesige Intervallsprünge, chromatische Tonleitern abwärts zu singen, spitze Staccati, lange Legato-Bögen in hoher Lage, auch nur als Vokalisen, dies alles erfordert die Partie der Nachtigall. Als Star des Abends meisterte Marie-Christine Haase diese Anforderungen grandios und verfügte zudem über die Stimmkraft, ohne Schärfe sich gegen Chor und Orchester zu behaupten – eine bewundernswerte Leistung des Osnabrücker Ensemblemitglieds. In der Partie ihres Partners Hoffegut glänzte mit heldentenoraler Attacke bis zu genau getroffenen Spitzentönen und weitgehend textverständlich Alexander Spemann als Gast. Auch als Gast sang Heikki Kilpeläinen die für einen Bariton hochliegende Partie des Ratefreund treffsicher, auch im schnellen Parlando verständlich und sogar stimmlich beweglich in Koloraturen. Er spielte geschickt den jeder Situation sich anpassenden Demagogen. Von ihm zum Grössenwahn verführt überzeugte mit kräftigem Bariton Daniel Moon als König Wiedehopf. Als er in Erkenntnis der Schuld am Untergang seines Volkes Selbstmord beging, war er der einzige, mit dem man Mitleid haben konnte. Münsteraner Opernfreunden noch u.a. als „Holländer“ in bester Erinnerung gestaltete Johannes Schwärsky den Prometheus mit grosser für einen Bariton tiefensicherer Stimme. Nicht nur musikalisch erinnert die Partie an Amfortas, wohl auch beabsichtigt einmal textlich (Er käme „von viel weiter auch als ihr denken könnt“). Auch alle anderen Partien waren stimm- und rollendeckend passend besetzt, erwähnt seien der koloraturensichere kokette Zaunschlüpfer von Susann Vent und der Baß Genadijus Bergorulko in der undankbaren Rolle des vergeblich warnenden Adlers.

Stimmgewaltig in der hymnischen Kriegseuphorie, durchweg exakt im schnellen Parlando und piano als Stimmen der Blumendüfte erfreuten Chor und Extrachor in der Einstudierung von Markus Lafleur.
Dies alles konnte nur so gelingen, weil GMD Andreas Hotz umsichtig und mit ganz grossem Gespür für die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen zwischen Wagnerschem Gefühlsüberschwang,und witziger Spielbegleitung das musikalische Geschehen leitete. Ganz wunderbar gelangen dem Osnabrücker Symphonieorchester und ihm die impressionistische Nachtszene zu Beginn des zweiten Aktes, die ein musikalischer Höhepunkt des Abends war. Trotz der grossen Besetzung wurden die Sänger nie zugedeckt. Durchhörbar vernahm man auch die vielen Soli einzelner Instrumente so etwa der Flöte als Begleitung der Nachtigall.
Als letztere jetzt mit blonden Zöpfen den Abend mit der Vokalise vom Beginn beendete und die Musik pp ausklang, gab es nach einer kurzen Besinnungspause im ausverkauften Theater langen Beifall mit vielen Bravos für die Hauptdarsteller, das Orchester und vor allem den Dirigenten als verdienten Dank für diesen großartigen Opernabend. Dieser wird leider nicht wiederaufgenommen .Es folgen aber aus derselben Epoche die „Soldaten“ nicht von Zimmermann sondern von Manfred Gurlitt (Premiere 17.01.2015
Sigi Brockmann 13. Juli 2014
Fotos Jörg Landsberg
DIE VÖGEL
Walter Braunfels
TRAILER
Premiere am 21.06.2014
besuchte Aufführung: 24.06.2014
Fatale Kriegsbegeisterung
Von den Opern des Komponisten Walter Braunfels (1882 – 1954), darunter die Werke „Prinzessin Brambilla“, „Don Gil von den grünen Hosen“, „Galatea“, „Verkündigung“ und „Der Traum ein Leben“, waren die 1920 unter der Leitung von Bruno Walter in München uraufgeführten „Vögel“ am erfolgreichsten. Über fünfzig Mal standen sie dort innerhalb von zwei Jahren auf dem Programm und wurden in rascher Folge u.a. in Berlin, Graz und Wien nachgespielt. Doch als die Nazis 1933 die Werke von Braunfels verboten, war dies offensichtlich der Todesstoß für sein künstlerisches Werk. Zwar wurden „Die Vögel“ 1948 für den Hessischen Rundfunk aufgenommen und 1971 kam die Oper in Karlsruhe, 1991 in Bremen sowie 1999 an der Volksoper Wien heraus, aber den Weg ins Repertoire hat sie nicht wirklich gefunden.

Das Osnabrücker Theater hat in dieser Spielzeit bereits mit „Vanda“ von Antonin Dvořák eine veritable Entdeckung präsentiert. Mit der Braunfels-Oper ist nun ein weiterer Coup gelungen. „Die Vögel“ ist ein musikalisch reichhaltiges und faszinierendes Werk, in seiner spätromantischen Diktion etwa an Wagner und Berlioz, ein wenig auch an Mahler und Strauss anknüpfend, mit einer farbigen, effektvollen Orchestrierung und einer trotz enger Anlehnung an Bekanntes eigenständigen, kaum epigonal zu nennenden Tonsprache. Dirigent Andreas Hotz führte die Meriten dieser Musik mit dem überwiegend klangvoll und konzentriert aufspielenden Osnabrücker Symphonieorchester nachdrücklich und überzeugend vor. Eine Rezension aus den zwanziger Jahren sprach von „symphonisch strömender Melodik von bestrickendem Wohllaut“ - und genau das wurde in der musikalischen Ausdeutung durch Andreas Hotz schon in dem bezaubernden Vorspiel nachvollziehbar.

Braunfels, der sein eigener Librettist war, hielt sich nur im ersten Teil an die Vorlage von Aristophanes, während er sich, nach eigenen Worten, im Weiteren eher von Eichendorff inspiriert fühlte. In der Tat trägt die Geschichte von Ratefreund und Hoffegut, der eine ein zynischer Pragmatiker, der andere ein träumender Idealist, durchaus auch romantische Züge. Beide jagen einer Utopie nach - doch während Ratefreund, der die Vögel zum Bau einer Stadt zwischen Himmel und Erde überredet, nur nach eigener Macht strebt und am Schluß mit leeren Händen dasteht, zieht Hoffegut aus seiner (zwar auch gescheiterten) Liebesbegegnung mit der Nachtigall Sinn und Glück für sein weiteres Leben.

Braunfels begann seine Oper 1913 und vollendete sie 1919. Dazwischen lagen die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Die koreanische Regisseurin Yona Kim zog die entsprechenden Parallelen. Ein goldener Vorhang, eine auch in den phantasievollen Kostümen (Hugo Holger Schneider) pittoresk gezeichnete Vogelwelt im Jugendstil markieren den Beginn. Die Nachtigall ist in einem goldenen Käfig angekettet, im Hintergrund erscheint eine Projektion von Caspar David Friedrichs „Der Wanderer über dem Nebelmeer“. Diese fast romantische Szenerie weicht kubistischen, kahlen Wänden, wenn die Vögel ihre Festung gebaut haben (Bühne von Evi Wiedemann). Fahnen und Schärpen und die schauerlichen Rufe „Krieg! Krieg! Krieg“ der Vögel, die inzwischen Pickelhauben tragen, deuten auf den verhängnisvollen Verlauf. Die fatale Kriegsbegeisterung der von Ratefreund aufgestachelten Vögel wurde von der Regisseurin beklemmend umgesetzt. Dazu gibt es sinnvolle, nie übertriebene Videoprojektion von Szenen aus dem Krieg, zumeist Flugzeuge und Luftangriffe. Schließlich geht es ja um die „Vögel“. Der warnende Adler (Genadijus Bergorulko) wird brutal niedergeprügelt. Auch die Mahnungen des Prometheus, der wie eine Mischung aus Jesus und Jochanaan erscheint, bleiben ungehört. Johannes Schwärsky hatte mit erzenem, wuchtig geführtem Bariton in dieser Szene einen ungemein starken Auftritt. Wenn der Zorn des Göttervaters Zeus in Form eines alles vernichtenden Gewitters (mit einer großartig realisierten Sturmmusik) über die Vögel hereinbricht, entzieht sich der Wiedehopf (sehr prägnant: David Moon), der König der Vögel, durch Selbstmord der Verantwortung. Am Ende, wieder in der Menschenwelt, gibt es eine Art Dorffest mit blondgezopften, „germanischen“ Mädels, die man unschwer als Zaunschlüpfer, Drossel und Nachtigall aus der Vogelwelt wiedererkennt.

Die ungemein schwierige Koloraturpartie der Nachtigall wurde von Marie-Christine Haase bravourös gemeistert. Auch wenn sich in ihren Stimmklang mitunter kleine Schärfen einschlichen, erklomm sie die extremen Höhen relativ mühelos. Ihre Leistung wurde zu Recht bejubelt. Alexander Spemann war für die ins Heldentenorale weisende Partie des Hoffegut eine adäquate Besetzung. Eindringlich gestalteten beide die zentrale Szene der Oper, das sehr lange Duett zu Beginn des 2. Aktes. Erst im Schlussmonolog kam Spemann an seine Grenzen und musste etwas forcieren. Heikki Kilpeläinen war mit markantem Bariton der Ratefreund, Susann Vent der Zaunschlüpfer, Almerija Delic die Drossel und Tadeusz Jedras der Rabe.
Ein Sonderlob gebührt dem von Markus Lafleur einstudierten Chor, der die machtvollen, gewaltigen Chortableaus inbrünstig und klangvoll realisierte. Insgesamt ist Osnabrück eine Produktion gelungen, die überregionale Beachtung verdient.

Wolfgang Denker, 25.06.2014
Fotos von Jörg Landsberg
Offizielle Webside Walter Braunfels
VANDA
(Antonin Dvořák)
besuchte Aufführung: 26.03.2014 Premiere am 15.03.2014
Liebe, Pathos und Chorgesang
In der Mitte der dunkel ausgekleideten Bühne (von Tom Musch) befindet sich ein riesiger Opferstein. Während der Ouvertüre erblickt man darauf einen Sarg und davor eine weibliche Gestalt verharren. Es ist Vanda, die um ihren verstorbenen Vater, den polnischen König Krak, trauert.

Antonin Dvořáks Oper „Vanda“ (seine fünfte) wurde 1876 in Prag uraufgeführt. Dem Theater Osnabrück gebührt das Verdienst der szenischen Erstaufführung in Deutschland. Die Oper spielt im 11. Jahrhundert und verarbeitet die Legende der polnischen Fürstin Vanda, die gegen ihren Willen und erst auf Druck des heidnischen Hohepriesters die Königskrone annimmt. Eine Heirat mit ihrem Geliebten Ritter Slavoj wird ihr aus Standesgründen verweigert. Stattdessen bewirbt sich der deutsche Herzog Roderich um ihre Hand. Als er abgewiesen wird, zettelt er einen Krieg an. Vanda legt ein Gelübde ab, ihr Leben zu opfern, falls sie gegen Roderich siegreich ist. Und so kommt es auch. Bei einer Schwarzen Messe der Priesterin Homena (ausdrucksstark Almerija Delic) hat Vanda die Vision von einer hoffnungsvollen Perspektive. Aber der Hohepriester besteht auf Einhaltung des Gelübdes und Vanda stürzt sich in die Weichsel. Slavoj bleibt verzweifelt zurück und ersticht den Hohepriester.

Dvořák hat die Handlung mit ihren verschiedenen Motiven wie Vater-Trauma, unglückliche Liebe, Machtmissbrauch der Kirche, Schwestern-Beziehung, Widerstand gegen bestehende Ordnung, Nationalpathos und Opfertod mit dramatischer, klangvoller und oft pathetischer Musik versehen. Dabei stehen die ungewöhnlich umfangreichen Chorszenen im Mittelpunkt Von marschartigen Aufzügen mit Fahnenschwingen, machtvollen Beschwörungen der Götter, pompöser Krönungszeremonie und bis hin zu Schlachtenjubel ist der Chor (neben Vanda) fast der Hauptprotagonist. Die großartigen Chortableaus, die Dvořák schuf, sind von großer überwältigender Wirkung. Grand Opera eben, bei der Meyerbeer (und vielleicht auch Wagner) durchaus Pate gestanden haben. Die Kehrseite ist, dass man nach drei Stunden (inklusive Pause) vielleicht ein bisschen übersättigt war. Aber der prachtvollen Leistung, die Chor und Extrachor in der Einstudierung von Markus Lafleur hier erbringen konnten, ist höchste Anerkennung zu zollen. Die Stimmen verschmolzen zu einem stets homogenen Gesamtklang, der mit wuchtigem oder beschwörendem Gestus restlos überzeugte.

Die Partie der Vanda ist riesengroß - die Figur ist pausenlos auf der Bühne. Mit Lina Liu hatte das Osnabrücker Theater eine Sängerin zur Verfügung, die der Rolle in jedem Moment gerecht wurde und alle Anforderungen glanzvoll erfüllte. Ihr tragfähiger, in der Höhe metallisch aufstrahlender Sopran hatte keine Mühe gegen die Klangfluten von Chor und Orchester. Darstellerisch vermochte sie die unglücklich und verzweifelt Liebende ebenso überzeugend zu verkörpern wie die heroische Kämpferin - bis hin zum bewegenden Opfergang. Ihr zur Seite stand Susann Vent als Vandas Schwester Božena, die ihren lyrischen Sopran durchaus auch dramatisch führen konnte. Als Slavoj führte Per Håkan Precht seinen robusten, im Klang mit etwas zu viel Druck geführten Tenor sicher durch die expressive Partie. Oleg Korotkov war der mit solidem Bass ausgestattete Hohepriester, dessen gefährliche Wirkung noch dadurch verstärkt wurde, dass er mit einer Maske im Rollstuhl saß. Daniel Moon kam als Roderich wie ein barocker „Lebemann“ mit Löckchen und goldenen Schuhen daher und trumpfte martialisch mit virilem Bariton auf.

Das Osnabrücker Symphonieorchester schwelgte unter der Leitung von Daniel Inbal mit opulentem Klang, der im Laufe des Abends immer präziser wurde. Die Akt-Finali waren klug gesteigert und entfalteten sich zu maximaler Wirkung. Dvořák hat sein Werk im Laufe der Jahre immer wieder umgearbeitet. In Osnabrück entschied man sich weitgehend für die letzte Fassung, allerdings wurde hier trotzdem die Ouvertüre der Urfassung verwendet, die Dvořák später durch eine andere ersetzte.

Regisseur Robert Lehmeier inszenierte „Vanda“ als zeitloses Märchen. Dabei setzt er weniger auf Aktion, vielmehr bietet er eine Bilderfolge von eindrucksvollen Tableaus. Insgesamt fällt die Inszenierung dadurch etwas statisch aus, aber Lehmeier reicherte sie mit aussagekräftigen Zutaten an. So reißt Slavoj seiner Jagdbeute das blutige Herz heraus und überreicht es Vanda. Die Gewänder von Vanda und Božena triefen nach der Schlacht gegen Roderich nur so vor Blut. Die Gesellschaft tritt mit Partykleid und Turmfrisuren auf, wenn sie jubelnd die Fahnen schwenken (Kostüme ebenfalls von Tom Musch). Die Messe bei der Zauberin Homena hat allerdings etwas von Geisterbahn-Atmosphäre. Gleichwohl - insgesamt ist die Osnabrücker Produktion absolut sehenswert.
Wolfgang Denker, 27.03.2014 Fotos von Jörg Landsberg
L'ELISIR D'AMORE
Besuchte Vorstellung: 23.01.2013 (Premiere am 19.01.2013)
Commedia dell’arte im 20. Jahrhundert
Neben der Lucia ist der Liebestrank unter den annähernd siebzig Opern Donizettis das meistgespielte Werk. Trotz seiner begrenzten Glaubwürdigkeit ist es dramaturgisch als Buffa perfekt, durchzogen mit süffigen, leicht wiedererkennbaren Melodien und trotz der einfachen, klaren Sprache der Orchesterpartitur musikalisch hoch inspiriert. So hat sich die Oper in unzähligen Inszenierungen bewährt, die das Geschehen in die unterschied-lichsten Umgebungen verlegen. Den vielen schönen Inszenierungen hat nun das Theater Osnabrück mit der Regiearbeit von Guillermo Amaya eine weitere hinzugefügt.
Amaya siedelt die Handlung im Nachkriegsitalien an. Adina ist die Inhaberin eines Milchabfüllungsunternehmens („Latte Adina“), welches Milch en vrac in Literflaschen abfüllt, in Holzkisten verpackt und zum Versand bringt. Gianetta ist die Vorarbeiterin der Mittelständlerin; sie treibt die MitarbeiterInnen zu deren Leidwesen zu hohem Durchsatz an. Nemorino indes hat es bloß bis zum Plakatkleber gebracht. Er kommt mit einem Damenfahrrad angefahren und arbeitet sich an einem Werbeplakat von „Latte Adina“ an der Außenwand der kleinen Fabrik ab. Da fehlt nämlich am Bildnis der Inhaberin noch ein Stück des Plakats. Nemorino wird und wird damit nicht fertig; zu sehr lenkt ihn die Inhaberin von der Arbeit ab. Schließloch schafft er es doch, das Foto belebt sich gar, als Nemorino eine verhohlene Träne bei Adina gesehen haben will.

Genadijus Bergorulko (Il Dottor Dulcamara)
Der Ausstatter Alexandre Corazzola hat dazu eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Konstruktion auf die Drehbühne gestellt: eine dreiflügelige Anlage mit der Abfüllanlage im Innenhof, außen eine Rollenbahn zum Versenden der Milchkästen, an der anderen Seite das besagte Plakat. In diese Vorstadtidylle schwebt Belcore als amerikanischer Fallschirmjäger-offizier ein: sechs Soldaten im Drillich helfen ihm, die Vorstadt zu besetzen und verhalten sich beifällig zu seinem sofort erfolgtem Heiratsantrag an Adina. Nemorina verzweifelt, aber es kommt ihm Dulcamara zu Hilfe, der mit einer Piaggio Ape und seinem Diener Giacomo (als stumme, aber darstellerisch sehr aktive Rolle von der der Regie hinzugefügt) erscheint. Letzterer schiebt den stotternden Zweitakter auf die Bühne: es folgt eine Sprecheinlage des Quacksalbers (ebenfalls frei eingefügt), die Giacomo mit seinen Clownerien begleitet.

Daniel Wagner (Nemorino), Susann Vent (Adina)
Die Regie fügt, um etwas Abstand zu generieren, Traumszenen ein – denn ganz glaubwürdig ist es ja nicht, dass die gestandene Adina dem hergelaufenen Belcore gleich ihr Jawort gibt. Im zweiten Akt wird dann schon Hochzeit gefeiert. Der ewig plappernde Quacksalber ganz im Stil des Doktors der commedia dell’arte führt dazu mit seinem Adlatus ein Rollenspiel auf. Dazu tritt noch eine Blaskapelle auf, die das Geschehen mit Misstönen kommentiert (Bläserphilharmonie Osnabrück e.V.) Nun ist allgemein bekannt, dass Adina und Nemorino sich finden, der Offizier Belcore mit seinem Stoßtrupp abzieht (um sich wohl anderswo wieder eine Adina zu suchen) und der Quacksalber Süßbitter (Dulcamaro) mit seinen Tinkturen und seinem einprägsamen musikalischen Thema ins nächste Dorf zieht. Vielleicht kann er dort wieder Elixire verkaufen, um seiner permanenten Geldknappheit zu wehren. – Gekonnte Personenführung und viele gelungene Regieeinfälle lassen in dieser gelungenen Regiearbeit keine Sekunde der Langeweile aufkommen.
Das Osnabrücker Symphonieorchester spielte zu dem Abend unter der Leitung von Daniel Inbal auf. Da wurde überwiegen federnder präziser und inspirierter Donizetti gespielt, aber es gab auch Passagen, wo das holzschnittartig rüberkam: aber dramatisch geschärft und mit flotten Tempi. Letztere brachten streckenweise die Artikulationsgeschwindigkeit des Dulcamara nahe an ihre physikalische Grenze. Der kleine Chor entfaltete in dem nicht sehr großen Theaterraum eine schöne Klangstärke und war ebenso wie Belcores „Eingreiftruppe“ ( Extrachor des Theaters) gut eingebunden.

Susann Vent (Adina), Marie-Christine Haase (Giannetta), Daniel Moon (Belcore), Chor, Bläserphilharmonie
Ansprechende Gesangsleistungen rundeten den gelungenen Abend ab, wozu auch das schauspielerische Geschick der Darsteller und ihre durchweg gute Textverständlichkeit beitrugen. Den Vogel schoss der litauische Bassbariton Genadijus Bergorulko mit seiner erzkomödiantisch ausgefüllten Rolle und seinem hellen kultivierten Bassbariton ab. Mit dunklem, mächtigem Bariton (und der für junge tiefe koreanische Stimmen typischen Einfärbung) gefiel Daniel Moon als Belcore. Susann Vent ließ als Adina ihren klaren Sopran aufleuchten. Als Nemorino überzeugte Daniel Wagner mit etwas eingedunkeltem tenoralem Schmelz. Marie-Christine Haase kam adrett als etwas zickige Gianetta daher. --- Wie bei allen Belcanto-Buffen erkennt man auch im Liebestrank Charaktere der commedia dell‘arte wieder: Nadina als Colombine, Dulcamara als Doktor. Weil der Arlecchino fehlt, hat die Regie ihn einfach als stumme Rolle dazu gesetzt: als Giacomo, den Assistenten Dulcamaras. Der Schauspieler Jacques Freyber füllte diese Rolle zur Begeisterung des Publikums aus: er kroch mit einer Milcharbeiterin in die Ape, entwand aus der Gesäßtasche eines Mitbürgers das Portemonnaie und spielte zusammen mit seinem Chef vor dem Vorhang der commedia einen Sketch zur (geplanten) Hochzeit von Belcore und Adina: ein genialer und spontan beklatschter szenischer Höhepunkt dieser kreativen quirligen Inszenierung.

Jacques Freyber (Giacomo), Genadijus Bergorulko (Il Dottor Dulcamara)
Großer Beifall aus dem sehr gut besuchten Haus belohnte alle Mitwirkenden für ihre ansprechende Leistung. Der Liebestrank steht bis zum 16. Mai noch acht Mal im Spielplan; ein Muss für Freund hochklassiger musikalischer und szenischer Unterhaltung.
Manfred Langer, 28.01.2013 Fotos: Marek Kruszewski