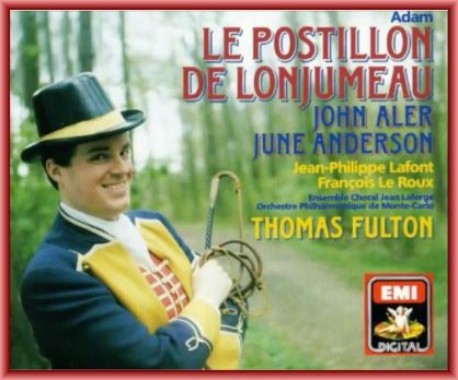OPERA COMIQUE



Bilder (c) RMN R-G Ojeda / designers anonymes
www.opera-comique.com
Phryné
von Camille Saint-Saëns an der Opéra Comique – 11 VI 2022
Ein weiteres unbekanntes Werk zum 100. Todestag des Komponisten, gleichzeitig auch als Erst-Einspielung als Buch-CD beim Palazzetto Bru Zane.

Anne-Catherine Gillet in Hochform als charmante und geistreiche Phryné
Das Jubiläumsjahr zum 100en Todestag von Camille Saint-Saëns (am 16. Dezember 1921 gestorben) ist noch nicht vorüber. So hat das Palazzetto Bru Zane noch eine weitere vollkommen unbekannte Oper von ihm (konzertant) in der Opéra Comique wieder aufgeführt (im Rahmen des 9en Festival Palazzetto Bru Zane Paris). Camille Saint-Saëns ist, wie schon letzten Herbst erwähnt, ein so ein vielseitiger Komponist, dass man ihn schwierig „unter einen Hut“ bringen kann. Sehr begabt (über 300 Werke!), aber vielleicht kein genuiner Opern-Komponist – nur „Samson et Dalila“ hat sich auf den Spielplänen halten können. Deswegen besitzt Saint-Saëns wahrscheinlich den traurigen Rekord an Absagen der Pariser Opernhäuser, die immer neue Ausreden erfanden, um seine Opern nicht auf zu führen. „Samson“ wurde ab 1859 komponiert, 1877 in Weimar uraufgeführt und erst 1892 an der Opéra de Paris gespielt – also nach 33 Jahren! Und wer kennt heute noch seine 12 andere Opern? So ist es sehr zu begrüßen, dass das Palazzetto Bru Zane im Jubiläumsjahr nun drei unbekannte Opern aufgenommen hat und diese mit sehr viel historischem Material (auf Französisch und Englisch) in ihrer Buch-CD-Reihe veröffentlicht hat.
Wir haben schon berichtet über „Le timbre d’argent“ (Die silberne Glocke), ein großformatiges „drame lyrique“ über das kunterbunte Paris der „Bohème“, mit 4 langen Akten, wovon der zweite - wie es sich an der Pariser Oper gehörte - mit großen Chorszenen und einem Schlussballett ausgestattet wurde (Libretto von Jules Barbier und Michel Carré, denselben Librettisten der „Contes d’Hoffmann“ von Offenbach). Die erste Fassung der „Glocke“ aus 1864 galt als unspielbar, sodass Saint-Saëns immer wieder ändern musste, bis 1880 eine 6e Fassung fertig war und 1894 noch eine 7e, 1903 eine 8e und 1913 eine 9e Fassung (!) folgen würden. Ohne Erfolg, „Le timbre d’argent“ ist (quasi) nie gespielt worden. „La princesse jaune“ (Die gelbe Prinzessin), ist dagegen eine kurze „opéra comique“ (also mit gesprochenen Texten), 1872 an der Opéra Comique in Paris uraufgeführt. Aber aus genau dem gegenteiligen Grund kam sie auch nicht ins Repertoire: Die „Glocke“ war zu groß, die „gelbe Prinzessin“ zu klein… Denn Einakter sind ein heute wenig gespieltes Genre, weil sie nicht abendfüllend sind. Und oft sind sie nicht so einfach zu kombinieren wie „Cavalleria rusticana“ von Mascagni + „Pagliacci“ von Leoncavallo oder die drei Einakter von Puccini. Denn „Phryné“ – auch ein Einakter - passt weder vom Thema und auch nicht musikalisch zur „gelben Prinzessin“ und wurde 1893 in der Opéra Comique uraufgeführt, zusammen mit einem anderen (vollkommen vergessen) Einakter des damaligen Repertoires, und dort oft und gerne bis 1950 gespielt – bis dieses ganze Repertoire in Vergessenheit geriet.
Der Erfolg von „Phryné“ im Vergleich zu den anderen Opern von Saint-Saëns ist leicht zu verstehen: es ist eine charmante und sehr Pariserische „opéra comique“, die vollkommen den damaligen Zeitgeist traf. Die Vorlage war – meines Erachtens (bei einer einzigen Vorstellung gab es kein Programmheft) – das berühmte Bild von Jean-Léon Gérôme „Phryné devant l’Aréopage“ aus 1861 (seit 1910 in der Hamburger Kunsthalle). Gérôme war ein sehr angesehener Maler des „Zweiten Kaiserreichs“, dies war mit sein bekanntestes Bild und, vor allem, das meist reproduzierte auf den Kunstdrucken und Kunstpostkarten des einflussreichen Verlegers Adolphe Goupil (der auch sein Schwiegervater war). Gérôme zeigte eine der vielen Legenden um die Hetäre Phryné, die 320 vor Christus durch den Senat in Athen verurteilt werden sollte, weil sie nackt für Künstler posiert hätte und so die guten Sitten der Stadt in Gefahr brächte. Doch kurz vor dem angekündigten Urteil riss ihr Anwalt ihr die Kleider vom Leib und waren die alten Senatoren so entzückt von ihrer Schönheit, dass sie in extremis noch freigesprochen wurde. Das auf den Kunstpostkarten zirkulierende Bild wurde auch noch 30 Jahre später in Paris viel kommentiert – u. A. durch Zola, Maxime Ducamp und Edgar Degas – und ich vermute, dass es solch ein Artikel war, vielleicht mit einer Karikatur („Phryné“ ist das meist karikierte Bild der Zeit zusammen mit Manets „Déjeuner zur l’herbe“), das Camille Saint-Saëns im fernen Algier – wo er sich die letzten 30 Jahre seines Lebens zurückgezogen hatte – zu diesem Sujet veranlasste.
Es könnte eine Novelle von Maupassant sein: der junge Lebemann Nicias, dessen ansehnliches Erbe immer noch durch seinen (ehr)geizigen Onkel Dicéphile verwaltet wird, bittet diesen um einen Vorschuss. Doch daraufhin kündigt der alte Senator an, dass er seinen Neffen wegen Schulden im Gefängnis einsperren lassen will. Gerade als Nicias dies seiner Geliebten Phryné ankündigt, erscheint der alte Mann bei ihr, um sie für ihre schlechten Sitten zu rügen. Doch die Kurtisane lässt sich nicht aus der Fassung bringen, braucht ewig um ihr neues Kleid und Schmuck anzulegen und bittet den Senator ihr dabei zu helfen und ihr eine frische Rose aus dem Garten zu holen. Dicéphile ist so überwältigt durch ihren weiblichen Charme, dass er ihr die Rose hingebungsvoll auf den Knien anbietet. In diesem Augenblick erscheint Nicias mit Phryné schlauer Kammerzofe Lampito (die das Lämpchen hält) und beide drohen in ganz Athen zu erzählen, in welcher Pose man den Senator bei der Kurtisane gesehen hätte - wenn dieser nicht augenblicklich Nicias die Hälfte seines Vermögens gibt. Nicias und Phryné küssen sich und denken darüber nach, wie sie dies Geld nun ausgeben wollen. Der Librettist Lucien Augé de Lassus machte daraus ein Konversationsstück in zwei kurzen Akten, mit Rezitativen in alexandrins, den 7-füssigen Reimen der großen Tragödien von Racine und Corneille. Sicher sehr amüsant für das damalige Publikum, dass diese Tragödien auf der Schule auswendig lernte, aber 1909 bat die Opéra Comique André Messager, die Rezitative neu zu schreiben und zu orchestrieren. Was er sehr feinfühlig im Stile von Saint-Saëns getan hat, so dass die amüsante Geschichte ohne musikalische Unterbrechungen durchplätschern kann. Das Resultat ist eine charmante „Konversationsoper“, ohne Arien oder Finale, nur mit Duos und Ensembles, aus dem der temperamentvolle Dirigent Hervé Niquet mit dem Orchestre National d'Île-de-France (in großer Besetzung) und dem Choeur du Concert Spirituel mehr herausholte, als man bei einer solchen Geschichte denken könnte.

Beim Schlussapplaus: Thomas Dolié (Dicéphile), Cyrille Dubois (Nicias), Anne-Catherine Gillet (Phryné), Camille Tresmontant (Cynalopex), Anaïs Constans (Lampito) und Matthieu Lécroart (Agoragine + Le Héraut) vor dem Orchestre National d'Île-de-France und dem Choeur du Concert Spirituel.
Anne-Catherine Gillet zeigte sich in Hochform als charmante und geistreiche Phryné, unterstützt durch die kecke Lampito von Anaïs Constans. Cyrille Dubois sang die sehr präsente Hauptrolle Nicias, obwohl er sich am Vortag bei der Oper als indisponiert angesagt hatte (doch man konnte für so eine seltene Rolle nicht im letzten Augenblick noch Ersatz finden). So wechselte er bei den höchsten Tönen in Kopfstimme, ohne dass dies einem Laien aufgefallen wäre – eben wie ein Kavalier, der sich mit Eleganz aus jeder Situation zu singen weiß. Thomas Dolié war ein urkomischer (ehr)geizigen Senator Dicéphile, mit Camille Tresmontant als Cynalopex. Ein besonderes Lob für Matthieu Lécroart als Agoragine und Le Héraut, denn wir haben ihn nur zehn Tage zuvor in der Wiederentdeckung von „Hulda“ von César Franck erlebt. So seltene Stücke gleich nacheinander und dann nur für eine Vorstellung, was für eine Arbeit! Aber sie lohnte sich, denn diese einzige Aufführung war ausverkauft – was noch mal beweist, dass es ein wirkliches Interesse für seltene Stücke gibt. Und nun kann man es sich auch auf Platte anhören – bis vielleicht Einakter eines Tages ins Repertoire kommen?
Waldemar Kamer, 17.6.22

Erst-Einspielung als Buch-CD beim Palazzetto Bru Zane mit demselben Dirigenten und (fast) demselben Cast.
Opéra Comique: www.opera-comique.com
Infos & CD-Buch: www.bruzanemediabase.com
Alle Bühnenfotos: © Stéphane Brion
Ambroise Thomas: HAMLET
24. Februar 2022
Einstand in schwierigen Umständen des neuen Intendanten: der Dirigent Louis Langrée, der dieses Repertoire kennt, liebt und wunderbar zum Klingen bringt.

Die Opéra Comique hat endlich einen neuen Intendanten und wir freuen uns sehr über diese Wahl. Denn dieses Mal siegten Kompetenz und Verstand über die immer abstruseren Forderungen der Politik. Der Präsident der Republik, der solche Ernennungen in Frankreich persönlich unterzeichnet, wollte am liebsten eine junge, wenn möglich farbige Frau, mit internationalen Medienkontakten und stellte sich erst mal stur als er auf der „Shortlist“ der Findungskommission keine solche fand. So wurde, wie bei der Pariser Oper, erstmal niemand ernannt und das Haus ein halbes Jahr „per interim“ geleitet - wie der Louvre, das Musée d’Orsay und immer noch das Schloss & Oper von Versailles. Da dieses offensichtliche Desinteresse der Regierung für die Kultur zu immer schärferer Kritik führt und es in gewissen Häusern gefährlich anfängt zu „brodeln“, wurden ausnahmsweise die Mitarbeiter selbst befragt, was für einen Intendanten sie sich denn wünschten. Und die Antwort lautete klar und deutlich: „Jemand, der das Haus & Repertoire kennt und die ganze Zeit anwesend sein wird“. So wurde Louis Langrée ernannt, der nicht zu den meist „medialen“ Kandidaten gehörte, aber dessen Kompetenz für diesen Posten niemand bestreiten kann.
Louis Langrée kennt man in Frankreich vor allem als Spezialisten des 19. Jahrhunderts: sein „Pelléas et Mélisande“ 2014 an der Opéra Comique ist zum Beispiel unvergessen. Wie sehr er dieses Repertoire kennt und liebt, kann man in dem Brief an das Publikum lesen, den er am Tag nach seiner Ernennung veröffentlicht hat: „Ich liebe dieses Haus, seine Geschichte, sein Repertoire, seine Mitarbeiter, seine Architektur, seine idealen Dimensionen, seine Intimität, seine perfekte Akustik, wo man alle Nuancen hören und fühlen kann zwischen Stille, Murmeln und Weinen, Tränen und Freude, Tragödie und Heiterkeit. (…) Ich hoffe, dass die wohlwollenden Geister der emblematischen Komponisten dieser Oper über mich wachen und mich führen werden: Debussy (Uraufführung von Pelléas), Ravel (die der L’Heure espagnole), Charpentier (Louise), Messager (Fortunio), Bizet (Carmen, die Perlenfischer), Delibes (Lakmé), Poulenc (Les Mamelles de Tirésias, La Voix Humaine), Berlioz (La Damnation de Faust), Offenbach (Les Contes d'Hoffmann), Magnard (Bérénice), Paul Dukas (Ariane et Barbebleue), Ambroise Thomas (Mignon), Saint-Saëns (la Princesse jaune), Massenet (Cendrillon, Manon), Cherubini (Médée), Boieldieu (la Dame blanche), etc…“ [alles Uraufführungen]. Louis Langrée beendet seinen Brief mit dem Versprechen, dass es sich „in den Dienst“ dieser Tradition stellen will. So einen un-egozentrischen Vorstellungsbrief eines Intendanten habe ich in Paris noch nie gelesen!

Der seltsame „Hamlet“ des „komischen Kauzes“ Ambroise Thomas
Louis Langrée dirigiert nun eine Oper, die sehr gut in seine obengenannte Liste passt. Ambroise Thomas (1811-1896) war einer der Pfeiler der Opéra Comique im 19. Jahrhundert. Von den 16 Opern, die er dort uraufgeführt hat, wurde „Mignon“ (1866, nach Goethes „Wilhelm Meister“) so erfolgreich, dass Thomas 1894 bei der 1.000en Vorstellung (!) auf der Bühne vom Staatspräsidenten die „grand croix de la Légion d’honneur“ bekam – eine Würdigung, die bis heute kein anderer Komponist in Frankreich bekommen hat. Doch außer „Mignon“ wird heute in den meisten Opernführern – wenn A. Thomas überhaupt vorkommt – kein anderes Werk mehr erwähnt. Dafür gibt es viele Gründe. Thomas wurde in jungen Jahren sehr geschätzt, auch z.B von dem überaus kritischen Hector Berlioz, der ihn 1846 „un de nos compositeurs les plus distingués“ nannte. 1856 wurde er Kompositionslehrer am Conservatoire und dort durch seinen Schüler Jules Massenet sehr geliebt. Doch ab 1870 galt er als Direktor des Konservatoriums für die neue aufblühende Generation als reaktionär. Claude Debussy, Gabriel Fauré und César Franck mochten ihn nicht und Emmanuel Chabrier schrieb den berühmten Satz: „Es gibt drei Arten Musik: die gute, die schlechte und die von Ambroise Thomas“. Dieser hämische Ausspruch klebt bis heute an ihm.

Ambroise Thomas war musikalisch (und anscheinend auch persönlich) ein „komischer Kauz“. Man wird (heute) nicht schlau aus ihm.
In seinem „Hamlet“ (1868) gibt es wunderbare Momente und andere, die erschreckend konventionell sind. Die relative Geschwindigkeit, in der er das Werk komponiert hat (ein Auftrag der großen Pariser Oper, die eifersüchtig auf den großen Erfolg der Opéra Comique mit „Mignon“ 1866 eine „grand-opéra“ bei ihm bestellte), kann dies nicht erklären – denn Rossini hätte für eine solche Riesen-Oper keine zwei Jahre, sondern kaum zwei Monate gebraucht. Bei Thomas sprudelte die Musik eben nicht von selbst, gewisse Passagen klingen „angestrengt“. So war auch Louis Langrée bereit, das an der Pariser Oper obligatorische Ballett im vierten Akt zu streichen – und wir vermissen diese 20 Minuten „Bauerntänze“ nicht. Denn gleich danach folgt eine der schönsten Sopranarien der französischen Oper des 19. Jahrhunderts: die Wahnsinns-Szene von Ophelia.
„Hamlet“ mit einem „Happy End“ von Barbier & Carré
Sie haben richtig gelesen: „Bauerntänze“ im Hamlet. Denn das Opernlibretto von Jules Barbier und Michel Carré verharmlost genau so sehr das Theaterstück von William Shakespeare wie sie es bei der besagten „Mignon“ (1866) mit Goethes Vorlage getan haben. Bei Gounods „Faust“ (1859) und seiner „Roméo et Juliette“ (1867) lief es auch nicht anders und Dante würde sicher auch staunen über was sie in „Françoise de Rimini“ (1882, für Ambroise Thomas) aus seiner „Göttlichen Komödie“ gemacht haben. Barbier & Carré waren so erfolgreich wie der 1861 verstorbene Eugène Scribe vor ihnen, weil sie genau auf die Erwartungen des damaligen Publikums einzugehen wussten. Und dies erwartete die von Berlioz erwähnte „distinction“ (schöne Sprache, Reime, Verse etc) und eine schickliche & sittliche Handlung mit keuscher Geschwister-Liebe und Todesbereitschaft für das Vaterland. So ähnelt die durch Barbier & Carré eingefügte Arie des Laërtes, womit er sich von seiner Schwester Ophelia verabschiedet, „Pour mon pays en serviteur fidèle, je dois combattre et je dois m’exiler“ inhaltlich haargenau der Arie des Valentin, mit der er sich in „Faust“ von Marguerite (Gretchen) verabschiedet: „Ô sainte médaille, qui me vient de ma soeur, au jour de la bataille, pour écarter la mort, reste-là sur mon coeur“ (auch durch sie erfunden). In „Hamlet“ gingen sie sogar so weit, dass sie der Tragödie von Shakespeare ein „Happy End“ zugefügt haben. Anstatt durch seinen bösen Onkel vergiftet zu werden (zusammen mit seiner Mutter), erschlägt Hamlet mit aktiver Beihilfe seines toten Vaters den Onkel, wird zum neuen König gekrönt und seine sündige Mutter verschwindet in einem Kloster. In Paris fand man das alles ganz normal, obwohl die Pariser das Theaterstück von Shakespeare sehr gut kannten, da es seit Napoleon (der es besonders mochte) sehr regelmäßig gespielt wurde. Keine einzige damalige Premieren Kritik geht auf die vielen Änderungen im Libretto ein! Doch als „Hamlet“ dann erfolgreich auf Tournee ging, fand man in England dieses „Happy End“ etwas „too much“ und musste Ambroise Thomas eine neue Schluss-Szene komponieren. Lustiger Weise wird bis heute nur dort dieses Shakespeare-konforme Ende noch gespielt, so wie es Louis Langrée amüsiert über seine „Hamlet“-Dirigate in London und New York berichtet (Covent Garden und Metropolitan Opera). Also wer das Stück kennt, wird sich etwas über die Oper wundern.
Und wer diese Oper kennt, wird sich etwas über diese Inszenierung wundern. Es ist überall dieselbe Geschichte: Man bittet Künstler aus anderen Disziplinen um eine erste Opern-Inszenierung, weil man sich davon neue Impulse für ein jüngeres Publikum erhofft. Das ist dem Videoperformer Cyril Teste gelungen: seine Inszenierung aus 2018 (nun wiederaufgen-ommen) war „neu“ und zog viele Jugendliche an dem von mir besuchten Premierenabend in die Opéra Comique, die sonst wahrscheinlich nicht so schnell in eine Aufführung von „Hamlet“ von Ambroise Thomas gekommen wären. Sein Konzept ist „heutig“: die Darsteller – Hamlet in Turnschuhen und Ophelia in Jeans - werden gleichzeitig „live“ gefilmt und man sieht schon während der Ouvertüre riesengroß auf dem Bühnenportal, wie die Sänger sich vorbereiten und zur Bühne laufen. Dort werden sie quasi während der ganzen Vorstellung durch ein Kamerateam gefilmt: Man sieht also das Bühnengeschehen und gleichzeitig wie es auf den Leinwänden wirkt, die auch noch quasi pausenlos auf der Bühne hin und her kurven. Mit einigen schönen Bildern/Filmen (wir sind in Frankreich und nicht im deutschen „Regie-Theater“), aber für mich wurde es recht anstrengend wegen der permanenten Reizüberflutung. Und in den wichtigsten Monologen, Hamlets „To be or not to be“ (Hier: „Être ou ne pas être… Ô mystère! Mourir!… dormir!“) und vor allem Ophelias Wahnsinnsarie, wo Video „innere Bilder“ hätte bringen können, versagt die Regie völlig. Schlicht und einfach, weil dem Regisseur das dafür nötige Handwerk fehlt. Das ist besonders schade, weil die musikalische Umsetzung vom Feinsten war und die Hauptdarsteller so etwas wie eine Idealbesetzung sind.
Wunderbares Dirigat mit einer Idealbesetzung
Louis Langrée hat feinfühlig das ihm vertraute Orchestre des Champs-Elysées und den Chor Les éléments dirigiert, mit denen er schon 2018 angetreten war. Wunderschön klangen zum Beispiel die vielen Einlagen, die außerhalb des Orchestergrabens gespielt wurden, nicht nur hinter der Bühne, sondern auch hinter dem Saal, also im Foyer und in den Gängen – was der Musik, die durch die geschlossenen Türen in den Saal drang, oft etwas Unwirkliches gab. Subtil auch ein Chor, der noch „à bouche fermée“ singen kann. Und für das erste Saxophon-Solo der Operngeschichte – die Pariser Oper war damals sehr stolz auf ihre vielen neuen Instrumente! - ließ man den Musiker auf die Bühne kommen. Was schon etwas beinahe Komisches hatte, da wir dieses Instrument heute mit Jazz verbinden und nicht als Unheil-verkündende Todesmusik des „Meurtre de Gonzague“. Die Hauptrolle ist ein Bariton – damals sehr ungewöhnlich, aber eine Forderung der Pariser Oper für den Ausnahme-Sänger Jean-Baptiste Faure, der auch ein begnadeter Schauspieler war und als Hamlet ein Publikumsmagnet. (Es gibt Porträts von Manet von ihm als Hamlet in der Oper von A. Thomas!) Für Ophélie war die schwedische Sängerin Christine Nilsson vorgesehen, da Hamlet ursprünglich in Dänemark spielt und Ophelia für die Pariser Poeten (Hugo, Verlaine, Rimbaud etc) aus … Norwegen kam. (Nilsson wurde ebenfalls durch Alexandre Cabanel in dieser Rolle porträtiert.) Die Oper wollte die blonde junge Frau zu einer neuen „schwedischen Nachtigall“ stilisieren wie Jenny Lind. Die beiden Hauptrollen haben also bei A. Thomas mehr zu singen als bei Shakespeare zu sprechen!
Hamlet ist eine Traumrolle für einen schauspielbegabten Bariton: fast 3 Stunden lang quasi permanent auf der Bühne, mal ausgelassen (die berühmte chanson bachique „Ô vin, dissipe la tristesse qui pèse sur mon coeur“), provozierend „verrückt“ und meist melancholisch mit Tiefgang (deswegen eben ein Bariton). Stéphane Dégout, der die Rolle 2018 schon gesungen hat, liefert ein fulminantes, sehr differenziertes Rollenporträt, man könnte beinahe sagen eine Idealbesetzung (er hatte am Premierenabend hörbare Schwierigkeiten in zwei Arien und keinen guten Regisseur zur Seite).

Sabine Devieilhe kann man uneingeschränkt eine Idealbesetzung nennen: als Sängerin braucht man sie, wie Stéphane Dégout, wohl nicht mehr vorzustellen; in dieser Rolle bringt sie genau die von dem Komponisten erwünschte, unmanierierte „nordische Unschuld“. Ihre „schwedische Ballade“ „Pâle et blonde dort sous l’onde profonde la Willis au regard de feu!“ gehörte zu den musikalischen Höhepunkten des Abends. Was wäre aus ihrer wahnsinnigen Wahnsinnsarie mit einem guten Regisseur geworden (unten ein Link mit der Arie in dieser Inszenierung auf Youtube). Jérôme Varnier, den wir vor zwanzig Jahren noch als Sarastro erinnern, konnte den beiden als sonorer Geist des verstorbenen Vaters absolut das Wasser reichen. Laurent Alvaro, der vor zwanzig Jahren noch die kleine Rolle des Polonius sang, ist inzwischen ein überzeugender König Claudius, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt in seiner Reue-Arie „Je t‘implore, ô mon frère“ (auch durch Barbier & Carré erfunden). Als gute Comprimari: Nicolas Legoux (der viel in Österreich, u. A. in Erl gesungen hat) als Polonius, Geoffroy Buffière (Horatio) und Yu Shao (Marcellus). Géraldine Chauvet als Gertrude ist ein eigenes Thema, denn sie sprang am Tag der Premiere für die Covid-positive Lucile Richardot ein - nur für eine Vorstellung.
Wie die Opéra Comique sich durch die Pandémie schlägt
So wie ich es bei der Wiederöffnung der französischen Opern und Theater im Juni 2021 geschrieben habe, kann man fairerweise keine Vorstellung mehr rezensieren ohne zu erwähnen in welchen Bedingungen die Darsteller zur Zeit hier arbeiten (müssen). Für den normalen Bürger werden hier die Corona-Auflagen jeden Tag weniger und man erwägt, sie vielleicht gänzlich abzuschaffen. Alles ist geöffnet und für einen Opernbesuch braucht man keinen Test (nur den „Green Pass“) – was auch erklärt, warum alle Vorstellungen, die ich seit Anfang Dezember besucht habe, eine Auslastung von an die 100 % hatten/haben. Doch für die Mitarbeiter der Theater gelten strenge Protokolle, die sich jeden Tag ändern und z.B. an der Pariser Oper für Vorstellungs-Absagen in letzter Minute sorgten (wie am 24. Dezember). Die Opéra Comique hat sich bewundernswert durch die Pandemie geschlagen. Bei der letzten Premiere, Gounods „Roméo et Juliette“ im Dezember, mussten Juliette (Julie Fuchs) an der Generalprobe und Roméo (Jean-François Borras) am Tag der Premiere als Covid-Positive absagen und dann 10 Tage in Quarantäne (die inzwischen in Paris aufgehoben wurde). Unter abenteuerlichsten Bedingungen konnte Ersatz gefunden werden und alle Vorstellungen stattfinden. Jetzt gibt es für jede Rolle, auch jeden Choristen und Orchestermusiker, ein Double für jede Vorstellung, die natürlich alle auch zumindest einmal geprobt haben müssen. In diesen Umständen musste die Inszenierung aus 2018 geändert werden, weil z.B. aus-dem- Saal-Singen für Solisten (ohne Maske) nicht mehr erlaubt ist. Choristen (nun alle mit Maske) dürfen das wohl. Auch im Orchester waren nun alle maskiert (außer die Bläser), einschließlich der Dirigent. Dass Louis Langrée in diesen Umständen mit seinem großen Team noch so liebevoll und differenziert zu musizieren wusste, kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Auch für die gute Laune, die trotz allem in seinem Theater herrschte (Garderoben und Bars sind nun geschlossen). In solch schwierigen Zeiten braucht man eben einen Intendanten mit Erfahrung, guten Nerven und vor allem großer Liebe zu diesem Metier.
Waldemar Kamer / 26.01.2022
Opéra Comique bis zum 3. Februar: www.opera-comique.com
Ophélies Wahnsinnsarie: https://www.youtube.com/watch?v=8Iyw2ESUt3M
(eine der schönsten Sopranarien der französischen Oper des 19. Jahrhunderts. Sabine Devieilhe in dieser Arie in dieser Inszenierung, von der es auch ein DVD gibt.)
Plattentipp:
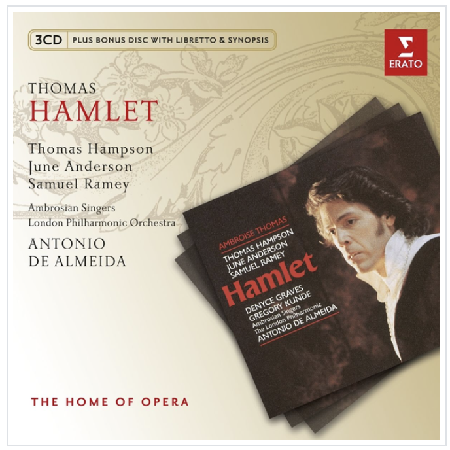
André Messager
FORTUNIO
18.12.2019
Rarität eines Komponisten, der eine große Rolle in der französischen Oper gespielt hat
Wir erwähnen viel zu selten André Messager (1853 – 1929) – meines Wissens nun zum ersten Mal im Merker. Dabei hat Messager eine ganz entscheidende Rolle im französischen Opernleben gespielt und bahnbrechende Erneuerungen eingeführt. Für seinen Zeitgenossen war er – ganz ähnlich wie Gustav Mahler in Wien - hauptsächlich ein Dirigent, der auch komponiert und dann Direktor der Oper wird. Messager war immer auf dem Laufenden, was auf den europäischen Opernbühnen passierte und ein hervorragender Organisator. Als Schüler und Schützling von Gabriel Fauré an der Ecole Niermeyer in Paris, war er sehr gut in die Pariser Musikreise eingeführt und wurde durch Marguerite de Saint-Marceaux - herrlich durch Proust in der „Recherche“ als „Madame Verdurin“ porträtiert - mit einigen anderen jungen Komponisten eingeladen zum ersten Festival in Bayreuth. Danach wurde er einer der Vorreiter des französischen „Wagnérisme“ und dann der „Französischen Antwort auf Wagner“ – nämlich, dass man nicht versuchen sollte, Wagner zu imitieren, sondern eine typisch französische Musik zu komponieren.

Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Messagers ersten großen Opern, „Madame Chrysantème“ (1893 – Vorlage für die spätere „Madama Butterfly“ von Puccini) und „Le Chevalier d’Harmenthal“ (1896 ähnlich wie der ein Jahr zuvor uraufgeführte „Roi Arthus“ von Chausson) keinen großen Anklang bei Publikum und Presse fanden.
Messager und Regisseur Albert Carré wurden beauftragt ein neues Konzept zu erarbeiten für die 1887 abgebrannte Opera Comique, die unter ihrer Leitung 1898 neu eröffnet wurde. Carré reiste durch Deutschland und Österreich und brachte zwei Erneuerungen mit: eine hydraulische Bühnentechnik und elektrische Beleuchtung - bis dato in Frankreich unbekannt - und ein wirklich festes Ensemble für alle Rollen ihres Faches anstatt rivalisierender Stars.

Messager setzte mehr Platz und Mut für Uraufführungen durch, u.a. für „Pelléas und Mélisande“ von Débussy (eine der vielen ungewohnt neuen Opern, die Carré nur konzertant geben wollte), die er als Musikdirektor und allgemein sehr geschätzter Dirigent 1902 natürlich selbst dirigierte. Diese allgemeine Achtung ermöglichte ihm eine Opernreform durchzusetzen, von der schon viele geträumt hatten (u.A. Berlioz). Er gab dem Dirigenten seinen heutigen Platz im Operngraben. Denn seit den Anfängen der Pariser Oper unter Lully stand der Dirigent an der Rampe und legte seine Partitur auf den Souffleurkasten. Er stand also mit dem Rücken zu den Musikern, die Richtung Bühne spielten (ein Klangbild, das z.B. Weber sehr gut gefiel und das er dann vergeblich versuchte in Deutschland durchzusetzen).
Dies sorgte für einen Aufstand in dem traditionsbewussten Frankreich, aber Messager wurde trotzdem nach der sehr gelungenen Uraufführung von „Fortunio“ 1907 zum Direktor der Pariser Oper ernannt, wo er alle die oben genannten Reformen durchsetzte - trotz Streik-Drohungen der damals schon streikfreudigen Musiker und einigen bekannten Dirigenten, die sich weigerten „bei diesem Unsinn mitzumachen“ und böse das Haus verließen.

An der Pariser Oper dirigierte er den ersten „Ring“-Zyklus (wie in Bayreuth), den ersten „Parsifal“ und, nach seiner Pensionierung, noch 1920 an der Opéra Comique die französische Erstaufführung von „Cosi fan tutte“.
Ein hochinteressanter Mann und Musiker, zu Lebzeiten ein sehr erfolgreicher Komponist (vor allem von typisch französischen Operetten und Lustspielen), aber ab 1945 beinahe vollkommen von den Spielplänen verschwunden. Es war also eine sehr begrüßenswerte Entscheidung, dass die Opéra Comique vor zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem Palazzetto Bru Zane „Fortunio“ wieder auf ihren Spielplan setzte - zum ersten Mal seit 1948.
Diese Produktion wird nun wieder aufgenommen, mit gleichem Dirigenten und Regisseur, aber mit einer neuen Besetzung. Woran es liegt kann niemand sagen, aber alle sind sich einig, dass es nun viel besser ist als vor zehn Jahren. Wie schon so oft geschrieben: gewisse französische Opern und Operetten entfalten nur dann ihren ganz eigenen Charme, wenn man genau den richtigen Ton trifft. Und den müssen die Sänger erst lernen.
„Fortunio“, eine durchkomponierte „comédie lyrique“ - also mehr „Oper“ als eine „opéra-comique“ mit gesprochenen Dialogen - ist eine typisch französische Ehebruchskomödie nach dem Theaterstück von Alfred de Musset „Le Chandelier“, das viele Komponisten inspiriert hat.

Als Erster Auber schon 1841. Offenbach komponierte eine „Chanson de Fortunio“ und wollte das ganze Werk vertonen, entschied sich aber dann für „Fantasio“, der zur Zeit wieder öfters auf den Spielplänen steht). Die Inszenierung von Denis Podalydès, mit Bühnenbild von Éric Ruf - beide von der Comédie Française - und Kostümen von Christian Lacroix, ist vom Feinsten, geschmackvoll bis ins kleinste Detail. Dirigent Louis Langrée, der sich schon als Musikchef der Oper in Lyon für Messager einsetzte, dirigierte mit „raffinement“, auch in den beinahe Wagnerhaften
Gefühlsausbrüchen der großen Liebesgeständnisse des letzten Aktes. Wunderbar das durch Philippe Herreweghe gegründete Orchestre des Champs-Elysées , das für dieses Repertoire gerne mit Langrée spielt, und der durch Joël Suhubiette vorbereitete Chœur Les Eléments.
Die Besetzung wurde angeführt durch Cyrille Dubois als Fortunio. Seitdem wir über ihn berichten als er vor acht Jahren noch im Opernstudio der Pariser Oper debütierte, singt erinzwischen schon an den großen Häusern Rollen, die meines Erachtens etwas zu groß für seinen nicht unbedingt „lyrischen“ Tenor sind. Aber hier war er perfekt, von seiner verhaltenen Auftrittsarie „Je suis très tendre et très farouche“ bis zu seinem finalen Liebesgeständnis „Dieu! Je rêve! Etre aimé de vous!“, in der er mühelos über das Orchester kam, ohne dabei sein schönes Timbre zu verlieren. Anne-Catherine Gillet war ihm als geliebte, unerreichbare Jacqueline vollkommen ebenbürtig, sowie Jean-Sébastien Bou als fescher Frauenheld Clavaroche und Franck Leguérinel als überaus komischer eifersüchtiger Ehemann Maître André.
Der Rest der Besetzung war vokal vielleicht nicht ganz homogen, aber das kann man niemanden in diesen widrigen Streik-Umständen übelnehmen, in denen viele Leute über 3 Stunden zu Fuß (!) zum Theater laufen mussten und die Luft in Paris zur Zeit so schlecht ist, dass Viele unter Atembeschwerden leiden.
Das größte Kompliment des Abends geht also an Alle die da waren und nicht gestreikt haben. Denn von den fünf Rezensionen, die ich im Dezember außerhalb von Paris schreiben wollte - die übliche „Hoch-Zeit“ für die hiesigen Theater - sind vier dem Generalstreik zum Opfer gefallen. Dies nur als kleiner Indikator für den immensen Preis, den nicht nur die französische Wirtschaft, sondern besonders das Kultur-Leben für diesen Streik bezahlt. So freuen wir uns doppelt und dreifach, dass wir trotzdem endlich einmal über André Messager berichten konnten.
Fotos (c) Stefan Brion
Waldemar Kamer, 22.12.2019
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
Unser Opernfreund Plattentipp:

Jacques Offenbach
MADAME FAVART
20.6.2019
Zum 200. Geburtstag eine wiederentdeckte französische „Zuckerbäckertorte“

Was für eine tolle Geburtstagsparty! Offenbach hätte sich gefreut über den Trubel (und die sehr seriösen Symposien) in seiner Geburtsstadt Köln und seiner Wahlheimat Paris. Und auch er wäre wahrscheinlich wie der Offenbachspezialist Heiko Schon (siehe das Interview mit Renate Wagner im Merker Online) nach Paris gefahren, denn die Premiere dort war sehr besonders und als Geburtstagsgeschenk wunderbar ausgesucht. Die Opéra Comique bringt in Zusammenarbeit mit dem Palazzetto Bru Zane Offenbachs letzten großen Erfolg in Paris, „Madame Favart“, eine opéra comique, von der wir noch nie gehört hatten. Am 28 Dezember 1878 in den Folies Dramatiques uraufgeführt, verschwand das Werk gänzlich von den Spielplänen mit dem (posthumen) Erfolg von „Hoffmanns Erzählungen“ und wurde noch nie an diesem Haus gespielt. Doch hier gehört sie absolut hin, nicht nur wegen ihrer Form, sondern auch wegen ihres Sujets, denn sie endet mit der Gründung der heutigen Opéra Comique durch den Theaterautor und Opernkomponisten Charles Simon Favart (1710-1790), weswegen der Saal an der Rue Favart bis heute „Salle Favart“ heißt.

Charles Simon war verheiratet mit der legendären Schauspielerin Justine Favart (1727-1772), die die europäische Theatergeschichte beeinflusst hat - man braucht nur zu lesen, was Voltaire oder Grimm über sie geschrieben haben. Denn sie war einer der Allerersten in einer Zeit, wo Schauspielerinnen selbst ihre oft sehr kostbaren und durch Gönner bezahlten Kostüme mitbringen mussten, diese eintauschte für eine oft sehr einfache Kleidung, die jedoch ihren Rollen entsprach. So sorgte sie für eine Sensation, als sie in „Bastien et Bastienne“ als einfache Landfrau mit Holzschuhen auf der Bühne erschien. Ein Stück bekannt durch die spätere Vertonung Mozarts, das übrigens sie und nicht ihr Mann geschrieben hat, so wie es fälschlicherweise beinahe überall noch erwähnt wird. Denn Justine Favart war auch Dichterin, Schriftstellerin und Komponistin, zusammen mit ihrem 17 Jahre älteren Mann, dem sie durch dick und dünn, privat und künstlerisch, immer die Treue hielt und der nach ihrem frühen Tod Wunderbares über sie geschrieben hat, um zu erklären, dass er ohne sie einfach nichts mehr schreiben konnte. So eine schöne und intelligente Schauspielerin hatte es im Paris von Louis XV und Madame de Pompadour natürlich nicht einfach, da alle großen Herren ihr nachstellten. Der bekannteste war Moritz von Sachsen (1669-1750), der erfolgreiche französische Feldmarschall im Österreichischen Erbfolgekrieg. Der „Maréchal de Saxe“ beorderte Charles Simon Favart mit seiner Frau an die Front, um für seine Soldaten zu spielen und engagierte sie auch – was viel weniger bekannt ist – als Doppelspionen, die seinen Gegnern am Tag vor der Schlacht gefälschte Informationen verkauften. Was dort alles genau passiert ist, konnte nie rekonstruiert werden, aber Tatsache ist, dass Justine und ihr Mann von der Front flüchten mussten und jahrelang untertauchen, um der Wut des Feldmarschalls zu entfliehen, dessen Avancen sie verweigert hätte. Justine wurden mehrere Male verhaftet, in verschiedenen Klöstern eingesperrt, aus denen sie jedoch auf abenteuerliche Weise entfliehen konnte. Denn sie war eine Meisterin im Verkleiden, sprach mehrere Sprachen und wusste in Verhören deutsche und französische Polizeichefs in die Irre zu führen.

Sie war ein „goldenes Sujet“ (wie man in Theaterkreisen sagt) für Offenbach, der nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 in Paris wieder Fuß fassen wollte als französischer Komponist. Frankreich besann sich nach seiner schmachvollen Niederlage auf seine großen Feldherren der Vergangenheit und George Sand hatte für viel Aufregung gesorgt, mit der in ihren Memoiren publizierten Behauptung, dass sie eine illegitime Urenkelin des Maréchal de Saxe und der Schauspielerin Marie Rinteau sei (was übrigens nachweislich nicht stimmt, auch wenn man es heute noch auf Wikipedia etc lesen kann). Es wimmelte damals an Stücken über die Liebschaften des Feldmarschalls, so wie die später durch Cilea vertonte „Adrienne Lecouvreur“ von Scribe, und an der Comédie Française wurde ein Stück aufgeführt über seine abenteuerliche Beziehung mit Justine Favart. Offenbach schrieb danach mit seinen Librettisten Alfred Duru und Henri Chivot eine ebenso abenteuerliche Handlung, die anfängt in einer Herberge in Arras, in der Charles Simon Favart sich in einem Keller versteckt hat und seine Frau in Verkleidung erscheint um ihn zu befreien. Doch bis es dazu kommt, muss sie sich noch fünfmal verkleiden und als elegante Dame den Gouverneur bezirzen, damit er ihren dort zufällig getroffenen Jugendfreund Hector zum Polizeikommandanten ernennt, in dessen Haus sie einstweilen vor der nach ihr suchenden Polizei sicher sein kann. Doch dort wird sie als Hausmädchen durch eine alte adelige Tante Hectors aus Paris erkannt als die getarnte Schauspielerin, nach der alle überall suchen, was zu einer abenteuerlichen Flucht führt mit vielen köstlichen Rollenspielen. Bis zum typischen Offenbach-Happy End, bei dem Justine sich flehend vor den König wirft, der den lüsternen Gouverneur Pontsablé (stellvertretend für den Maréchal de Saxe) in den Ruhestand schickt und Charles Simon Favart zum Direktor der Opéra Comique ernennt (was in Wirklichkeit ein bisschen anders verlief).

Um ein solches komische Oper über eine Schauspielerin zu inszenieren, engagierte die Opéra Comique die Schauspielerin Anne Kessler, Sociétaire der Comédie-Française, die nun als Opernregisseurin debütiert. Die Wahl ist gut getroffen, denn die Regisseurin überzeugte mit ihrer sehr fein ausgearbeiteten Personenregie, vor allem in den gesprochenen Dialogen. „Madame Favart“, wurde vollkommen strichlos aufgeführt, was für ein heutiges Publikum nicht immer leicht ist. Denn das bedeutet, dass genauso viel gesprochen wie gesungen wird. Nirgendwo auf der Welt spielt man heute noch die ursprüngliche Fassung von „Carmen“ mit allen gesprochenen Dialogen, weil man dafür Sänger-Schauspieler braucht und eben entsprechend lange Probenzeiten. Anne Kessler brachte das junge Ensemble der Opéra Comique - jetzt „Troupe Favart“ genannt - zu einer erstaunlich homogenen Ensembleleistung, in der jeder, auch der Chor, immer in seiner klar charakterisierten Rolle blieb (auch wenn er/sie nicht sang/en). Der einzige Minuspunkt war das Bühnenbild von Andrew D. Edwards, der die Handlung in das Kostümatelier der Opéra Comique verlegte. Dies ist dramaturgisch nachvollziehbar in dieser Verkleidungskomödie und auch nicht unästhetisch – wir sind in Frankreich und nicht im deutschen „Regie-Theater“ -, aber es brachte keinen Mehrwert und stiftete manchmal etwas Verwirrung. Und gerade in diesem Ambiente waren die Kostüme von Bernadette Villard einfach zu schlicht. Da wäre eine Ästhetik wie in dem hochgelobten „Postillon de Lonjumeau“ (siehe Merker 4/2019) vielleicht angebrachter gewesen. Aber auch mit dieser Optik gelang Kessler die für uns beste Inszenierung des Offenbach-Jahres in Frankreich.

Das Singen war genauso gut wie das Spielen. Marion Lebègue überzeugte als omnipräsente Madame Favart in stets neuer Verkleidung. Der szenische und musikalische Höhepunkt des Abends war ihr Auftritt als alte, intrigante Tante Hectors, Madame de Montgriffon, die als Peggy Guggenheim mit markanter Brille und Schoßhund erschien – wir haben die Sängerin einfach nicht wiedererkannt. Auch stimmlich nicht, denn ihre Arie „Je passe sur mon enfance“ – für uns die schönste des Abends – lag deutlich tiefer als ihre anderen Arien. Damit hatte Juliette Simon-Gérard, die 19-jährige Sängerin der Uraufführung, offensichtlich kein Problem, doch die vielen Registerwechsel - und das viele Sprechen! - brachten Marion Lebègue an der Premiere öfters stimmlich aus dem Lot. Christian Helmer überzeugte alsCharles-Simon Favart in der bekannten Zuckerbäcker-Arie (Favart war wie sein Vater ursprünglich ein Zuckerbäcker gewesen) und trumpfte in den Tiefen mit sonorem Bass, aber dafür weniger in der Höhe. Da hatten es Anne-Catherine Gillet als Suzanne („einstimmig“ Spielsopran) und François Rougier als ihr Ehemann Hector de Boispréau (Spieltenor) viel leichter. Die drei buffonesken alten Männer - offensichtlich ein Thema für den alten Offenbach - beherrschten die Bühne, auch wenn sie vergleichsweise weniger zu singen hatten. Allen voran Eric Huchet, vor drei Wochen ein köstlicher Maître Péronilla (siehe unsere letzte Offenbach-Rezension) und nun ein umwerfend lustiger Marquis de Pontsablé, der als lüsterner Gouverneur und Baron Ochs avant la lettre der armen Justine nachstellt. Ihm ebenbürtig zur Seite Franck Leguérinel als Major Cotignac und Lionel Peintre als Biscotin – beide nicht mehr aus dem Ensemble der Opéra Comique wegzudenken. Der exzellent durch Edward Ananian-Cooper vorbereitete Chœur de l’Opéra de Limoges sang absolut textverständlich, auch in den vielen typischen Offenbach-gallops, die Kaiser Napoleon III zu seinem berühmten Bon Mot inspirierten, dass er Offenbach hauptsächlich „mit den Beinen höre“.
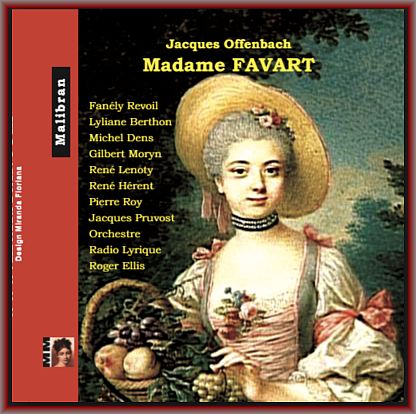
Der von uns schon öfters gelobte Laurent Campellone – er digerierte unlängst die „Belle Hélène“ in Nancy (siehe Merker 1/2019) und die Platte „Offenbach Colorature“ mit der Sängerin Jodie Devos und dem Münchner Rundfunkorchester, die nun beim Palazzetto Bru Zane erscheint – zeigte sich wieder als Offenbach-Spezialist. So einen Dirigenten braucht man auch, denn die Partitur wimmelt von Anspielungen auf die französische opéra comique des 18. Jahrhunderts, vor allem auf den durch Offenbach sehr geschätzten Nicolas Isouard (siehe seine „Cendrillon“ in Saint Etienne im letzten Merker). Doch gleichzeitig lässt Offenbach das kleine Mozart Orchester auch manchmal heftig aufspielen und galoppieren. Das führte damals wie heute zu einem frenetischen Schlussapplaus, den Offenbach kurz vor seinem Tod sehr genossen hat. „Madame Favart“ wurde zu seinen Lebzeiten noch 200 mal in Paris gespielt, auch 1879 im Theater an der Wien (Offenbachs letzter Besuch Wien). Wunderbar, dass dieses vergessene Werk wieder mit Erfolg ausgegraben wird, denn die Opern in Limoges und Caen kündigen schon eine Wiederaufnahme für die nächste Spielzeit an. Was für eine schöne „Torte“ zum 200. Geburtstag!
Waldemar Kamer 22.6.2019
Fotos (c) Stefan Brion
Opernfreund-Plattentipp
Aus den vielen vorliegend Aufnahmen, empfiehlt unser Paris-Kritiker Waldemar Kamer die Radioaufnahme aus 1953 mit der fantastischen Fanély Revoil (1906-1999), jetzt gerade bei der Firma Malibran neu herausgebracht.
Adolphe Adam
LE POSTILLON DE LONJUMEAU
30 III 2019
Eine wunderbar witzige Wiederentdeckung eines verschollenen Juwels: seit 125 Jahren nicht mehr in Paris gespielt!
Die Opernwelt geht manchmal seltsam mit ihren früheren Stars um: von den 72 Opern, Operetten und Vaudevilles von Adolphe Adam (1803-56) hat sich keine einzige auf den Spielplänen halten können, wo man jedoch jedes Jahr zwei von seinen zwölf Balletten findet: „Giselle“ und „Le Corsaire“. Adam wird wohl in den meisten Opern- und Operettenführern erwähnt, jedoch nur in einer Fußnote als ein „damals sehr bedeutender Komponist“. Wie bedeutend er war, erkennt man sofort in dem exzellenten Programmheft der Opéra Comique, in dem die hochkompetente Dramaturgin der Oper Agnès Terrier von Adams Erfolgen nicht nur in Paris, sondern auch in London, Berlin, Sankt Petersburg und Wien berichtet. „Le Postillon de Lonjumeau“ wurde schon im Jahr nach seiner Uraufführung 1836 an der Opéra Comique in 15 Hauptstädten Europas aufgeführt, erreichte 1840 Nord- und Südamerika und wurde sofort in 10 Sprachen übersetzt. Auch in Wien wurde „Der Postillon von Lonjumeau“ gerne und oft gespielt, denn die damalige Hofoper hatte 7 Opern und 6 Ballette von Adam im Repertoire, die auch noch an 7 anderen Theatern in Wien gespielt wurden. „Der Postillon“, der dem König von Preußen gewidmet war, war in Deutschland besonders populär, sodass die Partitur in 100 Jahren mehr als 30-mal verlegt wurde und der Tenor Theodor Wachtel die Rolle 1868 schon zum 1000. Mal sang. Anscheinend auch in Riga, wo ein junger Dirigent namens Richard Wagner so viel Vergnügen am „Postillon“ hatte, dass er 40 Jahre später, als er wegen des ganzen Stresses bei den Bayreuther Festspielen nachts nicht schlafen konnte, immer wieder diese eine Arie sang (sowie es Cosima 1878 in ihrem Tagebuch vermerkt).

Doch so schnell sein Stern im 19. Jahrhundert gestiegen war, fiel er wieder im 20en. Nach 1894 wurde „Le Postillon de Lonjumeau“ nicht mehr an der Opéra Comique gespielt und in Wien war die letzte Vorstellung anscheinend 1908 an der Volksoper. Der einzige Mensch, der mir von einer erlebten Vorstellung berichten konnte, ist unsere Merker-Chefredakteurin Sieglinde Pfabigan, die sich noch genau an eine Vorstellung 1956 in Linz erinnert: „an einen sehr vergnüglichen und Melodienreichen Abend, wo der damalige Hohes-C Tenor Hans Krotthammer auch noch ein herrliches hohes D sang“.
Dieses berühmte hohe D kann man nun wieder hören in einer eklatanten Produktion an der Opéra Comique, an der anscheinend mehr als 10 Jahre gearbeitet wurde. Denn solche Wiederentdeckungen haben nur Sinn – und dann auch wirklich Erfolg - wenn man das Werk stilgerecht aufführt. Und dafür braucht man nicht nur einen guten Hohen-D-Tenor, sondern auch einen Dirigenten, der diese Musik kennt und einen Regisseur, der mit einer opéra comique mit gesprochenen Dialogen wirklich etwas anfangen kann. So ein Team stand nun auf der Bühne und wir waren alle begeistert: das Werk entfaltete all seine gute Laune, seine feinen Nuancen und seinen besonderen Witz, dem man als Opernliebhaber nicht widerstehen kann.

Denn „Le Postillon de Lonjumeau“ ist eine Parodie der Oper, ausgehend von der Lebensgeschichte des legendären Tenors Pierre Jélyotte (1713-1797), für den Jean-Philippe Rameau (fast) alle seine großen Rollen komponiert hat, auch Abaris in den unlängst rezensierten „Les Boréades“ in Dijon. Der aus einem Bergdörfchen in den Pyrenäen stammende Jélyotte wurde in einem Kirchenchor in Toulouse durch den Prinzen von Carignan „entdeckt“, der den Landjungen mit nach Paris nahm, wo er der Sänger-Star der Pariser Oper wurde und ein Liebling am Hof. Jélyotte, auch ein begnadeter Komponist, begleitete zum Beispiel den kleinen Mozart auf der Gitarre als dieser in Versailles auftreten durfte. Was er auch tat, „alle Frauen waren wild nach ihm“ so wie es Marmontel in seinen Memoiren beschreibt. Adam schrieb die Rolle für den damaligen Startenor der Opéra Comique Jean-Baptiste Chollet, der sich als renommierter Frauenheld zum Zeitpunkt der Uraufführung zusätzlich auch noch von seiner Gattin, der großen Sängerin Zoé Prévost trennte – was diese Sänger- und Doppelehegeschichte noch pikanter machte, da beide auf der Bühne standen.
„Der Postillon von Lonjumeau“ ist ein schöner Kutscher mit einer noch schöneren Stimme, der seine arme Frau ohne viel Gewissensbisse in der Hochzeitsnacht verlässt, um Sänger an der Pariser Oper zu werden und in die Hofkreise eingeführt zu werden. Dort begegnet er zehn Jahre später einer vermögenden Gräfin, die ihn sogar heiraten will. Doch in der Hochzeitsnacht entpuppt diese sich als seine früher verlassene Frau, die einen Racheplan vorbereitet hat, sowie man ihn nur am Hof von Ludwigs dem XV. und Madame de Pompadour ausdenken konnte. Theater im Theater also, mit eingebildeten Tenören, heulenden Sopranen, streikenden Chören und nervösen Operndirektoren – einfach ein Genuss!

Die Musik von „Le Postillon de Lonjumeau“ – von dem es zum Glück einige Aufnahmen gibt – ist ganz anders als die symphonischen Ballette Adams, die Tschaikowsky zu seinen großen Handlungsballetten inspiriert haben. Es ist eine leichte Musik, im Sinne von Hérold, Boieldieu, Auber und Halévy, von denen wir schon einige opéras comiques rezensiert haben. Nur – wegen des Sujets – mit vielen Anleihen an die französische Musik des 18. Jahrhunderts, worunter zwei Opern von Rameau und Grétry, die im „Postillon“ aufgeführt werden. Sébastien Rouland, jetzt GMD in Saarbrücken, ist der ideale Dirigent für dieses Werk. Er weiß mit dieser Musik subtil umzugehen, gibt jeder Reprise eine andere Farbe – es gab nicht einen einzigen Strich in Wort und Ton - und weiß dem Orchester und Chor der Opéra de Rouen Normandie nicht nur „raffinement“, sondern auch „esprit“ (Witz) und Spielfreude ein zu flössen. Einfach herrlich und erfrischend. Michel Fau steht ihm als kongenialer, witziger und einfallsreicher Regisseur zur Seite. Fau ist ursprünglich Schauspieler und Theaterregisseur und weiß aus jeder noch so kleinen Sprechszene ein Maximum heraus zu holen. Jede Figur ist genau charakterisiert und auch wenn fast gar nichts passiert und Fau als Hofdame Rose in einem riesigen rosa Kleid stumm ins Publikum guckt, kann dieses sich vor Lachen kaum halten. Bevor der erste Ton gesungen war, war diese Premiere schon ein Erfolg.

Was nach den Arien des Tenors an Beifallsstürmen erklang, lässt sich kaum beschreiben. Michael Spyres ist ein hinreißender Postillon Chapelou / Opernsänger Saint-Phar, voller Witz und Spielfreude, auch in den gesprochenen Dialogen. Er hat als leichter Rossini-Tenor keine einzige Mühe mit dem hohen D, dass er auf dem Promotionsvideo der Oper (im Internet zu sehen) unzählige Male wiederholt – in Bruststimme anstelle der ursprünglich vorgesehenen „voix mixte“. Und weil das Publikum so tobte, stieg er am Premierenabend auch noch weiterhin auf zum hohen E und (fast) zum hohen F. Bald wird er an der Wiener Staatsoper debütieren! Florie Valiquette war als ebenso fulminanter Koloratursopran eine ihm absolut ebenbürtige Partnerin als verlassene Gattin Madeleine / rachsüchtige Madame de Latour (in der Schlussszene musste sie gleichzeitig beide Frauen mit zwei verschiedenen Stimmen und Kostümen spielen). Franck Leguérinel, ein oft und gern gesehener Gast an der Opéra Comique, war perfekt als Hofintendant, Operndirektor und Frauenheld Marquis de Corcy und Laurent Kubla als Hufschmied Biju, der zum Sänger Alcindor mutiert. Das gilt auch für Julien Clément als Bourdon und Yannis Ezziadi als Louis XV. Last but not least die Kostüme von Christian Lacroix, die auf den Fotos vielleicht etwas grell wirken können in den gekonnt „parodierten“ Bühnenbildern von Emmanuel Charles: jedes Kostüm war anders, kein Chorist sah gleich aus. Das war wirklich „haute couture“! Das Premierenpublikum tobte, die Presse jubelt und niemand kann verstehen, warum diese witzige Oper mit diesen Arien, die einem wie ein „Ohrwurm“ im Gedächtnis bleiben (und wahrscheinlich nicht nur bei Richard Wagner), seit 125 Jahren nicht mehr in Paris gespielt wurde. Das wird sich hoffentlich nun ändern, Dank sei dieser exzellenten Produktion, die hoffentlich noch an vielen Theatern nachgespielt werden wird. Wir sind gespannt! Waldemar Kamer
Waldemar Kamer 1.4.2019
Fotos: (c) Stefan Brion
OPERNFREUND CD TIPP