


http://www.stadttheaterbremerhaven.de/
MACBETH
Premiere am 17.09.2022
Horror und Neurosen
Macbeth ist die erste von den drei Opern Giuseppe Verdis nach William Shakespeare (neben „Otello“ und „Falstaff“). Es ist die düsterste seiner Opern - ein Nachtstück, bei dem es um krankhaften Ehrgeiz und Machtgier geht, um Mord und Hexenspuk, um Angst und Wahnsinn.

Philipp Westerbarkei, der mit dieser Inszenierung sein Bremerhavener Regiedebüt gibt, sieht in Macbeth den Stoff für eine Horrorgeschichte. Die allgegenwärtigen Hexen spielen dabei eine zentrale Rolle. In furchterregenden Kostümen (von Tassilo Tesche) fallen sie zu Beginn wie Vampire über Macbeths Soldaten her und töten sie wollüstig. Die wie Blitze immer wieder aufflammenden Neonröhren tauchen die zunächst kahle und schwarz ausgeschlagene Bühne (ebenfalls von Westerbarkei) in ein unheilvolles Licht. Später dient eine überdimensionale Holzkonstruktion als Spielfläche, die wie ein klaustrophobischer Sarg wirkt. Westerbarkei lässt die Handlung als psychologisches Kammerspiel ablaufen, bei dem Vieles nur im Kopf von Macbeth und Lady Macbeth stattzufinden scheint. Beim Festbankett etwa gibt es keine Gäste, nur das Gespenst des ermordeten Banquo erscheint zunächst, später dringen auch hier die Hexen ein. Die Morde an Duncan und Banquo werden nicht explizit gezeigt, beim ersten sticht Macbeth wie im Wahn mit einem Dolch auf den Bühnenboden, beim zweiten wird Banquo von unheimlichen Händen hinter den Vorhang gezogen, bis er ganz verschwindet. Blut und blutverschmierte Kostüme gibt es trotzdem genug.
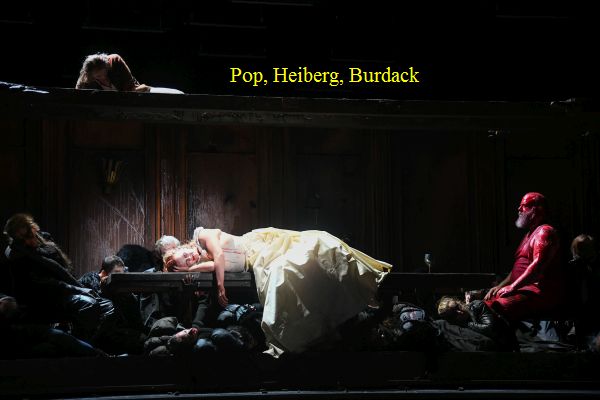
Macbeth wird als hochgradig psychopathisch gezeichnet. Er ist ein Mensch, der von Neurosen und Angstzuständen getrieben wird. Lady Macbeth lebt ebenfalls in ihrer eigenen Welt, bei der auch ihre sexuellen Phantasien eine Rolle spielen, etwa wenn ihr fast nackter Körper mit Blut beschmiert wird. Es ist insgesamt eine gelungene Inszenierung mit einer ganz eigenen Note, die die Düsternis des Werkes unterstreicht. Über die musikalische Seite lässt sich nur das Allerbeste sagen. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven spielen nicht nur hochkonzentriert und makellos. Sie setzen auch hochdramatische Akzente, geben mit genau den richtigen Tempi der Musik mitreißenden Schwung und lassen den Sängern Raum zum Atmen. Es ist eine Wiedergabe, die vom ersten bis zum letzten Takt fesselt und begeistert. Großen Anteil an diesem positiven Eindruck haben auch der Opernchor und der Extrachor in der Einstudierung von Mario El Fakih Hernández. So klangvoll und wuchtig hat man die Bremerhavener Chöre lange nicht gehört.

Als Lady Macbeth kann Signe Heiberg aus dem Bremerhavener Ensemble alle Erwartungen an die Partie erfüllen. Sie verfügt über einen kraftvollen, leuchtstarken Sopran, den sie raumgreifend und mühelos über dem Orchester schweben lässt und der auch in extremen Lagen nie ausbricht. Ihre Darstellung der Lady, schwankend zwischen Ehrgeiz, Hohn und Wahnsinn, kennt viele Facetten und Zwischentöne. Es ist eine Leistung, die auch an weitaus größeren Opernhäusern Bestand hätte. Aber auch der Gastsänger Marian Pop kann daneben bestehen. Sein warm timbrierter, sonorer Bariton strömt in allen Lagen ebenmäßig und wohlklingend. Die Neurosen der Figur und ihre Gebrochenheit verdeutlicht er ebenso überzeugend wie deren Skrupellosigkeit. Die Szenen zwischen Pop und Heiberg knistern geradezu vor Spannung und Emotionalität.

Nicht ganz auf diesem Niveau bewegt sich der Banquo von Ulrich Burdack. Auch er gibt seiner Partie durchaus Profil, aber stimmlich sind in Sachen Tiefe und Volumen doch ein paar Abstriche zu machen. Dafür sorgt Konstantinos Klironómos als Macduff für eine echte Überraschung. Seine Partie besteht fast nur aus der einen Arie O figli, o figli miei!, die er aber mit ausgesprochen schön, rund und höhensicher klingendem Tenor serviert.
Wolfgang Denker, 18.09.2022
Fotos von Heiko Sandelmann
OCEANE
Premiere am 29.04.2022
Geheimnisvolle Frau am Meer

Mit der Premiere der Oper Oceane von Detlev Glanert ist dem Stadttheater Bremerhaven ein musikalisch wie szenisch von der ersten bis zur letzten Sekunde fesselnder Opernabend gelungen. Das Werk wurde 2019 an der Deutschen Oper Berlin mit größtem Erfolg uraufgeführt und sollte schon ein Jahr später - noch in der Intendanz von Ulrich Mokrusch - in Bremerhaven gespielt werden. Doch dann kam Corona. Zum Glück hat sein Nachfolger Lars Tietje die Pläne übernommen und so eine geradezu beglückende Produktion ermöglicht.

Vorlage für die Oper ist vor allem das Novellenfragment „Oceane von Parceval“ von Theodor Fontane. Oceane ist eine geheimnisvolle Frau, die besonders der Natur und dem Meer verbunden ist. Sie findet in der bunten Gesellschaft, die sich in einem heruntergekommenen Hotel am Meer zu einem Sommerball versammelt hat, keinen Platz - so sehr sie sich auch danach sehnt. Zwar ist sie keine Nixe, aber doch eine „Schwester“ von Undine, Melusine oder Rusalka. So kann sie auch die stürmische (und übergriffige) Liebe, die ihr vom Gutsbesitzer Martin erklärt wird, nicht erwidern. Gefühle sind nicht ihr Ding. Die angeschwemmte Leiche eines Fischers löst bei ihr keine Empathie aus. Für sie ist es ein Bild der Natur. Zudem stachelt der eifernde Pastor Baltzer die Badegesellschaft zu Hass und Ablehnung gegen Oceane auf. Er behauptet, sie sei kein Kind Gottes und bringe den Tod. Ist es wirklich so? Immerhin begegnet sie gleich zu Anfang dem Fischer, der später tot angeschwemmt wird. Oceane erkennt jedenfalls, dass sie in der Welt der Menschen nie ankommen wird. Sie hinterlässt einen Abschiedsbrief für Martin und entschwindet genauso geheimnisvoll wie sie gekommen ist. Die Oper endet wie sie begonnen hat: Mit einer Vocalise Oceanes und den vom Chor ausgeführten Stimmen des Meeres. Die Musik verdämmert dabei fast unwirklich.

Diese Musik von Detlev Glanert ist gemäßigt modern. Mit Arien, Duetten und Ensembleszenen, mit Tänzen und orchetralen Zwischenspielen bedient sie sich gängiger Opernformen. Glanert beschwört sphärische, zarte Töne, setzt auf Melodie und Gesangslinie, auf Tanzrhythmen wie Walzer, Polka und Galopp und entfacht mit mächtigen Chorsätzen und expressiven Orchesterausbrüchen ein rauschhaftes und berauschendes Spektrum an Klängen. Er findet für Meer und Wind stets einen sinnlichen, musikalischen Ausdruck. Es ist eine Musik, die einfach begeistert, zumal Marc Niemann am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven für eine durchgängig spannende und überzeugende Wiedergabe sorgt. Allein die erste Szene ist an überwältigender Wirkung kaum zu übertreffen. Auch Chor und Extrachor (Mario El Fakih Hernández) zeigen sich dabei von ihrer besten Seite.

Katharina Thoma hat mit ihrer sehr stimmungsvollen und schnörkellosen Inszenierung entscheidend den Gesamteindruck geprägt. Mit sehr differenzierten Lichtstimmungen, mit wabernden Nebelschwaden, bläulichem Horizont und viel echtem Wasser auf der Bühne wird die Allgegenwärtigkeit des Meeres verdeutlicht. Dazu kommt bedarfsweise eine Rampe mit Badekabinen als Terrasse für das Sommerfest (Bühne von Sibylle Pfeiffer). Thoma gelingt es dank ausgefeilter Personenführung den Charakter jeder Figur genau herauszuarbeiten. Die stilisierten Tanzszenen des Sommerballs wurden von Lidia Melnikova choreographiert. Und wie Oceane sich geradezu in Ekstase tanzt und für einen Skandal auf dem Ball sorgt, ist atemberaubend.

Das Bremerhavener Theater glänzt hier mit einer sehr guten Ensembleleistung. Allen voran begeistert Signe Heiberg als Oceane, die mit ihrem leuchtstarken, kraftvollen Sopran mühelos Chor und Orchester überstrahlt und mit der Intensität ihrer Darstellung Maßstäbe setzt. Auch Patrizia Häusermann ist mit hervorragender Diktion und schönem Stimmklang eine hervorragende Hotelbesitzerin. Der Tenor von Alexander Geller mag Geschmackssache sein, aber er gibt dem Martin sehr leidenschaftliche Züge. Das zweite Paar (Albert und Kristina) ist mit Marcin Hutek und Victoria Kunze adäquat besetzt. Nicht immer ganz mühelos, aber dafür ausdrucksstark gibt Ulrich Burdack den Pastor Baltzer. Als Hoteldiener Georg sorgt Patrick Ruyters mit seinem ständigen „traurig, traurig“ für eine heitere Note.
Opernfreunde sollten sich das vielschichtige Werk in dieser hervorragenden Produktion nicht entgehen lassen.
Wolfgang Denker, 30.04.2022
Fotos von Heiko Sandelmann
Pressekonferenz zur Spielzeit 2020/21
am 29.04.2020
Mit optimistischem Blick
Das Stadttheater Bremerhaven ist im norddeutschen Raum das erste Haus, das seine Pläne für die Spielzeit 2020/21 vorgestellt hat. Bei allen Vorbehalten und Unwägbarkeiten blickt Intendant Ulrich Mokrusch mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. Dass die laufende Spielzeit, von mehreren Aktionen im Internet abgesehen, nun vorzeitig zu Ende ist, ist klar. Dem sind die beiden Produktionen „Endstation Sehnsucht“ von André Previn und „Werther“ von Jules Massenet zum Opfer gefallen. Sie werden auch in der kommenden Spielzeit nicht nachgeholt, während „Der Schimmelreiter“ von Wilfried Hiller nun am Ende der nächsten Spielzeit herauskommen soll.
Für Ulrich Mokrusch ist es seine letzte Spielzeit in Bremerhaven. Danach wechselt er an das Theater Osnabrück. Sein Nachfolger in Bremerhaben wird ab 2021/22 Lars Tietje sein, der bisher Intendant in Schwerin war. Mokruschs Pläne, die unter dem beziehungsvollen Motto „Umbruch und Veränderung“ stehen, sehen folgende Inszenierungen vor:
Gestartet wird, wie schon seit einigen Jahren, mit einem Musical. Diesmal ist es „Chicago“ von John Kander (19. September). Mit Davide Perniceni (musikalische Leitung) und Felix Seiler (Inszenierung) wird hier ein eingespieltes Team am Wirken sein.
Es folgt „Carmen“ (31. Oktober) mit Patrizia Häusermann in der Titelpartie und Jason Kim (Gast aus Oldenburg) als Don José. Gesungen wird in französischer Sprache, allerdings mit deutschen Dialogen. Matthias Oldag inszeniert, GMD Marc Niemann dirigiert.
Er steht auch bei „Lucia di Lammermoor“ am Pult. Die Belcanto-Oper ist als Weihnachtspremiere (25. Dezember) in der Inszenierung von Phillipp Kochheim vorgesehen.
Die Operette wird mit Lehars „Paganini“ (6. Februar) vertreten sein, wobei die musikalische Leitung in den bewährten Händen von Hartmut Brüsch liegt und Robert Lehmeier für die Inszenierung verantwortlich ist.
Bei „Oceane“ von Detlev Glanert handelt es sich um ein Werk, das erst im April 2019 an der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt wurde. Der Stoff beruht auf dem Novellenfragment „Oceane von Parceval“ von Theodor Fontane und führt in geheimnisvolle Wasserwelten, ähnlich wie „Undine“ oder „Rusalka“. Die Oper verlangt ein großes Orchester, das teilweise auch auf der Seitenbühne sitzen muss. Bremerhaven ist eines der ersten Häuser, das das Werk nachspielt (20. März). Marc Niemann wird dirigieren und Hendrik Müller inszenieren.
Mozarts „Le Nozze di Figaro“ ins Programm zu nehmen, war ein schon lange geäußerter Wunsch des Ensembles. Dieser Wunsch wird von Davide Perniceni am Orchesterpult und Ansgar Weigner am Regiepult erfüllt (30.April).
Die letzte, in die neue Spielzeit herübergerettete Premiere gilt Wilfried Hillers „Der Schimmelreiter“ (30. Mai). Das Werk wurde schon vor zwanzig Jahren in Bremerhaven gespielt und hat ja durchaus Bezüge zur Region. Die Regie hat Ulrich Mokrusch persönlich, der sich damit vom Bremerhavener Publikum verabschiedet.
Es bleibt zu hoffen, dass sich all diese Pläne wirklich realisieren lassen. Bleiben wir optimistisch!
Wolfgang Denker, 1.5.2020
LA CENERENTOLA
Premiere am 25.12.2019
Märchen mit britischem Witz
Wenn am Ende Angelina im weißen Brautkleid dasteht und ihren Peinigern (dem Stiefvater und den Stiefschwestern) voller Güte und in kaum zu ertragendem Edelmut verzeiht, wenn die Hochzeitstorte vom Himmel schwebt und wenn es dann noch Konfetti regnet - dann ist es da, das unvermeidliche Happy End des klassischen Märchens „Aschenputtel“. Der Stoff hat viele Komponisten von Jules Massenet bis Sergej Prokofjew, von Johann Strauß bis Richard Rodgers inspiriert. Und natürlich Gioachino Rossini - die Oper La Cenerentola gehört zu seinen erfolgreichsten Werken.

In Bremerhaven inszenierte Max Hoehn La Cenerentola als höchst vergnügliche Weihnachtspremiere. Hoehn ist britischer Staatsbürger. Und in seinem Konzept reichert er das Märchen mit viel (britischem) Humor an. Allein die marionettenhaften Bewegungen der skurrilen Dienerschaft des Prinzen Don Ramiro sind eine Klasse für sich. Und wenn die Diener noch bei Sturm und Regen als „Ersatzpferde“ vor die Kutsche des Prinzen gespannt werden, schlägt der Witz wahre Funken. Eine tolle Szene, mit der Rossinis Gewittermusik da umgesetzt wird. Dieser feine Humor mit Elementen von Monty Python zieht sich durch den ganzen Abend. Da wird bei der Ankunft des Prinzen hektisch ein roter Teppich wie ein Rollrasen ausgebreitet, die zickigen Schwestern Clorinda und Tisbe versuchen, sich gegenseitig bis hin zur handfesten Prügelei auszustechen. Am Ende erscheinen sie mit opulenten Hüten, mit denen sie auch beim Ascot-Derby eine gute Figur gemacht hätten.

Der Kammerdiener Dandini, der zwecks Täuschung in die Rolle des Prinzen schlüpft, gibt sich als smarter Dandy. Und Don Magnifico, vom Prinzen zum Kellermeister ernannt, ist an Selbstgefälligkeit kaum zu übertreffen. Hoehn zeichnet alle Figuren in ihrer ganzen Absurdität punktgenau, ohne sich in die Klamotte zu verirren. Nur Angelina ist die einzig menschliche, empfindsame Figur. Bei allen Turbulenzen setzt Hoehn auch immer wieder ruhige Momente, in denen sich Rossinis Musik ungestört und prachtvoll entfalten kann. Hoehn hat da eine gute, ausgefeilte Balance gefunden.
Die Bühnenbilder und die Kostüme von Darko Petrovic unterstützen sehr gelungen das Regiekonzept. Die Schwestern und Don Magnifico haben eigene Zimmer, die wie Puppenstuben oder Schilderhäuschen über die Bühne gefahren werden. Angelina hat nur eine kleine Dachkammer, die an einen Taubenschlag erinnert. Im zweiten Bild ist eine stilisierter Schlosspark zu sehen, der wie ein kleiner Irrgarten wirkt. Wenn die Köpfe immer wieder hinter den Hecken auftauchen und dann wieder verschwinden, unterstreicht das den skurrilen Humor.

Für den Kapellmeister Davide Perniceni ist diese Cenerntola (nach dem „Grafen von Monte Christo“) die zweite eigenverantwortlich einstudierte Produktion in Bremerhaven. Und auch die ist ihm trefflich gelungen. Sein Rossini klingt rhythmisch federnd, funkelnd in den instrumentalen Details und einfach mitreißend, etwa im Finale des 1. Aktes oder bei dem herrlichen Sextett. Zudem ist er den Sängern ein hervorragender Begleiter.
In der Titelpartie kann Gastsängerin Anna Werle mit einem sehr sinnlichen, warm timbrierten Mezzo überzeugen. Ihre Stimme ist nicht riesengroß, aber sehr beweglich und zu feinsten Nuancen fähig. Mit dem finalen Rondo „Nacqui all’affanno“ setzt sie einen Glanzpunkt. Christian Tschelebiew ist der zweite Gast und schöpft die Komik des Don Magnifico in vollen Zügen und mit prachtvollem Bass genussvoll aus. Seine Arie „Sia qualunque delle figlie“ gerät zum Kabinettstückchen. Die bösen Töchter Clorinda und Tisbe werden von Victoria Kunze und Patrizia Häusermann sehr beweglich gespielt und gesungen. Zickenkrieg auf höchstem Niveau.

Auch Christopher Busietta bewältigt die anspruchsvolle Partie des Don Ramiro sehr ansprechend. In der Höhe klingt die Stimme zwar manchmal etwas grell, aber er singt alle Verzierungen sehr sauber. Vikrant Subramanian ist mit seinem wendigen Kavaliersbariton ein attraktiver Dandini. Shin Yeo kann als Philosoph Alidoro den guten Eindruck bestätigen, den er im „Grafen von Monte Christo“ hinterlassen hat. Ein Sonderlob gebührt dem herrlich agierenden, von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Herrenchor. Die unbedingt sehenswerte Aufführung sorgte für begeisterten Jubel des Premierenpublikums.
Wolfgang Denker, 26.12.2019
Fotos von Manja Hermann
CAVALLERIA RUSTICANA / I PAGLIACCI
Premiere am 02.11.2019
besuchte Aufführung: 14.11.2019
Leidenschaft im Altersheim

Das Bühnenbild zu den Opern Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und I Pagliacci („Der Bajazzo“) von Ruggero Leoncavallo wirkt auf den ersten Blick irritierend. Ausstatterin Gudula Martin schuf nicht die Postkartenidylle eines sizilianischen Dorfplatzes, stattdessen erblickt man eine Frau im Rollstuhl, die sich in einem Altersheim mit Meeresblick befindet. Es ist Santuzza, die noch immer unter Albträumen leidet, weil sie sich schuldig gemacht hat durch den Verrat des Liebesverhältnisses von Turiddu und Alfios Frau Lola, der letztendlich zum Tod von Turiddu geführt hat. Als sie im Radio wieder die krächzende Serenade Turiddus hört, rastet sie völlig aus und kann kaum von der Krankenschwester und dem Pfleger gebändigt werden. Auch ein alter Mann am Krückstock geistert im Hindergrund durch die Szene, der sich später als der Gaukler Tonio aus dem „Bajazzo“ entpuppt.

Regisseur Martin Schüler hat für seine Inszenierung einen ungewöhnlichen Ansatz gefunden, der die Ereignisse in „Cavalleria rusticana“ als Rückblick Santuzzas und die im „Bajazzo“ als Rückblick Tonios sieht. Denn auch der hat durch seinen Verrat der Liaison von Nedda, die ihn abgewiesen hat, den Tod Neddas und ihres Liebhabers Silvio verschuldet.
Das Konzept geht glänzend auf, zumindest in der „Cavalleria rusticana“. Beim „Bajazzo“ ist es nicht mehr ganz so zwingend, trägt aber dennoch. Schülers Abwendung vom Folkloristischen und hin zur Atmosphäre eines Psychothrillers ermöglicht tiefe Einblicke in Santuzzas und Tonios Selenzustände, auch wenn manche Emotionen etwas plakativ ausgespielt werden, etwa bei Alfios Racheschwur. Die Geister der Vergangenheit, die sich oft wie in Zeitlupe bewegen und in fahl-blaues Licht getaucht sind, erleben beide als eine Art Albtraum. Gesungen wird eigentlich in italienischer Sprache, nur die Passagen, die Schüler in der Gegenwart des Altersheims verortet, erklingen auf Deutsch. Aber das trägt nicht zur Erhellung bei.

Musikalisch wird pure Leidenschaft beschworen. Marc Niemann kostet am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven, besonders in der „Cavalleria“, die knalligen Effekte der Musik voll aus und musiziert mit breitem Pinselstrich. Aber feinsinnige Details gehen ihm trotzdem nicht verloren.
Die Mezzosopranistin Jadwiga Postrozna als Santuzza ist ein Ereignis. Sie lässt ihre große, kraftvolle Stimme vor Leidenschaft beben und beherrscht souverän die Szene. Eine tolle, aufregende Leistung. Tijana Grujic ist da als Nedda filigraner und bezaubert mit einem leichtfüßig genommenen Vogellied. Patrizia Häusermann gibt sich verführerisch und ist in ihrem roten Kleid und mit der roten Rose fast eine Schwester von Carmen. Brigitte Rickmann als Mutter Lucia wirkt wie eine Mahnerin in einer griechischen Tragödie. Marco Antonio Rivera singt den Turiddu und den Canio mit kraftvollem und ausgesprochen schön timbrierten Tenor. Auch Marian Pop verkörpert zwei Figuren, den Alfio und den Tonio. Mit seinem erzenen Bariton gibt er beiden Rollen ein nachhaltiges „Schurkenprofil“.

In weiteren Rollen überzeugen Vikrant Subramanian als smarter Liebhaber Silvio und MacKenzie Gallinger mit einem schönen Ständchen des Harlekin. Ein besonderes Lob gebührt dem von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Chor, der etwa den Frühlingschor in „Cavalleria“ einfach prachtvoll singt.
Wolfgang Denker, 15.11.2019
Fotos von Manja Herrmann
DER GRAF VON MONTE CHRISTO
Premiere am 21.09.2019
Klassisches Abenteuer

Man könnte fast glauben, dass das Stadttheater Bremerhaven die heimliche Musical-Hauptstadt Deutschlands ist. Seit 2013 wird dort die Spielzeit mit einem Musical eröffnet, damals mit „Singin’ in the rain“. Es folgten „West Side Story“, „Anything goes“, „Dracula“, „Zorro“ und „Sunset Boulevard”. Aber auch bevor das Musical am Anfang der Saison stand, gab es dort maßstäbliche Produktionen. Ihnen allen war gemeinsam, dass die Inszenierungen aufwändig, sorgfältig und mitreißend gestaltet sowie erstrangig besetzt waren. Da gab es nie eine Enttäuschung - die Qualität der Musical-Aufführungen begeisterte und überzeugte. Das gilt auch uneingeschränkt für die diesjährige Produktion Der Graf von Monte Christo (nach Alexandre Dumas dem Älteren) aus der Feder von Frank Wildhorn. Die Uraufführung fand 2009 statt. Von Wildhorn stammen neben „Jekyll & Hyde“ auch die Musicals „The Scarlet Pimpernel“ und „Dracula“, die beide schon in Bremerhaven zu sehen waren.

Die Handlung ist bekannt: Der Seemann Edmond Dantès wird auf Grund eines Komplotts vierzehn Jahre auf einer Insel unschuldig eingesperrt. Seine Verlobte Mercédès heiratet inzwischen den Übeltäter Mondego, weil ihr gesagt wurde, Dantès sei tot. Der kann aber fliehen, findet einen Schatz und kehrt als reicher Graf von Monte Christo über Rom nach Paris zurück, um sich zu rächen.
Das ist eine ideale Vorlage für einen abwechslungsreichen Abenteuer-Bilderbogen. Regisseur Felix Seiler hat alle Chancen des Stoffes optimal genutzt. Seine Inszenierung ist temporeich und spannend. Die wechselnden Schauplätze der oft kurzen Szenen gehen Dank der Drehbühne nahtlos ineinander über. Die Bühnenbilder und die Kostüme (beides von Hartmut Schörghofer) sind von überwältigender Opulenz.

Auch der Einsatz von großflächigen Projektionen ist gelungen: Ein altes Segelschiff, das aufgewühlte Meer, die Sicht auf das römische Capitol oder die in Morgenrot getauchten kahlen Bäume bei der Duell-Szene - Bilder von pittoresker Schönheit. Hinzu kommen die vielen, von Andrea Danae Kingston choreographierten und bestens in die Aktionen integrierten Tanzeinlagen sowie die furiosen Kampf- und Fechtszenen, die Jean-Loup Fourure eingerichtet hat.
Zur Musik muss man sagen, dass Frank Wildhorn kein Frederick Loewe, Leonard Bernstein oder Cole Porter ist. Die musikalische Decke dieses Musicals ist vergleichsweise insgesamt etwas dünner, denn der Duktus der vielen Balladen ist doch oft ähnlich. Gleichwohl gibt es eine paar eindringliche Duette, einen hübschen Walzer und in den dramatischen Szenen durchaus Spannung. Und die fesselnde Inszenierung, der leidenschaftliche Totaleinsatz der Sängerinnen und Sänger sowie des machtvoll auftrumpfende Chor (Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández) machen dieses kleine Manko mühelos wett.

In der Titelrolle begeistert Vikrant Subramanian einmal mehr. Das Genre Musical scheint ihm besonders zu liegen, wie er schon mit seinen herausragenden Leistungen etwa in „Zorro“, „Sunset Boulevard“ oder „Maria de Buenos Aires“ bewiesen hat. Die Figur des Edmond Dantès verkörpert er perfekt. Seine Liebe zu Mercédès, seine Verzweiflung und sein unerbittlicher Entschluss zur Rache finden in ausdrucksvollem Gesang und in sehr präsenter Darstellung ihren Niederschlag. Wie er allein auf der in blutrotes Licht getauchten Bühne steht und seine Racheschwüre herausschleudert, ist grandios. Subramanians Identifikation mit der Figur des Edmond Dantès könnte nicht eindrucksvoller sein. Ihm zur Seite steht Anna Preckeler als Mercédès. Auch sie verfügt über eine starke Ausstrahlung und eine kraftvolle Stimme, mit der sie ihre Balladen und Duette ansprechend gestaltet. Was ihr an Lieblichkeit etwas abgeht, ersetzt sie durch emotionalen Ausdruck. Die Duette „Niemals allein“ und „Jeder Tag ein kleiner Tod“ zwischen ihr und Subramanian gelingen sehr anrührend und zählen zu den besten Nummern des Stücks.

Das Schurkentrio ist rollendeckend besetzt. Shin Yeo, der neue Bassist des Bremerhavener Theaters, gibt als Villefort mit profunder, runder Tiefe einen tollen Einstand. Marco Vassalli ist der schmierige Mondego und MacKenzie Gallinger der habgierige Baron Danglars. Er verkörpert auch den Abbé Faria, der Edmond während seiner Gefangenschaft unterrichtet und ihm den Weg zu dem Schatz weist. Victoria Kunze zieht bei der Episode auf dem Piratenschiff als Kapitänin Luisa Vampa alle Register der drastischen Komik. Sie singt auch die Valentine. Sie und Christopher Busietta als Albert geben ein schönstimmiges, jugendliches Liebespaar ab.
Für Drive und Tempo sorgt Davide Perniceni am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven. Nicht zuletzt auch ihm ist die enthusiastische Begeisterung zu danken, mit der das Publikum diese Premiere aufgenommen hat.
Wolfgang Denker, 22.09.2019
Fotos von Heiko Sandelmann
Mariechen von Nimwegen
Premiere: 08.06.2019
besuchte Vorstellung: 27.06.2019
Gelungene Symbiose
Lieber Opernfreund-Freund,
das Martinů-Jahr 2019 – der Tod des hierzulande noch immer viel zu selten gespielten tschechischen Komponisten jährt sich heuer zum 60. Mal – ist auch für die hiesigen Opernhäuser Anlass genug, seine Werke auf den Spielplan zu setzen. Ehe in der kommenden Saison die Oper Frankfurt seine Juliette und die Staatsoper Hannover die Griechische Passion zeigt, macht zum Spielzeitabschluss 2018/19 das Stadttheater Bremerhaven den Anfang und spielt Teile seiner Marienspiele und damit gelingt eine echte Entdeckung.
1923 hatte es Martinů nach Paris gezogen, dessen avantgardistische Kunstszene eine große Faszination auf ihn ausübte. Doch nach und nach nahm er mehr und mehr tschechisches Lokalkolorit in seine Arbeiten mit auf, was sich auch in seinen vier Kurzopern zeigt, die er 1935 zu den Marienspielen zusammenfasst und die neben dem in Bremerhaven gezeigten Prolog und dem auf einer flämischen Legende basierenden Mariechen von Nimwegen noch das mährische Weihnachtsspiel Die Geburt des Herrn und Schwester Pasaclina nach einer spanisch-französischen Vorlage umfasst. Sein tonaler Kompositionsstil ist zwar immer wieder von spannungsgeladenen Dissonanzen durchzogen, lässt aber ebenso sehr seine tschechische Seele aufblitzen. Dies zeigt sich in diesem Werk, das wie eine Mischung aus Oratorium, Oper und Theaterstück daherkommt (in Bremerhaven übernimmt der junge Schauspiel Marc Vinzing die Rolle des erzählenden Prinzipals, spielt frisch und versiert und zeigt umwerfende Bühnenpräsenz), besonders deutlich. Der Prolog erzählt das biblische Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, ist im Wesentlichen ein Chorwerk von monumentaler Wucht mit einzelnen solistischen Einlagen. Mariechen von Nimwegen berichtet dann von dem Mädchen Mariken, das sich im Wald verläuft, dort ausgerechtet auf den Teufel trifft und seiner Verführungskunst erliegt. Sie folgt ihm, lebt sieben Jahre mit ihm ein sündiges Leben, ehe ein biblisches Theaterstück sie bereuen und auf den Pfad der Tugend zurückkehren lässt.
Hauschef Ulrich Mokrusch zeichnet für die szenische Umsetzung dieser Rarität verantwortlich und zieht gleich zu Beginn alle Register. Die biblische Geschichte des Prologs lässt er effektvoll vom zu Anfang im Rang postierten Chor erzählen, ehe die Türen im Parkett aufschwingen und die Sängerinnen und Sänger sich im Saal, rechts und links des Publikums aufstellen. So entsteht ein wahrlich raumfüllender Klang, die „Verkündigung“ hat gleichsam etwas Erhabenes und der stark an ein Oratorium erinnernde Teil des Abends kommt so besonders zu Geltung. Für die Geschichte von Mariechen dann haben Okarina Peter und Timo Dentler, die auch für die dezenten Kostüme verantwortlich zeichnen, einen herabsenkbaren Bühnenboden ersonnen, durch den am Anfang von oben wie durch eine Tennenboden in einer Scheune das Licht fällt. Abgesenkt wird der Boden von Dutzenden Stahlseilen gehalten, die der Konstruktion etwas Filigranes geben und gleichzeitig die Waldkulisse für den Beginn der Erzählung sind. Die ausgezeichnete Personenführung und die eindrucksvollen Licht-und-Schattenspiele schaffen eine ruhige Erzählweise, die herrlich überzeichnete Kostümierung des Bibelspiels steht dazu in gelungenem Kontrast. In genialer Weise werden die verschiedenen Oratorien-, Schauspiel- und Opernteile so ineinander verwoben, dass ein eindrucksvoller Abend entsteht, der umso mehr neugierig macht auf die in Bremerhaven nicht gezeigten Teile der Marienspiele.
Die Sängerinnen und Sänger sind, wie der eingangs schon erwähnte Schauspieler Vinzing, allesamt wie gemacht für ihre Rollen. Victoria Kunzes Mariechen ist eine Frau, die der teuflischen Versuchung naiv erliegt, sich aber nach Jahren der Unterdrückung befreit. Das macht die gebürtige Bambergerin sicht- und hörbar mit ihrem großen darstellerischen Talent und einem farbenreichen Sopran, der alle Facetten ihrer Figur perfekt ausleuchtet. Die Partie des Teufels hat Martinů nicht in die Hände eines Baritons oder Basses gelegt, sondern eine Tenorpartie ersonnen, die Vikrant Subramanian mit heller, glanzvoller Stimme gestaltet. Patrizia Häusermann war mir schon als Törichte Jungfrau im Prolog aufgefallen mit ihrem Wärme verströmenden, ausdrucksstarken Mezzo. So ist auch die Partie der Muttergottes im zweiten Teil bei ihr in den besten Händen. Der Opernchor vollbringt Großes an diesem Abend, auch wenn gerade beim Gesang von der Galerie deutlich wird, dass die Damenstimmen nicht perfekt austariert sind. Ähnliches ist bei den Herren nicht zu beklagen, die singen und spielen fein aufeinander abgestimmt die umfangreiche Partie.
Unter der musikalischen Leitung des jungen Ektoras Tartanis, seines Zeichens 1. Kapellmeister am Haus, kann die Partitur Martinůs in all ihrer Pracht und all ihren Facetten funkeln. Der aus Griechenland stammende Dirigent lässt den an tschechisches Volksliedgut erinnernden Passagen ebenso viel Raum wie den kontrastreicheren, schroffen Passagen des Werkes, setzt gekonnt Akzente und so wird es ein extrem sehens- und hörenswerter Abend, der leider schon nach 80 Minuten endet. Das Publikum im nahezu voll besetzten Haus ist zu Recht begeistert und feiert die Entdeckung dieses außergewöhnlichen Werkes mit lang anhaltenden Ovationen.
Ihr Jochen Rüth 29.06.2019
Bilder siehe unten Premierenbesprechung
Martinu
MARIECHEN VON NIMWEGEN
Premiere am 8.6.2019
Holzschnittartiges Mysterienspiel

Bohuslav Martinů schuf seine „Marienspiele“ 1934. Sie bestehen aus den vier Kurzopern „Prolog. Die klugen und törichten Jungfrauen“, „Mariechen von Nimwegen“, „Die Geburt des Herrn“ und „Schwester Pascalina“, von denen das Stadttheater Bremerhaven die beiden ersten Teile in einer eindrucksvollen Produktion zum Abschluss der laufenden Spielzeit in deutscher Sprache herausbrachte.
Der Prolog greift ein Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium auf: In Erwartung des Bräutigams haben die klugen Jungfrauen nicht nur ihre Öllampen sondern auch Öl mitgenommen, während die Lampen der törichten Jungfrauen schnell erlöschen. Regisseur Ulrich Mokrusch hat dazu lediglich das Bild „Der Sturz der gefallenen Engel“ von Pieter Brueghel dem Älteren auf den Zwischenvorhang projizieren lassen, während der Chor vom Rang und von den Seitengängen singt. Das Ergebnis ist ein reizvoller und intensiver Raumklang, der vom Opernchor, dem Extrachor und dem Philharmonischen Orchester unter Ektoras Tartanis in beeindruckender Vielfalt realisiert wird.

In dem sich ohne Pause anschließenden zweiten Teil suggerieren die Ausstatter Okarina Peter und Timo Dentler zunächst eine geheimnisvolle Waldstimmung. Fast wartet man auf Rotkäppchen und den Wolf, aber es sind Mariechen und der nicht weniger gefährliche Teufel, die hier in Erscheinung treten. Zunächst leistet Mariechen Widerstand, aber nach einer längeren Hetzjagd und dem mit Schmuckgeschenken verstärkten Versprechung eines lustvollen Lebens sinkt sie ihm in die Arme. Rote Herzchen regnet es dabei auf die Bühne. Nach der Legende soll Mariechen sieben Jahre mit dem Teufel zusammengelebt und dabei alle Sünden ausgekostet haben. Ausgerechnet die Darbietung eines Jahrmarkttheaters, bei dem in ironisch-tollpatschiger Weise eine Art Passionsspiel aufgeführt wird, bringt Mariechen wieder auf den rechten Weg.
Mokrusch setzt in seiner sehr unterhaltsamen Inszenierung auf die Elemente des Volkstheaters, nicht zuletzt unterstrichen durch den von Marc Vinzing verkörperten Erzähler und Mahner. Die religiösen Aspekte dieses Mysterienspiel werden da eher zweitrangig. Aber Mariechens Schicksal vollzieht sich ohnehin eher holzschnittartig und weniger psychologisch motiviert.

Als Mariechen ist Julia Bachmann eingesprungen und hat sich die Partie in kürzester Zeit so perfekt und überzeugend angeeignet, dass keine Wünsche offen bleiben. Mit leuchtendem Sopran und sehr präsenter Darstellung steht sie im Mittelpunkt. Aber auch Vikrant Subramanian gibt mit schlankem Bariton einen smarten, eleganten Teufel ab. In dem Jahrmarktsspiel agieren Leo Yeun-Ku Chu als Christus, Patrizia Häusermann als seine Mutter und MacKenzie Gallinger als Teufel Maskaron mit dezenter Komik.
Die wunderbare und ausdrucksvolle Musik von Bohuslav Martinů, die zwischen böhmischer Folklore und Anklängen an Dvořrák und Janáček pendelt, ist bei Ektoras Tartanis und dem Philharmonischen Orchester in den besten Händen. Wieder einmal ist dem Stadttheater eine veritable Entdeckung zu verdanken.
Wolfgang Denker, 9.6.2019
Fotos von Manja Herrmann
MARIA DE BUENOS AIRES
Premiere am 27.04.2019
Eine eigene Welt voller Poesie und Mystik
Was für ein Abend! Schauspiel, Gesang und vor allem Tanz finden sich in Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla zu einem inspirierenden Kunstwerk zusammen. Hausherr Ulrich Mokrusch und Ballettchef Sergei Vanaev haben gemeinsam inszeniert. Herausgekommen ist eine beglückende Mischung aus Poesie, Melancholie und Mystik, bei der man in eine ganz eigene Welt, die vom Tango geprägt ist, geradezu hineingesogen wird.

Astor Piazzollas Werk Maria de Buenos Aires trägt die Bezeichnung „Operita“. Es wurde 1968 in Buenos Aires uraufgeführt und kam 1999 erstmals nach Deutschland. Inzwischen hat es auch hierzulande einen festen Platz im Repertoire gefunden. Eine richtige Oper ist „Maria de Buenos Aires“ allerdings nicht, auch kein reines Tanzstück. Vielmehr wird versucht, dem Mythos „Tango“ in einer Art poetischer Erzählung mit Musik nachzuspüren. Das Libretto von Horacio Ferrer ist gespickt mit Metaphern und Symbolen. Die Titelfigur Maria steht für die Inkarnation des Tangos und der Stadt Buenos Aires. Maria war die große Liebe von El Duende, dem Geist. Der beschwört die Erscheinung Marias und erzählt in zeitlichen Sprüngen ihre Geschichte: ihren Abstieg in die Prostitution, ihren Tod und ihre Wiederkehr als Schatten. Der Schatten bringt schließlich ein Mädchen zur Welt - eine neue Maria. Dazwischen gibt es viele skurrile Episoden mit Dieben, Hurenmüttern, Marionetten oder dem „Zirkus“ der abstrusen Psychoanalytiker.

Geprägt ist die Aufführung besonders von der Handschrift Sergei Vanaevs. In seiner Choreographie wird nicht einfach nur Tango getanzt Mit seinen zehn Tänzerinnen und Tänzern findet er immer neue Konstellationen und immer neue Spannungsbögen. Mal wirbeln sie voller Leidenschaft, bis hin zu fast akrobatischem Einsatz, über die Bühne, mal gibt es innige Momente, bei der die Welt scheinbar zum Stillstand kommt. Das ist ausdrucksvolles Tanztheater in Perfektion. Und immer ist Maria der Mittelpunkt. Das ist so geschickt gemacht, dass Patrizia Häusermann, die die Maria verkörpert, sich nahtlos in das Tanzensemble einfügt. Und stimmlich ist sie mit ihrem dunklen, sinnlichen Mezzo ohnehin ein Ereignis. Da wird jede Nuance, jede Farbe ausgekostet.

Benno Ifland ist als El Duende eine charismatische Persönlichkeit, die durchgehend fesselt. Und er verfügt über eine wunderbare, geradezu melodische Diktion. Vikrant Subramanian trifft als La Voz de un Payador (Stimme eines Sängers) mit seinem schlanken Bariton den Stil seiner Lieder punktgenau.
Mokrusch lässt die 17 Szenen mit dezentem Einsatz der Drehbühne und sinnvollen Lichtstimmungen nahtlos ineinander übergehen. Der Bogen ist dabei von der rituellen Beerdigung Marias bis zur burlesken Szene der wie Clowns agierenden Psychoanalytiker weit gespannt. Die Seiten der von Darko Petrovic gestalteten Bühne wirken wie ein aufgeklapptes Bandoneon, stehen aber auch für Häuserfronten mit Türen und Fenstern. Das echte Bandoneon wird einfühlsam von Lothar Hensel gespielt, der in diesem Fall Primus inter Pares bei den elf Musikern des Bremerhavener „Tango-Orchesters“ ist.

Die beschwören unter der Leitung von Ektoras Tartanis die Klangwelt von Astor Piazzollas wunderbarer Musik mit subtilen Feinheiten, aber auch mit viel Schwung absolut authentisch. Ein Abend, der süchtig machen kann.
Wolfgang Denker, 28.04.2019
Fotos von Manja Herrmann
GIER NACH GOLD - MCTEAGUE
Premiere am 23.03.2019
Vorsicht vor Zahnärzten!

Barbiere und Ärzte gibt es durchaus auf der Opernbühne (etwa bei Rossini, Cornelius und Berg) - aber Zahnärzte? Die gibt es sehr wohl, zumindest seit der Uraufführung der Oper McTeague von William Bolcom, die 1992 in Chicago erfolgte. Die Oper brauchte etliche Jahre, um den Weg nach Europa zu finden. Sie wurde unter dem Titel Gier nach Gold -McTeague erstmalig 2016 in Linz gespielt. Dort wurde sie als „weltweit erste und einzige Zahnarzt-Oper“ angekündigt. Das Stadttheater Bremerhaven sicherte sich nun die deutsche Erstaufführung.
Der Stoff beruht auf dem gleichnamigen Roman von Frank Norris, der 1899 veröffentlicht wurde und den Erich von Stroheim gut zwanzig Jahre später verfilmt hatte. Dauer des Films: mehr als acht Stunden. Ganz so lang ist die Oper von William Bolcom nicht, die er auf ein Libretto von Arnold Weinstein und Robert Altman (auch ein berühmter Filmproduzent) geschrieben hat. Hier genügen zweieinhalb Stunden, um den Aufstieg und Untergang des Zahnarztes McTeague zu schildern.

Die Handlung spielt um 1900 in San Francisco. Der große Goldrausch ist gerade vorüber, zeigt aber noch seine Nachwirkungen. McTeague hat es vom Goldminenarbeiter zu einem anerkannten Zahnarzt mit einer eigenen Praxis gebracht. Als „Firmenschild“ hängt ein riesiger goldener Zahn vom Schnürboden herab. McTeague verliebt sich in seine Patientin Trina, die eigentlich mit McTeagues Freund Schouler verbandelt ist. Der verzichtet aber großzügig. Erst als Trina einen Lotterie-Gewinn von 5000 Dollar in Gold erzielt, ist sie wieder interessant für Schouler. Und so sinnt er auf Rache. Er hetzt dem Zahnarzt das Gesundheitsamt in die Praxis. Denn McTeague hat weder ein Diplom noch eine Lizenz. Das hat fatale Folgen: Die Praxis wird geschlossen. McTeague verarmt und wird Tagelöhner. Seine Frau Trina hat ein geradezu pathologisches Verhältnis zum Geld entwickelt und ist nicht bereit, ihren Mann zu unterstützen. Geiz ist eben geil, wie ein Medienkonzern immer in seiner Werbung behauptet hat.
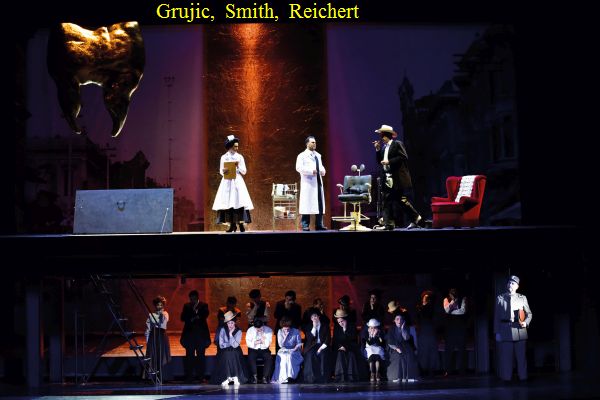
Es kommt zum Streit. McTeague bringt Trina um und flieht mit dem Gold in die Wüste von Nevada. Dort trifft er wieder auf Schouler, der mit McTeagues ehemaliger Putzhilfe Maria seinerseits auf trügerischer Goldsuche ist. Um McTeague dem Sheriff auszuliefern, kettet Schouler ihn mit Handschellen an sich. Aber McTeague tötet auch seinen ehemaligen Freund. In sengender Sonne und fernab von der nächsten Wasserquelle ist damit auch sein Schicksal besiegelt.
Regisseur Matthias Oldag, der in Bremerhaven schon für eine fulminante Inszenierung von Menottis „Konsul“ gesorgt hatte, ist mit McTeague wieder ein Volltreffer gelungen. Auf einem Hintergrundprospekt sind mal San Franciscos Straßen mit Oldtimern zu sehen, dann ist es wieder der rissige, trockene Boden der Salzwüste, von eine roten Sonnenscheibe erbarmungslos beschienen. Die Bühne (von Susanne Richter) wird in zwei Ebenen genutzt - oben die Zahnarztpraxis, unten das Wartezimmer. Für die Hochzeit wird ein ausgelassenes Bankett inszeniert, in das der Lotterie-Bote wie ein Wesen aus einer anderen Welt hereinplatzt.

Mit ironischem Augenzwinkern ist die Jahrmarktsszene mit Luftballons, einem „Hau den Lukas“ und (als Bezug zu Bremerhaven) einem Eisbären ausgestattet. Die Handlung wird als Rückblick erzählt. Gleich zu Beginn sieht man den verzweifelten McTeague in der Wüste. Diese Wüstenszenen werden wiederholt eingeschoben. Das Finale mit den schicksalhaft aneinander geketteten Männern hat etwas von einer antiken Tragödie. Die Charaktere der Protagonisten werden von Oldag sehr treffsicher und mit feiner Differenzierung gezeichnet. Vor allem Trinas Abdriften in eine besondere Form des Wahnsinns wird sehr deutlich.
Die Musik von Willuiam Bolcom ist durchweg unterhaltsam. Da gibt es Anklange an Puccini, Strauss, Britten und andere. Elemente der Filmmusik, des Jazz, des Ragtime und des Musicals mischen sich zu einer gut verträglichen Melange. Die Musik beim Hochzeitsbankett ist ausgesprochen schmissig und geht unmittelbar in die Beine. Vor allem im zweiten Teil gewinnt Bolcoms Komposition immer mehr an Eigenprofil, etwa in Trinas „Wahnsinnsarie“ oder dem Finale voller dramatischer Schlagkraft. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven sorgen dafür, dass niemals Langeweile aufkommt.

Für die Titelpartie wird ein Sänger benötigt, der auch heldentenorale Ansprüche erfüllen kann. Die Uraufführung wurde immerhin von Ben Heppner gesungen, und in Linz war ursprünglich Stephen Gould vorgesehen. Mit James Allen Smith steht in Bremerhaven ein Sänger zur Verfügung, der die besten Voraussetzungen für die viel Kraft fordernde Partie mitbringt. Smith singt sie mit beeindruckender Intensität. Aber auch Bariton Marek Reichert kann da als Schouler durchaus mithalten. Tijana Grujic vollbringt als Trina darstellerisch und gesanglich eine Glanzleistung. Und Patrizia Häusermann gibt der Maria nachdrückliches Profil.
Wolfgang Denker, 24.03.2019
Fotos von Manja Herrmann
William Bolcom

gehört zu den bei uns fast nie gespielten tollen amerikanischen Komponisten Bolcom, der immerhin den Pulitzer Preis für Musik bekam! Es ist nicht hoch genug zu bewerten, daß der Intendant des Stadtheaters Bremerhaven Ulrich Mokrusch endlich dieses lohnenswerte Werk ausgräbt und sich damit ums Musiktheater ernsthaft verdient macht, während seine Intendantenkollegen landauf landab in stupider Ignoranz und Langeweile uns mit den immergleichen Werken auf dem Spielplänen langweilen. Bravo! Wir haben einige Links gelegt, damit Sie, verehrte Opernfreund diesen großen Komponisten endlich kennenlernen und die Kritik von unserem Wolfgang Denker vielleicht zum Anlaß nehmen für eine Opernreise nach Bremerhaven. Wer weiß ob man dieses Werk überhaupt noch einmal sonst sieht. Für diese grandiose fulminante Inszenierung, diese mutige Entdeckung und auch hervorragende Umsetzung müssen wir den OPERNFREUND STERN vergeben.
TRAILER der Linzer Produktion 2016
Songs mit der großartigen Joan Morris - Bolcom persönlich am Klavier
Violin Concerto in D
Highlights der Oper A view from the bridge - Opera Rom
DIE HERZOGIN VON CHICAGO
Premiere am 09.02.2019
Pralles Vergnügen mit schmissiger Musik und viel Tanz
 Die Operetten „Gräfin Mariza“ und „Die Csárdásfürstin“ sind die Werke von Emmerich Kálmán, die jeder kennt und liebt. Auch „Die Zirkusprinzessin“ und die „Zigeunerliebe“ tauchen immer mal wieder in den Spielplänen auf. Aber Kálmán hat über zwanzig Operetten geschrieben, darunter auch die im Jahr 1928 entstandene Tanz-Operette Die Herzogin von Chicago. Auch sie findet in letzter Zeit zwar wieder mehr Beachtung (etwa in Produktionen am Deutschen Theater in München oder an den Opernhäusern von Leipzig und Regensburg), gleichwohl ist diese Operette immer noch eine Rarität. Das Stadttheater Bremerhaben präsentiert das Werk nun in einer rundum vergnüglichen Produktion.
Die Operetten „Gräfin Mariza“ und „Die Csárdásfürstin“ sind die Werke von Emmerich Kálmán, die jeder kennt und liebt. Auch „Die Zirkusprinzessin“ und die „Zigeunerliebe“ tauchen immer mal wieder in den Spielplänen auf. Aber Kálmán hat über zwanzig Operetten geschrieben, darunter auch die im Jahr 1928 entstandene Tanz-Operette Die Herzogin von Chicago. Auch sie findet in letzter Zeit zwar wieder mehr Beachtung (etwa in Produktionen am Deutschen Theater in München oder an den Opernhäusern von Leipzig und Regensburg), gleichwohl ist diese Operette immer noch eine Rarität. Das Stadttheater Bremerhaben präsentiert das Werk nun in einer rundum vergnüglichen Produktion.
Die Handlung der Die Herzogin von Chicago folgt dem üblichen Operetten-Schema: Erste Verliebtheit, dann Krach, Missverständnis und Trotzreaktionen und schließlich das unvermeidliche Happy End. Hier ist es die amerikanische Milliardärstochter Mary Lloyd, die mit ihren überdrehten Freundinnen eine Wette abgeschlossen hat: Wer das kauft, was für Geld am schwersten zu haben ist, gewinnt.

Sie trifft auf Sándor Boris, den Erbprinzen des verarmten Phantasielandes Sylvarien, und möchte mit ihm tanzen. Musikalisch steht sie aber für Charleston und Slowfox, er hingegen für Walzer und Csárdás. Dieser Wettstreit, das eigentliche Thema der Operette, bleibt unentschieden. Um ihre Wette zu gewinnen, kauft sie das Schloss des Prinzen und will ihn gleich als Dreingabe. Dazu wird sie noch schnell zur Herzogin von Chicago erhoben. Als Sándor von der Wette erfährt, will er sich zum Trotz mit der reizend lispelnden Prinzessin Rosemarie verloben. Die hat aber längt mit James Jonny Jacques Bondy angebandelt, dem Sekretär von Mary. Damit die Liebenden doch noch zusammenfinden, wird ein Hollywood-Regisseur wie ein Deus ex machina herbeigezaubert, der die (natürlich dann glücklich endende!) Geschichte der beiden verfilmen will.
Kálmán hat für dieses unterschätzte Werk eine durchweg schmissige Musik geschrieben, deren beste Nummern auch durchaus in der „Gräfin Mariza“ ihren Platz haben könnten, wie das sentimentale Lied „Wiener Musik“ oder die Buffo-Duette. Und für die amerikanischen Rhythmen (die natürlich mit Jazz nichts zu tun haben) hat Kálmán eine reizvolle, damals moderne Tonsprache gefunden.

Vor allem ist die Musik aber durchgehend so temperamentvoll, dass ständig und furios getanzt wird. Dem Dirigenten Hartmut Brüsch und dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven ist der Spaß an dieser Musik in jedem Takt anzumerken, so schwungvoll und mitreißend kommt sie daher. Aber dass Kálmáns Herz doch etwas mehr für Walzer und Csárdás schlägt, ist auch zu spüren.
Die Inszenierung von Felix Seiler glänzt durch eine schier überbordende Lebendigkeit. Gleichberechtigt ist daneben aber auch die Choreographin Andrea Danae Kingston zu nennen. Was sie aus dem Ballettensemble, aber auch aus den Sängern an tänzerischen Aktionen herausholt, ist mehr als beeindruckend. Regie und Choreographie gehen hier Hand in Hand und sorgen für ein fast dreistündiges, pralles Vergnügen. Die vielen kleinen und liebevoll erdachten Details bis hin zu den mit Petrus tanzenden Engeln und den auf Knien herumwuselnden „Kindern“ kann man gar nicht alle aufzählen. Auch das mit zwei Ebenen arbeitende, stimmungsvolle Bühnenbild sowie die farbenprächtigen Kostüme, beides von Barbara Bloch, sorgen für optischen Genuss.

Dass Regensburg ebenfalls Die Herzogin von Chicago im Programm hat, erwies sich als Glücksfall. Denn der Bremerhavener Tenor Christopher Busietta war indisponiert und konnte die Partie des Sándor nicht singen, wohl aber sprechen und spielen. Für den Gesang sprang Mark Adler aus Regensburg ein und rettete so die Premiere. Beide ergänzten sich perfekt: Adler sang mit höhensicherem Tenor und gefühlvollem Ausdruck, etwa bei „Komm in mein kleines Liebesboot“, die umfangreiche Partie von der Seite, während Busietta prächtig agierte und zum Gesang von Adler sogar die Lippen synchron bewegte. Als Mary überzeugt Tijana Grujic mit ihrem hübschen Sopran und sehr attraktiver Ausstrahlung. Ihr in mehrfachen Variationen wiederholtes Lied „Ein kleiner Slowfox mit Mary“ sticht besonders hervor. Victoria Kunze als Prinzessin Rosemarie und MacKenzie Gallinger als James Bondy sind das ebenso sympathische wie spielfreudige Buffopaar. Am Hof von Sándor sorgen John Wesley Zielmann als Finanzminister und Leo Yeun-Ku Chu als Staatsminister für immer neue, slapstickartige Späßchen. Chu gibt zusätzlich einen überzeugenden Zigeunerprimas ab. Vikrant Subramanian ist Sándors Adjutant und auch der leicht debile König Pankraz von Sylvarien. Und der Chor in der Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández mischt tänzerisch und gesanglich ordentlich mit.
Wolfgang Denker, 10.02.2019
Fotos von Heiko Sandelmann
MADAMA BUTTERFLY
Ambivalente Schuldfrage
Premiere am 25.12.2018
Gemeinhin gilt der amerikanische Marineleutnant Benjamin Franklin Pinkerton in Giacomo Puccinis gefühls- und tränenreicher Oper Madama Butterfly als der skrupellose Lüstling, der nur auf sein Vergnügen aus ist und seine Cio-Cio-San kaltschnäuzig sitzen lässt, während diese das unschuldige Opfer ist. Ganz so simpel sieht es Regisseurin Béatrice Lachaussée in ihrer Inszenierung von Madame Butterfly, die in diesem Jahr als traditionelle Weihnachtspremiere am Stadttheater Bremerhaven herauskam, denn doch nicht. Bei ihr ist die Schuldfrage durchaus ambivalent. Sicher - dass Pinkerton eine fünfzehnjährige Japanerin heiratet mit der Option, dass diese „Ehe“ nur auf Zeit gedacht ist, ist verwerflich. Aber ganz so skrupellos zeichnet sie den Pinkerton nicht. Er hat durchaus Zweifel daran, ob das alles so richtig ist, was er da tut. Das zeigt sich besonders im Liebesduett, bei dem er und auch Butterfly eher scheu und zaghaft agieren. Testosterongesteuert sieht anders aus. Und wenn er im 3. Akt zurückkehrt, um sein Kind zu holen (von dem er ja nichts ahnte) ist seine Reue und Bestürzung durchaus ehrlich.

Butterfly hat zunächst ernsthaft an ihr Glück geglaubt, was man einer fast naiven Fünfzehnjährigen ja auch zugestehen kann. Aber dann begeht sie einen entscheidenden Fehler, indem sie sich gänzlich von ihrer japanischen Kultur lossagt. Sie schwört nicht nur ihrem Glauben ab, was ihr die Ächtung ihrer Familie, verkörpert durch den Onkel Bonzo, einbringt und sie in der Gesellschaft isoliert. Sie gibt sich auch, wie sie meint, ganz als Amerikanerin, trägt ein schickes Kleid und hat ihre Haare blondiert. Dazu hat sie mit Sonnenbrille, Strohhut und Zigaretten genau die Accessoires, die auch Pinkerton bei seinem Auftritt hatte. Sie ist eine genaue Kopie von Pinkertons amerikanischer Frau Kate (Victoria Kunze), wie sich bei deren Auftritt im 3. Akt erweist. Diese Verdoppelung mutet allerdings etwas kurios an, wie auch das effekthascherische Kostüm von Onkel Bonzo. Dadurch, dass Butterfly die Augen vor der Realität schließt und gegen alle Warnungen taub ist, trägt sie auch ein wenig Mitschuld an ihrem Unglück.

Ansonsten kann man die Kostüme und die Bühnenausstattung von Nele Ellegiers als durchaus gelungen bezeichnen. Die etwas karge Optik mit nur ein paar verschiebbaren Wänden im 1. Akt und später mit schmucklosem, in kaltes Neonlicht getauchtem Beton korrespondiert aber mit dem sehr sachlichen Stil der Inszenierung. Lachaussée verzichtet auf jeglichen Kitsch und drückt auch nicht auf die Tränendrüse. Die Taschentücher bleiben trocken, was aber nicht heißt, dass ihre Inszenierung nicht berührt. Denn die Personenführung ist in ihren Details intelligent und ansprechend. Das Ausmaß der Tragödie kommt gut zur Geltung.

Das ist auch den guten sängerischen Leistungen zu danken. In der Titelpartie stellt sich Judith Kuhn mit üppig aufstrahlendem Sopran vor. Ihre Cio-Cio-San begeistert nicht nur in der Arie „Un bel di vedremo“ („Eines Tages seh’n wir“), die sie mit emotionaler Intensität gestaltet, sondern durchweg bis zum erschütternden Schluss. Auch Costa Latsos kann als Pinkerton mit höhensicherem und mühelos über das Orchester strahlendem Tenor überzeugen. Er meistert in der Darstellung den Spagat zwischen Leichtsinn und Reue. Als durch und durch noblen Gentleman gibt Alexandru Aghenie mit hellem Kavaliersbariton den Konsul Sharpless. Patrizia Häusermann zeigt sich als Butterflys Dienerin und Vertrauter Suzuki mitfühlend und gefestigt. Ihr schöner Mezzo kommt in der Partie bestens zur Geltung, besonders im Duett mit Judith Kuhn.

MacKenzie Gallinger ist der schleimige Goro, der in einem Foto-Leporello seine „Damen“ anbietet. Als Onkel Bonzo hat Bassist Leo Yeun-Ku Chu einen imposanten Auftritt. In weiteren Partien bewähren sich u. a. Christopher Busietta als Fürst Yamadori, Róbert Tóth als Kommissär und Jongwook Jeon als Standesbeamter. Für die Einstudierung des wieder gut disponierten Opernchors zeichnet Mario Orlando El Fakih Hernández verantwortlich.
Wie Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven Puccinis Musik mit sinnlicher Klangfülle, aber auch mit viel Sinn für feinste Details umsetzen, hat große Klasse. Das Schwelgen im Klang wird beim Auftritt des Kindes oder bei der Ankunft von Pinkertons Schiff zum Ereignis.
Wolfgang Denker, 26.12.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
DIE ZAUBERFLÖTE
Premiere am 03.11.2018
Papageno bezaubert alle
Die letzte Zauberflöte im Stadttheater Bremerhaven liegt gut dreizehn Jahre zurück. Damals wollte Regisseurin Sibylle Krantz den Focus auf den Machtkrieg zwischen Sarastro und der Königin der Nacht legen. Für die aktuelle Inszenierung zeichnet Roland Hüve verantwortlich, der in Bremerhaven bisher für Operette (Fledermaus, Graf von Luxemburg) und Musical zuständig war und für herausragende Produktionen gesorgt hatte. Unvergessen sind seine Inszenierungen von West Side Story, Crazy For You und vor allem von Singin’ in the Rain. Nun also Oper - dazu noch eine der beliebtesten des Repertoires.

Hüve bezeichnet die Zauberflöte als „Oper aller Opern“ - ein Prädikat, das aber eigentlich für den Don Giovanni vorbehalten ist. Seine Inszenierung fällt gemessen an diesem Anspruch aber ohne tiefschürfende Akzente aus. Auch er stellt den Konflikt zwischen Sarastro und der Königin der Nacht in den Vordergrund. Schon bei der Ouvertüre marschieren beide mit ihrem Gefolge vor dem geschlossenen Vorhang auf. Aber sie sind keine Gegner, sondern verabreden sich zu einer Art Experiment, das sie mit Pamina und Tamino durchführen wollen, dessen Verlauf immer wieder von der Königin der Nacht aus dem Hintergrund beäugt wird. Aber abgesehen von diesem Ansatz, lässt Hüve die Zauberflöte in gewohnten Bahnen abspulen. Seinem Prinzip einer werkgetreuen Inszenierung ohne Verfremdungen ist Hüve auch hier treu geblieben. Die Elemente der Freimaurerei sind dabei allerdings komplett ausgespart. Sarastro und seine Welt sind in der Mozart-Zeit angesiedelt: Perücke, Puder und opulente Kostüme von Dorit Lievenbrück bestimmen den optischen Eindruck. Nur Tamino und Pamina sind heutig - sie ein flotter Teenager mit Pferdeschwanzfrisur, er ein Jüngling in Schlips und Kragen. Die beiden jungen Leute wirken in ihrem Outfit wie Brad und Janet aus der „Rocky Horror Show“, nur dass sie sich nicht in die Welt von Frank N. Furter, sondern in die nicht minder skurrile von Sarastro verirren.

Das nüchterne Einheitsbühnenbild (auch von Lievenbrück) zeigt graue Wände mit rückwärtig freiem Blick auf den Sternenhimmel und einen abgestorbenen Baum. Nur diverse Lichtstimmungen variieren die Szenerie. Hüve inszeniert genau an der Vorlage, ohne Überraschungen, aber auch ohne Willkürlichkeiten. Er erzählt die Handlung geradlinig und schnörkellos. Man bekommt eine eher harmlose, unbeschwerte Version zu sehen, die aber durchaus fesselt und Spaß macht. Da gibt es die „furchterregende“ Schlange am Beginn, da marschieren Sarastros Priester mit viel Pathos auf und der Dolch, mit dem Pamina Sarastro morden soll, schwebt vom Himmel. Trotzdem will der Funke diesmal nicht so recht überspringen. Vieles bleibt zu brav und harmlos. Auch bei den Auftritten der Königin der Nacht hätte man sich etwas mehr effektvollen Bühnenzauber gewünscht. Nur die Bühne etwas hochzufahren reicht nicht. Aber immerhin darf Papageno seine sympathisch-drolligen Späßchen machen. Überhaupt Papageno - diese Figur hat Hüve mit besonderer Liebe und mit viel Charme charakterisiert. Vikrant Subramanian hat in dieser Partie die Sympathien ganz auf seiner Seite und bezaubert alle, seine Darstellung macht einfach Spaß. Er singt und spielt dabei mit viel Witz und überzeugendem Einsatz.

Einen furiosen Eindruck hinterlässt Marie-Christine Haase als Königin der Nacht. Mit herrischem Ausdruck gibt sie der Rolle markantes Profil. Ihre beiden vertrackten Arien serviert sie virtuos und mit einem Feuerwerk an Spitzentönen. Direkt zum Herzen zielt die berührende Darstellung der Pamina durch Tijana Grujic, die ihren schönen Sopran mit Anmut aufstrahlen lässt. Besonders in ihrer g-moll-Arie „Ach, ich fühl’s“ findet sie zu einem bewegenden Ausdruck. Christopher Busietta hat es als Tamino daneben etwas schwer, auch wenn er durchweg eine gute Figur macht. Seinem etwas spröden Timbre mangelt es noch an Schmelz und Wärme. Gleichwohl gestaltet er die Bildnisarie mit viel Ausdruck.
Leo Yeun-Ku Chu ist mit seinem fülligen Bass auch als Sarastro eine sichere Bank und dabei ganz in seinem Element. Er gibt der Partie Würde und Ausstrahlung, in den Dialogen allerdings zuviel hölzernes Pathos. Die Papagena ist bei Victoria Kunze ein kugelrunder Kobold, bevor sie sich als hübsches Mädchen entpuppt. Ihr Duett mit Papageno hat spielerischen Charme. Der nicht schwarz geschminkte, aber ganz in bedrohlichem Schwarz gekleidete Monostatos ist bei MacKenzie Gallinger dank seiner Agilität gut aufgehoben. Er singt auch den Ersten Geharnischten.

Für ordentliche Aktion sorgen die drei Damen gleich zu Beginn bei der Beseitigung der monströsen Schlange. Mit Judith Kuhn, Patrizia Häusermann und Sünne Peters sind sie stimmkräftig besetzt. Gute Ensembleleistungen gibt es auch von Henryk Böhm (Sprecher und Zweiter Geharnischter) sowie Róbert Tóth (Priester). Die drei Knaben Julian Franzius, Jacob von dem Busche und Nicolas Hüchting wurden aus dem Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen rekrutiert und bewähren sich bestens. Das kann man auch über den von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudierten Chor sagen, der seine Aufgaben klangschön erfüllt.
Das Philharmonische Orchester Bremerhaven unter der Leitung von Marc Niemann findet die richtige Balance zwischen weihevollem Pathos und spielerischer Leichtigkeit. Niemann sorgt für eine detailgetreue und ausgewogene Wiedergabe, die der Zauberflöte in jedem Moment gerecht wird. Diese Produktion dürfte, trotz der kleinen Einschränkungen, ein Publikumserfolg werden.
Wolfgang Denker, 04.11.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
SUNSET BOULEVARD
Premiere am 22.09.2018
Realitätsverlust einer alternden Diva

Wenn eine Sache abgeschlossen ist, sagt man oft „Klappe zu, Affe tot”. In der Karriere des einst großen Stummfilmstars Norma Desmond ist die letzte Klappe schon vor langer Zeit gefallen. Nur sie selbst will es nicht wahrhaben, auch wenn sie gerade ihren kleinen Hausschimpansen tränenreich begräbt.
Andrew Lloyd Webbers Musical „Sunset Boulevard“ (nach dem berühmten Film mit Gloria Swanson) führt in das Hollywood der fünfziger Jahre, wo junge Talente auf Arbeits- und Glückssuche sind. Darunter befindet sich auch der total abgebrannte Drehbuchschreiber Joe Gillis, der auf der Flucht vor seinen Gläubigern in der Villa von Norma Desmond landet. Die alternde Diva zwingt ihn geradezu, ihren (grottenschlechten) Drehbuchentwurf zu einem „Salome“-Film zu überarbeiten und vereinnahmt ihn dabei immer mehr. Als sich Joe schließlich zugunsten seiner jungen Kollegin Betty Schaefer aus Normas Fängen lösen will und ihr die ungeschminkte Wahrheit über ihr niemals stattfindendes Comeback ins Gesicht schleudert, wird er von ihr erschossen. In dem Musical erzählt Joe die Ereignisse im Rückblick als „Toter“.

„Sunset Boulevard“ steht etwas im Schatten anderer Werke von Lloyd Webber, nicht zuletzt weil musikalisch wirklich zündende Songs eher sparsam eingestreut sind und die Eingangszenen mit dem retrospektiven Sprechgesang etwas zu lang sind. „Wie immer besteht Lloyd Webbers Partitur nur aus fünf Melodien“, sagt Kapellmeister Ektoras Tartanis, was sicher etwas übertrieben ist. Gleichwohl bietet das Musical eine Story, die stimmig und berührend ist.
Aber das Werk steht und fällt eben doch mit der Besetzung der Norma Desmond und des Joe Gillis. Und da blieben in Bremerhaven mit Sascha Maria Icks uns Vikrant Subramanian keine Wünsche offen. Icks gehört dem Schauspielensemble an und hat z. B. als Edith Piaf begeistert. Stimmlich ist sie nicht unbedingt eine typische „Musical-Röhre“, obwohl sie auch ordentlich aufdrehen kann. Sie singt und spielt dafür aber die Norma Desmond mit feinen, sehr gut austarierten Nuancen. Den Song „Nur ein Blick“ schleudert sie nicht auftrumpfend oder triumphierend-trotzig heraus - bei ihr wird er eher zu einer träumerischen Erinnerung an vergangene Zeiten, ebenso das eindrucksvolle „Träume aus Licht“. Die Attitüde der Diva, die keinen Widerspruch duldet, trifft sie punktgenau. Den fortschreitenden Wahn der alternden Schauspielerin führt sie äußerst überzeugend vor. Und wenn sie sich nach dem Mord in ihr Salome-Kostüm stürzt und sich inmitten von Filmaufnahmen wähnt, kann die Szene schon wohlige Gruselschauer erzeugen. Die Tragik dieser unglücklichen Figur wird mehr als deutlich.

Vikrant Subramanian ist für den Joe eine perfekte Besetzung. Von Anbeginn sind er und die Rolle eins. Seine Gestaltung begeistert durchgängig. Er singt und spielt den verarmten Joe mit burschikoser Leichtigkeit, mit wohldosierter Mischung aus echtem Gefühl und Zynismus („Talent hatte ich letztes Jahr, dieses Jahr habe ich Hunger.“). Mit seinem schlanken Bariton setzt er auch gesangliche Maßstäbe.
Auch Normas Diener Max (der sich später als ihr erster Ehemann und Regisseur Max von Mayerling entpuppt) ist eine tragische Figur. Andrea Matthias Pagani hat mit der Rolle reichlich Erfahrung. Das ist in jeder Phase seiner anrührenden Darstellung spürbar. Hinter seiner scheinbaren Unnahbarkeit verbirgt er seine tiefe Verbundenheit mit Norma und seine Sorge um ihre psychische Zerbrechlichkeit. Patrizia Häusermann bringt als Betty Schaefer sympathische und erfrischende Jugendlichkeit in ihre Rolle. Sehr hübsch gelingt ihr Duett „Denn wir lieben uns viel zu sehr“ mit Joe. Der Chor hat hier überwiegend solistische Aufgaben. Fast jede Sängerin und jeder Sänger übernimmt eine der vielen kleinen Rollen
Die Inszenierung von Ansgar Weigner ist ein Volltreffer. Die überdrehte Filmwelt Hollywoods mit Leo Yeun-Ku Chu als Cecile B. DeMille im Zentrum wird ebenso getroffen wie Normas Einsamkeit in ihrer ehemals prunkvollen, inzwischen etwas heruntergekommenen Villa. Diese ist von Bühnenbildnerin Barbara Bloch (die auch für die stimmigen Kostüme verantwortlich zeichnet) eindrucksvoll und opulent ausgestattet. Mittels Drehbühne und verschiebbaren Wänden werden immer neue Schauplätze imaginiert.

Ironische Tupfer wie die Neueinkleidung von Joe oder die Fitness-Torturen von Norma werden gekonnt gesetzt. Aber vor allem ist Weigner eine feinsinnige Personenführung gelungen, die den Absturz von Norma Desmond beklemmend nachvollziehbar macht. Ballettszenen gibt es nur wenige (Choreographie von Lidia Melnikova), die dann aber schwungvoll und gelungen sind.
Ektoras Tartanis am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven lässt die süffige Musik von Lloyd Webber geradezu aufblühen. Die Widerholungen mancher Motive werden gekonnt aufbereitet. Der konsequent durchgehaltene musikalische Fluss garantiert eine Wiedergabe ohne Brüche oder Stillstand. Eine Eröffnungspremiere, wie sie besser und fesselnder nicht sein könnte.
Wolfgang Denker, 23.09.2018
Fotos von Manja Hermann
DER UNTERMIETER (THE LODGER)
Premiere am 02.06.2018
Opern-Thriller mit wohligem Gruseleffekt

Am Ende der Saison soll man es doch einmal betonen: Das Stadttheater Bremerhaven ist in Sachen Spielplangestaltung vorbildlich. Neben populären Opern (wie in dieser Spielzeit etwa „Rigoletto“ und „Der Liebestrank“) finden sich auch immer eher selten gespielte Werke („Der Konsul“) oder absolute Neuentdeckungen. Diesen Status kann „Der Untermieter“ („The Lodger“) von der britischen Komponistin Phyllis Tate (1911-1987) ohne Einschränkung für sich beanspruchen.
„Der Untermieter“ basiert auf dem 1913 erschienen Roman von Marie Belloc Lowndes, der im viktorianischen London spielt und sich um Jack the Ripper dreht.. Alfred Hitchcock hat ihn als Vorlage für seinen Stummfilm „The Lodger“ (1927) verwendet. Dort allerdings erweist sich der Verdacht gegen den Mieter, dass er in Wirklichkeit Jack the Ripper ist, als falsch. Die Änderung wurde vorgenommen, weil der Hauptdarsteller Ivor Novello keinen Bösewicht spielen wollte. Ein weiterer Film entstand 1944 mit Laird Cregar in der Regie von John Brahm. Der nichtssagende deutsche Titel war „Scotland Yard greift ein“.

Phyllis Tate ließ sich von dem Roman zu ihrer Oper „The Lodger“ inspirieren. Sie wurde 1960 in London an der Royal Academy of Music von Studenten uraufgeführt und geriet danach völlig in Vergessenheit. 1964 entstand allerdings eine Einspielung der BBC u. a. mit Owen Brannigan, Joseph Ward und Alexander Young, die erst 2015 auf CD erschienen ist.
Bremerhaven präsentierte nun nicht nur die deutsche Erstaufführung, sondern hat sehr verdienstvoll auch eine deutsche Textfassung erarbeitet. Aber der Aufwand hat sich in jeder Hinsicht gelohnt, denn „Der Untermieter“ ist ein durch und durch fesselndes Werk mit einer suggestiven Musik, deren Wirkung in der herausragenden Inszenierung von Sam Brown noch gesteigert wird.

Bei dem geheimnisvollen Mieter, der sich im Haus von Emma und George Bunting einquartiert hat, handelt es sich um niemand anderen als Jack the Ripper. Emma ahnt schon bald, wer da in ihrem Haus lebt, aber sie geht nicht zur Polizei. In ihren Augen ist Jack kein Monster, sondern ein Mensch, der ärztliche Hilfe benötigt. Deshalb lässt sie ihn auch am Ende entkommen, weil Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe die wichtigsten Dinge sind.
Regisseur Sam Brown und seine Ausstatterin Julia Przedmojska (Bühne und Kostüme) zaubern äußerst eindrucksvoll die düstere Atmosphäre vom viktorianischen London auf die Bühne. Durch immer neue Anordnungen der kastenförmigen Bühnenelemente wird das Wohnzimmer der Buntings, die Treppe zur Dachkammer des Untermieters, ein Wirtshaus oder eine Straßenansicht gezeigt - alles in stilechter Ausführung. Auch der (dezent eingesetzte) Londoner Nebel darf nicht fehlen. Und Sam Brown sorgt mit seiner Personenführung und Charakterisierung für nie nachlassende Spannung. „Der Untermieter“ ist ein Opern-Thriller mit wohligem, aber keineswegs vordergründigem Gruseleffekt.

Die Musik von Phyllis Tate ist nicht nur durchweg wohlklingend, sondern auch äußerst raffiniert und kunstvoll gearbeitet. Sie nimmt den fließenden Duktus der Sprache unmittelbar auf und erinnert an Britten oder Menotti. Es gibt aber auch Arien, eine Liebesduett zwischen Daisy, der Tochter der Buntings, und dem Polizisten Joe, einen in immer groteskerer Form wiederholten Chor der Betrunkenen (Einstudierung Mario Orlando El Fakih Hernández) mit Hartmut Brüsch als Kneipenpianist und im Finale des 1. Aktes eine umwerfende Ensembleszene. Allein dieses Quintett zeigt schon die Meisterschaft von Tate. Im Orchestersatz verdeutlicht sie im Grummeln der tiefen Streicher die schleichende Bedrohung und Unheimlichkeit. Ektoras Tartanis und das Philharmonische Orchester Bremerhaven setzen diese Musik mit kraftvollen Akzenten und eindringlich um - noch besser als in der CD-Aufnahme der BBC von 1964.

Patrizia Häusermann ist mit ausdrucksstarkem Mezzo als Emma die zentrale Figur. Leo Yeun-Ku Chu beeindruckt mit machtvollem Bass (und hervorragender Diktion) als George, Alice Fuder als Daisy und MacKenzie Gallinger als Joe repräsentieren quasi das Buffo-Paar. Als gespaltener Charakter zwischen oberflächlicher Freundlichkeit und religiösem Wahn bis zur Selbstgeißelung überzeugt Bariton Vikrant Subramanian in der Titelpartie stimmlich und darstellerisch ohne Einschränkung.
Wolfgang Denker, 03.06.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
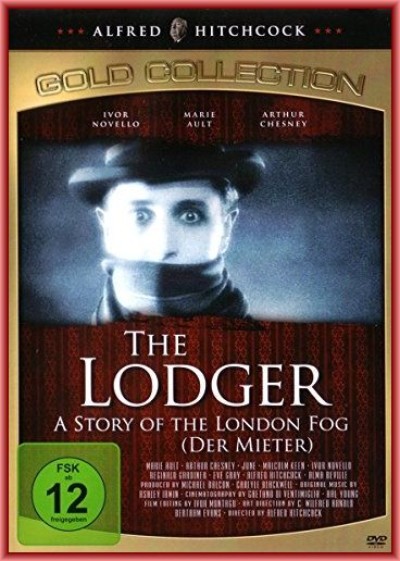

DER LIEBESTRANK
Premiere am 28.04.2018
Von bezaubernder Leichtigkeit

Er hat es - das leichte Händchen für Operetten und komische Opern. Und er hat es in Bremerhaven wiederholt bewiesen, bei „Gräfin Mariza“, bei „Madame Pompadour“, bei „Othello darf nicht platzen“ und (mit kleinen Einschränkungen) auch beim „Vetter aus Dingsda“. Die Rede ist vom Regisseur Ansgar Weigner, dem jetzt mit Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“ („Der Liebestrank“) wieder ein veritabler Volltreffer gelungen ist.
Schon das Bühnenbild von Martin Käser sorgt für gute Laune: Ein Platz in einem italienischen Städtchen mit einer Bar, einer Kirche und einer Autowerkstatt mit dem Namen „Riat“ - alles in vergnüglichen, quietschbunten Bonbonfarben. Wäsche hängt an den über die Gassen gespannten Leinen; und auf dem Platz tummelt sich vom Bäcker und vom Portier bis zum Gärtner und zum Pfarrer die ganze Dorfgemeinschaft.
Nemorino arbeitet in der Autowerkstatt, Gianetta ist die Kellnerin in der Bar. Adina tritt in signalrotem Kleid und mit einem Koffer auf. Sie ist gebildet und belesen und hat, nicht nur durch die Brille, die sie trägt, den Durchblick. Im Programmheft heißt es: „Adina kehrt heim aus der großen, weiten Welt in die Kleinstadtidylle ihrer Jugend.“
Weigner bringt das turbulente Geschehen in dieser Kleinstadtidylle mit bezaubernder Leichtigkeit auf die Bühne. Kleine Gags werden dezent und wohldosiert gesetzt. Die Inszenierung ist durchgängig von wohltuender Frische und Herzlichkeit geprägt und bleibt dabei völlig klamaukfrei, obwohl tatsächlich einmal eine Sahnetorte fliegt. Und auch kleine ironische Tupfer hält Weigner bereit, etwa wenn die Chordamen beim Kuss von Adina und Nemorino verzückt aufseufzen.

Mit viel Liebe zum Detail charakterisiert er die Personen. Herrlich gelingt das bei dem eitlen und narzisstischen Belcore, der trotz aller Selbstgefälligkeit sympathisch bleibt. Dulcamara kommt mit Hornbrille, blonder Mähne und extravagantem Anzug wie ein verkrachter, aber schlitzohriger Intellektueller daher. Nemorino ist alles andere als ein Tollpatsch, aber seine verzweifelte Liebe zu Adina macht ihn anfällig für Dulcamaras Liebestrank-Versprechen.
So vergnüglich wie die szenische Gestaltung, so beglückend fällt auch die musikalische Seite aus. Ektoras Tartanis sorgt am Pult des Philharmonischen Orchesters für lebendigen Schwung. Er begleitet die Sänger sensibel, heizt aber in den Finali auch das Tempo gehörig an.

Der Chor (in der bewährten Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández) präsentiert sich, auch im Spiel, in Bestform. Mit Tijana Grujic steht eine anmutige, selbstbewusste Adina zur Verfügung, die auch stimmlich aus dem Vollen schöpft. Vikrant Subramanian glänzt mit elegantem Bariton und ausgesprochener Spielfreude als Belcore. Für Leo Yeun-Ku Chu ist die Partie des Dulcama ein „gefundenes Fressen“, in der er seine Bassqualitäten und sein komödiantisches Talent bestens zur Geltung bringt. Alice Fuder gibt die Gianetta mit Charme und Präsenz. Aber für das herausragende sängerische Ereignis sorgt Kwonsoo Jeon als Nemorino. Was für ein Tenor! Die Stimme hat einen runden Klang und ein ausgesprochen schönes Timbre. In allen Lagen strömt sie mit ungefährdetem Glanz. „Una furtiva lagrima“ ist natürlich der Höhepunkt, für den es besonders begeisterten Beifall gibt. Aber die Leistung von Jeon ist durch die ganze Partie ohne jegliche Abstriche beglückend. Belcanto vom Feinsten in Bremerhaven!
Wolfgang Denker, 29.04.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
DER KONSUL
Premiere am 17.03.2018
besuchte Aufführung: 24.03.2018
Eine Bürokratie ohne Gnade und Mitleid
Es ist wie bei „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett: Die Titelfigur tritt auch in der Oper „Der Konsul“ von Gian Carlo Menotti nicht in Erscheinung. Dafür entscheidet die eiskalte Sekretärin des Konsuls über das Schicksal der Menschen, die verzweifelt und verfolgt um ein Visum zur Ausreise aus einem nicht näher lokalisierten Polizeistaat ersuchen. „Irgendwo auf der Welt“ ist der Schauplatz dieser Oper. Und Regisseur Matthias Oldag belässt es auch dabei und verzichtet auf jede platte Konkretisierung. Das Thema um Menschen in existentieller Verzweiflung und ihr Scheitern beim Kampf mit einer mitleidlosen Bürokratie ist zeitlos und doch aktueller denn je. „Ihr Name ist eine Nummer, die Geschichte ist nur ein Fall.“ Und hier geht es hauptsächlich um den „Fall“ von Magda Sorel. Ihr Mann John Sorel ist Widerstandskämpfer und will sich über die Grenze absetzen. Seine Frau soll sich die notwendigen Visa für sich, ihr Kind und seine Mutter besorgen und dann nachfolgen. Das Kind stirbt allerdings, ebenso die Mutter. Damit John keinen Grund mehr hat, weiterhin im Land zu bleiben, beschließt Magda sich zu opfern und Selbstmord zu begehen. Dass John schon bereits verhaftet ist, erfährt sie nicht mehr, denn der Anruf der Sekretärin, die plötzlich doch menschliche Empfindungen zeigt, geht ins Leere. Patrizia Häusermann bringt die Rolle mit anfänglicher Eiseskälte und ihrem schneidenden „Nächster!“ auf den Punkt.

Oldag inszeniert das Werk mit bewundernswerter Stringenz und mit einfachsten Mitteln. Für das Heim der Sorels genügt ein Gasherd (dessen Hähne Magda am Ende öffnet, eine Kommode und eine Wiege. Das Konsulat wird durch einen vom Bühnenhimmel schwebenden Schreibtisch symbolisiert, an dem die Sekretärin wie auf einem Thron regiert. Die Bittsteller sitzen auf Stühlen quasi zu ihren Füßen davor. Ansonsten ist die Bühne schneebedeckt, immer wieder fallen Flocken vom Himmel. Die kalte, seelenlose Atmosphäre ist zum Greifen deutlich. Diese simple Ausstattung von Susanne Richter ist von tiefer Wirkung. Mehr braucht es nicht.
Neben Magda gibt es unter anderen noch die verzweifelte italienische Mutter (Tijana Grujic), die zu ihrem todkranken Kind will, den Herrn Kofner (Leo Yeun-Ku Chu mit sattem Bass), dessen Papiere wieder einmal nicht der Form entsprechen, und einen Zauberer (MacKenzie Gallinger mit suggestiver Ausstrahlung), der alle in Trance versetzt und sie für wenige Momente aus der grausamen Realität entführt.

Auch Magdas Albträume holen sie aus der Realität, führen sie aber in eine von Ängsten bestimmte Welt, in der sie um ihren Mann fürchten lässt, der sich im Traum mit der Sekretärin einlässt. Oldag hat diese Szenen in magische Beleuchtungen getaucht, die in ihrer surrealen Wirkung tief beeindrucken. Das gilt auch für den beklemmenden Schluss, bei dem alle Personen sich wie zu einem Totentanz um Magda scharen, während sie das ausströmende Gas einatmet.
Inga-Britt Andersson kann als Magda Sorel alle Schattierungen ihrer Rolle mit ausdrucksvollem Gesang und fein differenziertem Spiel optimal umsetzen. Für ihre Arie am Ende des 2. Aktes bekommt sie spontanen Beifall. Ein grandioses Rollenporträt liefert auch Sünne Peters als Mutter, deren Wiegenlied für das Baby unter die Haut geht. Timothy Sharp ist der gehetzte und doch entschlossen für seine Sache eintretende John Sorel. Dem aalglatten Geheimpolizisten verleiht Daniel Dimitrov schauerliches Profil. In weiteren Rollen komplettieren Alice Fuder als Maria Gomez, Michaela Weintritt als Vera Boronel, Robert Tóth als Sorels Verbindungsmann Assan und Iris Wemme als Rundfunksängerin das hervorragend aufeinander eingespielte Ensemble.

Man hat Menotti auch als „amerikanischen Puccini“ bezeichnet. Tatsächlich erinnert seine Musik oft an diesen. Sie ist effektvoll und geht direkt ins Herz, wie etwa das wunderbare Terzett „Lippen sagt Lebewohl“, Magdas große Arie „Wir sind soweit“ oder die wiederholten melodischen Aufschwünge. Auch die orchestralen Zwischenspiele begeistern und unterstreichen geschickt die Handlung und die jeweilige Stimmung. Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven treffen den Charakter der Musik, ihre Dramatik und ihre Schönheit, in jedem Moment und sichern dem Abend eine tiefe, emotionale Wirkung. Ein beglückender und zum Nachdenken anregender Opernabend!
Wolfgang Denker, 25.03.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
Redaktions- P.S.
Ein toller Trailer (Seattle 2014)- bitte anklicken, damit können Sie verehrte Opernfreund-Leser in nur 3,5 Minuten einmal kurz reinhören, wie grandios diese Musik ist. Eigentlich ist es ein tolles Repertoire-Werk; leider immer noch überall irgnoriert. Ein großes di ckes Opernfreund-Lob dem Bremerhavener Stadtheater für diese hinreissende Ausgrabung. P.B.
DVD-Tipp
Leider gibt nur eine uralte Aufnahme, aber die ist grandios!

FRAU LUNA
Premiere am 03.02.2018
Gute Laune mit Berliner Luft
„Frau Luna” ist die erfolgreichste und bekannteste Operette von Paul Lincke - allenfalls „Lysistrata“ und „Im Reiche des Indra“ sind daneben heute noch ein Begriff. Schon die Uraufführung 1899 im Berliner Apollo-Theater war ein Riesenerfolg und markierte die „Geburtsstunde“ der Berliner Operette. Walter Kollo, Jean Gilbert und andere waren weitere Komponisten dieses Genres. Bei der Berliner Operette findet sich oft Marschmusik, während die Wiener Operette mehr vom Walzer geprägt ist.

Paul Lincke hat seine „Frau Luna“ im Laufe der Jahre immer um neue Lieder erweitert, wobei er auch Titel aus seinen anderen Werken übernahm, so etwa „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ oder „Das ist die Berliner Luft“. Erst 1922 lag „Frau Luna“ erstmalig als abendfüllender Zweiakter vor. In Bremerhaven hat man nun auch noch das „Glühwürmchen-Idyll“ (ursprünglich aus „Lysistrata“) eingefügt.
Obwohl „Frau Luna“ einen Ohrwurm an den anderen reiht und fast nur Melodien enthält, die jeder kennt und jeder mitsingen könnte, ist die Zeit doch über das Werk hinweggegangen. Die Geschichte des Berliner Erfinders Fritz Steppke, der mit seinen Freunden Lämmermeier, Pannecke und der resoluten Frau Pusebach zum Mond fliegt und dort im Reich von Frau Luna emotionale Verwirrungen erlebt und verursacht, ist doch reichlich überholt. Heute wirkt „Frau Luna“ nur noch durch die schmissige Musik.

Regisseur Holger Seitz tat gut daran, den revuehaften Charakter dieser Operette in den Mittelpunkt zu stellen und den Sinn oder Unsinn der Handlung nur als Beiwerk zu betrachten. Herausgekommen ist eine attraktive Unterhaltungsshow, die mit Sängern, Schauspielern, Chor, Ballett und Orchester alle Kräfte des Bremerhavener Theaters bündelt. Und da ist durchgängig gute Laune angesagt. Dafür sorgt schon besonders Hartmut Brüsch am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven, der die zündenden Märsche („Berliner Luft“ oder den „Schutzmann-Marsch“), die süffigen Melodien („Schlösser, die im Monde liegen“ oder „Wenn die Sonne schlafen geht“) und die großen Chorszenen mit Esprit und mitreißendem Schwung serviert. Da macht das Zuhören Spaß.

Aber auch das Zusehen: Darko Petrovic schickt das wie aus einem nostalgischen Jules-Verne-Film stammende Raumschiff mit seinen rot beleuchteten Fenstern und den Silhouetten der Mondreisenden über den ganzen Bühnenhimmel. Das ist liebevoll gelungen. Die Dachkammer von Fritz Steppke wird mit einer Konstruktion aus wenigen Stangen angedeutet und eine überwiegend in blaues Licht getauchte Mondlandschaft mit einer „Showtreppe“ für den effektvollen Auftritt von Frau Luna phantasievoll entworfen. „Lasst den Kopf nicht hängen“ singt sie dem Mondvolk und den Gästen von der Erde zu. Nein, das tut auch keiner. Dazu ist die Stimmung zu ausgelassen.
Die Titelpartie wird von Tijana Grujic elegant und verführerisch gestaltet. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf Fritz Steppke. Da ist es gut, dass seine Verlobte Marie in Gestalt von Alice Fuder noch gerade rechtzeitig auch auf dem Mond erscheint, um Schlimmeres zu verhindern. Sie hatte ihn ja ohnehin schönstimmig gewarnt: „Schlösser, die im Monde liegen, bringen Kummer, lieber Schatz!“.

Und so finden Frau Luna und Prinz Sternschnuppe, der von Tobias Haaks mit virilem Tenor gesungen wird, doch noch zueinander. Zuständig für die Komik sind Isabel Zeumer als Frau Pusebach mit einer gehörigen Portion Mutterwitz, Jürgen A. Ferch als Rentner Pannecke und auch MacKenzie Gallinger als Theophil, der um sein Glück mit der Kammerzofe Stella (liebenswert-schnippisch Patrizia Häusermann) fürchten muss. Steppke und Lämmermeier sind mit Benjamin Krüger und Vikrant Subramanian stimmig besetzt, ebenso Venus und Mars mit Sydney Gabbard und Lukas Baranowski. Iris Wemme versucht schnurrend wie ein Fabelwesen (Mondgroom) den Lämmermeier zu umgarnen.
Der Chor in der Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández sowie die von Sergei Vanaev und Holger Seitz eingerichteten Ballettszenen sorgen für zusätzliche Attraktivität.
Wolfgang Denker, 04.02.2018
Fotos von Heiko Sandelmann
FIDELIO
Premiere am 25.12.2017
„Fidelio“ als Weihnachtsmärchen

Wo hätte Regisseur Robert Lehmeier seine Bremerhavener Inszenierung von Ludwig van Beethovens einziger Oper „Fidelio“ wohl angesiedelt, wenn die Premiere nicht für Weihnachten sondern für Ostern geplant gewesen wäre? Hier jedenfalls blickt man zunächst in ein spießbürgerliches Wohnzimmer der fünfziger Jahre, wo Rocco, Marzelline, Jaquino und Fidelio sich den Weihnachtsbraten schmecken lassen. Rocco trägt ein Weihnachtsmannkostüm, im Hintergrund ist ein riesiger, etwas kitschiger Weihnachtsbaum zu sehen und vom Himmel fallen heimelig anmutende Schneeflocken. Da wundert man sich, wenn die Gefangenen später von der Frühlingssonne singen. Für deren Auftritt wird die Bühne hochgefahren, die sich zuvor noch in eine Küche mit Spüle und Waschmaschine verwandelt hatte. Die Gefangenen werden von Jaquino einzeln photographiert, ob für die Polizeiakte oder fürs Familienalbum, bleibt unklar. Für den zweiten Akt genügt dem Ausstatter Stefan Riekhoff die fast leere Bühne mit einer Deckenlampe und nur zwei Stühlen für Rocco und Florestan.

Vorher sitzt Florestan bei seiner Auftrittsarie „Gott! Welch Dunkel hier“ zusammen mit seinem Freund, dem Minister, in einem bequemen Plüschsessel und im hellen Licht einer Stehlampe. Aber das war wohl ohnehin nur eine Vision Leonores, die die Szene beobachtet. Überhaupt die Stehlampen - am Ende wird davon eine ganze Batterie zusammen mit den Chordamen in quietschbunten Kleidern und mit Blumensträußen auf die Bühne gefahren. Die „Gefangenen“ gesellen sich in schmucken Anzügen dazu. Friede, Freude, Weihnachtskuchen für alle? Leonore hält sich bei dem allgemeinen Jubel jedenfalls die Ohren zu.
Die, um es vorsichtig zu sagen, eigenwillige Inszenierung von Robert Lehmeier beginnt mit einer über Lautsprecher eingespielten Weihnachtsansprache von Joachim Gauck, in der um Vertrauen für den Staat, insbesondere für den Rechtsstaat, geworben wird. Das mag noch passen, aber Unterdrückung und staatliche Willkür werden hier viel zu wenig thematisiert. Und der Bösewicht Don Pizarro wirkt bei Lehmeier nur wie die Karikatur eines Schurken. Wenn er mit dem Dolch herumfuchtelt und später grinsend seine Handfesseln präsentiert, ist das eher unfreiwillig komisch. Die Gefährlichkeit der Figur wird nur von Marc Niemann am Pult es Philharmonischen Orchesters Bremerhaven verdeutlicht.

Keine schlechte Idee war es, statt der sonst oft hölzernen Dialoge nur innere Monologe der Figuren (von Schauspielern gesprochen) einzuspielen. Weniger gut die Idee, auch die Anfangstakte der Ouvertüre aus der Konserve zu liefern, bevor dann das Orchester einsetzt. Denn Marc Niemann und das Philharmonische Orchester Bremerhaven erweisen sich in Sachen Beethoven als sehr kompetent, was der Sinfonien-Zyklus auf CD zeigt, deren dritte Folge gerade erschienen ist. Auch bei „Fidelio“ erweist sich sein Zugriff auf die Musik als absolut stimmig und mitreißend. Schon der Ouvertüre gibt er Gewicht und Größe. Den im 1. Akt vorherrschenden Singspielcharakter treffen Niemann und das Orchester ebenso gut wie die dramatische Spannung und die Emotionalität des 2. Aktes. Das Quartett „Mir ist so wunderbar“ wird mit Ebenmaß, perfektem Tempo und schönster Klangbalance musiziert. Auch für die großen Chorszenen im Finale findet Niemann den richtigen Zugang, fernab von hohlem Pathos. Hier stimmt auch die Leistung von Opernchor und Extrachor in der Einstudierung von Mario Orlando El Fakih Hernández, die beim Chor der Gefangenen im 1. Akt noch nicht ganz überzeugte.

Eine kleine Enttäuschung bereitete Yamina Maamar als Leonore. Zwar hat ihr Sopran immer noch viel Durchschlagskraft, aber es fehlt ihm an Jugendlichkeit. Ihre Stimme macht für diese Partie einen überreifen Eindruck und neigt mitunter zu etwas schrillen Tönen. Tobias Haaks bekommt die heldischen Anforderungen der Florestan-Partie gut in den Griff. Auch den heiklen Beginn von „Gott! Welch Dunkel hier“ meisterte er sehr respektabel. Das Crescendo hätte noch besser sein können, aber sein Tenor entwickelt Kraft und Farbe - eine sehr gute Leistung! Der prachtvolle Bass von Leo Yeun-Ku Chu kommt auch bei der Partie des Kerkermeisters Rocco einmal mehr bestens zur Geltung; und Alice Fuder überzeugt als Marzelline (im albernen Glitzerkleid) mit beweglichem Soubretten-Sopran ohne Einschränkung. MacKenzie Gallinger gibt den Jaquino mit solider Routine. Derrick Ballard versieht die Partie des Pizarro mit viel Ausdruck und stimmlicher Wucht, während Vikrant Subramanian als Minister weit unter seinen Möglichkeiten bleibt.
Musikalisch gibt es also durchaus viele positive Eindrücke, während die Inszenierung dem Gehalt von Beethovens Meisterwerk nur in Teilen gerecht wird. Der recht kurze Schlussbeifall gilt vor allem der musikalischen Seite, während die Regie auch Buhrufe zu hören bekommt.
Wolfgang Denker, 26.12.2017
Fotos von Heiko Sandelmann
RIGOLETTO
Premiere am 04.11.2017
Ein Fest ausdrucksvoller Stimmen

Zeit und Ort sind in der Inszenierung von Verdis „Rigoletto” bei Regisseur Andrzej Woron nicht festgelegt. Zum Orchestervorspiel kommt ein Clown vor den noch geschlossenen Vorhang, fast so als wären wir im „Bajazzo“. Er lacht hysterisch und laut in die Musik hinein. Es ist Rigoletto, der Hofnarr des Herzogs von Mantua. Von Hofstaat ist allerdings nichts zu sehen. Das Bühnenbild besteht aus einer schräggestellten Drehscheibe, auf der sich Männer mit aufblasbaren Sexpuppen vergnügen. „Die Personen drehen sich auf einer Scheibe wie bei einem Roulette“, beschreibt Woron die Szene. Aber auch die Assoziation zu einer Zirkusmanege liegt nahe. Man trägt zwar überwiegend Alltagskleidung, aber die Gesichter der Hofschranzen sind weiß geschminkt. Später wird mittels Drehbühne der Blick auf Gildas enge, fast unterirdische gelegene Klause und später auf die puffrot beleuchtete Schänke von Sparafucile gelenkt. Das Bühnenbild stammt ebenfalls von Andrzej Woron, das er zusammen mit Hanna Sibilski entworfen hat.

Die erste Szene des 1. Aktes fällt dabei insgesamt etwas aus dem Rahmen und wirkt fast wie ein plakativer Beitrag zur aktuellen Sexismus-Debatte. Aber dann findet Woron doch schnell zu seiner eigentlichen Intention, nämlich einer psychologischen Zeichnung der Personen. Das ist besonders im Fall von Rigoletto gelungen, der als „Übervater“ seine Tochter einschließt und ihre Bedürfnisse ignoriert. Rigoletto ist hier kein Krüppel; wenn er seine Clownsperücke abzieht, wirkt er in Schlips und Kragen eher wie ein bürgerlicher Beamter. Die vermeintliche Liebe des Herzogs befreit Gilda geradezu psychisch und physisch aus ihrem engen Verließ: Sie entschwebt bei ihrer Arie „Caro nome“ auf einer Schaukel nach oben, sozusagen in den siebenten Himmel. Sie trägt dabei den Tüllrock und die roten Schuhe, die ihr der Herzog zuvor geschenkt hat. Das ist ein sehr gelungenes Bild, poetisch und symbolkräftig zugleich. Worons Inszenierung zeichnet sich zudem durch logisch durchdachte Details aus. Bei seiner Arie „Ella mi fu rapita“ etwa sucht der Herzog in ihrem Kabuff nach Gilda und nicht am Hof. Etwas überzogen ist der Schluss, wenn Gilda den Herzog umarmt und ihn einfach nicht loslassen kann, auch wenn der gerade mit Maddalena „rummacht“.

Musikalisch sorgt dieser „Rigoletto“ für ungetrübtes Verdi-Glück. Bremerhaven beschert ein Fest ausdrucksvoller Stimmen. Dae-He Shin, der 2010 zum Sänger des Jahres nominiert wurde, kam gastweise vom Meininger Theater. Er singt den Rigoletto mit erzenem Wohlklang und gestaltet die Partie mit einer reichen Ausdrucksfülle. Seine Arie „Cortigiani“ lässt an Emotionalität und Wucht keine Wünsche offen, ebenso wie das lodernde Racheduett und die vorausgegangene Szene mit Gilda. Die wird von Tijana Grujic mit leuchtendem und sicher geführtem Sopran gestaltet. Die Hoffnungen des jungen Mädchens verdeutlicht sie mit anrührendem Spiel und findet in der letzten Szene zu ätherischen Tönen. Mit Kwonsoo Jeon steht ein jugendlicher, burschikoser Herzog zur Verführung. Bei „Questa e quella“ hat er sich noch nicht ganz warm gesungen, aber das Duett mit Gilda gestaltet er mit sinnlichem Verführungston. Bestens gelungen und mit feiner Differenzierung versehen ist auch „Ella mi fu rapita“, während „La donna e mobile“ noch leichtfüßiger und eleganter denkbar ist.

Leo Yeun-Ku Chu begeistert einmal mehr mit seiner runden, sonoren Bassfülle. Der Sparafucile wird bei ihm zu einer Hauptrolle. Patrizia Häusermann erweist sich für die Maddalena als eine äußerst attraktive Besetzung. In weiteren Partien bewähren sich u.a. Brigitte Rieckmann als Giovanna, Daniel Dimitrov als Graf von Monterone, Lukas Baranowski als Marullo, MacKenzie Gallinger als Borsa und Michaela Weintritt als Gräfin von Ceprano. Der bestens singende und agierende Herrenchor wurde von Mario Orlando El Fakih Hernández einstudiert. Marc Niemann dirigiert das Philharmonische Orchester Bremerhaven mit Sinn für instrumentale Feinheiten und arbeitet spitzt die dramatischen Höhepunkte effektvoll zu, ohne dabei jemals „knallig“ zu wirken.
Wolfgang Denker, 05.11.2017
Fotos von Heiko Sandelmann
ZORRO - DAS MUSICAL
Premiere am 23.09.2017
Furios grandioser Saison-Auftakt
Die neue Spielzeit in Bremerhaven wurde (nun schon traditionsgemäß) mit einem Musical eröffnet. Diesmal fiel die Wahl auf „Zorro“. Zorro - das ist der mexikanische Edelmann Diego de la Vega, der maskiert gegen die Gewaltherrschaft seines Bruders Ramon und für die Rechte der Bürger kämpft. Die Musik stammt zum größten Teil von den Gipsy Kings, die Inszenierung lag in den Händen von Intendant Ulrich Mokrusch.

Wer kennt sie nicht aus seiner Jugendzeit, die Figur des edlen Freiheitskämpfers Zorro, der mit Maske und Degen für Gerechtigkeit kämpft? Sie tauchte erstmals 1919 in einem amerikanischen Groschenroman von Johnston McCulley auf und wurde unzählige Male verfilmt. Auch als Musical wurde der Stoff schon mehrfach bearbeitet (1998 und 2007), bevor Stephen Clark zusammen mit den Gipsy Kings 2008 die jetzt auch in Bremerhaven gespielte Version schuf.
Um es gleich zu sagen: Schwungvoller, rasanter und mitreißender hätte eine Spielzeiteröffnung kaum ausfallen können. Natürlich ist die unwiderstehliche Musik der Gipsy Kings (die von John Cameron um zusätzliche Nummern erweitert wurde) schon mehr als die halbe Miete.

Songs wie „Baila me“, „Bamboleo“ oder „Djobi Djoba“ bilden das musikalische Gerüst und sind in Bezug auf Wirkung und Temperament kaum zu schlagen. Aber die Regie von Ulrich Mokrusch, die Choreographie von Andrea Danae Kingston und die von Jean-Loup Fourure einstudierten Fechtszenen binden alles zu einer hochgradig unterhaltsamen Show zusammen. Mokrusch vermeidet es dabei, die etwas plakative Handlung ungebrochen in eine banale Heldengeschichte umzusetzen. Natürlich bleibt „Zorro“ auch bei ihm eine Mantel-und-Degen-Geschichte mit viel Aktion, etwa wenn Zorro drei Bauern vor dem Galgen rettet, aber er würzt sie mit feinem Humor und mit augenzwinkerndem Ansatz. Die Balance zwischen Pathos und Slapstick ist auf das Feinste ausgelotet. Als Edelmann gibt sich Diego betont naiv, fast tollpatschig, bevor er wieder in die Maske des Zorro schlüpft. Da wird er zum raffinierten Fuchs, etwa in der köstlichen Szene, in der er als falscher Pfarrer seinem Widersacher Ramon bei einer Beichte das Geheimnis um den doch noch lebenden Vater entlockt. Neben Diego beherrschen zwei starke Frauen das Bühnengeschehen.

Da ist Luisa, seine Liebe aus Jugendtagen, und da ist Inez, seine Mitstreiterin als Straßensänger. Wenn sie in jeweils sehr stimmigen Balladen oder in Duetten ihren Gefühlen und ihren Sehnsüchten Ausdruck geben, lässt die Regie von Mokrusch auch Sentimentalität zu. Herrlich auch, wenn Inez dem in sie verliebten Sergeanten Garcia die Kunst der Verführung bei dem Walzerlied „Noch ein Bier“ beizubringen versucht. Es überwiegen die temperamentvollen Szenen, bei denen auch der Chor (Einstudierung Mario Orlando El Fakih Hernámdez) und das Ballett zu Hochform auflaufen. „Bamboleo“ sorgt für besonders begeisterten Zwischenbeifall. Die Bühne von Dorit Lievenbrück mit Toren an den Seiten, einer stimmungsvollen Projektion im Hintergrund und einer großen Freifläche lässt dazu auch viel Raum. Wechselnde Schauplätze werden durch wenige Requisiten charakterisiert. Im Vordergrund sind durchgängig Grabkreuze, über denen sich manchmal ein Skelett erhebt.
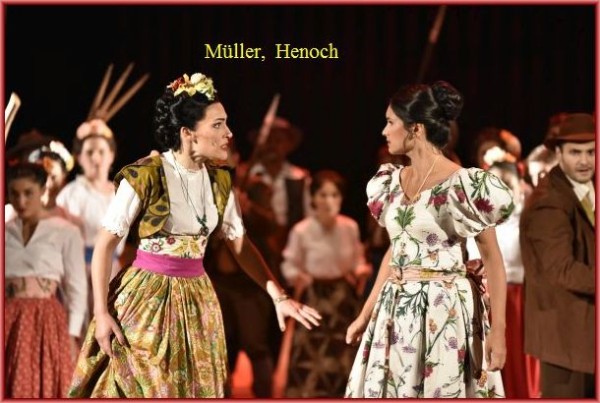
Als Zorro überzeugt Vikrant Subramanian, der seinen schlanken Bariton den ungewohnten Anforderungen perfekt angepasst hat und der in die Rolle wie in eine zweite Haut geschlüpft ist. Ein berührender Moment ist sein sehnsuchtsvolles Duett mit Luisa. Luisa und Inez sind mit Filipina Henoch und Dorothea Maria Müller bestens besetzt: Henoch stimmlich etwas lieblicher, Müller etwas erdiger. Beide können mit bester Bühnenpräsenz und auch tänzerischem Einsatz begeistern. Nicky Wuchinger gibt den Ramon als düsteren Erzschurken, Tobias Haaks mit kraftvollem Tenor den verliebten Sergeanten Garcia. MacKenzie Gallinger hat einen kurzen Auftritt als Vater der beiden Brüder.
Die hervorragende Band (Trompeten!) besteht aus Musikern des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven und wurde um vier Gitarristen erweitert, die den Klang maßgeblich bestimmen: Tim Schikoré, José Ribeiro dos Santos, Juan M° Claverias Jiménez und Jorge Ballesteros Vilches. Die musikalische Leitung liegt bei Ektoras Tartanis in den besten Händen, der für einen schwungvollen Abend der Extraklasse sorgt.
Wolfgang Denker, 24.09.2017
Fotos von Manja Herrmann
VANESSA
Premiere am 03.06.2017
Eng verknüpfte Frauenschicksale
Bei der letzten Opernpremiere im Großen Haus des Stadttheaters hat Intendant Ulrich Mokrusch persönlich die Regie übernommen. Wie schon im letzten Jahr mit „Der goldene Drache“ von Peter Eötvös gelingt es ihm wieder, diesmal mit „Vanessa“ von Samuel Barber, einen glanzvollen Schlusspunkt für die laufende Spielzeit zu setzen.

„Vanessa“ wurde 1958 an der Metropolitan Opera uraufgeführt und ist für lange Zeit etwas in Vergessenheit geraten. Aber in den letzten Jahren wurde das Werk von einigen Häusern wiederentdeckt. In Bremerhaven wird es erstmalig gespielt. Eine glückliche Wahl, denn „Vanessa“ ist ein Werk, das mit einer teils sinnlichen, teils feingliedrigen Musik besticht, die nicht „neutönerisch“ daherkommt, sondern viel Melodie und einen manchmal an Richard Strauss oder an Filmmusik erinnernden rauschhaften Orchesterklang enthält. Und die Handlung (auf ein Libretto von Gian Carlo Menotti nach einer Vorlage von Tania Blixen) fächert subtil die seelischen Zustände von zwei Frauen auf, deren Schicksale eng miteinander verknüpft sind.
Vanessa hat zwanzig Jahre auf die Rückkehr ihres Geliebten Anatol gewartet. Aber es kommt dessen leichtlebiger Sohn, der auch den Namen Anatol trägt. Zwar verführt der gleich in der ersten Nacht Vanessas Nichte Erika und schwängert sie, aber Vanessa hat sich auch in die jugendliche „Neuauflage“ ihres damaligen Geliebten verliebt. Anatol entscheidet sich für Vanessa. Beide ziehen nach Paris und lassen Erika zurück. Nun lässt die alle Spiegel verhüllen und wartet wie zuvor Vanessa.

Ulrich Mokrusch ist eine durch und durch feinsinnige Inszenierung gelungen, bei der jede seelische Regung der Figuren ihren entsprechenden Ausdruck findet. Vanessa verwandelt sich von der verbitterten, etwas verhärmten Person zu einer geradezu vor Jugendlichkeit strotzender Frau, während Erika die gegenläufige Entwicklung vollzieht. Vanessas Mutter, die alte Baronin (Katherine Marriot), schweigt meistens zum Geschehen. Sie wirkt durch ihre bloße Präsenz und erinnert an die Küsterin in Janáčeks „Jenufa“. Anatol ist der oberflächliche Jüngling, der alles im Leben mitnimmt, was er kriegen kann. Den alten Doktor, ein langjähriger Freund der Familie, zeichnet Mokrusch als eine Figur mit viel Herz und komödiantischem Charme, die auch in angetrunkenem Zustand einfach liebenswert ist.
Äußerst gelungen ist die Ausstattung: Timo Dentler und Okarina Peter zeichnen für Bühne und Kostüme verantwortlich. Die Spielfläche ist ein schneebedecktes Zimmer mit einem riesigen, in einen Goldrahmen gefassten Spiegel im Hintergrund, dazu eine Standuhr, die nicht mehr schlägt, sowie eine Lagerstatt für die Baronin. Oft fallen Schneeflocken. Die Lichtstimmungen wechseln zwischen poetischer Verklärung und eisiger Kälte. Es ist eine Inszenierung, die in ihrer Gesamtwirkung höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Auch die sängerischen Leistungen sind durchweg begeisternd. Allen voran kann Judith Kuhn mit raumgreifendem, leidenschaftlich geführtem Sopran als Vanessa überzeugen. Auch Carolin Löffler gibt mit schlankem Mezzo ein eindringliches Porträt der Erika und bezaubert mit der melancholischen Arie „Must the winter come so soon“. Tobias Haaks singt den Anatol mit tenoraler Strahlkraft und Vikrant Subramanian liefert als Doktor eine bis ins Detail ausgefeilte Charakterstudie. In weiteren Rollen sind Róbert Tóth als Majordomus, Lukas Baranowski und Michaela Weintritt als Bedienstete sowie Daniel Dimitrov als Pfarrer zu erleben. Der von Anna Milukova einstudierte Chor erfüllt seine vergleichsweise kleine Aufgabe bestens.
Thomas Kalb am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven schwelgt in der süffigen Musik und unterstreicht in vielen instrumentalen Details deren Qualität. Er ist ein feinsinniger Begleiter für die Sänger und gibt den vielen, rein orchestralen Passagen besonderes Gewicht. Eine Produktion, die sich niemand entgehen lassen sollte!

Wolfgang Denker, 04.06.2017
Fotos von Hilka Baumann und Heiko Sandelmann
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere am 29.04.2017
Oscars Totentanz
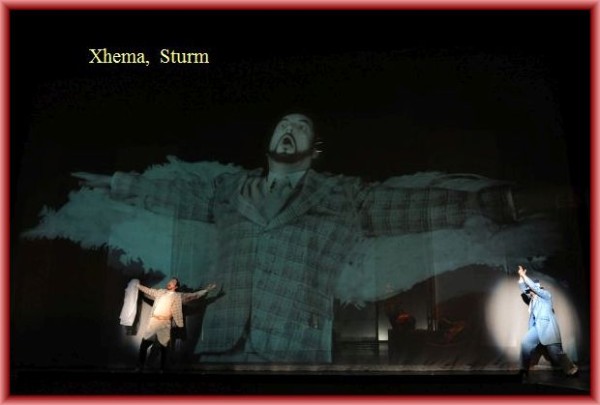
Der schwedische König Gustav III. ist die Hauptfigur in Giuseppe Verdis Oper „Un ballo in maschera“. Er wird am Ende ermordet. Welche Schwierigkeiten Verdi mit den italienischen Zensurbehörden hatte, ist bekannt Er wurde gezwungen, die Handlung nach Amerika zu verlegen. Aus Gustav wurde der Bostoner Gouverneur Riccardo. Inzwischen wird fast überall die Originalversion gespielt, so auch in der Bremerhavener Neuinszenierung von Roman Hovenbitzer. Der siedelt die Handlung allerdings auch nicht unbedingt in Schweden an, sondern eher in einem geheimnisvollen Land der Phantasie. Aber es ist ein Land mit doppeltem Boden…
„König Gustav ist ein Mensch, der für den Posten nicht geschaffen ist“, meint der Regisseur. Denn Gustavs Interessen liegen eher bei Kunst und Theater. Als „Theaterkönig“ ging er denn auch in die Geschichte ein.

Diesen Aspekt stellt Hovenbitzer in den Mittelpunkt seiner Inszenierung. Der Page Oscar wird zu einer Art Spielleiter, ähnlich dem Conferencier in „Cabaret“. Er zieht den Vorhang auf und zu und präsentiert mit eleganten Gesten die Handlung. Im Glitzeranzug und mit Zylinder ist er pausenlos auf der Bühne - ein diabolischer Hexenmeister, der mit allen sein Spiel treibt. Und auch Gustav ist dabei mit von der Partie und beteiligt sich an diesem Spiel von Schein und Sein. Das nimmt mitunter auch bösartige Züge an, etwa wenn die Wahrsagerin Ulrica hier schon im 1. Bild vorgeführt und gedemütigt wird. Oscar und der König: Man könnte sie fast mit Rigoletto und dem Herzog vergleichen.
Hovenbitzer und sein Ausstatter Roy Spahn arbeiten viel mit Videos, die auf einen Gazevorhang projiziert werden. Das erzeugt mitunter die Wirkung eines Film noir, ist aber auch oft zuviel des Guten. Als düstere Gruselszene präsentiert Hovenbitzer den 2. Akt. Nebelschwaden, graue Todesengel mit Totenschädeln und ein Grabstein erzeugen die Stimmung eines Horrorfilms. „Nacht des Schreckens“ steht als Überschrift zur Inhaltsangabe im Programmheft.

Gustav und Amelia haben jeweils einen Engelsflügel, sodass sie sich erst in der Umarmung ergänzen. Aber auch das Brautkleid und der Brautkranz täuschen nicht darüber hinweg, dass die Geschichte ein böses Ende nimmt. Einen völligen Kontrast gibt es dann im 3. Akt. Die Bühne wird hochgefahren und gibt den Blick auf ein spießiges Wohnzimmer mit Couch, Fernseher und Schrankwand frei. Das ist die bürgerliche, wohlgeordnete Welt von Renato Anckarström, dem Vertrauten und späteren Mörder des Königs. Sie ist völlig konträr zur Phantasiewelt Gustavs und erklärt zum Teil, warum sich Renatos Gattin Amelia zu Gustav hingezogen fühlt.
Wenn Gustav von den tödlichen Schüssen getroffen wird, steht er wieder auf, als wäre nichts geschehen. Erst im Bühnenhintergrund bricht er zusammen. Hovenbitzer hebt mit diesem Ende die Grenze zwischen Traum und Realität nicht auf. Die Frage, was Illusion und was irdische Wahrheit ist bleibt offen. Ist alles nur ein Spiel oder hat Gustav bewusst seinen eigenen Tod inszeniert? Oscars Totentanz - ein faszinierendes Spiel mit der Phantasie.

Sängerisch steht Katja Bördner als Amelia im Mittelpunkt. Sie führt ihren schönen Sopran mühelos und strahlend durch alle Lagen. Die emotionale Intensität, mit der sie ihre Partie gestaltet, berührt tief. Ihre Arien „Ecco l’orido campo“ und „Morrò, ma prima in grazia“ vereinen gesanglichen Feinschliff und Expressivität. Der albanische Tenor Adrian Xhema war Ensemblemitglied des Staatstheaters am Gärtnerplatz und des Opernhauses Münster. Er singt als Gast den Gustav mit großer Sicherheit und sehr präsentem Tenor. Um seine Höhe braucht man sich nicht zu sorgen. Im großen Duett des 2. Aktes vereinen sich seine und die Stimme von Katja Bördner zu veritablem Wohlklang. Der zweite Gast ist Alexandru Aghenie aus Moldawien. Er singt den Grafen Renato Anckarström mit seinem schlanken und wohltimbrierten Bariton sehr kultiviert und ganz auf Linie. „Eri tu“, die Glanzarie dieser Partie, lässt keine Wünsche offen. Darstellerisch kann er die seelische Verletzung der Figur gut vermitteln. Der Oscar ist in dieser Inszenierung zu einer Hauptpartie geworden. Regine Sturm gibt der Rolle auch im stummen Spiel bezwingende Präsenz. Ihre koloraturgespickten Arien bewältigt sie souverän. Das kann man von Svetlana Smolentseva als Ulrica leider nicht durchgehend behaupten. In der Höhe spricht ihre Stimme zwar gut an, aber bei der Ulrica ist eben doch das tiefe Register besonders gefragt. Durch Persönlichkeit kann sie aber vieles ausgleichen Besonders hervorzuheben ist die satte Bassstimme von Leo Yeun-Ku Chu, der der leider kleinen Partie des Verschwörers Graf Horn besonderes Gewicht verleiht. In weiteren Rollen sind Daniel Dimitrov als Graf Ribbing, Vikrant Subramanian als Matrose Cristiano und Kiyong Lee als Richter zu erleben. Felix Niemann mimt den Sohn von Amelia und Renato. Der Chor (in der Einstudierung von Anna Milukova) präsentiert sich von seiner besten Seite.
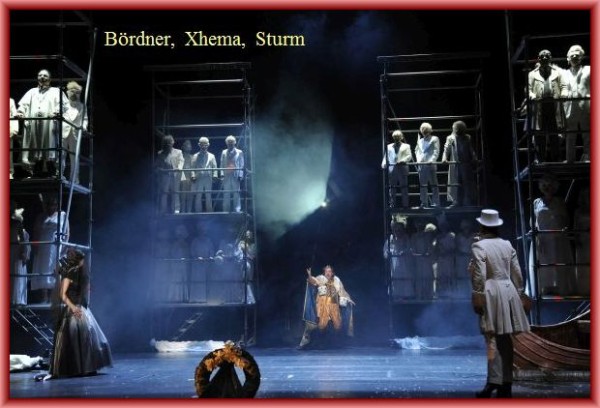
Marc Niemann und das Philharmonische Orchester geben diesem ungewöhnlichen Regiekonzept eine spannende Wiedergabe an die Seite. Er setzt die düstere Welt der Ulrica mit wuchtigen Orchesterschlägen ebenso überzeugend in Klang um, wie das leidenschaftliche Liebesduett oder die markanten Szenen der Verschwörer - eine durchweg spannende Wiedergabe, die der Leidenschaftlichkeit und dem Impetus der Musik nichts schuldig bleibt.
Wolfgang Denker, 01.05.2017
Fotos von Heiko Sandelmann
OTHELLO DARF NICHT PLATZEN
Premiere am 18.03.2017
besuchte Aufführung am 26.03.2017
Der dreifache Othello

Die Komödie „Othello darf nicht platzen“ („Lend me a tenor“) von Ken Ludwig aus dem Jahr 1986 ist eines der erfolgreichsten Boulevard-Stücke der letzten dreißig Jahre. Es wurde in 16 Sprachen übersetzt und in 25 Ländern gespielt. Allein in Wien begeisterte Otto Schenk in der Hauptrolle mit über 400 Aufführungen. Was lag da näher, als den Stoff auch zu einem Musical zu verarbeiten? 2006 schufen Brad Carrol (Musik) und Peter Sham (Textbuch) ihre Version, wobei sie sich genau an die Vorlage hielten. Die Musik von Carroll zeichnet sich durch große Originalität aus. Das Stück spielt 1934 und im Stil dieser Zeit sind auch viele der Songs gehalten. Hier gibt es keinen Einheitsbrei, den man oft in modernen Musicals vorfindet, sondern eine Vielzahl von guten, mitreißenden Einfällen. Das swingt und hat Melodie - George Gershwin und Cole Porter lassen grüßen. Dirigent Thomas Kalb und das Philharmonische Orchester Bremerhaven bringen diese vergnügliche Musik optimal zum Klingen - egal ob Jazziges oder Big Band Sound, ob Balladen-Ton oder ironisierendes Opern-Pathos gefordert wird. Die zentrale Musiknummer ist das berührende und mehrfach wiederholte „Sei du selbst“ („Be yourself“).

„Othello darf nicht platzen“ karikiert den normalen Opernbetrieb und nimmt den Starkult mit hysterischen Verehrerinnen ordentlich auf die Schippe. Damals war natürlich Luciano Pavarotti gemeint; im Stück heißt der Tenor Tito Merelli. Er soll in Cleveland einer Aufführung von Verdis „Othello“ besonderen Glanz verleihen. Leider fühlt er sich unwohl. Ein Beruhigungsmittel wirkt fatal: Merelli fällt in Tiefschaf, man hält ihn sogar für tot. Der genervte Theaterdirektor Saunders überlässt die Vorstellung notgedrungen seinem sangesbegabten Assistenten Max, der nun als falscher Merelli einen Triumph feiert. Saunders hat sich auch als Othello verkleidet, um den Gala-Empfang zu retten. Inzwischen ist der echte Merelli erwacht und geistert ebenfalls im Othello-Kostüm durch das Theater. Der dreifache Othello! Ein Feuerwerk der Verwechslungen ist die Folge, denn Saunders Tochter Maggie, eigentlich mit Max verlobt, stellt Merelli ebenso nach wie die Primadonna Diana Divane, die sich durch Merelli einen Karriereschub erhofft. Die Missverständnisse werden in irrwitzigem Tempo auf die Spitze getrieben, bevor sich alles in Wohlgefallen auflöst. „Sei du selbst!“ - das ist die Quintessenz, die zum Happy End führt.

Regisseur Ansgar Weigner hat das alles turbulent und punktgenau in Szene gesetzt, wobei die zweite Hälfte uneingeschränktes Vergnügen bereitet, während es sich vor der Pause auch etwas in die Länge zieht und sich Gags und Wortwahl oft unter der Gürtellinie bewegen. Gleichwohl gelingt es Weigner, aus dem Sängerensemble auch eine perfekte Schauspieltruppe zu formen. Das ist auch wesentlich, denn die Schauspielanteile sind bei diesem Musical mindestens genauso wichtig wie die musikalischen. Die Dialoge kommen unverkrampft über die Rampe, da sitzt jede Geste und auch jeder Tanzschritt (Choreographie von Andrea Danae Kingston). Das Bühnenbild von Christian Robert Müller zeigt eine plüschige Hotelsuite mit Salon und Schlafzimmer, dann wieder eine Ansicht der „Othello“-Opernbühne, auf der der Chor zunächst mit pathetischen, satirisch überzeichneten Gesten den Sturmchor probt und sich später Max und Diana ein kleines „Duell“ beim Applaus liefern. Es sind viele kleine Details, die Weigners Inszenierung liebenswert machen. Das Tempo, mit dem immer wieder Türen klappen und dann in Sekundenschnelle eben ein anderer Othello erscheint, ist an Tempo und Perfektion nicht zu überbieten.

Die eigentliche Hauptrolle ist der Max, der von Michael Ernst grandios verkörpert wird. Die Bremerhavener kennen ihn bereits aus der Produktion „Anything Goes“. Er legt den zunächst unscheinbaren Max wie eine Rolle von Woody Allen an, der sich vom Verlierertyp zum selbstbewussten Charakter entwickelt. Tobias Haaks gibt die prachtvolle Parodie eines Star-Tenors und glänzt mit kraftvollem Tenor. Ein Kabinettstückchen gelingt Katja Bördner, die als Diana stimmstarke Kostproben ihres Repertoires präsentiert und mit Carmen, Tosca und Butterfly bis hin zur Brünnhilde eine kleine One-Woman-Show liefert. Oliver Weidinger überzeugt als Saunders ebenso wie Regine Sturm als Maggie, Carolin Löffner als Merellis eifersüchtige Ehefrau und Thomas Burger als Inspizient.
Wolfgang Denker, 27.03.2017
Fotos von Manja Herrmann
BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER
Premiere am 04.02.2017
besuchte Aufführung am 08.02.2017
Die beste Tarnung ist die Wahrheit

Das Schauspiel „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch kennt jeder. Aber dass aus dem Stoff auch eine gleichnamige Oper komponiert wurde, dürfte für viele Musikfreunde neu sein. Der 1978 in Prag geborene Komponist Šimon Voseček schrieb sein Werk während seiner Studienzeit in Wien. Dort kam es auch 2013 zur Uraufführung, eine weitere Inszenierung erfolgte 2015 in London. Bremerhaven hat sich nun die deutsche Erstaufführung gesichert.
Die Geschichte ist bekannt. Der betrügerische und skrupellose Fabrikant Gottlieb Biedermann ist besorgt über immer neue Brandstiftungen in der Stadt. Dann tauchen die zwielichtigen Gestalten Josef Schmitz und Wilhelm Eisenreich auf. Trotz der Bedenken seiner Frau Babette lässt er sie ins Haus. Wenn sie schließlich Benzinfässer auf seinem Dachboden lagern, ahnt Biedermann zwar, dass er sich die gefürchteten Brandstifter ins Haus geholt hat, aber er verschließt die Augen vor den Tatsachen.
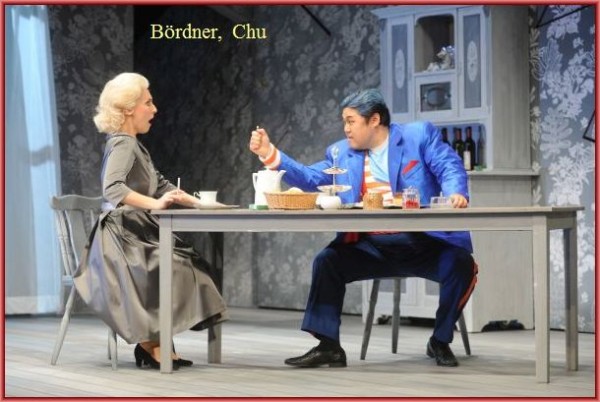
Auch als die beiden unverblümt über ihr Vorhaben sprechen, handelt er nicht und will an einen Scherz glauben. Wie sagt Eisenreich? „Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung bleibt immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand.“ Eine Erkenntnis, die einer eher politischen Interpretation den Weg weisen könnte.
Regisseur Christian von Götz setzt in seiner gelungenen Inszenierung aber vorwiegend auf die komödiantischen, grotesken Aspekte des Stoffes. Die Charaktere werden dabei sehr prägnant und holzschnittartig gezeichnet. Babette ist eine mondäne, etwas zickige Fabrikantengattin, die ebenso genussvoll an ihrer Zigarette zieht wie Biedermann an der Zigarre. Ein vorweggenommenes Spiel mit dem Feuer. Die drei Feuerwehrleute (Thomas Burger, Stefan Hahn und Jovan Koščica) lugen immer wieder „spähend, horchend“ über den Rand des Orchestergrabens hervor. Das quirlige Dienstmädchen Anna (hervorragend von Alice Fuder gespielt) bekommt wiederholt eine Sektdusche ab - ein slapstickartiger „running gag“. Beim gemeinsamen Abendessen wird die „Jedermann“-Nähe bei Frisch in Vosečeks Oper durch eine Anlehnung an die Komtur-Szene im „Don Giovanni“ ersetzt, bei der Schmitz als Geist eines von Biedermann in den Selbstmord getriebenen Mitarbeiters auftritt.
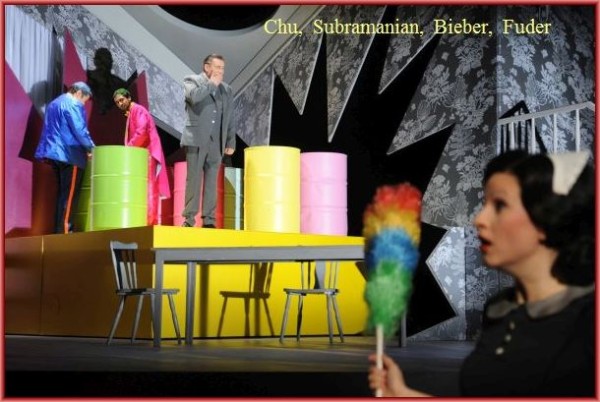
Das Bühnenbild von Lukas Noll mit grauen Wohnräumen, bei denen die bonbonfarbenen Benzinfässer immer mehr in den Vordergrund treten, ist ausgesprochen reizvoll ausgefallen und zählt zu den positiven Eindrücken.
Den Biedermann singt Clemens Bieber mit ausdrucksvollem, etwas stentorhaft geführtem Tenor, Katja Bördner ist Babette mit gekonnt „keifigen“ Tönen. Die Brandstifter sind mit Leo Yeun-Ku Chu als der etwas derbe Josef Schmitz und mit Vikrant Subramanian als der smartere Wilhelm Eisenring überzeugend besetzt.
Die mit dreizehn Musikern besetzten Bremerhavener Philharmoniker werden von Thomas Kalb geleitet, der auch gleich die Minirolle des Wachmanns übernimmt. Die Musik von Šimon Voseček hat eigentlich nur begleitenden Charakter und unterstützt den fast immer gleichbleibenden Sprechgesang, auch wenn mit drei Posaunen und Schlagwerk eine mitunter bedrohliche Stimmung erzeugt wird. Prima la musica e poi le parole? Nein, hier steht das Wort im Vordergrund.
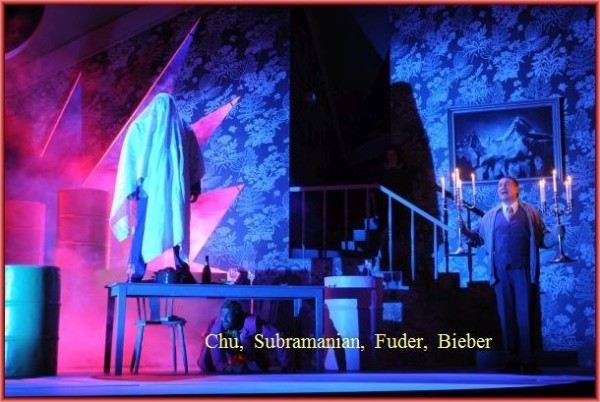
Als ein „Lehrstück ohne Lehre“ hat Max Frisch sein Schauspiel bezeichnet. Aber auch in dieser an der Komödie orientierten Inszenierung wird die mehr denn je aktuelle Lehre deutlich: Die Gefahr ist unter uns - wir müssen sie nur erkennen.
Wolfgang Denker, 09.02.2017
Fotos von Heiko Sandelmann
DIE FLEDERMAUS
Premiere am 25.12.2016
Geschüttelt, nicht gerührt
Zu Weihnachten eine Premiere im Musiktheater - das ist in Bremerhaven eine fast „heilige“ Tradition. Und ein ausverkauftes Haus ist auch immer garantiert. Dabei ist es fast nebensächlich, welches Werk auf dem Programm steht. In diesem Jahr war es eine Operette: „Die Fledermaus“ von Johann Strauß jr. erweist sich mit ihrer genialen Musik und dem erstrangigen Libretto immer wieder als Königin aller Operetten. Die Geschichte von der Rache des Dr. Falke, der von seinem Freund Eisenstein einst in einem Fledermauskostüm auf dem Marktplatz ausgesetzt wurde und der sich nun bei Eisenstein revanchiert, indem er ihn auf einem Ball des Prinzen Orlofsky in allerlei prekäre Situationen stürzt, hat zeitlose Komödienqualitäten.
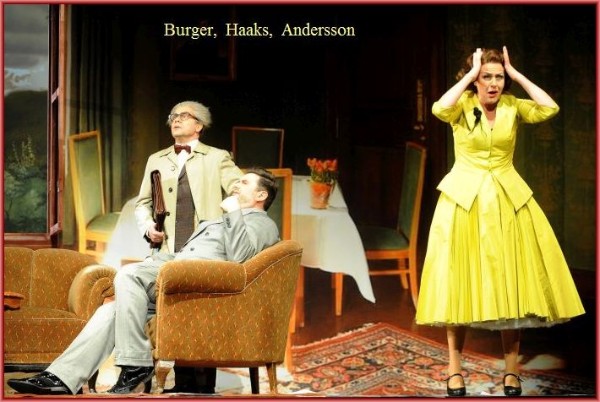
Diese Einheit von Libretto und Musik ist es auch, die Regisseur Roland Hüve besonders an dem Werk gereizt hat. Hüve hat in Bremerhaven mit „Singin’ in the Rain“, „Crazy for you“ oder dem „Grafen von Luxemburg“ bereits beglückende Inszenierungen vorgelegt. Leider lässt sich seine Sicht der „Fledermaus“ zunächst etwas zäh und bieder an. Die Sänger stehen oft an der Rampe, der Funke will nicht wirklich überspringen. Dass Rosalindes Verehrer Alfred immer wieder aus dem Fenster fällt, trägt nicht wirklich. Das Bühnenbild von Dorit Lievenbrück zeigt ein altmodisches Wohnzimmer und suggeriert sehr raffiniert mit einem Prospekt räumliche Tiefe. Sehr gelungen ist das Bild des 2. Aktes. Türen sind abstrakt angedeutet, hinter denen sich wohl der eigentliche Ballsaal befindet. Aber das bleibt der Phantasie des Zuschauers überlassen. Das erotische Katz- und Maus-Spiel findet quasi im Vorzimmer statt. Gleichwohl - bis zur Pause (nach dem Uhrenduett mitten im 2. Akt) waren die Zutaten zur Champagner-Seligkeit offensichtlich noch nicht richtig zusammengerührt.

In der Pause muss jemand die Champagner-Flaschen kräftig geschüttelt haben, denn plötzlich sprudelte es wie entfesselt. Hüves Personenführung legte an Witz und Originalität kräftig zu. Die große Verbrüderungsszene wird zu einer Art Orgie in Zeitlupe, bei der es jeder mit jedem treibt. Eine durchaus ästhetische Szene. Bei der Ballett-Einlage („Unter Donner und Blitz“) in der Choreographie von Andrea D. Kingston mischen sich Ballett- und Solistenensemble so geschickt und gekonnt, dass man kaum noch zwischen Tänzern und Sängern unterscheiden kann. Das war einfach mitreißend!
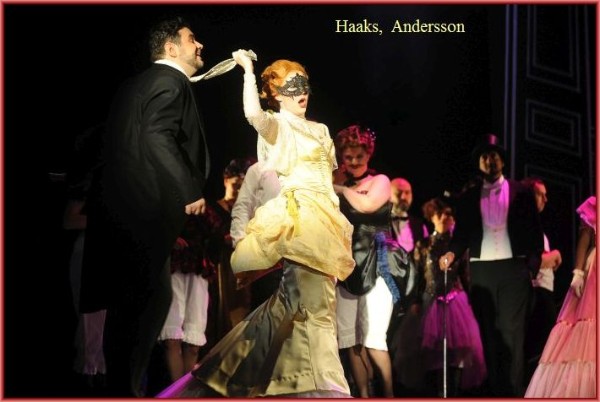
Der Schlussakt überrascht mit einem tollen Bühnenbild, bei dem endlos lange Gefängnisgänge vorgetäuscht werden. Und hier bereitet vor allem die Figur des Gefängniswärters Frosch ungetrübtes Vergnügen. Schauspieler John Wesley Zielmann erweist sich da als Glücksfall. Wie er mit vollem körperlichem Einsatz den Betrunkenen mimt, wie er punktgenau die Pointen setzt oder einen skurrilen Kampf mit einer Trittleiter besteht, ist große Klasse.
Sängerisch bewegt sich die Aufführung auf hohem Niveau. Inga-Britt Andersson ist eine ausdrucksvolle Rosalinde, die ihren Csardas ausdrucksvoll und mit sicherer Höhe hinlegt. So temperamentvoll hört man diese Arie selten. Aber Alice Fuder steht ihr gesanglich und darstellerisch in nichts nach. Ihre Adele hat zudem viel Charme und Witz. Als Eisenstein kann Tobias Haaks seinen schön timbrierten Tenor bestens zur Geltung bringen.

Eine schöne Stimme hat auch Daniel Szeili, der als Alfred zwar anfangs kleine Höhenprobleme hat und seine Partie durchgehend kraftvoll singt, der aber die Figur als selbstverliebten Verehrer überzeugend anlegt. Leo Yeun-Ku Chu stattet den Gefängnisdirektor Frank mit satten Tönen aus. Als Figur würde er auch als eine Loriot-Schöpfung durchgehen. Carolin Löffler ist ein sehr markanter Orlofsky. Ihre pompöse, phantasievolle Frisur ist ein kleines Kunstwerk für sich. Vikrant Subramanian ist mit schlankem Bariton ein eleganter Dr. Falke. Thomas Burger schöpft als stotternder Rechtsanwalt Blind die Möglichkeiten der Rolle voll aus.
Marc Niemann am Pult des Philharmonischen Orchesters Bremerhaven hat die „Fledermaus“ zur Chefsache erklärt. Man hört es. Schon bei der schwungvollen Ouvertüre betont er mit sinnvollen Ritardandi die Raffinesse der Musik. Die Champagner-Laune, die die Inszenierung im zweiten Teil nachliefert, ist bei seiner Wiedergabe durchgängig präsent.
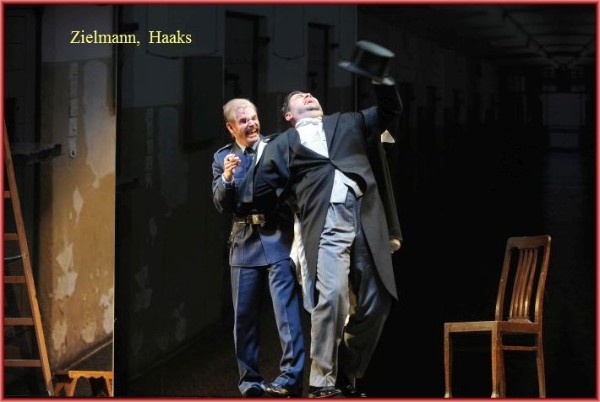
Bremerhaven ist immer eine Reise wert; besonders, aber nicht nur, für Opernfreunde. Hier macht Theater noch Spass. Die Operette lebt.
Wolfgang Denker, 26.12.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Premiere am 29.10.2016
Das Elend der Welt
Bei der Pressekonferenz zum Programm der neuen Spielzeit meinte Generalmusikdirektor Marc Niemann, dass der „Fliegende Holländer“ die einzige Wagner-Oper sei, die man in Bremerhaven seriös spielen könne. Tatsächlich taucht Wagner selten im Bremerhavener Spielplan auf - zuletzt 2001. Und auch da war es „Der fliegende Holländer“, ebenso 1991. Trotzdem soll man nicht vergessen, dass es etwa 1979 einen „Tannhäuser“ und 1983 einen sehr respektablen „Lohengrin“ mit Horst Hoffmann in der Titelpartie gab. Es geht also schon, wenn auch nur mit großer Kraftanstrengung.

Nun also zum dritten Mal in Folge der „Holländer“. Regisseur Matthias Oldag hat für seine Inszenierung teils faszinierende, teils rätselhafte Bilder gefunden. Im Programmheft sind die einzelnen Akte mit „Das Meer“, „Die Welt“ und „Der Tod“ überschrieben. Entsprechend ist die Bühnenausstattung von Anna Kirschstein ausgefallen. Sie ist mit ihrer in tiefstes Blau getunkten Projektion von sturmbewegten Wellen und Wolken von zentraler Bedeutung und Wirkung. Davor befindet sich ein schwankender Schiffsboden, auf dem halbtote Menschen liegen. Ist Dalands Schiff ein Sklavenschiff und Daland ein Schlepper? So abgefeimt und schmierig, wie Leo Yeun-Ku Chu die Figur gestaltet, liegt diese Vermutung nahe. Im zweiten Akt erblickt man eine Art Leichenhalle. Die dort tätigen Frauen sind mit ihren Springerstiefeln alles andere als Fabrikarbeiterinnen. Und die auf Paletten gestapelten Waschmaschinen sind nur Alibi und sollen über die tatsächlichen Geschäfte wie Menschenhandel hinwegtäuschen. Mary (Carolin Löffler) ist die sehr flittchenhafte Gespielin Dalands. Einzig Senta (Agnieszka Hauzer) ist anders und zeigt Empathie für ein gerade herein geschlepptes Mädchen. Sie selbst leidet offenbar unter epileptischen Anfällen.

Im dritten Akt stehen oben die Mannen Dalands aufgereiht zum Rudelsaufen, während von unten die Gespenstermannschaft des Holländers (effektvoll wie für die Geisterbahn zurechtgemacht) hochgefahren wird. Ein sehr eindrucksvolles Bild!
Der Holländer (Joachim Goltz) ist hier wirklich der „bleiche Mann“. Bei seinem ersten Auftritt färben sich die Wellen blutrot. Man denkt unwillkürlich an Dracula oder Nosferatu. Er ist offensichtlich nicht nur verbittert über sein eigenes Schicksal, sondern auch angeekelt vom Elend der Welt. Hoffnung auf Erlösung hat er kaum. Wenn er vom „Engel Gottes“ singt, ist nichts Weiches oder Tröstliches in seiner Stimme. So gibt es am Ende auch kein verklärtes Finale. Senta bleibt allein zurück und übergießt sich mit Benzin. Sie „brennt“ im wahrsten Sinne des Wortes für ihre fixe Idee.

Bremerhaven kann mit einer ganz hervorragenden Besetzung für den Holländer und für die Senta überzeugen. Joachim Goltz gibt mit virilem Heldenbariton dem getriebenen Seefahrer alle Verzweiflung und alle Sehnsucht dieser Welt mit. „Die Frist ist um“ fesselt von der ersten bis zur letzten Note. Agnieszka Hauzer führt als Senta einen ausgesprochen voll und rund klingenden Sopran ins Feld. Da gibt es auch in der Höhe keinerlei Verfärbungen oder Einbußen. Einzig ihre Textdeutlichkeit könnte noch etwas besser sein. Beider Duett „Wie aus der Ferne längst vergang’ner Zeiten“ wird zum Höhepunkt der Aufführung. Leo Yeun-Ku Chu gibt als Daland von Anbeginn an den Schurken vom Dienst. Entsprechend ruppig-expressiv und manchmal bewusst auf Kosten einer schönen Gesangslinie gestaltet er die Partie, ist aber dafür stets von ausdrucksvoller Präsenz. Tobias Haaks legt den Erik mit kraftvoll geführtem Tenor als hitzköpfigen Liebhaber an, der aber gegen Sentas Besessenheit ohnmächtig ist. Die Figur der Mary geht oft etwas unter - nicht bei Carolin Löffler, die schon rein optisch für eine deutliche Aufwertung sorgt. Als Steuermann (in Unterhosen) bewährt sich Thomas Burger mit hellem, schlankem Tenor.

Chor und Extrachor sind bei dieser Oper besonders gefordert. Die Einstudierung von Anna Milukova war hervorragend. So klangvoll und schlagkräftig wie die Aufgabe hier bewältigt wird, kann man es an einem Haus dieser Größenordnung selten erleben.
Leider hatten die Bremerhavener Philharmoniker nicht ihren besten Tag. Schon der erste Horn-Einsatz ging daneben, gefolgt von manch weiterem Patzer. Die Ouvertüre machte durchweg einen „lärmenden“ und wenig differenzierten Eindruck. Gleichwohl war die formende Hand von Marc Niemann am Pult stets spürbar. Das zeigte sich in vielen spannenden Akzenten. In der Dramatik des letzen Aktes blieben an Niemann und das Orchester denn auch kaum noch Wünsche übrig.
Wolfgang Denker, 30.10.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
DRACULA
Premiere am 17.09.2016
besuchte Aufführung: 25.09.2016
Vampire sind auch nur Menschen
Nein - Vampirzähne bekommt man nicht zu sehen, auch das ganze Vampir-Brimborium mit Kreuzen, Knoblauch und düsterer Karpatenlandschaft bleibt ausgespart. Ein bisschen Blut muss natürlich trotzdem sein, aber auch nicht zuviel.
Wieder einmal hat das Stadttheater Bremerhaven die Spielzeit mit einem Musical eröffnet und wieder auf ganzer Linie gewonnen. Die Wahl fiel diesmal auf „Dracula“ von Frank Wildhorn. Bei dieser Version des hinlänglich bekannten Stoffes handelt es sich mehr um eine Liebes- denn um eine Horrorgeschichte. Das hat Regisseur Philipp Kochheim auch ganz vorbildlich umgesetzt. Der Titelheld ist keine Kopie von Christoper Lee, sondern eigentlich ein ganz netter Kerl. Natürlich beißt auch er kräftig zu, aber eigentlich quälen ihn Einsamkeit und Sehnsucht. Deshalb siedelt Dracula auch von Transsilvanien noch London um. Vielleicht findet er dort Abwechslung, vielleicht sogar ein unverhofftes Glück. Schnell wird Mina, die Verlobte des Rechtsanwalts Jonathan Harker, das Objekt seiner Begierde. Das hindert ihn allerdings nicht, zunächst deren Freundin Lucy (in einer sehr deutlichen Szene) zu vernaschen und in einen blutigen Zombie zu verwandeln. Dank des Gelehrten van Helsing kommt die Londoner Gesellschaft schnell dahinter, was es mit Dracula auf sich hat. Das ist Anlass für den Regisseur, eine kleine Action-Einlage zu inszenieren: Eine turbulente Jagd mit Gewehren und Knallerei, aus der Dracula zunächst entkommt. Ihn hat ja die „wahre Liebe“ gepackt und es zieht ihn zu Mina. Vampire sind eben auch nur Menschen. Aber weil er sich unsterblich verliebt hat, ist der sterblich geworden. Und so endet es leider doch böse: Im letzten Bild richtet Jonathan die Flinte zum tödlichen Schuss auf ihn.

Kochheim hat eine sehr gelungene Inszenierung in sehr ästhetischen Bildern auf die Bühne gebracht. Ausstatterin Barbara Bloch variiert die Spielräume mittels Drehbühne geschickt zwischen einer Hausbar, einer geräumigen Wohnsuite und einem Schlafzimmer. Bedrohliche Stimmung wird mit gekonnten Lichteffekten erzeugt. Kochheims Personenführung ist in jedem Moment spannend und schlüssig. Auch die unvermeidlichen Gruseleffekte werden geschmackvoll ausgespielt.
Auch musikalisch ist die Produktion erstrangig. Das ist der hervorragenden Besetzung, dem opulenten Klang der Bremerhavener Philharmoniker und dem inspirierten Dirigat von Hartmut Brüsch zu danken. Die Musik von Frank Wildhorn hat da mit ihren individuellen Liedern und ihren fast sinfonischen Passagen viel zu bieten. Brüsch kostet die mitunter an schönste Filmmusik erinnernden, reinen Orchestersequenzen voll aus und spitzt die Dramatik spannungsvoll zu.

Als Dracula kann Christian Alexander Müller mit ausdrucksvoller Stimme und charismatischer Persönlichkeit überzeugen. Kein Wunder, dass Mina seiner Faszination erliegt, auch wenn sie sich zunächst dagegen wehrt. Erst der „Kuss der Erkenntnis“ (fast wie bei „Parsifal“, nur mit umgekehrtem Vorzeichen) ändert alles. Anna Preckeler gibt der Figur genau die richtige Zerrissenheit mit. Die Duette der beiden erklingen emotional aufgeladen. Carolin Löffler ist die leichtlebige, attraktive Lucy. Operntenor Tobias Haaks sorgt als van Helsing mit dem Schmelz und der Kraft seiner Stimme für besondere Höhepunkte. Gut besetzt sind auch die weiteren Rollen, darunter Maximilian Mann als Jonathan Harker und Thomas Burger als der skurrile, Spinnen fressende Diener Renfield.
Wolfgang Denker, 26.09.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
DER GOLDENE DRACHE
Premiere am 4.6.2016
Totenreise mit roten Lampions
Der Komponist Peter Eötvös ist im Bremerhavener Stadttheater kein Unbekannter - und umgekehrt auch nicht: Eötvös war vor drei Jahren anlässlich der Bremerhavener Neuinszenierung seiner Oper „Love and other demons“ persönlich zur Premiere gekommen. Nun steht „Der goldene Drache“ auf dem Programm. Die neunzigminütige Oper ist erst vor zwei Jahren in Frankfurt uraufgeführt worden. Bremerhaven ist das zweite Theater, das diese Oper spielt. Und Intendant Ulrich Mokrusch hat gleich selbst die Regie übernommen.

Die literarische Vorlage ist das gleichnamige Theaterstück von Roland Schimmelpfennig, der auch das Libretto der Oper eingerichtet hat. Eines der Themen ist die Ausbeutung von illegalen Einwanderern. Hier ist es ein chinesischer Junge, der in der Küche des Restaurants „Der goldene Drache“ arbeitet. Weil er sich illegal aufhält, kann er seine Zahnschmerzen nicht von einem Arzt behandeln lassen. Also zieht man ihm den Zahn brutal mit einer Rohrzange. Dumm, dass er daran verblutet. Seine Leiche wird im Fluss entsorgt, in der fast poetischen Hoffnung, dass er so die Reise in seine Heimat antritt. Der Zahn allerdings ist in einer Suppenschale gelandet, wo ihn eine Stewardess findet. Daneben gibt es andere, eigentlich schreckliche Handlungsstränge: Ein leichtlebiges Mädchen rutscht in Armut und Prostitution und wird schließlich ermordet. Das ist hier in eine Fabel von Ameise und Grille verpackt: Die Ameise arbeitet und sammelt den ganzen Sommer, während die Grille nur singt. Zum Winter steht die Grille mit leeren Händen (und leerem Bauch) da.

Andere Szenen zeigen einen Großvater, der sich an seiner Enkelin vergreift oder eine schwangere Frau, die geschlagen wird. Die Szenen sind nicht in sich abgeschlossen, sondern die Motive werden wie Puzzleteile immer wieder aufgegriffen und fortgeführt. Aber all das wird nicht plakativ und drastisch dargestellt, sondern entweder in skurriler Überzeichnung (wie beim Abklopfen der Zähne mit der Rohrzange) oder in dezenter, fast märchenhafter Lesart. Die insgesamt 21 Miniaturszenen werden durch die eher unaufgeregt daherkommende Musik von Peter Eötvös zu einem Ganzen geklammert. Diese Musik wartet mit einem fein verästelten Tongeflecht auf, gleichzeitig rhythmisch und filigran, selten wirklich auftrumpfend. Es ist ein eher kommentierender Klangteppich, mit flirrenden Streichern und einigen der chinesischen Musik nachempfundenen Elementen, über den sich die Gesangsstimmen mühelos legen können. Die Sänger haben vor allem eine Art Sprechgesang zu bewältigen, der immer wieder mit ariosen Phrasen durchsetzt ist. Um dem schnellen Wechsel der Szenen folgen zu können, ist Textdeutlichkeit hier eine der wichtigsten Anforderungen. Die jeweils zwei Sopranistinnen und Tenöre sowie der Bariton, die in über 20 Rollen schlüpfen müssen, haben das vorbildlich umgesetzt.

Dem Regisseur Ulrich Mokrusch ist eine optimale Inszenierung gelungen. Er hat alles aus dem Stück herausgeholt, was es hergibt. Orchester und Publikum haben ihren Platz auf der Bühne und sitzen rund um die zentrale Spielfläche. Die Szenenwechsel gelingen nahtlos und temporeich, die Rollenwechsel werden mit minimalen Änderungen in den Kostümen verdeutlicht. Bühne und Kostüme sind von Timo Dentler und Okarina Peter. Mokrusch hat in seine Inszenierung viele humorvolle Elemente einfließen lassen, etwa die Szenen zwischen den beiden Stewardessen und der Restaurant-Bedienung, ohne dadurch den ernsthaften Hintergrund zu opfern. Eine wirklich berührende Lösung ist ihm beim Tod des chinesischen Jungen gelungen. Zunächst stehen alle stumm und wie eine Mahnwache am Rand der ganz langsam rotierenden Drehbühne. Dann senkt sich ein Meer roter Lampions vom Bühnenhimmel, während der Junge seinen ergreifenden Abschiedsmonolog singt. Dies ist übrigens die einzige, etwas längere musikalische Szene mit ausgesprochenem Operncharakter. Schließlich entschwinden die Lampions und mit ihnen der Junge wieder himmelwärts. Ein eindrucksvolles Bild voller Zauber und Poesie.

Regine Sturm (Sopran I) verkörperte den armen chinesischen Jungen mit herzzerreißender Intensität und gesanglicher Souveränität. Tobias Haaks (Tenor II), der ein paar kräftig ausgestellte Glanztöne beisteuern darf, ist u. a. als Koch, Stewardess und prügelnder Mann zu erleben, Filippo Bettoschi (Bariton) mit köstlicher Mimik als Stewardess und Bedienung, Thomas Burger (Tenor I) als leidende Grille und Großvater, Patrizia Häusermann (Sopran II) als kaltschnäuzige Ameise und Enkelin. Die Wandlungsfähigkeit des Ensembles innerhalb von Sekunden ist bemerkenswert. Kapellmeister Ido Arad und die Bremerhavener Philharmoniker erfüllen ihre Aufgabe, die wechselnden musikalischen Stimmungen punktgenau umzusetzen, mit Bravour. Der anwesende Komponist bedankte sich, offensichtlich sehr gerührt, bei allen Beteiligten.
Wolfgang Denker, 5.6.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
EUGEN ONEGIN
Premiere am 23.4.2016
Dramatik im Birkenwald
Erst Tschaikowskys fünfte Oper, der 1879 entstandene „Eugen Onegin“, wurde ein veritabler Welterfolg; davor schrieb er „Der Wojwode“ (1869), die nie aufgeführte „Undine“ (1869), den ziemlich vergessenen „Leibwächter“ (1874) sowie die später zu „Pantöffelchen“ umgearbeitete Oper „Wakula der Schmied“ (1876).
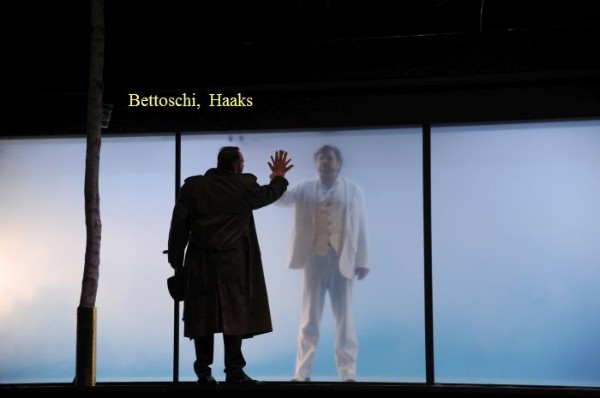
Tschaikowsky rettete sich aus seiner unglücklichen (nur wenige Tage dauernden) Ehe durch eine Flucht an den Genfer See, wo er mit der Arbeit an seinem „Eugen Onegin“ begann. Wie sehr Tschaikowsky dieses Werk, dem er die Gattungsbezeichnung „Lyrische Szenen“ gab, in erster Linie für sich selbst schrieb, zeigt ein Brief an den Komponisten Sergej Tanejew: „Ich pfeife darauf, dass es keine bühnenmäßige Oper wird. Dann spielt es eben nicht! Ich habe diese Oper nur komponiert, weil ich eines Tages das unüberwindliche Verlangen fühlte, alles, was im ‚Onegin’ geradezu nach einer Vertonung verlangt, in Musik zu setzen. Und das tat ich auch, so gut ich es vermochte. Ich habe mit ungeheurer Begeisterung und tiefem Genuss an dieser Oper gearbeitet, ohne mich um Wirkungen zu kümmern. Auf diese Wirkungen pfeife ich...“

Die letzte Bremerhavener Inszenierung von Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ liegt genau vierzehn Jahre zurück. Jetzt hat sich Regisseur Andrzej Woron der „Lyrischen Szenen“ angenommen. Woron hat in den letzten Jahren kontinuierlich und erfolgreich in Bremerhaven inszeniert. Erinnert sei an „Herzog Blaubarts Burg“, „Lady Macbeth von Mzensk“, „Love and other demons“, „Der Freischütz“ oder „Bluthochzeit“. Das Ergebnis war immer ein spannender, eigenwilliger Opernabend von besonderer Qualität.
Nicht anders ist es jetzt beim „Eugen Onegin“, bei dem Woron für Regie und Ausstattung verantwortlich zeichnet. Auch seine neueste Inszenierung entfaltet durchaus ihre starken Wirkungen. Woron lässt den „Eugen Onegin“ durchgängig im Freien spielen. Es gibt im ersten Bild kein Landgut: Schauplatz ist ein Birkenwäldchen, kahle Stämme hängen vom Bühnenhimmel herab. Es ist ein sehr stimmungsvolles, optisch sehr ansprechendes Bühnenbild, das völlig ausreichend Assoziationen an Russland erzeugt. Durch den Verzicht auf eine pittoreske Russland-Bebilderung konzentriert sich Worons Inszenierung ganz auf die Charakterisierung und die Seelenzustände der Protagonisten.

Schon zur Orchestereinleitung schleicht Onegin über die Bühne, setzt sich auf eine Bank und blättert in einem Buch, wie es früher Tatjana getan hat. Erinnerung? Eher psychologische Einstimmung, weil sich Onegin bei Woron am Ende der Oper erschießen wird. Sehr genau zeichnet er die ungleichen Schwestern Tatjana und Olga. Olga ist ein rassiges, attraktives Temperamentsbündel, neckisch, verspielt und von solch jugendlicher Ausgelassenheit, wie man es selten gesehen hat. Tatjana mit Brille, braver Frisur und „trutschigem“ Kleid wirkt daneben wie das hässliche Entlein. Umso wirkungsvoller ist dadurch ihre Wandlung zur eleganten Dame der Gesellschaft im letzten Akt. Aber Stolz und Selbstbewusstsein zeigt sie auch schon als junges Mädchen, nachdem Onegin sie zurückgewiesen hat. Gegensätzlich sind auch die Freunde Onegin und Lenski: Onegin selbstsicher, lässig und gelangweilt, der modebewusste Lenski hitzköpfig und eifersüchtig bis zur Raserei. Woron gelingt es, einen durchgängigen Spannungsbogen zu halten. Seine Personenführung ist in jeder Nuance ausgefeilt und immer sinnvoll. Und mit dem Fortschreiten der Handlung ändert sich auch das Bühnenbild.

Beim tödlichen Duell liegen die Birken entwurzelt auf der in tristen Nebel gehüllten Bühne, im Schlussakt sind die Birken von protzigen Säulen verdrängt. Mit der Einführung von drei Solotänzern (Cristina Commisso, Lorenzo Cimarelli, Ilario Frigione), die als Satyr, Pan und sterbender Schwan eindrucksvoll agieren, lockert er das Geschehen auf und fügt eine geheimnisvolle, mythologische Komponente hinzu. Das ist gelungen, auch in Bezug auf die Choreographie von Sergei Vanaev. Entbehrlich ist hingegen der kurze Abriss der russischen Geschichte bis zur Jetztzeit während der Polonaise des dritten Aktes: Hinter einer milchigen Glasscheibe erscheint erst der Geist Lenskis, dann marschieren Militär, Stalin, Bolschoi-Tänzerinnen, ein Astronaut und andere Figuren vorbei.
Inga-Britt Andersson fesselt als Tatjana vom ersten Moment an. Die Gefühlswelten der Figur kann sie mit klarem, sicher geführtem Sopran seismographisch nachzeichnen. Die Briefszene gerät zu einem sängerischen und darstellerischen Höhepunkt der Aufführung. Auch Filippo Bettoschi macht in der Titelpartie einen hervorragenden Eindruck. Mit virilem Bariton kann er seine verzweifelte Leidenschaft im letzten Akt verdeutlichen. Tobias Haaks führt seinen Tenor in der eigentlich lyrischen Partie des Lenski mit expressiver, dann wieder sensibler Stimmführung in Spinto-Bereiche. Bei Caroline Löffler wird die Olga dank ihrer Bühnenpräsenz mit zu einer Hauptpartie. Thomas Burger setzt die regiebedingt etwas überzeichnete Szene des Triquet, der bei seinem Vortrag betrunken vom Klavierhocker fällt, gekonnt um.

Gesungen wird in deutscher Sprache. Aber leider sind nicht alle Solisten so textverständlich wie Milcho Borovinov (als Gast von der Leipziger Oper), der den Gremin mit sattem Bass aber auch etwas steifen Tönen singt. Gute Leistungen liefern auch Karin Robben als Larina und Alexandra Kloose als Filipjewna.
Die „Lyrischen Szenen“ geraten in der Lesart von Marc Niemann und dem Philharmonischen Orchester Bremerhaven auch oft zu dramatischen Szenen, die mit ungeheurer Spannung aufgeladen sind. Die Leistungen von Niemann und dem Orchester bewegen sich jedenfalls auf ganz hohem Niveau. Das gilt auch für den von Jens Olaf Buhrow einstudierten Chor.
Wolfgang Denker, 24.4.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
WOZZECK
Premiere am 5.3.2016
besuchte Aufführung: 11.3.2016
Der andere „Wozzeck“
Vor kurzem hatte die Oper „Wozzeck“ von Alban Berg in Bremen Premiere. Es gibt aber auch den „Wozzeck“ in der Vertonung von Manfred Gurlitt, der jetzt am Stadttheater Bremerhaven zu bewundern ist. Das ist ein Beispiel für gut abgestimmte Spielplangestaltung und gibt die reizvolle Möglichkeit zum direkten Vergleich.

Gurlitt war von 1914 bis 1927 in Bremen tätig, die letzten Jahre davon als Generalmusikdirektor. Sein „Wozzeck“ wurde am 22.4.1926 in Bremen uraufgeführt, nur vier Monate nach Alban Bergs Oper. Beide Werke unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Gurlitt bediente sich nicht der Zwölftontechnik - seine Musik ist in freier Atonalität, aber auch mit vielen tonalen Anteilen komponiert. Die Partien des Wozzeck und der Marie sind sehr sangbar, teilweise fast melodiös. Wie bei Alban Berg gibt es auch bei Gurlitt feste musikalische Formen (Fuge, Chaconne etc.). Gurlitt bevorzugte in der Orchesterbehandlung durchgehend einen sehr kammermusikalischen, polyphonen Klang, wobei die Besetzung von Szene zu Szene wechselt.

Er setzte seine 18 Szenen ohne Übergang nebeneinander und erzeugt so besonders krasse Stimmungs- und Farbwechsel, während bei Berg die Szenen teilweise durch symphonische Zwischenspiele verbunden werden. Gurlitt lässt erst im Epilog das volle Orchester aufrauschen. Auch die Auswahl der Szenen aus dem Text von Büchner ist unterschiedlich. Bei Gurlitt tritt der Doktor nur noch in der kurzen Spott-Szene auf, seine Experimente an Wozzeck fehlen völlig. Dafür hat er eine Trostlose Märchenerzählung eingefügt, mit der die Kinder verängstigt werden. Sie trifft das dumpfe, triste Lebensgefühl der Menschen. Bei der Uraufführung schrieb die Presse: „Erst eine spätere Zeit kann darüber entscheiden, ob hiermit bereits die Musik der Zukunft gefunden ist, ob Gurlitts Musik als genial und fortzeugend zu bewerten ist.“ In Bremen wurde dieser „Wozzeck“ von Gurlitt 1987 in einer unvergessenen Inszenierung von Arno Wüstenhöfer wieder auf die Bühne gebracht, damals mit Katherine Stone und Richard Salter.

Dass Gurlitt und sein „Wozzeck“ trotzdem weitgehend vergessen wurden, ist ein Urteil der Musikgeschichte (zu Gunsten Alban Bergs), das in dieser Eindeutigkeit jedenfalls nicht gerechtfertigt ist. Das bewies die sehr ambitionierte Produktion in Bremerhaven. Regisseur Robert Lehmeier arbeitet in seiner Inszenierung mit sehr einfachen Mitteln. Die Bremer „Wozzeck“-Aufführung (von Berg) ist da deutlich aufwändiger gestaltet. Gleichwohl gelingt Lehmeier eine mindestens ebenso spannende wie beklemmende Wirkung. Das Bühnenbild von Mathias Rümmler besteht aus Biertischen und Bänken sowie einer Deckeninstallation von Neonröhren, die bei Bedarf abgesenkt werden oder flackern. Alle Personen sind stets auf der Bühne (eine Parallele zum Bremer „Wozzeck“) und kommen zu ihren Szenen an die Rampe. In beiden Inszenierungen kommt die Drehbühne zum Einsatz - in Bremerhaven mal fast unmerklich, mal in rasanterer Fahrt.

Ein Schicksalskarussell, aus dem es kein Entrinnen gibt. Lehmeier setzt seine Akzente klug und eindringlich. Das Kind (Andrej Albrecht) von Wozzeck und Marie ist behindert, was die Bürde des Außenseiters noch verstärkt. Die Eifersucht Wozzecks wird sehr eindringlich dargestellt und durch den Spott des Hauptmann und des Doktors zur Raserei gesteigert. Am Ende, wenn Wozzeck Marie mit dem Messer getötet hat und selbst ertrunken ist, sitzen alle lethargisch an den Biertischen und halten Smily-Luftballons in der Hand. Ein eindrucksvolles Schlussbild voller Zynismus. Eindrucksvoll ist auch die (bei Berg nicht vorkommende) Szene mit der Erzählung des abgewandelten Sterntaler-Märchens, das hier allerdings ein Gleichnis für totale Hoffnungslosigkeit ist.
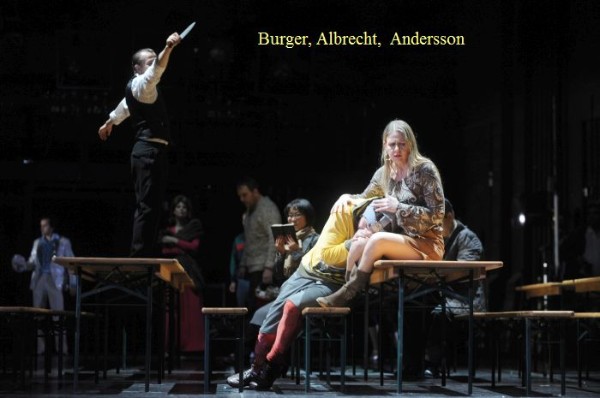
Mit Filippo Bettoschi stand für die Titelpartie ein Sänger zur Verfügung, der mit expressiv geführtem Bariton und mit darstellerischer Intensität alle seelischen Verwerfungen Wozzecks in jeder Nuance beklemmend verdeutlichte. Inga-Britt Andersson war eine Marie voller Lebenshunger, kokett und verzweifelt zugleich. Mit ihrem strahlkräftiger Sopran meisterte sie ihre Partie bis in die extremsten Höhen sehr souverän. Wie immer bereitete Leo Yeun-Ku Chu mit seinem fülligen Bass uneingeschränkte Freude, hier verkörperte er den Hauptmann mit satter Präsenz. Die Tenöre Tobias Haaks und Thomas Burger waren Andres und Doktor, Henryk Böhm als Tambourmajor die Karikatur eines Sexprotzes und Carolin Löffler eine aufreizende Margaret. Der von Jens Olaf Buhrow einstudierte und auch darstellerisch geforderte Chor zeigte sich seiner Aufgabe bestens gewachsen.
Für Marc Niemann am Pult des Philharmonischen Orchesters muss die Realisation dieser Oper ein Herzensbedürfnis gewesen sein: So sorgfältig und klanglich abgestuft, wie das Orchester die Feinheiten der Partitur umsetzte, blieb kein Wusch offen. Besonders die erschütternde Schlussmusik hinterließ einen tiefen Eindruck. Um sich ein umfassendes „Wozzeck“-Bild zu machen, kann nur der Besuch beider Aufführungen wärmstens empfohlen werden.
Wolfgang Denker, 14.3.2016
Fotos von Heiko Sandelmann
MADAME POMPADOUR
Premiere am 30.01.2016
besuchte Aufführung: 06.02.2016
Eine kluge Frau lenkt die Geschicke
Leo Fall hat gut zwanzig Operetten geschrieben, darunter „Der fidele Bauer“, „Die Dollarprinzessin“, „Die Rose von Stambul“ und „Die Kaiserin“. Am Stadttheater Bremerhaven kann man jetzt seine „Madame Pompadour“ erleben. Sie wurde 1922 in Berlin mit größtem Erfolg uraufgeführt - drei Jahre vor dem Tod des Komponisten. Die Titelpartie sang damals die unvergleichliche Fritzi Massary.

Volker Klotz, der Autor eines Standardwerks über die Gattung Operette, bezeichnet „Madame Pompadour“ als die „faszinierendste Operette der zwanziger Jahre“, nicht zuletzt deshalb, weil sie den aufsässigen Zeitgeist eines Jacques Offenbach wieder auf die Bühne brachte.
Die Bremerhavener Inszenierung von Ansgar Weigner ist zwar sorgfältig und optisch opulent gelungen, aber das Urteil über das Werk ist trotzdem heute nicht mehr ganz nachvollziehbar. Das liegt nicht an der Musik: Leo Fall gelang ein Ohrwurm nach dem anderen in seiner an süffigen Melodien reichen „Madame Pompadour“. Aber die anzüglichen Frivolitäten, mit denen das Libretto gespickt ist, mögen in den zwanziger Jahren wirklich frech gewesen sein (zumal wenn eine Darstellerin vom Kaliber der Massary sie serviert), doch heute wirken sie eher lahm.
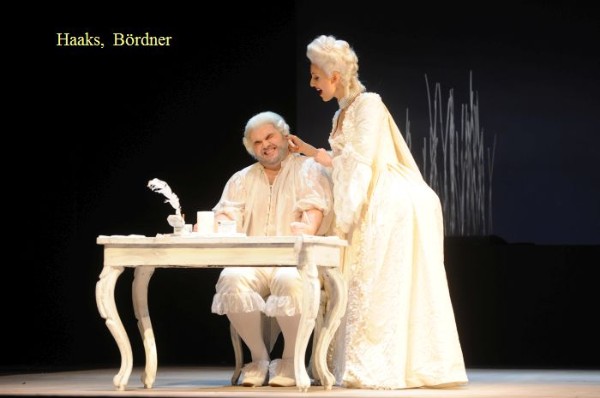
Immerhin hält Weigner die Geschichte der Mätresse Ludwig XV., die sich selbstbewusst ihre Liebhaber auswählt, den hinterlistigen Polizeiminister Maurepas austrickst und nebenbei noch die Staatsgeschäfte steuert, weitgehend von übertriebenen Albernheiten frei. Bei ihm steht die nicht nur vergnügungssüchtige, sondern auch kluge Frau im Mittelpunkt. Er lässt sie Sätze sagen wie „Viele Frauen haben die ganze Brust voll Hirn“ - ein Originalzitat der historischen Pompadour.
Das Karnevalstreiben im „Musenstall“ wird mit phantasievollen Tiermasken verdeutlicht: Der Dichter Calicot, der seine Spottlieder auf die Pompadour singt, tritt als Fuchs auf, andere als Vögel, Katzen oder Schweine. Graf René, auf den die Pompadour ein Auge geworfen hat, kommt im Bärenfell. Der kahlköpfige Maurepas sieht ein wenig aus wie Nosferatu. Am Hofe Ludwigs sind dann alle in wunderbare, weiße Kleider gehüllt. Puder und Perücke - dazu die schwarz-weiße Optik der Bühne mit ihrer besonderen Ästhetik. Ausstatter Christian Robert Müller hat da viel fürs Auge gezaubert. Dazu hübsche Bilder, wenn die Pompadour auf einer Schaukel sitzt oder wenn zu ihrer (hier umgetexteten) Einlage „Du mein Schönbrunn“ aus der „Kaiserin“ Schneeflocken vom Himmel rieseln.

Ganz ausblenden kann Weigner die etwas banaleren Operettenscherze nicht, etwa Maurepas ständige Behauptung „Ich bin schläuer“, das Herumfuchteln mit Banane und Gurke oder die etwas zu lang geratene Anklopfszene. Gleichwohl sichert er seiner Protagonistin Katja Bördner Charme und Persönlichkeit. Bei Bördner ist die Figur der Pompadour eine souveräne Drahtzieherin, die das Leben von der leichten Seite nimmt. Nur als sie auf René verzichten muss, weil der sich als ihr Schwager entpuppt, verliert sie die Contenance. Gesanglich gestaltet sie ihre Partie mit geschmeidigem Sopran ganz hervorragend, ganz besonders ihre gefühlvoll gesungene Einlage. Ihre Zofe Belotte ist bei der quirligen Regine Sturm gut aufgehoben. Tobias Haaks sichert dem René mit virilem Tenor viel Profil und findet nach anfänglichen Schwierigkeiten zu kraftvollem Tenorschmelz. Thomas Burger singt und spielt den Calicot durchweg vergnüglich und übersteht auch die „gefährliche“ Situation beim Duett „Josef, ach Josef, was bist du so keusch“. Carolin Löffler kommt als Schwester der Pompadour mehr zum Sächseln als zum Singen. Oliver Weidinger als König und Schauspieler Peter Wagner als Maurepas sind natürlich die „Trottel vom Dienst“ und sorgen für die unvermeidlichen Scherze.

Das Philharmonische Orchester Bremerhaven wird von Hartmut Brüsch geleitet, der die Finessen der Partitur gekonnt auffächert und die Walzer- und Marschthemen überzeugend erklingen lässt.
Wolfgang Denker, 08.02.2016
Fotos (c) Heiko Sandelmann
PLATÉE
Premiere am 25.12.2015
Opulentes Barockspektakel
Gerade hat das Stadttheater Bremerhaven den erstmalig verliehenen Theaterpreis des Bundes zugesprochen bekommen - nicht zuletzt auch wegen seiner spartenübergreifenden Produktionen. Die diesjährige Weihnachtspremiere in Bremerhaven ist auch so ein Projekt. Dabei hat man es sich mit der Entscheidung für „Platée“ („Die Hochzeit der Platäa“) von Jean-Philippe Rameau nicht leicht gemacht, weil das eher selten gespielte Werk nicht unbedingt ein Selbstläufer ist. Aber die Inszenierung von Hinrich Horstkotte ist derartig wohlgelungen, dass sich das Publikum an einem heiteren, farbenfrohen und bewegenden Abend erfreuen kann.

Rameau hat seine Oper als „Ballet bouffon“ bezeichnet. Es ist eine Ballettoper, bei der Gesang und Tanz fast gleichberechtigt nebeneinander stehen. Uraufgeführt wurde sie 1745 in Versailles anlässlich der Hochzeit von Prinz Louis (dem Sohn von Ludwig XV.) mit der spanischen Infantin Maria Theresia. Diese war nicht gerade mit Schönheit gesegnet. Umso pikanter die Handlung der „Platée“: Da geht es darum, Jupiters Gattin Juno von ihrer Eifersucht zu kurieren, indem ihr vorgegaukelt wird, dass Jupiter die ziemlich hässliche Wassernymphe Platée zu heiraten gedenkt, die im sumpfigen Reich der Frösche zu Hause ist. Junos Verdacht soll damit ad absurdum geführt werden. Tragisch ist nur, dass Platée das zynische Spiel für bare Münze nimmt. Ausgedacht haben sich diese List verschiedene Götter und Musen in weinseliger Laune. Diese Szene bildet den Prolog der Oper.

Hinrich Horstkotte und sein Bühnenbildner Martin Dolnik beschwören in der Inszenierung den ganzen Zauber der Barockoper: prachtvolle Dekorationen aus Pappmaché, knallig bunt und phantasievoll ausgeführt. Diese zweidimensionalen, gemalten Kulissen mit Wellen, Wolken, Vögeln und vielen Überraschungen geben der Aufführung einen besonderen Reiz. Ganz prachtvoll ist die knallgelbe Luxuslimousine (natürlich auch nur aus Pappe), mit der Jupiter in die Szene rollt. Die leichte Ironie, mit der all das serviert wird, ist stets geschmackvoll und ausgewogen. Dem Auge wird viel geboten.
Dazu zählen auch die Kostüme, die ebenfalls von Hinrich Horstkotte entworfen wurden. Sie sind eine gelungene Mischung aus barocker Opulenz, märchenhafter Phantasiewelt und augenzwinkernder Stilisierung, wie sie auch in einer Offenbach-Operette verwendet werden könnten. Jupiter im pompösen Weiß eines Operettenfürsten, Platée im froschfarbenen, ganz unsinnlichen Kleid, Juno hingegen ganz mondän im kleinen Blauen. Thalia und Thespis sehen aus wie Max und Moritz, die ja für das Aushecken von Streichen bekannt sind. Und Merkur ist mit geflügeltem Helm und stets mit dem Fahrrad unterwegs.

Horstkottes Regie bewegt sich überwiegend in komödiantischen Gefilden und erfreut mit liebevollen Details. So posiert Platée wie einst Marilyn Monroe mit wehendem Rock über dem Luftschacht, wenn auch mit ganz anderer Wirkung. Die verschieden Gestalten, in denen Jupiter auftritt, vom Esel und Uhu bis zum Hund fallen vergnüglich aus. Vor allem, wenn Platée dem Hund ein Leckerli anbietet. Dazwischen immer wieder die ausgedehnten Tanzszenen, die nicht losgelöst, sondern immer ganz in das Geschehen integriert sind. Ballettchef Sergei Vanaev hat da ganz hervorragende Arbeit geleistet. Ganz bezaubernd die Szene mit dem „Wasser-Ballett“! Überhaupt das Wetter: Horstkotte verlegt die Handlung fast in Bremerhavener Regionen. Regenschirme sind hier ein oft benötigtes Utensil; und Sturm und Regen peitschen über einen imaginären Deich.

Bei allem Komödiantischen wird aber zunehmend deutlich, dass der armen Platée übel mitgespielt wird und sich ihre Wunschträume in Albträume verwandeln. In einer Traumszene bringt sie ein Baby zur Welt, das zweite „Kind“ ist dann doch ein grüner Frosch. Am Schluss überzeugt Horstkotte mit einem tollen Einfall, bei dem die Stimmung in sekundenschnelle kippt. Platée fliegt die Perücke vom Kopf und sie/er entpuppt sich als Transvestit, der aller Hoffnungen beraubt ist und in Strapsen vor den Scherben seiner Träume steht. Mit einer aus Rameaus Oper „Castor e Pollux“ entliehenen Arie behält Platée das Schlusswort: „Mein Weg ist hier zu Ende“. Eine Szene, die unter die Haut geht, tief berührt und die Komödie auf den letzten Metern noch zur Tragödie wandelt.

Im Mittelpunkt des sehr homogenen, in deutsche Sprache singenden Ensembles steht als Platée der lyrische Tenor François-Nicolas Geslot, der die Partie schon unter Mark Minkowski gesungen hat. Er durchlebt alle Facetten der Rolle von naiver Eitelkeit bis zur besagten, traurigen Schlussszene mit greifbarer Intensität, stimmlich dabei sehr kultiviert und präsent. Leo Yeun-Ku Chu gibt den Jupiter mit profundem Bass, Filippo Bettoschi ist Cithaeron, Tobias Haaks der Merkur, Thomas Burger Thespis, Katja Bördner ist als Thalia und Juno zu hören, Regine Sturm die allegorische Figur der „Verrücktheit“, Manos Kia ist der Gott des Spotts und Carlolin Löffler verkörpert die Liebe.
Marc Niemann und dem Philharmonisches Orchester Bremerhaven gelingt eine Wiedergabe auf höchstem Niveau, die dem tänzerischen Impetus der Musik und dem barocken Klangbild in jedem Moment gerecht wird.
Wolfgang Denker, 26.12.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
LA BOHEME
Premiere am 07.11.2015
Mitten ins Herz
Laut Libretto tummeln sich die vier Künstlerfreunde in Puccinis Oper „La Boheme“ in einer Dachmansarde. In einer Bremer Inszenierung von 2002 lebten sie im Erdgeschoss - und in Bremerhaven sind sie nun im Keller gelandet. Die Inszenierung von Oliver Klöter ist aber trotzdem ganz oben anzusiedeln, weil sie sehr sorgfältig und stimmig bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist und weil sie den emotionalen Gehalt des Werks nicht konterkariert.

Klöters Regie war ein gutes Beispiel für lebendige, sinnvolle Personenführung, die aber trotz vieler witziger Einfälle nie aufdringlich wurde. Selten hat man die vier Freunde so natürlich und unverkrampft agieren sehen. Aber Klöter scheute sich nicht, dort, wo die Musik die großen Gefühle transportiert, ihr den Vortritt zu lassen. So wurde das Liebesduett des 1. Aktes einfach an der Rampe gesungen, weil die Musik schon alles ausdrückte. Aber gut durchdachte oder witzige Aktionen gab es genug. Die Episode mit dem Hauswirt Benoit (Clemens Gnad), der vergeblich versucht, die Miete einzutreiben, war sehr witzig. Köstlich war die Szene im letzten Akt, wo die Bohemiens sich unterhaken und ein paar gekonnte Ballettschritte riskieren. Dass Musetta beim Streit mit Marcello im 3. Akt deutlich beschwipst ist, war ein origineller Einfall. Bei ihrer Auftrittsarie vor dem Café Momus schoss er allerdings etwas über das Ziel hinaus: Wie Musetta ihren Marcello geradezu körperlich anging, war etwas zuviel des Guten. Gleichwohl traf diese „Boheme“-Inszenierung direkt ins Herz. In diesem Sinne hat Klöter, insbesondere auch bei dem emotional sehr berührenden Schluss, einen Volltreffer gelandet.

Daran hat auch die Ausstattung von Darko Petrovic ihren Anteil. Die halb hochgefahrene Bühne zeigte unten die Kellerräume, während oben einsame Passanten durch die Pariser Nacht eilten. Für die Massenszenen des 2. Aktes stand der gesamt Bühnenraum zur Verfügung und konnte sehr sinnvoll genutzt werden. Im 3. Akt schließlich fiel der Blick auf die nebelverhangene Stadtmauer, die in ihrer Trostlosigkeit der Abschiedsstimmung entsprach.

Musikalisch bot das Stadttheater ein Sängerfest. Wer sich allerdings auf Katja Bördner als Mimi gefreut hatte, wurde enttäuscht, weil sie krankheitshalber die Premiere absagen musste. Mit der israelischen Sopranistin Noa Danon von der Magdeburger Oper konnte jedoch ein hervorragender Ersatz gefunden werden. Sie hat verschiedene Preise gewonnen und diverse Meisterkurse besucht, u. a. bei Michèle Crider (die den Bremerhavenern von der Operngala 2004 bekannt ist). Ihre Mimi hatte großes Format. Mit mühelos aufstrahlendem Sopran zeichnete sie alle Empfindungen der Figur sehr differenziert nach. Als Rodolfo gastierte Kwonsoo Jeon, der das Publikum im Sturm eroberte und nach seiner Arie “Che gelida manina” mit spomntanem Beifall belohnt wurde. Er führte seinen hellen und schmelzreichen Tenor sicher durch die Partie und bestach mit ausgesprochen schönem Timbre. Zudem überzeugte er mit jugendlichem, engagiertem Spiel.

Regine Sturm gab die Musetta regiebedingt vielleicht etwas zu quirlig, stimmlich wurde sie der Partie trotz kleiner Abstriche bei der Auftrittsarie durchaus gerecht. Filippo Bettoschi war ein gestandener Marcello und bot ein starkes Rollenporträt. Das Quartett der vier war ein Höhepunkt der Aufführung. Das gilt auch für die Mantelarie des Philosophen Colline, die Leo Yeun-Ku Chu mit rundem, samtweichem Bass gestaltete. Ebenfalls ein Gast war Manos Kia, der dem Schaunard mit sehr markantem Bariton und attraktiver Bühnenerscheinung überdurchschnittliches Profil sicherte.
Marc Niemann dirigierte das bestens disponierte Philharmonische Orchester und den von Jens Olaf Buhrow einstudierten Chor schwelgerisch und mit vielen Farben, deckte die Sänger nicht zu und atmete mit ihnen.
Wolfgang Denker, 09.11.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
ANYTHING GOES
Premiere am 19.09.2015
Eine Seefahrt, die ist lustig
Da ist dem Stadttheater Bremerhaven wieder ein toller Coup gelungen. Schon zum dritten Mal hat Intendant Ulrich Mokrusch ein Musical an den Beginn der Spielzeit gesetzt. Nach „Singin’ in the Rain“ und der „West Side Story“ war es diesmal „Anything Goes“ von Cole Porter. Das Musical entstand 1934 - Porter selbst nannte es „eine seiner zwei perfekten Shows“. Mit der anderen meine er „Kiss me, Kate“. Vielleicht ist der Titel „Anything Goes“ nicht jedem geläufig, aber die darin enthaltenen Songs sind es allemal. Es ist wie eine Hitparade von Porter-Titeln: „I get a kick out of you“, „It’s de-lovely“, „Easy to love“ und viele andere gehören dazu. Sie alle sind von Interpreten wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald oder Louis Armstrong bis heute jedem im Ohr. Denn es ist einfach so: Die musikalische Qualität der „guten alten Stücke“ ist hervorragend und unterscheidet sich wohltuend von der Klang-Soße vieler heutiger Musicals - von der Vielfalt der Melodien und der Originalität des Orchestersatzes ganz zu schweigen.

Gleich bei der schmissigen Ouvertüre ist man entzückt von der jazzigen Musik, die vom Philharmonischen Orchester Bremerhaven hervorragend umgesetzt wurde. „Die Musiker wissen, wie Musical läuft“, meinte Dirigent Ido Arad in einem Gespräch. Und das war auch zu hören. Da blieb in Sachen Schwung, Rhythmus und Präzision kein Wusch offen. Der Streicherapparat war auf eine einzige Geige reduziert, hier hatten die Bläser das Wort. Und was sie zu sagen hatten, war einfach mitreißend. Ido Arad und das Orchester beherrschen das Musical-Genre perfekt. Wie das Orchester und die Solisten die vielen klassischen Songs von Cole Porter, von denen viele Eingang in das „American Songbook“ gefunden haben, zum Leben erweckten, war eine Klasse für sich.

Was passt besser zu Bremerhaven als eine Handlung, die auf einem großen Schiff spielt? „Anything Goes“ ist eine pfiffige Slapstick-Komödie mit vielen Verwechslungen und skurrilen Situationen. Ort des Geschehens ist besagter Dampfer auf der Überfahrt von New York nach London. An Bord tummeln sich der Wall-Street-Makler Whitney und sein Assistent Billy Crocker, der sich aus verzweifelter Liebe zu Hope Harcourt heimlich an Bord geschlichen hat. Hope soll nämlich den spleenigen Lord Oakley heiraten, der wiederum seine Leidenschaft für Reno Sweeney entdeckt, eine sich auch als Predigerin betätigende Nachtklubsängerin. Dass sich auch noch der polizeilich gesuchte Gangster Moonface mit seinem Liebchen Emma an Bord befindet, trägt obendrein zur Verwirrung bei.

Eine Bar, eine Gangway und dann schließlich die monumentalen Schiffaufbauten mit Decks und einem Schornstein gaben den von Bühnenbildner Manfred Breitenfellner gestalteten Rahmen für das turbulente Geschehen. Die Drehbühne sorgte dabei für immer neue Perspektiven. Regisseur Nico Rabenald steuerte den Musical-Dampfer mit viel Spielwitz, mit vergnüglichen Dialogen und mit der furiosen Choreographie von Andrea Danae Kingston sicher bis zum unvermeidlichen Happy End.

Rabenald würzte seine Inszenierung mit vielen liebenswürdigen Details und Pointen. Herrlich, wenn Whitney in der Badewanne sitzt und ein bierzelttaugliches Walzerlied schmettert oder, seiner Brille beraubt, irrtümlich dem Kapitän (Christoph Finger) einen Heiratsantrag macht. Der Kapitän seinerseits verwechselt sein Manuskript und liest bei einer Trauung aus einer Bestattungsansprache. Oder das Gangsterliebchen Emma. Sie soll eine Matrosenuniform besorgen, was ihr mit ihren weiblichen Reizen nicht schwer fällt. Und der eigentlich zunächst zurückhaltende Lord steigert sich, als seine Leidenschaft erst einmal entfacht ist, zu einem köstlichen Balztanz. Überhaupt die Tänze! Die Solisten und das Ballett leisteten auch in dieser Beziehung ganz Hervorragendes. Bezaubernde Stimmung kam bei dem Liebesduett „Easy to love“ auf, wenn die Bühne in blaues Licht getaucht wird und Billy mit Hope traumverloren tanzt. Und Renos „Predigt“ erwies sich als opulente Shownummer („Blow, Gabriel, blow“).

Das Ensemble sang, spielte und tanzte ohne Ausnahme auf hervorragendem Niveau. Sopranistin Regine Sturm als Hope erwies sich einmal mehr als sehr musicaltauglich, Michael Ernst war als Billy Crocker ein sympathischer Tausendsassa. Dorothea Maria Müller war als Reno eine Art Drahtzieherin, die als einzige den coolen Überblick hatte. Oliver Weidinger gab einen prachtvoller Whitney ab, Alexander Kerbst war ein formvollendeter Lord, der sich zu wahrer Leidenschaft beflügeln ließ. Die Gangsterbraut Emma wurde von Carolin Löffler sehr sexy gespielt und zeigte in ihrem Solo beachtliches Stimmpotential. Isabel Zeumer verkörperte die Mutter von Hope. Und Thomas Burger bereitete als schlitzohriger Gangster Moonface reinstes Vergnügen. Und dass die Dialoge in deutscher Sprache, die Songs aber im englischen Original geboten wurden, war eine gute Lösung. Also: Ein Spielzeitauftakt nach Maß!
Wolfgang Denker, 21.09.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
LA RONDINE
Premiere am 30.05.2015
Puccini-Rarität in origineller Inszenierung
Selbst wenn die Deutsche Oper Berlin auch gerade Puccinis Oper „La Rondine“ („Die Schwalbe“) herausgebracht hat, ist sie auf den Bühnen doch eine veritable Rarität. Das Stadttheater Bremerhaven stellt sie in einer originellen Inszenierung vor.

Wunderbare Kantilenen, melodischer Reichtum, große Chorszenen und eine sentimentale Herz-Schmerz-Geschichte - eigentlich ist es nicht zu verstehen, dass Giacomo Puccinis Oper „La Rondine“ („Die Schwalbe“) so selten gespielt wird. Auch in Bremerhaven erklang sie erstmalig. An der Musik liegt es jedenfalls nicht. Sie ist bester Puccini, auch wenn stellenweise (bei Walzerthemen) durchaus zu hören ist, dass die „Rondine“ ursprünglich eine Operette werden sollte. Auch das Vorspiel zum 3. Akt zeigt die Nähe zu Franz Lehar. Aber letztlich ist das Werk mit seinen leidenschaftlichen Duetten und Arien und mit dem Chor im 2. Akt doch eine richtige Oper geworden, die mitunter an „La Boheme“ erinnert und in der Instrumentation auch schon auf „Gianni Schicchi“ verweist. Puccini hat sein Werk als „Lyrische Komödie“ bezeichnet.

Vielleicht liegt die Seltenheit der Oper eher am Libretto, denn an Handlung passiert nicht viel. Zunächst wird mit dem Dichter Prunier über die Liebe philosophiert, dann verlieben sich Magda, die Geliebte Rambaldos, und der junge Ruggero ineinander, um sich dann, wenn Ruggero das Thema Ehe anschneidet, wieder zu trennen. Für den Schluss gibt es mehrere Fassungen. Eigentlich lässt Magda den völlig verzweifelten Ruggero zurück, aber in der in Bremerhaven gespielten Version verstößt Ruggero seine Geliebte.
Dass Magda eigentlich eine Kurtisane ist, fällt in der Inszenierung von Philipp Kochheim unter den Tisch. Er hat für die Geschichte eine „zweite Ebene“ eingezogen, indem er die Handlung in einem Opernhaus spielen lässt und wir uns in den Akten zunächst auf einer Konzeptionsprobe, dann auf einer Bühnenprobe und schließlich nach der fiktiven Premiere in der Künstlergarderobe befinden. Der Dichter Prunier fungiert hier als Regisseur, Rambaldo ist der Intendant. Ruggero ist hier ein Tenor, der zum Vorsingen erscheint. Er wird mit der effektvollen Arie „Parigi ė la città die desideri“ eingeführt, die aus der 2. Fassung der „Rondine“ übernommen wurde.

Kochheims Sichtweise ist sehr geschickt, denn dadurch sind die Gefühle per se zunächst nur gespielt und die Grenzen zwischen Schein und Realität sind fließend. Es ist sehr reizvoll, zu „raten“ wann und ob wirkliche Liebe ins Spiel kommt. Und das Konzept geht überraschend gut mit dem eigentlichen Inhalt der Oper überein. Kochheims Personenführung ist sehr ausgefeilt und spart nicht mit kleinen Persiflagen auf den Opernbetrieb. Barbara Bloch hat dazu helle, freundliche Bühnenräume geschaffen, wobei im 2. Akt ein riesiges Bett als Spielwiese dient.

Die bekannteste Arie ist „Che il bel sogno di Doretta“, die von Katja Bördner mit traumwandlerischer Sicherheit und ätherischem Höhenglanz gesungen wurde. Ihre Gestaltung der Magda, elegant im Hosenanzug und lässig eine Zigarette rauchend, faszinierte gesanglich und darstellerisch, wobei sie sehr deutlich machte, wie ihre Gefühle sich wandelten. Als Ruggero gastierte Daniel Szeili, dessen Tenor mit schöner Mittellage erfreute. Aber er differenzierte zu wenig und hatte in den Höhen deutliche Probleme. Schade, dass man die Partie nicht Tobias Haaks gegeben hat, der als Prunier mit weichem und schmelzreichem Tenor rundum überzeugte. Die von ihm verehrte Lisette fand in Regine Sturm eine quirlige, kokette Interpretin (alternativ mit Réka Kristóf besetzt). Filippo Bettoschi sang den Ramboldo (eigentlich ein reicher Bankier) sehr souverän und sicherte der Figur sogar Sympathie. In kleineren Partien sammelten Studentinnen der umliegenden Hochschulen für Musik erfolgreich erste Bühnenerfahrungen: Santa Bulatova (Bremen), Helena Castro.Ferreira (Hamburg) und Anna-Doris Capitelli (Hannover).

Marc Niemann und die Bremerhavener Philharmoniker erweckten Puccinis süffige und melodienselige Musik mit Herzblut zum Leben. Anfangs war der Orchesterklang noch etwas herb, aber dann tauchten sie mit viel Sinn für die großen Aufschwünge in Puccinis Klangwelten ein. Besonders großartig gelangen die Chorszenen des 2. Aktes (in der hervorragenden Einstudierung von Jens Olaf Buhrow) und das berührende Finale. Wer Puccini liebt, sollte sich die Aufführung auf keinen Fall entgehen lassen.
Wolfgang Denker, 31.05.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
Opernfreund-CD-Tipp

ZAR UND ZIMMERMANN
Premiere am 25.04.2015
Der Bürgermeister macht Wahlkampf
Die Zeiten, in denen die Werke von Albert Lortzing fester Bestandteil in den deutschen Theatern waren, sind lange vorbei. Umso mehr kann man sich freuen, wenn das Stadttheater Bremerhaven einen Lortzing auf die Bühne bringt. Die Wahl fiel auf „Zar und Zimmermann“ und damit auf die wohl populärste Oper Lortzings. Natürlich wäre es reizvoll gewesen, vielleicht auch mal seinen „Hans Sachs“ oder seine „Regina“ auszugraben, aber mit Blick auf das Bremerhavener Publikum, das sich mit unbekannteren Werken etwas schwer tut, ist die Entscheidung legitim. Die ausverkaufte Premiere bestätigt das.

Im Land Bremen herrscht Wahlkampf. Wer das noch nicht bemerkt hat, sollte sich diesen „Zar und Zimmermann“ ansehen. Denn dort marschiert der aufgeblasene Bürgermeister van Bett bei seinem Auftritt beifallheischend durch das Publikum, wobei sein Adlatus Rosen und er selbst seine Visitenkarte verteilt. „Ehrlich gemeinsam weiterkommen!“ stand da als Politphrase drauf. Das war einer der vergnüglichen Einfälle, die der britische Regisseur Walter Sutcliffe seiner Inszenierung mit auf den Weg gab. Und auch den Schauplatz (eigentlich eine Schiffswerft in der holländischen Stadt Saardam) rückte er an die Seestadt heran - genauer in ein Container-Terminal. Das war durchaus stimmig und passte zum Werk: Die bunten, riesigen Container rund um die Spielfläche boten einen attraktiven Rahmen (Bühnenbild und Kostüme von Okarina Peter und Timo Dentler). Hier verbringen die Arbeiter mit ihren Schutzhelmen die Mittagspause und werden von der Witwe Browe (Hannah von Peinen), die hier zur Kantinenwirtin mutiert ist, versorgt. Nur der Zar schleppt Kisten und ist ordentlich am arbeiten.

Das Bühnenbild hatte aber auch Nachteile. Weil es nicht nach hinten geöffnet werden konnte, musste für den Abschied des Zaren eine Notlösung herhalten: Der Zar schwingt wie Tarzan an einem Seil herein, verabschiedet sich und entschwindet nach oben, während der erfolglose englische Gesandte das Mobiliar zertrümmert. Das war wenig überzeugend. Trotzdem geriet die Inszenierung trotz einiger Einwände im Detail insgesamt sehr unterhaltsam. Denn Sutcliffe hatte im ersten Teil ein glückliches Händchen für komödiantische Aktionen. Er überzeugte mit weitgehend ausgefeilter Personenführung und mit guter Charakterisierung. Das fing mit dem Bürgermeister van Bett an. Mit Oliver Weidinger hatte er auch einen Sänger an der Hand, der alle Register seines komödiantischen Talents zog, der gesanglich mit markantem Bass auftrumpfte und als Figur keineswegs nur der Trottel vom Dienst war. Gerade das machte den Reiz der Politiker-Parodie aus. Der Gag mit dem mobilen Klo, in dem irgendwann auch der Bürgermeister verschwindet und durch lautes Ächzen alle an seinem Tun teilhaben lässt, war hingegen grenzwertig.

Im zweiten Akt findet eine Hochzeit statt, aber es ist eher eine Art Betriebsfest, bei dem eine Discokugel vom Bühnenhimmel kommt und der Marquis von Chateauneuf zu einem (zum Glück stummen) Mikrofon greift und seine Arie „Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen“ wie eine Schlagereinlage singt. Ebenso macht es später der Zar bei seinem „Sonst spielt’ ich mit Zepter, mit Krone und Stern“ - ein Einfall, der durch Wiederholung nicht besser wird. Gut gelöst war hingegen das Sextett, bei dem die Gruppen nicht jede in einer Ecke verhandeln, sondern immer wieder durch die Menge wuseln. Das brachte Bewegung und verstärkte das Verwirrspiel.
Die Regie offenbarte dann aber doch zunehmend einige Schwächen. Die endlose (und lautstarke) Polonaise gehörte ebenso dazu wie die nicht überzeugend ausgefallene Prügelei, in der der Regisseur Parallelen zu den „Meistersingern“ sehen will. Die Razzia durch die Bundespolizei (mit einem lahmen Gustav Klitsch als Oberinspektor) hatte wenig Witz. Und der Holzschuhtanz, bei dem nur ein Video aus dem Container-Terminal gezeigt wurde, hätte liebloser nicht behandelt werden können. Eine der beliebtesten Nummern der Oper ging so fast völlig unter. Daher gab es am Ende doch auch einige Buhrufe für die Regie. Dennoch: Die positiven Aspekte der Inszenierung überwiegen.

Solisten, Dirigent und Orchester wurden hingegen einhellig gefeiert. Die Tatsache, dass Lortzings Oper hier fast völlig ohne Striche gegeben wurde, konnte man genießen, denn Ido Arad am Pult der Bremerhavener Philharmoniker leistete Hervorragendes. Das zeigte sich schon in der lebendig und präzise musizierten Ouvertüre. Das Orchester befindet sich momentan in sehr guter Verfassung und trug das hohe Niveau durch die gesamte Aufführung. Lob auch für den von Jens Olaf Buhrow einstudierten Chor.

Filippo Bettoschi war zwar kein Zar aus „Samt und Seide“, aber einer mit kantigem Profil und markantem, strömend geführtem Bariton. Die Figur bekam bei ihm Gewicht und viel Ausstrahlung. Auch die Marie, die Nichte des Bürgermeisters, fand in Regine Sturm eine attraktive Interpretin, die mit klarem, über das Soubrettenfach hinausweisendem Sopran ihrem Peter Iwanow gehörig einheizte und auch sonst als blonder, „heißer Feger“ in feuerrotem Kleid den Männern schon den Kopf verdrehen konnte. Besonders dem Marquis von Chateauneuf, der mit Tobias Haaks luxuriös besetzt war und der mit schmelzreichem Tenor sang. Kleine Anfangsschwierigkeiten waren schnell überwunden. Thomas Burger war der in Marie verliebte Peter Iwanow, den er mit besonderer Spielfreude und beweglichem Tenor sympathisch darstellte. Gesanglich mit seiner fülligen Bassstimme wieder einmal aus dem Ensemble herausragend war Leo Yeun-Ku Chu als englischer Gesandter. Der russische Gesandte, der seine Informationen immer als SMS erhielt, war Mathias Tönges von der Bremer Musikhochschule.
Wolfgang Denker, 27.04.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
DIE BLUTHOCHZEIT
Premiere am 14.03.2015 besuchte Aufführung: 27.03.2015
Rot ist die Liebe und rot ist das Blut
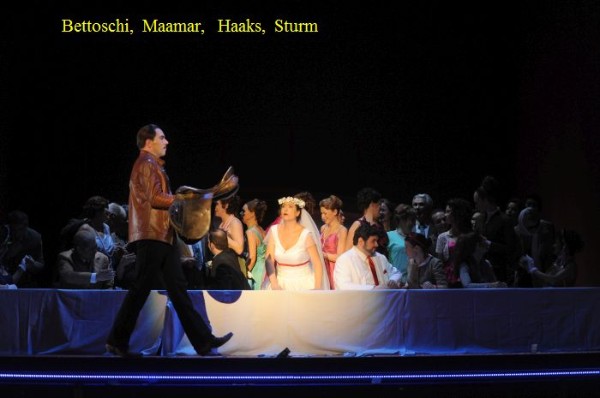
Es ist eine absolute Rarität, die das Stadttheater Bremerhaven mit der Oper „Die Bluthochzeit“ („Vérnász“) von Sándor Szokolay (1931 – 2013) in dieser Spielzeit bietet. Sie basiert auf dem Schauspiel „Bodas de sangre“ von Federico Garcia Lorca. Darin geht es um eine junge Frau (die Braut), die sich am Tage ihrer (arrangierten) Hochzeit von ihrem ehemaligen Verlobten Leonardo, den sie noch immer liebt, entführen lässt. Der hat zwar inzwischen selbst Frau und Kind, aber das hindert ihn nicht. Der Bräutigam nimmt die Verfolgung auf. Es kommt zu einem für ihn und Leonardo tödlichen Messerzweikampf. Die Mutter des Bräutigams bleibt zurück und verflucht das Messer, das ihr einst schon den Ehemann und einen anderen Sohn genommen hat.

Szokolays Oper wurde 1964 in Budapest uraufgeführt. Es war nicht die erste Vertonung dieses in ihrer expressiven Emotionalität der „Cavalleria rusticana“ nicht unähnlichen Dramas um Eifersucht und Rache. 1956 hatte der spanische Komponist Juan José Castro eine Oper nach Lorcas Stück geschrieben; 1957 folgte Wolfgang Fortner mit seiner bei uns bekannteren Oper „Bluthochzeit“. Die unterscheidet sich in ihrer musikalischen Substanz aber grundsätzlich vom Szokolays Werk. Bei Fortner ist eher kammermusikalische Zwölftonmusik zu hören, während Szokolays Musik in der Tradition eines Bartók, Strawinsky oder (was den Sprechgesang und die Verwendung von Folklore-Elementen angeht) auch Janáček steht. Gleich vom ersten Orchesterschlag an ist man von der unbändigen Kraft und der archaischen Urgewalt dieser Musik gefangen. Es ist eine Musik, die sich mit ihren stampfenden Rhythmen und ihrer dramatischen Wucht überwiegend im Fortissimo-Bereich bewegt und in ihrer fiebrigen Emotionalität kaum Gelegenheit zum Atemholen bietet. Erst im letzten Akt finden sich auch leisere Töne, wenn die allegorischen Figuren des Mondes, des Todes (hier als obdachlose Bettlerin) und der drei Holzfäller auftreten. Marc Niemann am Pult der wie entfesselt aufspielenden Bremerhavener Philharmoniker sicherte dieser die Grenzen der Expressivität oft sprengenden Musik nicht nur in den aufwühlenden Zwischenspielen eine faszinierende Intensität.

Kongenial war die Regie und Ausstattung von Andrzej Woron, der ein klar strukturiertes Bühnenbild und symbolkräftige Farboptik zum Einsatz brachte. Das Bühnenportal wird von einem großen Rahmen mit LED-Lämpchen begrenzt, die mal weiß, mal rot leuchten, etwa wenn die Braut und Leonardo sich (wieder) näher kommen. Rot ist die Farbe der Liebe, aber auch die des Blutes. Leonardos Frau und ihre Schwiegermutter sieht man mit Kinderwagen in einer engen, rosaroten Behausung, obwohl deren Situation alles andere als rosarot ist. Die Liebeszene zwischen Leonardo und der Braut findet in einem hoch über der Bühne schwebenden Käfig statt. Auf dem thront später auch der wie ein Clown kostümierte Mond. Und für den tödlichen Zweikampf werden Leonardo und der Bräutigam wie Marionetten an Strippen hochgezogen, wobei im Hintergrund eine schicksalsdräuende Kreissäge zu sehen ist.

Das Ensemble und die Chöre (Opernchor, Extrachor und Kinderchor - alle von Jens Olaf Buhrow trefflich einstudiert) waren extrem gefordert. Beate-Maria Vorwerk gab die dominante, aber auch sorgenvoll verhärmte Mutter wie eine griechische Tragödin, fast wie eine „Schwester“ der Küsterin. Yamina Maamar war mit kraftvollem, die Orchesterfluten durchschneidendem Sopran eine intensive Braut. Filippo Bettoschi war mit virilem Bariton der kaltschnäuzige Leonardo, der seinen Sattel herumschleppte, um mit der Braut fortzureiten. Als heißblütiger, von Rache getriebener Bräutigam setzte Tobias Haaks seinen robusten Tenor adäquat ein. Leonardos Frau litt in der Gestalt von Annabelle Pichler hilflos vor sich hin, ihrer Schwiegermutter gab Kathrin Verena Bücher skurriles Profil. Regine Sturm war ein engagiertes Dienstmädchen, das trotz aller Warnungen die Katastrophe nicht verhindern konnte. Mit gleißendem Tenor setzte Thomas Burger als Mond besondere Akzente. Svetlana Smolentseva war mit dunklem Mezzo ein geheimnisvoller Tod und Leo Yeun-Ku Chu gab mit profundem Bass den leutseligen Vater der Braut. Ein bereichernder und unbedingt sehenswerter Opernabend!
Wolfgang Denker, 28.3.2015
Fotos von Heiko Sandelmann
DER VETTER AUS DINGSDA
Premiere am 31.01.2015 besuchte Aufführung: 04.02.2015
Roderich rutschen die Hosen

Es „vettert“ in den Theatern unserer Region. Drei Wochen nach einer vergnüglichen Produktion der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke in Oldenburg legte nun das Stadttheater Bremerhaven nach. Hier wie dort darf man sich der Zustimmung des Publikums gewiss sein. Denn die Geschichte bietet mit ihren vielen Verwicklungen und den skurrilen Charakteren genug Stoff für boulevardartige Komödie - wenn man die Möglichkeiten denn auch nutzt. Zur Erinnerung: Julia schwärmt seit Jahren für ihren Freund Roderich aus Kindertagen, der nach Batavia (nach „Dingsda“) ausgewandert ist und sie längst vergessen hat. Noch steht sie unter der Vormundschaft von Onkel Josse und Tante Wimpel, die sie mit ihrem Neffen August Kuhbrot verheiraten wollen, um den Zugriff auf Julias Vermögen zu sichern. Nach einigen Turbulenzen finden sich die richtigen Paare: Julias Freundin Hannchen und der echte Roderich sowie dann tatsächlich Julia und August, der sich vorher als Roderich ausgegeben hat. Und alle fallen sich in die Arme, sogar die beiden Diener. Nur der täppische Egon von Wildenhagen geht wieder leer aus.

Regisseur Ansgar Weigner, der in Bremerhaven vor einem Jahr eine herausragende „Gräfin Mariza“ inszeniert hatte, brachte für den „Vetter“ zwar durchaus viele Einfälle mit, aber so richtig zünden wollte der Funke nicht. Auch wenn manche Figuren wie Hannchen oder Onkel Josse an die Klim-Bim-Familie erinnerten. Zwar flogen keine Sahnetorten, aber Roderich rutschte die Hose herunter und gab den Blick auf seine geblümte Unterhose frei - ein Gag, der erstaunlicherweise immer noch Lacher auslöst. Bei einem hinzuerfundenen Opa, der wie ein Möbelstück in seinem Rollstuhl hin und her geschoben wurde, wartete man vergeblich auf die Pointe. Auch für das Dienerpaar (Leo Yeun-Ku Chu und Stefan Hahn) hätte man sich komischere Szenen vorstellen können. Und der Batavia-Fox wurde mit etwas gebremstem Übermut serviert, da war in Oldenburg mehr los.

Hübsch war die Szene, bei der die Diener zu Julias Arie eine Mondlaterne über den Orchestergraben hielten. Die Wortspielereien mit dem Namen Wildenhagen waren dafür eher flau. Allerdings hatte Regisseur Weigner einen sehr unter die Haut gehenden Einfall: Wenn der falsche Roderich alias August Kuhbrot entlarvt und fortgejagt wird, verdunkelt sich die Bühne und er singt „Fremd bin ich eingezogen“ aus Schuberts „Winterreise“. Ein wunderbarer Moment des Innehaltens, bei dem die Operettengefühle sich plötzlich in tiefe Emotionen verwandeln. Zudem sang Tenor Tobias Haaks dieses tieftraurige Lied über Einsamkeit mit berührender Schlichtheit. Überhaupt war Haaks für die Partie des Fremden eine stimmlich ausgezeichnete Besetzung; er servierte nicht nur den Hauptschlager „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ mit fast italienischem Schmelz. Da war er seinem Oldenburger Kollegen etwas überlegen, auch wenn er darstellerisch im schweinchenrosa Anzug eher Teddybären-Charme ausstrahlte. Katja Bördner war als etwas überspannte Julia, die auch schon mal in Ohnmacht fällt, mit ihrem lyrischen Ausnahmesopran musikalisch ebenfalls ein Genuss. Den „Strahlenden Mond“ besang sie mit reinstem Wohlklang. Hannchen mit Brille und Pferdeschwanz, von Regine Sturm manchmal etwas spitz gesungen, brachte viel Temperament auf die Bühne, Thomas Burger als verklemmter Egon von Wildenhagen sorgte mit präsentem Tenorbuffo für dezente Komik. Filippo Bettoschi war der echte Roderich, der als Flieger buchstäblich vom Himmel fiel und Hannchen mit unwiderstehlichem Charme umgarnte. Oliver Weidinger war ein stets nach einem Schnitzel verlangender, zackiger Josse. Isabel Zeumer als Tante Wimpel war etwas gewöhnungsbedürftig - wie sie aber aus dem Klavier immer wieder geistige Getränke zauberte, hatte schon was.

In Oldenburg war das Orchester (zwar sehr gelungen) auf Kammerbesetzung reduziert, aber in Bremerhaven brachte das Philharmonische Orchester den vollen Künneke-Klang zur Geltung. Das war doch ein Gewinn, besonders wenn ein so versierter Operetten-Kenner wie Hartmut Brüsch am Pult steht, der die schmissige Musik in all ihren Facetten aufblätterte und der raffinierten Orchestrierung zu ihrem Recht verhalf.
Szenisch geht trotz des hellen Bühnenbilds (etwas heruntergekommener Speisesaal, dessen ehemaliger Glanz aber noch deutlich wurde) von Christian Floeren der Punkt nach Oldenburg, musikalisch eher nach Bremerhaven. Dennoch sollte man sich die Bremer Inszenierung aus dem Jahr 2010 (damals mit Steffi Lehmann und Karsten Küsters) ins Gedächtnis rufen. An die reichen beide Neuproduktionen nicht heran.
Wolfgang Denker, 5.2.2015
Fotos von Heiko Sandelmann