

www.staatstheater.karlsruhe.de
TURANDOT
Premiere am 25. Januar 2020
Das Badische Staatstheater Karlsruhe kam nun mit einer optisch beachtlichen „Turandot“- Produktion heraus, die schon das Licht der Welt im Rahmen einer Koproduktion mit dem Teatro Massimo Palermo (Januar 2019) erblickte und an der auch das Teatro Comunale di Bologna beteiligt ist. Vor der Premiere lud das Staatstheater zusammen mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe-ZKM Medienkünstler und Theatermacher zu einem Oper- und Medienkunst-Symposium ein, als weiteren Beitrag in seiner Reihe „Oper und Medienkunst“. Das Symposium ging der Frage nach, wie die Oper mit den heute verfügbaren digitalen Technologien in 50 Jahren aussehen könnte. Nur in 50?!
So stand die „Turandot“- Inszenierung, vom italienischen Regisseur Fabio Cherstich in Zusammenarbeit mit dem russischen Videokunstkollektiv AES&F (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky + Vladimir Fridkes) inszeniert, auch ganz im Zeichen dieser Technologien, zu denen am ZKM fleißig geforscht wird. Vor Jahren erlebte ich bei der Münchner Biennale unter ihrem damaligen Intendanten Peter Ruzicka ein interessantes Projekt des ZKM.

Mit vornehmlich visuellen Mitteln auf einem dreiflächigen Bildschirm hinter der Bühne (etwa wie ein mittelalterlicher Klappaltar) und der Lichtregie von Marco Giusti versucht das Regieteam, mit der Bebilderung der Vergangenheit, die Turandot zu ihrem furchtbaren Gelübde gebracht hat und weshalb sie permanent „Rache an allen Heiratswilligen“ nimmt, die Auflösung dieses Traumas durch ihr Erkennen der Zuneigung Calafs zu zeigen. Auch das bis dahin manipulierte Volk wird dabei erstmalig zur Empfindung von Gefühlen wie Empathie und Güte fähig. Am Ende wird statt der Bedrängung des weiblichen Geschlechts durch den Mann in der weit zurückliegenden Vergangenheit (und das Regieteam meint wohl auch in der Gegenwart…) ein utopisches Bild von Harmonie und Liebe auf Lotus- und allen anderen möglichen Blumen Postuliert: Frauen mit Männern, deren abgeschnittene Köpfe noch kurz zuvor auf Blüten über die Leinwand schwebten, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und alle miteinander. Wer weiß schon, ob das in überschaubarer Ferne als Normalität noch Utopie ist - wahrscheinlich nicht, eigentlich ja schon heute nicht…

Nach starkem poetischem und surrealistischem Beginn, vor allem mit faszinierenden Bildern einer futuristischen chinesischen Großstadt mit unzähligen unaufhaltsam kreisenden Flugobjekten bei Tag und Nacht - es könnte wegen des Meeres im Hintergrund Shanghai sein, und deshalb nicht Peking, wie im Programmheft spekuliert wird - die sich aber eng an „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahre 1927 anlehnen und einige Bezüge aus der architektonischen Ästhetik der Londoner City aufweisen, wird immer mehr deutlich, dass vor der überbordenden und sich ständig bewegenden Bilderflut das eigentliche Operngeschehen zu kurz kommt, ja bisweilen verloren geht. Der Bilderwirbel dringt sogar in einen imposanten blutroten Riesendrachen ein, der durch die Lüfte und einmal sogar durch das All kurvt. Er beherbergt in seinem Innern die - wie sollte es anders sein - nur mit Unterhosen bekleideten Opfer Turandots in allen möglichen Verrenkungen und Malträtierungen durch geschlechtslos wirkende chinesische quallen- oder tintenfischartige Frauenkonstruktionen ausgesetzt. Später kommen die acht Männer auf dem Fließband in eine Art chop-off Maschine. Ihre Hälse sind so sauber abgeschnitten wie der Hinterbeinschinken beim Metzgermeister…

Trotz aller immer wieder beeindruckenden Bilder, aber ohne entsprechend angereicherte Personenregie „am Boden“ (AES&F machte mit dieser „Turandot“ seine erste Musiktheater-Produktion überhaupt) gleitet das Ganze im 3. Akt in Edelkitsch ab, der seinen Höhepunkt im Finale mit einem sich auf und ab wiegenden chinesischen Riesenbaby findet, schon jetzt viel zu dick und aufgeplustert, mit den früheren Opfern, sei es Mann oder Frau, in Miniatur zärtlich gestikulierend auf seinen Armen und Beinen sitzend. Auch wenn das, wie die dann noch auftretende Miezekatze, parodistisch gemeint sein sollte, so kam es in Bezug auf die Oper „Turandot“ nicht recht rüber. Was so oft passiert, wenn ein Regisseur eine gute Idee hat, he gets carried away with it. Man spielt dasselbe bis zu Abwinken, obwohl eine sparsamere Dosierung fast immer mehr wäre, vor allem dramaturgisch, wo hier einiges verpasst wurde, was man durchaus hätte machen können. So wäre auch eine intensivere Kongruenz der Bilderwelt in Einklang mit dem eigentlichen Operngeschehen „am Boden“ wünschenswert gewesen. Es stellte sich zumindest für mich stärker noch als sonst derzeit einmal mehr die Frage, wieweit das Medium Film und Video in der Oper überhaupt gehen kann und sollte…

Elena Mikhailenko a.G. sang eine statische Turandot mit kräftiger Stimme, aber angestrengter Höhe und geringster Wortdeutlichkeit. Sie blieb gegen den charismatischen Rodrigo Porras Garulo blass, offenbar ein Publikumsliebling, und das durchaus zu Recht, denn er spielte und sang den Calaf intensiv, emphatisch, mit guter Mimik und einem Tenor, der manchmal eher ins Wagnerfach zu weisen schien als den letzten Forderungen italienischer Gesangskunst und Farbgebung sowie Italianità zu entsprechen. Sehr steigern konnte sich über den Abend die junge Agnieszka Tomaszewska als Liù, die mit ihrer finalen Arie die Herzen aufgingen ließ. Unter den drei Ministern ragte Vazgen Gazaryan als Ping heraus. Vazgen Gazaryan war ein sonorer Timur, Ks. Klaus Schneider ein guter Pang und Matthias Wohlbrecht ein Pong, der ihm mehr lag als der kürzlich hier gesungene Max. Ks. Johannes Eidloth sang den Altoum, und Seung-Gi Jung bestach als klangvoll prägnanter Mandarin.

Der von Ulrich Wagner einstudierte Chor und Extrachor des Badisches Staatstheaters und der Cantus Juvenum Karlsruhe e.V. sangen außerordentlich gut und transparent. Sie bekamen zu Recht den meisten Applaus, neben Garulo. Johannes Willig dirigierte die Badische Staatskapelle mit außerordentlich viel Verve und für meinen Geschmack in einer Reihe von Momenten, insbesondere bei den großen Tableaus, zu laut. Pathos war offenbar angesagt.
Fotos: Falk von Traubenberg
Weitere Aufführungen am 25.4., 15. und 24.5.,11. und 18.6. und 24.7.20.
Klaus Billand/20.3.2020
www.klaus-billand.com
Straßburg und Karlsruhe:
Herbst-Konferenz von OPERA EUROPA „Building Bridges“ oder: Wie es mit der Oper weitergeht/weitergehen könnte… – 24.-27. Oktober 2019
Hier geht es zum ausführlichen Konferenzbericht von Klaus Billand
DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN
Besuchte Vorstellung: 25. Oktober 2019
Viel Poesie und Leidenschaft…
Das Badische Staatstheater Karlsruhe brachte im Dezember letzten Jahres eine überaus phantasievolle und allenfalls vordergründig auf Kinder zugeschnittene Produktion des „Schlauen Füchslein“ von Leos Janáček heraus. Regisseur ist Yuval Sharon, bekanntlich „Co-Regisseur“ des Bayreuther „Lohengrin“, auch wenn er als Regisseur neben den Bühnen- und Kostümbildnern Neo Rauch und Rosa Loy geführt wird. Für Sharon ist „Das schlaue Füchslein“, wie er im sehr schön bebilderten und inhaltvollen Programmheft darlegt, „wie ein ruheloses, wildes Tier, das sich jedem Versuch, es mit einfachen Erklärungen oder symbolischen Interpretationen zu zähmen, widersetzt.“ Man müsse ein Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen herstellen. „Die Aufführung soll spielerisch, aber nicht kindisch sein, poetisch, aber nicht schwerfällig, mitfühlend, aber nicht sentimental, phantasievoll, aber zuerst und vor allem die Phantasie des Publikums anregen.“ Es lässt sich einfach nicht besser als mit diesem Zitat des Regisseurs beschreiben, was er mit dramaturgischer Unterstützung durch Boris Kehrmann auf der Karlsruher Bühne erreicht hat, mit dem Orchester direkt vor dem Bühnenbild - als Teil der Produktion auch optisch beteiligt. All dies ist sein „Schlaues Füchslein“ geworden.

Im Rahmen einer bestechenden technischen Animation der Walter Robot Studios sowie Bill Barminski&Christopher Louie mit Projektion und Licht von Jason H. Thompson auf einem dreiflächigen bunten und immer neue Naturstimmungen wiedergebenden Bühnenscreen im Hintergrund, treten die Tiere aus Öffnungen nur mit den Köpfen hervor, in fantasievollen Masken von Cristina Waltz. Das wirkt spielerisch, wenngleich ihre Dialoge an Intensität gewinnen, weil man sich so konzentrieren muss, welcher Tierkopf nun grade mal wieder und wo auf der großen Leinwand erscheint und zu singen beginnt. Die Füchsin agiert als Protagonistin als bewegtes Bild auf der gesamten Leinwand und fügt so gewissermaßen die verschiedenen Kommentare der Tiere auch dramaturgisch zu einer Handlung im ästhetisch alles dominierenden Wald zusammen. Sie bewirkt somit auch eine optische Dynamik von stets großer Poesie. Das wird besonders deutlich, als die Tiere es gemeinsam mit ihr schaffen, den unfreundlichen Dachs aus seinem Bau zu vertreiben, in den er die Füchsin nicht einlassen wollte. Man wird auf eine modern-romantische Art und Weise Zeuge einer imaginären Welt, die dennoch ungemein viel mit der unsrigen zu tun hat. Darin liegt ja auch der eigentliche Aussagewert dieser Oper von Janáček, die er zunächst als „Opernpantomime“ komponierte und später als „Waldidyll“ bezeichnete…

Eine andere und noch intensivere Ebene der Darstellung wird erreicht, als Fuchs und Füchsin zu ihren Liebesannährungen und der anschließenden verklärten Hochzeit im Schneeregen als wirkliche menschliche Figuren im Fuchskostüm in Erscheinung treten. Halt so, wie man sie in traditionellen Inszenierungen meist sieht. So bekommen diese Momente mit den übrigen Tieren im Hintergrund angedeutet und dem Specht, der die Hochzeit noch auf den letzten Drücker durchführt, eine ganz eigene poetische Note. Die Polin Agnieszka Tomaszewska als Füchslein Schlaukopf singt mit einem facettenreichen Sopran und ist ansonsten im Karlsruher Ensemble auch als Pamina, Fiordiligi, Gretel, Adina und sogar Freia unterwegs. Die türkische Mezzosopranistin Dilara Bastar als Fuchs gehört ebenfalls zum Ensemble und kann dem Sopran der Füchsin einen klangvollen Mezzo entgegensetzen und somit ihre Rolle als Fuchs auch vokal bestens zu Gehör bringen. Bastar wird hier noch in dieser Saison die Muse und Niklausse in „Hoffmanns Erzählungen“ singen.

Die Menschen treten natürlich ohnehin ad personam auf, und zwar auf einer schmalen Bühnenfläche hinter dem Orchester in rustikalem Ambiente, auch was die Kostüme von Ann Cross-Farley angeht - eine Art Gegengewalt zu jener der Tiere im Wald. Alle können ebenfalls stimmlich voll überzeugen, so Ks. Armin Kolarczyk als Förster, Christina Niessen als Frau Försterin, in Karlsruhe auch Kundry, Brangäne und Gutrune eingesetzt, Ks. Klaus Schneider als Schulmeister und von Hause aus passionierter Liedsänger, Nathanael Tavernier a.G. als Pfarrer und Dachs, ebenfalls begeisterter Liedsänger und Preisträger des ADAMI Classique. Der Koreaner Seung Gi Jung wartet als Haraschta und Landstreicher mit einem klangschönen und voluminösen Bariton auf, der nicht überraschen lässt, dass er in Karlsruhe auch Rollen wie Macbeth, Simon Boccanegra, Kurwenal, Donner und Scarpia singt und bald am Teatro San Carlo di Napoli als Renato in „Ein Maskenball“ gastieren wird. Der Badische Staatsopernchor wurde von Ulrich Wagner und der Cantus Juvenum Karlsruhe e.V. von Katrin Müller einstudiert, beide mit großer Präzision.

Die vom Karlsruher GMD Justin Brown geleitete Badische Staatskapelle entwickelte wohl auch wegen der offenen Bühnenplatzierung ein ausgezeichnetes transparentes Klangbild, das die vielen flimmernden Details der glutvollen und so slawischen Janáček-Partitur exzellent wiedergibt, mit immer wieder bestechenden Soli. Brown wusste das Tempo in rechten Moment anzuziehen, aber auch lyrischen Momenten, wie jenem der Hochzeit, malerische Farben zu verleihen, ebenso wie melancholische oder gar traurige Momente zu ihrer passenden Charakterisierung kamen. Für Justin Brown hat Janáček, wie er in einem Interview im Programmheft sagt, hinsichtlich des „Ausdrückens von Leidenschaften und Gefühlen mit den Mitteln der Neuen Musik das tiefste Verständnis von allen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und vor ihm gab es eigentlich auch nur Mozart, Wagner und einige Stücke von Verdi, die den Menschen so tief durchdrangen und in der Lage waren, die menschliche Erfahrung so ernsthaft zu gestalten, ohne zu idealisieren … Janáček beschönigt nichts. Bei ihm müssen sich die Tiere gegenseitig töten um zu überleben“.
Fotos: Falk von Traubenberg
Klaus Billand/28.11.2019
www.klaus-billand.com
TRISTAN UND ISOLDE
17.11.2019
Spätestens wenn eine Sängerin der Isolde mit einer Gänsehaut erregenden Emphase zu Beginn des zweiten Aktes Dass hell sie dorten leuchte intoniert, hat sie mein Herz gewonnen. Doch bei Annemarie Kremer musste man gestern am späten Nachmittag im Badischen Staatstheater gar nicht so lange warten. Bereits im ersten Akt begeisterte die Sängerin mit einer exemplarischen Reinheit der Gesangslinie, herrlich samtener Tiefe, warmer, expressiver Mittellage und mühelos erreichten Spitzentönen. Mit bewegender Intensität gestaltet Frau Kremer das Warten auf Tristan im zweiten Akt – und dann kommt er, dieser Gänsehaut-Moment, unterstützt vom Glanz des Orchesters. Spannend gestaltet sie die oft gestrichene Passage über den Tag , bevor sie zusammen mit dem Tristan von Stefan Vinke die Wunder der Liebe, das entrückt Sein in der Nacht besingt. Für den Liebestod schließlich, der in der Inszenierung von Christopher Alden keiner ist, steht Annemarie Kremer ganz alleine auf der Bühne, man kann sich voll und ganz auf die exquisite Schönheit ihrer Stimme konzentrieren, raumgreifend zwar, doch ohne jegliches Forcieren, wunderbar strömend, den todessehnsüchtigen Sog dieser Musik aufs Schönste evozierend. Nur schon die Steigerung bei immer lichter, wie er leuchtet sorgt für einen weiteren Gänsehaut-Moment. Sie selbst steigt als starke Frau, die sie in dieser Inszenierung ist zu In dem wogenden Schwall auf den Souffleurkasten und wir versinken in höchster Lust...
 Das ganz große Glück dieser Wiederaufnahme war, dass Frau Kremer - siehe Bild rechts - einen mehr als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite hatte: Stefan Vinke, der fast auf den Tag genau vor 25 Jahren hier am Badischen Staatstheater Karlsruhe mit einem Anfängervertrag seine Karriere startete, welche ihn über Mannheim - dort hörte ich ihn vor 15 Jahren als Tristan und war damals schon begeistert - und Leipzig an Opernhäuser rund um den Erdball bis zu den Bayreuther Festspielen führte, wo er noch letzten Sommer ebenfalls den Tristan sang. Die gestrige Vorstellung nun war eine Sternstunde, noch selten habe ich einen stimmlich präsenteren, unverkrampfteren Tristan erleben dürfen. Keine Drücker, kein Forcieren, seine Stimme strömt kraftvoll und überaus differenziert, im zweiten Akt mit dem langen Liebesduett schon beinahe liedhaft zart und mit wunderbar fein gesetzten, tragfähigen Piani! Auch darstellerisch überzeugt er als psychisch angeschlagener Held mit Alkohol- und Herzproblemen, für die nur die Wunderheilerin Isolde Erlösung bringt. Meisterhaft gestaltet Stefan Vinke den dritten Akt, in welchem Wagner dem Tenor lange, anstrengende Fieberphantasien in die Kehle schrieb. Doch bei Vinke klingen diese völlig unangestrengt, wunderbar leicht und sauber und doch voller Ausdrucksstärke in den kontrollierten Ausbrüchen.
Das ganz große Glück dieser Wiederaufnahme war, dass Frau Kremer - siehe Bild rechts - einen mehr als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite hatte: Stefan Vinke, der fast auf den Tag genau vor 25 Jahren hier am Badischen Staatstheater Karlsruhe mit einem Anfängervertrag seine Karriere startete, welche ihn über Mannheim - dort hörte ich ihn vor 15 Jahren als Tristan und war damals schon begeistert - und Leipzig an Opernhäuser rund um den Erdball bis zu den Bayreuther Festspielen führte, wo er noch letzten Sommer ebenfalls den Tristan sang. Die gestrige Vorstellung nun war eine Sternstunde, noch selten habe ich einen stimmlich präsenteren, unverkrampfteren Tristan erleben dürfen. Keine Drücker, kein Forcieren, seine Stimme strömt kraftvoll und überaus differenziert, im zweiten Akt mit dem langen Liebesduett schon beinahe liedhaft zart und mit wunderbar fein gesetzten, tragfähigen Piani! Auch darstellerisch überzeugt er als psychisch angeschlagener Held mit Alkohol- und Herzproblemen, für die nur die Wunderheilerin Isolde Erlösung bringt. Meisterhaft gestaltet Stefan Vinke den dritten Akt, in welchem Wagner dem Tenor lange, anstrengende Fieberphantasien in die Kehle schrieb. Doch bei Vinke klingen diese völlig unangestrengt, wunderbar leicht und sauber und doch voller Ausdrucksstärke in den kontrollierten Ausbrüchen.

Den beiden Protagonisten hat Wagner je eine Vertraute, einen Vertrauten zur Seite gestellt, wichtige und gewichtige Partien. Katharine Tier begeistert mit ihrer Darstellung der altjüngferlichen, bieder daherkommenden Brangäne, ein Mauerblümchen, das so gerne geliebt werden möchte - und sogar dem Kurwenal Avancen macht, erst vergeblich, doch am Ende des zweiten Aktes wird sie von Kurwenal gar geküsst. Frau Tier vermag auch stimmlich sehr zu überzeugen, ihre Habet acht!–Rufe und der lange gehaltene Ton auf Nacht erzeugen grandiose Wirkung. Sehr schön herausgearbeitet ist ihr zärtliches Verhältnis zu Isolde, eine tief gehende Frauenfreundschaft. Die parallele Männerfreundschaft zeigen der Tristan von Stefan Vinke und Seung-gi Jung als Kurwenal. Der Bariton verleiht der Rolle mit bewegendem Aplomb eine großartige Präsenz, es ist eine wahre Freude, ihm zuzuhören! Renatus Meszar singt den großen Monolg des Königs Marke mit anrührender Bassstimme, anklagend, verletzt, aber nicht weinerlich, den Schmerz des Verrats macht er ergreifend fühlbar, man leidet mit ihm. Kammersänger Klaus Schneider gibt einen passend spitz und scharf intonierenden Denunzianten Melot. Ganz besondere Erwähnung verdient Cameron Becker, welcher den jungen Seemann im ersten und den Hirten -hier ein Bewacher Tristans - im dritten Akt gibt. Welch eine wunderbar timbrierte, rein und makellos sauber intonierende Tenorstimme ist da zu erleben!

GMD Justin Brown hat sich für eine Fassung ohne Striche entschieden, zu Recht. Denn gerade die oft einem Strich zum Opfer fallende Passage vor O Sink hernieder, Nacht der Liebe ist nicht nur schön, sondern auch für das Tag-Nacht Gefüge der Komposition sehr aussagestark. Unter Justin Browns Leitung erklingt ein wunderbar zarter Wagner, soghaft strömend, zielgenau kulminierend an den entsprechenden Stellen, transparent und doch samten und weich im Gesamtklang. Die Badische Staatskapelle setzt dies an allen Pulten mit begeisternder Schönheit um.
Wer regelmäßig meine Texte liest, weiß, dass ich nicht der allergrößte Freund von Einheitsbühnenbildern mit Sitzlandschaften bin. Paul Steinberg nun hat für den Regisseur Christopher Alden ein solches entworfen: ein riesiger Raum mit weißen, kahlen Wänden auf der einen Seite geschlossen und gerundet, wie ein Schiffsbauch, auf der anderen Seite eine gigantische Fensterfront mit Galerie. Darin verteilt eine Menge flaschengrüner Sessel und Sofas im Bauhausstil von Le Corbusiers LC2. Mal mit Hüllen abgedeckt, mal nicht. Interessant - und deshalb stört mich die Bühne nicht – ist, wie der Regisseur, der Lichtdesigner Stefan Woinke - toll herausgearbeitet die Tag-Nacht Stimmungen mit dem Lichtschalter - und die als Movement director im Besetzungszettel geführte Elaine Brown diesen Einheitsraum bespielen. Und das hat durchaus etwas Bezwingendes, auch wenn stellenweise in diesem 1940er Ambiente eine gewisse Sterilität vorherrscht.

Aber man muss ja szenisch nicht immer noch die Emotionalität der Musik verstärken und verdoppeln. Sue Willmington hat die dazu passenden Kostüme entworfen, Anzüge für die Herren, strenger Sekretärinnen-Look für Brangäne -im zweiten Akt im Pyjama - etwas verspielter für Isolde. Hoch interessant ist die Personenführung gehalten, so spannend, dass man den unterkühlten Raum beinahe vergisst. Vor allem die Charakterzeichnungen von Brangäne, Isolde und Tristan sind fantastisch gelungen. Da hat sich der Regisseur Christopher Alden wirklich sehr gute, stimmige und sinnige Gedanken gemacht. Einen Coup stellt auch die Ankunft Markes im ersten Akt dar: Da Tristan und Isolde von der Liebestrank-Droge noch immer benebelt und in innigster Umarmung verharren, meint der König, Brangäne sei seine Zukünftige und überreicht ihr den Rosenstrauß. Die Rosen ziehen sich dann auch durch die beiden Folgeakte durch, im zweiten werden sie von Isolde auf dem schwarz spiegelnden Boden verteilt vor der Liebesnacht, im dritten tritt sie schon viel früher als vorgesehen in der Villa auf und streut die Rosen von der Galerie, während Tristan noch im Fieberwahn deliriert: Macht eigentlich gerade in dieser Inszenierung Sinn, da die beiden Liebenden ja von Anbeginn hier in König Markes Villa sind – am Ende werden sie einfach wegen des Verrats und Ehebruchs voneinander getrennt gehalten. Sehr gelungen auch der Einbezug des Plattenspielers, auf welchem für die Liebesnacht und die alte Weise des Hirten im dritten Akt Schellackplatten aufgelegt werden. Tristan zerbricht sie dann, wenn er die Ankunft Isoldes vermeint zu sehen.

Am Ende bleibt Isolde alleine auf der Bühne zurück. Die Leichen von Tristan und Kurwenal - von Melot erschossen - werden weggetragen, Marke schlüpft in Hut und Mantel und geht ebenfalls ab, Brangäne legt eine Pistole auf die Sessellehne und überlässt die Bühne der Isolde für den verklärten Schlussgesang. Wird sich Isolde mit der Waffe erschießen und so Tristan ins Reich der Nacht folgen? Der Regisseur lässt das Ende offen.
Fazit: Eine grandiose Vorstellung, die man sich gerne öfter ansehen und vor allem anhören möchte. Verdiente Beifallsstürme für alle!
Kaspar Sannemann, 18.11.2019
Fotos (c) Falk von Traubenberg
DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN
Wa 16.11.2019
Leoš Janáčeks Oper über die Abenteuer des Füchsleins Schlaukopf – DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN – gehört zu den vielschichtigsten, facettenreichsten Werken des musiktheatralischen Repertoires. Das 100 Minuten dauernde Werk weist vordergründig die Folie von der freiheitsliebenden Füchsin, ihrer Gefangennahme und Flucht, der Idylle des Waldes, der Trauer des plötzlichen Todes durch den Schuss des Wilderers auf. Doch hinter dieser parabelhaften Folie werden Themenkreise des Eros, der Sozialkritik, der Revolution aufgetan, feinsinnig und auch humorvoll eingebettet in die Handlung, die nie putzig oder verniedlicht wirkt. Dazu hat Janáček eine Musik komponiert, die mal flirrend und irisierend wirkt, die Mystik der Natur evoziert, dann wieder geradezu melancholische Züge aufweist, Anklänge an Märsche und mährisches Musikantentum aufweist und am Ende beinahe apotheosenhaft strahlt. Die Partitur besteht ungefähr zu einem Drittel aus reiner Instrumentalmusik (Vor- und Zwischen- und Nachspiele) und deshalb ist es nur richtig, das Orchester in einer Inszenierung zum gleichwertigen Bühnenpartner zu machen, wie es der Regisseur Yuval Sharon am badischen Staatstheater in Karlsruhe getan hat (Premiere war am 16.12.2018, in einer Koproduktion mit dem Cleveland Orchestra). Das Orchester ist also mitten auf der Bühne platziert und eine riesige Cinemascope-Leinwand spannt sich im Halbrund um den groß besetzten Orchesterapparat. So ist es angebracht, erst mal über das Orchester zu sprechen.

Denn die Musiker*innen der Badischen Staatskapelle unter der einfühlsamen, prägnanten Leitung von Dominic Limburg leisten Außerordentliches. Dominic Limburg gelingt es, den Facettenreichtum von Janáčeks musikalischer Sprache mit ungeheurer Plastizität zu formen, eine kammermusikalische Transparenz zu wahren, bei der man die herrlichen Flageolett Passagen, das Klopfen mit dem Bogen, feingeästelte Phrasen der Holzbläser genauso klar heraushört, wie das hervorragend intonierende Hornquartett. Die Badische Staatskapelle lässt sprühenden Witz und elegische Melodien hören und der Schluss fährt dann total ein, erzeugt Gänsehaut, gerade auch im Zusammenspiel mit der Inszenierung. Yuval Sharon hat mit den Walter Robot Studios von Bill Barminski & Christopher Louie zusammengearbeitet, welche einen ganz wunderbaren Animationsfilm kreiert haben, der in über 150 Sequenzen aufgeteilt und mit technischer Perfektion auf den Takt genau gesteuert auf die Leinwand projiziert wird. Die Fabeltiere kommen dann oft zum Halt, eine kleine Öffnung auf der Leinwand dient dazu, dass der Kopf der Sänger*innen nun zum Tierkopf wird. Genial gemacht, aber nie allzu putzig oder „Bambi-mäßig“, eine leicht ironische Distanz wahrend. In der Zeichentechnik erinnern die Bilder leicht an den Schweizer Künstler Alois Carigiet. Die Menschen in dieser Oper lässt Sharon dann ganz real auftreten, so den Förster und seine Familie, den Wilderer, den Schulmeister, den Pfarrer, den Gastwirt und dessen Frau. Perfekt gemacht ist die Interaktion zwischen den animierten Figuren und den Menschen und meisterhaft konzipiert die Verschmelzung der Menschen in ihren Träumen mit der gezeichneten Welt und umgekehrt, wenn die Liebesgefühle der Tierwelt „menschlich“ werden, treten sie aus der Leinwand heraus. Die Flüge der Libelle durch den Wald, die Liebes- und Hochzeitsszenen zwischen Füchsin Schlaukopf und dem adeligen Fuchs von und zu Tiefengrund, die revolutionären Szenen im Hühnerhof und dem Dachsbau gehören zu den unzähligen Höhepunkten dieser heftig und begeistert applaudierten Derniere der Wiederaufnahmenserie.

Gesungen wurde in deutscher Sprache, was bei Janáček immer eine gewisse Problematik beinhaltet, da der Komponist ja sehr bewusst der Sprachmelodie seiner Landsleute gelauscht hatte, Rhythmus und Tonhöhen notierte. Doch gerade beim SCHLAUEN FÜCHSLEIN darf man getrost auf eine Wiedergabe in der Landessprache setzen, vor allem wenn das Auge durch die einfallsreiche Videoanimation und das Beobachten des Orchesters schon so intensiv beschäftigt ist, dass man froh ist, nicht auch noch Übertitel lesen zu müssen (aber sie sind selbstverständlich da). Das große Ensemble spielt und singt wie aus einem Guss auf sehr hohem Niveau. Uliane Alexyuk begeistert mit ihrem hellen, wunderschön timbrierten Sopran als Füchslein Schlaukopf, Alexandra Kadurina kontrastiert hervorragend mit ihrem herberen Timbre als Fuchs. Andrew Finden singt einen nuancierten Förster, Christina Niessen leiht ihre schöne Stimme der Försterin und der Eul. Nathanael Tavernier setzt seinen schön gerundeten Bass als Pfarrer und als Dachs ein. Klaus Schneider zeigt die Tragik des im Alkohol Zuflucht suchenden Schulmeisters eindringlich (und gibt auch der Mücke seine Stimme). Renatus Meszar ist ausgezeichnet besetzt als Haratschta, der Landstreicher und Wilderer. Tiny Peters gibt eine umwerfende Frau Pasek und leiht ihre Stimme auch dem Hahn und dem Eichelhäher. Auch die Interpret*innen der kleineren Partien verdienen eine Erwähnung, sie allesamt tragen zum beglückenden Erfolg des Abends bei: Baris Yavuz als Pasek, Luise von Garnier als Dackel, Ilkin Alpay als Schopfhenne und Specht, Taavi Baumgart als Pepik und Grille, Teresa Tampe als Frantik und Heuschrecke, Magdalene Wetzel als Frosch und Lydia Spellenberg als kleine Füchsin. Eindringlich und atmosphärisch dicht gelingen auch die Auftritte des Badischen Staatsopernchors (Hochzeitsszene!) und des Cantus Juvenum Karlsruhe.
Viele Szenen der Animation sind dermaßen gut gelungen, dass sie auf dem Nachhauseweg noch einmal vor dem inneren Auge ablaufen – und die wunderschönen musikalischen Einfälle Janáčeks bleiben im Ohr haften. Hoffentlich wird diese zauberhafte und feinsinnige Inszenierung nicht aus dem Spielplan verschwinden.
Kaspar Sannemann 17.11.2019
copyright: Falk von Traubenberg
DER FREISCHÜTZ
Vorstellung am 26. Oktober 2019
Realistisches und überzeugendes Regietheater
Im Rahmenprogramm des Herbstmeetings von OPERA EUROPA besuchten die Teilnehmer am Badischen Staatstheater Karlsruhe eine bemerkenswerte Regietheater-Inszenierung des Freischütz durch die nicht gerade für Konventionalität bekannte Verena Stoiber. Das wäre ja gerade bei von Carl Maria von Webers (hoch)-romantischer Oper in unserer Realität auch kaum noch glaubhaft zu vermitteln. So deckt Stoiber (Dramaturgie Deborah Maier) mit ideenreichen und dramaturgisch stets nachvollziehbaren Regieeinfällen schon während der Ouvertüre schonungslos die ganze Falschheit, Bigotterie, und auch Borniertheit einer biedermeierlich naiv strukturierten Gesellschaft im Dorfmilieu auf und zieht im Finale mit einer exzellenten Personenregie und Mimik auch den Zynismus ihrer Führer Kuno und des Pfarrers Ottokar blank.

In einem dazu bestens passenden gotischen Kirchenraum von Sophia Schneider (auch passende Kostüme) stellt sie das gottlose „Prinzip Kaspar“ mit dem besten Sänger des Abends, dem jungen und äußert agil spielenden US-Amerikaner Nicholas Brownlee mit einem bestens artikulierenden, prägnanten und kraftvollen Bassbariton dar. Wie Mephisto kommt er auf die Bühne und mischt die ganze „feine Gesellschaft“ richtig auf. In Frankfurt am Main wird Brownlee bald den Jochanaan und Holländer singen. Ich bin mir sicher, dass sich da mittelfristig zumindest der Rheingold-Wotan anbahnt, später dann noch viel mehr. Dorothea Herbert a.G. beeindruckt als naiv zwischen Hure und Heiliger agierende Agathe, mit einem fast perfekt intonierenden, vibratoarmen und glockenreinen Sopran. In Mönchengladbach machte sie soeben guten Eindruck als Salome und wird im kommenden Jahr in einer Neuinszenierung von Christof Loy am Theater an der Wien zu erleben sein. Renatus Meszar überzeugt stimmlich und darstellerisch als zynischer und gutsherrenartig agierender Erbförster und Präsident des dörflichen Schützenvereins. Es ist herrlich mitanzusehen, wie er mit allen Facetten seiner Mimik versucht, Ottokar dazu zu bringen, Max in die Wüste zu schicken, und wie der Pfarrer voll Angst vor der Obrigkeit nach den Worten des Eremiten klein beigibt – die Anpassungsfähigkeit der Kirche an die Gegebenheiten…

Sophia Theodorides ist als Ännchen die einzige, die vernünftig ist und den Durchblick hat. Das wurde nicht zuletzt unmittelbar klar aus einem allen Protagonisten einmal im Laufe der Handlung gewährten Video-Monolog (Thiemo Hehl) im Altarraum, in dem sie ihre wahren Gefühle und Handlungsweisen unzweideutig klar machten – ein für mich zumindest neuer und in diese Produktion bestens passender dramaturgischer Einfall, durchaus auch mit humoristischen Nebeneffekten. Gestalterisch eindrucksvoll meistert Theodorides die Rolle mit einem gefälligen Sopran. Der Eremit von Vazgen Gazayan sorgt im Finale mit seinem klangvollen und profunden Bass für einen Prometheus-haften Auftritt à la „Die Vögel“ von Walter Braunfels und bewirkt augenblickliches Umdenken beim zuvor Max im Rückkehrfall noch mit Kerker drohenden Ottokar. Zuerst wie ein Sandler unter dem Altar kauernd und dankend von Agathe etwas zum Essen annehmend, später immer wieder mal völlig unbeachtet auf Knien durch den Kirchenraum robbend, wird er nun zur übermächtigen Stimme Gottes. Pfarrer Ottokar wird von dem körperlich alle überragenden KS Edward Gauntt mit einem klangvollen Bariton gesungen. Der brasilianische Bariton Arthur Cangucu a.G. ist ein guter Kilian.
 Leider wird der Max von Matthias Wohlbrecht zum Manko des Abends. Mit einer allzu festsitzenden und meist verquollen klingenden Stimme bei wenig tenoralem Glanz und Resonanz kann er den Max stimmlich einfach nicht ausfüllen, sei denn, man hat ihn extra auch stimmlich als Agathe nicht würdigen Bräutigam darstellen wollen. Das hat er nämlich schauspielerisch wirklich eindrucksvoll über die Rampe gebracht, obwohl ihre Brautwürdigkeit wahrlich auch nicht eindeutig ist und auch sie wohl noch etwas warten sollte. Stimmlich war Wohlbrecht für mich aber eine Fehlbesetzung. Er ist sicher ein guter Mime und wohl ganz allgemein eher im Charakterfach zu Hause.
Leider wird der Max von Matthias Wohlbrecht zum Manko des Abends. Mit einer allzu festsitzenden und meist verquollen klingenden Stimme bei wenig tenoralem Glanz und Resonanz kann er den Max stimmlich einfach nicht ausfüllen, sei denn, man hat ihn extra auch stimmlich als Agathe nicht würdigen Bräutigam darstellen wollen. Das hat er nämlich schauspielerisch wirklich eindrucksvoll über die Rampe gebracht, obwohl ihre Brautwürdigkeit wahrlich auch nicht eindeutig ist und auch sie wohl noch etwas warten sollte. Stimmlich war Wohlbrecht für mich aber eine Fehlbesetzung. Er ist sicher ein guter Mime und wohl ganz allgemein eher im Charakterfach zu Hause.
Johannes Willig leitet die Badische Staatskapelle mit viel Verve und einem guten Gespür für die zeitweise skurrilen Geschehnisse auf der Bühne. Natürlich ist bei den von Ulrich Wagner einstudierten Chören der berühmte Jägerchor das herausragende Ereignis. Er wird hier von Kuno als sarkastische Satire auf die kleinkarierte Mentalität der Dorfgemeinschaft dirigiert – irre! Aber bei den Damen steht ihm der Jungfernchor an Skurrilität nicht nach. Er endet mit dem Öffnen der Schachtel mit dem Jungfernkranz – und siehe da, den Kranz trägt zu aller Entsetzen ein Totenschädel! Verena Stoiber überrascht immer wieder mit solch drastischen Regieeinfällen, die aber stets in das dramaturgische Gewebe ihrer Interpretation des Freischütz passen.

So ist man während der Ouvertüre noch überrascht, dass Agathe, die zunächst züchtig wie Tosca in die Kirche kommt, sich von Kaspar dann ausgerechnet im Beichtstuhl hinter einem roten Samtvorhang zu einem blow job hinreißen lässt, auch wenn ihr diese Tat danach äußerst peinlich ist. Wenn Max später zwischen den Kirchenbänken sogar ein quicky mit einem von Kaspar mitgebrachten leichten Mädchen macht und nach seinem wiedermaligen Abblitzen bei Agathe erst die Gebetbücher zerfetzt, dann eine Kirchenbank umwirft und den Beichtstuhl zertrümmert, sowie schließlich das Altarplakat „Viktoria“ herunterreißt und „Hure“ an die Wand schmiert, wissen wir, mit welcher Gesellschaft wir es zu tun haben, und dass von ihr nichts Gutes zu erwarten ist. Dabei ist die Rauferei, die gleich zu Beginn nach dem Auftritt Kilians losgeht, noch das Wenigste, nur ein Vorgeschmack auf das, was dann kommen sollte. Immerhin versucht Ännchen krampfhaft, die „Hure“ wieder mit dem „Viktoria“ zu verdecken…

Am Schluss wird der Eremit von Kunos Leuten abgeführt, und Ottokar liest wieder die Messe, als sei nichts gewesen, mit der frommen Agathe als Administrantin neben ihm. Oben taucht plötzlich Kaspar auf, und Max versucht verzweifelt, auf ihn als den Schuldigen hinzuweisen. Niemand schenkt ihm Aufmerksamkeit. Es geht alles so weiter im Dürrenmattschen Dorf weitab der Aufklärung…
Meines Erachtens war es ein spannender Opernabend und endlich einmal wieder eine „wasserdichte“ und realistische Regietheater-Produktion, die die so oft bestrittene Relevanz dieses Inszenierungsstils einmal mehr unter Beweis stellt! Jedenfalls war das viel besser als Stoibers überzogenes „Rheingold“ in Chemnitz…
Klaus Billand/8.11.2019
www.klaus-billand.com
Copyright der Bilder:
Bild 1: Felix Grünschloß
Bilder 2, 3, 4: Tom Kohler
Bild 5: Klaus Billand
ELEKTRA
Besuchte Vorstellung am 19. April 2019
In seiner aktuellen Inszenierung der „Elektra“ von Richard Strauss am Badischen Staatstheater Karlsruhe erzählt Regisseur Keith Warner die Geschichte einer kaputten Familie. Dazu spielt Warner mit unterschiedlichen Zeitebenen und vermischt Antike und Gegenwart. Als Schauplatz hat ihm dazu Bühnenbildner Boris Kudlicka einen gewaltigen Museumsraum auf die Bühne gebaut. Der Bühnenraum ist bereits geöffnet, wenn der Zuschauer den Saal, das Museum betritt. Eine Antikenausstellung ist im Gange. Museumsbesucher betrachten die Objekte. Unter ihnen eine junge Frau, die sich im Museum einschließen lässt. Allein diese stumme Szene ist sehr schlüssig und spannend inszeniert. Bekannte Personen mischen sich unter die Besucher…..
Da beginnt mit dem Agamemnon-Motiv die Oper. Die Besucherin wird zu Elektra. Aus Traum wird Wirklichkeit…..Sie betrachtet sich sodann einen Film, der eine Opferszene zeigt, die Szene der Mägde, deren Stimmen zunächst nur aus dem Off zu hören sind. Dann betreten diese die Bühne. Im weiteren Verlauf der Handlung bedienen sich die Protagonisten der Ausstellungsobjekte und verwandeln sich so in antik anmutende Gestalten.
Elektra ist eine völlig gebrochene Frau, die nur ihrer Rache entgegen fiebert, eine Gezeichnete. Negativität und Düsternis gehen von ihr aus. Und doch ist ihre große Verletzlichkeit jederzeit spürbar.
Was war da geschehen? Warner deutet in der Begegnung mit dem Bruder Orest an, dass da auch ein inzestuöses Bündnis die Geschwister verband.
Unheimlich der Auftritt ihrer Mutter Klytämnestra, die wie ein lebendiger Geist aus der Vitrine tritt. Auch sie ist eine Gefallene, die Zuflucht im Alkohol fand. Sehr drastisch wird sie dann vom eigenen Sohn ins Jenseits befördert. Zwei harte Schläge genügen und ihr Kopf fällt……
Chrysothemis wird als Lichtgestalt gezeichnet, die am Ende doch zu schwach bleibt, eine Wende einzuleiten. Am liebsten zieht sie sich in ihre heile Welt des Kinderzimmers nebst Teddy zurück. Orest agiert als finsterer Herrenmensch, dem die Wiederbegegnung mit Elektra schier die Fassung raubt. Aegisth wirkt eher ungewöhnlich stark und gibt einen fordernden Charakter.
Keith Warner zeigt großes Geschick in der spannenden Personenführung. Sehr genau hat er in die Partitur hineingeschaut und offenbart dem Zuschauer viele neue Einblicke. Hier war ein Könner am Werk, der virtuos mit dem gigantischen Bühnenbild spielt, welches sich immer wieder verändert und so neue Handlungsräume eröffnet. Dazu ein immer wieder stimmungsvolles Licht (John Bishop) und Rollencharaktere, die aufs Beste miteinander interagieren. Ein packender Horror-Thriller, gekonnt und atemberaubend inszeniert.
Musikalisch ist der Abend am Staatstheater auf ausgezeichnetem Niveau. In der Titelpartie zeigt Rachel Nicholls eine völlig stimmsichere Bewältigung ihrer Rolle. Die schlanke Stimme kennt keine Mühe in der Höhe oder in der Durchschlagskraft. Unermüdlich, ohne jegliches Forcieren, verkörperte sie eine Elektra, wie sie heute selten sein dürfte. Die hohen C‘s kamen topsicher und dazu immer wieder feinste Lyrismen. Ihre Ausdauer war grenzenlos und bescherte dem Publikum die sehr seltene Gelegenheit, das Duett mit Orest, ohne den üblichen Strich zu hören. Lediglich auftretende Vokalverfärbungen beeinträchtigten etwas ihren Gesang. Darstellerisch agierte sie mit Hingabe und großer Natürlichkeit.
Anna Gabler war mit hellem,kompakten Sopran ein guter Kontrast. Mit viel Emphase und Unbedingtheit identifizierte sie sich mit ihrer Rolle und konnte wunderbar in der Höhe aufblühen. Auch sie erlebte ihre Rolle stark und suchte immer wieder das Zusammenspiel zu ihrer Bühnenschwester.
Anna Danik als Klytämnestra war eine ungewöhnliche Besetzung. Ein imposante, große Mezzosopran-Stimme, die vor allem ihre Rolle sang und nicht auf Tonhöhe sprach. Dabei legte sie besonderen Wert darauf, die inneren Verletzungen ihres Rollencharakters zu offenbaren. Vorbildlich dazu ihre Textverständlichkeit.
Als Orest erschien Renatus Meszar düster und gefährlich. Herrlich sonor erklang sein kultivierter Bass-Bariton. Gekonnt setzte er Textakzente und war darstellerisch außergewöhnlich engagiert. Selten gibt es einen Orest zu sehen, der in seiner Szene szenisch so „brennt“, bei welchem jeder Blick, jede Geste, eine tiefe Bedeutung erfährt. Und auch er ist ein erkennbar geschädigter Charakter.
Matthias Wohlbrecht nutzte als Aegisth seine wenigen Minuten für einen sehr pointierten Auftritt, bevor er sehr drastisch in den Tod befördert wurde. Seinen Charaktertenor setzte er schneidend ein und konnte auch in den schweren Schlussausbrüchen mühelos bestehen. Seine Sprachbehandlung war vorbildlich.
In den vielen Nebenrollen überzeugten die Ensemble-Mitglieder des Badischen Staatstheaters ausnahmslos. Ein überzeugender Leistungsbeweis für die Qualität des Theaters.
Große Kompetenz am Pult der Badischen Staatskapelle zeigte Dirigent Johannes Willig. Mit Ruhe, Umsicht und doch viel Energie trieb er die Partitur mit höchster Dramatik auf den Siedepunkt. Immer wieder rauschte das Orchester entfesselt auf, spielte drastische Akzente glühend aus. Sein Gefühl für die richtigen Steigerungen und die notwendigen Ruhepunkte war jederzeit untrüglich. Dazu ließ er vor allem dem Orchester Raum für die kantablen Stellen, etwa im lyrischen Teil des Duettes zwischen Elektra und Orest.
Die Badische Staatskapelle demonstrierte eindrucksvoll ihre große und langjährige Kompetenz gerade für die Opernwerke von Richard Strauss. Das Orchester spielte sauber und überwältigend schlagkräftig, ohne jegliches Lärmen. Alle Orchestergruppen musizierten hörbar motiviert. Selten lässt sich „Elektra“ rein orchestral so eindrucksvoll und derart packend erleben.
Am Ende große Begeisterung im Publikum.
Dirk Schauss 21.4.2019
Bilder liegen leider keine vor.
GÖTTERDÄMMERUNG
Besuchte Aufführung: 22.10.2017 (Premiere: 15.10.2017)
Die Nornen als Regisseure
Das war einer jener unvergesslichen Opernabende, die noch lange in Erinnerung bleiben. Mit der „Götterdämmerung“ ging der neue Karlsruher „Ring des Nibelungen“, an dem am Badischen Staatstheater seit Ende der vorletzten Spielzeit geschmiedet wurde, mit Bravour in die letzte Runde. Wie weiland in Stuttgart und Essen sind auch in der Fächerstadt die vier Teile der Tetralogie auf unterschiedliche Regisseure verteilt. Nach David Hermann, Yuval Sharon und Thorleifur Örn Arnasson ist die Reihe nun an Tobias Kratzer, dem in Zusammenarbeit mit dem Bühnen- und Kostümbildner Rainer Sellmaier nichts weniger als ein Geniestreich gelungen ist. Selten hat man Wagners Werk so spannend, hervorragend durchdacht, tempo- und abwechslungsreich erlebt. Die stringente Personenregie war vom Feinsten, Leerläufe und Langeweile kamen an keiner Stelle auf. Wie gebannt folgte man dem Geschehen auf der Bühne, das sich vom Anfang bis zum Ende wie aus einem Guss präsentierte und beredtes Zeugnis von den außergewöhnlichen Fähigkeiten Kratzers ablegte, der nächstes Jahr mit „Tannhäuser“ auch die Bayreuther Weihen erhält.

Kratzer ist, wie gesagt, nur ein Regisseur unter vieren. Und genau das bringt er auch auf die Bühne. Zu Beginn sieht man die drei Regisseure der vergangenen Abende auf ihren Regiestühlen mit dem Rücken zum Publikum vor einem Zwischenvorhang mit der Aufschrift „The end“ schlummern. Nacheinander erwachen sie und beginnen mit Frauenstimmen zu singen. Es sind die Nornen, die sich hier in Kostüm und Maske der drei Regisseure präsentieren und dabei individuell charakterisiert werden. David Hermann, der im „Rheingold“ die anderen Teile des Zyklus szenisch vorwegnahm, sind von Kratzer die vier „Ring“-Partituren zugeordnet, Yuval Sharon erscheint mit Tablet und Videokamera und Thorleifur Örn Arnasson benötigt zum Inszenieren nur ein Reclam-Heft. Die Nornen im Gewand der drei Regisseure werden hier zu den eigentlichen Hauptrollen. Sie erfahren bei Kratzer eine ungemeine Aufwertung. Er weist ihnen nicht nur eine erzählende, passive Funktion zu, wie es in anderen Inszenierungen des Stückes immer der Fall ist, sondern eine durchaus aktive. Immer wieder geistern sie über die Bühne und versuchen den von ihnen erkannten Untergang abzuwenden. Dazu schlüpfen sie in die verschiedensten Rollen. Im dritten Aufzug erscheinen sie im Gewand der Rheintöchter mit Nixenschwänzen, die Siegfried anhand der Partitur klar machen, dass Wagner seinen Tod fordert. Und im ersten Aufzug verkleidet sich die erste Norn alias David Hermann als Waltraute, um in dieser Maske Brünnhilde dazu zu bewegen, den Ring zurückzugeben. Im zweiten Aufzug übernehmen die Nornen darüber hinaus auch die wenigen Sätze der Chorfrauen. Ihren Bemühungen ist indes kein Erfolg beschieden. Sie können das Schicksal nicht aufhalten. Darin liegt ihre Tragik. Dieser Handlungsstrang wird von Kratzer konsequent durchgezogen und erlahmt nie. Deutlich wird, dass der Regisseur mit Tschechow´schen Elementen trefflich umgehen kann.

Daniel Frank (Siegfried)
Aber auch für Bertolt Brecht beweist er ein untrügliches Gespür. Dem Walkürenfelsen, der hier ein weißes Boudoir mit Himmelbett darstellt und von dem „The end“- Vorhang als Brecht’sche Gardine abgeschlossen wird, kommt die Funktion eines Theaters auf dem Theater zu. Die Gibichungenhalle stellt einen Spiegelsaal dar, der seine Bewohner ständig mit der eigenen Unvollkommenheit konfrontiert und auch den Zuschauern den sprichwörtlichen Spiegel vorhält. Hagen trägt einen dunklen Anzug mit Hemd und Krawatte. Ihm wurde das Trauma seines entmannten Vaters Alberich vererbt. Dieser verlangt von seinem Sohn, sich ebenfalls zu kasteien, Hagen entgeht diesem Schicksal aber. Die bereits heruntergelassene Hose darf er sich wieder hochziehen. Insgesamt wirkt er viel ernster als seine beiden Halbgeschwister. Gunther ist der konventionelle Schwächling, der hier Männer liebt. Seine Homosexualität kommt in dem Augenblick zum Ausdruck, als er drauf und dran ist, Siegfried anzubaggern, aber im letzten Augenblick einen Rückzieher macht. Dass er nicht gerade der Stärkste ist, wird auch am Schluss des ersten Aufzuges deutlich, mit dem Kratzer ein echter Coup de théatre gelungen ist. Bei ihm erscheinen Siegfried und Gunther gemeinsam im Boudoir Brünnhildes. Siegfried trägt dabei eine Fechtmaske, die an die Stelle des Tarnhelms tritt. Sehr interessant war, dass Gunther in dieser Szene vom Regisseur ein Großteil des Gesangs von Siegfried zugeordnet wurde. Die tiefen Töne, die Wagner hier von seinem Helden verlangt, sind für einen Bariton aber durchaus singbar. Dieser phantastische Regieeinfall machte ganz großen Eindruck. Bei der Überwältigung Brünnhildes zieht Siegfried ihr den Ring vom Finger und übergibt ihn Gunther, erhält ihn aber wenig später von ihm zurück. In der Folge erweist sich der Gibichungenkönig als unfähig, mit der wohl stark widerstrebenden Brünnhilde den Geschlechtsakt zu vollziehen. Resigniert tritt er wieder vor den Zwischenvorhang. Siegfried hilft ihm, die ehemalige Walküre auch in dieser Hinsicht zu bezwingen. Dabei kommt der Wotan-Enkel auf den Geschmack. Nachdem er wieder von Gunther abgelöst wurde, beginnt er heftig zu onanieren. Nicht nur hier wurde ersichtlich, dass Gunther ständig an seinem Selbstbild zweifelt. Er lebt in ständiger Angst davor, dass sein Schwulsein offenkundig wird. Im zweiten Aufzug erscheint er in einem Jeep auf der Bühne. Seine Schwester Gutrune ist eine durchaus schön anzusehende Frau, die indes nicht ernst genommen wird. Bevor sie in die Intrige gegen Siegfried eingeschaltet wird, beschränkt sich ihre Funktion am Gibichungenhof darauf, das Frühstück zu machen.

Ks. Armin Kolarczyk (Gunther), Daniel Frank (Siegfried), Heidi Melton (Brünnhilde)
Nicht nur den verschiedenen Personen, die unter seiner Ägide durchweg eine sensationelle Zeichnung erfahren und öfters in Unterwäsche und Nachtgewand auftreten - das war schon zum Schmunzeln -, weist Kratzer essentielle Bedeutung zu. Auch dem Ross Grane schenkt er entschieden mehr Aufmerksamkeit als die meisten seiner Regiekollegen. Im ersten Aufzug sieht man Siegfried und Brünnhilde nur die Zügel halten. Zu Beginn des zweiten Aufzuges erblickt man ein echtes Pferd auf der Bühne. Am Ende dieses Aktes wird ein künstlicher Pferdekadaver auf die Bühne gebracht, dem die hasserfüllte Brünnhilde dann auch gleich die blutigen Eingeweide herausreißt. Zum Schluss sieht man erneut nur die Zügel Granes. Klug war die Interpretation von Hagens Zaubertrank. Er weist überhaupt keine Magie auf, sondern besteht aus reinem Alkohol. Siegfried verträgt ihn nicht und bricht nach seinem Genuss zusammen. Am Ende erweist sich die große Meisterschaft Kratzers aufs Neue. Dem großen Weltenbrand erteilt er eine klare Absage. Ihm genügt ein winziges Lagerfeuer, in dem Brünnhilde die „Götterdämmerung“-Partitur verbrennt. Sie will als Regisseurin den Ausgang des Stückes selbst bestimmen und lässt sich von den drei Regisseuren nichts mehr sagen. Mit dem Ring in der Hand spult sie die Zeit zurück. Es kommt zu einer Auferstehung der Toten - neu war, dass sich Hagen und Gutrune gegenseitig mit einem Messer umbringen - und alles strebt wieder dem Anfang zu. Brünnhilde kehrt in ihr Boudoir zurück, in dem sie erneut auf den zu neuen Taten aufbrechenden Siegfried trifft. Das war alles sehr überzeugend und in geradezu preisverdächtiger Weise umgesetzt. Bravo!

Ks. Konstantin Gorny (Hagen), Herren des Badischen Staatsopernchores
Auch die gesanglichen Leistungen bewegten sich durchweg auf hohem Niveau. Heidi Melton war eine insgesamt mit guter Stütze und recht gefühlvoll singende Brünnhilde. Lediglich bei den Spitzentönen neigte sie etwas zum Forcieren, was aber angesichts der überzeugenden Gesamtleistung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Eine Meisterleistung erbrachte Daniel Frank als Siegfried. Hier geht ein neuer Stern am Heldentenorhimmel auf. Wunderbar fokussiertes Stimmmaterial, Kraft und Eleganz der Tongebung, differenzierter Ausdruck sowie eine gute Diktion formten sich zu einem sehr ansprechenden Ganzen. Hoffentlich wird Bayreuth auf diesen phantastischen Tenor in nicht allzu ferner Zukunft ebenfalls aufmerksam. Darstellerisch prägnant und stimmlich mit seinem tadellosen, ebenmäßig geführten und textverständlichen Bass in gleicher Weise gefällig präsentierte sich der Hagen von Ks. Konstantin Gorny. Gut gefiel Ks. Armin Kolarczyk, der mit in jeder Lage sauber ansprechendem, klangvollem und gut verankertem Bariton den Gunther sang. Eine stimmlich robuste, mit viel vokaler Dramatik aufwartende Gutrune war Christina Niessen. Einen stimmlich markanten, trefflich deklamierenden Alberich gab Jaco Venter. Tiefsinniges Mezzomaterial brachte Sarah Castle für die erste Norn, die Flosshilde und die Waltraute mit. Insbesondere mit der sehr emotional vorgetragenen Erzählung der Walküre im ersten Aufzug vermochte sie zu punkten. Tadellos sang Dilara Bastar die zweite Norn und die Wellgunde. Gut gefiel An de Ridder in der Partie der dritten Norn. Die gefällige Woglinde von Agnieszka Tomaszewska rundete das homogene Ensemble ab. Mächtig legten sich die von Ulrich Wagner bestens einstudierten Herren des Badischen Staatsopernchores ins Zeug.

Heidi Melton (Brünnhilde), Ks. Armin Kolarczyk (Gunther), Daniel Frank (Siegfried), Christina Niessen (Gutrune)
Eine Meisterleistung erbrachte wieder einmal GMD Justin Brown am Pult. Mit untrüglichem Gespür für die Feinheiten von Wagners genialer Musik animierte er die Badische Staatskapelle zu einem intensiven, facetten- und nuancenreichen Spiel, das von großen Spannungsbögen und vielen Farben geprägt war.
Fazit: Ein absolut erstklassiger Abschluss des neuen Karlsruher „Rings“. Die beste Götterdämmerung seit langem! Unbedingt reingehen. Es lohnt sich!
Ludwig Steinbach, 23.10.2017
Die Bilder stammen von Matthias Baus
SIEGFRIED
Besuchte Aufführung: 2.7.2017 (Premiere: 10.6.2017)
Selbstfindung und Generationenkonflikt
in der Rumpelkammer

Vorhang auf zum Scherzo. Mit Aplomb ging die Neuproduktion von Wagners „Ring des Nibelungen“ am Staatstheater Karlsruhe in die dritte Runde. In alter Stuttgarter Manier haben sich in Karlsruhe vier unterschiedliche Regisseure der Tetralogie angenommen. Dieses Mal lag die Regie in den Händen von Thorleifur Örn Arnarsson. Für das Bühnenbild zeigte Vytautas Narbutas verantwortlich, die Kostüme und die Videosequenzen besorgte Sunneva Asa Weisshappel.

Erik Fenton (Siegfried)
Mit seinem Konzept knüpft der isländische Regisseur an die alten Edda-Sagen seiner Heimat an. Es sind mächtige Bilder, die sich dem Auge bieten. Das Einheitsbühnenbild stellt eine Rumpelkammer mit Reichstagskuppel dar. Hier liegt allerhand Gerümpel herum. So erblickt man Ritterrüstungen, antike Statuen, ein Spinnrad, Büsten, einen Holzofen, einen Leiterwagen, Vitrinen und Gemälde. Aus einer Standuhr heraus erfolgt im Waldweben der Auftritt des wie Papageno gewandeten Hornisten Dominik Zinsstag. Alberich entsteigt einem Kühlschrank. Mime tritt aus einem Gulli auf. Nachdem er durch seinen eigenen Giftrank umgekommen ist, wird seine Leiche von Siegfried auch in diesen entsorgt. Zudem gibt es noch einen Tisch mit einem Schachspiel, dem sich die Beteiligten manchmal widmen. Insbesondere die wie Orks gekleideten Nibelungen-Brüder - ein guter Einfall - bestreiten im zweiten Aufzug eine ausgedehnte Schachpartie um die Macht. Beim Schmieden des Schwerts steht Siegfried hinter einer Tonne und bedient den Blasebalg.

Auf einer Balustrade liegt von Anfang an das Gerippe des Drachen, durch das man den Sänger des Fafner nur undeutlich sieht. Beim Kampf mit dem Wurm erklimmt Siegfried eine Treppe und sticht mit Notung von unten in den Leib des Skeletts. Von dem Geländer aus blicken Wotans Raben hinunter auf die Rumpelkammer. Sie sind von ihrem Herrn zum Spionieren ausgesandt. Der Wanderer tritt als Zauberer Gandalf aus dem „Herrn der Ringe“ bei Mime ein. Zauberhut, langer Bart und grauer Mantel sind jedoch nur Kostüm und Maske Wotans, der als Schauspieler durch die Welt zieht. Während der Wissenswette tritt er immer wieder gegen die Schwertstücke und versucht Mime auf diese Weise zur richtigen Frage zu bringen. Dies allerdings erfolglos. Wenn der Göttervater gerade nichts auf der Bühne zu tun hat, sitzt er in moderner Kleidung in einer rechts neben dem Orchestergraben eingerichteten Überwachungszentrale und beobachtet über zahlreiche Monitore das Geschehen. Big Brother Wotan ist watching you. Sein allsehendes Auge wird des öfteren auf den Hintergrund projiziert. Er ist allerdings nicht nur der passive Beobachter, sondern wird durchaus auch noch aktiv tätig.

Renatus Meszar (Wanderer), Statisterie
Gemäß dem Charakter des „Siegfried“ als Scherzo des „Rings“ wartet Arnarsson auch mit heiteren Aspekten auf. Die beginnen schon bei Siegfried, der recht ungehobelt wirkt und ständig das Kostüm wechselt. Mal ist er Supermann, mal ein diffus angeleuchtetes Skelett. Ein Höhepunkt der Aufführung ist die Szene, in der er mit Hilfe eines alten, verstimmten Klaviers, auf dem eine Wagner-Büste steht, mit dem Waldvogel Kontakt aufnehmen will. Hier gibt es mehre Vögel in Gestalt von vom Schnürboden herabschwebenden hübschen Mädchen. Herrlich wie sie sich die Ohren zuhalten, als sie Siegfrieds Geklimper nicht mehr ertragen können. Am Ende des zweiten Aufzugs überreicht die Vogel-Maid Siegfried Wagners Partitur. Der Held, der sich sein Leben selbst gestalten wollte, muss nun erkennen, dass seine Geschichte von jemandem anderen stammt, den er nicht kennt. Da mitzumachen hat er aber überhaupt keine Lust. Er steht gegen die Fremdbestimmtheit auf und geht auf die Suche nach sich selbst. Die von ihm angestrebte Selbstfindung ist das zentrale geistige Element von Arnarssons Regiearbeit. Im dritten Aufzug reißt er dem Wanderer sein Gandalf-Kostüm vom Leib und bespritzt ihn mit Wasser, bevor er schließlich noch den Speer über seinem Knie zerbricht. Die Speerspitze behält er. Respekt hat er überhaupt keinen. Eindringlich wird hier - und auch in Siegfrieds Verhältnis zu Mime - ein Generationenkonflikt geschildert. Nachhaltig prallen alte und neue Zeit aufeinander, wobei die alte unterliegt. Während der ganzen Zeit macht der Waldvogel mit seiner Handy-Kamera eifrig Photos von Siegfried.

Katharine Tier (Erda)
Recht gefühlvoll ist Wotans Begegnung mit Erda inszeniert. Die Ur-Wala ist in Begleitung zweier Nornen. Wo ist die dritte Norn? Sie ist nirgends zu sehen. Am Ende der Szene geht Erda nicht ab, sondern beobachtet die Auseinandersetzung zwischen dem Göttervater und seinem Enkel. Mit Tschechow’schen Elementen kann der Regisseur umgehen. Das wurde schon an anderer Stelle offenkundig. Zur letzten Szene schiebt Siegfried Teile der Rumpelkammer beiseite und reißt den Hintergrundprospekt ab. Von Brünnhilde ist indes nichts zu sehen. Nun wird es psychologisch. Siegfried sitzt im Vordergrund allein am Tisch und singt. Er imaginiert Brünnhilde so lange, bis die ehemalige Walküre schließlich doch noch, gleichsam im letzten Augenblick, aus der Versenkung auftaucht. Das Duett der beiden wird von allerlei Projektionen begleitet, deren Sinn sich nicht immer erschließt. Am Ende senkt sich die Balustrade wie eine Käseglocke über das neue hohe Paar. Gemeinsam sind sie gefangen. Können sie ihrem Gefängnis jemals wieder entkommen? Diese Frage wird wohl nicht beantwortet werden, denn die für Oktober 2017 anvisierte „Götterdämmerung“ liegt in den Händen eines weiteren Regisseurs.

Jaco Venter (Alberich), Renatus Meszar (Wanderer)
Auf hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Erik Fenton war ein darstellerisch glaubhafter und gesanglich äußerst konditionsstarker Siegfried. Er verfügt über einen bestens fokussierten, differenzierungsfähigen Tenor mit volltönender Mittellage und strahlender Höhe. Die dramatischen Ausbrüche kamen genauso überzeugend wie die emotionalen, sehnsuchtsvollen Momente. Matthias Wohlbrecht war ein sehr maskig klingender, sowohl stimmlich wie auch schauspielerisch recht schmieriger und hinterhältiger Mime. In dem Wanderer dürfte Renatus Meszar eine seiner besten Rollen gefunden haben. Er gestaltete seinen Part mit enormer vokaler Noblesse, großer Durchschlagskraft und feinem Nuancierungsvermögen. Jaco Venter war ein kernig und markant singender Alberich, den er auch ansprechend spielte. Mit hohen sonoren Bassqualitäten stattete Avtandil Kaspeli den Fafner aus. Einen voll und rund klingenden Mezzosopran mit profunder Tiefe und tadellosem hohem ‚gis’ nannte die Erda von Katharine Tier ihr eigen. Obwohl sie sich wegen einer Indisposition ansagen ließ, kam Heidi Melton in der Rolle der Brünnhilde gut über die Runden. An diesem Abend erwies sie sich als echte hochdramatische Sängerin mit imposanten Höhenflügen und farbiger, strahlkräftiger Mittellage. Einen tiefgründig intonierenden Waldvogel gab Uliana Alexyuk.
Eine Meisterleistung ist GMD Justin Brown und der ausgezeichnet aufspielenden Badischen Staatskapelle zu bescheinigen, Zusammen erzeugten sie einen abwechslungsreichen, dynamisch fein abgestuften und von großer Intensität und Pracht geprägten Klangteppich, der sich zudem durch viele Farben und eine hohe Gefühlsskala auszeichnete.
Fazit: Eine Aufführung, die durchaus empfohlen werden kann.
Ludwig Steinbach, 3.7.2017
Die Photos stammen von Falk von Traubenberg
„Adriana Lecouvreur“
B-Premiere am 7.4.17
Dank überzeugender Einspringerin gerettet
Lieber Opernfreund-Freund,
am gestrigen Freitag fand in Karlsruhe die so genannte B-Premiere von „Adriana Lecouvreur“ statt, die am Haus durch alle Rollen doppelt besetzt ist und bei der sich die zweite Garde - ohne das qualitativ wertend zu meinen - an Cileas Schmachtfetzen versuchen durfte.
 Die vertrackte Story um Machtspiele, Eifersucht und Giftmord mittels eines Veilchenbuketts war Regisseurin Katharina Thoma wohl ein wenig zu konstruiert und so hat sie die Oper nach der Vorlage von Eugène Scribe und Ernest Legouvé gründlich entdramatisiert. Sie betont in den ersten drei Akten ihrer Inszenierung die komödiantischen Anteile des Werkes, die in Musik und Text zweifelsohne vorhanden sind. Damit wertet sie gleichsam das Quartett der Schauspielerinnen und Schauspieler der Comédie-Française auf, das doch eigentlich eher Staffage ist, auch wenn es im ersten Akt durchaus als Motor, der die Handlung vorantreibt, fungiert. Die Bühne auf der Bühne darzustellen, ist wohl eine besondere Gelegenheit, mit verschiedenen Ebenen zu spielen, so dass es durchaus schlüssig scheint, dass die Handlung ins Hier und Heute verlegt wurde, das dargebotene Theater im Theater aber ein antikes Stück präsentiert, für das Irina Bartels hinreißende historische Kostüme geschneidert hat. Die Drehbühne des Hauses bietet weitere Möglichkeiten, mit Schein und Wirklichkeit zu spielen, so dass Kunst und Realität hier zu verschwimmen scheinen - die gelungenen Aufbauten stammen von Dirk Becker. Im letzten Akt wird’s dann doch dramatisch. Die Titelheldin stirbt allerdings nicht durch die von der Rivalin übersandten vergifteten Blumen. Vielmehr ist sie da eine alternde Diva, die nicht mehr spielt und deren einstiger Chef Michonnet an der Flasche hängt, so dass beide vielleicht ein realistisches Bild eines Künstlerlebens zeichnen, in dem Erfolge nur noch in der Erinnerung bestehen.
Die vertrackte Story um Machtspiele, Eifersucht und Giftmord mittels eines Veilchenbuketts war Regisseurin Katharina Thoma wohl ein wenig zu konstruiert und so hat sie die Oper nach der Vorlage von Eugène Scribe und Ernest Legouvé gründlich entdramatisiert. Sie betont in den ersten drei Akten ihrer Inszenierung die komödiantischen Anteile des Werkes, die in Musik und Text zweifelsohne vorhanden sind. Damit wertet sie gleichsam das Quartett der Schauspielerinnen und Schauspieler der Comédie-Française auf, das doch eigentlich eher Staffage ist, auch wenn es im ersten Akt durchaus als Motor, der die Handlung vorantreibt, fungiert. Die Bühne auf der Bühne darzustellen, ist wohl eine besondere Gelegenheit, mit verschiedenen Ebenen zu spielen, so dass es durchaus schlüssig scheint, dass die Handlung ins Hier und Heute verlegt wurde, das dargebotene Theater im Theater aber ein antikes Stück präsentiert, für das Irina Bartels hinreißende historische Kostüme geschneidert hat. Die Drehbühne des Hauses bietet weitere Möglichkeiten, mit Schein und Wirklichkeit zu spielen, so dass Kunst und Realität hier zu verschwimmen scheinen - die gelungenen Aufbauten stammen von Dirk Becker. Im letzten Akt wird’s dann doch dramatisch. Die Titelheldin stirbt allerdings nicht durch die von der Rivalin übersandten vergifteten Blumen. Vielmehr ist sie da eine alternde Diva, die nicht mehr spielt und deren einstiger Chef Michonnet an der Flasche hängt, so dass beide vielleicht ein realistisches Bild eines Künstlerlebens zeichnen, in dem Erfolge nur noch in der Erinnerung bestehen.

Vom Geliebten vor Jahren verlassen, setzt die Schauspielerin ihrem Leben selbst ein Ende, imaginiert die Wiedervereinigung mit ihrem Maurizio schlaftablettenumnebelt und tritt - dann doch wieder ganz theatralisch - für immer aus dem Scheinwerferkegel. Durch die Interaktion des Paares wird am Schluss allerdings diese an sich nicht unüberzeugende Lesart verwässert, wird wenig stringent aufgelöst, so dass mancher Zuschauer nicht zu deuten wusste, ob es sich nun um Realität oder ein Trugbild einer Sterbenden handelt. War dies ein von Katharina Thoma gewollter Effekt, so hat er mich nicht überzeugt, der Rest des Abends durchaus.
Der wäre allerdings um ein Haar an der Erkrankung von Katherine Broderick gescheitert, die ihr Debüt als „Adriana“ geben sollte, gestern nur spielen, aber nicht singen konnte. Als Retterin in letzter Sekunde trat glücklicherweise Hrachuhí Bassénz auf den Plan, die die Rolle bereits in Covent Garden verkörpert hatte und von der Seite sang. So kann ich Ihnen hier nur meinen Eindruck von den darstellerischen Qualitäten von Katherine Broderick wiedergeben, die vor allem dann überzeugte, wenn sie nicht die Diva, sondern die Frau dazustellen hatte. So lief sie im Finale des zweiten Aktes im Wortgefecht mit der Fürstin und vor allem im Schlussakt zu Höchstform auf.

Die zeigte die Einspringerin den ganzen Abend über. Wie Hrachuhí Bassénz mit an feine Seidenfäden erinnernden Höhenpiani und expressiver Mittellage auftrumpft, ist schon ein Erlebnis. Da sehnt man sich förmlich danach, diese hervorragende Sängerin auch spielen zu sehen - Katherine Brodericks Leistung in allen Ehren. Die Rolle ihres Geliebten Maurizio ist ein Paradebeispiel für einen Spinto, gewissermaßen die italienische Version des Heldentenors, die sich furchtlos in jede noch so gewagte Höhe schraubt und mit viel Gefühl und reichlich Schmelz die Töne erst dann beendet, wenn der Dirigent schon längst abgewunken hat. Diese Herausforderung hat der junge James Edgar Knight, seit 2015 Ensemblemitglied in Karlsruhe, so offen muss ich sein, nicht gemeistert. Er verfügt an sich über einen feinen Tenor von schöner Farbe, aber eher schlanker, denn voluminöser Art und hätte vielleicht den kleinen, aber feinen Part des Abbé mit Bravour gemeistert und ist sicher auch als Alfredo in der „Traviata“ hörenswert. Der Maurizio allerdings ist ihm doch noch ein paar Nummern zu groß. Viel zu früh kommt die Partie, die zu den Paraderollen von Caruso, Gigli, Corelli und Domingo gehörte. Die fehlende Kraft versucht der junge Australier mit viel Druck wett zu machen, wird dadurch mitunter unkontrolliert tremolierend, die Höhen gelingen eher kurzatmig denn imposant und wenn dann eine Phrase einmal technisch perfekt über den Graben tönt, erreicht sie mich seltsam seelenlos. Viel Seele packt dagegen Sanja Anastasia in die Partie der Fürstin. Die durchlebt schon im zweiten Akt die Erfahrung, die Adriana in Karlsruhe am Ende macht. Sie ist eine nicht mehr ganz junge Frau, sieht ihre Schönheit schwinden und wird zur Furie als ihr junger Liebhaber sich von ihr abwenden will. Sanja Anastasia gestaltet die Figur mit imposant-vollem, facettenreichem Mezzo, schießt in der Höhe aber mitunter über das Ziel hinaus.

Ensemblemitglied Jaco Venter ist in Karlsruhe eigentlich die Bank für die schweren Wagnerrollen. In den ersten Takten geht ihm eine gewisse Italianitá auch noch ab, fast nach Hans Sachs klingt da sein Michonnet. Ab seiner Arie im ersten Akt aber gelingt ihm eine überzeugende, zu Herzen gehende Interpretation des Theatermenschen mit sattem Bariton voller Gefühl. Avtandil Kasperli ist ein imposanter Fürst von Bouillon, der Abt von Chazeuil von Kammersänger Klaus Schneider kommt unterwürfig-schmierig daher. Agnieszka Tomaszewska, Ariana Lucas, Nando Zickgraf und Opernstudio-Mitglied Hakan Çiftçioglu ergänzen sich und das Ensemble als Komödiantentruppe perfekt mit viel Spielwitz.
Das Ballett „Das Urteil des Paris“ ist dankenswerterweise in Karlsruhe einmal nicht gestrichen und wird als stimmungsvolles, von Hélène Verry choreografiertes Schattenspiel gegeben. Dadurch hat auch der Badische Staatsopernchor unter der Leitung von Ulrich Wagner ordentlich zu tun und macht seine Sache gut. Im Graben zeigt Johannes Willig einen schwungvollen Cilèa und präsentiert den reichen Strauß an eingängigen Melodien voller Verve und Leidenschaft.
Das Publikum im vollbesetzten Haus ist begeistert, applaudiert allen Beteiligten und spart nicht mit „Bravo“-Rufen. Dass der junge, hoch gewachsene Haustenor dabei stärker gefeiert wird als die den Abend rettende Hrachuhí Bassénz, mag entweder dem Respekt vor dessen Mut oder einer ausgeprägten Fangemeinde geschuldet sein. Ich wünsche jeder Künstlerin und jedem Künstler die Geduld, seine Stimme wie seine darstellerischen Fähigkeiten in Ruhe reifen zu lassen und Freunde und Berater, die ihm dabei offen und ehrlich zur Seite stehen.
Trotz kleinerer Wermutstropfen, die Inszenierung, und einem größeren, die künstlerische Qualität betreffend, ist die Produktion doch sehenswert - und im Zweifel gibt es ja auch noch eine alternative Besetzung.
Ihr Jochen Rüth / 8.4.17
Die Fotos stammen von Falk von Traubenberg und zeigen die Besetzung der Premiere.
DIE WALKÜRE
Besuchte Aufführung: 18.12.2016
(Premiere: 11.12.2016)
Bewältigung einer traumatischen Vergangenheit
Entsprechend dem alten Stuttgarter Konzept Klaus Zeheleins hat das Badische Staatstheater Karlsruhe seinen neuen „Ring“ ebenfalls vier jungen Regisseuren, die vierzig Jahre noch nicht überschritten haben, anvertraut. Nach David Hermanns vollauf gelungenem „Rheingold“ ist das großangelegte Projekt nun mit der „Walküre“ fortgesetzt worden. Für die Regie zeichnet Yuval Sharon verantwortlich. Zu seinem Team gehören ferner Sebastian Hannak (Bühnenbild), Sarah Rolke (Kostüme) und Jason A. Thompson (Video).

Peter Wedd (Siegmund), Katherine Broderick (Sieglinde)
Hier haben wir es mit einer recht vielschichtigen Inszenierung zu tun. Der Begriff des Gesamtkunstwerks erhält für Sharon zentrale Bedeutung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Technik. Wagner war ein großer Anhänger technischer Errungenschaften. Darüber ist sich der Regisseur im Klaren und stellt die Frage, welche technischen Mittel der Bayreuther Meister angewendet hätte, wenn er heute gelebt hätte. Die vom Regieteam gegebene Antwort lautet: Videos und Projektionen. Diese durchziehen die ganze Produktion und verleihen ihr einen ganz eigenen Charakter. Es sind immer wieder imposante visuelle Impressionen, die hier entstehen und über die etwas rudimentäre, nicht sehr ausgefeilte Personenregie hinwegtrösten. Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen auch die oft ins Feld geführten Schattenspiele. Dies alles, Regie, Bühnenbild, Kostüme und Licht bilden eine ausgesprochen poetische Einheit von hoher Eindringlichkeit.

Katherine Broderick (Sieglinde), Heidi Melton (Brünnhilde), Peter Wedd (Siegmund)
Den ersten Aufzug deutet Sharon als Kammerspiel à la Ibsen. Siegmund und Sieglinde, denen der Regisseur noch zwei kindliche Alter Egos zur Seite stellt, begegnen sich in einem schier endlosen Gang mit ständig auf- und zugehenden Türen. Hinter diesen erscheinen manchmal den Primat der Musik versinnbildlichende Instrumentalisten. In erster Linie sind es aber Bilder aus der Vergangenheit sowie Wünsche und Sehnsüchte des Wälsungenpaares, die hier abgebildet werden. In der Tat spielt die vergangene Zeit bei Sharon eine wesentliche Rolle. Sie hat bei den Geschwistern zu Traumen geführt, die sie nur schwer bewältigen können. Bei Siegmund hat die durch Wotan genossene Erziehung zum Gesetzlosen und Außenseiter das Trauma ausgelöst. Bei Sieglinde ist es die Zwangsehe mit Hunding, in der sie zum reinen Objekt degradiert ist. Kein Wunder, dass sie ihren ungeliebten Ehemann hasst, der sie wie einen Wertgegenstand behandelt. Die Perspektive der Geschwister ist begrenzt. Von ihren Erinnerungen heimgesucht ist ihr Wahrnehmungsradius eingeschränkt. Sie leben in der Vergangenheit und agieren ständig in immer demselben Raum, in dem auch der zweite Teil des Mittelaufzuges spielt. Die Zukunft ist ihnen verschlossen. Als Ausgleich dafür steht ihnen aber noch die Hoffnung zur Verfügung. Sie dürfen noch hoffen, was bei Wotan nicht mehr der Fall ist.

Renatus Meszar (Wotan), Heidi Melton (Brünnhilde)
Zu Beginn des zweiten Aufzuges ist der Raum erweitert. Wotan und die anderen Götter erleben die Zeit kreisförmig. Dem Göttervater ist die Zukunft nicht verschlossen. Er sieht sein nahendes Ende voraus und lässt alle Hoffnung fahren. Ständig tritt er auf der Stelle und kommt nicht so recht weiter. Aus diesem Gedanken heraus hat das Regieteam das Bild der Rolltreppe vor einem goldenen Hintergrund entwickelt, auf dem Wotans Diskussion mit Fricka stattfindet. Wer gerade die Oberhand hat, steht oben. Die Göttin der Ehe wird hier nicht als böse Zicke vorgeführt, sondern als geschickt argumentierende Strategin. Im Zentrum des Interesses steht bei Sharon der große Monolog Wotans, den er auf ganz eigenwillige, so noch nie erlebte Weise deutet. Der Gott verlässt die Bühne und singt per Mikrophon aus dem Off, während sein Gesicht öfters in Großformat auf den Hintergrund projiziert wird. Auch die Konterfeis anderer „Ring“-Protagonisten und Erinnerungsstücke an das „Rheingold“ erscheinen immer wieder im Bild. Hier liegt der Fokus ganz auf einer von zahlreichen Videos dominierten Rückschau. Das war schon eine ungewöhnliche, aber durchaus Eindruck machende Vorgehensweise. Wenn die Rede des Gottes auf Siegmund kommt, tritt dieser in Anwendung eines Tschechow’schen Elementes selbst auf. In Vorausahnung seines Todes sticht ihm Wotan hier bereits seinen Speer in den Rücken.

Heidi Melton (Brünnhilde)
Den größten Eindruck hinterließ der Walkürenritt. Der dritte Aufzug, in dem die Zeit stillsteht, spielt in einer aus mannigfaltigen weißen Platten bestehenden Eis- und Schneelandschaft, die an Caspar David Friedrichs Gemälde „Die verlorene Hoffnung“ gemahnt. Die Jagdfliegerstaffel der in signalfarbenes Orange gekleideten Walküren springt vor der Kulisse des Paramount-Berges mit Fallschirmen ab. Später trennt Wotan mit seinem Speer die Eisplatten, um auf diese Weise eine Öffnung zu erzeugen, in der Brünnhilde schließlich einschlafend versinkt. Kurze Zeit später taucht sie in einen Eisblock eingeschlossen wieder auf. Siegfried wird im dritten Teil der Tetralogie viel Energie aufwenden müssen, um diesen zum Schmelzen zu bringen. Ob ihm das gelingen wird? Da im „Siegfried“ aber ein anderer Regisseur am Werk sein wird, wird diese interessante Frage wohl nicht beantwortet werden.

Ensemble der kleinen Walküren
Durchwachsen muteten die gesanglichen Leistungen an. Heidi Melton sang die Brünnhilde in Mittellage und Tiefe zwar mit guter Stütze und imposantem Ausdruck. In der oberen Lage blieben indes Wünsche offen. Die Höhe war oft geschrien. Zudem erreichte sie bei den einleitenden „Hojotoho“-Rufen die hohen c’s nicht. Vielleicht hätte Frau Melton bei der Sieglinde bleiben sollen. Die Brünnhilde ist noch eine Spur zu groß für sie. Renatus Meszar tat sich als Wotan zu Beginn mit einer hoch liegenden Phrase etwas schwer. Dieses Problem bekam er aber schnell in den Griff und überzeugte im Folgenden mit gut gestütztem und geradlinig geführtem Bass-Bariton. Insgesamt haben wir es hier mit keinem außergewöhnlichen, aber durchaus soliden Vertreter des Göttervaters zu tun. Einen auf den ersten Blick kräftig und markant singenden Tenor brachte Peter Wedd für den Siegmund mit. Die Stimme ist aber dennoch noch nicht gänzlich ausgereift. Bei aller Intensität wirkte seine Tongebung oft gaumig und geknödelt. Auch die Diktion des englischen Sängers ließ zu wünschen übrig. Nicht gerade den besten Eindruck hinterließ auch die Sieglinde von Katherine Broderick. In der Höhe und bei den dramatischen Ausbrüchen ging sie oftmals vom Körper weg, woraus eine recht schrille Tongebung resultierte. Ks. Ewa Wolak war eine sehr dominante Fricka, die sie mit pastoser Altstimme insgesamt auch gut sang. Dass ihr bei der Stelle „Jauchzend jagt sie daher“ einmal das hohe fis misslang, sei ihr angesichts der ansprechenden Gesamtleistung verziehen. Gesanglich nichts auszusetzen gab es an dem sonor singenden Hunding Avtandil Kaspelis. Darstellerisch blieb er aber etwas blass. Das Sieglindes Ehemann anhaftende Böse konnte er in keiner Weise vermitteln. Viele gute Stimmen, aber auch eine sehr dünne Stimme hörte man in dem Ensemble der kleinen Walküren, das aus Ks. Barbara Dobrzanska (Helmwige), Christina Nissen (Gerhilde), Ks. Ina Schlingensiepen (Ortlinde), Katharine Tier (Waltraute), Roswitha Christina Müller (Siegrune), Ks. Tiny Peters (Rossweise), Kristina Stanek (Grimgerde) und Ariana Lucas (Schwertleite) zu bestand. Als kleines Wälsungenpaar gefielen Nils Cordes und Ella Schwartz.

Renatus Meszar (Wotan), Heidi Melton (Brünnhilde)
Eine Glanzleistung ist GMD Justin Brown und der versiert aufspielenden Badischen Staatskapelle zu bescheinigen. Es war schon ein recht vielschichtiger, differenzierter und nuancierter Klangteppich, den Dirigent und Musiker hier erzeugten. Überaus rasant gelang bereits der einleitende Gewittersturm. Auch im Folgenden setzte Brown auf insgesamt eher zügige Tempi. Einfach grandios, warm und gefühlvoll erklangen die Motive der Wälsungen-Zwillinge. Prägnant und energiegeladen präsentierte man den Walkürenritt. Die auf der Bühne vorherrschenden großen Emotionen fanden eine treffliche Entsprechung im Orchester. Darüber hinaus wartete der Dirigent auch mit einer gelungenen Transparenz auf. Das erste Zwischenspiel von Wotans Abschied mit dem großen Ausbruch nahm er etwas langsamer, als man es sonst gewohnt ist.
Fazit: Ein szenisch und musikalisch gelungener Abend mit einigen Schwächen auf der vokalen Seite.
Ludwig Steinbach, 19.12.2016
Die Bilder stammen von Falk von Traubenberg

HÄNSEL UND GRETEL
Besuchte Aufführung: 4.12.2016
(Premiere: 14.6.2003)
Hexentraum zweier Geschwister
Wie zur Adventszeit an vielen Opernhäusern allgemein üblich, stand auch am Badischen Staatstheater Karlsruhe heuer wieder Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ auf dem Spielplan. Die Inszenierung von Achim Thorwald in dem ästhetischen Bühnenbild von Christian Floeren und den gelungenen Kostümen von Ute Frühling hat in den dreizehn Jahren ihres Bestehens nichts an Kraft eingebüßt. Sie ist immer noch so sehenswert wie am ersten Tag. Kleine wie auch große Zuschauer zeigten sich mit dem Dargebotenen voll zufrieden. Und das war sehr verständlich. Was sich vor den Augen des Publikums abspielte, war einerseits durchaus kindgerecht, auf der anderen Seite aber auch recht innovativ und trefflich durchdacht.

Ks. Ina Schlingensiepen (Gretel), Kristina Stanek (Hänsel), Kinderballett
Thorwald hat sich der Geschichte um die im Wald verirrten Kinder mit viel Liebe angenommen. Sein Ansatzpunkt ist psychologischer Natur. Ihm geht es in erster Linie um die Aufzeigung von Angstzuständen in der Kinderpsyche. Alles, was die Geschwister in Furcht versetzt, wird seitens des Regisseurs übermäßig groß dargestellt. Das beginnt schon bei dem Elternhaus, das Hänsel und Gretel als „überdimensionaler Schrecken“ (vgl. Programmbuch) erscheint. Gegenüber der monumentalen Einrichtung und den sich auf Kothurnen fortbewegenden Eltern wirken die beiden Kinder klein und hilflos. Erst am Ende begegnen sich die Geschwister und das Besenbinderpaar auf Augenhöhe. Die Eltern erscheinen nun in ihrer normalen Größe, jetzt werden sie von ihren herangereiften Kindern nicht mehr gefürchtet.
Der zweite Akt begnügt sich nicht mit reiner Natur. Der die Geschwister mit Hilfe der Drehbühne umkreisende Wald erscheint als Metapher ihrer seelischen Ängste. Im Hexenbild wird dieses Konzept konsequent weitergeführt. Die sich zunächst recht liebevoll gebende und daher nicht gerade Angst einflößende Hexe erscheint als kleine, sich auf den Knien fortbewegende alte Frau. Erst nachdem sie die Maske fallengelassen und ihr wahres Gesicht offenbart hat, erhebt sie sich zu ihrer vollen Größe. Ebenfalls klein ist das Hexenhaus, in das der Backofen integriert ist. Die mutig gewordene Gretel darf die Zauberin am Ende allein in den Ofen schieben.

Gut mutet der Regieeinfall an, dass Hänsel und Gretel die Begegnung mit der Hexe nur träumen. Offenkundig wird, dass die Magierin nur einen Ausfluss der Phantasie der Geschwister darstellt und dass jedes Kind unter derartigen Angstträumen leiden kann. Was Thorwald anhand der Titelfiguren vorführt, die lernen, sich ihrer Furcht zu stellen, dieser zu trotzen und zu guter Letzt zu sich selbst finden, gilt für alle Kinder. Dies wird seitens der Regie dadurch verdeutlicht, dass am Ende die aus dem Bann der Hexe befreiten Lebkuchenkinder als Alter Egos von Hänsel und Gretel erscheinen. Sie sind wie diese gekleidet. Diese Konzeption war sehr überzeugend und wurde mit einer stimmigen Personenregie einfühlsam umgesetzt. Auch auf Brecht’sche Elemente versteht sich der Regisseur. So lässt er den Besenbinder bei seinem ersten Auftritt die Bühne durch den Zuschauerraum betreten. Herrlich anzusehen ist die nächtliche Pantomime, in der die den Schlaf von Hänsel und Gretel bewachenden Engel von einem niedlichen Kinderballett getanzt werden. Der Mann im Mond beobachtet das Ganze von erhobener Warte aus - ein sehr ästhetisches Bild. Unter diesen Umständen war es kein Wunder, dass der Schlussapplaus auch dieses Mal wieder ausgesprochen herzlich ausfiel.

Ks. Ina Schlingensiepen (Gretel)
Mit den Sängern/innen konnte man insgesamt zufrieden sein. Ks. Ina Schlingensiepen war darstellerisch eine recht anmutige Gretel, die sie mit bestens fokussiertem, differenziertem und mühelos bis zum hohen c hinaufreichendem lyrischem Sopran auch ansprechend sang. In nichts nach stand ihr Kristina Stanek, die den Hänsel recht burschikos spielte und mit ebenfalls vorbildlich sitzendem, wandlungsfähigem Mezzosopran auch perfekt sang. Die beiden Sängerinnen ergänzten sich hervorragend, ihre Stimmen harmonierten vorzüglich miteinander. Schauspielerisch einfach köstlich gab Matthias Wohlbrecht die Knusperhexe. Stimmlich machte er aus der Zauberin eine maskige Charakterstudie. Einen gut sitzenden, robusten Bariton brachte Jaco Venter für den Besenbinder Peter mit. Christina Niessen stattete die Gertrud vokal mit großer Dramatik aus. Mit enormer Stimmkraft und sehr markant sang Dilara Bastar das Sandmännchen. Recht dünn und kopfig klang dagegen Ilkin Alpays Taumännchen. Gut machte seine Sache der Cantus Juvenum Karlsruhe.
Ansprechende Leistungen erbrachten Ulrich Wagner am Pult und die exzellent aufspielende Badische Staatskapelle. Das Dirigat zeichnete sich durch ebenmäßigen Fluss und eine enorme Farbpalette aus. Den Spagat zwischen Volksliedhaftigkeit und Wagnernähe haben Dirigent und Musiker gut bewältigt. Insgesamt wurden die verschiedenen Facetten von Humperdincks vielschichtiger Musik trefflich herausgearbeitet und einander gegenübergestellt, woraus ein abwechslungsreicher, nuancierter und ausdrucksstarker Klangteppich resultierte.
Fazit: Eine gelungene Wiederaufnahme, deren Besuch sich durchaus gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 5.12.2016
Die Bilder stammen von Jochen Klenk
DAS RHEINGOLD
WA am 30.9.2016
Premiere: 9.7.2016
Der ganze „Ring“ im „Rheingold“
Es war ein vollauf gelungener Abend, die Wiederaufnahme von Wagners „Rheingold“ am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Mit dieser beachtlichen Produktion startet die Karlsruher Oper einen neuen „Ring“. Vorausgegangen waren ihr an diesem Haus die Interpretationen von Grüber/Rudolph (1975-1985), Neuhold/Martinoty (1993-1999) und Bramall/Krief (2004-2013). Man sieht: Der „Ring“ ist also so etwas wie ein Dauerbrenner in der Fächerstadt. Angesichts des hohen Niveaus des neuen „Rheingolds“ kann man auf die folgenden Teile schon gespannt sein.

Ariana Lucas (Erda), Rheintöchter, Loge
Der „Ring“ hat eine recht vielschichtige Dramaturgie. Im Laufe seiner cirka ein Vierteljahrhundert währenden Entstehungszeit wurde er von Wagner stets aufs Neue und unterschiedlich interpretiert, sodass im Lauf der vier Musikdramen verschiedene geistige Ansätze sichtbar werden. Ein Perspektivwechsel von Werk zu Werk findet statt. Und genau den wollte Intendant Spuhler herausstellen, als er die großangelegte Tetralogie gleich vier jungen Regisseuren unter 40 Jahren anvertraute. Nun ist diese Vorgehensweise nicht mehr neu. Der legendäre 1999/2000 entstandene Stuttgarter „Ring“ fußte auf demselben Konzept, das international viel positives Aufsehen erregte. Auch am Aalto Theater Essen ging dieser Ansatzpunkt vor einigen Jahren voll auf. Und nun also auch das Badische Staatstheater Karlsruhe. Die Zeichen, dass der „Ring“ mit seinen vier variierenden Sichtweisen ein großer Erfolg wird, stehen gut. Den Anfang mit dem „Rheingold“ machte der deutsch-französische, dem Karlsruher Publikum schon durch „Les Troyens“ und „Boris Godunow“ bekannte Regisseur David Hermann, der die Messlatte für die drei anderen Regisseure Yuval Sharon („Die Walküre“), Thorleifur Örn Arnasson („Siegfried) und Tobias Kratzer („Götterdämmerung“) hoch gesteckt hat.

Rheintöchter
David Hermann ist in Zusammenarbeit mit Jo Schramm (Bühnenbild) und Bettina Walter (Kostüme) eine gut durchdachte, flüssige und spannende Inszenierung gelungen, die sich tief in das Gedächtnis eingrub. Indes sollte der geneigte Operngänger, der dieses „Rheingold“ besucht, auch die anderen drei Teile des „Ringes“ gut kennen, sonst läuft er Gefahr, nicht zu verstehen, was das Regieteam da so versiert auf die Bühne gebracht hat. Denn in Hermanns Deutung des Vorabends sind die drei anderen Teile des Zyklus bereits in nuce mit enthalten. Man könnte von einem Ring an einem Abend sprechen, der ist aber freilich nicht von Loriot. Es ist zudem das erklärte Anliegen des Regisseurs, Wagners ausgeprägte Leitmotivtechnik auch szenisch umzusetzen. Den musikalischen korrespondieren bildliche Leitmotive, die bereits in die Zukunft weisen und die Hermann mit Schauspielern temporeich in Szene setzt. Insgesamt ist seine Personenführung ausgefeilt und stringent.

Jaco Venter (Alberich)
Durch das Aufeinanderprallen mehrerer Zeitebenen werden dem im modernen Businessanzug auftretenden Wotan in einem Tagtraum die Folgen seines fragwürdigen Tuns bereits am Vorabend nachhaltig vor Augen geführt. Ständig einen Blick neben sich werfend, sieht sich der Göttervater mit einer negativen Zukunft konfrontiert, die er durch sein verantwortungsloses Tun selbst heraufbeschworen hat, an der er aber nichts mehr ändern kann. Was er angerichtet hat, ist unumkehrbar. Seine Zukunftsvisionen spielen sich auf einer übergeordneten Meta-Ebene ab. So sieht man während des das zweite Bild einleitenden Walhall-Motivs bereits den flüchtenden Siegmund, der von seiner Zwillingsschwester Sieglinde gastlich aufgenommen wird und während Wotans Ehestreit mit Fricka, der in einem Bürohaus mit Tisch, Lederstühlen und Aktenschrank stattfindet, mit dieser ein inzestuöses Verhältnis beginnt. Wenn die fliehende Freia auf den Plan tritt, ergreifen auch die sich liebenden Geschwister die Flucht. Während der Diskussion Wotans mit den Riesen wird man bereits Zeuge von Brünnhildes Todesverkündigung, von Siegmunds Kampf mit Hunding sowie von Sieglindes Rettung durch die Walküre.

Loge, Mime
Am Ende des zweiten Bildes sieht man Wotans menschliche Tochter dann schwanger über die Bühne huschen. Bei der Fahrt in die von einem Stacheldrahtzaun begrenzte Fabrik Nibelheim trifft Wotan dann auf die tote Sieglinde, die eben das Baby Siegfried geboren hat, das der Obergott liebevoll in den Arm nimmt. Das Schmieden der Nibelungen mutiert gleichsam zum Herzschlag des kleinen Siegfried. Dieser wird indes sehr schnell erwachsen und beginnt die Stücke des Schwertes Notung zusammenzuschmieden. Bereits jetzt sieht Wotan voraus, dass ihm sein Enkel den Speer zerschlagen wird. Wenn sich Alberich in einen Lindwurm verwandelt - man sieht nur dessen leuchtende roten Augen -, tötet Siegfried gleichzeitig auch den Drachen. Dann bricht der Held zusammen mit dem Waldvogel zum Walkürenfelsen auf, wo er die schlafende Brünnhilde erweckt. Seinen Höhepunkt erreicht die Parallelhandlung im vierten Bild, wenn Hagen neben seinen ihm täuschend ähnlich sehenden, den Ring verfluchenden Vater Alberich tritt. In dem Moment, in dem diesem von Wotan der Ring vom Finger gerissen wird, widerfährt auf der oberen Ebene Brünnhilde durch Siegfried das Gleiche - ein starker Moment. Und während Fafner seinen Bruder Fasolt ermordet, wird gleichzeitig Gunther von Hagen getötet - eine sinnfällige Entsprechung. Der Kampf der Riesen erneuert sich, wie schon im Klavierauszug der „Götterdämmerung“ aus Wagners Mund überliefert wird. Beim Einzug der Götter in Walhall flammt der Scheiterhaufen Siegfrieds auf. Hier ist die Wotan-Familie bereits an ihrem Ende angelangt. Angesichts des Feuer-Bildes wird der musikalische Triumphzug der Götter, die nur einen Etappensieg erzielt haben, gleichsam zum Trauermarsch.

Loge, Jaco Venter (Alberich), Renatus Meszar (Wotan)
Diese Vorgehensweise ist sehr überzeugend, kann aber nur aufgehen, wenn das Werk, wie hier, als Einzelstück inszeniert wird. Zeigte nur ein einziger Regisseur für den gesamten „Ring“ verantwortlich, müsste diese Konzeption scheitern, bei dem nur für den Vorabend verantwortlichen Hermann geht sie indes vortrefflich auf. Man möchte sie unter all den vielen Interpretationen des Vorabends der Tetralogie nicht missen. Hier haben wir es auch szenisch mit einer gelungenen Rechtfertigung dafür zu tun, den „Ring“ vier Teams anzuvertrauen. Hermann will seine Regiearbeit als Wahrnehmungsexperiment verstanden wissen, das in diesem Zusammenhang voll funktioniert. Das Ganze wird von ihm als Kreislauf angelegt. Zu Beginn bewacht Erda den Schlaf der vor einem schwarzen Lavafelsen schlummernden, märchenhaft schön eingekleideten Rheintöchter. Dann wirft sie den Mädchen den Ring zu. Wenn die Urmutter am Ende dann den Ring dem Rhein zurückgibt, schließt sich der Kreis. Hier weicht Hermann vom Schluss der „Götterdämmerung“ ab, in diesem konkreten Kontext mag der Einfall aber durchaus angehen. Insgesamt bietet der Regisseur viel Neues, einiges kommt einem aber schon bekannt vor. So z. B. dass der aus einem Feuerofen auftretende Loge als diabolischer Strippenzieher fungiert und dass Freia unter einem Stockholmsyndrom leidet. Das Liebesverhältnis, das sie wider den Text mit dem sympathischen Jung-Architekten Fasolt unterhält, spricht da eine eindeutige Sprache. Auf seinen Tod reagiert sie äußerst betroffen. Auch dass Alberich augenscheinlich etwas zu viel Testosteron sein Eigen nennt, hat man schon anderswo gesehen. Diese Aspekte fügen dem insgesamt überaus positiven Gesamteindruck der Inszenierung aber keinen Schaden zu.

Loge, Jaco Venter (Alberich), Renatus Meszar (Wotan)
Eine ausgezeichnete Leistung ist auch GMD Justin Brown am Pult zu bescheinigen. Dieser famose Dirigent dürfte derzeit einer der besten Anwälte von Wagners Werk sein. Zusammen mit der bestens disponierten, konzentriert und klangschön aufspielenden Badischen Staatskapelle wurde er jeder Nuance der Partitur voll gerecht. Der von ihm und den Musikern erzeugte Konversationston ging mit dem Inhalt der Handlung eine vorzügliche Verbindung ein. Die transparente musikalische Tonsprache war voll und ganz dem auf der Bühne vorherrschenden Parlando angeglichen. Wunderbar war obendrein, wie Brown die herrliche Musik ebenmäßig und gut strukturiert dahinfließen ließ und dabei auch mit einer reichhaltigen Farbpalette aufwartete. Für minutiös ausgeleuchtete Details zeigte er genauso viel Gespür wie für den großen Zusammenhang. Die von ihm angeschlagenen Tempi waren dabei schön bedächtiger Natur, sodass der ganze (Vor-) Abend cirka zweieinhalb Stunden dauerte.

Renatus Meszar (Wotan), Yang Xu (Fasolt), Avtandil Kaspeli (Fafner), Matthias Rott (Hunding), Witalij Kühne (Siegmund), Diana Matthess (Brünnhilde)
Auch gesanglich konnte man insgesamt zufrieden sein. Renatus Meszar war ein solide singender Wotan, dessen Bass-Bariton indes in der Höhe etwas mehr hätte aufblühen können. Übertroffen wurde er von Jaco Venter, der einen kernigen, robusten Bariton für den Alberich mitbrachte, den er auch intensiv spielte. Eine hervorragende Leistung erbrachte Klaus Schneider - in dieser Produktion alternativ auch als Mime besetzt - als Loge. Er machte aus dem Feuergott keine Charakterstudie, sondern näherte sich ihm mehr von der lyrischen Seite her, die auch so manche heldische Töne einschloss. Eine voll und rund singende Fricka war Katherine Tier, die in der Premiere noch die Flosshilde sang. Stimmkräftig und mit guter Gesangsstütze präsentierte sich Agnieszka Tomaszewska in der Partie der Freia. Eine pastose, volltönende Altstimme brachte Ariana Lucas für die Erda mit. Mit recht maskigem Tenorklang stattete Thorsten Hofmann von der Staatsoper Stuttgart den Mime aus. Auch der Froh von Cameron Becker klang recht flach. Da war es um den kraftvoll und gut focussiert singenden Donner Ks. Armin Kolarczyks schon besser bestellt. Der helle, gut gestützte Bass von Yang Zu als Fasolt zeichnete sich durch einfühlsame Linienführung und schönes Legato aus. Ein tadellos singender, markant klingender Fafner war Avtandil Kaspeli. Einen homogenen Gesamtklang bildeten die allesamt ansprechend singenden Rheintöchter von Ks. Ina Schlingensiepen (Woglinde), Kristina Stanek (Wellgunde) und Dilara Bastar (Floßhilde). In den stummen Rollen waren die Schauspieler/innen Witalij Kühne (Siegmund und Siegfried), Rosa Sutter (Sieglinde und Gutrune), Diana Matthess (Brünnhilde), Matthias Rott (Hunding und Hagen) und Stefan Pikora (Gunther) zu erleben.
Fazit: Ein gelungener „Ring“-Auftakt“, der den Besuch durchaus gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 1.10.2016
Die Bilder stammen von Falk von Traubenberg
TRISTAN UND ISOLDE
Besuchte Aufführung: 26.6.2016
Premiere: 27.3.2016
Tristans Fieber-Vision von Isolde
Im April 1859 schrieb Richard Wagner an Mathilde Wesendonk über seinen „Tristan“: „Ich fürchte, die Oper wird verboten - falls durch schlechte Aufführungen nicht das Ganze parodiert wird -: nur mittelmäßige Aufführungen können mich retten! Vollständig gute müssen die Leute verrückt machen“. Nun: verrückt wurde man bei der Karlsruher Aufführung von „Tristan und Isolde“ ganz und gar nicht, obwohl es sich dabei um eine ganz vorzügliche Aufführung handelt. Das Badische Staatstheater ist an diesem voll gelungenen Abend seinem Ruf als erstklassiges Wagner-Haus wieder einmal voll und ganz gerecht geworden. Noch viel zu wenig bekannt ist die Tatsache, dass das Werk einst fast in Karlsruhe aus der Taufe gehoben worden wäre. Und das Ehepaar Schnorr von Carolsfeld, das bei der Münchner Uraufführung 1864 die Titelpartien sang, war zuvor einige Jahre in Karlsruhe engagiert.

Isolde, Erin Caves (Tristan), Katharine Tier (Brangäne), Seung-Gi Jung (Kurwenal), Herren des Badischen Staatsopernchores
Alles wirkte wie aus einem Guss. Regie und musikalische und gesangliche Leistungen fügten sich zu einer ansprechenden Symbiose zusammen, die das Publikum stark in ihren Bann zog. Gelungen war schon die Inszenierung von Christopher Alden, für die Paul Steinberg das Bühnenbild und Sue Willmington die Kostüme beisteuerten. Um sich nicht allzu weit von den Problemen und Konflikten der Entstehungszeit des Werkes zu entfernen, andererseits aber auch zur Pflege eines modernes Ambientes, hat Alden die Oper in den 1930/40er Jahren angesiedelt. Das Ganze spielt sich in einem Einheitsraum ab, der die Lounge eines Ozeansdampfers der Zeit um 1940 darstellt. Die runden Fassaden des hell gehaltenen, viele Assoziationen eröffnenden Bühnenbildes, wie beispielsweise die Bullaugen, sind ganz dem Schiffsbau dieser Ära nachempfunden. Im zweiten Aufzug stellt dieser reich mit Sofas, Sesseln und einem Konzertflügel ausgestatte Raum die Machtzentrale König Markes und im dritten Aufzug, in dem die Sitzmöbel im Hintergrund aufgestapelt sind, Tristans Burg Kareol dar. In diesem Ambiente setzt der Regisseur ganz auf eine psychologische Ausleuchtung des Innenlebens der beteiligten Personen. Der Ort des Geschehens wird so zur Nebensache, der Fokus liegt auf der Psyche der Handlungsträger. Ihr Seelenleben und die zwischenmenschlichen Beziehungen werden von Alden spannend und mit großer Akribie herausgearbeitet.
 Isolde kommt gleichsam aus einer anderen Welt. Gefühlsbetont bricht sie in die rationale, politische Tageswelt ein, die von ihr im Folgenden ganz schön durcheinander gebracht wird. Es gelingt ihr, Tristan auf ihre Seite zu ziehen, der bereits zu Beginn an seiner Wunde dahinsiechend im Bett liegt. Diese sieht man auch am Ende des zweiten Aufzuges noch an seiner Brust. Einer Verletzung durch Melot bedarf es da gar nicht mehr. Hier haben wir es gleichsam mit einer symbolischen Blessur zu tun. Sie ist sinnbildlich als Ausdruck der Tageswelt zu deuten, der sich Tristan nicht entziehen kann. So gerne er mit Isolde in der Nacht verschwinden will, er kann dem Tageskosmos nicht entrinnen. Dieses Unvermögen, sich der Welt Markes zu entziehen, macht seine seelische Verletzung aus, die im Fieberdelirium des dritten Aufzuges ihren Höhepunkt erreicht. Der König selbst erscheint in Aldens Deutung als kühler Machtpolitiker, der sich bei seiner Klage erst einmal eine Zigarette anzünden und dabei überlegen muss, was er von Tristans Verrat halten soll. Schließlich schüttelt er Isolde ein Glas Hochprozentigen auf ihr Kleid und zertritt obendrein eine Schellackplatte, die Tristan zu Beginn des Liebesduetts auf ein altes Grammophon gelegt hat. Auch die Weise des im dritten Aufzug auf einem Stuhl ruhig Zeitung lesenden Hirten ertönt von einer Platte.
Isolde kommt gleichsam aus einer anderen Welt. Gefühlsbetont bricht sie in die rationale, politische Tageswelt ein, die von ihr im Folgenden ganz schön durcheinander gebracht wird. Es gelingt ihr, Tristan auf ihre Seite zu ziehen, der bereits zu Beginn an seiner Wunde dahinsiechend im Bett liegt. Diese sieht man auch am Ende des zweiten Aufzuges noch an seiner Brust. Einer Verletzung durch Melot bedarf es da gar nicht mehr. Hier haben wir es gleichsam mit einer symbolischen Blessur zu tun. Sie ist sinnbildlich als Ausdruck der Tageswelt zu deuten, der sich Tristan nicht entziehen kann. So gerne er mit Isolde in der Nacht verschwinden will, er kann dem Tageskosmos nicht entrinnen. Dieses Unvermögen, sich der Welt Markes zu entziehen, macht seine seelische Verletzung aus, die im Fieberdelirium des dritten Aufzuges ihren Höhepunkt erreicht. Der König selbst erscheint in Aldens Deutung als kühler Machtpolitiker, der sich bei seiner Klage erst einmal eine Zigarette anzünden und dabei überlegen muss, was er von Tristans Verrat halten soll. Schließlich schüttelt er Isolde ein Glas Hochprozentigen auf ihr Kleid und zertritt obendrein eine Schellackplatte, die Tristan zu Beginn des Liebesduetts auf ein altes Grammophon gelegt hat. Auch die Weise des im dritten Aufzug auf einem Stuhl ruhig Zeitung lesenden Hirten ertönt von einer Platte.

Erin Caves (Tristan), Katharine Tier (Brangäne), Isolde
Insgesamt hinterließ die ungekürzt erklingende Liebesszene - auf den oft gepflegten, schmerzlichen Tag- und Nachtsprung hatte man in Karlsruhe dankenswerterweise verzichtet - einen starken Eindruck. Im Gegensatz zu anderen Regisseuren, die das Paar hier meistens auf Distanz zueinander halten, lässt Alden Tristan und Isolde wirklich zusammenkommen und sich oft berühren. Bilder von großer Poesie gelingen ihm, wenn das Liebespaar zu Brangänes Wachtgesang auf einmal langsam zu tanzen beginnt oder wenn beide am Boden liegen und Tristan Isolde dabei sanft über Arm und Wange streichelt. Die Liebe kommt hier endlich einmal wieder voll zur Geltung. Sie stellt einen explosiven Gegenpol zur kalten, von nüchterner Ratio geprägten Welt Markes dar, zu der das Paar nachhaltig auf Konfrontationskurs geht. In ihrer Phantasie setzen sie diese noch schnell in Brand, bevor sie schließlich entdeckt werden und Marke das Licht anknipst. Hier bekommt die Inszenierung ganz im Einklang mit Wagner etwas Revolutionäres. Hervorragend gelungen ist auch der dritte Aufzug, in der Alden Isolde in trefflicher Anwendung eines Tschechow’schen Elementes bereits während der Fieberanfälle Tristans auftreten lässt. Sie stellt gleichsam eine Vision des halluzinierenden Tristan dar. Dass er diese aber nicht greifen kann, verstärkt seinen Schmerz. Der Regisseur lässt ihn später sterben, als es in den meisten anderen Inszenierungen der Fall ist. Das Ende bleibt offen. Die Frage, ob sich Isolde mit der Pistole des überlebenden Melot, die ihr Brangäne reicht, erschießt, wird nicht beantwortet. Dadurch bekommt der Schluss eine immense Stärke. Insgesamt weist die gesamte Produktion große Spannkraft auf und zeichnet sich obendrein durch beeindruckende Lichteffekte - Beleuchtung: Stefan Woinke - aus.

Katharine Tier (Brangäne), Erin Caves (Tristan), Isolde
Zufrieden sein konnte man mit den gesanglichen Leistungen. Der Tristan war bei Erin Caves in guten Händen. Hier haben wir es mit einem beachtlichen Zwischenfach-Tenor zu tun, dessen Stärken sich insbesondere im zweiten Aufzug zeigten. Die lyrischen Stellen gelangen ihm hervorragend. Bezüglich Pianokultur, Legato und schöner Phrasierung blieben keine Wünsche offen. Aber auch die dramatischen Stellen meisterte er achtbar. Im ersten Aufzug ging er zwar bei den Spitzentönen auch mal vom Körper weg, im dritten Aufzug verfügte er aber noch über genügend Reserven, um die gewaltigen Fieberausbrüche elegant und schön auf Linie vorzutragen. Hier wurde nicht geschrieen oder gestemmt, sondern wirklich gesungen. Leider machte er bei der Stelle „Vergeh die Welt meiner jauchzenden Eil“ einen Bogen um das abschließende hohe ‚a’. Neben ihm bewährte sich als Isolde Rachel Nicholls. Diese Sängerin verfügt über enormes dramatisches und gut gestütztes Stimmpotential, was insbesondere die furiosen Racheausbrüche der irischen Königstochter im ersten Aufzug zum Ereignis werden lies. Darin erschöpften sich ihre Möglichkeiten indes nicht. Gleich Caves wartete auch sie beim Liebesduett mit schönen Lyrismen und einfühlsamer Linienführung auf. Insgesamt war ihre Leistung differenziert und nuancenreich. Bei der vom Regisseur als Gemisch von strenger Gouvernante und Mauerblümchen vorgeführten Brangäne von Katharine Tier klang ein hoher Ton auch mal etwas schrill. Insgesamt vermochte sie mit ihrem dunkel getönten, tiefgründigen Mezzosopran aber trefflich zu überzeugen. Ein stimmkräftiger, markanter Kurwenal mit vorbildlicher italienischer Technik und tadelloser Diktion war Seung-Gi Jung. Renatus Meszar hat sich Aldens Verständnis von König Marke gut zu eigen gemacht und spielte die Rolle nicht eben sehr sympathisch aus. Stimmlich gefiel er mit volltönendem, prägnantem und textverständlichem Bass. Kräftiges Tenor-Material brachte Ks. Klaus Schneider für den Melot mit. Mit bestens im Körper sitzendem, glanzvollem Tenor wertete Eleazar Rodriguez die kleinen Rollen des Hirten und des jungen Seemanns auf. Solide war Mehmet Altiparmaks Steuermann.

Erin Caves (Tristan) Seung-Gi Jung (Kurwenal), Isolde
Der eigentliche Star war an diesem Abend aber die Badische Staatskapelle unter der musikalischen Leitung von GMD Justin Brown. Was da aus dem Graben ertönte, bewegte sich auf ausgezeichnetem Niveau und vermochte sogar die Leistungen größerer Orchester nachhaltig in den Schatten zu stellen. Mit großer Verve führte Brown die perfekt und klangschön aufspielenden Musiker von einem Höhepunkt zum anderen. In nicht zu langsamen Tempi und mit spannungsgeladenem Impetus warteten Dirigent und Musiker mit einer selten gehörten dynamischen Vielseitigkeit und enormer Transparenz auf, wobei einzelnen Details dasselbe Gewicht zukam wie dem großen Gesamtzusammenhang. Der Nuancen- und Farbenreichtum von Browns herrlichem Dirigat war enorm. Präzision und Einfühlsamkeit des Klangs wurden hier ganz groß geschrieben. Bravo!
Ludwig Steinbach, 27.6.2016
Die Bilder stammen von Falk von Traubenberg
DER PROPHET
B-Premiere: 22.10.2015
(A-Premiere: 18.10.2015 / Kritik bitte runterscrollen)
Manipulation von Massen und mediale Vermarktung
Wir scheinen uns auf der Schwelle zu einer Meyerbeer-Renaissance zu befinden. Immer mehr Opernhäuser setzen seine Werke auf den Spielplan, und nicht nur große, sondern auch mittlere wie beispielsweise Würzburg und Braunschweig. Erst vor kurzem hatte die „Afrikanerin“ in Berlin Premiere. Jetzt ist am Badischen Staatstheater Karlsruhe der „Prophet“ herausgekommen.

Erik Fenton (Jean), Ensemble, Badischer Staatsopernchor, Extrachor
Zu der Aufführung kann man der Opernleitung nur gratulieren. Das war eine hoch spannende, erstklassige Angelegenheit, die dem Theater zur hohen Ehre gereicht. Schon das Werk an sich ist beachtlicher Natur. Hört man sich die Musik des „Propheten“ an, verwundert es doch sehr, dass dieses reizvolle Werk zusammen mit anderen Kompositionen des Komponisten so lange in der Versenkung verschwunden war. Gründe dafür könnten früher in einem auch die Kunst tangierenden Antisemitismus und der heftigen Kritik Richard Wagners an seinem verhassten Kontrahenten zu suchen gewesen sein. Heute haben derartige Argumente indes längst ihre Bedeutung verloren. Betrachtet man sich die Klangsprache Giacomo Meyerbeers einmal genauer, wird offensichtlich, warum er zu seiner Zeit einer der erfolgreichsten Tonsetzer war. Er hat eine eindringliche, recht imposante Musik mit großen Tableaus und gewaltigen Chorszenen geschrieben, wobei er mehr intimen Augenblicken dasselbe Recht zukommen ließ wie den sehr effektiv gestalteten großen Massenszenen, die eines der stärksten Wesensmerkmalen der Grande Opéra waren. Das liebten die Zuschauer damals und darauf verstand sich Meyerbeer hervorragend. Der Ruhm, den er damals genoss und der im Augenblick wieder aufdämmert, ist durchaus nachzuvollziehen.

Giovanna Lanza (Fidès), Agnieszka Tomaszewska (Berthe)
Dass es gerade dem „Propheten“ sehr zu wünschen ist, in Zukunft wieder häufig den Weg auf die Opernbühnen zu finden, liegt nicht zuletzt daran, dass er unglaublich zeitgemäß ist. In der Tat dürfte es nur wenige Werke des Musiktheaters geben, deren Handlung so stark modern anmutet wie es bei diesem Stück der Fall ist. Das Geschehen, das ursprünglich während des „Täuferreichs von Münster“ spielte, könnte sich genauso im Hier und Jetzt abspielen, ohne dass die Vorzeichen groß geändert werden müssten. Dieser Aktualität gilt auch das vornehmliche Interesse von Regisseur Tobias Kratzer, dem zusammen mit seinem Bühnen- und Kostümbildner Rainer Sellmaier ein wahrer Geniestreich gelungen ist. Weit entfernt von jeder vordergründigen platten Aktualisierung entwickelt er seine voll und ganz der Gegenwart verpflichtete Deutung gänzlich aus dem Stück heraus, ohne ihm Gewalt anzutun. Ihm kommt es nicht so sehr auf letztlich belanglose Äußerlichkeiten an, vielmehr legt er den Fokus auf eine prägnante Analyse des Subtextes und eine eindringliche Herausarbeitung des gesellschaftskritischen Potentials. Die Rechnung ist dann auch voll aufgegangen.

Andrew Finden (Graf Oberthal), James Edgar Knight (Jonas), Renatus Meszar (Mathisen) Luiz Molz (Zacharias), Giovanna Lanza (Fidès), Agnieszka Tomaszewska (Berthe)
Wenn sich der Vorhang hebt, erschließt sich dem Blick ein nach vorne offenes Gebäude in einem etwas heruntergekommen anmutenden Banlieu einer französischen Großstadt - vielleicht Paris, wo Meyerbeer einen seiner beiden Hauptwohnsitze hatte (der andere war Berlin). Oben rechts befindet sich die Kneipe des späteren Propheten Jean van Leyden, links davon das Schafgemach, das er sich mit seiner Mutter Fidès teilt, zu der er in einer ganz eigenen Beziehung steht. Er kann sich nicht entscheiden, ob er sie oder seine Braut Berthe mehr liebt und schwankt zwischen Mutter- und Geschlechtsliebe hin und her. Im unteren linken Bereich sieht man die Einfahrt einer Garage, rechts unten ein Getränkelager, in dem die Mitglieder der Stuttgarter Truppe TruCru /Incredible Syndicate mit sehr beachtlichen Sporteinlagen aufwarten. Sie sind es auch, die während der großen Ballettszene des zweiten Aktes mit Hilfe eines ungemein beeindruckenden rasanten Breakdance und fulminanter Akrobatik einen erheiternden Kontrapunkt in dem ansonsten recht dramatischen Geschehen setzen, wofür ihnen großes Lob gebührt. Das war eine äußerst gelungene, fetzige Angelegenheit. Wenn sich das Haus dreht, kommen ein Basketball-Platz und eine Treppe zum Vorschein, die den Volksmassen genügend Platz für ihre Versammlungen bieten. An der Seite ist ein leicht demolierter Polizeiwagen abgestellt, in dem Berthe zuerst von dem vom Grafen zum Polizeichef mutierten Oberthal und dann von einem seiner Polizisten vergewaltig wird. Das Auto geht im weiteren Verlauf des Abends in Flammen auf. Später wird noch ein Junge in einer Stretchlimousine missbraucht. Es ist ein von Gewalt, Drogen und Arbeitslosigkeit beherrschtes Ambiente, das das Regieteam hier mit enormem Nachdruck zeichnet und überzeugend einige essentielle Probleme unserer Zeit heraufbeschwört.

Hier KarlsruheProphet06f – Dass sich das Geschehen ursprünglich in der Zeit der Wiedertäufer abspielt, wurde oben schon gesagt. Da dieser Glaubensrichtung heute aber keine Bedeutung mehr zukommt, erscheinen die drei Wiedertäufer Zacharias, Jonas und Mathisen hier als eine gelungene Kombination aus Mormonen, Zeugen Jehovas und Scientology-Angehörigen. Welcher dieser Sekten sie angehörigen, ist aber letztlich gleichgültig. Der religiöse Fanatismus, um den es hier geht, lässt sich in jedem Glaubensgewand ausleben, auch im christlichen. Das lehrt nicht zuletzt die Geschichte. Demgemäß rückt Kratzer den Propheten Jean auch in die Nähe von Jesus Christus und setzt ihm gleich diesem eine Dornenkrone auf. Nachhaltig wird hier die Irrationalität jeder Religion aufgezeigt. In erster Linie interessieren den Regisseur dabei die Wirkungsmechanismen zeitgenössischer Propheterie. Diese erreichen ihre Adressaten über Internet, Facebook und Twitter. Immer auf der Höhe der Zeit bedienen sich Jean und die Widertäufer der Erzeugnisse modernster Massenkommunikation und posten, was das Zeug hält. Die Ansprachen des Propheten werden per Video auf riesige Leinwände projiziert. Ihr Inhalt ist durchaus nicht nur religiös. Die zunehmend mediale Vermarktung des Protagonisten beinhaltet zunehmend auch fragwürdige politische Aspekte.

Giovanna Lanza (Fidès), Erik Fenton (Jean), Renatus Meszar (Mathisen), Luiz Molz (Zacharias), James Edgar Knight (Jonas)
Der große Massendemagoge Jean wirkt in erster Linie über die Medien und ist darin einem modernen Politiker ausgesprochen ähnlich. Die dazu aufgebotenen Bilder sind manchmal recht simpler Natur. Die Grenze zur Satire wird dabei in bedenklicher Weise gestreift. Von Überzeichnungen und Ironisierungen wimmelt es in der Produktion nur so, was indes kein Fehler ist. Sie passen sich in das Gesamtgefüge der Grand Opéra ganz vorzüglich ein. Jean muss kein Bilderstürmer sein, um die intendierte Wirkung zu entfalten. Die Manipulation und Verführung von Massen, die Kratzer ins Zentrum seiner Betrachtungen stellt, funktioniert auch mit weniger ausgeprägten visuellen Impressionen. Hier wird ein in der Öffentlichkeit stehender Mensch künstlich größer gemacht als er ist. Und wenn im vierten Akt rein zufällig Fidès vor die Live-Kamera gerät und man in einer Großaufnahme ihr verzweifeltes Gesicht und ihr Minenspiel sieht, wird deutlich, dass auch die Privatsphäre, selbst wenn das gar nicht intendiert ist, leicht in das Licht der Öffentlichkeit geraten kann und die intimsten Gefühle publik werden. Gefährlichen Radikalisierungen sind Tür und Tor geöffnet. Da dauert es dann auch gar nicht lange, bis die Grenze zum Terrorismus überschritten ist. Der Anschlag auf Charlie hebdo wird problematisiert und am Ende sprengt sich der auf der ganzen Linie gescheiterte Jean mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft. Das war alles gedanklich sehr überzeugend und wurde mit einer stringenten Personenregie auch perfekt umgesetzt. Hier haben wir es mit hochkarätigem Musiktheater vom Feinsten zu tun. Ein herzliches Bravo an die Adresse der Regie!

Erik Fenton (Jean), Renatus Meszar (Mathisen), Luiz Molz (Zacharias), James Edgar Knight (Jonas), Mehmet Altiparmak (Ein Wiedertäufer), Giovanna Lanza (Fidès), Badischer Staatsopernchor, Extrachor
Von den Sängern wusste in erster Linie Gastsänger Erik Fenton auf sich aufmerksam zu machen, der einen hervorragenden Jean van Leyden sang. Hier haben wir es mit einem prachtvollen, kräftigen, sonoren und dunkel timbrierten Spinto-Tenor mit vorbildlicher Fokussierung zu tun, der die hohe Tessitura seiner Partie mit Bravour bewältigte und über einen großen Nuancenreichtum verfügt. Auch darstellerisch wurde er der Rolle vollauf gerecht. Als Fidès gab, ebenfalls als Gast, Giovanna Lanza am Badischen Staatstheater ihr Deutschlanddebüt. Dieser Sängerin merkte man die Rossini-Vergangenheit an. Ihr gut gestützter, voller Mezzosopran ist sehr üppiger Natur und wurde von ihr flexibel und koloraturgewandt eingesetzt, ohne dabei die stark ausgeprägte emotionale Seite zu vernachlässigen, die sich in wunderbaren lyrischen Phrasen offenbarte. Eine insgesamt ansprechende Berthe war Agnieszka Tomaszewska. Ihr Sopran klang über weite Strecken gut fundiert und ausdrucksstark und wurde größtenteils recht gefühlvoll geführt. Nur bei den Spitzentönen verhärtete sich die Stimme manchmal etwas. Ein in der Mittellage ordentlich singender, im oberen Stimmbereich aber sehr dünn klingender Zacharias war Luiz Molz. Recht flach klang der stark in die Maske singende Jonas von James Edgar Knight. Stimmlich versiert und kraftvoll zeigte sich Renatus Meszar in der Rolle des Mathisen. Lediglich durchschnittlich schnitt Andrew Finden mit nicht genügend tiefer Gesangsstütze als Graf Oberthal ab. Rollendeckend waren die zahlreichen kleinen Partien besetzt. Ein Extralob gebührt dem von Ulrich Wagner phantastisch einstudierten Badischen Staatsopernchor. Anette Schneider hatte die ebenso gut gelungene Vorbereitung des Kinderchores übernommen.

James Edgar Knight (Jonas), Luiz Molz (Zacharias), Erik Fenton (Jean), Renatus Meszar (Mathisen)
Eine treffliche Leistung erbrachte Johannes Willig am Pult, der zusammen mit der klangschön und intensiv aufspielenden Badischen Staatskapelle die Strukturen von Meyerbeers Musik einfühlsam herausarbeitete und sie in rhythmischer Ausgefeiltheit gekonnt vor den Ohren des Publikums ausbreitete. Zudem wartete er mit großer Expressivität auf und entlockte dem vielschichtigen Klangteppich viele spezifische Couleurs.
Fazit: Trotz einiger Defizite bei den Sängern kann der Besuch der Aufführung nur dringendst empfohlen werden. Herzlichen Dank an das Badische Staatstheater für diese preisverdächtige Ausgrabung!
Ludwig Steinbach, 24.10.2015
Die Bilder stammen von Matthias Baus
LE PROPHÈTE
Premiere 18.10.2015
Sie waren einst die reinsten „Strassenfeger“, die Grand Opéras von Giacomo Meyerbeer. Im 20. Jahrhundert fristeten sie aus verschiedenen Gründen ein Mauerblümchen-Dasein. Nun scheint sich eine Renaissance dieser Werke und dieses wichtigen Komponisten anzubahnen – und das ist gut so. Das Badische Staatstheater Karlsruhe jedenfalls hat mit der gestrigen,zu Recht heftig applaudierten und bejubelten Premiere jedenfalls einen enorm wichtigen Beitrag dazu geleistet.
Spektakulär ist nur schon die Bühne von Rainer Sellmaier. Er hat den Häuserblock eines Problembezirks der Banlieu einer französischen Grossstadt auf die Drehbühne gestellt, mit der schäbigen Bar der Fidès und des Jean, dem angrenzenden Schlafraum, dem Getränkelager und der anonymen Tiefgarage, dahinter das Feld für Streetball und die Treppe, auf der sich die Jugend zu ihren Saufgelagen und ähnlich sinnvollen Freizeitbeschäftigungen trifft. Autos, auch brennende, spielen eine wichtige Rolle. In dieser tristen Betonumgebung, geprägt von Arbeitslosigkeit, Drogen, Gewalt fällt die unheimliche Saat der religiösen Eiferer (bei Meyerbeer sind es Wiedertäufer) natürlich auf fruchtbaren Boden. Regisseur Tobias Kratzer gelingt es mit überaus realistischer Eindringlichkeit, manchmal auch sehr plakativ, die Geschichte von Jean und seiner vom mächtigen Polizeichef (Oberthal) und seinen Schergen missbrauchten Braut Berthe, von seiner Mutter Fidès und von den unsäglichen korrupten Machenschaften der drei Missionare Zacharias, Jonas und Mathisen zu erzählen. Das geht unter die Haut, rüttelt auf, öffnet die Augen. Kratzer ist ein sehr genauer Beobachter der Gegenwart, ein hervorragender Charakterisierungskünstler und scheut sich nicht, Klartext zu reden (zu zeigen): Vergewaltigung, Missbrauch von Knaben durch die Missionare, Manipulation der Massen mit Hilfe der elektronischen Medien (Manuel Braun war verantwortlich für die hervorragenden Videoprojektionen der Postings auf Facbook, Twitter, mittels Live-Kameras). Und wie löst man die Ballettszenen in diesem Ambiente? Denn Eisläufer usw. wie bei Meyerbeer kann man ja nicht zeigen. Eigentlich ganz naheliegend: Man engagiert eine B-BoyingGruppe – und was für eine! Was die sechs Tänzer (Levent Gürsoy, Mohamad Kamis, Faton Kurtishaj, Michael Massa, Trung Dun Nguyen, Hakan Özer) von TruCru/Incredibly Syndicate aufs Parkett, sorry auf die ausgebreiteten Pappkartons der Massenplünderungen, legten, war von umwerfender Perfektion: Freezes, Locking, Powermoves u.v.a.m in absoluter Perfektion. Klasse! Und dies nicht etwa zu Hip-Hop, sondern zu Meyerbeers originalen Märschen und Walzern, die von der Badischen Staatskappelle unter der umsichtigen und präzisen Leitung von Johannes Willig (wie so vieles anderes den ganzen viereinhalb stündigen Abend hindurch) mit Verve, Schmiss und feinfühliger Interpretation aus dem Orchestergraben erschallten. Es gäbe noch vieles zu berichten von dieser spannenden Inszenierung – doch alles soll nicht verraten werden. Ich empfehle: Hingehen und selber anschauen!
Ganz grossartig auch, wie sich der Badische Staatsopernchor, der Extrachor und der Cantus Juvenum (ganz hervorragend!) auf diese schwierige Aufgabe vorbereitet und eingelassen haben. (Einstudierung: Ulrich Wagner). Keinen Moment hatte man das Gefühl, klassische Chorsängerinnen und -sänger zu erleben, sie alle waren perfekt in ihren Rollen als Strassenkinder, umherstreunende Jugendliche und Alkis.
Diese Oper zu besetzen ist wahrlich kein einfaches Unterfangen, denn die Hauptrollen sind umfangreich und äusserst anspruchsvoll. Dass das Badische Staatstheater dazu nur für die Titelrolle einen Gast brauchte, spricht für das herausragende Ensemble. Allen voran soll Kammersängerin Ewa Wolak hervorgehoben werden: Ihre Fidès war schlicht atemberaubend. Die Stimme dieser Altistin hat ein Volumen (das sie aber ungemein differenziert einzusetzen weiss), ein Timbre und einen Registerumfang von stupender Qualität. Sie vermag damit sämtliche Gefühlsregungen und -verwirrungen auszudrücken: Mütterliche Besorgnis, Enttäuschung, Hass, Erniedrigung, Rache, Verzeihung. Dies alles gelingt ihr mit einer Gänsehaut erzeugenden Intensität. Toll auch die Idee des Inszenierungsteams, dass man Frau Wolak im wichtigen vierten Akt per Video der Fernsehteams anlässlich von Jeans Krönung in Grossaufnahme sieht und so zusätzlich zu ihren stimmlichen Künsten auch noch ihre eindringliche Mimik verfolgen kann. Einen weiteren Höhepunkt stellte ihre Air à deux mit der Berthe von Kammersängerin Ina Schlingensiepen dar, in der sich die beiden Stimmen so herrlich vereinen und wieder voneinander absetzen, dazu eine fantastisch sauber a cappella gesungene Passage als Dreingabe. Frau Schlingensiepen, die stets in (zusehends zerrissenen) schwarzen Netzstrümpfen und im tief ausgeschnittenen Top aufzutreten hatte, gezeichnet von zahlreichen blutigen Missbräuchen, war schon vorher mit ihrem zart intonierenden Sopran aufgefallen, der sich jedoch auch mit einer durchaus durchschlagskräftigen Höhe bemerkbar machen konnte. Die Titelrolle vertraute man dem jungen amerikanischen Tenor Marc Heller an. Er stand die schwierige Partie mit der hohen Tessitura (Domingo z.B. sang eine transponierte Version!) mit bemerkenswerter Kraft durch, überzeugte mit feiner französischer Phrasierung und hatte nur in der langen Szene im dritten Akt mit einem kleinen Einbruch zu kämpfen, meisterte aber auch diesen souverän und war nach der zweiten Pause wieder voll da für den vierten Akt (die Begegnung mit und Verleugnung der Mutter). Sehr gut gelang ihm dann der Schlussakt, wenn er sich als Selbstmordattentäter gebärdet und mit Sprengstoffgurt um die Hüfte bewaffnet die ganze Szenerie mitsamt allen Bösewichten (und seiner ihm zu Hilfe eilenden Mutter) in die Luft sprengt. Nur so am Rande: Hier hätte man vom Inszenierungsteam, das vorher nicht mit brennenden Autos, Stretchlimos, Citroën-Kastenwagen, zerbeulten Polizeiautos etc. gespart hatte, eigentlich mehr erwartet, als nur diesen kleinen Pfupf hinter der Szene ... .
Mit unheimlicher Bühnenpräsenz agierten die drei Wiedertäufer Zacharias (Avtandil Kapeli mit profundem Bass), Jonas (Matthias Wohlbrecht mit schneidendem Tenor) und Mathisen (Lucia Lucas mit sehr markantem Bariton). Der brutale Polizeichef Odenthal wurde von Armin Kolarczyk mit testosterongesteuerter Schmierigkeit gegeben.
Bei dieser Premiere war das Badische Staatstheater voll besetzt – bleibt zu hoffen, dass diese Produktion (die erste hier seit 1922, an dem Ort, an welchem ein Grossteil der Komposition entstanden war) ebenfalls zu einem „Strassenfeger“ wird!
Kaspar Sannemann 20.10.15
Bilder siehe Oben !
Weitre Aufführungen: 18.10. | 22.10. | 8.11. | 28.11. | 27.12. 2015 | 15.1. | 6.2. | 10.3. | 6.4. | 22.4.2016
PARSIFAL
Premiere: 29.3.2015
Von Prometheus zu Karl Marx
Zu Recht von dem begeisterten Auditorium am Ende heftig beklatscht wurde die Premiere von Wagners „Parsifal“ am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Rechtzeitig zum Karfreitag, zu dem es in wesentlichem Bezug steht, wurde das Bühnenweihfestspiel jetzt in einer vollauf gelungenen Neuproduktion in der Fächerstadt erneut zur Diskussion gestellt. Dass sich das Ergebnis sehen lassen konnte, ist in erster Linie Regiealtmeister Keith Warner zu verdanken, der das Werk vortrefflich durchdacht und mit Hilfe einer präzisen, punktgenauen Führung der Personen auch spannend und abwechslungsreich umgesetzt hatte. Warner hatte den „Parsifal“ schon einmal erfolgreich auf die Bühne gebracht, das war 2012 in Kopenhagen. Die Karlsruher Produktion stellt indes keine Wiederaufbereitung dieser seinerzeit bei Publikum und Presse auf große Zustimmung gestoßenen Inszenierung dar, sondern zeichnet sich durch eine gänzlich neue Konzeption aus. Warner hat sich die ihm in Karlsruhe gebotene Chance, die einzelnen Charaktere weiter zu entwickeln und ihnen ein noch schärferes Profil zu geben, voll genutzt und auf der ganzen Linie Hervorragendes geleistet. Das verschlungene Beziehungsgeflecht zwischen den einzelnen Figuren hat er trefflich aufbereitet und in einen überzeugenden geistlich-weltanschaulichen Kontext gestellt. Seine Regie weist viele neue Ideen auf. Dabei gelingen ihm aber auch Bilder von hoher suggestiver Kraft und Eindringlichkeit. Archetypus und Realismus reichen sich in Warners Inszenierung die Hand, der Spagat zwischen beiden wird von ihm vorzüglich und wohldosiert beleuchtet.

Erik Nelson Werner (Parsifal),Christina Niessen (Kundry), Alfred Reiter (Gurnemanz)
Tilo Steffens hat ihm einen karg und nüchtern anmutenden Raum in strengen Schwarz-Weiß-Tönen auf die Bühne gestellt. In dessen Hintergrund ragt eine riesige Kuppel auf, die Raum für mannigfaltige Assoziationen eröffnet. Angesichts der sie umgebenden Rundbogen-Fragmente kann man sie als Bunker innerhalb einer von Auseinandersetzungen geprägten Welt ansehen. Mit Hilfe der Drehbühne ziehen vielfältige, unterschiedlich gestaltete Räume in loser Folge an den Augen des Betrachters vorbei. Ihre Funktionen sind in gleichem Maße vielfältiger Natur wie die Regie, die sich vielschichtig und zeitübergreifend gibt. Letzteres offenbart sich nicht zuletzt an den von Julia Müller erstklassig gestalteten Kostümen, die zum großen Teil modern gehalten sind, aber durchaus auch mal der Entstehungszeit des Werkes huldigen. Im dritten Aufzug weichen die sich drehenden Räume einer Bushaltestelle mit Bank und Straßenlaterne, bei der sich der heimkehrende Reisende Gurnemanz und Kundry treffen. In diesem Ambiente erweist Warner so mancher Größe des Theaters seine aufrichtige Reverenz. So beispielsweise Bertolt Brecht, wenn er die große Szene zwischen Parsifal und Kundry in einem Theater auf dem Theater spielen lässt. Und bei der durchaus nicht als „Urteufelin“ und „Höllenrose“ gedachten, sondern als moderne Frau aus Fleisch und Blut präsentierten Verführerin wird die Nähe zu Ibsen spürbar. Die Art und Weise, wie der Regisseur die bereits zu Beginn von den Knappen stark bedrängte und misshandelte Kundry hier auf Distanz zur ihrer eigenen Sexualität gehen lässt, zu der sie augenscheinlich ein zwiespältiges Verhältnis hat, ist recht eindrucksvoll. Hier haben wir es mit einer Frau zu tun, die gelernt hat, sich und ihr Verhalten selbst zu hinterfragen; und das gilt mehr oder weniger für alle Handlungsträger.

Erik Nelson Werner (Parsifal), Christina Niessen (Kundry)
Bei Warner gerät Wagners Weltabschiedswerk zu einer geistvoll-innovativen Parabel über eine Gemeinschaft, die durchaus religiöser Natur sein kann, es aber nicht sein muss. Sie vermag auch anderen Wertvorstellungen Rechnung zu tragen. In seiner Betrachtung des Grals-Kollektives zeigt sich der Regisseur sehr tolerant. Den verschiedenen Glaubensrichtungen von Christentum und dem von Wagner hoch verehrten Buddhismus stellt er gleichberechtigt philosophische, mythologische und gesellschaftskritische Aspekte an die Seite und schafft damit in der Gralsgemeinschaft ein eindringliches Abbild unserer zeitgenössischen, unterschiedlich zusammengesetzten Gesellschaft. Nacheinander erschließen sich dem Zuschauer Bilder von Isaaks Opferung, dem unter den Augen Kundrys sein Kreuz vorbeitragenden Jesus und einem indischen Buddha. Zentrale Relevanz kommt in diesem Reigen visueller Impressionen aber der Gestalt des an den Felsen gefesselten Prometheus zu. Mit ihm schafft Warner gekonnt einen Weg zu den nicht christlichen Wertordnungen von der altgriechischen Mythologie, der nicht religiösen Philosophie und des Atheismus, wobei er Karl Marx besondere Bedeutung beimisst.

Renatus Meszar (Amfortas), Badischer Staatsopernchor, Statisterie
Der Prometheus-Mythos ist ein Hauptbestandteil der Kritik am Christentum, wie sie vor allem von Marx und anderen namhaften Philosophen geübt wird. John Dew hat vor einigen Jahren in seiner Darmstädter Inszenierung des „Parsifal“ einen ähnlichen Ansatzpunkt gewählt, machte das Ganze aber an Nietzsche fest. Bei Warner ist es, wie gesagt, Marx, der das menschliche Selbstbewusstsein als die oberste Gottheit ansieht. Und dieses kann nur durch ständiges Lernen erworben werden. Dem entspricht es, dass der Lernprozess in dieser Inszenierung eine zentrale Rolle spielt, wobei eine simple Schwarz-Weiß-Malerei nicht stattfindet. Der augenscheinlich den Harry-Potter-Filmen entsprungene Klingsor ist in gleicher Weise ein ernst zu nehmender Lehrer wie Gurnemanz. Beide erwachen jeweils zu Aktbeginn auf derselben Matratze und unterrichten in ein und demselben Klassenzimmer. Diese Gleichstellung wäre vielleicht noch stärker ausgefallen, wenn Warner beide Rollen von demselben Sänger hätte singen lassen. Auf Gut oder Böse kommt es dabei nicht an. Der Grundsatz „Wissen ist Macht“ gilt für jeden und überall. Jeder gibt Wissen nach seiner eigenen Facon weiter. In diesen Prozess eingebunden reift im zweiten Aufzug das hier von Klingsor unterwiesene Kind Parsifal schließlich zum erwachsenen Mann, den seine Mitschülerinnen, ursprünglich die Blumenmädchen, in heißes Erstaunen versetzen. Zunehmend lernt er, „dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei“, womit wir bei Marx’ „Kritik der Hegel’schen Rechtsphilosophie“ angelangt wären, aus der sich der kategorische Imperativ ergibt, dass alle Verhältnisse umzuwerfen seien, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes oder verächtliches Wesen ist. Dieses von Marx herrührende Postulat kommt auch Klingsor zugute. Dieser verkörpert bei Warner nicht das Böse an sich, sondern nur einen Teilaspekt in dem einen Spiegel unserer Gesellschaft darstellenden Gralskollektiv mit all seinen religiösen, bürgerlichen und politischen, in Parteien und Vereinen verbundenen Gruppierungen mit manchmal sehr entgegengesetzten Anschauungen. Konsequenterweise tragen die Gralsritter, die sich im dritten Aufzug auch mal in gewalttätigen Exzessen ergehen, bürgerliche Anzüge. Entsprechend Marx’ eben genannter Kritik an Hegel wird am Ende der alte, vom Glauben geprägte Zustand nicht wieder hergestellt. Der Gral ist und bleibt verschwunden, da können die Knappen noch so viele Kisten auspacken. Es findet eine Grunderneuerung der Verhältnisse statt, in die nun auch die leichte Frühlingskleider tragenden Frauen eingebunden werden. Eine neue Gesellschaft ist entstanden, die mit Religion nicht mehr viel am Hut hat. Der während des gesamten dritten Aufzuges als Rumpelkammer für nicht mehr benötigte spirituelle Gegenstände dienende Innenraum der Kuppel ist am Ende ganz leer. Der Atheismus hat gesiegt. Als Gralskönig wird Parsifal keine Funktion mehr haben, vielleicht aber als Lehrer für ein einzelnes Kind, dessen Interesse an den alten religiösen Werten nicht gebrochen ist. Das hat Warner alles hervorragend durchdacht und so packend und stringent auf die Bühne gebracht, dass man nur staunen konnte. Bravo!

Erik Nelson Werner (Parsifal). Blumenmädchenensemble und -chor
Zufrieden sein konnte man auch mit den gesanglichen Leistungen. Für die Titelpartie stand mit Erik Nelson Werner ein Sänger zur Verfügung, der mit seinem vom Bariton kommenden, dunkel timbrierten, sonoren und obertonreichen Tenor die gesamte vokale Skala des reinen Toren perfekt auszuloten verstand. Mit impulsiver, markanter und sehr gefühlvoller Tongebung verströmter er großen stimmlichen Glanz und ging auch schauspielerisch voll in seiner Rolle auf. In puncto Ausdrucksstärke und Intensität ihres Vortrags stand ihm die über einen beeindruckenden dramatischen Sopran verfügende Christina Niessen als Kundry in nichts nach. Auch sie stürzte sich in jeder Beziehung mit großer Intensität in ihre dankbare Rolle, die sie mit gutem stimmlichem Fokus, markant intonierend und mit sicheren hohen h’s meisterte. Die großen Leiden und die ausgeprägte Agonie des Amfortas hat Renatus Meszar mit insgesamt trefflich sitzendem Heldenbariton und einer ausgedehnten Ausdrucksskala eindringlich vermittelt. Dass er aber ursprünglich ein Bass ist, belegt neben seinem Bruchton d das im dritten Aufzug nicht erreichte hohe g. Die Höhe war es auch, die dem Gurnemanz von Alfred Reiter manchmal zu schaffen machte. Das hohe es bei „O wunden-wundervoller heiliger Speer“ misslang ihm gänzlich und klang reichlich gequält. Besonders im oberen Stimmbereich klang sein nicht sehr tiefgründiger Bass oft recht kopfig. Wie anders dagegen Jaco Venter, der mit stimmlichem Totaleinsatz, vorbildlich tiefer Fokussierung seines kraftvoll und markant geführten Baritons und vorbildlicher Diktion einen exzellenten Klingsor sang. Von Avtandil Kaspelis großen Bass-Wohlklang verströmendem, im ersten Aufzug in einem Glassarg liegendem Titurel hätte man gerne mehr gehört. Von den Gralsrittern hatte der Tenor Steven Ebel gegenüber seinem Bass-Kollegen Luiz Molz die Nase vorn. Die Blumenmädchen waren mit Ks Ina Schlingensiepen, Lydia Leitner, Sofia Mara, Agnieszka Tomaszewska, Ks Tiny Peters und Katharine Trier insgesamt ansprechend besetzt, nur der allzu dünne Sopran von Frau Peters störte den ansonsten trefflichen Klangeindruck etwas. Die Damen Leitner und Mara werteten mit ihren vollen, runden Stimmen zudem die kleinen Partien des ersten und des zweiten Knappen gehörig auf. Flach gab Max Friedrich Schäffer den dritten Knappen. Noch dünner intonierte der stimmlich ebenfalls noch sehr unfertige Nando Zickgraf die kurzen Einwürfe des vierten Knappen. Keine gute Idee war es, die für einen Alt geschriebene Stimme aus der Höhe von dem Knabensopran Moritz Prinz singen zu lassen. Bei dem von Ulrich Wagner einstudierten Badischen Staatsopernchor machten in erster Linie die Damen und die Bassisten nachhaltig auf sich aufmerksam. Bei den Tenören dominierten an diesem Abend leider etwas die nicht im Körper sitzenden Stimmen.

Erik Nelson Werner (Parsifal), Christina Niessen (Kundry), Alfred Reiter (Gurnemanz)
GMD Justin Brown am Pult fasste den ersten und den dritten Aufzug sehr weihevoll auf und präsentierte sie in sehr gemäßigten, getragenen Tempi. Der zweite Aufzug dagegen nahm unter seiner versierten Leitung die Ausmaße einer großen Oper an. Da ließ er die Zügel locker und animierte das prachtvoll aufspielende Badische Staatskapelle zu einer von großer Dramatik und Fulminanz geprägten Tongebung. Durch die Bank vorzüglich waren die fein gesponnenen, langen und große Spannung atmenden Bögen sowie die an den Tag gelegte große Transparenz. Da war fast jede Kleinigkeit deutlich zu vernehmen. Auch Brown hatte sich den starken Schlussapplaus, der ihm am Ende seitens des begeisterten Publikums entgegenschlug, redlich verdient.
Ludwig Steinbach, 1.4.2015 Die Bilder stammen von Jochen Klenk
Offenbachs Tragik
FANTASIO
Opéra comique in drei Akten von Jacques Offenbach – Uraufführung der wiederhergestellten Urfassung in deutscher Sprache
Zwischen den Zeiten und Welten in der Diaspora der Operngattungen
Das so stark im Bestehen sich wähnte, das zweite französische Kaiserreich, seinem Ende eilte es zu. Und je weiter es auf diesem Weg fortschritt desto weniger wurde Jacques Offenbach als Parodist von Reich und Gesellschaft gebraucht und wandte sich seinem wohl lange gehegten Traum zu, Opern zu komponieren. Sein Genre lag im Dreieck der Bouffe, der komischen und der romantischen Oper. In einem Winkel seines Herzens war er Deutscher geblieben. Als in Paris Barrikaden errichtet wurden, setzte er sich nach Osten über die Grenze ab; kulturell blieb er dem deutschsprachigen Kulturraum verbunden und wirkte häufig in Wien. Im Sommer hielt er am liebsten in Bad Ems Hof, wo es auch immer eine zahlkräftige französische Gesellschaft gab, da in Frankreich der letzte König 1837 den Betrieb von Spielcasinos untersagt hatte. Der dramatische Wechsel in den französisch-deutschen Beziehungen nahm ironischerweise 1870 gerade dort in seine dramatische Wendung zum Krieg.
 Prinzessin Theres (Jennifer Riedel) und Fantasio (Stefanie Schaefer) verlieben sich ineinander bei romantischem Gesang
Prinzessin Theres (Jennifer Riedel) und Fantasio (Stefanie Schaefer) verlieben sich ineinander bei romantischem Gesang
Die komische Oper Fantasio schrieb Offenbach 1870 als Auftragswerk für die opéra comique; ihre für 1870 geplante Uraufführung fiel dem Krieg zum Opfer. Das mit pazifistischen Themen durchzogene Werk wurde nach gründlicher Bearbeitung 1872 uraufgeführt. Der Erfolg war weniger als mäßig, da die Franzosen in ihrer Revanchelust Pazifismus nicht goutierten. Offenbach selbst war zur tragischen Figur geworden. Im noch weniger liberalen Deutschland war die Wertschätzung für den Juden und „Vaterlandsverräter“ ohnehin gering. Aber nach 1871 mochten ihn auch die Franzosen nicht mehr, obwohl er 1860 eingebürgert worden war. Sie behandelten ihn als Boche und preußischen Agenten. Georges Bizet, den er zeitlebens gefördert hatte, beschimpfte ihn gar als Schwein und seine Werke als Müll. An seinen Operetten war man nicht mehr interessiert. Der Schwerpunkt der Operettenkultur verlagerte sich nach Wien, Offenbach wandte sich seinem opus magnum zu: Les Contes d‘Hoffmann.
Fantasio wurde noch 1872 schon einen Monat nach der Pariser Uraufführung in einer stark veränderten dritten Fassung in Wien herausgebracht. Aber auch diese verschwand bald in der Versenkung. Die französische Uraufführungspartitur ist wahrscheinlich beim Brand der Opéra Comique 1887 vernichtet wurde, was einer weiteren Verbreitung des Werks auch nicht zuträglich war. Offenbachs Nachkommen haben dessen Autografen in alle Welt verstreut. Dem Offenbach-Liebhaber und Musikologen Jean-Christophe Keck gelang es, die einzelnen Teile der Urfassung wieder einzusammeln und in seiner kritischen Offenbach-Ausgabe neu zu edieren. Dieser neue alte Fantasio wurde im Dezember 2013 unter Mark Elder in London konzertant gegeben und kam nun in deutscher Sprache am Badischen Staatstheater als szenische Uraufführung heraus.

Studentenprotest in Bayern
Als Textvorlage für die Oper diente das gleichnamige Theaterstück von Alfred de Musset (1834). Bis zu vier Librettisten befassten sich mit dem Opern-Büchlein zu Fantasio: Alfred de Mussets Bruder Paul, Camille du Locle, Charles Nuitter und vermutlich auch Alexandre Dumas d. J. Wieder einmal hatte Offenbach einen deutschen Stoff gewählt, in welchem man schon rein literarisch die drei implizierten Gattungen des Musiktheaters erkennt: die Bouffe, die komische und die romantische Oper. Handlung: Der bayerische König hat zur Rettung seines Reichs von Krieg und Elend seine Tochter Theres dem reichen Prinzen von Mantua versprochen. Der tauscht die Kleidung mit seinem Adjutanten Marinoni, um seine Zukünftige incognito begutachten zu können. Fantasio, ein Studentenführer, der sich in die Prinzessin verliebt hat, schlüpft in die Verkleidung eines Hofnarren und macht bei einem Fest den Prinzen von Mantua bei Hofe lächerlich, woraufhin der Rache fordert, mit Krieg droht und Fantasio festsetzen lässt. Die Prinzessin widersetzt sich der Zwangsheirat und erwidert die Liebe von Fantasio. Am Schluss wird der pazifistische Narrenstaat ausgerufen, nachdem Fantasio die Exponenten der Staaten aufgefordert hat, sich gefälligst selbst zu duellieren, statt ihre Völker in den Krieg zu schicken.

Jennifer Riedel (Prinzessin Theres), Kristina Stanek (Flamel, "Hofdame"); Damen des Staatsopernchors
Offenbach behandelt seine alten Lieblingsthemen: Anmaßung, Kleinstaaterei, Dünkelhaftigkeit, Spießertum. Das Werk, halb komische Oper und halb Offenbachiade, verfügt und über deutliche Einstreuungen deutscher Spieloper und romantischer Oper mit Weltschmerz und Todessehnsucht. Offenbach hat Wagners Lied an den Abendstern als eine von der romantischen Melodien eingearbeitet. Über den Prinzen von Mantua und den Narren Fantasio führt eine Linie auch zu Rigoletto. Die politische brisanten Themen sind abgeschwächt: Studentenprotest mit Demos, arrangierte Hochzeit aus Staatsraison, Krieg aus verletzter Ehre. Den Schluss dieses Wirrwarrs bildet die Friedenbotschaft Fantasios. Ist dessen Name Omen für den Realismus einer solchen Botschaft?
Regisseur Bernd Mottl setzt die Schwerpunkte der Oper in Komödiantik und Satire. Erstere bleibt ziemlich klaumaukig, die letztere gerät zu flach.Friedrich Eggert schafft sehr konkrete Bühnenbilder. Der erste Akt soll in München spielen. Man sieht aber ein Dorf aus lauter Fachwerkhäuschen in schwarz-weißer altsächsischer Ständerbauweise, wie man es in idealer Weise in Freudenberg im Siegerland bewundern kann. ( www.sauerland. ) Im Hintergrund erheben sich die bayerischen Alpen; die Bühnenbegrenzungen und die Soffitten sind blauweiß rautiert. Das könnte tatsächlich mit Schlossturm und behütender Kirche der Landsitz eines Duodez-Fürsten sein. Im zweiten Akt ist die Bühne leergeräumt und nur mit einigen komfortablen Stühlen möbliert; in der Mitte hängen lange Streifen, aus deren Bedruckung sich eine etwas verzerrter herrschaftlicher Saal zusammensetzt. Zunehmend geraten auch Umzugkartons mit aufgedruckten QR-Codes auf die Bühne; einer davon ist so groß, dass er Fantasio zum Gefängnis dienen kann. Schließlich wird das hübsche Dorf in solche Kartons verpackt; das Elend will, dass man verkaufen muss. In dieser Umgebung ruft Fantasio zum entscheidenden Frieden auf.

Ks. Klaus Schneider (Marinoni), Gabriel Urrutia Benet (Prinz von Mantua) (Foto: Falk von Traubenberg)
Das Lokalkolorit wird durch die Trachten des Chors vermittelt, wobei die im Verlauf mehr und mehr stilisiert werden. Alfred Mayerhofer schafft die bayerischen Kostüme für die autochthonen Bayern und Zirkusbekleidung für das italienische Paar Prinz/Adjutant, das mit seinen Auftritten wie Plisch und Plum im Zentrum der Komödie steht. Eine zehnköpfige Trachtengruppe ist in der Verkleidung Komödienstadl-authentisch. Deren Schreit- und Hopstänze bleiben ebenso im Bereich des Biederen wie die gesamte (Operetten-)-Choreographie von Otto Pichler. Am besten gelungen ist die komödiantische Maskerade des mantuanischen Prinzen und eines Adjutanten, die auftreten wie Plisch und Plum, wobei sich der als niederrangig verkleidete Prinz nicht damit abfinden will, dass nun er auch den Niederrangigen spielen muss. So ist die Inszenierung insgesamt zwar vergnüglich und unterhaltsam, aber sie bleibt bekenntnislos an der Oberfläche. Studentenprotest wird zur Bierseligkeit (Besäufnisse sind ein Topos in französischen Opern über Deutschland – wohl nach Mme de Stael); die Offenbachsche Satire der politischen Konstellation bleibt flach; der romantische Handlungsstrang versinkt in biedermeierlicher Schlafmützigkeit. Dazu kommt ein völlig überflüssiger Schuss „Neudeutung“: der Ausverkauf von traditionellen Werten zugunsten von moderner Masenware. Diese „Modernisierung“ geht meilenweit am Stoff vorbei und kann schon gar nicht den vor allem im ersten Akt spürbaren Mangel an Schwung kompensieren. Mottl hat diesen Ausverkauf mit dem industriellen Tand der 50er Jahre visualisiert, dem die Dorfbewohner wie Fetischen huldigen, während sie auf zwischen ihren verkauften und versandbereiten Häusern sitzen.

Stefanie Schaefer (Fantasio), Jennifer Riedel (Prinzessin Theres)
Das musikalische Profil der Produktion liegt weitaus höher. Auch in der Partitur ist die Stilvielfalt des Stoffs angelegt; die verschiedenen Genres sind musikalisch verarbeitet, wobei Offenbach vor allem an seine Bouffes erinnert (Couplets und sich aufschaukelnde Orchesterbegleitungen) und den Defiliermarsch parodiert. Man wundert sich, wie nahe Offenbach bei Weber liegen kann. Instrumentierungen mit Hörnern und Holzbläsern könnten dem Freischütz entnommen sein. Liedhafte Motive durchziehen die Partitur und halten sie zusammen. Auch Rigoletto wird zitiert. Offenbachs Partitur ermöglicht in der großen Orchesterbesetzung reiche Farbgebungen, die schon auf sein letztes Bühndnwerk hinweisen. Das Dirigat von Andreas Schüller am Pult der Badischen Staatskapelle stellt das ebenso schön heraus, wie die typischen Offenbach-Harmonien und -Rhythmen. Das blieb trotz der Grenzübergänge der Kern des Dirigats: die unverwechselbare Offenbach-„Tinta“ mit viel Verve gelang ihm prächtig, nicht so sehr hingegen das präzise Zusammenspiel mit dem Chor, der hier und da von dem abwich, was der Taktstock vorschreiben sollte. Die große, stimmkräftige Truppe hat Ulrich Wagner einstudiert.

Gefängnis mit Zivilisationsmüll: Jennifer Riedel (Prinzessin Theres), Stefanie Schaefer (Fantasio)
Sängerisch brannte gar nichts an. Jennifer Riedel als Prinzessin Theres glänzte darstellerisch als aufmüpfiges, zur Selbstbestimmung tendierendes Mädchen und erfreute als lyrischer Koloratursopran mit hellem, silbrigem und sehr beweglichem Material, mit Sicherheit und Brillanz in einer Rolle, die schon auf die Olympia hinweist. Als Fantasio erfreute Stefanie Schäfer ihr Publikum mit behändem, ja akrobatischem Spiel, samtig ansprechendem klarem und dennoch glutvollem Mezzosopran und schön ausgesungenen Linien. Warum sie sich am Ende ihrer Hosenrolle ihrer Brustquetsche entledigen und ihre Rolle in schwarzem BH zu Ende spielen muss, konterkarierte frontal das Prinzip der verosimiglianza im Theater. Mit deutlich dunklerem, kräftigem Mezzo sang Kristina Stanek die Rolle der Hofdame Flamel, hier praxisnäher als Kammerzofe dargestellt, die der widerborstigen Prinzessin das unerwünschte Hochzeitskleid überzieht. Viel Spaß bereiteten die (abgesehen von ihrer identischen Größe) wie Pat und Patochon auftretenden, ewig streitenden Prinz von Mantua und sein Adjutant Marinoni. Letzteren gab Matthias Wohlbrecht mit schönem Schmelz und nicht zu hellem Charaktertenor; ersteren Gabriel Urrutia Benet mit fast zu noblem hellem Bariton-Material. Eine größere Rolle sang noch Dennis Sörös als Studentenführer Spark im (Che-Guevara-T-Shirt) mit sonor kultiviertem Bariton; seine „internationalen“ Studenten-Kollegen Facio, Max und Hartmann in kleinen Gesangsrollen empfahlen sich in ihren revoluzzerischen Aktivitäten durch quicklebendiges Spiel (Max Friedrich Schäfer, Nando Zickgraf, Daniel Pastewski). Nicht gut kam Luiz Molz mitseiner Bassrolle als König von Bayern (herausgeputzt in Anlehnung an den „Kinni“ Ludwig II) mit schwanken halsiger Stimme zu recht. Der Multi-Tasker Peter Pichler gab die Sprechrolle des Haushofmeisters am Bayerischen Hof.
Fazit: Bernd Mottl hat die Oper leider konzeptionell unter Wert „verkauft“. Dem Badischen Staatstheater ist aber hoch anzurechnen, dass es dies interessante Werk abseits des Einheitsbreis vorstellt. Sicher wird es nachgespielt, allein weil es originell ist und weil Offenbach immer zieht. Stil-Puristen werden den Genre-Mix, den musikalischen Eklektizismus und Offenbachs Zugeständnisse an die damaligen Usancen (Auftragswerk!) bemängeln; Freunde anspruchsvoller musikalischer Unterhaltung kommen indes auch bei dieser Inszenierung auf ihre Kosten. Ein Kompliment auch an den Dramaturgen Boris Kehrmann nicht nur für seinen informativen Einführungsvortrag, sondern vor allem für die Gestaltung des Programmhefts und seine konzisen, erhellenden Beiträge, die man unbedingt lesen sollte. Es enthält keine „Note“ zu viel und ist auch im Internet zugänglich: programmheft/fantasio.pdf. Das Publikum im nur mäßig gut besuchten Haus quittierte die Aufführung mit herzlichem Beifall.
Manfred Langer, 20.12.2014
Fotos: Jochen Klenk, wenn nicht anders angegeben
 Von der im Beitrag erwähnten konzertanten Aufführung des Fantasio ist bei opera rara ein Mitschnitt erschienen.
Von der im Beitrag erwähnten konzertanten Aufführung des Fantasio ist bei opera rara ein Mitschnitt erschienen.
Orchestra of the Age of Enlightenment; Sir Mark Elder
www.opera-rara.com/
Nicht Fisch nicht Fleisch
Hans Krása (1899-1944)
VERLOBUNG IM TRAUM
Aufführung am 25.10.2014 (Premiere am 18.10.14)
Fröhlich plätscherndes Gesellschaftsbild nach Dostijewski - gut dargeboten
Hans Krása hatte einen tschechischen Vater und eine deutsch-jüdische Mutter und wuchs in der einzigartigen Mischkultur Prags auf, die seit dem Zweiten Weltkrieg wegen der Ermordung der einen und Vertreibung einer anderen Gruppe nicht mehr existiert. Krása war in der Musik-, Theater- und Literaturwelt Prags bestens vernetzt, eine Zeitlang Direktor des Neuen Deutschen Theaters, Schüler von Alexander von Zemlinsky, kannte Max Brodt und war Bewunderer von Rainer Maria Rilke. Er ließ sich in Paris von Albert Roussel und der groupe des six beeinflussen. 1942 kam er ins Konzentrationslager Theresienstadt und wurde von dort nach Ausschwitz deportiert. Aus seinem musikalischen Schaffen ist die (schon in Theresienstadt vielfach aufgeführte) Kinderoper „Brundibár“ das bekannteste Werk, das nach seiner Wiederentdeckung 1985 wieder häufig aufgeführt wurde und in dieser Saison im Opernprogramm von Karlsruhes Partnerstadt Halle an der Saale erscheint (ab 05.11.14). --- Zum 70. Tag der Ermordung des Komponisten Hans Krása in Auschwitz 1944 stellte das Badische Staatstheater dessen einzige abendfüllende Oper „Verlobung im Traum“ zur Diskussion. Wenn man sich die Vita von Hans Krása anschaut und sonst von dem Komponisten nichts weiß, denkt man bei einer Ausgrabung einer Oper dieses Komponisten sicher zuerst an einen düsteren, psychologischen Stoff (wie z.B. Schulhoffs „Flammen“ oder die jüngst in Karlsruhe gebrachte deutsche EA von Weinbergs „Passagierin“): weit gefehlt. Auch in den Topf mit den nach der Nazi-Diktatur jahrzehntelang auch nicht aufgeführten Opernkomponisten wie Schreker, Korngold, Braunfels, v. Zemlinsky oder Goldschmidt mit deren postromantischen Duktus passt Krása nicht. Krása könnte Krása sein.

Dana Beth Miller (Marja Alexandrowna), Jaco Venter (Fürst), Katharine Tier (Nastassja), stehend mit Zigarette: Agnieszka Tomaszewska (Sina)
1928 bis 1930 arbeitete er an seiner Oper „Verlobung im Traum“, für welche die Journalisten Rudolf Fuchs und Rudolf Thomas, Redakteure des Tagblatts, das Libretto nach Dostojewskis Novelle „Onkelchens Traum“ (1859) erstellten. Das ist ein nicht ganz unpolitisches Gesellschaftsbild, dessen Handlung mit nur wenigen Änderungen in die Oper einfloss. Marja Alexandrowna möchte ihre hübsche Tochter Sina gern an einen vermögenden Mann verheiraten. Gerade gelegen kommt es, dass ein Fürst in der Nähe des gesichtslosen Provinzstädtchens Mordassow mit seiner Kutsche havariert und zum Bleiben gezwungen ist. Obwohl Sina den schwerkranken brotlosen und revolutionär angehauchten Dichter Fedja liebt (tritt in der Oper nicht auf), lässt sie sich von ihrer Mutter dazu bringen, den alten und senilen Fürsten mit einer Opernarie zu bezirzen, so dass der der einen Heiratsantrag macht. Das missfällt Paul, einem Neffen des Fürsten, der sich selbst Hoffnung auf Sina macht und Nastassja, einer intriganten Verwandten der Familie. Beide hintertreiben die Verlobung. Paul überzeugt seinen Onkel, dass er die voreilige Verlobung bloß geträumt habe und in aller Ruhe abreisen könne. Sina besinnt sich wieder auf Fedja; aber leider wird dessen Ableben vermeldet. Marja verheiratet ihre Tochter schließlich mit einem gut gestellten, hohen Beamten im fernen Osten, wo sie eine angesehene Frau wird, aber ein kaltes Leben ohne Liebe führt.
Krása hatte es nicht leicht, ein Theater für die UA seiner Oper zu gewinnen. Deutschland wäre mit seiner damaligen progressiven Atmosphäre ein geeignetes Aufführungsland gewesen, aber da damals schon SA-Horden in den deutschen Theatern gegen missliebige Stücke und jüdische Autoren randalierten, zögerten die Intendanten selbst der Kroll-Oper unter Erich Kleiber. Schließlich kam es am Neuen Deutschen Theater zum Prager Frühling 1933 zur Uraufführung des Werks in Prag. Trotz der positiven Kritiken wurde das Werk bis zum Krieg nirgends mehr nachgespielt und gelangte erst 1994 in einer Koproduktion zwischen der Prager Staatsoper und dem Nationaltheater Mannheim wieder zur Aufführung, ehe es nun in Karlsruhe einen weiteren Wiederbelebungsversuch gab.

Agnieszka Tomaszewska (Sina), Dana Beth Miller (Marja Alexandrowna)
Der Regisseur Ingo Kerkhof geht mit seiner szenischen Umsetzung in die Entstehungszeit der Oper zurück und inszeniert passgenau zur Musik. Krása hat eine große Zahl von Einflüssen aus der Kompositionszeit verarbeitet, unter anderem auch Jazziges und Revuehaftes, auch typisch für die 20er Jahre. So wurde aus Dostojewskis dramatisch wenig zwingendem Gesellschaftsgemälde mit seinen politischen und moralischen Vertiefungen eine unterhaltsame Revue, bei der sich jeder Zuschauer selbst einen möglichen Tiefgang erschließen kann. Denn in dieser Hinsicht werden durchaus etliche Aspekte angerissen von „Der alte Mann und das junge Mädchen“ bis zur arrangierten Ehe, gesellschaftlicher Missgunst, Verrat aus materiellen Gründen und eben Leben ohne Liebe, aber dafür im Wohlstand. Nichts davon wird in der Inszenierung vertieft, wie auch keine vertiefende psychologische Feinzeichnung der Personen erkennbar ist. Das Stück lebt nicht aus der Binnenspannung, sondern eher vom Bühnenspaß und ist dabei nicht jederzeit spannend. Wenn man aber den Regieansatz als solchen akzeptiert, dann kann man dem Regisseur eine handwerklich exzellente Arbeit attestieren, denn sie ist durchgängig, stringent und lebhaft bei relativ einfachen Mitteln; changiert zwischen Satire und Boulevardkomödie mit bitterer Komik, bei welcher zuletzt alle die Düpierten sind.

Ensemble
Dostojewski hat seine Novelle eingerahmt in zwei Erzählungen des Stadtarchivars von Mordassow, die als Prolog und Epilog des Stücks dienen. Kerkhof hat diese Figur in einen Conférencier verwandelt, der kalt und glatt in das Geschehen einführt, das Personal vorstellt und schließlich über die Folge informiert. Er erscheint aus der Tiefe der von Bühnenbildner Dirk Becker stilsicher möblierten Spielfläche hinter einem mit sieben Reihen von insgesamt 800 Glühlampen bestückten Bühnenportal. Hinten wird die Bühne entweder durch einen einfachen Brechtschen Vorhang oder alternativ einen hereingefahren Prospekt mit einer Tür begrenzt, durch welche die Protagonisten auf- und abtreten können. Die werden umwuselt von einer Gruppe von Revuegirls, die in allerlei fantasievolle Kostüme vom Tutu bis zum Charleston-Kleid gesteckt sind (Kostüme: Inge Medert); man bleibt also konsequent im Stile der roaring twenties. Anerkennenswert ist, was diesen offensichtlich zu diesem Zweck handverlesenen Statistinnen an Bewegungsperfektion antrainiert worden ist.

Jaco Venter (Fürst), Agnieszka Tomaszewska (Sina), Damen des Staatsopernchors
Welche die musikalischen Präferenzen des Komponisten waren und welchen Einflüssen er erlegen war, macht Krásas Partitur klar. Die Musik eklektisch zu nennen, trifft aber den Sachverhalt nicht, denn die verschiedenen Einflüsse sind nicht amalgamiert, sondern situativ werden in einer Art Montagetechnik entweder Zemlinsky, Weill, Strawinsky oder auch andere gespielt. Das reicht vom Strauss’schen Konversationston bis zu geschärften polytonalen Attacken à la Strawinsky und ist handwerklich gelungen, aber kompositorisch alles andere als aufregend. Dass die zitierte Musik gut inszeniert werden kann, zeigt Sinas verführerischer Gesangsvortrag: um dem Fürsten zu gefallen, trägt sie dozil und schön Bellinis „Casta Diva“ aus Norma vor; durch aufkommende Eifersucht schlägt die Szene in Parodie und Chaos um, was in der Musik aufgenommen und zum Höhepunkt des ersten Akts wird. (Der italienische Sänger aus dem Rosenkavalier lässt grüßen, dessen Szene ebenfalls im Tumult untergeht.)
Die Badische Staatskapelle unter ihrem GMD Justin Brown musizierte das engagiert und konzentriert in großer Besetzung, ob Strauss-Walzer (Johann via Richard) oder kleinteilige Motivwiederholungen à la Janáček, summarisch: mit Witz, Wärme und Charme. Solistisch parodiert das Saxophon, das in dieser Collage natürlich nicht fehlen darf, wenn Jazziges oder Bänkelgesang eingestreut wird. Der Damenchor des Staatstheaters, dessen Mitglieder als „wissbegierige“ Frauen der Gesellschaft von Mordassow ein hübsche gut bewegte Gruppe darstellen, die erst im zweiten Akt Verwendung findet, war von Ulrich Wagner präpariert.

Hatice Zeliha Kökcek (Sofia Petrowna) Jaco Venter (Fürst), Statisterie; (Foto: Markus Kaesler)
Was die solistischen Leistungen anbelangt, konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Krása seine Stimmen den Sängern nicht eben in die Kehle geschrieben hat. Gerade im Sinne einer Revue oder eines Variétés hätte das vielfach deutlich glatter klingen müssen, zumal auf Deutsch gesungen wurde. Ungewöhnlich für das Staatstheater, die hohe Zahl von vier Gästen unter den insgesamt acht Partien. Agnieszka Tomaszewska gab die Sina mit makellosem klarem lyrischem Sopran bis in die sehr hohen Lagen der Partie und überzeugte auch darstellerisch durch ihre attraktive Bühnenpräsenz, schien aber ein wenig zu brav. Dana Beth Miller als Gast sang in der für Mütter und Kupplerinnen traditionellen Mezzo-Lage die Marja Alexandrowna und brachte ihr geschmeidiges Material schön fokussiert zur Geltung. Katharina Tier als Nastassja wurde als indisponiert angesagt. Auch darstellerisch wirkte sie in dieser interessanten Rolle gehemmt. Jaco Venter brachte gesanglich mit seinem sehr kultivierten und kraftvollen Bariton die Höchstleistung des Abends als Fürst, den er nicht als demente Knallcharge darstellte, sondern dem er durchaus Würde verlieh. Christian Voigt als Gast kam mit der Rolle des intriganten Neidlings Paul vor allem im hohen Register nicht gut zurecht; hier wäre vielleicht ein Charaktertenor angebracht gewesen. Süffisant mit festem, kernigem und deutlichem Bassbariton ging Armin Kolarczyk die Rolle des Archivars/Conférenciers an. In zwei kleinen Rollen noch Sofia Mara als Barbara und Hatice Zeliha Kökcek als Bürgerin Sofia Petrowna (beide Gäste).

hängend: Agnieszka Tomaszewska (Sina); stehend: Joco Venter (Fürst), Armin Kolarczyk (Conférencier), Christian Voigt (Paul), Dana Beth Miller (Marja), Hatice Zeliha Kökcek (Sofia Petrowna) (Foto: Markus Kaesler)
Die Oper wir in eindreiviertel Stunden reine Spielzeit gebracht. Sicher auch wegen der Beliebtheit der Veranstaltung „Sternfahrt“ mit Bus sowie Kaffee und Kuchen war diese Nachmittagsvorstellung der Produktion, die überregionales Interesse erzeugt hatte, fast ausverkauft und erhielt sehr freundlichen Beifall. Ob es sich aber um eine von etlichen meiner Kollegen bereits im Vorhinein gefeierte Entdeckung eines neuen Repertoire-Stücks gehandelt hat, muss sich erst noch erweisen. Die Oper wird wieder am 14.11. gezeigt und kommt noch insgesamt sechs Mal bis zum 21. Januar.
Manfred Langer, 26.10.2014
Fotos von Falk von Traubenberg, wenn nicht anders genannt.
Sensationell!
Arien von Johann Adolph Hasse
Opernkonzert im großen Haus des Staatstheaters am 28.09.14
Mit Max Emanuel Cencic und der armonia atenea unter der Leitung von George Petrou

Johann Adolph Hasse,
ein Spätgeborener der Barockmusik, wurde 1699 in Bergedorf (heute Hamburg) in eine Musikerfamilie geboren, genoss eine Gesangsausbildung und wirkte als Sänger am Hamburger Gänsemarkttheater. Seine erste Oper „Antioco“ wurde 1721 in Braunschweig uraufgeführt. Dabei trat er selber als Sänger auf. Von 1722 bis 1725 studierte Hasse in Neapel bei Nicola Porpora (später Konkurrent Händels in London) und Alessandro Scarlatti. 1730 heiratete er den gefeierten Gesangsstar Faustina Bordoni, mit der er eine über 50-jährige Ehe führen sollte. In Italien erlangte er bald als Opernkomponist Berühmtheit, der Name il divino sassone eilte ihm voraus. Ab 1731 wirkte er in Dresden und leitete dort die Hofmusik, wobei er das Orchester so vorbildlich organisierte, dass Jean-Jacques Rousseau den Sitzplan dieses Klangkörpers im Artikel „Orchestre“ seiner Encyclopédie als Musterbeispiel veröffentlichte. Ein besonderes Verhältnis baute er zu dem Wiener Hofdichter und Librettisten Metastasio auf, dessen literarischen Konzepten er bis an sein Schaffensende die Treue hielt, weshalb Hasse sich auch den Reformoper-Aktivitäten von Calzabigi und Gluck gegenüber abweisend verhielt. Auch in seiner Dresdner Zeit wurde Hasse genügend Spielraum gegeben, immer wieder nach Italien zu fahren, so dass er Vermittler italienischer Opernkultur in Deutschland blieb. Höhepunkt von Hasses europäischem Ruhm war eine Einladung des französischen Hofs nach Paris 1750, wo er von den Aufklärern um Voltaire und Rousseau als Botschafter der italienischen Musikkultur gefeiert wurde. Einer Einladung nach London kam Hasse vorsichtigerweise nicht nach; dort wirkte inzwischen sein früherer Lehrer Porpora; mit ihm und Händel wollte er sich nicht in Wettbewerb begeben. Hasse war mit Größen seiner Zeit bekannt, traf den alten Bach wie den jungen Mozart und musizierte mit König Friedrich II von Preußen, dessen Hobby die Musik war. (In seinem Hauptberuf als König und Feldherr zerdepperte Friedrich im sieben-jährigen Krieg nicht nur Hasses Haus in Dresden, sondern auch die Hofoper, worin es ihm in späteren Zeiten Bakunin und die alliierten Bomberverbände gleichtaten. Hasses interessante Vita: wikipedia.org/wiki/ Hasse

George Petrou (Foto: Ilias Sakalak)
1793 Hasse starb 84-jährig in Venedig; seine Musik war obsolet geworden, der Komponist bereits in Vergessenheit geraten. Von der nun schon bald 100 Jahre andauernden Renaissance der Händel-Opern profitiert Hasses umfangreiches Werk nur ganz sporadisch. Während im Rahmen des Händel-Hypes viele weit weniger bedeutende Komponisten des Barock wieder auf die Bühne gebracht werden, bleiben Hasses Werke immer noch absolute Raritäten. Hasse als Komponist war mehr Sammler denn Jäger; seine Musik weniger originell als die Händels, aber viel gefälliger. Nun hat das Staatstheater Karlsruhe im Rahmen der alljährlich veranstalteten Händelfestspiele im Februar (staatstheater.karlsruhe.de/haendel) (15.02. bis 06.03.2015) als Zwischenkonzert einen Opernabend mit Konzerten und Arien von Hasse und unter dem Titel „Rokoko“ einen kleinen Einblick in das Werk des Komponisten vermittelt. Mit Affektenlehre, Generalbass, da-capo-Arien (harmonisch und im Tempo jeweils deutlich abgesetzt) Gleichnisarien und Stufendynamik bestimmen noch die barocken Elemente die Musik Hasses.

Max Emanuel Cencic in Karlsruhe (Foto: Jochen Klenk)
Mit dem Countertenor Max Emanuel Cencic und der armonia atenea auf Originalinstrumenten unter der Leitung von George Petrou waren für das Konzert höchste musikalische Kompetenz und Qualität aufgeboten. Cencic hat eine der schönsten Stimmen im Counterfach; Petrou, ein ausgewiesener Barockspezialist ist künstlerischer Leiter der armonia atenea, das mit führenden Barock-Ensembles mithalten kann. Dafür legten die Ausführenden an diesem Abend beredtes Zeugnis ab.
Gespielt wurden neben den Arien Ouvertüren zu den Hasse-Opern Artemisia (1754), Siroe (1733), das Concerto in F op. 4,1 und als ausgesprochenes Schmankerl das Concerto für Mandoline und Streicher in G op. 3,11, das Theodoros Kitsos, auch Basslautenist im Continuo, interpretierte. Ein solches Konzert käme allerdings in einem intimeren räumlichen Rahmen als dem großen Theatersaal noch besser zur Geltung. - Das Vokalprogramm begann mit der Arie „Notte amica, oblio de mali“ aus dem Spätwerk „Il cantico de tre fanciulli“ (1774), in der Cencic gleich sein großes Spektrum präsentierte: seine weich und samtig ansprechende Stimme, hinreißend gestaltete Emotionen im langsamen Teil mit beweglichen Fiorituren und klare Spitzentöne; dazu zeigte er auch seinen beachtlichen Stimmumfang und fiel selbst bei den tiefsten Tönen nicht aus dem Register. In dem sehr energischen „Solca il mar e nel periglio“ aus „Tigrane“ (1723) kamen erste Kostproben von seinem anscheinend anstrengungslosen Volumen und atemberaubenden Vokalisen, für deren schnelle Tonfolge Cencic immer genügend Stimmdruck verfügbar hatte. Sehr engagiert dabei auch das Orchester. Nach der kurzen ABA-Arie „Saper ti basta o cara“ aus „Il trionfo di Clelia“ (1762) kam vor der Pause der erste Höhepunkt des Abends mit „Siam navi all’onde algenti“ aus „L’Olimpiade“ (ja, auch Hasse hat eine Olimpiade auf Metastasios Textbuch geschrieben). Eine großartige, rasend schnelle Sturm-Musik (man glaubt kaum, dass das hier prägnant eingesetzte Fagott so schnelle Läufe spielen kann) mit enormer Energiefreisetzung im Orchester und halsbrecherischen Gesangspassagen, die Cencic an die Grenze seiner Möglichkeiten von Artikulation und Aussprache brachten, blieben nicht ohne Wirkung auf das Publikum, das im Laufe des Abends immer mehr mitging.
Mit „La sorte mia tiranna“ aus „Siroe re di Persia“ (1763) ging das Programm weiter, ein Lamento fast noch in Händel-Art, gemessen kraftvoll im A-Teil und auflehnend im B-Teil. In „De‘ folgori di Giove“ aus „Il trionfo di Clelia“ blitzte es textgemäß aus dem Orchester und aus der Kehle des Sängers mit einem dramatischen Ausbruch in die höchsten Stimmregionen des Solisten, der hier seinem Temperament Lauf ließ. Eine ausdrucksstarke messa di voce und schöne piano-Kultur zeigte Cencic beim „Dei di Roma, ah, perdonate“ noch einmal aus aus „Il trionfo di Clelia“. Das Programm schloss mit einem sehr bewegten „Vo disparato a morte“ Arie des Sesto aus „Tito Vespasiano“ (1735), Arie mit großen Tempo-Unterschieden zwischen den Teilen; Cencic interpretierte den sehr schnellen A-Teil mit viel Energie und Exaltation und drehte zu begeisternden Spitzentönen auf; im langsamen B-Teil nachdenklich und ausdrucksstark. - Unter den drei Zugaben sei noch eine temperamentvolle Arie aus Georg Christoph Wagenseils Euridice erwähnt, die mit ihren energischen Streicherpassagen an Gluck gemahnt: eine nette Geste der Musiker an einen fast völlig vergessenen Komponisten.
Max Emanuel Cencic ist zu den besten jüngeren Counter-Sängern zu rechnen. Seine Stimme zeichnen Leuchtkraft, Beweglichkeit und das anscheinend mühelose Volumen zusammen mit der ganz natürlich wirkenden weichen Intonation über den gesamten großen Stimmumfang aus. Dabei wirkt er etwas introvertiert, fast schüchtern. Nicht so ein Strahlemann wie Philippe Jaroussky, der ihm zwar in Artikulation und Aussprache voraus ist, aber nicht über Cencic’s warmes Ausdrucksvermögen verfügt.

armonia atenea; George Petrou (Foto: Pappas)
Das Orchester spielte tadellos auf. Petrou gelangen bei bester Präzision ein meist leichter, federnder Ausdruck und sehr gelungenen Klangabmischungen mit den Holzbläsern und Hörnern. Letztere zeigten sich auch bei piano-Begleitungen präzise und jederzeit leicht. Lediglich beim Concerto in F, wo sie passagenweise dominant spielten, hatten die Hornisten mit den schwierig zu spielenden Naturinstrumenten etwas zu schaffen.
Die begeisterte Aufnahme des Konzerts schaute den Besuchern aus den Augen. Da das Konzert leider alles andere als gut frequentiert war, klatschten alle Besucher hinterher für drei und sorgten so für sehr gelöste Stimmung bei den Mitwirkenden.
Manfred Langer, 30.09.2014
 Zum Hören bzw. Nachhören: Ein fast identisches Programm haben Petrou und Cencic bei DECCA aufgenommen; vieles davon Ersteinspielungen.
Zum Hören bzw. Nachhören: Ein fast identisches Programm haben Petrou und Cencic bei DECCA aufgenommen; vieles davon Ersteinspielungen.
1 CD / 0289 478 6418 9 CD DDD DH
Zu unserer CD-Besprechung
Keine Folklore
BORIS GODUNOW
Zweite Vorstellung am 23.07.2014 (Premiere am 20.07.2014)
Aufstieg und Fall eines Usurpators – ein Boris mit Sympathiewert
Alexander Puschkin war nicht der erste, als er 1825 die historischen Geschehnisse um Boris Godunow in seiner 17 Bilder umfassenden „Komödie“ niederlegte. Schon 1710 hatte Johann Matheson den Stoff zu einer Barockoper für das Hamburger Gänsemarkt-Theater verarbeitet und auch Schillers letztes Fragment Demetrius (1805) befasste sich mit dem „falschen“ Dimitri. Mussorgsky beschäftigte sich mit einer Trilogie „musikalischer Volksdramen“ in einer Zeit, in welcher in Russland die Zuwendung zur nationalen Kultur erfolgte. Später kam noch Chowanschtschina hinzu, deren Instrumentation der Komponist nicht mehr vollenden konnte. Zu Boris Godunow verfasste er sein eigenes Libretto und dampfte die Puschkin-Vorlage auf neun Bilder ein, in denen er ohne durchgängigen dramaturgischen Fluss zwei Handlungsstränge zusammenführt und mit den Eckpfeilern der gewaltigen Choreinsätze dem „Aufstieg und Fall“ des Regenten und Zaren Boris G. dramatisch Form und Struktur verlieh. Gegenüber dem ironisierenden komödiantischen Stil Puschkins schuf Mussorgsky ein frühes Werk des historischen Realismus mit der dazu passenden emotionalen Musik. Seine „Urfassung“ der Oper (1869) wurde mangels einer Liebesgeschichte von der Leitung des Mariinsky-Theaters als nicht operngängig verworfen, und Mussorgsky musste Änderungen ins Werk setzen, die er zusammen mit seinem freundschaftlichen Berater Rimski-Korsokow erstellte. Zusammen mit diversen späteren Umgliederungen und Neuinstrumentierungen ist aus Boris Godunow ein unübersichtlicher Wust aus Fassungen geworden. Dem Trend der jüngeren Zeit folgend stellte nun das Badische Staatstheater wieder die Originalversion des Stücks vor, die logischerweise der Intentionen des Komponisten am nächsten kommen sollte, einen „Ur-Boris“, der in vier Teilen und sieben Bildern präsentiert wird.

Kammersänger Konstantin Gorny (Boris Godunow)
Die Oper spielt um 1600 in den Wirren der Zeit nach Iwan dem Schrecklichen, der den Protagonisten in der Oper noch in „bester“ Erinnerung ist, und ist voller historischer Figuren. Ein Historiendrama hat der Regisseur David Hermann nicht in Szene gesetzt. Wenn man eine Boris-Vorstellung in osteuropäischen Ländern besucht, sieht man glänzende Kreml-Dächer, prachtvoll gekleidete Chöre mit Fellmützen und glänzenden Stiefeln in wehenden Mänteln marschieren; dazu Kosaken, die das Volk bedrängen und einen Kordon um die Krönungspracht des Boris bilden; dazu prächtige Bojaren. Diese Volklore ist in deutschen Theatern heute weniger gefragt, auch ist die Ausstattung mit ihrer kurzen Halbwertzeit zu teuer. Der Historienprunk lenkt außerdem von dem ab, was moderne Regisseure bevorzugt zeigen; nämlich die Personen, um die es eigentlich geht. So lässt sich David Hermann von seinem Ausstatter Christoph Hetzer auch eine sehr reduzierte Szenographie auf die Bühne bringen: einen leeren dunklen Raum, über dem sich wie ein Schallsegel eine bewegliche bühnengroße Elementendecke befindet, die nach hinten absenkbar ist. Sie hat neben der an sich überflüssigen optischen auch eine szenische Funktion: Dahinter kann der Riesenchor auftreten und verschwinden, ohne dass für diese Menschenmenge ein langer Auf- oder Abzug vorgesehen werden muss. Als Möblierung der Szenerie gibt es einfache Tische und Stühle (wegen der wachsenden Beliebtheit bei Regisseuren immer wieder verwertbar!), die für die einzelnen Szenen nur jeweils anders angeordnet werden.
Boris Godunow ist eine politische Oper, die nicht nur von Herrschermacht handelt, sondern auch intrigantem politischem Gewürm Raum gibt und das wankelmütige Volk thematisiert. Das ist zeitlos, und so haben Hermann und Hetzer die Handelnden in moderne Kostüme gekleidet. Schtschelkalow und Schujski sind aalglatte Figuren in weißen Hemden und schwarzen Anzügen; die Bojaren ein undisziplinierter Haufen in Freizeitkleidung ebenso wie das Volk. Boris ist verletzlich dargestellt: barfuß, schwarze Hose, offenes weißes Hemd. Vor seiner Krönung zieht er sich bis auf die Unterhose aus, ehe ihm dufte Hostessen ein goldenes Ornat anzaubern. Das steht später wie ein Popanz auf einem Kleiderständer, während Boris wieder wie vor auftritt und vor seinem Tode sich wieder bis auf die Unterhose aller Kleidung entledigt: Aufstieg und Fall! Die ersten beiden Bilder sind recht statisch angelegt und kommen etwas müde herüber. Da bleibt die Bewegung des Volkes auf der Strecke; keine Bedrängung oder Aufruhr; das steht nur gleichmütig herum oder bewegt sich ganz langsam. Zum Schluss das gleiche. Eindrucksvoll ist die düstere Klosterszene, Klosterschüler kopieren alte Schriften. Die allgegenwärtigen „Gorillas“ in Lederjacken treten auch hier auf, sorgen für Ordnung und sammeln die Hefte ein. Es bleibt aber alles ein wenig im Vagen, die „Modernisierung“ geschieht ohne konkrete Anspielungen. Das wäre auch wohlfeil gewesen, denn das korrupte Beziehungsgeflecht von Herrschaftssystem, Machtspielern und Mitläufern ist ubiquitär – bis in die westlichen Demokratien. Die Regie hätte es ruhig noch abstrakter darstellen können.

Avtandil Kaspeli (Pimen); Statisterie
Für schrillen Kontrast sorgt die Wirtshausszene an der litauischen Grenze. Da diese den komödiantischen Teil des Werks beinhaltet, hat hier die Regie mit bizarren, grellen Figuren zugeschlagen, damit auch jeder merkt, dass jetzt Komödie angesagt ist. Ausstaffierung und Bewegung der Figuren passen gar nicht recht zum Rest der Oper und schon gar nicht zur Musik. Sind das strahlende und von Tschernobyl erbgutgeschädigte Personen mit merkwürdigen Auswachsungen? Im Lokal hat sogar ein müder wirkender stummer Napoleon Platz genommen, der anscheinend den Rückzug über den Njemen verpasst hat. Nach diesem überflüssigen Ausritt nimmt die Inszenierung im dritten und vierten Teil wieder größere Tiefe an. Etwas merkwürdig ist noch das Bild mit Boris‘ Kindern gestaltet: die Karte des Reichs, die Fjodor studiert, besteht aus einer langen Ansammlung von traurigen Terracotta-Figuren gestaltet à la Käthe Kollwitz. Fjodor will die zum Schluss nicht mehr sehen und kriecht unter der Tischreihe fort. Die Gottesnarr-Szene ist insofern gut vorbereitet, als diese Figur in weißem Gewand, verunstaltetem Gesucht und Dornenkrone von der Regie schon ganz zu Anfang stumm eingeführt wurde und dann Teile seiner Klage a cappella vor den Zwischenvorhängen vorträgt. Die Figur ist somit stark aufgewertet, und die Regie macht Anspielungen, dass es sich beim Gottesnarr gar um einen Wiedergänger des zu Tode gekommenen Zarewitsch Dimitri handeln könnte. Er inkarniert das schlechte Gewissen des Boris Godunow, der sich zuletzt eingestehen muss, dass ihm nichts gelungen ist. Vom verarmten Volk in der letzten großen Chorszene angeklagt kann Boris den Anschuldigungen des Mönchs Pimen nicht mehr wehren und erhebt seinen Sohn auf den Thron. Das ergibt den beeindruckenden Schluss der Inszenierung.

Lucia Lucas (Warlaam), Yang Xu (Polizist), Stefanie Schaefer (Wirtin)
Boris Godunow ist das umfangreichste Werk Mussorgskys, das er selber vollständig instrumentiert hat. Musikalisch mutet die Partitur Mussorgskys (naher Zeitgenosse Tschaikowskys, aber durch seine Trinkgewohnheiten leider viel früher verstorben) noch heute modern an. Anders als Tschaikowskys Musik in westlich romantischer Manier mit einem Schuss slawischer Sauce, ist die Mussorgskys tönende Urgewalt der musikalischen russischen Seele. Das will erst einmal musiziert sein. Johannes Willig am Pult der sehr konzentriert aufspielenden Badischen Staatskapelle machte das sehr gut. Er hebt nicht auf folkloristischen Schmelz ab, sondern schöpft aus dem Herben der Musik. Mit eher gemäßigten Tempi gewinnt er an Breite und Tiefe, ohne an Spannung einzubüßen. Die farbenreiche Instrumentierung breitet er wie einen großen Teppich aus, schafft andrerseits aber auch große emotionale Intensität. Zu den Höhepunkten zählen dabei auch die magischen, besonders langsam scheinenden Chorpassagen, die in ihrer leitmotivischen Melodik sehr prägend sind und musikdramaturgisch wie große Eckpfeiler am Beginn und am Ende des Stücks stehen. Was für ein Unterschied zu Tschaikowskys Gesäusel z.B. im Eugen Onegin zwanzig Jahre später! Dagegen hörte man an diesem Abend teilweise wenig elegantes Wogen der Instrumentengruppen, kräftige Bläser-Attacken, die schon früh in rauen Einsätzen der Basstuba gipfelten. Chor und Extrachor waren von Ulrich Wagner und Stefan Neubert einstudiert. es kam noch ein großer Kinderchor zum Einsatz: Cantus Juvenum Karlsruhe in der Einstudierung von Anette Schneider, der auch szenisch gut zur Geltung kam. Insgesamt hinterließen Chor und Orchester den stärksten Eindruck an diesem Abend.

Kammersänger Hans-Jörg Weinschenk (Gottesnarr); Cantus Juvenum, Chor
Dazu bewies aber auch das Sängerensemble hohe und homogene Qualität. Dass fast alle Rollen überzeugend aus dem Hause besetzt werden konnten, zeugt von der Leistungsfähigkeit des Staatstheaters. Die Titelrolle sang Konstantin Gorny mit hellem, elegantem und kraftvollen Bass; er verkörperte auch darstellerisch gut den stets von Zweifeln geplagten Godunow bis in den Untergang und rührte in der Szene mit seinen Kindern. Das ganz tiefe Fundament der Herrschergestalt hatte er stimmlich nicht. Hiermit glänzte indes Avtandil Kaspeli als Pimen, der auch die fordernden Höhen dieser Rolle bestens meisterte. Darstellerisch war er nicht so gefordert wie der Titelheld, aber er verlieh dem Mönch auch vom Auftreten her das dem stimmlichen entsprechende würdig-bestimmte Profil. Andrea Shin gefiel mit sauber geführtem, klarem und strahlendem Tenor in der Rolle des Grigori/falscher Dimitri. Den Gottesnarr sang der einzige Gast des Abends Hans-Jörg Weinschenk frisch mit hellem Charaktertenor, stets klagend und wohlklingend, nie dünn oder spitz. Ein weiterer Vertreter dieses Fachs wird den Schujski benötigt. Matthias Wohlbrecht konnte seine Stimme gut auf diesen Schleicher und Intriganten mit vorgezeigter hündischer Unterwürfigkeit einstellen, während die Regie ihn darstellerisch unter Wert einsetzte. Den Duma-Schreiber Schtschelkalow verkörperte Gabriel Urrutia-Benet mit sehr hellem, der Rolle entsprechendem scharfen Bariton. Stefanie Schneider gab mit schlankem gefälligem Mezzo die sehr eigenartig präsentierte Schenkwirtin und befand sich dabei in Gesellschaft der beiden skurril präsentierten Bettelmönche Warlaam (Lucia Lucas mit überlegenem, rundem Bass-Material) und Missail (Max Friedrich Schäffer mit geradlinigem Tenor). Auch aus der Familie Godunow ist stimmlich auch nur Vorteilhaftes zu berichten: Larissa Wäspys klarer heller Sopran als Xenia, Dilara Baștar mit klangschönem schlankem Mezzo als Fjodor (beide aus dem Opernstudio) und nicht zuletzt der für eine Rolle wie der der Amme bewährte ausladende Alt von Rebecca Raffell.

Kammersänger Konstantin Gorny (Boris Godunow), Matthias Wohlbrecht (Schujski)
Eine gewisse Betroffenheit hinterließ die Inszenierung beim Publikum; denn der Beifall wollte erst nicht so recht in die Gänge kommen, wurde dafür aber sehr lang. Da die letzten drei Bilder der Inszenierung die stärksten sind und der letzte Eindruck immer der entscheidende ist, konnte man in der Rückschau über einiges Fragliches der Inszenierung hinwegsehen und überdies das eindringliche musikalische Ereignis nachwirken lassen. In der nächsten Spielzeit wird mit der B-Premiere am 25. September die Produktion wieder aufgenommen.
Manfred Langer, 24.09.14 Fotos: Falk von Traubenberg
Gewaltige Hörbilder
DOCTOR ATOMIC
(John Adams * 1947)
Vorstellung am 21.05.2014 (Premiere am 25.01.2014)
Brennt die Atmosphäre? Auf dem Wege zur Vernichtung unseres Planeten
Am Badischen Staatstheater kam nun nach „Wallenberg“ und „Die Passagierin“ als drittes Werk in der Serie „politische Oper“ der Doctor Atomic von John Adams heraus. Als Teil einer Serie entstand auch dieses Auftragswerk der San Francisco Opera und wurde dort 2005 uraufgeführt. Denn wie schon in seinen vorangegangenen Opernkompositionen („Nixon in China“ und „Klinghoffers Tod“) hat sich der Komponist Adams ein Thema der Zeitgeschichte vorgenommen und sich dabei – soweit auf einer Opernbühne überhaupt möglich –an der historischen Realität orientiert. Dr. Atomic, das ist die Gestalt des Robert Oppenheimer, Sohn deutsch-jüdischer Emigranten, der in Göttingen bei Max Born promoviert hat und als „Vater der Atombombe“ gilt. Das Libretto für die Oper schuf Peter Sellars. Dabei handelt es sich um eine Collage aus historischen Dokumenten (Protokolle, Berichte, Korrespondenz) einerseits und von Oppenheimer geschätzter Lyrik andrerseits. Dieser Antagonismus aus banal wirkenden Textausrissen und tiefgründiger und rätselhafter Poesie (Baudelaire), der Spannung aus dem Text erzeugt, überträgt sich auch auf die Musik mit ihrem Gegensatz aus motorischem, heftigem Vorwärtstreiben mit den entsprechenden Schlagzeuggewittern und kontemplativen romantisierenden Passagen. Zudem sind die beiden Akte der Oper mit ihrem jeweils drei Szenen gegensätzlich angelegt: handlungsgetrieben der klar strukturierte erste, nach innen gekehrt der zweite Akt, der mit seiner unrealen Durchmischung der Handlungsorte zudem einen Hang zum Surrealen aufweist.

Steven Ebel (Robert Wilson), Armin Kolarczyk (Robert Oppenheimer), Lucas Harbour (Edward Teller)
Der Quantenphysiker Robert Oppenheimer treibt als wissenschaftlicher Leiter den ersten Atombombenversuch in der Wüste von New Mexico voran. Kontrastierend dazu die Idylle mit seiner Ehefrau Kitty im Bungalow. Sein Mitstreiter (und Hintertreiber) Edward Teller (der ist mit seinen Gedanken schon bei der thermonuklearen Waffe) gestaltet mit ihm und weiteren historischen Figuren ein Drama auch um die Frage, soll man oder darf man nicht? Der autoritäre militärische Leiter des Projekts General Leslie Groves, Robert Wilson (Spezialist für die Isotopentrennung), der Strahlungsmediziner Captain James Nolan und Jack Hubbard, Chefmeteorologe des Projekts, sind weitere historische Figuren des Librettos. Mit dem indianischen Hausmädchen Pasqualita wird als Kontrast naturverbundene Person in das Technik- und Männer-dominierten Szenario gesetzt.
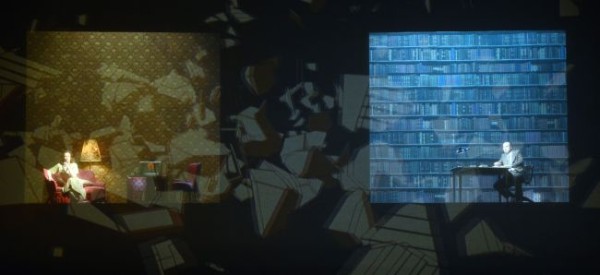
Katharine Tier (Kitty Oppenheimer), Armin Kolarczyk (Robert Oppenheimer)
Der Regisseur Yuval Sharon setzt die gegensätzlichen Akte ganz unterschiedlich in Szene. Der erste Akt findet hinter einem Schleiervorhang statt, auf welchen kommentierende, erläuternde oder verstärkende Videoprojektionen (Formeln der Experimentalphysik, Wüstenlandschaften oder z.B. Gewittersturm) eine zweite Ebene ergeben, hinter welcher an einem zweiten Horizont die einzelnen Orte der Handlung (Büro, Privatwohnung) wie kleine Puppenstuben aufgezogen werden. (Bühnenbild: Dirk Becker) Da werden die Handlungselemente mit den Spielorten immer scharf herausbeleuchtet und in den etwas diffuseren Umweltkontext gestellt. Diese Klarheit ist im zweiten Akt nicht mehr gegeben. Als Spielfläche dient ein großes, sich noch hinten aufsteilendes, konkaves rot kariertes Skizzenpapier, wie es Ingenieure benutzen. Die Szenen mit den jeweils wenigen Protagonisten werden aufgemischt durch die Choristen, die auf der Bühne umherziehen, aber anscheinend keine Orientierung gewinnen können und wieder und wieder die Protagonisten umlaufen. Da hier die Handlungsorte (Privatwohnung und Testgelände) schon im Libretto durchmischt sind, vermeidet diese völlig abstrakte Szenerie den schwierigen Versuch, das zu konkretisieren. Die Spannung des zweiten Akts wird nicht mehr durch das Bühnengeschehen erzeugt, sondern speist sich vorwiegend aus der Musik. So konkret und funktionell im ersten Akt die Kostüme von Sarah Rolke einschließlich der in Schwarz agierenden Choristen sind, so abstrakt sind letztere im zweiten Akt in helle Schlabberkluft gekleidet, deren Funktion sich nicht zuordnen lässt: haben die neben einem nicht entstaubten Zementwerk gearbeitet, oder befindet sich (nach dem langen Gewitter!?) Wüstenstaub auf der Kleidung? Was im ersten Akt sehr gut gelingt und dann bis in den zweiten nachwirkt, sind die Charakterzeichnungen des Personals zwischen zynischen Treibern und nachdenklichen Zweiflern, über welchen der Popanz des Generals Leslie Groves agiert und donnert. Im zweiten Akt ist es eine Art abwartender Spannung, die dominiert, als der Test näher rückt.

Renatus Meszar (General Leslie Groves), Armin Kolarczyk (Robert Oppenheimer)
Starke Bläsersektion, (relativ) noch stärkere Schlagwerksgruppe und eine große Streicherformation; so könnte man in wenigen dürren Worten beschreiben, was sich da unter der Leitung des stellv. GMD Johannes Willig von der Badischen Staatskapelle im Graben versammelt hatte; auf die Orchesterstärke bezieht sich das nicht, was man als minimal music bezeichnet, deren Vertreter in der zweiten Generation der Komponist John Adams ist. Auch die reine Spielzeit des Werks von etwas über zweieinhalb Stunden ist alles andere als „minimal“, gerade für ein zeitgenössisches Werk. Einige Intonationsfehler und Unsauberkeiten im Graben waren zwar kaum überhörbar; aber insgesamt hinterließ der Orchesterpart doch einen prächtigen Eindruck. Überwiegend im ersten Teil waren die dramatischen Schlagwerk-Ostinati („patterns“ - eine Szene lang Gewitter!) angeordnet, deren Urgewalt sich hier und da auch im zweiten Teil Bahn brach. Dieser aber wurde mehr von raffiniert instrumentierten Klangteppichen beherrscht, von romantisierenden Tremoli der tiefen Streicher und deren spannungsgeladenen Crescendi. Unheilverkündend saßen darauf die Linien der tiefen Holzbläser, namentlich Kontrafagott und Bassklarinette. Das wurde sehr eindrücklich musiziert ebenso wie die vorwärtstreibenden Orchesterzwischenspiele des ersten Akts. Was man aus den Instrumenten im Graben nicht herausholen konnte, wurde zugespielt. Zuerst das unheimliche metallische Summen und Dröhnen elektronischer Musik, die das Unheil der Atomkraft kennzeichnen soll; visualisiert auf dem Millimeterpapier-Hauptvorhang der Bühne während der Ouvertüre als Oszillogramme in drei Ebenen, deren Zacken immer weiter ausschlagen, sich vermischten und beim Einsatz des Orchesters sich über die ganze Bühnenhöhe ausschlugen. Dann auch die diversen Klangeffekte des militärischen Alltagslebens. Präzise wirkte der Chor (Einstudierung: Ulrich Wagner) in lapidaren Einwürfen und Kommentaren in ganz engem Tonspektrum bleibend.

Dilara Baştar (Pasqualita); Ensemble, Staatsopernchor
Alle Solistenrollen waren aus dem Karlsruher Ensemble prima besetzt. In der Titelrolle war Armin Kolarczyk ein glaubwürdiger Darsteller zwischen geschworener Pflichterfüllung, konsequentem Vorgesetzten und einfühlsamem Musensohn. Dazu aber auch knallharter Zynismus (bei den Japanerm muss der größtmögliche „Eindruck“ erzeugt werden) Kolarczyk mit facettenreichem, kultiviertem Bariton wurde allen stimmlichen und schauspielerischen Anforderungen der Rolle gerecht und passte auch von seiner Bühnenerscheinung zu seinem schlanken Vorbild. Das „holy sonnet“ von John Donne „Batter my heart, three-person’d god“ gelang ihm in ergreifender Weise und sehr nachhaltig unmittelbar vor dem Publikum stehend. Dieser Gesang gehört zweifellos zu den anrührendsten Stücken des modernen Musiktheaters. (Warum ein Jude wie in einem Gebet die dreifaltige Gottheit anruft, hat sicher seinen Grund.) Mit dunklerem, runden und volltönendem Bariton gab Lucas Harbour den Edward Teller und stellte ihn – stets wie aus dem Ei gepellt als Sarkasten dar („wie nur 300 Tonnen TNT?; das ist ja kaum mehr als eine Fehlzündung!“) (Teller hat später bei Verdächtigungen der MacCarthy-Zeit seinen Kollegen Oppenheimer als Sicherheitsrisiko belastet.)

Katharine Tier (Kitty Oppenheimer), Armin Kolarczyk (Robert Oppenheimer), Dilara Baştar (Pasqualita)
Als befehlsgewaltiger General Groves war Renatus Meszar besetzt. So kompromisslos er unsinnige Befehle erteilte, so gerade heraus war auch sein kerniger Bass. Das Wetter konnte er zwar nicht beherrschen; aber dem Chefmetereologen befehlen, eine günstige Prognose zu stellen. Dabei menschelte es auch in ihm, wenn er – auf sein Körpergewicht anspielend - zugab, zu viele Brownies gegessen zu haben. Den Metereologen Frank Hubbard sang Jaco Venter mit durchschlagskräftigem dunklem Bariton; eine Art tragikomische Gestalt zwischen Disziplin und wissenschaftlicher Wetterbeobachtung. Der zweifelnde Physiker Robert Wilson war mit Steven Ebel besetzt, der über schönen, ziemlich hellen Tenorschmelz verfügte. Eine weitere kleinere Tenorrolle ist der Militärarzt Capt. James Nolan, dem Ks. Klaus Schneider mit viriler Timbrierung und weicher Intonation stimmlich Profil verlieh. Katharine Tier sang eine einfühlsame Kitty Oppenheimer; sie bewies nuancenreiches, tiefgründiges und ausdrucksstarkes Mezzo-Material vor allem in der Mittellage, während sie sich in den hoch gelegenen Passagen nicht ohne Schärfe ihres Vibratos bediente. Bis in erdige Tiefen vermochte der Mezzo von Dilara Baștar herabzusteigen; aber sie verfügt auch über schlanke Höhen und sprengte in die letzten Szenen immer wieder ihre beiden Lieder ein, von denen eines die „Wolkenblume“ beschwört, unbehaglicher Hinweis auf die kommenden Atompilze.

Lucas Harbour (Edward Teller), Armin Kolarczyk (Robert Oppenheimer), Renatus Meszar (General Leslie Groves)
Das bedrückende Ende der Oper zeigt die drei Hauptschuldigen Oppenheimer, Teller und General Groves mit Lichtschutzbrillen gegen den Atomblitz auf der Bühne; sie geben sich nach dem „geglückten“ Versuch mehrfach beglückwünschend die Hand; während japanischsprachige Stimmen eingespielt werden: „ich brauche Wasser“; „ich suche meinen Mann“. Betroffenheit beim Publikum im gut besuchten Saal; dann langsam einsetzende große Zustimmung zum Gesehenen. Fazit: sehenswert, aber leider nur noch einmal am 25. Mai zu erleben und nicht zur Wiederaufnahme vorgesehen. In der nächsten Spielzeit wird die Reihe „politische Oper“ mit Fantasio von Jacques Offenbach fortgesetzt.
Manfred Langer, 22.05.2014 Fotos: Falk von Traubenberg
Parodie des Regietheaters
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
Premiere am 27.04.2014
Sehr Einfallsreich zwischen altem Libretto und neuen Einfällen
Von der ersten niedergelegten Prosaskizze der Meistersinger (1845 in Marienbad) bis zur Uraufführung am Hoftheater in München 1868 vergingen 23 Jahre. Kein mythologischer Stoff hatte Wagners Fantasie angeregt, sondern verschiedene Lektüren über die historischen Meistersinger mit der belegten Gestalt Hans Sachsens im Mittelpunkt. Die Handlung dazu, die Milieu-Schilderungen, die Charaktere, alles das entsprang Wagners Fantasie, und in diesen Stoff hat er natürlich auch (nicht unberührt von autobiografischen Anspielungen) seine Meinungen zu Kultur, Kunst und Politik sublimiert, weshalb es nicht unwichtig ist, sich stets die Werdenszeit dieses Werks vor Augen zu halten.

vor dem Vorhang: Renatus Meszar als Hans Sachs
Regisseur Tobias Kratzer legt für seine neue Meistersinger-Produktion eine in vielen Punkten originelle Arbeit vor, bei der sich ein wirklich neues Regiekonzept mit einer professionellen, detailfreudigen Durcharbeitung zusammenfindet. Man sieht drei völlig verschiedene Aufzüge, für die der Ausstatter Rainer Sellmaier ein einheitliches Bühnenkonzept (kein Einheitsbühnenbild) und vielfältige Kostüme vorstellt. Wie der Querschnitt durch eine Basilika sieht das Bühnenbild aus: ein breiter großer höherer Mittelraum mit kleiner symmetrischen Nebenräumen, eine Gebäudestruktur der Jetztzeit in Modulbauweise mit Vor- und Hinterzimmer des Mittelsaals, in welchem zu Beginn der Oper ein Chor unter der Leitung von Sixtus Beckmesser Choralsingen übt. Auf einem einfachen Pedestal die überlebensgroße Büste des Bayreuther Meisters, Beckmessers Vorbild. Evchen Pogner fliegt auf Gammler und Penner; mit einem knutscht sie im Vorraum herum, ein zweiter, noch interessanterer kommt vom Hinterzimmer herein; es ist Walther von Stolzing. Die handelnden Personen haben banale Alltagsklamotten an. Die Meistersinger erscheinen als bunt gemischter Haufen von Individuen; keine uniformierte Gesellschaft. Sicher sind einige der Figuren an Promis der Gegenwart angelehnt. Einer hat sein Schoßhündchen mitgebracht; ein anderer muss zwischendurch aus dem Saal, um eine Raucherpause zu machen; einen dritten plagt ein schlimmer Rücken: seine Frau hat eine Schaumstoffmatratze mitgebracht. Beckmesser locker flockig mit umgehängtem Pullover; von Stolzing schlampig mit Jeans und heraushängendem karierten Hemd; Nur Hans Sachs als Schwarzhemd in der Berufskleidung der Künstler. Mit diesen Figuren lässt Kratzer das Geschehen des ersten Aufzugs bruch- und reibungslos nahe am Libretto ablaufen. Eine hübsche, geschlossene Regiearbeit, die das Geschehen ins Hier und Heute verlegt.

Die Meistersinger: Andrew Finden (Konrad Nachtigall), Lucas Harbour (Fritz Kothner), Max Friedrich Schäffer (Kunz Vogelgesang), Renatus Meszar (Hans Sachs), Kammersänger Hans-Jörg Weinschenk (Augustin Moser), Guido Jentjens (Veit Pogner)
Aber was ist das? Im zweiten Aufzug steht im Mittelbau des Bühnenbilds auf einem Drehteller eine lauschige historische Stadtecke mit Fachwerk und kleinem Schusterladen; alles ziemlich einfach auf bemaltem Pappmaché; aber man weiß, was gemeint ist: das mittelalterliche Nürenberg. Der konservative Teil des Publikums wittert Morgenluft und beklatscht schüchtern das Bühnenbild; Kratzer weiß, was das bürgerliche Publikum will: die Mitwirkenden nun in Renaissance-Kostümen. Doch mitten im Fliedermonolog dreht sich die Bühne und Sachs wandert dabei auf eine schräg nach hinten ansteigende elliptische Fläche mit Einbuchtung: eine Malerpalette zwar statt des Wielandschen Rings, Fliedergemälde im Hintergrund, Fliederstrauß auf der Spielfläche: man ist in Neubayreuth angelangt oder einer Parodie darauf, wie auch das historische Eckchen eine Inszenierungsparodie auf Urbayreuth war. Das Inszenierungskarussel dreht sich weiter. Als Beckmesser zum Ständchen auftritt, beginnt eine gekonnte Parodie aufs moderne „Regie“-Theater Da hat Kratzer genau hingeschaut und lässt es an nichts fehlen: Walther und Evchen drücken sich schmusend zwischen blauen Müllsäcken und verzinkten Müllcontainern herum. Die Kulisse zeigt nun einen Plattenbau mit Schusterladen; es ist eine Franchise von Mister Minit, 50 m vom nächsten Döner entfernt. Sachs hockt davor auf einem Bierkasten und repariert Schuhe. Beckmesser bringt zur Begleitung seines Ständchens eine Musikkonserve mit; Strom dafür zapft er in Sachsens Mister-Minit-Laden. Bei Hans Neuenfels hat sich Tobias Kratzer noch eine große Lohengrin-Ratte ausgeliehen und fertig ist das vermüllte Ratten-Desillusionstheater, in welchem Magdalena den Ständchen-singenden Beckmesser mit dem Inhalt einer Kartoffelchipstüte bewirft und das Liebespaar bei Sachs noch schnell zwei Flaschen Bier schnorrt. Döner mampfende Bürger werden vom Lärm angezogen; nun wieder fast alle in historische Renaissance-Kleidung. Die Szene endet bekanntermaßen in einer großen Schlägerei, die hier mit einer solchen Härte geführt wird, dass Opfer auf dem Schlachtfeld bleiben (vgl. Neuenfels Stuttgart 2003).

Daniel Kirch (Walther von Stolzing), Eleazar Rodriguez (David), Renatus Meszar (Hans Sachs)
Den dritten Aufzug zeichnet Kratzer wieder mit seinem eigenen Regiestil. Es ist nicht der humpelnde zerschlagene Beckmesser, dessen Szene vielfach etwas peinlich wirkt. Nein, der kommt wieder frisch und locker im Pulli daher, und setzt sich an Sachsens Flügel, wobei er noch die Vision hat, dass der Bayreuther Meister ihm erscheint. Hingegen hat es David erwischt; der trägt den Arm in der Binde. Aus den noch leblos herumliegenden Personen rekrutieren sich die weiteren Mitspieler im dritten Aufzug. Nach der Verwandlung wird die Wiesn-Szene als ein videoflimmerndes Medienereignis aufgeführt. Der Werbegesang findet in der von roten Vorhängen bedeckten Mittelhalle vor Monitoren statt, auf denen bekannte Wagnersänger (Peter Seiffert, Gösta Winbergh, Plácido Domingo und Lauritz Melchior(?)) flimmern; das Ereignis wird dem Volk draußen öffentlich übertragen. Da er auf der so stark segmentierten Bühne nicht Platz findet, muss der Handwerkschor in den Zuschauerraum ausweichen. Die von den „politisch Korrekten“ problematisierte Festwiese wird szenisch einfach ausgelassen.
Die Inszenierungsstruktur des zweiten Aufzugs als Streifzug durch die Rezeptionsgeschichte der Meistersinger ist schon auf dem Bühnenvorhang angekündigt. Der stellt eine Collage aus Aufführungsplakaten, Besetzungszetteln und CD-Titelbildern vieler Perioden dar, so dass man hier abstrakt stilisierte Ankündigungen ebenso sieht wie Aufdrucke, die denen auf einer Kiste von Nürnberger Lebkuchen gleichen. Als Sachs zu seinem Monolog „Verachtet mir die Meister nicht“ nach vorne kommt, senkt sich dieser Vorhang hinter ihm, und Sachs heftet noch das neue Plakat der Karlsruher Aufführung dazu. Seit man diesen Monolog problematisiert hat und mit zeitgemäßem Dreck bewirft und seit Konwitschnys origineller Antwort in Hamburg auf diese Tiraden, ist man immer besonders gespannt, wie die Regie diesen Monolog ex- oder inkulpiert. Tobias Kratzer hat es sich leicht gemacht: aus einer Kiste, in der Hans Sachs auch „Wagners gesammelte Dichtungen“ aufbewahrt, holte er diese Textsammlung hervor und liest daraus vor. Herr Kratzer wäscht seine Hände in Unschuld!

Renatus Meszar (Hans Sachs), Rachel Nicholls (Eva), Daniel Kirch (Walther von Stolzing)
Mal genau in den Text geschaut, führt Sachs zur Kunst aus: „im Drang der schlimmen Jahr' - blieb sie doch deutsch und wahr.“ Welche "schlimmen Jahr‘" kann Wagner Mitte des 19. Jhdts. gemeint haben? Etwa fremdländische Unterdrückung, gar die Franzosen? Aus heutiger Sicht denken wir an andere „schlimme Jahre“ – aber die Worte passen auch. Dann heißt es: „und welschen Dunst mit welschem Tand - sie pflanzen uns in deutsches Land.“ Das müsste man allerdings heute anders schreiben: und Ami-Dunst mit Ami-Tand – sie pflanzen uns in deutsches Land. Was zu inszenieren wahrheitsnah, aber politisch unkorrekt wäre, obwohl wir mit uns mit hündischer Unterwürfigkeit belauschen und unsere Sprache verhunzen lassen. --- Ganz korrekt hat sich in Kratzers Inszenierung das Evchen indes zum Schluss auch nicht verhalten. Als Walther - inzwischen in den deutschen Künstler-Mittelstand integriert – in schickem schwarzem Anzug den Schlusschor dirigiert (da hat er nun im gleichen Mittelraum den Sixtus Beckmesser als Chef abgelöst), stiehlt sich das Evchen in den Nebenraum: eben ist ein neuer Gammler eingetroffen; sie scheint nicht abgeneigt... Kratzer beleuchtet abwechslungsreich und gekonnt dieses und jenes; aber er bezieht nicht Stellung. Seine Inszenierung ist mit unzähligen, einer musikalischen Komödie angepassten Einfällen gleichwohl rundum gelungen.

oben: Stefanie Schaefer (Magdalene); unten: Daniel Kirch (Walther von Stolzing), Rachel Nicholls (Eva), Renatus Meszar (Hans Sachs), Armin Kolarczyk (Sixtus Beckmesser)
GMD Justin Brown brachte die drei Aufzüge mit den zwei Vorspielen in ziemlich genau viereinhalb Stunden reiner Spielzeit durch. Dabei begann er mit der Badischen Staatskapelle mit einem flotten Tempo im Vorspiel des ersten Akts, welches etwas uninspiriert dahineilte. Von Pathos und Schwulst hielt Brown indes sein Dirigat durchgängig frei, so brauchte man auch nicht beim x.ten mal Meistersingerthema-Pomp in Ehrfurcht zu erstarren; denn die Staatskapelle bevorzugte einen filigranen, vielfach kammermusikalischen Begleitton mit leichtem Klangfluss und blieb fast immer sängerfreundlich. Viereinhalb Stunden höchste Konzentration und Premierenfieber fordern natürlich hier und da auch ihren Tribut. Dass den gerade die im Festwiesenaufzug sehr exponierten Hörner und Trompeten zahlen mussten, braucht sich j in en Folgevorstellungen nicht zu wiederholen. Nicht zuletzt durch die räumlich komplexe Aufstellung der im Übrigen sehr klangschönen und- kräftigen (Gewaltiger Einsatz des „Wach‘ auf!“) Chöre (Badischer Staatsopernchor und Extrachor; Einstudierung: Ulrich Wagner) kam es im dritten Akt auch noch einigen Unschärfen, die bei Folgevorstellungen vielleicht vermieden werden können.

Ensemble, Badischer Staatsopernchor und Extrachor
Solistisch brannte an diesem Premierenabend kaum etwas an. Offensichtlich haben am Badischen Staatstheater die Meistersinger lange nicht mehr auf dem Spielplan gestanden. Denn bis auf die Gäste befanden sich alle Solisten im Rollendebut. Renatus Mészár gab sich in der Riesenrolle des Hans Sachs keine Blöße und überzeugte bis zur in dieser Rolle sehr fordernde Schlussszene. Sein sicherer und scheinbar mühelos strömender Bassbariton überzeugte im Parlando wie im Arioso mit seiner Klangschönheit und Ausgewogenheit und wies den richtigen dunkel väterlichen Ton aus. Die Spitzentöne mühten ihn hingegen. Guido Jentjens als Gast gab den Veit Pogner kraftvoll mit sehr kultiviertem rundem Bass. Als sein Meistersingerkollege und Schriftwart Fritz Kothner war Lucas Harbour besetzt, der als biederer Buchhalter in Strickweste mit sonorem gut grundiertem Bassbariton gefiel. Als Walther von Stolzing war Daniel Kirch als Gast besetzt. Er schlug sich mit bemerkenswertem schauspielerischen Talent durch die vielen Regievarianten bis zum neu ernannten Meister in schwarzem Anzug; meisterlich setzte er auch seinen geschmeidigen, recht hellen Tenor ein, der sowohl im gut grundierten Parlando als auch gesanglich mit strahlenden Höhen überzeugen konnte – immer mit guter Textverständlichkeit. Armin Kolarczyk überzeugte als Sixtus Beckmesser, den die Regie abseits von allen peinlichen historischen Stereotypen zeichnet und gewissermaßen neu erfindet, mit gewandtem, dunklem Bariton und gelöstem Spiel. Rachel Nicholls als Gast für die Eva besetzt, konnte indes nicht überzeugen; ihre forcierten Höhen wirkten scharf, ihr Parlando-Geplapper war wegen schlechter Aussprache kaum verständlich, und ihr Tremolo wollte nicht recht zu dieser jugendlichen Rolle passen. Besser machte es Stefanie Schaefer als wunderbare Magdalena mit schlankem, gut fokussiertem Mezzo. Das Altjüngferliche hatte ihr die Regie zum Glück nicht zugemutet. Eine sehr gute Partie lieferte auch Eleazar Rodiguez als David ab. Sein gut gestützter bronzener Tenor hebt ihn von den für diese Rolle vielfach eingesetzten leichteren Charaktertenören positiv ab.
Über 15 Minuten ovationsartiger Beifall folgte dem Schlussvorhang; David, und Sachs bekamen deutlich das meiste ab. Eine kleinere Gruppe buhte dem kleinen Regieteam zu, wahrscheinlich die Zuschauer, die bei dem Zuckerbäckerbild aus Pappmaché im zweiten Aufzug spontan geklatscht hatten. Die nächste Aufführung ist die B-Premiere am 07.05. in teilweise anderer Besetzung. Danach kommen die Meistersinger noch weitere fünf Mal bis zum Spielzeitende; darunter eine Operngala mit Albert Dohmen als Sachs und Dmitry Ivashchenko als Pogner am 08.06.14.
Manfred Langer, 28.04.2014 Fotos: Falk von Traubenberg
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich unten auf der Seite Karlsruhe des Archivs - ohne Bilder