

Claude Debussy
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Premiere: 20. März 2022

Die einzige Oper aus der Hand von Claude Debussy ist nicht einfach eine Oper im üblichen Sinn. Debussy versuchte eine neue Form des Musiktheaters zu schaffen, welche sich von Meyerbeer, Wagner und anderen Komponisten und Komponistinnen unterscheidet. In Pélleas und Mélisande wird nicht die Handlung, die Geschichte vom Orchester begleitet und unterstrichen. Das Orchester ist der Hauptdarsteller (Protagonist) und seine >Gegenspieler< (Antagonisten) die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Dies muss in der Regie berücksichtigt werden und dies wurde in Bern unter der Spielleitung von Regisseur Elmar Goerden nur zum Teil erreicht. Die Handlung auf der Bühne war zu bewegt und gab eigentlich nie Ruhe und genügend Platz für die Musik Debussys. Auch die dauernde Bewegung der Drehbühne, einzelne Spielräume darstellenden, half nicht zum Verständnis, was Debussy in seiner Oper eigentlich anstrebte. Die stärksten Momente waren die Parts, wo das Orchester ohne Gesang aufspielte, obgleich auch hier die dauernde Veränderung auf der Bühne leicht störend wirkte.
Das Berner Symphonieorchester unter der Leitung des jungen Dirigenten Sebastian Schwab, erster Kapellmeister an den Bühnen Bern, interpretierte die Komposition Debussys mit viel Empathie und Präzision, ich bezeichne die Berner Interpretation als eine musikalische Meisterleistung.

Michal Proszinski, inszeniert als introvertierter Buchhaltertyp singt die Rolle sauber intoniert und mit guter Diktion. Seine schauspielerische Leistung, seine Mimik und Gestik ist noch nicht ausgereift und wird sich im Ensemble Bern, dessen Mitglied er ist, sicherlich verbessern.
Golaud, gesungen und gespielt von Robin Adams dagegen hat eine sehr starke, in einzelnen Passagen zu starke, Bühnenpräsenz. Seine Körpersprache wirkt überzeugend. Der Bariton, führend in der Interpretation zeitgenössische Musik, brilliert mit hervorragender Intonation und Diktion.
Mélisande, der Part wird durch die Mezzosopranistin Evgenia Asanova, Ensemblemitglied der Bühnen Bern, hervorragend gesungen. Auch hier lassen Intonation und Diktion keinen Wunsch übrig.
Weitere Mitspielerinnen und Mitspieler: Matheus Franca, Orsolya Nyakas, Christian Valle und Claude Eichenberger.

Silvia Merlo und Ulf Stengl zeichnen verantwortlich für Bühne und Lichtgestaltung. Die Drehbühne mit immer wechselnder Ansicht von Spielorten darf als gelungen bezeichnet werden, obgleich die dauernde Drehung hier und da stören wirkt. (siehe oben)
Im Grossen und Ganzen ist die Berner Inszenierung sicher sehenswert, nicht aber wirklich neu und eröffnet nicht unbedingt neue Sichtweisen auf Claude Debussy.
Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die Leistung der Künstlerinnen und Künstler vor, unter und hinter der Bühne mit dem verdienten Applaus.
Peter Heuberger, Basel
© Janosch Abel
DAS RHEINGOLD
Regie: Ewelina Marciniak
Musikalische Leitung: Nicholas Carter
Premiere: 12. Dezember 2021
Bern plant einen ganzen Ring-Zyklus auf die Bühne zu bringen und startet Ende 2021 mit dem Vorabend >DAS RHEINGOLD<.

Die polnische Regisseurin, es ist ihre erste Regiearbeit im Musiktheater, versucht die Handlung mit Ballett-Einlagen zu unterstreichen und verstärken. Dazu mehr weiter unten!
Es ist der Regien gelungen, ein sehr einfühlsames Rheingold auf der Bühne zu präsentieren. Die Zusammenarbeit des gesamten künstlerischen Ensembles darf als hervorragend bezeichnet werden. Die Interaktion der einzelnen Figuren wurde makellos herausgearbeitet.
Mimik, Gestik und Körpersprache stimmen bis ins Letzte. Dazu kommt die hervorragende sängerische Leistung der Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Der Regie ist es gelungen, die Beziehungen der einzelnen Charaktere verständlich und logisch aufzuzeigen. Dies gelingt, gerade in Rheingold eher selten.

Josef Wagner als Wotan besticht durch saubere Intonation, kräftige voluminöse Stimme und perfekter Diktion. Dasselbe gilt für seinen Antagonisten Alberich, gespielt und gesungen von Robin Adams, welcher die so zwiespältige Rolle meisterhaft interpretiert.
International ist die Besetzung der Riesen: Aus Brasilien stammt Matheus Franca als Fafner voller Kraft und der Norweger Christian Valle als Fasolt, verliebt in Freia. Beeindruckend Fasolts Appell an Wotan: >Verträge halte die Treu! Was du bist, bist du nur durch Verträge;< Ein Appell, welcher auch heute immer noch Gültigkeit hat!
Als Wotans Gattin Fricka steht Christel Loetzsch auf der Bühne. Sie verkörpert, ganz im Sinn der Regisseurin, die liebende Gattin, ohne dabei unterwürfig zu erscheinen. Ganz im Gegenteil: Fricka ist der Archetypus der modernen Frau, ohne aufdringlich feministisch zu wirken. Ihre Gestik, Mimik und Körpersprache unterstreichen ihren Anspruch auf Gleichberechtigung. Ihre Intonation und Diktion sind makellos, ihre Höhen ohne Schärfe, ganz im Sinne Wagners, welcher den Part für einen tiefen Sopran geschrieben hat.

Sehr interessant ist die Rolle Loges interpretiert: Loge ist nur Halbgott und weiss nicht so recht, ob er lieber Mensch oder Gott ist. Dieser Zwiespalt wird durch Marco Jentzsch hervorragend dargestellt. Dazu kommt, dass Jentzsch gekonnt auch seinen Zynismus zeigt, ohne dass dieser auf seine Mitspielerinnen und Mitspieler verletzend wirkt. Sein klarer Tenor überzeugt von Anfang bis Schluss. Seine Diktion und seine Intonation ohne jede Einschränkung Weltklasse. Seine Körpersprache, Mimik und Gestik, kurz seine schauspielerische Begabung lassen einen Loge auf der Bühne erstehen, wie man/frau ihn selten erleben kann. Seine Interpretation ist derjenigen von Gerhard Stolze mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan gleichzusetzen. (Gesamtaufnahme 1967) Überzeugt hat auch die junge südafrikanische Sopranistin Masabane Cecilia Rangwanasha als Freia mit ansprechender Intonation und Diktion.

Eher farblos erschien Mime, interpretiert vom polnischen Tenor Michal Proszinsky. Das kann allerdings auch an der Inszenierung hängen, da parallel zu seinem Auftritt auch die Tänzer auf der Bühne zu sehen waren. Seine Intonation und Diktion waren sehr gut. Mimik und Gestik kann aus obenerwähntem Grund nicht beurteilt werden.
In weiteren Rollen zu sehen und hören: Als Donner Gerardo Garciacano, als Froh Filipe Manu und als Erda Veronika Dünser.
Das Berner Symphonieorchester unter der Leitung von Nicholas Carter interpretierte die bearbeitete Orchesterfassung von Gotthold Ephraim Lessing gekonnt und mit der nötigen Dynamik und Präzision. Wobei diese Fassung nicht an das Original Wagners heranreicht. Die Wahl Carters kann ich nachvollziehen, bin aber der Auffassung, dass das Original auch Platz gefunden hätte. Freiburg hat unter Barbara Mundel in der Regie von Frank Hilbrich den Ring mit der Originalpartitur produziert. Das Dirigat übernahm Fabrice Bollon. In Freiburg ist der Graben nicht wesentlich grösser als in Bern.

Der Versuch, mit Tänzern die Handlung zu unterstreichen und zu beleben, ist in meinen Augen für das Werk Wagners verfehlt, nicht zielführend, und stört die von Wagner so plastisch geschriebenen Verwandlungsmusiken durch unnötige Hektik auf der Bühne. Die einzige Szene, in der dies noch angeht, ist nach meinem Dafürhalten die erste Szene, in welcher drei alter Egos der Rheintöchter Alberich verführen und necken, während Wellgunde (Evgenia Asanova), Woglinde (Giada Borelli) und Flosshilde (Sara Mehnert) die Gesangspartien bestreiten.
Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die Leistung des gesamten Ensembles mit langanhaltendem Applaus.
Peter Heuberger, 16.12.2021
© Rob Lewis
DON CARLOS
Regie: Marco Storman
Musikalische Leitung: Nicholas Carter
Premiere: 16. Oktober 2021
Besuchte Aufführungen: 28. November und 5. Dezember 2021

Die Bühnen Bern haben es auf sich genommen, die französische, eher selten gespielte Version von Verdis >DON CARLOS< auf die Bühne zu bringen. Diese Version ist gewöhnungsbedürftig, eignet sich doch die französische Sprache meine Meinung nach nicht unbedingt für klassische Opern, dies im Gegensatz zu anderen Musikgattungen wie Chanson zum Beispiel.
Das Berner Symphonieorchester, Stabführung Nicholas Carter, brillierte mit herausragender Präzision, wunderbarer Farbigkeit stimmiger Dynamik, nie zu laut und nie zu leise, und bildete so für den Chor, die Solistinnen und Solisten auf der Bühne das musikalische Fundament.

Unter der Regie von Marco Storman entwickelte sich Schillers Drama, vertont von Giuseppe Verdi, logisch und verständlich. Dabei, und das ist nicht der Regie anzulasten, fehlt in grossem Masse die Interaktion zwischen den Sängerinnen und Sängern. Die fiel vor allem in den Duetten zwischen Rodrigue, Marquis de Posa (Gustavo Castillo) und dem Infanten Don Carlos, dem Neapolitaner Raffaele Abete auf. Abete singt hervorragend, intoniert sauber, seine Diktion ist ansprechend, dagegen lassen seine schauspielerischen Fähigkeiten zu wünschen übrig. Es reicht heute einfach nicht mehr, nur zu singen und an der Rampe zu stehen. Auch die Mimik, Gestik und Körpersprache sollte stimmen, denn nur so entstehen Interaktionen zwischen den Protagonistinnen und Protagonisten.

Viel besser gefällt Philippe II, gesungen und gespielt vom Bassisten Vazgen Gazaryan. Seine Interpretation > Sie hat mich nie geliebt<, ist hervorragend interpretiert, wobei den Sänger eindeutig der französische Sprachduktus, Sprachrhythmus stört. Seinen Auftritten mit Rodrigue und Elisabeth fehlt es nicht an ansprechender Interaktion. Elisabeth de Valois wird gesungen und gespielt von der jungen Südafrikanerin Masabane Cecilia Rangwanasha. Sie interpretiert ihre Rolle feinfühlig aber zwingend und ist, ungewollt, ganz Königin von Spanien. Ein absolutes Highlight in dieser Inszenierung ist die aus Sofia stammende Mezzosopranistin Jordanka Milkova. Ihr Singen, ihre schauspielerische Leistung, Ihre Diktion, Körpersprache, Mimik und Gestik lassen keine Wünsche offen. Mehr ist dazu nicht zu sagen!

Der Chor der Bühnen Bern, einstudiert von Zsolt Czetner, meistert seine Aufgabe präzise und musikalisch makellos, dies trotz der Covid Masken!
Die Bühne, entworfen von Frauke Löffel und die Kostüme, gezeichnet von Axel Aust entsprechen der Inszenierung und helfen der Regie ohne Umbauten die fünf Akte spielen zu lassen. So bleibt die Spannung erhalten.
Der Schlussapplaus war seltsamerweise eher verhalten, dies ganz im Gegensatz zum, leider immer wieder üblichen Szenenapplaus.
Peter Heuberger
© Janosch Abel
DIE SCHMUTZIGEN HÄNDE
von Jean Paul Sartre
Regie: Sophia Aurich Premiere: 26. April 2021 Bühne Vidmar 2
Besuchte Vorstellung (Dernière): 17. Oktober 2021
Die Thematik des Werks von Jean Paul Sartre, >LES MAINS SALES< (Uraufführung 2. April 1948 - Die Schmutzigen Hände) ist auch heute hochaktuell. Der politische Pragmatismus führt viele, alle politischen Menschen, und wer ist nicht politisch, dazu, sich in aus Zweckmässigkeit die Hände zu beschmutzen. Es geht dabei nicht nur um juristisch nachvollziehbare Handlungen, es ist die ewige, nicht abzuschliessende Fragestellung nach Gut und Bös, richtig oder falsch. Die Frage: Für Wen oder Was?

Die Regisseurin Sophia Aurich hat mit den Dramaturginnen Myrta Bonderer und Margrit Sengebusch das Werk Sartres in eine moderne Form gebracht und dies auf der Bühne schlüssig inszeniert. Die Verwendung von zusätzlichen Texten, so zum Beispiel von Sartres langjähriger Partnerin, Simone de Beauvoir. Die Schmutzigen Hände wurde nach der Uraufführung von Links angegriffen und von Rechts aus demselben Grund gefeiert. Der politische Pragmatismus Höderers stiess bei den Linken und Kommunisten auf Ablehnung, weil die mögliche Spaltung der Partei im Raume stand. Und genau dies gefiel und gefällt der politischen Rechten.
Die heutige Parteienlandschaft ist zwar recht unterschiedlich und heterogen gestaltet, die politischen Ansichten prallen aber immer noch heftig aneinander. Mit Pragmatismus macht sich auch heute noch jeder Politiker die Hände, nach Jean Paul Sartres Definition, schmutzig. Und dies gilt nicht nur für Politiker und Politikerinnen, sondern auch, und dies in wirtschaftlich/ökonomischer Hinsicht für die gesamte Menschheit!

Die Personen und Ihre Darsteller:
HÖDERER : Gabriel Schneider, HUGO: Luka Dimic, OLGA: Milva Stark, JESSICA: Gina Lorenzen, LOUIS, SLICK, KARSKY: Stefano Wenk
Die Regisseurin arbeitet gekonnt mit Rückblenden und Gegenwartsszenen. Die Rückblenden werden im Stil «Big Brother is watching» beobachtet. Die schauspielerische Leistung des gesamten Teams , die Diktion und Sprachverständlichkeit, Mimik und Körpersprache müssen als hervorragend bezeichnet werden.

Die Bühnen Bern zeigen eine zwingende Darstellung des Schauspiels aus dem Jahr 1948, welches auch heute, 2021, in der Schweiz noch so aktuell ist wie in Frankreich 1948 und aktuell auf viele Jahre hinaus bleiben wird.
Peter Heuberger, 31.10.21
Fotos © Florian Spring
POLNISCHE HOCHZEIT
«Es bleibt Dir treu, nur Dein Hund und der Wein»
Wie so viele andere Veranstalter auch, musste die Berner Sommeroperette ihre für 2020 geplante Produktion des Zigeunerbarons auf das Jahr 2022 verschieben. Um die Wartezeit zu überbrücken hat man sich entschieden drei konzertante Aufführungen der Polnischen Hochzeit von Joseph Beer (1908-1987) zu spielen. Michael Kreis, Spiritus rector der Berner Sommeroperette, hat das 1937 am Zürcher Stadttheater (heute Opernhaus Zürich) uraufgeführte Stück im Lockdown entdeckt und jetzt die Schweizer Erstaufführung seit 1939 initiiert. Und diese Tat kann nicht hoch genug gelobt werden.
Der Komponist Joseph Beer wurde im Mai 1908 in Chodorow nahe Lemberg (heute Lwiw, Ukraine) als Sohn eines Bankiers und einer jüdischen Mutter geboren. Beers Mutter entdeckte die musikalische Begabung ihres Sohns bereits in der Kindheit, als er zur Niederschrift seiner Kompositionen ein Notensystem zu entwickeln versuchte. Auch wenn Beer parallel zum Gymnasium in Lemberg das dortige Konservatorium besuchen durfte, hatte ihn sein Vater zum Studium der Jurisprudenz bestimmt. Nach einem Jahr aber konnte Joseph seinen Vater überzeugen, ihm das Ablegen der Aufnahmeprüfung an der Wiener Staatsakademie für Musik (heute Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) zu erlauben. Als Joseph bestand, die ersten vier (!) Jahre überspringen konnte und gleich in die Meisterklasse des Komponisten Joseph Marxaufgenommen wurde, war auch der Vater überzeugt. Nach dem Abschluss des Studiums 1930 wurde Beer von der Wiener Ballett-Kompanie Rainer Simons, die Tourneen durch Österreich, Europa und den Mittleren Osten machte, als Chorleiter und Dirigent angestellt. Auf einer dieser Tourneen wurde Beer in Palästina von einem komponierenden Kollegen gebeten, einige seiner Kompositionen dem Librettisten Fritz Löhner-Beda vorzuspielen. Als Beer aus diesem Grund bei Löhner-Beda war, bat er auch darum eigene Kompositionen vorspielen zu dürfen. Von den Kompositionen des Komponisten aus Palästina war Löhner-Beda nur mässig begeistert. Von den Werken Beers dagegen so sehr, dass er sich ihm als Librettist und Agent zu Verfügung stellte. Damit erhielt Beers Karriere einen gewaltigen Schub, denn als führender Librettist seiner Zeit machte Löhner-Beda Beer mit allen wichtigen Leuten bekannt. So konnte er seinen Operetten-Erstling, den «Prinz von Schiras» am 31. März 1934 am Stadttheater Zürich uraufführen. Der Startenor Richard Tauber sass im Publikum, die Uraufführung wurde auf Mittelwelle am Radio übertragen. Wahrscheinlich sass Familie Beer in Chodorow am Radio. Ebenfalls am Stadttheater Zürich, am 26. April 1937, wurde Beers zweites Werk, die Polnische Hochzeit uraufgeführt. Als auch dies ein Grosserfolg wurde, übersetzt in acht Sprachen und mit vierzig Folgeproduktionen, planten das Pariser Châtelet und das Theater an der Wien Produktionen mit Martha Eggert, Jan Kiepura und Richard Tauber. Nun aber beendete die Geschichte jäh Beers Karriere.
Mit dem Anschluss Österreichs ans Dritte Reich wurden die Pläne der Aufführung der Polnischen Hochzeit am Theater an der Wien obsolet. Die sofortige Übernahme und Anwendung der Rassengesetze hatte fatale Auswirkungen nicht nur auf Beer sondern auf den ganzen Bereiche der Operette bis hin zu den Verlagen. Maurice Lehman, Direktor des Théâtre du Châtelet verschaffte Beer ein Visum für Frankreich. Bis Deutschland 1940 Paris besetzte, hielt sich Beer mit der Erstellung von Arrangements von Orchesterwerken über Wasser und schrieb sich an der Sorbonne ein. Mit Kriegsbeginn hatte sich die Chance der Aufführung der Polnischen Hochzeit am Châtelet zerschlagen. 1940 floh er dann zu seinem Bruder Joachim nach Nizza, die Pläne einer Emigration in die USA hatten sich zerschlagen, und tauchte bis Kriegsende in Nizza unter. Nach dem Krieg gelang es Beer nicht seine Karriere fortzusetzen. Zur Ermordung von Vater, Mutter, Schwester und Löhner-Beda im KZ Auschwitz kam die Frustration über die Beschlagnahmung der Tantiemen durch das Dritte Reich und die ausgebliebene Entnazifizierung im Musikwesen und der Misserfolg von «Stradella in Venedig», als «Stradella» am 23. November 1949 am Stadttheater Zürich uraufgeführt: Beer zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, heiratete die Holocaust-Überlebende Hanna Königsberg und lebte in Nizza. 1966 doktorierte Beer («Die Entwicklung des harmonischen Stils in den Werken von Scriabin») an der Sorbonne. Bis zu seinem Tod am 23. November 1987 arbeitete Beer an seinen Spätwerken «Mitternachtssonne» und «La Polonaise» (Überarbeitung der «Polnischen Hochzeit»): er blieb sein Leben lang, trotz widrigsten Umständen, der Musik, die ihm auch die schwierigsten Zeiten half, treu.
Wenige Wochen vor der Uraufführung des Prinzen von Schiras erlebte Lehárs Alterswerk «Giuditta» an der Wiener Staatsoper seine Uraufführung. In diesem Umfeld galt Beers Erstling als Überraschungswerk und Beer wurde die Fähigkeit zugeschrieben, den auf dem Gebiet der Operette anstehenden Generationenwechsel herbeizuführen. In der Polnischen Hochzeit, der einzigen Zusammenarbeit von Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald für einen anderen Komponisten als Paul Abraham, verdichten sich alt und neu in der einzigartigen Musik Beers nochmals. Folkloristische Buffo-Duette im Stile Kalmans wechseln sich mit opernhaften Finali in der Weise Lehárs und den unwiderstehlichen Tanz-Schlagern Abrahams ab, Jüdische Folklore, Klezmereinflüsse, Stepp-Tanz, Jazz und Walzersentimentalität bilden eine Mischung, die dem Zuhörer lange nicht aus dem Kopf geht. Der junge polnische Freiheitskämpfer Boleslaw ist unverkennbar ein Bruder des Millöckerschen Bettelstudenten, die Gutsverwalterin Suza eine Schwester der Helena aus dem Nedbalschen Polenblut und das Milieu erinnert an Kálmáns Gräfin Mariza. Dass sie sich allen Schemata und Einordnungen entzieht, ist das Charakteristikum der Musik der Polnischen Hochzeit.
Das Orchester der BernerSommerOperette unter der Leitung von Michael Kreis setzt Beers Musik schmissig und viel Gefühl für ihre Charakteristika um und reisst sofort mit. Michael Feyfar und Rebekka Maeder als Graf Boleslav und Jadja überzeugen mit ihren wunderbaren Stimmen von Anfang an als jugendliches Liebespaar. Wolf Latzel gibt einen herrlich blasierten Grafen Staschek. Die Entdeckung des Abends ist Kathrin Hottiger, die als Suza mit grossartiger Bühnenpräsenz Staschek mehr als nur Paroli bietet. Simon Burkhalter, der auch die Textfassung erstellt hat, gibt mit wunderbar kernigem Bariton den Gutsbesitzer Baron Oginsky. Erwin Hurni ist der Gutspraktikant Casimir. Martin Schurr führt als Conférencier durch den Abend.
Hier lässt sich ein Stück Operettengeschichte, das man lange nicht vergessen wird, hautnah erleben!
Weitere Aufführungen im Sternensaal Bern-Bümpliz:
Freitag, 10.09.2021, 19:30; Sonntag, 12.09.2021, 16:00.
17.09.2021, Jan Krobot
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
OPERNFREUND CD TIPP

Eine 5 Sterne Aufnahme - via u.a. Amazon noch lieferbar
Auszug Akt 1 - "In der Heimat" bitte mal reinhören! Ein wirklich hörenswertes, leider zu Unrecht vergessenes Stück. (PB)
Hier die gesamte Operette als konzertante Aufführung des Bayerischen Rundfunks von 2015 - Danke an Youtube.
Und noch ein Trailer der Oper Graz - anno 2019
OTELLO
Premiere: 10. Oktober 2020
Es ist der Regisseurin und dem musikalischen Leiter zu verdanken, dass trotz der Beschränkungen durch die vom Staat vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen ein relativ langes Werk wie Verdis Otello auf der Berner Bühne Premiere feiern konnte. Leider musste der Operndirektor Xavier Zuber an der Premiere eine weitere Einschränkung bekannt geben: Berns Otello, der aus Mexiko stammende Sänger Rafael Rojas war indisponiert und konnte nur spielen, nicht aber singen. Er wurde sängerisch gedoubelt vom australischen Tenor Aldo di Toro.

Im Ganzen gesehen kann die Produktion der Regisseurin Anja Nicklich als handwerklich solide Arbeit bezeichnet werden. Frau Nicklich inszeniert Verdis Otello in konventioneller Art ohne neue Aspekte des Werkes aufzudecken. Die Spielleiterin auf die Frage nach dem Aussenseitertum Otellos:“Es ist das Prinzip des Spiegels. Wie reagieren die anderen Figuren auf Ihn“. In der Regie in Bern sind auf dieses Aussenseitertum keine Reaktionen zu spüren. Otello ist für alle ein Held, einer der Ihren. Die Ausgrenzung im dritten Akt ist nicht auf den “Mohr von Venedig“ zurückzuführen, sondern auf die Misshandlung von Desdemona durch Otello. Otello ist in Bern nicht als Schwarzer dargestellt, sondern als Venezianer, als General im Dienst der Dogen.
Viel besser charakterisiert und unterstrichen durch seine Körpersprache, durch seine Mimik und Gestik, ist Jago, gespielt und gesungen durch den aus Hawaii stammenden Bariton Jordan Shanahan. Dies gilt auch für die Darstellerin der Desdemona, der Sopranistin Evgenia Grekova, Ensemblemitglied des Konzerttheaters.

Auch in Bern wird, wie in den meisten Produktionen von Otello, nicht herausgearbeitet, dass der Antagonist von Jago nicht Otello, sondern Desdemona ist. Sie sollte nicht nur als Mensch dargestellt werden, sondern auch als Verkörperung des Guten, der Liebe und der Duldsamkeit. Jago dagegen ist das Böse, Zerstörerische, immer mehr Wollende. Beide stehen also auch für die übergeordneten Prinzipien auf der Bühne. Otello dagegen steht als Nur-Mensch in der Mitte zwischen Gut und Bös. Er wird von Jago instrumentalisiert, zur Eifersucht aufgestachelt und ermordet schlussendlich das Gute, also Desdemona und sich selbst, den Menschen. Was gewinnt Jago dadurch: Nichts als Mensch, alles dagegen als Prinzip des Bösen. Böse sein ist Jagos Lebenszweck, dies übrigens im Gegensatz zu anderen Figuren von Shakespeare, welch zwar böse sind, dies aber nur unter Zwang werden. Am Schluss der Oper wird Jagos Intrige zwar aufgedeckt, bleibt aber für ihn selbst ohne Folgen.
Jago, Shakespeares Bösewicht, ist das Böse selber. Dies im Gegensatz zu vielen Charakteren bei Shakespeare, welche durch äussere Umstände Bösewicht wurden. Zwei Zitate dazu können dies aufzeigen: Und darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese fein beredten Tage bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden und feind den eitlen Freuden dieser Tage. (Richard III, erster Akt, Szene 1, Monolog Gloster)

Ich bin ein Bösewicht, weil ich ein Mensch bin und fühle den Schlamm meines Ursprungs in mir! Ja, das ist mein Glaube! Ich glaube mit festem Herzen, so wie die Witwe im Tempel, dass ich das Böse, das ich denke, das von mir ausgeht, als mein Schicksal erfülle! (Aus Otello Jago, Libretto von Arrigo Boito, 2. Akt, Szene 1)
Der Bösewicht Jago ist bei Shakespeare wesentlich subtiler charakterisiert als in Boitos Libretto.
Der ukrainische Tenor Nazariy Sadivskyy gibt den Cassio sängerisch hervorragend. Seine schau-spielerische Leistung bleibt jedoch weit hinter seiner hervorragenden musikalischen Interpretation der Rolle zurück. In weiteren Rollen zu sehen und hören: Andries Cloete als Roderigo, Young Kwon als Lodovico, Montano wird interpretiert von Philip Mayer und eine sehr gute Emilia gibt die Mezzosopranistin Sarah Mehnert.
Als hervorragend ist auch die Arbeit des Chores zu erwähnen, an Arbeit mangelt es in Verdis Otello für den Chor nicht. Aufgrund der behördlichen Vorgaben musste der Chor mit Gesichtsmasken singen. Mein Eindruck war, dass dies den Gesang der Sängerinnen und Sänger nicht wesentlich beeinflusste. Die Einstudierung der grossen Chorpartien wurde von Zsolt Czetner besorgt. Der Entwurf der Bühne stammt von Janina Thiel, die Kostüme zeichnete Gesine Völlm.

Das Berner Symphonieorchester musizierte unter der Leitung von Matthew Toogood. Für den Dirigenten war dies die erste Begegnung mit dem Spätwerk Verdis. Ich empfand sein Dirigat eher zu dramatisch, zu stark auf die musikalischen Effekte zugeschnitten. Seine Zusammenarbeit mit der Bühne, das Eingehen auf den Chor und die Solisten auf der Bühne ist vorbildlich und kann einigen anderen Orchesterleitern als Vorbild dienen.
Das zahlreich erschienene Premierenpublikum, darunter erfreulich viele junge Besucherinnen und Besucher, belohnten den Abend mir rauschendem Applaus. Das Haus war trotz der Sicherheitsvorschriften praktisch ausverkauft.
Peter Heuberger, Basel
Bilder © Annette Boutellier
Programmvorschau 2020/2021
OTELLO GIUSEPPE VERDI Stadttheater 10. Oktober 2020
Musikalische Leitung: Matthew Toogood Regie: Anja Nicklich,
DIE FLEDERMAUS JOHANN STRAUSS Stadttheater 22. November 2020
Musikalische Leitung: Enrico Delamboye Regie: Alexander Kreuselberg
JENŮFA LEOŠ JANAČEK Stadttheater 17. Januar 2021
Musikalische Leitung: Matthew Toogood Regie: Eva-Maria Hockmayr
NORMA VINCENZO BELLINI Stadttheater 06. März 2021
Musikalische Leitung: Enrico Calesso Regie: Adriana Altaras
THE RAPE OF LUCRETIA BENJAMIN BRITTEN Stadttheater 17. April 2021
Musikalische Leitung: Matthew Toogood Regie: Andrea Moses
PARSIFAL RICHARD WAGNER Stadttheater 06. Juni 2021
Musikalische Leitung: Mario Venzago Regie: Matthew Wild
REQUIEM W.A. MOZART Stadttheater 03. April 2021
Chorkonzert zu Ostern
Auch im Sprechtheater des Konzerttheaters Bern sind einige interessante Produktionen zu sehen. Nachstehen nur einige wenige Stücke aus der Programmvorschau.
ULYSSES JAMES JOYCE Regie: Sebastian Klink
FRÄULEIN JULIE AUGUST STRINDBERG Regie: Alexandra Wilke
ONKEL WANJA ANTON TSCHECHOW Regie: Kieran Joel
DIE SCHMUTZIGEN HÄNDE JEAN-PAUL SARTRE Regie: Sophia Aurich
Und als Wiederaufnahme neben vielen Anderen die ausgezeichnete Berner Produktion
DER GROSSE DIKTATOR CHARLIE CHAPLIN Regie: Cihan Inan
Der LINK für das ganze Programm: www.konzerttehaterbern.ch
Die ganze Programmvorschau ist ab sofort online abrufbar!
Peter Heuberger, Basel 17.5.2020
Arthur Miller
TOD EINES HANDLUNGSREISENDEN
Premiere: 15. Februar 2020
Besuchte Vorstellung: 20. Februar 2020
Das Schauspiel von Arthur Miller in der deutschen Fassung von Volker Schlöndorff hat nichts von seiner Aktualität verloren. Das Werk wurde 1949 zu Beginn der McCarthy-Ära uraufgeführt. Miller, der 1953 in seinem Theaterstück Hexenjagd die Hetze der McCarthy-Ära kaum verhohlen kritisiert hatte, wurde 1956 von der Untersuchungsbehörde “Committee on Government Operations“ vorgeladen. Er erschien in Begleitung seiner Frau Marilyn Monroe und weigerte sich, irgendwelche Namen von Weggefährten zu nennen. Arthur Miller wurde verurteilt und legte Berufung ein, welcher schlussendlich 1958 vom Appellationsgericht in Washington stattgegeben wurde.

Dies könnte auch unter der heutigen amerikanischen Administration geschehen. Die sozialen Missstände in Amerika haben sich in den letzten 71 Jahren für einen grossen Teil der Bevölkerung Amerikas nur unmerklich verbessert. Der “AMERICAN DREAM“, vom Tellerwäscher zum Millionär, wird von Donald Trump zwar beschworen aber ad absurdum geführt. Die amerikanischen Militärausgaben steigen ins unermessliche, Steuern für Reiche werden gesenkt und dafür die Sozialleistungen für grosse Teile der Bewohner der USA gekürzt oder gleich ganz gestrichen.
Die Personenführung des Regisseurs Gerd Heinz legt grossen Wert auf die Übereinstimmung von Text mit der Körpersprache, der Mimik und der Gestik. Dies ist ihm bei seinem Bühnenteam hervorragend gelungen. Dazu kommt, dass er die gesamte Tiefe und Breite der Berner Bühne als Spielort verwendet.

Interessant ist auch die dramaturgische Darstellung der Zeitsprünge, welch von der Gegenwart in die Zukunft und wieder zurück in die Gegenwart pendelt und im Tode Willy Lomans endet. Eigentlich erlebt die Zuschauerin, der Zuschauer das Stück als ein “Memento Mori“, als eine Rückerinnerung.
Was auffällt, ist der fehlende Bezug zur heutigen Zeit sowohl im politischen als auch im gesellschaftlich/sozialen Kontext. Gerd Heinz zeigt ein Frauenbild aus dem Jahr 1949. Die #MeToo 2019 Bewegung aber hat auf die Regie keinen Einfluss gehabt. Ebenfalls wird ausgeklammert, dass sich die amerikanische Gesellschaft zwar verändert hat, dass aber die soziale Ungleichheit, Ungerechtigkeit heute ebenso gross ist wie nach dem zweiten Weltkrieg. Vom Dramaturgen hätte man sich eine modernere Aufarbeitung des Werkes erwartet. Schade!

Die Schauspielerinnen und Schauspieler interpretieren ihr Rollen innerhalb der in der Spielanlage gesetzten Grenzen ausgezeichnet. Speziell fällt dabei allen voran Jürg Wisbach als Kaufmann Willy Loman und Chantal Le Moign als dessen Frau Linda. Da wird auf hohem Niveau Theater gemacht. Gut gefallen haben auch die beiden Söhne, Luka Dimic spielte den kritisch eingestellten Sohn Biff Loman und Gabriel Schneider als Happy Loman. Speziell erwähnenswert ist die live gespielte Bühnenmusik, komponiert und auf dem Tenorsaxophon interpretiert von Marc Stucki.
Die Bühne und die Kostüme wurden von Lilot Hegi entworfen. Das stimmige Lichtdesign stammt von Christian Aufderstroth.

“DAS IST EINE ZEITBOMBE UNTER DEM AMERIKANISCHEN KAPITALISMUS“ (Zwischenruf bei der Uraufführung am Broadway) Nun, diese Zeitbombe hat im Jahr 2020 in Bern nicht gezündet.
Das Publikum belohnte die Arbeit mit dem verdienten Applaus vor allem für die hervorragende schauspielerische Leistung.
Peter Heuberger, Basel
© Annette Boutellier
MADAMA BUTTERFLY
Premiere: 19. Januar 2020
Besuchte Vorstellung: 22. Januar 2020

Die sechste Oper Puccinis, Madama Butterfly (Tragedia giapponese), spielt laut dem Original-Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica. in Japan, in Nagasaki zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es basiert auf der Erzählung Madame Butterfly (1898) von John Luther Long und der Tragödie Madame Butterfly (1900) von David Belasco.
Die Musik Puccinis verurteilt die Überheblichkeit der westlichen Hemisphäre im auslaufenden 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel in Pinkertons Arie "Dovunque al mondo", untermalt mit Zitaten aus der Marinehymne "The Star-Spangled Banner". Diese Arroganz ist auch heute noch vorhanden. Nur ist es nicht mehr eine rein westliche Arroganz, auch asiatische Nationen haben die ausbeuterische, kapitalistische Auffassung von "Entwicklungshilfe!?" des Westens übernommen.
Der britische Regisseur und Bühnenausstatter, Nigel Lowery, inszeniert im Konzerttheater Bern Madama Butterfly. Regie und Bühnenausstattung sind zwei Paar Schuhe. Wenn diese Schuhe von der gleichen Person getragen werden, besteht die Möglichkeit, wie hier in Bern, dass das Resultat suboptimal ist.

Die Spielanlage möchte den amerikanischen Kolonialismus, die neu erwachte Lust der USA auf die Weltherrschaft im Jahre 1854 kritisch betrachten. Dieser Ansatz ist Lowery gründlich misslungen. Es reicht einfach nicht, die Bühne mit Chormitgliedern und Statisten als "Uncle Sam" verkleidet auf der Bühne sinnlos herumwuseln zu lassen. Diese Kritik muss durch die Protagonistinnen und Protagonisten mit guter schauspielerischer und emotional stimmigem Gesang dargestellt und verstärkt werden. Dies bedingt eine zielführende Regie und eine entsprechende musikalische Unterstützung. Die Personenführung des Regisseurs verfehlte den Anspruch bei Weitem, so dass die zu erzählende Geschichte nicht wirklich zu sehen, zu spüren war.
Erschwerend dazu kommt, dass der Dirigent, Péter Halász, die Musik Puccinis zu bombastisch, zu schwer und laut interpretierte. Die beiden Hauptdarsteller, Cho-Cho-San, genannt Butterfly, (Lana Kos) und B. F. Pinkerton (Xavier Moreno) sangen zwar melodiesicher, aber zu oft an der Rampe, zu solistisch ohne erkennbare Interaktion zwischen der verliebten Butterfly und dem zynischen Marine-Leutnant Pinkerton. Ein Liebesduett, auch wenn ein Partner ein Zyniker ist, klingt für mich anders, subtiler, mit mehr Emotionen. Dies Alles gilt vor allem für den ersten Akt, vor und während der "FAKE" Hochzeit der beiden Hauptdarsteller.

Musikalisch wesentlich besser herausgearbeitet sind die Emotionen von Butterfly und der Dienerin Suzuki (Eleonora Vacchi) im zweiten und dritten Akt. Aber auch hier lässt die Personenführung, die Regie Lowerys zu wünschen übrig. Dazu kommt, dass der Dirigent den Sängerinnen und Sängern nur wenige Freiheiten erlaubt, welche in zwingende musikalische Auslegungen münden könnten.
Das Berner Symphonieorchester interpretierte, geleitet vom ungarischen Dirigenten, Puccinis Musik präzise, wenn auch die Lautstärke oft an der oberen Grenze lag. Der ungarischen Interpretation von Puccinis Musik mangelt es etwas an Feingefühl. Dies ist dem Dirigat zuzuschreiben. Weniger (Lautstärke) wäre oft mehr. Es scheint, dass leise Töne, subtile Interpretation nicht unbedingt Halász's Stärke sind.
Der katalanische Tenor Xavier Moreno als Pinkerton intoniert sauber, seine Diktion ist makellos. Seinem Spiel als selbstbewusster Marineleutnants aus Amerika fehlt die schauspielerische Glaubwürdigkeit. Seine Mimik, Gestik und seine Körpersprache wirken aufgesetzt, sein Zynismus ist höchstens im Text des Librettos vorhanden, nicht aber in seinem künstlerisch perfekten Gesang. Er singt "Bel Canto", schönen Gesang, welcher ohne viel Emotionen daherkommt.

Auch die kroatische Sopranistin Lana Kos als Butterfly gibt ihre Rolle in der gleichen Art. Ihre Intonation und Diktion lassen nichts zu wünschen übrig. Ihre Höhen sind oft eher ein bisschen scharf und oft sehr laut. Auch ihre Mimik, Gestik und seine Körpersprache wirken künstlich, unglaubhaft. Ihre Bühnenpräsenz ist zwar stark, aber erinnert in ihren Bewegungen an das Bühnenideal der 1950er Jahre. All dies kann auch an der minimalistischen Personenführung liegen.
Das Berner Ensemblemitglied der Amerikaner Todd Boyce überzeugt auf der ganzen Linie als Konsul Sharpless. Seine schauspielerischen Fähigkeitenallerdings, welch in der Berner Bohéme als Marcello so gut zu verfolgen waren, werden vom Regisseur nicht voll ausgenützt. Ein erhobener Zeigfinger reicht einfach zu Charakterisierung einer Person nicht aus. Boyce ist ein ausgezeichneter Schauspieler, wenn man ihn lässt. Sein stilsicherer Gesang gefällt in jeder Hinsicht.
Dasselbe gilt für den südafrikanischen Tenor Andries Cloete. Auch er wird von der fast nicht vorhandenen Personenführung Lowerys ausgebremst und kann die Rolle des Heiratsvermittlers Goro nur teilweise ausspielen. Bei beiden Bühnenkünstlern verpasst die Regie Chancen zu optimalen Leistungen auf der Bühne.
In weiteren Rollen zu sehen und zu hören: Als Suzuki die Italienische Sopranistin Eleonora Vacchi und Réka Szabo als Kate Pinkerton. Dann Giacomo Patti als reicher Yamadori, Philipp Mayer gab den Onkel Bonzo und David Park spielte den kaiserlichen Kommissar.
Der Chor Konzerttheater Bern wurde einstudiert von Zsolt Czetner, für die Dramaturgie war Gerhard Herfeldt zuständig. Die Lichtführung besorgte Bernhard Bieri.
Das nicht sehr zahlreich erschienene Publikum belohnte die einzelnen Leistungen mit dem verdienten Applaus.
Peter Heuberger Basel
© Janosch Abel
Charlie Chaplin
DER GROSSE DIKTATOR
Deutschsprachige Erstaufführung
Regie / Bühnenfassung: Cihan Inan
Premiere: 19. Oktober 2019
Besuchte Vorstellung: 4. Dezember 2019

Es braucht viel Mut, um eines der Schlüsselwerke des grossen Schauspielers Charlie Chaplin, den Film "THE GREAT DICTATOR" als Schauspiel auf die Bühne zu bringen.
Cihan Inan, der Schauspieldirektor des Konzert Theater Bern hat bewiesen, dass dies möglich ist. Basierend auf dem Originaldrehbuch des Films hat er eine deutschsprachige Bühnenfassung erarbeitet, welche nicht hoch genug gelobt werden kann. Der Film ist so aktuell wie 1939 und die Berner Produktion unterstreicht diese auch für 2019 gültige politische, gesellschaftliche und sozio-ökonomische Aktualität. Sorgfältig fügt Inan kleine Anpassungen an die heutige Zeit ein, ohne die Handlung zu verändern. Bewusst will er mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern nicht die Figuren in Chaplins Film kopieren, sondern lässt seinem Bühnenteam die Freiheit, eigene Sichtweisen in die Handlung zu haben und diese auf der Bühne auszuleben, darzustellen.

Inan hat von der Familie Chaplin die Rechte und das Drehbuch des Films erhalten, welches nur die Dialoge, aber keine Regieanweisungen enthält. "Eine grosse Ehre", betont er. Die Chaplins wollten aber wissen, wie wir den Stoff umsetzen.
>Ich will eine Hommage an Charlie Chaplin und gleichzeitig dessen Idee neu denken< Cihan Inan bleibt mit seiner Inszenierung nahe an Chaplins Vorlage. Trotzdem werden sich die Zuschauerinnen, die Zuschauer in Hynkel-Hitlers Hassrhetorik auch an heutige Redner wie Donald Trump, Kim Jong Un und auch an einige Schweizer erinnern.
>Es geht darum, wie Populisten mit ihrer Sprache verführen und was wir dem entgegensetzen; wir müssen uns den Anstand im Umgang miteinander zurückholen<.

Um an den geschichtlichen Kontext des Originaldrehbuches zu erinnern, hat der Spielleiter die Person der Erzählerin eingefügt. Diese Rolle wird ausgezeichnet gespielt von Chantal Le Moign. Die Erzählung begleitet und unterstreicht das Spiel der ProtagonistInnen auf der Bühne. Der Text weist auf die geschichtlichen Ereignisse zwischen 1918 und 1941 in Europa hin. Diese Ereignisse, heute in der Erinnerung nicht mehr so präsent, bilden die Grundlage für den Originalfilm und auch für die in Bern gezeigte Bühnenfassung.
Die Schlussrede Hynkels wurde von Inan ein klein wenig auf die heutige Zeit zugeschnitten. So findet sogar das Internet und die sozialen Medien Platz darin. Nicht verändert wurde der Hynkels Appell an Humanismus und Mitgefühl, die Aufforderung Nationalismus und Ausgrenzung zu ächten.

Gabriel Schneider als jüdischer Friseur und Diktator Hynkel spielt seine Sichtweise der beiden Rollen in herausragender Weise. Er kopiert nicht Charlie Chaplin, sondern interpretiert die beiden Rollen für seine ZuschauerInnen neu. Und dies gilt nicht nur für Schneider, sondern auch für alle seine Mitspielerinnen und Mitspieler auf der Berner Bühne.
Der Regisseur hat bei allen Rollen in seiner Personenführung darauf geachtet, dass die dargestellten Personen nicht wie Kopien aus dem Film erscheinen, sondern als eigene Interpretationen auf der Bühne stehen. Dies ist dem gesamten Team in vorbildlicher Weise gelungen.
In den weiteren Rollen zu sehen: Hans-Caspar Gattiker, Jürg Wisbach, Stefano Wenk, Luise Schneider, Gabriel Noah Maurer und Gina Lorenzen.

Die Bühne stammt von Konstantina Dacheva, die Kostüme zeichnete Yvonne Forster. Für die Lichtführung zuständig war Bernhard Bieri und die Live Musik wurde gespielt von Daniel Stössel. Für die nicht einfache Dramaturgie verantwortlich: Adrian Flückiger.
Das sehr junge Publikum belohnte die Berner Produktion mit dem wohlverdienten lautstarken Applaus. Als Berichterstatter kann/darf/muss ich an die Adresse des Konzert Theater Bern schreiben: Bravi !
Peter Heuberger, 5.12.2019
Fotos © Annette Boutellier
Karol Szymanowski
KÖNIG ROGER
Premiere: 1. Dezember 2019 / Schweizer Erstaufführung
Die Oper handelt von der Erleuchtung des christlichen König Roger II durch einen jungen Hirten, der für heidnische Ideale steht. Die Komposition Szymanowskis spielt in Sizilien im 12. Jahrhundert. In seiner 1926 in Warschau uraufgeführten Oper erschafft der polnische Komponist Karol Szymanowski eine Klangwelt, die archaische Chorblöcke mittelalterlicher Strenge den dionysisch-ekstatischen Ausbrüchen des unergründlich Neuen gegenüberstellt und so Kulturen und Gegensätze auf einer ganzheitlich erfahrbaren Ebene aufeinanderprallen lässt. (Programmheft)

Da die Oper fast niemand kennt und sie auch nicht in allen Opernführern steht, macht eine Inhaltsangabe Sinn:
Während der Messe flehen die Geistlichen König Roger an, die christlichen Sitten vor den aufrührerischen Reden eines fremden Schäfers zu schützen. Der Hirte wird vorgeführt. Trotz der Forderung des Erzbischofs nach Bestrafung überzeugt Rogers Frau Roksana den König, ihn nicht töten zu lassen. Roger befiehlt dem jungen Mann, an diesem Abend im Palast zu erscheinen, wo er sich weiter erklären und auf das königliche Urteil warten soll.
Zweiter Akt: Der Hirte erscheint an den Palasttoren. Roksana singt ein verführerisches Lied, das eindeutig eine Reaktion auf den Besucher ist, und Roger wird zunehmend aufgeregt. Der Hirte beschreibt seinen Glauben im Detail. Bald folgt fast das gesamte Gericht ihm in einem ekstatischen Tanz.
Dritter Akt: Roksana erklärt ihrem Mann Roger, dass nur der Hirte ihn von seinen Ängsten und seiner Eifersucht befreien könne. Ein Feuer veranlasst den König und die Anhänger des Priesters neuerlich zu tanzen. Der Hirte verwandelt sich in Dionysos. Roger begrüßt den Morgen mit einer frohen Hymne.
In der Regie von Ludger Engels spielt die Oper in einer Zeit, welche dem heutigen politischen und sozialen Umfeld ähnlich ist. Der religiöse Aspekt der Handlung wird bewusst vordergründig, penetrant angesprochen. In der Person des Hirten wird dieser Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, auf absoluten Glauben in Frage gestellt. " Ein Revolutionär ist ein Mensch, welcher NEIN sagt" ist eine der Kernaussagen des Revolutionärs, des Führers in einen neuen Glauben. Dabei verlangt auch dieser neue Glaube, diese neue Freiheit eine absolute Nachfolge, welche wiederum Zwänge auferlegt. Das Werk ist zum Teil autobiografisch, hat doch Szymanowski sein Leben lang unter gesellschaftlichen und religiösen Konventionen gelitten, sich dagegen gesträubt. Das Berner Symphonieorchester unter der Leitung des Australiers Matthew Toogood interpretiert die Komposition Szymanowskis mit viel Empathie und herausragender Musikalität.
 Chorsingen hat in Polen, ganz allgemein in osteuropäischen Staaten eine lange Tradition. Der Chor spielt in Krol Roger eine wesentliche Rolle, ist er doch verantwortlich für den Fortgang der Handlung und ist als roter Faden ein wichtiger Teil der Dramaturgie.Der Chor Konzerttheater Bern, zusammen mit dem Kinderchor Singschule Köniz löst diese Aufgabe, welche auch schauspielerisches Können verlangte, mit Bravour. Einstudiert wurden die umfangreichen Chorpartien vom Berner Chorleiter Zsolt Czetner.
Chorsingen hat in Polen, ganz allgemein in osteuropäischen Staaten eine lange Tradition. Der Chor spielt in Krol Roger eine wesentliche Rolle, ist er doch verantwortlich für den Fortgang der Handlung und ist als roter Faden ein wichtiger Teil der Dramaturgie.Der Chor Konzerttheater Bern, zusammen mit dem Kinderchor Singschule Köniz löst diese Aufgabe, welche auch schauspielerisches Können verlangte, mit Bravour. Einstudiert wurden die umfangreichen Chorpartien vom Berner Chorleiter Zsolt Czetner.
Für den Zuschauer, die Zuschauerin stellt sich bei KROL ROGER die Frage, wer der Hauptdarsteller ist. Ist es der König? Oder ist es der Hirte? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Beide Figuren sind Hauptdarsteller: Protagonist ist König Roger und sein Antagonist, sein Gegenspieler ist bis zur Bekehrung Rogers der Hirte! Es ist aber auch die Umkehrung möglich. Dies ist die Freiheit der Regie, eine Freiheit welche auch in der Oper Szymanowskis beschworen wird! Rogers Reise nach innen zeigt in Engels Regie wie der Konflikt der Suche nach sich selbst mit dem Druck, sich der Norm zu fügen, konfrontiert wird.
Dieser Konflikt setzt die Bereitschaft voraus, sich verzaubern zu lassen, Ambivalentes, Ungewöhnliches zu akzeptieren. Das gilt für Roger in Krol Roger, gilt aber auch für die Besucher und Besucherinnen des Musiktheaters, vom Schauspiels, im Leben ganz allgemein! Die Personenführung Ludger Engels ist hervorragend. Dabei muss man sich klar sein, dass bei einer Oper mit so vielfältigen Choreinsätzen genau diese Personenführung sehr hohe Ansprüche an die Spielleitung stellt. Dazu kommt, dass Engels Ansprüche an Körpersprache, Mimik und Gestik hoch, sehr hoch sind. Das ganze künstlerische Team auf der Bühne entspricht diesen Ansprüchen vorzüglich. Die Inszenierung in Bern ist zeitgemäss, den heutigen sozio-ökonomischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst und zeigt auch auf wo eventuelle Defizite vorhanden sind. All dies ohne Aufdringlichkeit, ohne Mahnfinger, so dass sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch selber erkennen können.

Das Berner Ensemblemitglied Andris Cloete interpretiert die Rolle des Hirten sehr überzeugend. Er spielt die unterschiedlichen Facetten dieser Rolle mit einer Körpersprache und einer Mimik und Gestik, welche in dieser Qualität im Musiktheater nur selten bewundert werden können. Dazu kommt sein klarer Tenor, welcher auch die musikalische Interpretation der sehr anspruchsvollen Rolle des Hirten gerecht wird. Der Hirte ist ja einerseits Untertan Rogers, daher der Gerichtbarkeit des Königs unterworfen, andererseits ist er auch Führer einer revolutionären Bewegung, welche ebendiese Gerichtbarkeit, diesen patriarchalisch/absoluten Anspruch in Frage stellt, mit friedlichen Mitteln gewaltlos bekämpft.
Dasselbe gilt für seinen Gegenspieler König Roger: Die Interpretation des polnischen Baritons Mariusz Godlewski in seiner Zerrissenheit kann nicht genug gelobt werden. Vielleicht entspricht seine schauspielerische Leistung nicht ganz den westeuropäischen Ansprüchen, aber dies ist der Ausbildung in östlichen Regionen zuzuschreiben, welche traditionell den Schwerpunkt der Ausbildung auf das Singen legen. Trotzdem, sein Roger überzeugt von Anfang bis Ende!
Die Sopranistin Evgenia Grekova als Roksana brilliert mit überragender Intonation, klaren Höhen ohne Härte, ohne falsches Vibrato. Auch für ihre Mimik und Gestik, ihre Leistung als Schauspielerin gilt was ich bei Godlewski geschrieben habe.
Ich kann bei Sängerinnen und Sängern Diktion und Verständlichkeit nicht abschliessend beurteilen, klingt Polnisch für mich doch sehr fremd vor dem Ohr. Was ich hörte, war verständlich und klar. Ob dies auch für polnisch Sprechende zutrifft, weiss ich nicht.
In weiteren Rollen zu sehen und zu hören waren: Nazariy Sadivskyy als Edrisi, Young Kwon als Erzbischof und Sarah Mehnert in der Rolle der Diakonissin.
Die Bühne wurde von Ric Schachtebeck entworfen, die Kostüme zeichnete Heide Kastler. Für das Licht war Bernhard Bieri zuständig. Der Dramaturg Gerhard Herzfeld modernisierte das nahezu hundertjährige Libretto von Jaroslaw Iwaszkiewicz und Karol Szymanowski, so dass Ludger Engels eine zeitgemässe Sichtweise von Krol Roger auf der Berner Bühne inszenieren konnte.
Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die reife Leistung des gesamten Teams mit dem wohlverdienten langanhaltenden Applaus.
Peter Heuberger, 2.12.2019
Bilder (c) Theater Bern
Franz Hohler
CENGALO, DER GLETSCHERFLOH
Regie: Meret Matter Musik: Sybille Aeberli, Meret Matter, Chrischi Weber
UA Premiere: 15.11. 2019 Besuchte Vorstellung: 23.11.2019

Cengalo (Thomas U. Hostettler) ist Musiker, Hausmann und ein zufriedener Gletscherfloh. Menschen interessieren ihn nicht besonders, dafür hat er eine umso grössere Leidenschaft für Musik. Seine Gletscherfloh-Frau Cengala (Grazia Pergoletti) arbeitet in der Gletscherbank, wo sie die Gletscherwährung Eiszapfen verwaltet.
Ihre Kinder Cengalina und Cengalino, (Irina Wrona und Chrischi Weber), besuchen mit ihren Freunden Kät (Aline Beetschen) und Pät (Lukas Dittmer) die Gletscherschule. Beetschen und DIttmer studieren im HKB-Schauspielstudio der Hochschule für Künste in Bern.
Die Eltern von Kät und Pät lieben ihren Motorschlitten. Ökologie ist für die Rätters, Vater Ratter the Knatter (Stéphane Mäder) und Mama Rita (Sibylle Aeberli) ein Fremdwort.

Die beiden Familien erhalten Besuch aus den Fidschi Inseln. Fidschi (Cecilia Ngafor) und Fadschi (Pablo Conca) erscheinen frierend in den Gletscherhöhlen. Sie mussten aus Fidschi flüchten, weil dieses warme Inselparadies überflutet wurde.
Die Anlage dieser Kinderoper/Kinder-Schauspiels mit Musik entspricht in allen Teilen dem empfohlenen Minimalalter (6 Jahre). Interessant ist zu beobachten, dass die Kinder sehr gut mitmachen, wenn sie dazu aufgefordert werden, sonst aber der Handlung gespannt folgen und sich über die zwei Stunden sehr diszipliniert verhalten. In der Pause machen die Kleinen und weniger Kleinen den speziellen Hüpfgang der Gletscherflöhe nach.

Die Arbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne kann nur als hervorragend bezeichnet werden. Aufgefallen ist mir ganz speziell Aline Beetschen als Kät. Ihre Körpersprache überzeugt, ihre Mimik entspricht der Rolle. Oft hat sie ihren Partner Pät, gespielt von Lukas Dittmer, fast an die Wand gespielt. "Schau dass deine Partner gut sind, dann bist du auch gut" Dieser Satz wird Stanislawski zugeschrieben.
Alle Schauspielerinnen und Schauspieler sind in dieser Jugend/Kinderoper auch Sängerinnen und Sänger. Diese zusätzliche Herausforderung lösen die KünstlerInnen auf der Bühne mit Bravour. Die ganze Musik ist recht rockartig angelegt. Einige Songs kommen als RAP daher und sind in jeder Hinsicht dem Alter der jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauer angepasst.

Das Konzerttheater Bern bestätigt mit dieser Produktion den Willen, auch junges, sehr junges Publikum anzusprechen.
Der rauschende Schlussapplaus beweist den Erfolg dieser Uraufführung.
Peter Heuberger, Basel
© Annette Boutellier
SWAN
Drei neue Sichtweisen auf SCHWANENSEE
Choreografien: Jo Strømgren, Estefania Miranda, Ihsan Rustem
UA-Premiere: 2. November 2019

Das Konzert Theater Bern und seine Ballett-Direktorin haben es unternommen, eine andere Sichtweise, eine ungewöhnliche Interpretation der wahrscheinlich bekanntesten Ballett-Geschichte, nämlich "SCHWANENSEE", auf die Bühne zu bringen. Die Uraufführung des Ballettabends kann nur als sehr gelungen bezeichnet werden. Zwei Choreografen, der Norweger Jo Strømgren, der Engländer Isham Rustem sowie die Berner Tanzdirektorin Estefania Miranda zeigen in einem Ballettabend ihre Interpretation der Schwanengeschichte, welche auf uralten Mythen basiert.
Teil 1: DER UNERWARTETE GAST
Für seine Bilder vom schwarzen und weissen Schwan wählte der Choreograf und Bühnenbildner Jo Strømgren Musik des Norwegers Bergmund Skaslien. Er zeichnet ein poetisch romantisches Bild der Widersprüche, der Beziehungen zwischen schwarz und weiss, Yin und Yang, Gut und Böse. Bei ihm gibt es keinen Konflikt zwischen den ProtagonistInnen. Seine Tänzerinnen und Tänzer suchen ihre Individualität, ihr eigenes ich. Dabei wird der unerwartete Gast durch einen in Europa nicht heimischen schwarzen Schwan symbolisiert. Die Tanzcompagnie ist aufgeteilt in Schwarze und Weisse, Bewunderer des weissen, respektive schwarzen Schwans. Im Gegensatz zur Originalgeschichte aus dem Jahr 1877 gibt es in der Interpretation Strømgrens keine Feindschaft, sondern ein Miteinander, ein Suchen nach dem Partner, dem geeigneten Antagonist. Dies in Anlehnung an die Lebensweise der Schwäne, welche lebenslange Partnerschaften eingehen und diese erst durch den Tod getrennt werden.
Unter der Stabführung von Thomas Rösner unterstützt die eingängige, melodische Musik von Bergmund Skaslien, (Werk für Streichorchester und grosse Trommel) subtil und emotionell interpretiert vom Berner Symphonieorchester, die Intentionen und Darstellungsweise des Choreografen.

Die Kostüme (Bregje van Balen) und das Lichtdesign (Jonas Bühler) unterstreichen die märchenhafte Atmosphäre dieser Inszenierung. Die Gruppen Weiss und Schwarz, hervorragend getanzt von der Tanzcompagnie Konzert Theater Bern, überzeugten vom ersten Moment an und zogen die zahlreichen BesucherInnen, das Haus war ausverkauft, in den Bann der Handlung. ! BRAVI !
Teil 2: THE SIGN OF THE SWAN
In der klassischen Inszenierung von Schwanensee werden Odile (schwarzer Schwan) und Odette (weisser Schwan) meistens mit einer weissen Tänzerin besetzt. Dies um dem männlichen Anspruch auf gertenschlanke, hellhäutige Tänzerinnen zu entsprechen. Diversität und Gleichberechtigung fallen dieser Sichtweise zum Opfer. So sind dunkelhäutige Tänzerinnen im Theater noch stark in der Minderheit, dies im Gegensatz zu den dunkelhäutigen Tänzern. Die erste schwarze Odile/Odette war 2015 Misty Copeland vom American Ballet Theatre. Estefania Miranda inszeniert ihr Ballett, "DAS ZEICHEN DES SCHWANS", als Aufruf zur Gleichberechtigung, als Sinnbild der Universalität, der Gleichheit in der Diversität. Ihre ProtagonistInnen (Mahélys Beautes, Livona Ellis, Winston Ricardo Arnon, Yacnoy Abreu Alfonso) sind alle vier dunkelhäutig! Die tänzerische Arbeit dieses Tanzquartettes ist in seiner expressionistischen, schon fast exhibionistischen Ausführung beeindruckend und bringt den Anspruch Mirandas auf Gleichheit klar auf die Bühne.

So zum Beispiel die ähnliche Darstellung der Männer mit nacktem Oberkörper und der Tänzerinnen mit teilentblösstem Busen. Ich kann nur sagen: So subtil, unter die Haut gehend, muss eine Hinweis auf die heutige Ungleichheit in der sozio-ökonomischen Gesellschaft dargestellt werden. Nur so fühlen sich Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen, dargestellt! Als Musik, im Playback gespielt, wählte Miranda als Auftakt das Lied "My Heart's in the Highlands" von Arvo Pärt. Diese Musik geht über in eine für diese Inszenierung neue Komposition des Holländers Jorg Schellekens. Die Musikauswahl für diese Art von Ausdruckstanz ist stringent, speziell die Komposition des Musikers und Sounddesigners Schellekens (Märchen im Grand Hotel, Theater Luzern).
Teil 3: O / O
Der englische Choreograf Ihsan Rustem wählte für seine Sicht auf Schwanensee die wichtigsten Teile aus der Originalpartitur von Pjotr I. Tschaikowsky. Die Musikauswahl des Abends umfasst einen Zeitraum von 142 Jahren (1877 bis 2019). Die musikalische Leitung für diesen Teil hat wiederum Thomas Rösner. Unter seiner Leitung interpretierte das Berner Symphonieorchester die Komposition Tschaikowskys, respektive Ausschnitte daraus, mit hoher Spielfreude und viel Gefühl für die Ästhetik russischer Musik des 19. Jahrhunderts.

Rustem besetzte die Rollen von Odile und Odette, von schwarz und weiss mit zwei Tänzern. Dies im Einklang mit dem Hinweis auf Gleichheit, welche schon Estefania Miranda in ihrer Choreografie, mit ihrer Auswahl von Künstlern gegeben hat. Weiss tanzt Andrey Alves und schwarz wurde interpretiert von Toshikata Nakamura. Alle "Pas de Deux" werden sehr ruhig mit spürbaren Emotionen getanzt, dies unabhängig vom Tempo in der Musik ohne Hektik, ohne Eile. Diese Ruhe, diese Emotionen gingen in den Gruppendarbietungen der Kompagnie etwas verloren. Hier hätte ich mir etwas weniger Aufregung, Hast gewünscht.
Das Berner Premierenpublikum belohnte den gelungenen Abend mit langanhaltendem Applaus für Tänzerinnen und Tänzer, Choreografin und Choreografen und auch für das Berner Symphonieorchester mit seinem Dirigenten.
Nach diesem Applaus gab es noch eine Zugabe. Hier muss ich bemerken, dass die Intendanz sich diese Zugabe hätte sparen sollen. Sie entliess das Publikum mit Lachen über die Zugabe anstelle von Gedanken zum Dreiteiler. Schade!
Peter Heuberger 3.11.2019
Foto © Gregory Batardon
CARMEN
14.09.2019

Faszination I, die Musik: Da denkt man, man habe Bizets CARMEN – von der keine vom Komponisten als endgültig deklarierte Fassung existiert - schon so oft gesehen, dass man musikalisch nicht mehr wirklich überrascht werden könne und ist dann bei dieser Berner Fassung der Oper doch erstaunt, wieviel Spannendes und neu zu Entdeckendes in dieser Partitur liegt. Der Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters, Mario Venzago, hatte sich auf Spurensuche begeben und einige bis dato eher unbekannte Schätze dieser wunderbaren Musik gehoben. Da ist zum Beispiel gerade am Beginn die Pantomime genannte Szene zwischen Moralès und dem Chor. Oder die Urfassung der bekannten Auftrittsarie der Carmen L' amour est un oiseau rebelle, welche erst für die zweite Strophe in den allgemein bekannten, dramatischen Duktus einschwenkt. Zudem hatten sich der Regisseur Stephan Märki und Mario Venzage entschieden, sowohl auf die Dialoge als auch auf die von Ernest Guiraud nachkomponierten Rezitative zu verzichten, was zu einer packenden Stringenz und Unerbittlichkeit der Handlung führte.

Faszination II, die Inszenierung: Zur Ouvertüre torkelt Carmen auf die Bühne, im roten Hosendress. Eine Frau, am Rande des Abgrunds, ihr irrer Blick in die Tiefe des Orchestergrabens spricht Bände. Diese Frau ist stark suizidgefährdet, vom Leben mehr als enttäuscht, sucht den Tod als Erlösung vom langen und letzendlich erfolglosen Suchen nach Erfüllung. Sie hat alles durchgemacht, erduldet, manchmal selbstbestimmt, manchmal fremdbestimmt, verhaltensauffällig und exaltiert gelebt, nun den Tod erwartend. Um diese Frau dreht sich alles in der Inszenierung von Stephan Märki. Sie ist Projektionsfläche männlicher Begierden, spielt selbst aber auch gekonnt damit. Dass Carmen in allen Frauengestalten dieser Oper steckt, zeigen die identischen Perücken und die Schnitte der Kostüme von Carmen, Michaëla, Frasquita, Mércèdes und den Chordamen, sowie dem Kinderchor, in welchem lauter Püppchen-Carmens eines widerlichen Beauty Contests singen. In einer gigantischen Spiegelwand auf der Bühne spiegelt sich nicht nur der Zuschauersaal mit uns, dem Publikum, das so zu Voyeuren des Dramas wird, auch Carmen sieht sich im Spiegel. Doch der bekommt schnell Risse, die Spiegelbilder verzerren sich. Zudem kann sich die Spiegelwand teilen, Nischen bilden, Handlungsorte konzentrieren.

Die Bühne und die Kostüme wurden von Philipp Fürhofer entworfen, rund um den Orchestergraben verläuft eine Rampe, auf der sich die Sänger*innen bewegen, uns ihre Emotionen ganz nahe bringen, beinahe schmerzhaft nahe. Der Boden ist eine schwarze Spiegelfläche, auf der Bühne wird die Hebebühne benutzt, was eine gleichzeitige Sicht auf die Handlung auf mehreren Ebenen ermöglichte. Zusätzlich sieht man die Zigaretten rauchende Carmen in einer grossen Videoprojektion, wie sie sich und ihre Entourage wie in einem Rückblick auf ihr Leben beobachtet. In diesem Bilderrahmen erscheint auch mal eine Landschaft, doch nichts Folkloristisches. Carmen als allgemeingültige Metapher für ein bis zum Exzess gelebtes (und gescheitertes) Leben. Stephan Märki hat zusätzlich die Figur des „Joker“ eingeführt, ein Tänzer, welcher Carmen in ihren quasi zweieinhalbstündigen Todestanz begleitet, ihr am Ende auch den Todeskuss gibt. Er ist es auch, der ihr eine Scherbe des zerbrochenen Spiegels erst als Don José erotisierende Waffe in die Hand gibt und sie am Ende sich selbst auf diese spitze Scherbe stürzen lässt. Das alles ist mit einer beachtlichen und stets ästhetischen Konsequenz in Szene gesetzt, wie auch insgesamt die Personenführung unerhört bezwingend gehalten ist. Beinahe soghaft wird man als Zuschauer – und eben Voyeur – in die Tragik heineingezogen.

Faszination III, die Interpret*innen:Claude Eichenberger ist eine absolut erstklassige Carmen. Nicht nur, weil diese Künstlerin eine herausragende Präsenz und Intensität des Spiels aufweist, eben ein richtiges Bühnentier ist, sondern und gerade auch, weil sie ihre wunderbare, bestechend sicher geführte Stimme so gekonnt mit all den zur Verfügung stehenden Schattierungen einzusetzen weiss.
Xavier Moreno besticht mit seinem herrlich direkt in allen Lagen sicher und sauber ansprechenden Tenor, der sowohl über Kraft als auch über tenoralen Schmelz verfügt, nie larmoyant oder verquollen klingt. Jordan Shanahan verströmt begeisternd die geforderte Virilität und Nonchalance des Escamillo, Oriane Pons lässt als Micaëla mit ihrem herrlich aufblühenden Sopran mit gekonnt eingesetztem, leicht dramatischem Beiklang aufhorchen. Orsolya Nyakas setzt als Frasquita fulminante Spitzentöne, z.B. im Finale II, Eleonaora Vacchi kontrastiert diese mit samtenem Mezzo. Zusammen mit Nazariy Sadivskyy (Dancïro) und Andries Cloete (Remendado) bilden diese vier Sänger*innen ein exquisites Schmugglerquartett. Young Kwon singt einen soliden Zuniga und Todd Boyce als Moralès macht die neu entdeckte Pantomime im ersten Bild zu einem vokalen und darstellerischen Kabinttsstückchen.

Vittorio Bertolli verleiht dem Joker überaus agiles und dauerpräsentes Charisma. Zsolt Czetner hat den Chor und den Extrachor Konzert Theater Bern einstudiert – das Ergebnis lässt sich hören! Klangstark und rythmisch präzise singen der Damenchor auf der Bühne und der Herrenchor aus den Proszeniumslogen und dem ersten Rang. Auch der Kinderchor der Singschule Köniz steuert wunderbar reine Töne und gekonnte Synchronität beim Tapdance während des Beauty pageants bei.
Ein Ereignis stellen natürlich die Farbigkeit der Partiturauslegung und die mit herausragender Differenzierung und Subtilität austarierten Tempi des Berner Symphonieorchesters unter der mitreissenden Leitung von Mario Venzago dar!
Fazit: Wer CARMEN schon oft gesehen hat – HINGEHEN, weil es soviel Neues zu entdecken gibt und die Inszenierung von atemberaubender Stringenz ist.
Wer CARMEN noch nie gesehen hat – HINGEHEN, weil (siehe 1.) ... .
(c) Tanja Dorendorf | T+T Fotografie
Kaspar Sannemann 18.9.2019
Zum Zweiten
TRISTAN UND ISOLDE
16.06.2019
Die Kunst der bedingungslosen Liebe ist eine Kunst, die nur wenige beherrschen, und noch weniger Menschen können (oder wollen?) diese Kunst verstehen. Und diese Kunst muss jedes Paar für sich immer wieder neu erfinden, denn es gibt keine allgemeingültigen Rezepte, welche für jede Art von Liebe anwendbar wären. Also erfordert das Lieben totalste Freiheit – eine solche Freiheit fordert der Künstler Jonathan Meese für die Kunst im Allgemeinen. Spiel, Risiko, Radikalität und v.a.m. Die Thesen von Jonathan Meese hat der Regisseur der Berner Neuinszenierung, Ludger Engels, als Ausgangspunkt und Inspirationsquelle für seine Sicht auf die neben ROMEO UND JULIA wohl bekannteste Liebesgeschichte des Abendlandes genommen, für Wagners TRISTAN UND ISOLDE. In einem Atelier setzt ein Künstler diese Liebesgeschichte in Szene.
Schon während des Vorspiels instruiert der Künstler (der mit seiner platinblonden Perücke etwas von Warhol hat) drei Damen über ihre Auftritte innerhalb des künstlichen Settings: Die drei Damen symbolisieren die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Protagonisten Tristan. Im TRISTAN entdecken wir ja einige autobiographische Züge des Schöpfers Richard Wagner selbst. So ist die Vergangenheit verkörpert durch Wagners zur Zeit der Entstehung des Musikdramas (Noch-) Ehefrau Minna (in typischer 1850er Robe), die Gegenwart wäre Mathilde Wesendonck, seine unerreichbare Liebe (in heutigen Alltagskleidern) und die Zukunft wäre Cosima von Bülow, die zur Zeit der Komposition ebenfalls in Zürich weilte und Wagners spätere Ehefrau wurde. Sie tritt im futuristischen Barbarella – Look auf. Der Künstler (mit grosser Agilität hüpft Andries Cloete gleich eines Shakespearschen Puck auf der Bühne herum und singt ganz beiläufig auch noch den jungen Seemann und den Hirten) beginnt also diese Utopie der bedingungslosen Liebe zu inszenieren. Eine Art Konferenzraum, der sich durchaus im Bauch eines Schiffes befinden könnte, mit langem Tisch wird gleich einer Kartonschachtel auf die Bühne geschoben (das vielseitige, spannend ausgeleuchtete Bühnenbild entwarf Volker Thiele, das Licht stammt von Bernhard Bieri).
Darin spielt sich dann der erste Akt ab, mit Brangänens Austausch der Tränke und der Einnahme des Liebestrankes durch Tristan und Isolde. Nach dessen Einnahme beginnen die beiden hemmungslos zu lachen – man spürt, dass da vorher schon eine intensive Verbindung war, die nun einfach neu entfacht wurde. Vieles ist zum Schmunzeln in diesen durch intensive Personenführung spannend gestalteten Szenen. Erste Bausteine des Errichtens eines eigenen, von der übrigen Welt abgewandten Kosmos werden offensichtlich. Das setzt sich im zweiten Akt, dem Liebesakt, mit bildgewaltiger Kraft fort. Auf das Corbusier-Sofa von König Marke werden Styropor-Alpen gebaut, die Liebenden scheinen sich in ein nur ihnen allein zugängliches Tal zurückzuziehen. Zwar versucht Melot noch, die Berge zu zerstören, doch vergeblich, Tristan und Isolde sind quasi der realen Welt abhanden gekommen, ziehen sich in ihren Glitzer-Unisex Anzügen (die phantastisch zum Konzept passenden Kostüme wurden von Heide Kastler entworfen) in ein eigenes Reich zurück. So braucht Melot den Tristan auch nicht zu verwunden – er kann sich nur die Augen reiben und den Dolch mit einem Achselzucken - ohne jegliches Verständnis für die Welt Tristans - fallen lassen.
Gerade in der Figur des Melot zeigt sich exemplarisch die Kunst des Regisseurs Ludger Engels. Was er aus dieser Randfigur an tiefem Sinn und Charakterisierung herausholt, ist unglaublich spannend. Dieser eitle, schleimige, eifersüchtige und seinen Herrn Marke bedingungslos liebende (und anscheinend auch körperlich begehrende) Geck wird darstellerisch sportlich und gesanglich mit herrlich präsentem Bariton von Todd Boyce verkörpert. Wunderbar. Doch auch die Brangäne erreicht mit ihren aus dem Off gesungenen, so Gänsehaut erregenden „habet acht“ - Phrasen die Liebenden nicht mehr. Claude Eichenberger gestaltet diese wunderbare Szene einfach famos. Bereits im ersten Akt, wo sie gewaltig viel zu singen hat, zeigt die Mezzosopranistin eine gestalterisch reifen Leistung, sie verfügt über eine traumhaft sichere Höhe und eine packende Mimik. Kai Wegner macht den langen, von Unverständnis geprägten Monolog König Markes am Ende dieses Aktes zu einem Ereignis. Mit balsamischem Bass gestaltet er die herrlichen Phrasen, welche Wagner für den König Marke komponiert hatte, unterstützt durch die zügigen Tempi, welche Kevin John Edusei mit dem Berner Symphonieorchester anschlägt.
Überhaupt klingt das Orchester ungemein präsent, die Balance Bühne-Graben gerät jedoch nie in Gefahr. Edusei vermag es, einen nie abbrechenden, hoch spannenden Fluss aufrecht zu erhalten, die lange Oper wird auch musikalisch nie lang. Die Burg Kareol im dritten Akt ist eine riesige Amethystenhöhle – weit jenseits von der realen Welt. Tristan (physisch unverwundet) kann seinen schwierigen, fiebrigen und langen Monolog so also im Stehen singen, was für den Sänger bestimmt eine Erleichterung bedeutet, zumal Heiko Börner erst am Tag vor der Vorstellung erfahren hat, dass er am Sonntag um 16 Uhr in Bern für den erkrankten Daniel Frank einspringen muss. Am Sonntagmorgen noch probte er das Szenische und somit kam man in den Genuss einer vollwertigen Aufführung. Gerade in diesem anspruchsvollen dritten Akt zeigten sich Heiko Börners Qualitäten: ein einnehmendes Timbre, das im Verlauf des Abends zunehmend freier klang, eine unglaubliche (und höhensichere) Stamina für den dritten Akt. Begleitet in diese abgedriftete Bergwelt wurde er von seinem getreuen Gefährten Kurwenal, der von Robin Adams mit stimmgewaltigem Bariton und sympathischem Spiel gegeben wurde. Eigentlich hat man ein wenig Mitleid mit Kurwenal, der seinen Herrn Tristan so bedingungslos liebt.
Einen kurzen Moment lang im dritten Akt hegt man die Hoffnung, dass es zu einer Ménage à trois kommen könnte, als sich Kurwenal in den von Tristan schon im zweiten Akt auf den Boden gemalten gelben Kreis legt und auch Isolde bei ihrem Eintreffen in der kristallinen Bergwelt sich dazu gesellt. Doch das ist von kurzer Dauer. Hingegen beobachtet man einen grouphug der drei Wagner-Liebchen im Hintergrund, auch ein schönes, utopisches Bild, das die im Menschen anerzogene Eifersucht zu überwinden scheint. Isolde löst sich aus dieser Gruppenumarmung, winkt dem zunehmend amüsiert über den Selbstläufer seiner Kunstinstallation schmunzelnden Künstler zu (... der Hirte auf dem Felsen) und hebt zu ihrem Schlussgesang an. Lee Bisset singt dieses Mild und leise, wie er lächelt der Isolde überhaupt nicht als von Liebes- und Weltenschmerz verklärte Szene, sondern schöpft daraus eine verzückte, grandiose Hymne auf die Liebe, gestaltet mit überwältigender Kraft den Schlussgesang Isoldes.
Diese Kraft war bereits von Anfang an da, wie ein Sturmwind fegt ihre klar artikulierende und mit schöner Phrasierung aufwartende Stimme in den Konferenzsaal des ersten Aktes, schwappt in den Saal, steigert sich in ungeduldige Ekstase (Dass hell sie dorten leuchte – erneut Gänsehaut pur, einfach geil) im zweiten Akt, wenn sie endlich das Licht der Stehlampe löschen will, das ihren Geliebten zu ihr führen soll, wo sie sich dann unter wild drehenden Spiegeln und in besagtem Giltzerdress vereinigen können. O sink hernieder, Nacht der Liebe - da beginnen sie in ihren ganz eigenen Raum abzudriften, die Welt um sich herum zu vergessen, mit Hilfe des Künstlers ihre eigene – gelbe – Welt zu erschaffen. Zwar wird am Ende der Oper noch versucht, auch den Melot und den Marke mit gelber Farbe zu markieren, vergeblich. Ist auch richtig so, denn wie hat doch Jonathan Meese in seinem Verständnis von totalster Kunst geschrieben: Kunst ist immer ohne Gruppenzwang!
Zwei kleine Anmerkungen zur Inszenierung muss ich mir, bei aller Hochachtung für die genaue, intelligente Arbeit des Regisseurs, doch noch von der Seele schreiben: Dass Andries Cloete während des herrlich soghaft vom Berner Symphonieorchester intonierten Vorspiels seine „Regieanweisungen“ in einem Kauderwelsch für alle hörbar den drei Damen zuflüstern musste, störte mich extrem. Dazu bin ich zu sehr Romantiker, um das goutieren zu können. Ebenso lenkte mich beim Schlussgesang Isoldes das pinselträchtige Gewusel auf der Bühne von der mitreissenden Emphase des Schlussgesangs ab. Eben, ich bin halt ein unverbesserlicher Romantiker ... .
Kaspar Sannemann 18.6.2019
Bilder siehe unten Premiernebericht
TRISTAN UND ISOLDE
Premiere: 25. Mai 2019
Besuchte Vorstellung: 29. Mai 2019
Das Berner Symphonieorchester unter der Leitung von seines Dirigenten, Kevin John Edusei, interpretierte TRISTAN UND ISOLDE in Hochform und mit viel Emotionen und Empathie für das eher handlungsarme Werk Wagners, dies trotz, oder gerade wegen der nur als mittelmässig zu bezeichnenden Leistung der Interpretin von Isolde.
Missfallen hat auch eine Regie-Idee in der Visualisierung des Vorspieles: Dort sprach ein Schauspieler (Der Künstler) während der Ouvertüre. Dies geht nun gar nicht! Bildliche Darstellung ja! Akustische Untermalung: Auf gar keinen Fall!

Die Regie von Ludger Engels nimmt wenig Rücksicht auf die nur in der Musik und der Interaktion zwischen den Protagonisten vorhandene Handlung. Seine Personenführung lässt ein besseres Verständnis für die Emotionen vermissen. Ich habe einige der Künstler auf der Bühne in anderen Werken gehört und gesehen und bin der Meinung: Die können besser spielen als ich gestern Abend gesehen habe. Die sängerische Leistung dagegen war mit Ausnahme der weiblichen Hauptrolle sehr gut. Davon weiter unten mehr!
Sehr gut inszeniert war der dritte Aufzug, in welchem auch die Personenführung gelungen ist. Die Zuneigung Kurwenals zu Tristan war spürbar und berührend. Auch König Markes Monolog war ausgezeichnet in Szene gesetzt. Allerdings nur solange Frau Bisset (Isolde) nicht auf der Bühne war. Etwas befremdend waren die einige Male unmotivierten Spaziergänger auf der Bühne, dramaturgisch unnötige Ablenkungen vom musikalischen Geschehen.

Wenn Zweitbesetzungen nicht im gedruckten Programmheft des Konzerttheaters zu Wagners Tristan (Redaktionsschluss 20.05.2019) aufgeführt sind, lässt das den Schluss zu, dass diese Zweitbesetzung sehr spät gesucht und gefunden wurde. Dies ist bei der Berner Produktion Tristan und Isolde, Premiere am 25. Mai 2019 allem Anschein nach der Fall. Nach der guten ersten Vorstellung mit Catherine Foster als Isolde besuchte ich die zweite Aufführung mit Lee Bisset in der Hauptrolle. Bisset hat noch nie auf einer deutschsprachigen Bühne gesungen. Dies im Gegensatz zu Frau Forster, welche an einigen grossen Bühnen, darunter auch Bayreuth bewiesen hat, dass sie eine Wagner-Sängerin ist. Wieso dieser Wechsel? Allem Anschein nach war dieser nicht vorgesehe.

Lee Bisset mag als Sängerin für Bühnen wie Oper Memphis und Oper Omaha (USA) oder auch Mexico City genügen. Für ein Haus wie das Konzerttheater Bern reicht ihre sängerische und schauspielerische Leistung in der Rolle der Isolde nicht. Ihre Intonation war korrekt. Ihre Emotionen waren im Gesang nicht zu erfassen, ihr dauerndes Vibrato, um nicht zu sagen Tremolieren, störte ebenso wie ihre schlecht Diktion, ihr verschlucken von Silben, verhinderte eine auch nur ausreichende Interpretation der Isolde. Dies mag auf angelsächsischen oder spanischen Bühnen weniger wichtig sein, auf deutschen Bühnen ist dies ein absolutes "no go" Zum Glück wurde vieles von ihrer fragwürdigen Interpretation durch das vorzügliche Orchester verbessert, übertönt. Auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten liessen zu wünschen übrig. Die irische Prinzessin verwandelte sich in eine wütende Megäre, unglaubhaft dargestellt. Dies mag aber auch der Personenführung zuzuschreiben sein oder den eventuell mangelnden, zu kurzen Proben, auch war Ihre Körpersprache, ihr Mimik und Gestik unglaubwürdig. Bisset hat die Tendenz, sich in den Vordergrund zu drängen, dies auch dort wo es dramaturgisch nicht angebracht ist. Sie hat anscheinen noch nie gehört, dass ein Künstler nur gut sein kann, wenn sein Partner/Seine Partnerin gut ist! (Stanislawski)

Ein Zuhörer machte nach dem Fallen des Vorhanges zur ersten Pause seinem Missmut kräftig, aber berechtigt mit einem lautstarken "merde" Luft. Obgleich Gegner solcher Äusserungen kann ich nach diesem ersten Aufzug das Missbehagen nachvollziehen.
Eine ausgezeichnete Leistung bot Claude Eichenberger als Brangäne. Ihre Diktion, ihre Intonation ohne unnötiges Vibrato und ähnliche ungewollte Beimengungen lassen keine Wünsche übrig. Die Regie verpasste ihr sehr zurückhaltende, unterkühlte Auftritte.
In der Rolle des Tristan ist der schwedische Tenor Daniel Frank zu sehen und hören. Seine Interpretation ist Sehens- und hörenswert. Intonation und Diktion sehr gut und auch seine Körpersprache, seine Mimik und Gestik entsprachen innerhalb der Personenführung den Erwartungen. Tristan steht sehr lange auf der Bühne und hat viel zu singen. Er muss mit seiner Stimme haushalten, um auch im letzten Aufzug noch voll da zu sein. Man kann daher eine gewisse Schonung im ersten Akt verstehen, verzeihen.

Robin Adams als Kurwenal überzeugte mit kräftiger Stimme, ausgezeichneter Intonation und Diktion. Er überzeugte als Antagonist von Melot, welcher vom Ensemblemitglied Todd Boyce interpretiert wurde. Boyce überzeugte, bedingt durch die Regie, nicht hundertprozentig. Seine Leistung als Marcello in La Boheme hier in Bern war wesentlich zwingender. Er kann's besser, wenn man ihn denn lässt. Seine Leistung als Sänger war der Rolle angepasst und sehr professionell gelungen.
König Marke wurde ausgezeichnet interpretiert vom deutschen Bassist Kai Wegner. Seine Intonation und Diktion war hervorragend. Es ist immer wieder interessant dass aus der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin sehr gute Sänger und Sängerinnen kommen.
In weiteren Rollen waren zu sehen und hören:
Als Steuermann David Park, und in drei Rollen (Hirt, Künstler und junger Seemann) Andries Cloete, Ensemblemitglied in Bern.
Der Kostümentwurf von Heide Kastler war im ersten und dritten Aufzug gut. Als geschmacklos zu bezeichnen, sind die silberfarbenen Ganzkörperanzüge von Tristan und Isolde zum Duett "Sink hernieder, Nacht der Liebe". Über Geschmack lässt sich bekanntlich endlos streiten!

Die Bühne, gebaut von Volker Thiele, gefiel im Allgemeinen. Der Einfluss des deutschen Regisseurs, Frank Hilbrich, war vor allem im zweiten Aufzug nicht zu übersehen. Die verzerrenden Spiegel, da sehr ungewohnt, lenkten doch etwas von der Musik ab. Stimmig die Höhlenlandschaft von Thiele im dritten Aufzug, unterstützt von der Lichtführung, designt von Bernhard Bieri.
Das Publikum belohnte die Leistung der Künstler und Künstlerinnen im Graben und auf der Bühne mit dem verdienten Applaus.
Peter Heuberger, 30.5.2019
© Christian Kleiner
Abbildung Isolde: Catherine Foster
Philippe Boesmans
REIGEN
Premiere: 31. März 2019
Besuchte Vorstellung: 3. April 2019
Etwas Unaufführbareres hat es noch nie gegeben -so äusserte sich Arthur Schnitzler selbst über die zehn Dialoge, die er 1897 unter dem Arbeitstitel Liebesreigen verfasste. Die Uraufführung fand am 23. Dezember 1920 am Kleinen Schauspielhaus in Berlin statt und war einer der größten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts.
Hugo von Hofmannsthal in einem Brief an Arthur Schnitzler: Denn schließlich ist es ja Ihr bestes Buch, Sie Schmutzfink. Worum geht es? Worum es immer geht: Das Stück schildert in zehn erotischen Dialogen die unerbittliche Mechanik des Beischlafs - dankenswerter Weise im Stück selbst nicht gezeigt - und sein Umfeld von Macht, Verführung, Sehnsucht, Enttäuschung und das Verlangen nach Liebe. Dabei werden alle sozialen Schichten vom Proletariat bis zur Aristokratie in einem bunten Reigen kontaktiert.

Der belgische Komponist Philippe Boesmans nahm sich dieses Stoffs in seiner am 4. März 1993 uraufgeführten Oper Reigen an und setzte darin das Prinzip des Reigens musikalisch um. Die eingängige Musik ist reich an humorvollen Irritationen und gleichzeitig von einer allgemeinen Traurigkeit, was den Gemütszustand der ProtagonistInnen auf geschickte Weise widerspiegelt.
Wie bringt ein Regisseur zehn Szenen mit unterschiedlichen Handlungsorten auf die Bühne ohne dass irre viel Zeit für Umbauten gebraucht wird? Markus Bothe, der im Berner Stadttheater zuletzt mit Le Nozze di Figaro und Il Trovatore grosse Erfolge feierte, führt Regie und hat dies, zusammen mit seinem Bühnenbildnerin
Kathrin Frosch geschafft. 10 Szenen und nur eine Pause! So bleiben die dramatische Spannung und der musikalische Fluss erhalten. Keine Pause wäre noch besser und bei eine Spieldauer von 150 Minuten auch tragbar.
Dazu kommt die exzellente Lichtführung, entworfen von Bernhard Bieri, welche subtil die Tageszeiten darstellt und auch die Emotionen der ProtagonistInnen unterstreicht. Der Verzicht auf Videoprojektionen wird von mir dankbar zur Kenntnis genommen. Es geht, wie der Regisseur beweist, bestens auch ohne!

Markus Bothe, stellt in seinem Reigen die Verzweiflung und die Traurigkeit der Menschen stringent ins Zentrum. Denn obwohl sie sich in intensive Liebeleien verstricken, bleiben sie teilweise unfähig, miteinander zu kommunizieren und wirkliche Nähe zuzulassen. Die Kommunikation der Paare auf der Bühne spiegelt die heutige Gesprächskultur wider. Jeder/jede spricht eigentlich nur von und für sich. Oder ist mit seinem Handy anstelle mit dem jeweiligen Partner, der jeweiligen Partnerin beschäftigt.
Bothes Personenführung unterstützt und erlaubt den Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne neben ihrem hervorragenden Singen auch ihre schauspielerischen Leistungen, ihre Körpersprache und ihre Gestik und Mimik einzusetzen. Jede der dargestellten Figuren wirkt lebendig und präsent. Diese Körperarbeit erleichtert das Verständnis für die 10 Geschichten. Der musikalische Ausdruck, die Intonation und die Diktion aller Sängerinnen und Sänger können nur als makellos bezeichnet werden. Mehr ist dazu nicht zu schreiben.

Das Berner Symphonieorchester, geleitet von Kevin John Edusei, interpretiert die sehr modern gesetzte Musik des Komponisten präzise und mit viel Empathie für das Geschehen auf der Bühne. In einigen Passagen könnte Edusei die Dynamik, die Lautstärke zugunsten des Singens auf der Bühne etwas drosseln
Die Kostüme, gestaltet von Justina Klimczyk, werden dem unspektakulären Bühnenaufbau gerecht. Die Dramaturgie von Katja Bury übernimmt viele Regieanweisung Arthur Schnitzlers, da diese für den roten Faden, die zu erzählenden Geschichten wesentlich sind. Als Strukturprinzip verwandte Schnitzler die Tanzform des Reigens(höfischer Rundtanz), wo eine Figur immer die Hand einer neuen Figur für die nächste Szene reicht.
Die Regie/Dramaturgie hat dieses Prinzip weitgehen übernommen. Nach jeder Szene wird ein Partner ausgetauscht und dabei die gesellschaftliche Leiter erstiegen, von Dirne, Soldat und Stubenmädchen über junger Herr, Ehefrau, Ehemann und süßes Mädel bis zum Dichter, der Sängerin und dem Grafen, der am Schluss wieder mit der Dirne zusammentrifft und so den "Reigen" schließt.

Auch verzichten Bury und Botha auf die explizite Darstellung der Sexszenen, so wie dies im Originaltext des Dichters auch vorgesehen ist. Danke!
Das nicht sehr zahlreich erschienene Publikum belohnte die reife Leistung des gesamten Teams mit dem verdienten Applaus. Es ist zu hoffen, dass sich das Berner Konzerttheater bei den weiteren Vorstellungen wesentlich besser füllt! Wer nicht hingeht, verpasst, nein nicht etwas, sondern sehr viel!
Peter Heuberger 5.4.2019
Fotos © Christian Kleiner
Händel
LOTARIO
Premiere: 24. Februar 2019
Besuchte Vorstellung: 5. März 2019

Musikalisch ist die leider selten gespielte Oper Lotario, geschrieben von Georg Friedrich Händel 1729, sehr vielfältig. Die dramaturgische Handlung jedoch ist eher mager, dies vor allem in der Berner Inszenierung, welche den Spielort (Bühnenentwurf Rifail Ajdarpasic) auf einen grossen Saal mit Balkon beschränkt. Der Besucher, die Besucherin ist für das Verständnis des Dramas auf die Erzählung der ProtagonistInnen angewiesen. Ohne die im Programmheft erklärte Handlung ist ein Nachvollziehen der Geschichte praktisch nicht möglich.
Das Berner Symphonieorchester, hervorragend geleitet vom englischen Dirigenten Christian Curnyn, interpretierte die Musik von Händel mit viel Gefühl für die kleinen und grossen Schönheiten der Partitur. Speziell erwähnenswert ist die subtile Begleitung der Rezitative.
Die Visulisierung der Ouvertüre zeigt die Ermordung des Ehemannes von Adelaide. Dies ist im Libretto so nicht vorgesehen. Eine durchaus interessante Idee des Regisseurs.

Die Personenführung von Carlos Wagner kann im ersten und zweiten Akt als zum Teil gelungen bezeichnet werden. Er lässt seine Sängerinnen und Sänger auf der ganzen Bühne agieren. Er vermeidet das bei handlungsarmen Opern so gefährlich/verlockende Rampenstehen und Absingen von Arien.
Nicht so überzeugend ist der Einsatz von Körpersprache und Mimik seiner Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. So ist es dramatisch nicht nachvollziehbar, dass Lotario als deutscher König hin und her tänzelt und so Adelaide vor dem Sarg ihres ermordeten Gatten zum Lachen bringt. Auffallend ist dies auch im dritten Akt, wo die Körpersprache von Berengario und Matilde Angst, Entsetzen und Hass ausdrücken sollte. Wagner versucht dies durch den Einsatz expressionistischer Körpersprache, Mimik und Gestik darzustellen, verwendet in Stummfilmen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Dazu braucht es aber hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen. SängerInnen sind mit dieser Arbeit meist überfordert. Ihr Beruf, Ihre Berufung ist Singen und nicht schauspielern. So wirkt die Personenführung des Regisseurs eher peinlich, freundlich ausgedrückt.

Als sehr gelungen betrachte ich die Interpretation der Schweizer Sopranistin Marie Lys. Als Adelaide beherrscht sie die Bühne jederzeit, ohne ihre AntagonistInnen an die Wand zu spielen. Sie lässt ihren Mitspielerinnen und Mitspielern den nötigen Raum, um ihre Rollen zu spielen/singen. Es scheint, dass der Regisseur bei Frau Lys in Bezug auf Mimik und Gestik weniger Einfluss nahm als bei anderen Künstlern auf der Bühne. Dadurch wirkt sie weniger künstlich als zum Beispiel Lotario.
Sehr gefallen hat mir die österreichische Mezzosopranistin Sophie Rennert als Lotario. Ihre Diktion, die Dramatik ihrer Stimme überzeugt in jeder Hinsicht. Ihre Intonation ist makellos ohne falsches Vibrato. Es ist schade, dass die Personenführung Wagners ihre natürliche Körpersprache verhindert und dass die Gestik zum Teil fast ins Lächerliche abrutscht. Rennert kann dies besser, wenn man sie denn lässt!
Hervorragend singt und spielt das Berner Ensemblemitglied, der Bariton Todd Boyce, seinen Part als Clodomiro. Seine Diktion und Intonation ist makellos und seine Bühnenpräsenz in der Zerrissenheit seiner Rolle stark. Auch bei ihm wurde anscheinend weniger Einfluss auf Mimik und Gestik genommen, so dass sein Clodomiro sehr glaubhaft wirkt.

Ursula Hesse von den Steinen als Matilde ist eine der starken Persönlichkeiten auf der Bühne. Sie singt und spielt glaubhaft ihren Hass, Ihre Liebe, Ihren Machtbesessenheit. Bei ihr jedoch ist der Einfluss auf Mimik und Körpersprache der Regie klar zu erkennen und dieser Einfluss kann nur als negativ bezeichnet werden. Ich habe Frau Hesse in anderen Rollen vom rein schauspielerischen her viel besser erlebt, zum Beispiel hier in Bern als Disinganno in Händels Il Trionfo del Tempo e del Disiganno (Regie Calixto Bieito). Leider wird dadurch die Glaubhaftigkeit ihrer Interpretation von Matilde, speziell im dritten Akt, stark getrübt. Ihr Gesang ist der Rolle angepasst und wird den Emotionen, welche die Rolle der Matilde verlangt, gerecht.
Meine Anmerkungen zu Körpersprache, Mimik und Gestik gelten leider auch für die beiden Darsteller von Berengario und Idelberto.
Sängerisch wird die Rolle des Berengario hervorragend interpretiert durch Andries Cloete. Leider leidet durch den Einfluss der Regie die Glaubwürdigkeit der Interpretation. Ich habe Cloete in Fierabras und Cosi fan tutte erlebt und kann nur bemerken: Auch Cloete kann die Rolle des Berengario ohne zu weit gehende Regieanweisungen besser darstellen.

Der koreanisch-amerikanischen Countertenor Alto Kangmin Justin Kim interpretiert die Rolle des Idelberto. Auch für ihn gilt meine Anmerkung betreffend Regieanweisungen. Es fiel mir auf, dass einige Rollen vom Regisseur im eher peinlich-lächerlichen Bereich angesiedelt wurden. Dies gilt ganz speziell für Idelberto, welcher als schwach, als absolutes Muttersöhnchen daher kommt, aber eher unglaubwürdig wirkt. Als Sänger glänzt Kim mit klarer Diktion, sauberen Höhen und guter Intonation. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen Kraft, Volumen im unteren Bereich seiner Stimme.
Leider hat das nicht allzuzahlreiche Publikum es fertig gebracht, mit zu frühem Szenenapplaus musikalisch wichtige Schlusstakte nach Arien zu übertönen. Nur einer der Gründe, wieso der Szenenapplaus abgeschafft gehört.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer entliessen das gesamte Team, auf der Bühne und im Graben mit dem verdienten Applaus.
Peter Heuberger, Basel
Fotos © Christian Kleiner
Fotos: Konzert Theater BOKern
http://www.konzerttheaterbern.ch/
Franz Schubert
Fierabras
am 31. Januar 2018
Franz Schubert beendete seine Oper Fierabras im Jahr 1824. Nach dem Misserfolg der Uraufführung in der Wiener Hofoper von Carl Maria von Webers Euryanthe am 25. Oktober 1823 wurde der für Anfang 1824 bereits angekündigte Fierabras abgesagt. Die szenische Uraufführung unter Felix Mottl war daher erst 75 Jahre später, am 9. Februar 1897, aus Anlass des hundertsten Geburtstages des Komponisten im großherzoglichen Hoftheater Karlsruhe zu sehen und hören.

Fierabras ist ein Werk, welches sich eigentlich für eine konzertante Wiedergabe anbietet. Hier könnte man auch die unnötigen banalen Rezitative (ohne Musik) weglassen. Die Handlung ist kärglich, nicht leicht verständlich und uninteressant, die Texte des Librettos mögen der Entstehungszeit angemessen sein, für heutige Begriffe ist das intellektuelle Niveau ungenügend und banal. Die Musik Schuberts dagegen ist komplex und, am Entstehungsjahr gemessen sehr modern gesetzt. Vielleicht wäre als Librettist Heinrich Heine (*1797) geeigneter gewesen. Vielleicht wären dann Texte wie aus Heines Buch der Lieder in Franz Schuberts Schwanengesang (D 957) entstanden.
Das Berner Symphonieorchester unter der Stabführung seines Chefdirigenten Mario Venzago interpretierte Schuberts Komposition makellos mit Emotion und professionellem Einsatz. Venzago hat mit seinem Dirigat den angekündigten Ausfall von acht Chorsängern berücksichtigt und auch für die Partie des indisponierten Hauptdarstellers Fierabras (Andries Cloete) die Lautstärke angepasst.

Das Bühnenbild, entworfen von Silvia Merlo und Ulf Stengl, ermöglichte ohne Umbaupausen ganz unterschiedliche Perspektiven. Die Kostüme, gezeichnet von Lydia Kirchleitner sind zeitlos und der Produktion angepasst.
Nach den Inszenierungen, welche ich von Elmar Goerden sehen durfte, war ich auf seine Auffassung der schwierig zu inszenierenden Oper Schuberts gespannt. Trotz seiner Bemühung um mehr Handlung, mehr Action, blieb das Spiel der ProtagonistInnen auf der Bühne flach und uninteressant. Hilfloses Treppensteigen eines überalterten Königs, peinliche Hinweise auf das Jus primae noctis, ein immer wieder erscheinender Harfen-Rollkoffer und anderes mehr reichen einfach nicht aus, um Mängel in der Dramaturgie auszugleichen.

Wieso die beiden Herrscher in einer heroischen Oper, König Karl (Kai Wegner) und König Boland (Young Kwon) so greisenhaft, hinfällig dargestellt werden mussten, entzieht sich meine Kenntnis. Die Personenführung war für meine Begriffe nicht zielführend und der Handlung, respektive Nichthandlung, auch nicht angepasst. Gesamthaft gesehen muss ich bemerken, dass Fierabras in Bern nicht zu den besten Arbeiten Elmar Goerdens gehört.
Herausragend aus der gesamthaft sängerisch eher mageren Leistung war Todd Boyce als Roland. Er schloss nahtlos an seine Darstellungen in Cosi fan tutte und La Bohème hier im Konzerttheater Bern an. Für Young Kwon und Evgenia Grekova kann ich dies leider nicht schreiben. Ihre sängerischen Qualitäten in Fierabras entsprachen bei weitem nicht dem was ich in Boheme hören durfte.

Andries Cloete als Fierabras zu beurteilen ist nicht möglich, da er doch sehr stark indisponiert war. Viele Sänger hätten unter diesen Umständen, zu Recht übrigens, abgesagt. Bravo und Danke! Ich habe alle anderen Sänger und Sängerinnen in anderen Rolle gehört. Alle waren als KünstlerInnen wesentlich überzeugender als heute Abend in Fierabras.
Die Produktion von Fierabras braucht Mut und diesen hat das Konzerttheater Bern gehabt.
Der Schlussapplaus des Publikums war eher verhalten. Vielleicht war der Zugang zu Schuberts Werk der zu schwierig, die Erwartung an Schubert zu unterschiedlich vom Gehörten und gesehenen.
Peter Heuberger 2.2.2019
Fotos © Tanja Dorendorf
LA BOHÈME
Premiere: 24. November 2018
Die Erinnerungen des Malers Marcello
Was ist die Herausforderung bei einer Neuinszenierung? Diese Frage stellt sich für jeden Regisseur, jede Regisseurin bei der Inszenierung eines Klassikers, sei es im Musiktheater oder auf der Sprechbühne. Der Regisseur der Berner Bohème, Mathew Wild, beantwortet diese Frage wie folgt: Meiner Erfahrung nach hat das Publikum zu meist eine recht konkrete Erwartungshaltung, was vergleichbare Opernklassiker angeht. La Bohème wird beispielsweise ein vermeintlich romantisches Bild unterstellt, behandelt aber schwierige Themen wie Armut, Künstlertum, Krankheit oder Tod. Für mich ist die Jugend mit all ihren positiven und negativen Aspekten in diesem Werk ein zentrales Thema: Auf der einen Seite steht deren unerschöpfliche Energie, Sorglosigkeit, Kreativität und die Verweige-rung aller Seriosität, auf der anderen Seite eine grosse Rücksichtslosigkeit im Zwischenmenschlichen und das Unverständnis der eigenen Sterblichkeit. Genau hier liegt der Anknüpfungspunkt meiner Inszenierung: Marcello wird sowohl durch eine junge als auch eine betagte Bühnenfigur verkörpert. Mittlerweile zu Erfolg und Ansehen gekommen, wird er im Alter– auch im Rahmen seines teilweise dementen Zustandes – mit Erinnerungen an seine Jugendzeit konfrontiert. So begegnet die Weisheit und Reue des Alters direkt der Unachtsamkeit der Jugend.

Der südafrikanische Regisseur hat für seine Arbeit in Bern einen interessanten Ansatz gewählt: Die gesamte Handlung wird als Rückerinnerung des alten, an der Schwelle des Todes stehenden Marcello dargestellt. Dieser ist inzwischen ein berühmter Künstler geworden. Vorbereitungen für die Eröffnung der Retrospektive über sein künstlerisches Werk sind in vollem Gange. Marcello im Rollstuhl betritt mit seiner Frau Musetta und seinem Enkelsohn die Galerie. Angeregt von all seinen Kunstwerken setzt die Rückblende auf sein Leben in der Pariser Bohème ein.
Diese Erinnerungen folgen genau dem Libretto und der Musik Puccinis.

Mathew Wilds Regie sprüht vor Lebenslust. Seine Figuren auf der Bühne lassen keine Langeweile aufkommen, seine Personenführung ist zwingend, erlaubt aber seinen ProtagonistInnen genügend Bewegungsspielraum. Er vermeidet dadurch das im heutigen Musiktheater nicht mehr zeitgemässe, aber oft noch zelebrierte Rampensingen. Seine Künstler singen dort auf der Bühne wo es dramaturgisch Sinn macht und die Geschichte weiterführt. Jedes der vier Bilder wird vom alten Marcello mit seiner Entourage eröffnet und beendet. Dieser rote Faden hilft dem Verständnis für die Geschichte und hält das ganze Werk zusammen.

Sehr gelungen ist der Abschluss des Werkes: Bei Puccini singt Rodolfo "Mimi, Mimi"! Ende! Bei Wild steht Mimi auf, nimmt den greisen Marcello bei der Hand und führt ihn weg. Wohin ?! Mit dem Tod Mimis lösen sich die Erinnerungen auf und der alte Marcello ist bereit, nun selbst seine letzte Reise anzutreten.
Das Berner Symphonieorchester unter der musikalischen Leitung von Ivo Hentschel präzise und professionell mit viel Energie und Emotionen. In ff-Passagen erschien mir das Orchester gegenüber den Sängern eher zu laut. Es zwingt die KünstlerInnen auf der Bühne zu stimmlicher Parforceleistung, welche dem Schönheitsideal einer modernen Aufführung nicht unbedingt entspricht. Dramatik kann und muss auch anders als mit Lautstärke dargestellt werden!
 Als immer präsenten greisen Marcello erlebte ich auf der Bühne den Tenor John Uhlenhopp, welcher auch die Rollen von Benoit, Parpignol und Alcindoro übernahm. Die Interpretation Uhlenhopps ist sowohl gesanglich als auch darstellerisch makellos und überzeugend.
Als immer präsenten greisen Marcello erlebte ich auf der Bühne den Tenor John Uhlenhopp, welcher auch die Rollen von Benoit, Parpignol und Alcindoro übernahm. Die Interpretation Uhlenhopps ist sowohl gesanglich als auch darstellerisch makellos und überzeugend.
Vier Rollen in einer Person? Wieso dies? Dazu der Regisseur im Interview mit der Dramaturgin Katja Burri: Um dem Älterwerden ein Gesicht zu geben, fassen Sie die drei Charaktere Alcindoro, Benoît und Papignol zu einem zusammen. Was prädestiniert diese Figuren dazu, zum alten Marcello zu verschmelzen?
Auch hier lassen wir den Regisseur zu Worte kommen: In seiner teils schmerzhaften Erinnerung wird der alte Marcello zu einem Abbild all der älteren Menschen, denen er in jüngeren Jahren selbst respektlos begegnet ist. In einer bisweilen buffonesken Manier hat Puccini den vier Bohémiens Marcello, Rodolfo, Schaunard und Colline einen eher hässlichen und garstigen Umgang mit älteren Menschen angedeihen lassen – wobei dies sicher auch der komischen Operntradition entspringt.
Hervorragend, emotionell überzeugend mit sicherer Intonation und Diktion, die Sopranistin Evgenia Grekova, Ensemblemitglied im Konzerttheater Bern. Ihre musikalische Auffassung der Rolle überzeugt von Anfang an. Ihre Körpersprache unterstreicht zusammen mit ihrer Mimik ihre Zerrissenheit und ihre Liebe zu Rodolfo. Eine Spitzenleistung der anspruchsvollen Rolle. Ihre Schlussarie vierten Bild "Sono andati? Fingevo di dormire" im Duett mit Rodolfo überzeugt vom ersten bis zum letzte Ton.

Der dänische Tenor Peter Lodahl als Rodolfo ist ein ebenbürtiger Partner von Grekova. Seine gespielte Eifersucht um eine Trennung herbeizuführen überzeugt, seine Intonation und Diktion ist makellos (voller Hingabe und Liebe seine Arie "Che gelida manina") bis auf die Passagegen wo meines Erachtens das Orchester zu laut ist, dort leidet seine Stimme durch die erzwungene Lautstärke.
Als junge Musetta feiert die Ungarin Orsolya Nyakas im zweiten Bild einen triumphalen Auftritt. Auch Nyakas ist Berner Ensemblemitglied. Ihr strahlender Sopran, gepaart mit einer überzeugenden Musikalität und hoher darstellerischer Kunst, dominieren das zweite Bild im Cabaret Momo ohne dabei den Gesamteindruck zu zerstören. Sie lässt bei aller Virtuosität Platz für das gesamte Ensemble.
Als jungen Marcello sehen und hören wir den amerikanischen Bariton und Ensemblemitglied Todd Boyce. Er hat mich schon als Don Alfonso überzeugt. Als Marcello gefällt er mir noch besser, seine Persönlichkeit als Liebhaber, als eifersüchtiger Liebhaber spielt er überzeugender als den Zyniker Don Alfonso. Seine gesangliche Leistung ist überzeugend und präzise, sein kraftvoller Bariton immer präsent in sehr guter Diktion und Intonation.

Amüsant der in Prag geborene Bariton Michal Marhold als Schaunard. Er wirbelt als Transvestit grossgewachsen auf hohen Absätzen präzis singend über die Bühne. Eine durchaus originelle, der Bohémien Zeit im 19. Jahrhundert angemessen. Sein voller Bariton kontrastiert wunderbar mit seiner Rolle. Seine Schauspielkunst, seine Mimik und Gestik überzeugen bis zuletzt, wirken aber nie aufgesetzt, übertrieben.
Der Südkoreanische Bassist Young Known gefällt mit profunden kraftvollen Tiefen als Colline. Seine Mantel-Arie (Arietta) im vierten "Vecchia zimarra, senti" überzeugt durch präzise Tongebung und hervorragend gesungener Emotion.
Chor und Extrachor Konzerttheater Bern (Einstudierung Zsolt Czetner) präsentierte sich in Hochform. Amüsant war der Auftritt Kinderchor Singschule Köniz als "Batman's.
Für die Bühne verantwortlich war Kathrin Frosch. Die Lichtführung wurde von Bernhard Bieri entworfen. Die Kostüme zeichnete Ingo Krügler.
Den einzelnen Buhrufern ins Tagebuch geschrieben sei: Derjenige der nichts zu sagen hat, soll dies nicht mit reden (Buhen) beweisen! Nur fortschrittliche Ideen junger RegisseurInnen bringen das moderne Musik- und Sprechtheater weiter, erlauben eine Weiterentwicklung. Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.
Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die Arbeit des gesamten Teams mit langanhal-tendem Applaus.
Peter Heuberger 26.11.2018
© Fotos Annette Boutellier
COSI FAN TUTTE
Premiere am 14. Oktober 2018
Würde Mozart tindern, das ist hier die Frage?

Dating-Plattformen haben das Liebesleben des modernen Menschen grundlegend verändert. Ein interessanter Ausgangspunkt für den Regisseur Maximilian von Mayenburg, um in Mo-zarts Cosὶ fan tutte Fragen nach der allgegenwärtigen Selbstoptimierung, nach Täuschung und Echtheit zu stellen. Sind die potentiellen LiebespartnerInnen wirklich authentisch? Auf ihren Profilen inszenieren die UserInnen die scheinbar vorzüglichste Version ihrer selbst, es wird kaschiert, geflunkert, getäuscht. Aber wohin führt diese Selbstoptimierung in unseren Liebesbeziehungen?
Ein hoher Anspruch für einen Regisseur, all dies in einer Oper aus dem 18. Jahrhundert zu erzählen, klar zu machen. Von Mayenburg setzt seine ProtagonistInnen in eine After-Party-Situation, wo sie vom listigen Barkeeper Alfonso als Advocatus Diaboli zu wirren Liebesexperimenten in seiner Bar verführt werden.

Leider wird die Geschichte nicht schlüssig erzählt, gespielt. Zu vordergründig sind die Anleihen bei anderen Werken wie zum Beispiel die verklärenden/verfälschenden Brillen, bei Hoffmanns Erzähungen. Dazu kommt, dass die Anlage des Werkes zum Rampensingen verführt. Seine Personenführung ist statisch, auf die Rampe fixiert. Die Interaktion zwischen den ProtagonistInnen wirkt aufgesetzt und unglaubwürdig, ebenso die Körpersprache der KünstlerInnen auf der Bühne.
Oriane Pons als Fiordiligi überzeugt stimmlich durch ihre saubere Intonation; keine überflüs-sigen Vibrati und nicht zuletzt durch eine hervorragende Diktion. Sie hat Fiordiligi in sehr kurzer Zeit einstudiert, da die vorgesehene Sängerin krankheitshalber absagen musste. Pons war eigentlich vorgesehen als Despina. Diese musste also ebenfalls ersetzt werden. Die junge Sopranistin aus Ungarn, Orsolya Nyakas, meisterte diese Rolle hervorragend. Auch sie studierte den Part in sehr kurzer Zeit.

Als Dorabella konnte das zahlreich erschienene Premierenpublikum Eleonora Vacchi hören. Überzeugend sang auch Todd Boyce den Don Alfonso. Die beiden Liebhaber Giuglielmo und Ferrando wurden von Michael Marhold und Nazariy Sadivskyy dargestellt. Die musikalische Interpretation aller Sängerinnen und Sänger liess keine Wünsch offen. Ich bin aber überzeugt, bei besserer Personenführung könnte auch die darstellerische Leistung der Protagonistinnen und Protagonisten auf dasselbe Niveau gebracht werden.
Die Bühne wurde von Christoph Schubiger entworfen. Die Kostüme zeichnete Marysol del Castillo. Für die Lichtgestaltung war Bernhard Bieri zuständig. Der Chor Konzerttheater Bern, einstudiert von Zsolt Czetner, meisterte seinen Auftritt mit gewohnter Professionalität. Unter der Stabführung von Kevin John Edusei interpretierte das Berner Symphonieorchester Mozarts Werk mit viel Einfühlungsvermögen.

Das Premierenpublikum belohnte den Einsatz des gesamten Teams auf, vor und hinter der Bühne mit rauschendem Applaus und Bravirufen. Friedrich Nietzsche schrieb einmal: Die gute alte Zeit ist dahin, in Mozart hat sie sich ausgesungen.
© Tanja Dorendorf
Peter Heuberger 18.10.2018
Saison 2018/2019 Musiktheater Premieren
Stephan Märki (Bild unten), Intendant des Konzerttheater Bern hat seinen Musiktheater-Premieren vorgestellt. Das Berner Publikum wird ein ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zu hören und sehen bekommen.

6. Oktober 2018 ADAM SCHAF Georg Kreisler
13. Oktober 2018 COSI FAN TUTTE W. A. Mozart
24. November 2018 LA BOHEME Giacomo Puccini
27. Januar 2019 FIERABRAS Franz Schubert
24. Februar 2019 LOTARIO G. F. Händel
31. März 2019 REIGEN (Arthur Schnitzler) Philippe Boesmans
25. Mai 2019 TRISTAN UND ISOLDE R. Wagner
14. März 2019 HUMANOID Leonard Evers (UA)
Credit (c) Theater Bern
Peter Heuberger Basel 9.5.2018
TANNHÄUSER
Premiere am 25.03.2017
Nur schon um den Interpreten der Titelrolle erleben zu dürfen, lohnt sich die Reise nach Bern! Wie der junge schwedische Tenor Daniel Frank diesen Tannhäuser mit packender Intensität spielt und singt ist geradezu ereignishaft. Wann hat man je eine solch plastisch gestaltete Romerzählung gehört, voller Leidenschaft, Tragik und Verbitterung – und dazu ohne jegliche stimmlichen Ermüdungserscheinungen. Denn der Tannhäuser ist und bleibt eine der anspruchsvollsten und gefürchtetsten Tenorpartien aus Wagners Schaffen.

Doch Daniel Frank singt ihn mit fantastischer Leichtigkeit und Genauigkeit der Tongebung, dynamisch fein abgestuft, die Kräfte klug und stimmig disponierend. Dem lichten Timbre seiner kontrolliert und sauber ansprechenden, hervorragend fokussierten Stimme ist die baritonale Vergangenheit seines stimmlichen Werdegangs kaum mehr anzumerken. Hervorragend auch, wie Daniel Frank die schwierige Szene im Venusberg zu Beginn der Oper meistert: Verhalten steigt er ein in die Lobpreisung der Göttin, steigert sich von Strophe zu Strophe, legt an energischer Entschlossenheit zu. Und die braucht er auch, um sich von der selbstbewussten Venus loszueisen. Denn hier, in der Inszenierung von Calixto Bieito, ist Venus weder üppige Puffmutter noch ein Abbild eines Männerfantasien bedienenden Centerfold-Girls. Nein, hier ist die Venus eine Frau in ihren besten Jahren, welche sich ihrer sexuellen Bedürfnisse voll bewusst ist, sich zu nehmen weiss, was sie braucht. Claude Eichenberger verkörpert diese Frau mit bezwingender darstellerischer und stimmlicher Wucht, versteht es, den Heinrich Tannhäuser zu ihrem ergebenen Sexsklaven zu machen, holt sich den Cunnilingus, wenn sie ihn braucht, stillt ihr sexuelles Verlangen auch mal selbst oder reibt sich an dem verkehrt rumhängenden Geäst des schwülen Waldes.

Ihre Stimme strahlt eine herrlich herbe Erotik aus, kann durch Mark und Bein gehen, ohne hysterisch zu klingen. Toll!!! Ja, sie ist ein Naturphänomen, diese Venus – weckt Begehren und stösst in ihrer selbstsicheren Unerbittlichkeit auch ab. Eigentlich hätte man gedacht, die Szene im Venusberg sein eine Steilvorlage für den Regisseur Calixto Bieito, ein Regisseur, der sich in der Regel nicht scheut, Orgien, Sexualität und Gewalt mit handfester Körperlichkeit auf den Opernbühnen des Kontinents zu zeigen. Doch Bieito ist ein kluger Analyst und unterläuft die Erwartungshaltung manches Operngängers mit Subtilität. In dem von der Bühnenbildnerin Rebecca Ringst gestalteten Bühnenraum herrscht eine schwül-tropische Atmosphäre, die feuchte Hitze bringt zum Bacchanal die Venus, diese Frau im schwarzen Unterrock, in Wallung, die kopfüber rumhängenden Bäume sind das Ballett, Venus die einzige Tänzerin. Nebelschwaden, fahles Licht, eine Teichfolie als Boden. Dazu Wagners geniales Vorspiel mit dem für Paris komponierten Bacchanal, welches vom Berner Symphonieorchester unter der Stabführung von Kevin John Edusei mit transparenter Klangkultur gespielt wird, dem soghaften Duktus der Musik aber nichts schuldig bleibt.

Wunderbar setzt Edusei die geballten Höhepunkte, das Pilger- und Erlösungsmotiv wird mit architektonischer Finesse aufgebaut, bäumt sich hoch – und findet die exakte Entsprechung auch auf der Bühne. Von den sorgfältig herausgearbeiteten Arpeggien der Harfe und den chromatischen Wendungen des Bacchanal geht eine flirrende Sinnlichkeit aus, kann rabiat umschlagen, das gesamte Dirigat ist nie bloss zelebrierend, sondern richtet den Blick nach vorne, bleibt hochspannend, genau wie die Inszenierung, die insgesamt sehr schlüssig gehalten ist. Nachdem Tannhäuser sich dann von Venus losgesagt hat, findet er sich wieder in der Männergesellschaft seiner alten Kumpels von der Wartburg. Diese gebärden sich im ersten Akt wie eine Gruppe von Managern (oder Politikern), welche sich in einem dieser Trainingscamps befinden, wo sie im Wald ihren infantilen Männerritualen frönen dürfen. Sie ziehen sich aus, beschmieren sich mit Blut, Rangeleien um die Hackordnung brechen sich Bann, alles leicht homoerotisch aufgeladen, wenn auch die Sexualität durch eben diese „Bubenspielchen“ quasi ersetzt wird. Bieitos Dauerthema (Männer sind Schweine) schimmert immer wieder durch, auch im zweiten Akt. Hier, in der Halle der Wartburg, ist alles klinisch rein. Die dreischiffige, lichte Säulenhalle strahlt eine emotionale Kälte sondergleichen aus, das Lichtdesign von Michael Bauer unterstreicht diese unterkühlte, lustfeindliche Atmosphäre sehr gekonnt. Und man merkt es von Beginn an, der Tannhäuser wird sich in diese Gesellschaft mit ihren faschistoiden Zügen nie und nimmer einfügen können. Zwar ordnet er sich zu Beginn des Sängerwettstreits noch unter, legt den Hoody und die Schlabber-Combathosen zur Seite, zieht sich Hemd, Fliege, Sakko und feine Hose an (Kostüme: Ingo Krügler), wirft sich auch in Büssermanie bäuchlings auf den Boden wie alle anderen Minnesänger.

Lange hält er es allerdings nicht durch, alles wird ihm schnell zu eng. Kalt wie ihre Umgebung klingt auch die Stimme Elisabeths in der Hallenarie: Liene Cinča singt sie mit grosser, sauber geführter Stimme. Man spürt bei ihr deutlich die Enttäuschung, die Verbitterung über Tannhäusers Weggang, der sie in dieser unerfreulichen, die Frauen als zu begrapschendes Objekt behandelnden Männergesellschaft zurückgelassen hat. Sie scheint zu spüren, dass sie nie daraus wird ausbrechen können. Ihre mit grandioser Expressivität gesungene Phrase „Heinrich, was tatet ihr mir an?“ drückt all die Gefühle aus, welche Elisabeth empfindet. Der Regisseur hat diese Szene ganz besonders genau und textbezogen in Szene gesetzt, zeigt die Bedürfnisse Elisabeths mit exemplarischer Deutlichkeit. Wenn sie sich dann (nach dem turbulent endenden Sängerstreit) mit „Der Mut des Glaubens sei ihm neu gegeben“ für Heinrich einsetzt, geht das wahrlich unter die Haut. Auch ihr Gebet im dritten Akt „Allmächt'ge Jungfrau“ gelingt Frau Cinča ausgezeichnet, sie kann hier ihre Stimme wunderschön ins mezzopiano zurückführen. In Jordan Shanahans Wolfram von Eschenbach hat Elisabeth einen zweiten Verehrer, der in Bieitos Sicht auf das Werk aber beileibe nicht der seine Sexualität in geistiger Verklärung auflösende Gutmensch ist. Im Gegenteil: Er bleibt ein Rivale Heinrichs und ein unbeholfen grapschender Macho. Shanahan gibt ihn nicht mit balsamischem Wohlklang. Seine ausgesprochen und bewundernswert penible Diktion bewirkt eine gewisse Kurzatmigkeit bei den Phrasen, so dass z.B. das O du, mein holder Abendstern etwas eher Drängendes denn Tröstliches hat.

Ein interessanter Ansatz, den Shanahan mit seinem markanten, sauber intonierenden Bariton hervorragend umsetzt. Der Landgraf (Kai Wegner) ist ein gar unheimlicher Oheim Elisabeths und Landesfürst. Er beteiligt sich mit Lust an den Spielen der „wilden Kerle“ im Wald, gibt dann den Gastgeber auf der Wartburg und lebt nebenbei noch seine pädophilen Neigungen aus, indem er einen der Edelknaben auf den Schoss nimmt, ihn unangemessen tätschelt und ihm auf anzügliche Art und Weise einen Lollipop in den Mund schiebt. Das etwas flach intonierte „So bleibe denn unausgesprochen“ des Landgrafen erhält so eine ganz eigene, unerwartete Dimension. Unter der nach aussen so klinisch sauberen Fassade brodeln also dunkle Abgründe. Auch die anderen Minnesänger (besonders erwähnenswert der wie stets ausgezeichnet singende und engagiert agierende Andries Cloete als Walter von der Vogelweide) sind wahrlich keine Musterschüler an Keuschheit und Ritterlichkeit. Sie sind doppelzüngige, scheinheilige Männer, die sich genauso nach Freiheit von der autoritären Unterdrückung sehnen wie die Gäste auf der Wartburg (verkörpert vom Chor und Extrachor Konzert Theater Bern, Einstudierung: Zsolt Czetner), welche auch die Pilger verkörpern und den Chorpassagen dynamisch fein abgestuften Wohlklang und glutvolle Intensität einhauchen.
Wenn sie dann am Schluss über die zusammengeraffte Teichfolie zwischen den nun von der Natur wieder zugewucherten und quasi zurückeroberten Säulen der Halle zur Rampe gekrochen kommen, ein Halleluja anstimmen und von der Gnade Heil singen, dabei aber wie Gefangene die Hände nach Erlösung und Verlangen nach Freiheit in den Raum recken, so kommen einem doch berechtigte Zweifel am „seligen Frieden“. Ein paar störende Regieeinfälle sollen aber nicht verschwiegen werden, sie wiederholen sich bei Calixto Bieito leider in seinen eigentlich sehr genau konzipierten Inszenierungen immer wieder: Im dritten Akt rauscht zu Beginn 20 Minuten lang (akustisch störend) Wasser vom Bühnenhimmel zu Boden, nur mit dem Zweck, eine Pfütze zu haben, in welcher dann der von Elisabeth zurückgestossene Wolfram buchstäblich baden gehen kann. Auch das Finale II wird einmal mehr durch Bühnengeräusche „versaut“: Die Minnesänger schlagen mit Eichenlaub unaufhörlich und überaus laut auf Tannhäuser ein, kasteien und erniedrigen den in der Pose des Gekreuzigten (auch diese Pose hat man schon zu oft gesehen) an der Rampe stehenden Heinrich. Für mich ist diese Missachtung der Musik (wie in Bieitos Inszenierung von DER FLIEGENDE HOLLÄNDER in Stuttgart) ein absolutes No-go. Und sehr gerne würde ich einmal eine Inszenierung von Bieito sehen, in der Männer nicht nur Schweine sind, sondern auch positive Identifikationsfiguren darstellen können. So schlecht sind wir doch nicht (alle) ... .
Bilder (c) Philipp Zinniker, mit freundlicher Genehmigung KonzertTheaterBern
Kaspar Sannemann 2.4.2017
CALLAS
Tanzstück von Estefania Mirandas
Uraufführung
Besuchte Vorstellung vom 18.12.2016

Copyright: Philipp Zinnicker/ Stadttheater Bern
Das Leben der Maria Callas in einer Stunde und vierzig Minuten auf die Bühne zu bringen und abzuhandeln, in einem modernen Tanzstück und mit einer Sopranistin, ist im Ansatz spannend aber die Choreografin Estefania Miranda hat hier nur ein mässig geglücktes Werk erschaffen. Hätte man das Programmheft nicht intensiv gelesen, unter dem Titel „Wandelbare”, würde man das Geschehen auf der Bühne nur in kleinen Ansätzen verstehen.
Die Callas liegt auf dem Boden, Tod, einsam gestorben in ihrer Paris Wohnung. Tänzer und Tänzerinnen in Trauerkleidung füllen den Raum, umringen sie, verzerren sich und berauben sie; ihrer Kleider, Wertsachen, schlicht und einfach ihrer letzten Würde.
Die Callas hat alles für ihre Karriere gegeben, deshalb ist der Titel „Wandelbare“ nicht von der Luft gegriffen. Dieses Phänomen nimmt die Choreografin auf (wie es im Programmheft steht) und versucht ein Abbild zu schaffen, von ihrem Leben und die Wahrnehmung der Menschen um sie herum. Die Sopranistin singt und verkörpert die Callas. An ihrer Seite sind über die Länge des gesamten Stücks fünf Tänzerinnen gestellt, die jeweils in den Momenten des sich Neufindens in die Rolle der Callas schlüpfen und so die grossen Verwandlungen in ihrem Leben physisch reflektieren; Callas das Kind (Nozomi Matsuoka), Callas die Ehefrau (Angela Dematté), Callas an der Seite der Sängerin (Olive Lopez), Callas die Geliebte (Dafna Duduvich), Callas die Gefallene (Marieke Monquil). Von der verhassten Mutter (Pamela Monreale), vom ersten Mann und Manger Giovanni Battista Meneghini (Konstantinos Kranidiotis) bis zum geliebten Aristoteles Onassis (Winston Ricardi Annon) fehlt niemand in dieser Tanzgeschichte.
Die tanzenden Stellvertreterinnen sollen der singenden Callas die Möglichkeit geben sich selbst und ihr Leben von aussen zu betrachten und dadurch neu zu bewerten. Die Metaphern sind schwer erkennbar. Tänzerinnen in Bungee-Seilen befestigt, zeichnen die Abhängigkeit der Callas von Stimmbändern, Saiteninstrumenten oder sogar der Nabelschnur an. Die Callas als Kind mit ihrer verhassten Mutter Evangelista, mit ihr durchlebt sie ein Leben als drangsaliertes nicht bevorzugtes Kind. Vom Wunsch besessen eine berühmte Opernsängerin zu werden, gelingt ihr der grosse Sprung auf die Karrierebühne. Dargestellt durch die Übernahme einer Perücke, die den Wandel zum Star visualisiert. Das Eheleben mit Meneghini und die liebe zu Onassis wird ebenfalls skizziert dargestellt, wie auch das Comeback einer Legende die am Ende ist.
Der Auftritt in einer Freak-Show ähnlichen Zirkusdarbietung ist schlicht und einfach ein Fehlgriff der Choreografin. Dreibeinige Artisten, eine exaltierte Drag Queen, ein Feuerspeier, eine Beinlose Frau und viele weitere geschmacklose Figuren werden zum traurigen Versuch, die letzten Auftritte der Callas zu verschmähen. Eine wahrlich alptraumhafte Szenerie eines Comebacks welche die echte Maria Callas so in dieser Form nicht verdient hat.
Die Sopranistin Alexandra Lubchansky interpretiert die Arien; Casta Diva, Norma von Vincenzo Bellini, Ebben ne andro lontana aus La Wally von Alfredo Catalani, Ah, non credea mirarti aus der Sonnambula von Vincenzo Bellini, E strano …. Ah, forse e lui aus La Traviata von Giuseppe Verdi, Un bel di vedremo aus Madama Butterfly von Giacomo Puccini und Vissi d’Arte aus Tosca ebenfalls von Giacomo Puccini.
Maria Callas hatte eine sehr markante Stimme und eine für sie bestimme spezielle Art der Interpretation, sodass man etwas Mühe hatte mit der kantig-scharfen Stimme der Alexandra Lubchansky, obwohl sie die Arien bravurös vortrug. Am besten gelang ihr die Cio-Cio-San aus der Madama Butterfly.
Das Ballett hat hervorragend getanzt und die moderne Musik von Phylipp Glass, Michael Nyman und Wojciech Kilar technisch perfekt vorgetragen.
Das Orchester unter der profunden Leitung von Jochem Hochstenbach wurde glanzvoll und souverän geführt.
Trotz allem zeigt sich, dass ein Leben wie das einer Maria Callas nicht so einfach visualisierbar ist. Einerseits verstehen die Fans der Callas die Entrückung der Geschichte in verzerrten Bildern nicht wirklich und anderseits passt die moderne Musikgestaltung nicht in ein vergangenes Leben einer anderen musikalischen Epoche. Die Geschichte um das bewegte Leben der Maria Callas ist in dieser Form vom Tanzstück mit bewegten Bildern kaum zu erkennen.
Marcel Paolino 30.12..2016
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere am 6.2.2016
Für Opernfreunde ist es Allgemeinwissen, dass die Zensur Neapels die dort geplante Uraufführung des „Ballo in Maschera“ auf Grund des Königmords platzen liess, Rom als Einspringer die Verlegung der Handlung aus Europa weg nach Nordamerika durchsetzte. Und somit wurde schon 1859, ein erstes Mal ein Werk in ein anderes Milieu verpflanzt. Verdi’s Maskenball, Werk mit dramaturgisch sehr stringentem Plot, eignet sich geradezu für andere Örtlichkeiten, Dreiecksgeschichten gibt es allerorten, der Mord könnte sich am Wiener Opernball, einem Faschingsball in Deutschland, einem Fasnachtsball in der Schweiz, einem Ball der HighSociety oder in einer Disco ereignen, die Wahrsagerin Ulrica lässt man ohne Sinnentfremdung zur Astrologin oder zum Medium mutieren. Vielleicht ist es gerade dieser Handlungs-Geradlinigkeit geschuldet, dass Regisseure erstaunlicherweise bei diesem Oeuvre meist eher brav am Original bleiben. Mir bleibt nur eine brandaktuelle Inszenierung in Erinnerung haften, als in den Neunzigerjahren zur Zeit der Clinton/Lewinsky-Affäre Zürich das Werk im Oval Office des Weissen Hauses spielen liess.

Nun auch KonzertTheater Bern in der Regie von Adriana Altares hat sich für Nordamerika entschieden, zeigt – was weit wichtiger ist als die Örtlichkeit – Riccardo als ein Gouverneur, der an Kunst, Theaterspiel und Geld ausgeben, nur in geringem Mass an Politik und seinen Geschäften interessiert ist. Das äussert sich einmal bildlich (Bühne: Christoph Schubiger), dass in seiner Residenz renoviert wird, zum andern dass er Kostüme (Nina Lepilina) und Verkleidungen mag. Sein spielerischer Charakter ist in der Handlung durchaus vorgegeben: er begibt sich mit seiner Entourage zur angeklagten Ulrica um sich selbst ein Bild zu machen, um unerkannt zu bleiben verkleidet er sich, spontan gibt er Geld aus um deren Prophezeiung für den Matrosen wahr werden zu lassen. Auch musikalisch ist dieser Charakterzug nach der für ihn fatalen Voraussage seiner eigenen Zukunft durch „è scherzo od è follia…“ und dem sich anschliessenden Ensemble mit Chor klar legitimiert. In dieser Grenzsituation flüchtet er sich ins Spiel, in einen eigenen, beinahe kindlichen Fantasie-Kosmos.

Frau Altares unterstreicht ihre Grundidee, dass das Werk durchaus auch eine komische Seite hat, durch eine sehr genaue, differenzierte Führung der beiden bassgewaltigen Verschwörer Samuel (Kai Wegner) und Tom (Pavel Shmulevich), die nicht wie üblich nur in einer Ecke stehen und bös dreinschauen, sondern schon fast Mephisto-ähnlich immer mal wieder aktiv in die Handlung eingreifen. Ein wahrer „coup de théâtre“ gelingt der Regisseurin auf dem Friedhof zum Abschluss des zweiten Akts, wenn die als Mordwaffe vorgesehenen Golfschläger der Verschwörer nach der überraschenden Demaskierung Amelias und dem damit verbundenen musikalischen Stimmungsumschwung zum Spottchor hin zum Geigenbogen umfunktioniert werden. Das nimmt Dr.Mirakel-grotesk-hoffmanneske Züge an und unter dem Hohngelächter wird Amelia betatscht, zur Prostituierten degradiert. Daumen hoch für die konsequente, lebendige Regie, auch wenn zwei-drei kleine Einfälle überflüssig waren.
Kevin John Edusei spielt mit dem Berner Symphonie Orchester einen dynamisch sehr differenziert-abgestuften Verdi, allerdings wird es einige Male arg knallig, schlicht zu laut. Und noch ein Einwand: die Übergänge zur Bühnenmusik und eine zusätzliche Einspielung ab Konserve/Aufnahme (?) waren in der Lautstärke zu wenig abgestimmt, aber das lässt sich korrigieren. Wunderschön hingegen das Solo des Englischhorns in Amelias erster Arie. Der Chor, wie immer von Zsolt Czetner bestens einstudiert, war voll bei der Sache und die Balance der einzelnen Stimmen machte Freude.

Zu den Sängern: Die beiden Kleinstpartien/Wurzen waren mit Mariusz Chrzanowski und Andres del Castillo adäquat besetzt, der Silvano des Wolfgang Resch wusste weniger zu gefallen, stark die bereits oben erwähnten Verschwörer Samuel und Tom, Letzterer im Sinne der Regie äusserst spielfreudig. Yun-Jeong Lee war Oscar, vom Charakter her als androgyner Begleiter des Vorgesetzten gezeichnet: die Stimme der Koloratursopranistin aus Korea ist gewachsen, hat aber ihre Agilität bewahrt, das bewies die federleicht-überzeugend präsentierte Arie im Schlussbild. Zu Beginn schien sie mir nervös, sang einige Hochtöne mit Überdruck. Die Serbin Sanja Anastasia hauste in einem Wohnwagen, ging ihrer Arbeit unter einer Autobahnhochstrasse nach, sang die schwierige Partie der Seherin ausdrucksstark wie manche Ulrica-Kollegin mit zwei nicht ganz verblendeten Stimmregistern. Die gesangliche Krone der Aufführung geht ganz eindeutig an die wunderbare Amelia der Miriam Clark: ein erlesenes Timbre, eine technisch sauber geführte Stimme, die selbst im zartesten Piano bis in den hintersten Winkel trägt, doch auch in Expansion zu dramatischen, wunderbar runden, dem Ohr schmeichelnden Akzenten befähigt ist … grossartig! Der Mexikaner Juan Orozco war ein Renato, der den Anforderungen dieser Baritonpartie mehr als gerecht wurde, insbesondere berührte seine differenzierte Darstellung, die Entwicklung vom Freund-Kollege-loyaler Mitarbeiter des Chefs hin zum wütenden Ehemann, der trotz seiner Enttäuschung seine Gattin noch immer liebt.

Alessandro Liberatore hat erfreulich viele, wenn auch nicht alle Facetten der Regievorgabe umsetzen können, die Versetzung seines untergebenen Freundes und damit der Verzicht auch auf Amelia wurde schwermütig überzeugend vermittelt, die spielerische, locker-leichte Seite, die ich mir mit einer Herzogattitüde des Rigoletto-Herzogs gewünscht hätte, kam weniger ausgeprägt herüber. Der Künstler hat das Potenzial, alle Töne für diese Zwischenfach-partie, allerdings schien mir sein Tenor ab und an leicht gefährdet, etwas belegt zu sein, wie nach einer erst kürzlich überwundenen Verkühlung, nicht ganz frei zu strömen.
Résumé: ein Erfolg von unbestrittener Qualität an einem kleinen Haus und als Folge einhelliger, begeisterter Beifall beim Premierenpublikum für eine schlüssige Interpretation.
Bilder (c) Philipp Zinniker / Theater Bern
Alex Eisinger 12.2.16
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
SALOME
Premiere am 17.01.2015
Das Abstoßende im Menschen hervorgehoben
Lange, sehr lange hat sich Richard Strauss Zeit gelassen, bevor er sich in seinem Schaffen dem Musiktheater zugewandt hat. Mit seinen sinfonischen Dichtungen (u.a. Don Juan, Till Eulenspiegel, Also sprach Zarathustra) hat er sich das Handwerk des genialen Instrumentationskünstlers angeeignet, die farblichen Möglichkeiten des grossen Orchesters wie kaum ein zweiter ausgelotet und zur Perfektion getrieben. Nach zwei eher erfolglosen Versuchen im Bereich des Musikdramas (GUNTRAM, FEUERSNOT) fand er im Alter von beinahe 40 Jahren in Oscar Wildes SALOME endlich den Stoff für sein bahnbrechendes Werk. SALOME kann man als erste deutsche Literaturoper bezeichnen, die aristotelische Einheit des Dramas (Zeit, Ort, Handlung) ist in geradezu exemplarischer Weise gewahrt. Die Figur der femme fatale (und der entsprechenden Männerphantasien ...), welche in ihrem selbstbestimmten sexuellen Begehren auch immer den Tod als Ziel in sich trägt, hatte bereits andere Werke des ausgehenden 19. und beginnenden 20 Jahrhunderts beeinflusst (Delila, Thaïs, Carmen – später Lulu).
Die Komposition wurde von den bedeutendsten Zeitgenossen (Puccini, Mahler, Berg, Schönberg) als wichtigstes Ereignis im Bereich der Oper seit Wagners TRISTAN UND ISOLDE bezeichnet. Strauss schrieb eine packende, erotisch schwülstige und trotz ihrer Komplexität die Grenzen der Tonalität kaum verlassende Musik. Auch der riesige Orchesterapparat wurde von ihm mit grandioser Raffinesse eingesetzt. Nur in ganz wenigen, dramatisch zugespitzten Momenten entlädt sich die volle Wucht des Orchesters. Ansonsten herrscht ein ausgeklügelter Parlandostil vor, gespickt mit ariosen Aufschwüngen, untermalt von einem - in idealen Interpretationen – farblich fein abgestuften, transparenten und ungemein sinnlichen Orchesterklang, einem kunstvollen Stimmengeflecht.

Die Titelrolle gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben für Sopranistinnen im lyrisch-dramatischen Fach. Obwohl Salome oft mit hochdramatischen Sopranen besetzt wurde und wird (Nilsson, Borkh, Gwyneth Jones), liegt die Partie auch schlankeren Stimmen ausgezeichnet, da das Orchester die Sängerin eigentlich kaum zudecken sollte. Viele der besten Salomes waren eher lyrische Soprane (Welitsch, della Casa, Rysanek, Malfitano und vor allem Montserrat Caballé in der empfehlenswerten Einspielung unter Erich Leinsdorf).
„Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht ...“ schmachtet Narraboth zu Beginn der Oper. Nun, die Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters – oder ist Narraboths Beschreibung der judäischen Prinzessin gar als purer Sarkasmus zu verstehen? Wie dem auch sei, von „Schönheit“ ist in dieser Neuproduktion von KonzertTheaterBern rein gar nichts zu sehen. In Kostümen, die an Hässlichkeit kaum mehr zu überbieten sind (Katrin Wittig) und in einem kalten Bühnenraum (Ric Schachtebeck), der die seelische Leere der Bewohner und ihrer Gäste spiegelt, stellt Regisseur Ludger Engels das konzentrierte Drama in grausig-intensiver Konsequenz auf die Bühne. Es gelingt dem Inszenierungsteam dabei vortrefflich, uns mit den psychischen Deformationen der Figuren in ihrer abscheulichen, perversen Ausgestaltung zu konfrontieren, die wahrlich unschönen Seiten menschlicher Abgründe, welche Oscar Wilde in seinem Text und Richard Strauss in seiner schlicht genialen Tonsprache sublimierten an die Oberfläche zu transportieren. Immer wieder deckt Ludger Engels dabei unerfüllte Sehnsüchte, Wünsche, verschüttete Emotionalität auf, welche die Personen aufgrund ihrer Verderbtheit, ihrer Neurosen und ihres Klammerns, ihres Ausgeliefertseins an Macht, Fanatismus und religiöse Doktrin nicht zuzulassen im Stande sind . Exemplarisch gelingt ihm dies in der Charakterzeichnung des gefangenen Propheten Jochanaan, der durch Salomes Begehren scheinbar erstmals mit seinen eigenen sexuellen Bedürfnissen konfrontiert wird und diese nicht akzeptieren kann und will, sich deshalb in widerlichste Selbstkasteiung flüchtet. Oder in den wenigen kurzen Momenten des Glücks zwischen Narraboth und Salome, wo die beiden sich wie verliebte Backfische Huckepack nehmen und endlich die Kindheit leben, welche wohl beide nie gehabt haben.
Salome ist ganz das Produkt ihrer Mutter Herodias, sie scheint ihr das Tanzen, das erotische Verführen, die Macht des weiblichen Körpers beigebracht zu haben – und dabei wirkt die Mutter jünger als die Tochter, denn Salome ist eine Kindfrau, ein Geschöpf, das nie Kind sein durfte und dem so wichtige entwicklungspsychologische Schritte schlicht vorenthalten wurden. Nur so ist die Abscheulichkeit ihres perversen Begehrens nach dem Kopf des Propheten erklärbar. Herodes wird als nervliches Wrack (manisches Zittern der Hände) gezeichnet, politisch unentschlossen, schwach, wohl auch impotent (und deshalb nach einem letzten verbotenen Kick, dem Sex mit der Stieftochter, suchend), vom Alkohol umnebelt. Bezwingend gelingt dem Regieteam auch die Charakterzeichnung der Nebenfiguren: Die beiden Soldaten (in schicken Anzügen von Bodyguards), einer als gläubiger Anhänger der neuen Religion, der andere durch und durch korrupt (Bestechung durch den neugierigen Kappadozier). Beide vortrefflich gesungen von Iyad Dwaier und Daniel Mauerhofer. Interessant und kontrovers auch die Zeichnung der fünf Juden (Andries Cloete, Michael Feyfar, Angel Petkov, Andrés Del Castillo und Nuno Dias singen die schwierigen Passagen sehr gut und bringen es fertig, nie keifend zu wirken!). Bei all diesen Religionsfanatikern, inklusive der beiden Nazarener (Kai Wegner, Wolfgang Resch), gelingt es Salome durch den sehr durchdacht, abgefeimt und die zarte musikalische Verästelung genau gestaltenden Tanz, die (auch homoerotischen) Bedürfnisse dieser Männer aufzudecken und für kurze Zeit unter einem riesigen Schleierzelt zuzulassen.

Die Salome sollte einerseits eine mädchenhafte, leichte und helle Farbe haben, andererseits aber auch über das grosse Orchester triumphieren können, ohne forciert zu wirken. Allison Oakes gelingt dies mit bewundernswerter Kondition, sie lässt bis zum schrecklich-schönen Schlussgesang keinerlei stimmliche Einbrüche oder gar Schonung zu. An einigen Stellen hätte die Gesangslinie durchaus noch etwas mehr an Differenzierung und dynamischer Abstufung ertragen können. Ihre Darstellung der allzu früh zum Erwachsenwerden gezwungenen Frau allerdings gelingt packend und unter die Haut gehend. Unvergesslich, wie sie trotzig schmollend auf ihrem Kinderstühlchen sitzt, dann wieder mit gespreizten Beinen Herodes unter ihre Hotpants schielen lässt. John Uhlenhopp gibt den schwachen Tetrarchen mit biegsamer, sehr gut fokussierter Stimme, verfällt nie in hysterischen Sprechgesang sondern lotet den Text intelligent aus. Claude Eichenberger verleiht der Herodias durch ihren satten, sicher und durchschlagkräftig eingesetzten Mezzosopran und ihr subtiles Spiel eine beeindruckende Präsenz. Grossartig, wie sie ihre Verbundenheit mit ihrer Tochter im Tanz zeigt, herrlich, wie sie sich während Herodes vergeblichen Umstimmungsversuchen zu Salomes Begehren die Klunker vom Hals reisst in der Erkenntnis, dass ihre Zeit wohl abgelaufen ist. Im letzten Moment, bevor dann alles aus ist, bemächtigt sie sich jedoch wieder ihres Schmuckes, denn man weiss ja nie, ob er nicht doch noch zu etwas nütze sein könnte ... . Aris Argiris singt den Jochanaan in seiner Plexiglaszelle (akustisch nicht ganz unproblematisch) mit wohlklingendem Bariton, manchmal leicht kurzatmig und Phrasen nicht rund beendend. Packend ist jedoch sein Spiel, sein Aufbäumen gegen seine Bedürfnisse als Mann, das nicht Zulassen seiner eigenen Sexualität. Michael Feyfar ist ein wunderbar lyrischer Narraboth, welcher die schmachtenden Phrasen mit jugendlicher Emphase zum Klingen bringt. Nach seinem Selbstmord wird er auch noch als zweiter Jude eingesetzt. Dafür müssen ihn die Bodyguards in vorauseilendem Gehorsam von der Bühne fegen, bevor Herodes befiehlt „Fort mit ihm!“ ... . Sophie Rennert weiss stimmlich als der besorgte und in Narraboth verliebte weibliche Page zu gefallen, welcher das Unheil von Anbeginn weg kommen sieht (Schreckliches wird geschehn).
Kevin John Edusei bringt mit dem Berner Symphonieorchester die schillernde Farbenpracht, das Oszillierende und unterschwellig erotisch aufgeladene der Partitur zum Blühen. Der Dirigent lässt den Sängern Zeit für auf grossem Atem durchgestaltete Phrasen, deckt sie nicht mit den Orchesterwogen zu und sorgt damit auch für eine gute Textverständlichkeit.
Fazit: SALOME wäre als kulinarisch üppig parfümierter Pseudo-Historienschocker wohl kaum zu ertragen. Diese psychologisch feinnervig durchdachte Regiearbeit von Ludger Engels bringt uns die Figuren näher – auch wenn wir sie hässlich und überaus abstossend finden. Weitere Aufführungen in Bern: 17.1. | 25.1. | 28.1. | 3.2. | 14.2. | 21.2. | 8.3. | 15.3.2015
Kaspar Sannemann, 17.01.2014 Fotos: Annette Boutellier
Originalbeitrag auf oper-aktuell
Die ungetreue Zerbinetta
ARIADNE AUF NAXOS
Premiere am 03.05.2014 (2. Fassung)
Das Ernste auf die Schippe und das Lustig-Komische ernst genommen
ARIADNE AUF NAXOS ist nach ELEKTRA und DER ROSENKAVALIER die dritte gemeinsame Arbeit des Gespanns Strauss/Hofmannsthal. Ursprünglich war das Werk als Einlage für Hofmannsthals Bearbeitung von Molières Komödie DER BÜRGER ALS EDELMANN gedacht. In dieser Form wurde es auch am 25. Oktober 1912 in Stuttgart uraufgeführt. Die Oper von Strauss wurde also in das Schauspiel eingebettet und ohne das später komponierte Vorspiel gegeben. Doch diese Kombination von Schauspiel und Oper setzte sich nicht durch. Also machten sich Strauss und Hofmannsthal an eine Überarbeitung: Nun wurde dem Einakter ein Vorspiel vorangestellt, der Komponist erhielt eine herrliche Gesangspartie. Die Urfassung mit ihrer langen (und z.T. unendlich geschwätzigen) Spieldauer erscheint nur noch selten auf den Spielplänen, zuletzt 2012 in Salzburg. Die Zweitfassung mit ihrer kammermusikalischen Transparenz hingegen erfreut sich – vor allem unter Strauss-Liebhabern – grosser Popularität. In den Phrasen des Komponisten, dem Leiden der Ariadne, dem Schlussduett und natürlich den mit Schwierigkeiten gespickten, ausgedehnten Koloraturen der Zerbinetta darf man quasi Strauss at his best erleben!

Bettina Jensen (Primadonna/Ariadne)
Das Ernste auf die Schippe und das Lustig-Komische ernst zu nehmen – dies ist der Regisseurin Lydia Steier und ihrem Ausstattungsteam (Bühne: Katharina Schlipf, Kostüme: Ursula Kudrna, Licht: Bernhard Bieri) mit der kongenialen Umsetzung von Strauss'/Hofmannsthals ARIADNE AUF NAXOS im Berner Stadttheater wunderbar gelungen. Im Vorspiel taumelt der junge Komponist, erfüllt von jugendlichem Enthusiasmus, auf die leere Bühne. Er kann sein Glück kaum fassen: Seine Oper, sein Erstlingswerk, wird auf dieser Bühne uraufgeführt werden. Sophie Marilley hat den Komponisten an diesem Abend ganz kurzfristig übernommen – und löst die Aufgabe fantastisch! Ihre schlanke Gestalt ist wie geschaffen für die Rolle, sie gibt den jungen Schnösel mit Samtjackett und Elvis-Schmachtlocke mit burschikosem Elan und herrlich satter Stimmgebung. Das Licht im Zuschauerraum bleibt während des Prologs an, wir werden Teil der problematischen Vorbereitungen für den vom „reichsten Manne in Wien“ gesponserten Event. Dieser Mann tritt tatsächlich auf, als Tattergreis im Rollator, die Kaugummi kauende blonde Nutte stets an seiner Seite. Selbstverständlich kommen die beiden dann auch verspätet zur Aufführung der Oper nach der Pause und der Dirigent, Thomas Blunt, muss das Vorspiel unterbrechen und dann nochmals von vorne beginnen. Herrlich! Uwe Schönbeck ist als Haushofmeister das Sprachrohr dieses Greises und erfüllt die Aufgabe mit schmieriger Geschmeidigkeit hervorragend. Kai Wegner, in ausgebeulten Hosen und schlecht sitzendem Sakko wie ein zerstreuter Professor wirkend, steht dem Jungspund-Komponisten mit väterlichem Rat und wohlklingendem Bassbariton zur Seite. Während dieses turbulenten Vorspiels wird die Bühne allmählich hergerichtet – und Lydia Steier und Katharina Schlipf lassen dazu aus zwei gigantischen Containern augenzwinkernd eine Unzahl an Versatzstücken des modernen Regietheaters auffahren: Blinkende Kreuze, ein abgeschnittener Finger, Waschmaschinen, Kühlschrank, ein Klo mit blutverschmiertem Graffiti (Theseus), ein geschächteter Stier, eine Büste Lenins, ein blauer Riesenteddy, ja selbst das obligate Hakenkreuz darf nicht fehlen, wird aber vom Inspizienten schnell wieder weggewunken. Der Tanzlehrer (umwerfend tuntig Andries Cloete) führt die Truppe Zerbinettas ein, Primadonna und Tenor bekriegen sich aus den Proszeniumslogen. Doch dann ist da plötzlich der intime Moment zwischen dem Komponisten und Zerbinetta, in dem Zerbinetta, die Heitere, ihre Empfindsamkeit offenbart – und die Regisseurin lässt dazu den roten Vorhang schliessen, der Komponist und Zerbinetta (Yun-Jeong Lee) stehen allein davor. Ein zu Tränen rührender Moment, von Yun-Jeong Lee und Sophie Marilley mit viel Empfindungskraft gestaltet.

Andries Cloete (Brighella), Michael Feyfar (Scaramuccio), Wolfgang Resch (Harlequin), Yun-Jeong Lee (Zerbinetta), Pavel Shmulevich (Truffaldin)
Nach der Pause dann die Oper: Ariadne gleicht Bette Davis in Whatever happend with Baby Jane, ein Frau, die sich vom Schicksal gezeichnet besäuft und in die Rolle des kleinen Mädchens flüchtet, übermässig geschminkt, in Puppenkleidern. Bettina Jensen hält fast bis zum Schluss beharrlich an dieser Regieanweisung fest, singt mit wunderbar zarter Tongebung ihre grosse Szene, baut die Höhepunkte dynamisch klug auf. Doch trotz Harlequins Mitleid (sehr schön gesungen von Wolfgang Resch) stülpt sich die Szenerie von LA CAGE AUX FOLLES (oder eben DIE UNGETREUE ZERBINETTA) über die Trümmer des unsinnigen Regietheaters und die Zerbinetta schwebt im Goldregen in einem goldenen Bauer vom Bühnenhimmel und hat als androgyne Varieté-Chefin ihren grossen Auftritt – und was für einen! Mit stupender Intonationssicherheit turnt Yun-Jeong Lee virtuos und glockenrein durch die Koloraturen. Fantastisch! Während des wunderschönen nachfolgenden Quintetts der Varieté-Truppe (neben Yun-Jeong Lee und Wolfgang Resch stöckeln Andries Cloete, Michael Feyfar und Pavel Shmulevich gekonnt in Highheels als schrille Transvestiten über die Bühne) zieht sich Ariadne Zeitung lesend aufs Klo zurück, reisst dem Teddy schon mal ein Ohr ab und wartet auf den Auftritt Bacchus' aus dem Kühlschrank. Michael Putschs Circe Rufe erschallen aus dem Off noch etwas wackelig, sobald er jedoch auf der Bühne steht, glänzt er in der diffizilen Tessitura mit sicher und kräftig erreichten Höhen, die auf solidem, baritonal gefärbtem Fundament aufbauen. Lange Zeit haben Najade, Echo und Dryade (Ani Taniguchi, Camille Butcher und Nonoslava Jaksic) in Puppenkostümen und mit Wischmopps regietheatermässig sinnlos die Bühne gefegt, doch mit dem Auftritt des Bacchus verändert sich alles: Die betörende Musik des Komponisten entfaltet ihre Macht, die Perücken und die unsäglich doofen Kostüme werden abgelegt, der sinnentleerte Regietheatermüll wird in die Container verpackt, die Glitzervorhänge niedergerissen. Wir befinden uns wieder auf der leeren Bühne. Die Stimmen der Ariadne und des Bacchus blühen wunderbar auf in ihrem Schlussduett – es gibt ein „Hinüber“, wir sind ergriffen, dazu bedarf es weder des Baldachins noch des Sternenhimmels, es reicht die tröstende Kraft der so fein ziselierten Musik, welche von den Musikerinnen und Musikern des Berner Symphonieorchesters unter der einfühlsamen Leitung von Thomas Blunt aus dem Graben erklingt. Der Komponist stürmt wieder auf die leere Bühne. War es am Ende gar bloss ein Traum?

Kai Wegner (Musiklehrer), Bettina Jensen (Primadonna), Claude Eichenberger (Komponist), Andries Cloete (Tanzmeister), Yun-Jeong Lee (Zerbinetta), Michael Feyfar (Scaramuccio), Pavel Shmulevich (Truffaldin)
Fazit: Wunderbar witzig, ein bisschen böse - und intelligent! Doch warum ist ARIADNE AUF NAXOS Kassengift? Das Haus war an diesem Samstagabend kaum zur Hälfte besetzt ... ein ähnliches Schicksal war schon den ebenfalls sehr gelungenen Produktionen in St.Gallen, Freiburg und z.T. selbst den starbesetzten Aufführungen in Zürich beschieden. Weitere Aufführungen in Bern: 19.4. | 26.4. | 29.4. | 3.5. | 10.5. | 13.5. | 18.5. | 25.5.2014
Kaspar Sannemann, 03.05.2014 Fotos: © Annette Boutellier
Der Originalbeitrag steht bei www.oper-aktuell.info/kritiken
Giuseppe Verdi
MACBETH
Besuchte Vorstellung: 27.01.2013 (Premiere)
Zeitlebens hat sich Verdi mit Shakespeare beschäftigt, erkannt in dessen Werken riesiges Potential für das Musiktheater und setzte drei Werke des englischen Dichters in Musik: MACBETH, OTELLO und FALSTAFF. Mit KING LEAR beschäftigte er sich ebenfalls ausgiebig, gelangte jedoch nie zur Niederschrift einer Partitur und vernichtete schliesslich sämtliche Skizzen.
MACBETH stellte 1847 geradezu ein revolutionäres Werk dar: Keine Liebesgeschichte, eine Handlung voller Blut und Düsternis, der Tenor in einer Nebenrolle (Macduff). Von der Kritik wurde das Werk abgelehnt, das Publikum der Uraufführung feierte zwar den Komponisten mit 38 Vorhängen, doch so richtig durchsetzen konnte sich MACBETH nie. Für Paris arbeitete Verdi seine Lieblingsoper etwas um, fügte das obligate Ballett ein, komponierte für die Lady eine neue Arie im zweiten Akt (La luce langue), der Chor der vertriebenen Schotten (O patria oppressa) und ein neuer Schluss für den vierten Akt kamen dazu. Dafür wurde Macbeths Sterbeszene geopfert, welche nun in Bern wieder ins Werk aufgenommen werden wird. Als Schlachtmusik griff Verdi, der sonst mit traditioneller Schulmusik nicht allzu viel am Hut hatte, auf eine Fuge zurück, da ihm deren Reibungen und Gegenüberstellungen von Themen als besonders angemessen dafür erschienen. Doch auch die Pariser Fassung war seinerzeit heftig kritisiert, ja gar als „unshakespearisch“ bezeichnet worden, was den Shakespeare-Kenner und –Verehrer Verdi ganz besonders schmerzte. Erst nach 1920 erkannte man die immensen Qualitäten des Werks und seine herausragende Stelle im Schaffen des Komponisten auf dem Weg von den konventionellen Anfängen zum echten Musikdrama, mit psychologisch feinsinnig und intelligent durchformten Charakteren. Gerade mit der Figur der Lady ist ihm eine Gestalt gelungen, die sich wie ein erratischer Block aus der italienischen Opernlandschaft erhob: Eine Frau, die mit hässlicher, rauer, hohler aber auch Mark und Bein durchdringender Stimme und dann wieder in tragfähigstem Piano flüsternd zu singen hatte, keine Sympathien erwecken durfte – eine Sängerin mit diabolischer Klangfarbe ist gefordert. Die Partie wurde im 20.Jahrhundert sowohl von Sopranistinnen (Callas, Rysanek, Barstow, Zampieri), hochdramatischen Sopranen (Nilsson, Dame Gwyneth Jones) als auch von dramatischen Mezzosopranistinnen erfolgreich verkörpert (Cossotto, Verrett, Ludwig).

Kritik: Mutig, brisant und relevant - Konzert Theater Bern verblüfft, wühlt auf und begeistert mit einer im besten Sinne des Wortes radikalen (an die Wurzeln gehenden) Aufführung von Verdis ambitioniertem Musikdrama. Sowohl Robin Adams als auch Fabienne Jost gelingen Gänsehaut erregende Darstellungen des mörderischen, von den Verführungen der Macht korrumpierten Duos. Geradezu unheimlich genau die Personenführung von Ludger Engels, grossartig die Kostümdramaturgie (Moritz Junge) und bedrückend das kalte "Kanzlerbungalow" Bühnenbild von Ric Schachtebeck. Pavel Shmulevich (als wunderbar sonorer Banquo), Adriano Graziani (ein Macduff mit hellem wunderschön phrasierendem Tenor) sowie Claude Eichenberger und Andries Cloete (Dama und Malcolm) komplettieren das begeisternde Ensemble. Prägnante Akzente setzt Srboljub Dinic mit dem Berner Symphonieorchester.
Mut beweist das Theater Bern mit der Wahl des Werks zum Verdi-Jahr: Nicht einer der landauf, landab bekannten Reisser des Maestros wird präsentiert, sondern mit der Berner-Fassung des MACBETH ein Werk, welches zwar von Kritikern, Sängerinnen/Sängern und aficionados hoch geschätzt, ja zu Recht abgöttisch geliebt wird, den Durchbruch zum Publikumsmagneten aber (noch) nicht geschafft hat. Denn mit dieser Shakespeare Adaption ist dem jungen Verdi ein mutiges, für die damalige Zeit geradezu revolutionäres und verstörendes Drama gelungen. Dass das Werk nichts an seiner Brisanz und Relevanz verloren hat, zeigt die Berner Produktion auf eindringliche Art und Weise. Die Inszenierung von Ludger Engels lässt uns nicht wohlig schauernd zurücklehnen und dabei etwas Theaterblut und schotttischen Nebel geniessen, sondern rüttelt auf, dringt zum Kern des Werkes vor, zeigt die höllische Spirale des korrumpierten Strebens nach Macht parabelartig im an den Bonner Kanzlerbungalow gemahnenden Raum, welchen Ric Schachteback entworfen hat.

Eine brutale Geschichte, wie sie sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder ereignet hat und ereignen wird, läuft mit atemberaubender Spannung vor unseren Augen ab, ein veritabler Psycho- und Politthriller mit Tiefgang. Denn Engels hat die Figuren und deren seelische Zustände genau unter die Lupe genommen, seziert sie quasi vor unseren Augen. Subtilste (auch mal zärtliche und zum Schmunzeln verführende!) Regungen, stumme Mundbewegungen, aber auch Schreie, Sarkasmus und Hohn fliessen in die Personenführung ein – Musiktheater vom Feinsten! Einige Erklärungsversuche für das mörderische Tun des Paares hat Engels sehr nachvollziehbar in die Szene eingebaut: Die Kinderlosigkeit der Macbeths (das leere Kinderzimmer mit den Kuscheltieren und Spielzeugpanzern spielt eine gewichtige Rolle), die Unfruchtbarkeit der alternden Lady, die Schwäche ihres deutlich jüngeren Ehemanns, der in seiner Gemahlin wohl eine Mutterfigur gesucht hat, die Infantilität von Macbeth, seine Ängste, ihre Psychosen). Zwar sind die Kostüme mehrheitlich im Stil der 50er und 60er Jahre gehalten, wollene Deux pièces für die Damen, Schlaghosen für einige Herren, daneben Kampfanzüge, biedere Bürokleidung, auch mal Kilts für die Herrschenden (Moritz Junge hat eine überaus stimmige Kostümdramaturgie entworfen!). Doch immer wieder wird durch „unpassende“ Accessoires (Bier in Aludosen, Laptops) die Allgemeingültigkeit der zentralen Aussage betont, die Inszenierung lässt sich nicht auf eine bestimmte Zeit und/oder konkrete Personen festnageln. Die ganze Handlung spielt sich im Inneren des Bungalows ab, Fremdes, Störendes, Unnatürliches dringt durch die gigantische Glasfront von aussen herein: Die Hexen sind eigentlich Kopfgeburten des infantilen Macbeth. Mit den gigantischen Perücken erinnern sie an Struwwelpeter, die riesigen Glasaugen haben sie Puppen und Kuscheltieren aus dem Kopf gerissen, die wollenen Kostüme hingegen wirken mütterlich und betonen den Oedipuskomplex des Titel“helden“. Für den zweiten Auftritt haben die Hexen ihre Augen dann abgelegt und sich die Teddybären auf den Kopf gestülpt – alles gerät aus den Fugen. Die Prophezeiungen der Thronfolge: Blutüberströmte Körper, das brutale Machtstreben wird weitergehen und mit dem Tod Macbeths eben nicht enden. Und gerade deshalb war es eine kluge Entscheidung der Verantwortlichen eine Mischfassung aus Florentiner (1847) und Pariser (1865) Fassung zur Diskussion zu stellen. Hier in Bern endet die Oper nicht mit dem Triumph der Befreier (die mit Tischbeinen und Aktenordnern die Festung "Bungalow" stürmen), sondern mit dem von Malcolm und Macduff mit unglaublich roher Gewalt herbeigeführten Todes des einsamen Königs Macbeth. Musikalisch mag da zwar ein gewisser Bruch auszumachen sein, doch rechtfertigt die Aussage und die Radikalität von Verdis ursprünglicher Idee diesen Eingriff.

Mut beweist auch Fabienne Jost in der Rolle der Lady, indem sie Verdis Forderung nach einer rauen, durch Mark und Bein gehenden Stimme konsequent umsetzt. Die Wahnsinnsszene reichert sie bewusst mit „falsch“ klingenden Tönen an. Die zu Beginn so starke Frau ist nun total irre geworden und Fabienne Jost spielt und singt diesen Wahnsinn mit einer Intensität, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ihr stark überschminktes Gesicht ist zu einer hässlichen Fratze geworden, die Töne strömen fahl, rau, dann wieder zärtlich verklingend aus ihrer Kehle – grossartig und wie gesagt: MUTIG! Denn dass sie auch fulminant und bravourös singen kann, hat sie in ihren grossen Szenen Vieni t'affretta, La luce langue und im Brindisi sowie im zentralen Duett bereits bewiesen. Robin Adams gibt einen ebenso intensiv durchgestalteten Macbeth. Sein Bariton verfügt über alle erforderlichen Schattierungen: Machohaft kann er auftrumpfen, infantil und ängstlich zittern, fahl und unbeteiligt wirken, hämisch und fordernd sein, mit nihilistischen Aussagen um sich werfen. Die Original Shakespeare-Zitate die er zusätzlich zu seiner umfangreichen Gesangsrolle noch zu sprechen hat, wirken bei ihm ganz organisch in den Aufstieg und Fall des Tyrannen eingebaut. Mit wunderbar sonorem Bass gestaltet Pavel Shmulevich den Banquo. Adriano Graziani glänzt mit sehr schönem, hellem Timbre und eindrucksvoller Phrasierung als Macduff. Geradezu luxuriös besetzt sind die Dama der Lady (aus ihr macht Engels eine effiziente und intrigante Assistentin mit Wendehals-Charakter!) mit Claude Eichenbergers sattem Mezzosopran und der Malcolm mit Andries Cloete.
Genauso spannungsgeladen wie das Geschehen und der Gesang auf der Bühne sind auch die Klänge aus dem Graben. Srboljub Dinic und das Berner Symphonieorchester bleiben dem Werk nichts an geradezu lautmalerischen Effekten schuldig. Eindrücklich und mit gekonnter Vulgarität singen und spielen die Damen des Chors Konzert Theater Bern (Leitung Zsolt Czetner) die dankbaren Hexenszenen.
Das Theater Bern zeigt ein kühnes Werk eines relativ jungen Komponisten in einer szenisch und musikalisch brisanten, eindringlichen Umsetzung.
Kaspar Sannemann © Originalfassung in oper-aktuell
Fotos © Annette Boutellier, Konzert Theater Bern, mit freundlicher Genehmigung





















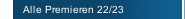




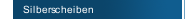
















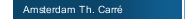













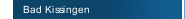




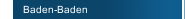





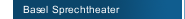




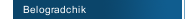

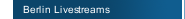





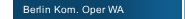



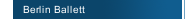





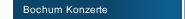



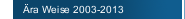





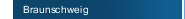

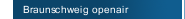




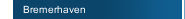




















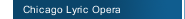


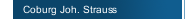





















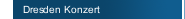



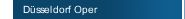



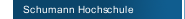









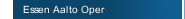




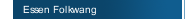










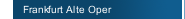
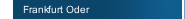





















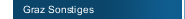








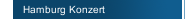
















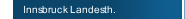

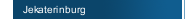

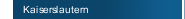











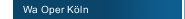


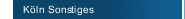
















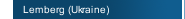





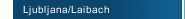





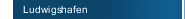























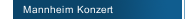













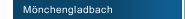





















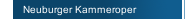
















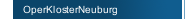


























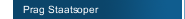
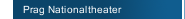

















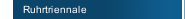

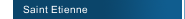







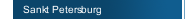



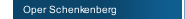
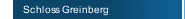














































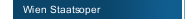

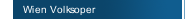

















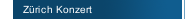
















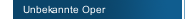




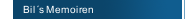





















 Chorsingen hat in Polen, ganz allgemein in osteuropäischen Staaten eine lange Tradition. Der Chor spielt in Krol Roger eine wesentliche Rolle, ist er doch verantwortlich für den Fortgang der Handlung und ist als roter Faden ein wichtiger Teil der Dramaturgie.Der Chor Konzerttheater Bern, zusammen mit dem Kinderchor Singschule Köniz löst diese Aufgabe, welche auch schauspielerisches Können verlangte, mit Bravour. Einstudiert wurden die umfangreichen Chorpartien vom Berner Chorleiter Zsolt Czetner.
Chorsingen hat in Polen, ganz allgemein in osteuropäischen Staaten eine lange Tradition. Der Chor spielt in Krol Roger eine wesentliche Rolle, ist er doch verantwortlich für den Fortgang der Handlung und ist als roter Faden ein wichtiger Teil der Dramaturgie.Der Chor Konzerttheater Bern, zusammen mit dem Kinderchor Singschule Köniz löst diese Aufgabe, welche auch schauspielerisches Können verlangte, mit Bravour. Einstudiert wurden die umfangreichen Chorpartien vom Berner Chorleiter Zsolt Czetner.


































 Als immer präsenten greisen Marcello erlebte ich auf der Bühne den Tenor John Uhlenhopp, welcher auch die Rollen von Benoit, Parpignol und Alcindoro übernahm. Die Interpretation Uhlenhopps ist sowohl gesanglich als auch darstellerisch makellos und überzeugend.
Als immer präsenten greisen Marcello erlebte ich auf der Bühne den Tenor John Uhlenhopp, welcher auch die Rollen von Benoit, Parpignol und Alcindoro übernahm. Die Interpretation Uhlenhopps ist sowohl gesanglich als auch darstellerisch makellos und überzeugend.























