

http://www.theaterluebeck.de
LOHENGRIN
Besuchte Aufführung am 18.09.22 (Premiere am 04.09.22)
Einfaches Denken führt nicht zum Glück
Sehr lange mußte das Lübecker Publikum auf die Neuproduktion von Wagners "Lohengrin" warten; angekündigt war sie vor zwei Jahren, was dann kam wissen wir alle. Doch was lange währt, wird endlich gut, auch bei so einer Choroper wie Wagners trauriges Märchen vom Schwanenritter. Und gerade die hervorragenden Chöre bilden eines der Rückgrate von Anthony Pilavacchis Inszenierung, denn hier werden die Sachsen gegen die Brabanter positioniert. Brabant als chaotisches, heruntergekommenes Land wie man es in dystopischen Filmen a la "Mad Max" findet, Tatjana Ivschina setzt auf die Drehbühne moderne Glasarchitektur gegen alte Wand mit historischer Fensterrosette auf bröckeliger Betonrampe, eine zeitlose Verortung von Vergangenheit und Heute. Die Brabanter sind ein wilder Haufen aus folkoristischer Rückschrittlichkeit gegen die, die Sachsen als Beamte und Politiker in Trenchcoat jedoch auch nicht sympathischer wirken. König Heinrich als populistischer Politiker hat sich optisch den primitiven Barbaren mit einem Pelzmantel angeglichen, sein Pressesprecher/Heerrufer gehört ganz um zivilisierten Politapparat der Sachsen.. Bei den Brabantern stechen Elsa und Gottfried in hellen Farben heraus, letzterer wird schon während des Vorspiels von Ortrud ermordet und durchzieht als federnstreuender "Cantus firmus" den ganzen Abend.
Wie bereits geschrieben, bilden die Chöre und Extrachöre des Theater Lübeck einen der Hauptdarsteller der Inszenierung Pilavacchis und klanglich wie spielerisch (unter der Leitung von Jan-Michael Krüger) wird ein sehr hohes Niveau erreicht. Dem Regisseur gelingen immer wieder spannende Konstellationen zwischen Aktion und Tableau, aus denen sich (ebenfalls an diesem Abend keine Nebenrollen) die Gruppen der vier Edelknaben und der vier brabantischen Edlen gleichsam herausschälen, gesanglich alles ausgezeichnet, szenisch sind die ersten eher Frauen aus dem Volke, hier zwar modisch etwas punkig, die sich von jeder öffentlichen Meinungsmache mitreißen lassen, letztere rückschrittliche Traditionalisten. Valentina Rieks, Nataliya Bogdanova,Frederike Schulten, Iris Meyer, Gustavo Mordente Eda, Noah Schaul, Laurence Kalaidjian und Christoph Schweizer verdienen es durch Engagement und Qualität alle namentlich erwähnt zu werden. Ein aktuelles Abbild einer Gesellschaft, wie wir sie augenblicklich an mehreren Stellen der Welt in immer neuen Konstellationen finden.
Das ist also die äußere Folie um die Schicksale der Protagonisten herum, über den König hatte ich schon geschrieben, bleiben noch das helle und das dunkle Paar. Ortrud und Telramund wollen eindeutig an die Macht und schrecken auch vor Mord nicht zurück, wobei Ortrud eindeutig die bestimmende Triebfeder ist; Bea Robein bringt ihren Mann mit attraktiver Sexualität immer wieder auf Kurs, stimmlich eher ein heller Mezzosopran ohne orgelnde Dämonie. Anton Keremidtchiev ist als Telramund einfach eine Traumbesetzung, äußerlich ein starker Mann, innerlich manipulativ ergiebig, stimmlich mit virilem Bariton mit leicht metallischem Klang perfekt, so gut hört man die Partie selten gesungen. Doch auch Elsa und Lohengrin, vor allem letzterer, können nicht von einem kompromisslosen Schwarz-Weiss-Denken abrücken, was letztendlich zu ihrem Unglück führt. Genau wie im richtigen Leben: Schwarz-Weiss-Denken ist schön einfach, führt aber zu nichts. Peter Wedd scheint relativ kurzfristig in die Produktion eingesprungen zu sein, oder liegt es daran, das die Rolle des Lohengrin eher zur Projektion taugt, szenisch wirkt er unbedeutender als die anderen. Gesanglich liegt der Tenor, für mich dramatisch etwas über der Titelpartie, denn im Lyrischen weicht er gern in die Kopfstimme aus, fulminant wirkt sein gleissender Tenor in den dramatischen Partien wie dem Finale des zweiten Aktes. Es ehrt den Sänger musikalisch auch das Zarte des Charakters zu betonen. Anna Gabler gelingt ein sehr differentiertes Porträt Elsas, gesanglich neigt sie ebenfalls dem Dramatischen zu, was sich in einer angespannten, leicht flackerigen Höhe zeigt. Runi Brattaberg singt einen soliden König Heinrich mit vibratoreichem Bass und Höhenschwierigkeiten im dritten Akt. Jacob Scharfman ist mit ausgeglichenem Bariton ein in jeder Hinsicht guter Heerrufer, den ich gerne im bald projektierten Mozart-Figaro hören möchte.
Pilavacchis Inszenierung ist durchweg gekonnt und setzt gezielt Theatereffekte ein, nimmt jedoch im dritten Akt richtig an Fahrt auf: das fehlgeschlagene Hochzeitsfest, das Kammerspiel des Brautgemachs und der Schrecken des Finales setzt noch richtig "einen drauf" und ist einfach sauspannendes Theater. Zudem merkt man, wie ordentlich mit den Sängern am Text gearbeitet wurde, vielleicht nicht ganz so wie sein Lübecker "Ring", der sicherlich ein großes Statement war, aber wieder eine gelungene Arbeit, die man nicht aller Tage sieht. Natürlich ist Wagner Chefsache in Lübeck und Stefan Vladar dirigiert einen, ich möchte mal sagen, flexiblen "Lohengrin", also nicht lyrisch oder schnell, sondern der Bühnensituation angeglichen. Man ist manchmal etwas überrascht von einigen Tempi, doch gleichzeitig gelingt es dem Dirigenten, den Rezensenten einige Stellen quasi "neu" hören zu lassen.Das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck folgt mit wirklich nur kleinen Unkonzentriertheiten bestens. Insgesamt eine Aufführung, die sich sehen und hören lassen kann.
Martin Freitag, 24.9.22
Versteinerte Machtgier – „L´amore dei tre re“ von Italo Montemezzi
Besuchte Vorstellung am 12. Juni 2022
Kolossale graue Steinköpfe umringen mit geschlossenen oder blind wirkenden Augen die Szene; sie muten an wie die zum Monument gewordene stumme Trauer über eine längst verlorene Größe. Vielleicht ist es auch die Beschwörung einer Vergangenheit, die nie so ruhmreich war, wie von den Herrschenden dargestellt.
Mit der selten aufgeführten Oper „L´amore dei tre re“ („Die Liebe der drei Könige“) von Italo Montemezzi in der Inszenierung von Effi Méndez hat das Theater Lübeck ein weiteres Mal bewiesen, wie experimentierfreudig dieses Haus ist. Zudem ist die Produktion dieses Dreiakters aus dem Jahre 1913 in jeder Beziehung von hoher künstlerischer Qualität, was sich schon im Bühnenbild von Stefan Heinrichs zeigt.
Die Assoziation einer gigantischen Gruft kommt nicht von ungefähr, denn die steinernen Gesichter sind stark an die Schicksalsmasken aus der Krypta im Leipziger Völkerschlachtdenkmal angelehnt, die in ihrer düsteren Gigantomanie für die überzogene männliche Selbstdarstellung und kriegerische Entschlossenheit des wilhelminischen Deutschen Reichs stehen. Aber diese monströse Inszenierung hat keine Zukunft, weil sie ihr Selbstbewußtsein auf längst verblichenen Ruhm stützt und neuen, frischen Bewegungen die Luft zum Atmen nimmt. Der muffige Dunst des Dekadentismus durchwabert dieses Grab der eigenen Geschichte und dem entsprechen im Bühnenbild die grünen Algen und Wurzeln, die bald auf und zwischen den grauen Köpfen wuchern. Daß der Herrschersitz in Wirklichkeit ein Mausoleum ist, beweist in einer Szene, wo sich ein Teil der Bühne nach oben hebt, ein gisant, also die steinerne Liegefigur auf einem Grabmal, die eigentlich eine Brücke vom Tod zur Auferstehung schlägt.

Die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist tatsächlich ein zentrales Thema der Oper, wenngleich hier das eigentlich künftig Mögliche von der Übermacht des Vergangenen erstickt wird. Und so stehen die drei Könige stehen für die unterschiedlichen Zeitebenen, was sich in der Geschichte schicksalhaft entgegen dem märchenhaften Titel niederschlägt.
Der alte König ist Archibaldo, Haupt einer Herrscherfamilie aus dem Norden, die in das italienische (Phantasie-)Königreich Altura eingefallen ist – man mag hier an die Normannen denken, die ab dem 11. Jahrhundert auf Sizilien herrschten. Dies greise und blinde Sinnbild der Vergangenheit begehrt die Prinzessin des besiegten Volkes, die schöne Fiora – zu wirklicher Liebe ist Archibaldo nicht in der Lage. Fiora wurde aus politischen Gründen mit Archibaldos Sohn Manfredo zwangsverheiratet. Dieser steht für die Gegenwart; er wird zwar von seinem Vater instrumentalisiert, wirbt aber mit Hingabe um die Gunst der jungen Prinzessin. Daß er ständig unterwegs ist, ist nur ein Grund für die Unmöglichkeit einer echten Beziehung, denn Fiora und den rechtmäßigen Thronanwärter Avito verbindet tatsächlich gegenseitige, leidenschaftliche Liebe.

In dieser emotional und heiratspolitisch angespannten Situation wäre Fiora sogar bereit, mit Manfredo zu leben, aber die Verbindung mit Avito ist zu stark. Der junge Prinz symbolisiert die Zukunft, aber die hat in dieser Geschichte keine Chance, denn der Alte wittert den Verrat. Er erwürgt Fiora und beträufelt ihre Lippen mit Gift, um den ihm unbekannten Liebhaber zu entlarven. Avito tappt in die Falle, küßt die Tote und stirbt. Erschüttert und schicksalsergeben gibt auch Manfredo seiner toten Frau einen letzten Kuß und so bleibt Archibaldo einsam zurück, als Opfer seiner eigenen Gier nach Macht und Kontrolle über alle um ihn herum.
Der Schwere und emotionalen Aufgeladenheit der Handlung entspricht Montemezzis Musik in ihrer spätromantischen, satten Farbigkeit, die zwar von Wagner beeinflußt, aber völlig eigenständig in der Instrumentierung und Wiedergabe von Gefühlen oder Handlungselementen ist. Eine gewisse Leitmotivik läßt sich aber in jedem Falle ausmachen, beispielsweise wenn das Hinken des alten Archibaldo in einem Synkopenmotiv wiedergegeben wird. Wie ein störender Geist tritt er gerade in den Momenten auf, in denen Hoffnung und Leidenschaft wächst; von der musikalischen Form her schafft sein Erscheinen jeweils einen gliedernden Einschnitt.

Und ja, auch diese Musik kann süchtig machen, in all ihrer tiefen Heißblütigkeit und Morbidität. Das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck unter der Leitung von GMD und Operndirektor Stefan Vladar breitet diese dunkel-symbolistischen Tongemälde mit Hingabe aus, bleibt aber stets exakt und pointiert, zumal bei den jähen Einbrüchen.
Die solistischen Leistungen sind bemerkenswert bis grandios. Rúni Brattaberg als alter König übertrifft seine Darstellung bei der Premiere am 13. Mai und verleiht mit seinem wuchtigen Baß dieser Rolle die Dominanz, die sie fordert. Seinen Diener Flaminio gibt diesmal Gustavo Mordente Eda, der deutlich mehr als nur eine sekundäre Rolle spielt. Der Bariton Anton Keremidtchiev ist der amtierende Herrscher Manfredo, sowohl schauspielerisch als auch sängerisch sehr stark und überzeugend. Yoonki Baeks Tenor hat oft etwas Flehendes, was aber zu seinem Prinzen Avito paßt, denn der unglückliche junge Mann kann ja beides nicht erlangen – Thron und Geliebte. Die singt María Fernanda Castillo mit größtem Einsatz und Entschiedenheit, ihr starker Sopran dringt ins Mark und gibt ihrer Sehnsucht und ihrem tiefen Schmerz innigen Ausdruck. Aber auch in den zarten Passagen ist sie präsent und erlaubt Einblicke in ihre verwundete Seele.

Ilona Holdorf-Schimanke hat sich für moderne Kostüme entschieden, deren Farbigkeit sich im Lauf der Handlung verändert. Dem Preußischblau der Uniform Archibaldos steht leuchtendes Königsblau der drei anderen Protagonisten gegenüber, das aber immer mehr reduziert wird, als schwände mit ihrem Tun und Leiden das Königliche aus ihnen. Fioras Name bedeutet ja „Blume“ und Blumen sind es schließlich nur noch, die als feine blaue Stickerei auf ihrem Morgenrock und am Ende auf ihrem Tuch verbleiben. Hinter den Farben droht das Grau des Grabes. Die frischen Blumen im Gesteck für die Ermordete wirken wie ein Hohn auf das nicht gelebte Glück, der Chor unter der Leitung von Jan-Michael Krüger stimmt dazu eine wunderbare Klage an.
Eine Grabskulptur ist es auch, wozu sich ein zentrales Wandel-Objekt im dritten Akt entwickelt hat; zuvor war das Gebilde aus zwei gegenübergestellten Steinköpfen mit je halbrunder Umfassung ein überdimensioniertes Ehebett, ganz am Ende ist es ein Brunnen, bei dem die Köpfe als Wasserspeier fungieren. Bei aller inneren Statik und Unverrückbarkeit der dominanten Positionen, die keine echte Weiterentwicklung zulassen, bietet das Bühnenbild immer wieder Veränderungen in der Perspektive und zeigt, was möglich gewesen wäre.
Hätte die Liebe zwischen Fiora und Avito leben dürfen, wäre es nicht allein bei dem Glücksmoment des berückend schönen Duetts im zweiten Akt geblieben. So aber erblüht hier das Verschmelzen zweier Liebender zumindest in wenigen Augenblicken, die nicht verweilen dürfen. Zuerst nur auf dem Bühnenhintergrund, dann auf einen Fransenvorhang projiziert, ist Klimts Gemälde „Der Kuß“ sichtbar, dessen Gesichter allmählich ineinander verschwimmen und zusammen mit der berauschenden Musik das vermitteln, was keine Bühnenhandlung auszudrücken vermag.
Umso entsetzlicher ist der grausame Mord an Fiora, die der Alte mit seinen nach wie vor kräftigen Klauen erwürgt. Die naturalistische Härte dieser Tat schockiert, ist aber in der Darstellung auf der Bühne völlig angemessen und wird nur noch durch das Wegschleifen des Körpers an einem Arm übertroffen.
Auch bei der dritten Vorstellung dieser Produktion gab es begeisterten, langanhaltenden Beifall mit vielen Bravo-Rufen – zu Recht!
Die unbedingt sehenswerte Inszenierung dieser großartigen Oper wird in der nächsten Spielzeit wiederaufgenommen und ist auch eine längere Anreise wert.
Dr. Andreas Ströbl, 15. Juni 2022
Photos: Olaf Malzahn
Viva la Mamma!
Großer Spaß mit Brokkoli und Gorilla
Besuchte Vorstellung: Premiere am 8. Oktober 2021
„Schaffen Sie sich niemals Eltern an! Gerade Mütter können höchst anstrengend sein!“ Diese Warnung ruft man vielen seiner geplagten Zeitgenossen zu, aber da ist es eigentlich immer schon zu spät.
Wenn so eine Mutter sich mal was in den Kopf gesetzt hat, ist sie meist schwer zu bremsen. Das beweist auch der großartige Zweiakter von Gaetano Donizetti, der eigentlich „Le convenienze ed inconvenienze teatrali“, also „Sitten und Unsitten der Theaterleute“ heißt. Das trifft zwar den Inhalt der Opera buffa, aber der auch für die Lübecker Inszenierung gewählte, mitunter gebräuchliche Titel „Viva la Mamma!“ trifft viel besser die spritzige Italianità und den satirischen Humor dieses witzigen Werks.
So eine Produktion paßt ganz wunderbar in die Zeit des Aufbruchs mit Licht am Ende des Corona-Tunnels und folglich herrschte Partystimmung am Premierenabend im Lübecker Theater.

Dabei ist die Stimmung im Stück eher gereizt, weil die Aufführung der Oper „Romulus und Ersilia“ in der Katastrophe zu versinken droht. Eifersüchteleien und Allüren der Protagonisten führen zu handfesten Streitereien, zwei Hauptdarsteller schmeißen hin und dem Impresario geht das Geld aus. Die Mutter der zweiten Sopranistin bietet sich an, das Stück zu retten und zwar durch die Übernahme einer Rolle und die Verpfändung ihres Schmucks. Das ist die Ultrakurzfassung der Handlung und man ahnt zu Recht Schlimmes für den Ausgang…
Es ist unter Theaterleuten eine bekannte Tatsache, daß es viel schwerer ist, überzeugend lustig zu sein als dramatische oder ernste Rollen zu spielen. Eine vollständige Oper mit rasantem Tempo und großer Besetzung durchweg komisch rüberzubringen, ist in der Tat nicht leicht, aber in der Inszenierung von Effi Méndez wundervoll gelungen. Mit Donizettis herrlich dynamischer Musik voll schmissiger 4/4–Takte und parodistischen Anleihen aus der Opernliteratur des frühen 19. Jahrhunderts kann man eigentlich nichts falsch machen.

Takahiro Nagasaki und das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck feiern diese musikalische festa furiosa nicht nur mit hörbarem Spaß an der Sache, sie arbeiten auch die differenzierten Klangfarben fein und klar heraus. Farbig, ja knallbunt ist ebenfalls das Bühnenbild von Stefan Heinrichs, von Joan Mirós Bildern inspiriert. Dazu passen die Kostüme von Ilona Holdorf-Schimanke – alles ist natürlich parodistisch übertrieben, aber nicht albern überzogen. Das trifft insgesamt für die Produktion zu; es ist kein Klamauk-Theater, sondern ein Riesenspaß mit bezaubernden Ideen. Lediglich die Verzerrung Ersilias als Klofrau, die eine vergoldete Toilette schrubbt, wirkt etwas überzogen. Aber es ist ein Gesamtkunstwerk zum Tränenlachen mit großartigen Leistungen der Solisten.
Andrea Stadel als Primadonna Corilla spielt und singt die Rampensau so brillant, daß sie mehrfach verdienten Szenenapplaus dafür geschenkt bekommt. Von dem gab es ohnehin reichlich an diesem Abend. Ihr Ehemann Stefano definiert sich vor allem durch den Dienst an der Diva, Erwin Belakowitsch ist unglaublich komisch, wenn er seine Gattin anpreist.

Einer der witzigsten Inszenierungs-Einfälle ist seine Powerpoint-Präsentation mit Bildern der Sängerin in Begleitung vieler Prominenter. Nicht minder lustig ist er in der Rolle des Romulus, die er anstelle des ersten Tenors übernimmt. Für die war eigentlich der Russe Antolstoinolonoff vorgesehen, der die Produktion aus Protest verlassen hatte. Yoonki Baek gibt einen herrlich schmierigen Goldkettchenhelden, der in seiner Überzeugung von seiner Begabung ziemlich alleine dasteht. Zu den Deserteuren gehört ebenfalls die Mezzosopranistin Dorotea. Auch wenn dies eine Nebenrolle ist, so ist sie doch mit der großartigen Wioletta Hebrowska besetzt.
Das macht auch die Qualität der Inszenierung aus, in der nicht am falschen Ende gespart wird. Ob Johan Hyunbong Choi als Komponist, Beomseok Choi als Librettist oder Gerard Quinn als Impresario – alle Rollen sind hochkarätig besetzt.
Das gilt ebenso für Luigia, die zweite Sopranistin spielt eine kleinere Rolle, aber die singt immerhin Evmorfia Metaxaki, bewährt hinreißend charmant. Absoluter Abräumer ist aber Steffen Kubach als deren Mutter, Mamma Agata. Zu den herausragenden Leistungen des fast zwei Meter großen Baritons gehört schon das zweistündige Laufen und Tanzen auf Stöckelstiefeln. Sprachlich, spielerisch und sängerisch ist der Mamma-Mann eine Wucht; man muß diese übergriffige, überkandidelte, überschminkte und mit viel zuviel Glitzer behängte Übermutter einfach lieben!

Kubach und auch die anderen Solisten variieren als singende Schauspieler oder spielende Sänger durch Mimik, Gestik und Bewegung kurzweilig die – der Oper dieser Zeit gemäßen – Wiederholungen von Textstellen. Der gesprochene Text nach der Fassung von Karlheinz Gutheim und Horst Goerges wurde hier noch einmal bearbeitet, was dem Ganzen eine frische Spontaneität verleiht. Da scheint auch in der Probenarbeit eine belebende Freiheit geherrscht zu haben, was allerdings dem exakten und synchronen Spiel bzw. Gesang aller Mitwirkenden keinen Abbruch tut. Das Textverständnis ist so gut, daß die Übertitel eigentlich nicht nötig wären, aber es lohnt, sich diese anzusehen, denn darin verbirgt sich mancher Gag, etwa, wenn einige Textstellen des russischen Tenors in kyrillischen Buchstaben wiedergegeben sind. Seine mangelnde Textkenntnis führt zu absurden Auswüchsen wie der Beschwörung des „klaren Brokkoli“; diese Albernheiten hatte tatsächlich auch schon Donizetti vorgesehen, indem er Rossini-Arien parodierte.

Nicht von Donizetti stammen in jedem Falle das „Tristan“-Zitat, als es um die verrückten „Neutöner“ geht, das „Esultate“ aus Verdis „Otelleo“ oder das Lied „Mein Gorilla hat ´ne Villa im Zoo“ von 1933, das die Mamma ansingt, um die Primadonna Corilla zu verspotten.
Die Detailverliebtheit mit viel Humor zieht sich bis ins Programmheft mit, unter anderem, zahlreichen lustigen Texten aus dem 18. und 19. Jahrhundert und wunderbaren Photos von Kubach, wie er als Mutti den Prosecco gleich aus der Flasche trinkt oder beim Ladendiebstahl erwischt wird.
Wer diese großartige, mit begeistertem Applaus gefeierte Produktion versäumt, ist selber schuld – und riskiert, daß la Mamma ihm eins mit der Handtasche überzieht!
Dr. Andreas Ströbl, 9. Oktober 2021
Photos: Olaf Malzahn
„…der Welt zurück“
Ein Galaabend des Musiktheaters Lübeck
Besuchte Vorstellung: Premiere am 19. September 2021
Auf den Tag genau vor einem Jahr feierte das Theater Lübeck mit dem Gala-Abend „Unter die Haut“ so etwas wie den unerschütterlichen Glauben an die Lebendigkeit des Musiktheaters, wenn man nur die Hoffnung auf gemeinsame Überwindung einer echten Krise nicht aufgibt. Voraussetzung ist ein entsprechend kluges Hygiene-Konzept und ein bei allen Einschränkungen reduziert, aber regelmäßig verabreichtes, gegen die Corona-Depression wirksames Psychopharmakon, das Musik heißt. Allmählich dürfen manche Regeln gelockert werden und so gibt es auch wieder deutlich mehr Sitzplätze im Lübecker Jugendstil-Theater, das etwas voller hätte sein dürfen an diesem hoffnungsvollen Abend. Den moderierte der stellvertretende Operndirektor Bernd Reiner Krieger; mit der deutsch-russischen Kombination – einerseits von Beethoven über Wagner bis zu Strauss, andererseits mit Stücken von Tschaikowsky, Borodin und Rachmaninow – konnte man musikalisch nichts falsch machen.

Man hat von Theaterseite viel verschieben oder gar absagen müssen und hofft als Zuschauer, daß Produktionen, auf die man sich so sehr gefreut hat, im nächsten Jahr doch noch auf die Lübecker Bretter gebracht werden. Noch liegt das im Dunkeln und so begann auch der Gala-Abend tatsächlich mit dunkler Bühne. Als hätte GMD Stefan Vladar mit dem Verzicht auf den Begrüßungsapplaus ein Zeichen setzen wollen, daß es hier, um mal wieder mit Wagner zu sprechen, der Kunst gilt, schritt er bei schwachem Dämmerlicht ans Dirigentenpult. Aus der Dunkelheit ersteht der Morgen und den gab es mit dem wunderbaren 4. Lied aus den Orchesterliedern Op. 27 von Richard Strauss, gesungen von Gastsopranistin Bea Robein.
Zu den hoffentlich bald realisierten Produktionen gehört Wagners „Lohengrin“; die Gralserzählung sang sehr einfühlsam ebenfalls ein Gast, der Tenor Bernhard Berchtold.
Außer dem Haus-Baß Rúni Brattaberg und dem Tenor Noah Schaul traten im Quartett „Mir ist so wunderbar“ aus dem ersten Akt von Beethovens „Fidelio“ Bea Robein und die Sopranistin Conelia Ptassek als Gäste auf – ein starkes, gut aufeinander abgestimmtes Miteinander. Überhaupt waren die Lautstärken-Proportionen von Solisten und Orchester am ganzen Abend harmonisch ausgewogen. Vladar hatte das – endlich mal wieder große – Orchester mit seinem sehr zu begrüßenden Hang zur Schmissigkeit sowohl bewährt im Griff, wenn es galt, reduktiv hinter den Solisten etwas zurückzutreten, als auch überzeugend in die Offensive zu gehen.

Wiederum ein Gast war Marlene Lichtenberg mit ihrer leidenschaftlichen Interpretation der Arie der Johanna aus Tschaikowskys „Jungfrau von Orleans“, unbedingt einer der stärksten Auftritte der Soirée.
Sehr stark waren auch die „Polowetzer Tänze“ aus Borodins „Fürst Igor“, bei denen zum ersten Mal seit 18 Monaten der Chor des Theaters Lübeck auftreten durfte. „Endlich fortissimo!“ hätte man mit Gustav Mahler ausrufen wollen, als der nach füllendem Klang dürstende große Saal wieder einmal die musikalische Labung bekam, für die er überhaupt existiert. Damen- und Herrenchor sangen exakt und ausnehmend kraftvoll, das Orchester strahlte.
Szene und Arie der Marschallin und das Schlußterzett aus Strauss´ “Rosenkavalier“ beschlossen den ersten Teil, dargeboten wiederum von Cornelia Ptassek, Marlene Lichtenberg und der jungen Sopranistin Nataliya Bogdanova. Cornelia Ptasseks Marschallin glänzte in den Höhen, schwand etwas in den Tiefen; Marlene Lichtenbergs Octavian bestach nicht zuletzt durch gute Textverständlichkeit. Das sensible Spiel der ersten Violine entsprach der Zartheit dieser Musik.

Kriegers Moderation war weit mehr als nur die Ansage von Titeln und die Vorstellung der allesamt mit Begeisterung mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler. Seine unaufgeregte Art verbarg nicht die Rührung und Freude darüber, daß das Lübecker Haus wieder mit der Qualität in Quantität glänzen darf, die es zu einem der besten Theater im Norden gemacht hat.
Dahinter steht auch eine Verantwortung für die hochengagierten Kräfte. Vladar hatte sich persönlich dafür eingesetzt, daß alle Gäste und Freiberuflichen, denen aus Corona-Gründen Engagements weggefallen waren, zum Teil oder zur Gänze bezahlt wurden. Zudem hat die Leitung den meisten der genannten Folgeverträge angeboten, was tatsächlich nicht alle Veranstalter und Häuser tun. Das hat sicher die eine oder andere Depression gemildert oder verhindert.
Auf Stillstand folgt in Lübeck kein gemächliches Sich-Erheben, sondern mitreißende Lust an großer Kunst. Fulminant war folglich zum Beginn des zweiten Teils das Philharmonische Orchester mit dem Schleiertanz aus Strauss´“Salome“. Der satte Klang und die differenziert ausgespielten Tempi mit wild-rhythmischen Eruptionen ließen keinen Zweifel, daß es hier um echten Sex ging und das orgiastische Ausloten der eigenen Reize, um das Unerhörte zu erreichen.
Fast brav kam dagegen das Quartett aus dem 2. Akt des „Fidelio“ mit Bea Robein, Bernhard Berchtold, Anton Keremidtchiev und Rúni Brattaberg daher, wenngleich ausgesprochen beschwingt und frisch.

María Fernanda Castillos klarer und voller Sopran bot herzergreifend die Arie der Lisa aus Tschaikowskys „Pique Dame“, ein weiterer, dazu sehr emotionaler Glanzmoment des Abends. Herausragend war auch der Bariton Anton Keremidtchiev mit der Cavatine des Aleko aus Rachmaninows gleichnamiger Oper und seiner authentischen Darstellung. Warum wird diese zauberhafte Oper eigentlich so selten aufgeführt?
Joo-Anne Bitters heller Sopran und gutes Textverständnis gaben dem 4. der Fünf Lieder, „Befreit“, von Strauss eine schillernde Präsenz; aus diesem Lied ist der Titel des Abends entlehnt.
Diejenigen, die sich an den letzten Gala-Abend erinnern, hatten den Eindruck, als hätte Rúni Brattaberg das Sofa in der letzten Nummer abonniert. Auf dem hatte er vor einem Jahr den Ochs aus dem „Rosenkavalier“ gegeben“, nun war es Sir Morosus aus Strauss´ “Die schweigsame Frau“. Seine Arie „Wie schön ist doch die Musik“ geriet zum sympathischen Lach-Finale, denn die Titelzeile endet ja schließlich mit „aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!“. Brattaberg sank mitsamt seinem tiefen Baß satt und zufrieden in den Fauteuil. „Unbeschreiblich wohl“ durfte sich das Lübecker Publikum mit ihm fühlen, wenngleich es weniger nach der im Libretto beschworenen Ruhe verlangte, sondern nach gemeinsam gehörter, lebendiger Musik. Die bekam es noch als begeistert erklatschte Zugabe in Form des Schlußsextetts aus dem 2. Akt von Mozarts „Don Giovanni“. Mit Leidenschaft gibt sich die Kultur der Welt zurück.
Andreas Ströbl, 21.9.2021
Photos (c) Olaf Malzahn
„Das Bildnis des Dorian Gray“
Ballett von Yaroslav Ivanenko im Theater Lübeck
Eine Kooperation des Theaters Lübeck mit dem Theater Kiel
Todestanz der Eitelkeit
Besuchte Vorstellung: Premiere am 11. September 2021
Es ist schon ein kühnes Unterfangen, eine so komplexe und vielschichte Literaturvorlage wie Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ in einer gut einstündigen Ballettadaption einfangen zu wollen. Der ukrainische Tänzer, Choreograph und Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko hat gar nicht versucht, alle Figuren und Handlungseinheiten wiederzugeben, sondern sich auf das für ihn Wesentliche konzentriert. Herausgekommen ist eine ungemein dynamische Verdichtung des Stoffs in sieben Bildern auf Beziehungen, Wandlungen und starke Emotionen in einem Gesamtkunstwerk aus hochanspruchsvoller Choreographie, wunderbaren Kostümen, einem tänzerisch-beweglichem Bühnenbild und phantastischer Musik. Letzteres betrifft sowohl die Auswahl der kammermusikalisch wiedergegebenen Werke als auch das mitreißende Spiel der Musikerin und Musiker unter der Leitung von Daniel Carlberg. Dominiert wird das Programm durch vier Stücke von Dmitri Schostakowitsch, dann folgt Frédéric Chopin mit zwei Werken und zentral steht Musik von Ludivoco Einaudi, der vor allem als Komponist von Filmmusik bekannt ist. In großartiger Synchronizität tanzen die Mitwirkenden zu den Stücken und bilden so eine beeindruckende Einheit. Hervorragende tänzerische Leistungen bieten in der ganzen Produktion die Hauptrollen ebenso wie das Corps de Ballet und die sich daraus lösenden Paare und Solisten.

Bereits in den ersten beiden Bildern, in denen sich die Geschichte des mit magischem Talent begnadeten Malers und des durch sein Aussehen und seine Kultiviertheit aus der Masse herausstechenden Dorian Gray entwickelt, wird durch den Tanz des Protagonisten Christopher Carduck und des Künstlers Jean Marc Cordero deutlich, daß es in dieser Inszenierung vor allem um Macht, Instrumentalisierung und Beeinflussung geht. Der Maler formt die Haltungen von Hanna Sofo als sein Modell nur durch Winke. Seine Skizzen sind dabei durch ebenso diskrete wie wirkungsvolle Projektionen auf gerahmten Leinwänden wiedergegeben, die sich immer wieder mal auf die Bühne oberhalb der getanzten Handlung senken und dann wieder in den Schnürboden verschwinden. Dorian Gray ruft in ihm allerdings den Willen hervor, über sein bisheriges Schaffen hinauszugehen. Der dämonische Lord Henry Votton, dargestellt von Amilcar Moret Gonzalez, offenbart in seiner finsteren Erscheinung und seinen überzeugenden diabolisch beschwörenden Gesten seinen mephistophelischen Charakter – vor allem er ist es, der durch seine Verführungskünste Macht ausübt und den jungen Dorian dazu bringt, alle Begriffe von Moral und Altruismus fallenzulassen.

Der ist fortan narzißtisch besessen von seiner unsterblichen Jugend, die ihm verliehen wurde, und baut eine krankhafte Beziehung zu dem Gemälde auf, das an seiner Statt altert. Krankhaft wird schnell auch sein Verhältnis mit der Schauspielerin Sibyl Vane, denn er verliebt sich in ihre Rollen, nicht in den Menschen, der dahintersteht. Ihr Nachname ist ein sprechendes Vanitassymbol. Keito Yamamoto, die tänzerisch etwas mehr aus sich hätte herausgehen dürfen, macht innerhalb eines Bildes den Abstieg der bejubelten Künstlerin erlebbar, denn durch die Beziehung zu Dorian hat sie ihr Talent eingebüßt und stirbt schließlich daran. Auch der Wandel ihres Miteinander von echter Innigkeit zur völligen Entfremdung wird dramaturgisch gestrafft, aber erhält dadurch eine dichte Intensität. Alle Veränderungen und inneren Wandlungen werden durch ein lebhaft-bewegtes Bühnenbild verstärkt; die Kulissenschieber gehören zum Ensemble und so tanzt die ganze Bühne mit allen Requisiten, Wänden, Spiegeln und Bildern gleichsam mit.

Zugegeben – man durfte gespannt sein, wie Einaudis Musik mit der von Schostakowitsch und Chopin reagieren würde, denn viele seiner Stücke schrammen hart an der Beliebigkeit von Fahrstuhlmusik vorbei und werden dennoch in immer mehr Radiosendern inflationär aufgelegt. Aber seine „Experience“ in der Version für Klaviersolo und Klavierquartett unterstrich großartig die inneren Kämpfe und die handfesten Konflikte der Akteure.
In der Handlungsentwicklung steigern sich die Tänzer immer mehr in eine rauschhafte Agonie, die Schostakowitschs 4. Satz aus seinem 2. Klaviertrio in seiner unbarmherzigen Dynamik und verzweifelten Aufgewühltheit zu einem großen Danse Macabre macht. Dorian Grays Portrait verfällt nicht mit aufgesetztem Gruselfaktor, sondern erhält eher einen Verlust des Persönlichen durch eine Verwischung seiner Gesichtszüge, wie sie Francis Bacon in seinen Bildern eingesetzt hat. Heiko Mönnichs Ausstattung ist zwar reduktiv, aber in jedem Detail gekonnt und sicher ausgearbeitet.

Die dritte und letzte Wandlung des Bildnisses nach Dorians Zusammenbruch unter der Last seines Gewissens – auch den Maler hat er schließlich ermordet – zeigt bereits das Zerrbild einer Todesfratze. Er zerstört mit dem Dolch, an dem noch das Blut seines Schöpfers klebt, das Gemälde, beendet damit die grausige Geschichte und sein Leben. Hinter der zerrissenen Leinwand steht wie ein stiller Triumphator der dunkle Lord.
Langanhaltender, begeisterter Applaus für eine mitreißende Produktion.
Dr. Andreas Ströbl, 12. September 2021
Photos: Olaf Struck
Benjamin Britten
„Owen Wingrave“
„Ein kleines Wort: Nein!“ – Mit Ernst und Leidenschaft gegen den Kriegsdienst
Besuchte Vorstellung: Premiere am 3. September 2021
Eine der frühesten Kindheitserinnerungen Benjamin Brittens war der Knall einer explodierenden Bombe, die ein deutscher Zeppelin in der Nacht zum 10. August 1915 über seinem Heimatort Lowestoft abgeworfen hatte. Da war der Junge noch nicht mal zwei Jahre alt, aber unter anderem dieses Erlebnis hat zu seiner späteren Kriegsdienstverweigerung geführt, zu der er sich gemeinsam mit seinem Partner Peter Pears aus tiefster pazifistischer Überzeugung entschied.
In einer Welt mit 2020/21 knapp 30 Kriegen bzw. kriegerischen Konflikten ist es schmerzliche Pflicht, auch den kulturellen Fokus entsprechend auszurichten. Das experimentierfreudige Theater Lübeck hat die neue Spielzeit mit Brittens selten aufgeführter Oper „Owen Wingrave“ aus dem Jahre 1971, einer klaren Absage an jede Heldentümelei, eröffnet. Der Komponist hatte das Werk unter dem Eindruck des Vietnam-Krieges für die BBC geschrieben, auf die Bühne kam die Oper erst zwei Jahre später.

Die musikalische Leitung der rundum überzeugenden Produktion hat der GMD und Operndirektor Stefan Vladar inne, Regie führt Stephen Lawless, der als junger Mann noch von Britten selbst als Bühnenmanager angestellt worden war. Für die Ausstattung ist Ashley Martin-Davis verantwortlich. Dies schon vorweg: Bereits nach dem ersten Akt gab es begeisterten Applaus.
Die Inszenierung versetzt das Stück aus dem spätviktorianischen Zeitalter – Libretto-Vorlage ist eine Kurzgeschichte von Henry James aus dem Jahre 1893 – in den Ersten Weltkrieg. Bereits das erste Bild (möglicherweise eine Vision des Protagonisten) entkleidet die Ausbildung an der Waffe als sadistische Quälerei, denn die vermeintlichen Pappkameraden, auf die die Rekruten mit ihren Bajonetten in einer Gefechtsübung einstechen, sind in Wahrheit gefangene deutsche Soldaten, die reglos vom Schnürboden hängen. Während sein Freund und Kamerad Lechmere (ein überzeugend skrupelloser Yoonki Baek mit scharfem Tenor) genüßlich sein Bajonett in dem leblosen Körper dreht, weicht der Titelheld vor der Gewalttat zurück, worauf das durch die Angriffe der vorigen Soldaten längst tote Opfer seine Hände flehend zu ihm erhebt. Ob aus Grauen vor der gespenstischen Geste oder aus Hilflosigkeit in der peinigenden Situation – Owen sticht schließlich doch auf die Gestalt ein, die dann endgültig in die Schlaffheit einer Leiche verfällt.

Dies ist die Schlüsselszene, denn hier erwacht in dem jungen Mann der Trotz, sich gegen den Massenmord in Uniform aufzulehnen. Sein kleines Wort „Nein!“ macht ihn innerlich groß und gibt ihm die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Das Libretto wird ihn später ein Bekenntnis zum Frieden sprechen lassen, das an die paulinische Inbrunst des Ersten Korintherbriefes mit seinem Hohelied der Liebe erinnert.
Der Bariton Johan Hyunbong Choi singt und spielt sowohl den Kampf mit seinem Gewissen als auch die neugewonnene langgereifte Überzeugung absolut glaubhaft; niemand kann ihn dazu bringen, wieder zur Waffe zu greifen. Weder vermag dies sein Ausbilder Spencer Coyle, dessen militärische Zackigkeit der Bariton Gerard Quinn ebenso glaubhaft vermittelt wie sein Verständnis für die Kursänderung seines Untergebenen, noch kann es die Familie mit ihrer jahrhundertealten militärischen Tradition. Die bildet einen eigenen Kriegsschauplatz, denn sowohl der Großvater, der General Sir Philip Wingrave (man wünscht sich, daß sich der Tenor Wolfgang Schwaninger als Militärparodie wie Loriots Opa Hoppenstedt entpuppt, aber der verhärtete Greis ist vom Kriegführen besessen) als auch die Damen des Hauses sind in ihrer nationalistischen und familientraditionalistischen Haltung die erbitterten Gegner des Neu-Pazifisten Owen. Ob seine keifende Tante (Sopranistin Sabina Martin mit entsprechender Schärfe), seine Schwiegermutter in spe, Mrs. Julian (Sopranistin Andrea Stadel macht die Zwanghaftigkeit und Unsicherheit der Figur ahnbar), oder vor allem seine Verlobte Kate – alle wenden sich gegen ihn. Die Mezzosopranistin Wioletta Hebrowska gibt eine beängstigend von sich und ihrer Mission überzeugte junge Frau, der man abnimmt, über Leichen zu gehen.

Diese Frauen lassen an die Mütter und Ehefrauen denken, die im Folgekrieg angeblich freudig ihre Söhne und Männer dem „Führer“ opferten, um dem Irrsinn eines verlorenen Krieges einen Sinn zu geben. Es sind die Frauen, vor allem eben die Mütter, die neben den Patriarchen die nationalistischen und fundamentalistischen Systeme stützen, indem sie das Wort „Nein!“ nicht aussprechen. Und so weinen hernach die Witwen an den Gräbern, denn der Krieg kennt nur Verlierer. Der Name „Wingrave“ bedeutet nichts anderes; es ist eine Familie, die Gräber gewinnt und Kanonenfutter produziert.
Auch die Gattin des Offiziers Coyle, deren differenziertere, aus Sensibilität erwachsene Haltung Evmorfia Metaxaki sympathisch verkörpert, kann sich nicht gegen den nationalen Strom stellen, in dessen familiärer Mitte, wie es im Libretto so treffend heißt, „Soldaten gezüchtet“ werden. Owen wird als Schande für die Familie beschimpft, man wirft ihm Egoismus und Feigheit vor.

Und hier verläßt der Rezensent die distanzierte Haltung. Ich fühlte mich von der ersten Szene an in die frühen 80er Jahre versetzt, eine der heißeren Phasen des Kalten Krieges. Aufgewachsen in einer der größten deutschen Garnisonsstädte, entschied ich mich dafür, im Kriegsfalle weder auf meine eigenen Verwandten jenseits des Eisernen Vorhanges noch auf irgend jemanden anderen zu schießen. „Drückeberger“ nannten einige Klassenkameraden uns zwei Verweigerer aus dem Jahrgang und die, die am lautesten gekeift hatten, wiesen bei der Musterung seltsamerweise plötzlich Atteste von befreundeten Ärzten vor, die sie als dienstuntauglich bewerteten. In der Gewissensprüfung ließen uns Uniformträger ihre ganze Verachtung spüren und konfrontierten uns mit absurden Phantasie-Situationen, die nicht nur weitab von der Wirklichkeit militärischer Ausbildung standen, sondern in deren Lösungsversuchen man beinahe immer scheitern mußte. Wir haben nach erfolgreicher Prüfung, die uns manchmal monatelang aus Studium und Ausbildung riß, dann mit Überzeugung zivil gedient. Und im Kriegsfalle werden wir nicht irgendwo gemütlich daheim sitzen, sondern selbstverständlich eingezogen. Die Waffe werden wir nicht anfassen, aber wir werden unsere Kameraden versorgen, ihre Wunden verbinden und sie begraben müssen.
Auch Owen wird nicht vom frühen Tod verschont. Kate, die schamlos mit Kamerad Lechmere geflirtet hat, schlägt ihm eine unsinnige Mutprobe vor: Ihr Verlobter soll, wenn er denn kein Feigling sein will, die Nacht in einem sogenannten Spukzimmer im Familienanwesen verbringen. Dort hat ein Vorfahr einst seinen Sohn erschlagen, weil dieser sich weigerte, sich für die Familienehre zu prügeln. Der böse Ausgang wird im Gesang des Theaterkinderchors Vocalino unter der Leitung von Gudrun Schröder vorausgeahnt. Owen geht in das verfluchte Zimmer und stirbt dort. Die Gespenster der Vergangenheit haben ihn umgebracht.
Die Düsternis des Geschehens ist in ein zurückgenommenes, aber sprechendes Bühnenbild gebettet: ein Schützengraben mit Eisenklappen und Brettern ist ebensogut Familiengruft mit Grabplatten und Sargdeckeln. Die dunkle Wandvertäfelung erzeugt keine heimelige Geborgenheit, sondern ähnelt einem Columbarium, in dessen zahllosen Fächern all die Gefallenen aus der Familie wohnen, deren Portraits sich immer wieder wie geisterhafte Visionen herabsenken.
Brittens Musik ist ebenso hart wie mitreißend. Partitur und Libretto bilden eine großartige, bedrückende Einheit und es gibt trotz aller Sprödigkeit wunderbare Momente, etwa wenn eine atmosphärische Zartheit mit der Celesta erzeugt wird oder das Pizzicato der Streicher an das Ticken einer alten Standuhr erinnert, die die verstreichende Zeit als ein klingendes Vanitassymbol hörbar macht. All diese verschiedenen Klangfarben und Rhythmusbrüche entläßt das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck unter Vladars ebenso entschiedenem wie feinfühligem Dirigat makellos und eindringlich aus dem Graben.
Die Oper klingt leise klagend aus, die Trompetenfanfaren lassen an das „War Requiem“ denken; eine Reminiszenz ebenso an das eigene Werk wie an die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges und ein Appell zu echter Versöhnung und dauerhaftem Frieden.
Langanhaltender, verdienter, stehender Applaus und viele „Bravo“-Rufe für eine ganz große Oper.
Dr. Andreas Ströbl, 5. September 2021
Photos: Jochen Quast
Die Gespenstersonate
Kammeroper von Aribert Reimann
„Angst beklemmt der Menschen Brust“
Besuchte Vorstellung: Premiere am 21. Mai 2021
Einen „gespenstischen Opernabend“ versprach der Lübecker GMD und Operndirektor Stefan Vladar dem nach Kultur dürstenden Lübecker Publikum, das aufgrund des hervorragenden Hygienekonzepts des Hauses in großen Abständen voneinander endlich wieder im geliebten Jugendstil-Theater Platz nehmen durfte. Es hätten ein paar mehr sein dürfen, aber noch haben die Menschen Angst, wenngleich man sich leichter im Baumarkt infizieren kann als in der Oper. Angst bestimmt auch große Linien des nicht leicht zugänglichen Stückes, in dem sich eine surreale Handlung, eine Sprache voller Abgründe und Aribert Reimanns Musik mit ihren Brechungen, Härten und bis ans Schmerzhafte gehenden Auslotungen des gesanglich Möglichen kongenial zusammenpressen und miteinander reagieren. So geriet tatsächlich weniger gespenstisch als vielmehr ins Mark treffend lebendig, ums Leben kämpfend und energetisch aufgeladen, was die Inszenierung von Julian Pölsler dieser Kammeroper aus dem Jahre 1984 auf die seit dem Herbst verwaiste Lübecker Bühne brachte.

Der literarische Hintergrund dieser ungemein differenziert, weil auf jede Figur individuell auskomponierten Oper mit kammermusikalischer Besetzung ist Strindbergs gleichnamiges Theaterstück, das der Beethoven-Bewunderer in Anlehnung an dessen „Gespenstersonate“ und das „Geistertrio“ so nannte und dem Drama tatsächlich die Struktur einer Sonate gab. Reimann vollendet den Bogen und gibt dem Werk wieder die musikalische Sprache zurück, was zumal in den Partien, in denen das Schweigen thematisiert wird, dem Ganzen eine erweiterte Ebene verleiht, weit über das hinaus, was Sprache und gerade deren Ausbleiben nicht ausdrücken können. Das Libretto von Reimann und Uwe Schendel gibt die Struktur des Kammerspiels wieder, weicht aber in manchen Aspekten davon ab. Wesentlich und unverändert ist die surreale Darstellung eines psychischen und beziehungstechnischen Infernos, in dem ein unsympathischer, innerlich verrottender Patriarch, Direktor Hummel/Der Alte, mit den Gespenstern seiner eigenen Vergangenheit abrechnen will, aber von ebendiesen gerichtet wird.

Grandios fies und ungemein bühnenpräsent auch im Rollstuhl wird er von Otto Katzameier gegeben. Eine skurrile Essensgesellschaft, die aus einem Gemälde von James Ensor entsprungen oder eher entkrochen sein könnte, ist in einem Geflecht aus Bosheiten, alter Schuld, Verlogenheiten und Ängsten gefangen; man hat sich nichts zu sagen und alle sind in ihren toten Ritualen und Illusionen festgefault. Der angeblich adlige Oberst ist weder von edler Abkunft noch von Rang, was Wolfgang Schwaninger auch optisch überzeugend entblättert. Dessen Gattin schleicht wie eine lebende Tote mumienhaft durch ihr moderndes Sein; Karin Goltz verkörpert seelentief ihr dunkles, aber nach Wahrheit suchendes Wesen. Eine Facette dieser komplexen Gestalt ist eine Figur, die sich scheinbar für einen Papagei hält – girrend und glaubhaft verrückt durch Iris Meyer gesungen. Beider Tochter ist das Fräulein, ein mädchenhaft-sehnsüchtiges Geschöpf, dessen Träume nicht in Erfüllung gehen und das an der Fauligkeit der ganzen Gesellschaft zugrunde geht; Andrea Stadel realisiert einfühlsam ihre traurige Existenz. Star des Abends ist Yoonki Baek als metaphysisch begabter Student Arkenholz, der versucht zu helfen, instrumentalisiert wird, sich in das Fräulein verliebt und schließlich feststellen muß, daß er hier weder Liebe noch Wahrheit oder Erlösung erlangen kann. Die Rolle ist gnadenlos anspruchsvoll, aber auch die extremen Höhen, für die man eher eine Altus-Kopfstimme wählen würde, meistert Baek ohne Anstrengung und jegliches Quetschen.

Vom Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck ist man seit Jahren Erstklassiges gewohnt. Andreas Wolf leitet den reduzierten Klangkörper souverän; die Partitur hat es in sich, weil sie so viele Klangfarben und figurenbezogene Zuschnitte erfordert. Dieses Werk ist keine leichtverdauliche Kost, aber faszinierend. Zu seinem mitunter rätselhaft-symbolistischem Charakter paßt die Ausstattung von Roy Spahn, dessen bildmächtige Installationen mitunter leitmotivisch den Text illustrieren oder ihn erweitern. Die vom Fräulein gepflegten und geliebten Hyazinthen erscheinen plastisch und riesig über den Köpfen der metaphorisch unterirdischen Tischgesellschaft, die innerlich abgestorben wie eine Gemeinschaft von lebendig Begrabenen die Radieschen bzw. die Hyazinthenwurzeln von unten betrachtet.
Eine solche Riesenblume senkt sich schließlich herab, während Arkenholz dem Fräulein die mythische Bedeutung der Hyazinthe erklärt und die junge Frau deren Farbsymbolik erläutert. Diese romantisch überhöhte Vereinigung ist trügerisch wie die Pflanze selbst, denn sie ist einerseits Sinnbild des Glücks und der Liebe, andererseits steht sie für die Totenklage Apolls über den versehentlich getöteten Geliebten Hyakinthos, aus dessen Blut sie erwuchs. Ihre Blütenblätter bilden den Klageruf des trauernden Gottes.

Das prachtvolle Blumenkleid des Fräuleins sticht aus dem trostlosen Geisterfummel der morbiden Gesellschaft heraus; auch äußerlich verbindet sie nichts, denn sie tragen „Kostüme, die keine gemeinsame Zeit teilen“ (O-Ton Roy Spahn).
Große Banner mit Christusdarstellungen und griechischen Buchstaben, die keinen Sinn ergeben, symbolisieren vielleicht die Hoffnung auf eine Erlösung, die aber in bloßen Ritualen erstarrt ist und deren Botschaft niemand mehr versteht. Sie erinnern an Totenfahnen, die Archäologen manchmal in Grüften finden und deren Texte so unleserlich geworden sind, daß die Erwartung einer besseren Welt nur noch kryptisch erahnbar ist. Die Hoffnung, aus all dieser Düsternis herauszukommen, flirrt sanft durch die letzten Worte des Studenten und daß Angst kein guter Ratgeber ist, haben wir – hoffentlich – alle in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt. Tatsächlich war es nicht nur Erleichterung darüber, daß das Lübecker Haus wieder aufgemacht hat, sondern echte Begeisterung, die den Applaus bestimmte: herzlich und langanhaltend.
Andreas Ströbl, 23.05.2021
Bilder (c) Musiktheater Lübeck/Olaf Malzahn
„Unter die Haut“
Ein Galaabend des Musiktheaters Lübeck
Besuchte Vorstellung: Premiere am 19. September 2020
Nach einem sehr guten Essen fragt man sich manchmal, ob die Küche so herausragend war oder ob es auch daran lag, daß man schon den ganzen Tag nichts gegessen hatte. In der Tat zeigte das Lübecker Publikum am Samstagabend, daß es Hunger nach seinem Musiktheater hatte, denn das große Haus war sehr gut besucht. Eine genaue Einschätzung fällt schwer, weil das gut durchdachte Sicherheitskonzept des Theaters viele leere Reihen und Sitzplätze zwischen den Besuchern vorsieht. Man darf sich sicher fühlen im Lübecker Theater und wünscht dem Haus, daß das Konzept und damit das Angebot in allen Sparten entsprechend angstfrei wahrgenommen wird.

Zur musikalischen Küche: Es gab zahlreiche Sternenköche und die servierten ein erstklassiges Menü. „Zusammenrücken“ war als Devise ausgegeben worden und das war im übertragenen Sinn zu verstehen. Ein mögliches Gefühl des Vakuums, das durch die leeren Plätze und die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Künstlern hätte aufkommen können, hatte die Lübecker Leitung klug ausgeschaltet. Das begann schon im gratis verteilten Programmheft mit den großformatigen Portraitphotos der Mitwirkenden, die auch im Aufgang zu sehen sind, und deren persönlichen Äußerungen zu ihrer Kunst. Dadurch wurde Nähe und individuelle Begegnung vermittelt. Eine ausgesprochen reizvoll zusammengestellte Mischung aus bekannten und weniger gehörten Musikstücken sowie die launige Moderation durch die Schauspielerin Sara Wortmann, den Künstlerischen Betriebsdirektor Bernd Reiner Krieger und den Sänger Steffen Kubach füllten jede mögliche Leerstelle mit dichter, qualitätvoller Unterhaltung. Das Motto „Unter die Haut“ beschwor schließlich nicht nur Nähe, sondern das, was Ausführende und Rezipienten seit dem Frühjahr vermissen: die intensivste Vermittlung von Kunst, die ins Innerste dringt. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ war die kämpferische Ansage, allerdings unter dem Primat der Vernunft mit Berücksichtigung aller mitunter lebenswichtigen Hygienerichtlinien.
Wer Stefan Vladar als GMD hat, kann schon kaum mehr etwas falsch machen. Die unter seiner Leitung seit einem Jahr über sich hinausgewachsenen Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt ließen Brittens „Four Sea Interludes,“, die den Abend leitmotivisch durchzogen, wie impressionistische Gemälde erstrahlen, mit all ihrem flirrenden Sonnenlicht auf dem Wasser, den Hafengeräuschen und wogenden Wellen, dem mächtigen Sturm. Allein dafür hatte sich der Abend schon gelohnt.

Der war wie bereits zur ersten Opernpremiere am 28. August mit Humor gewürzt, einer guten Ingredienz gegen Corona-Depression. Sara Wortmann bewies mit „Send in the Clowns“ von Steven Sondheim, daß sie auch eine talentierte Musical-Sängerin ist. Dazu rollten die Solistinnen und Solisten mit roten Clownsnasen und passenden Hütchen die unvermeidlichen Trennwände aus Plexiglas auf die Bühne. „Champagner!“ hallte es dann mit Strauss´ „Fledermaus“ durch den Saal und die Sopranistin Evmorfia Metaxaki ließ es, wie nicht anders von ihr erwartet, auch stimmlich als Prinz Orlofsky knallen, accompagniert von Nataliya Bogdanova (Sopran) als Adele und Yoonki Baek (Tenor) als Eisenstein. Anschließend gab der Bariton Johan Hyunbong Choi einen entschlossenen, zupackenden Escamillo aus Bizets „Carmen“, gefolgt vom Ochs-Monolog aus Strauss´ „Rosenkavalier“. Rúni Brattabergs Baß geht in seinen fülligen, schweren Tiefen schon als profundo durch. In Jeletzkis Arie aus Tschaikowskys „Pique Dame“ zeigte der Bariton Gerard Quinn, daß er auch das russische Fach beherrscht, wenngleich der große weiche Bogen fehlte. Die Sopranistin María Fernanda Castillo als Mimi und Yoonki Baek als Rodolfo aus Puccinis „La Bohème“ spielten souverän mit der Corona-Trennscheibe wie ein Paar, das bei einer Besuchsstunde im Gefängnis die direkte Berührung meiden muß und das kalte Glas mit ihrer Liebe durchdringt. Wiederum Puccini gab es mit Evmorfia Metaxaki als Lauretta aus „Gianni Schicchi“, deren berühmte Arie sie mit Hingabe sang. Leidenschaftlich war auch Yoonki Baeks Cavaradossi aus „Tosca“, mit dem der Puccini-Reigen beschlossen wurde.

Ihren großen Auftritt hatte María Fernanda Castillo dann als Leonora aus Verdis „La forza del destino“; die Arie durchdrang und füllte ungemein stark jeden Kubikzentimeter des Saales. Mit den Clowns und damit Humor wurde der Abend beschlossen, als die um die Sporanistin Virginia Felicitas Ferentschik, die Mezzosopranistin Milena Juhl und den Tenor Daniel Schliewa ergänzten Solistinnen und Solisten die muntere Ensemble-Schlußfuge aus Verdis „Falstaff“ gaben.
Dann zeigten die Lübecker, daß auch mit starker zahlenmäßiger Einschränkung ein brandender Applaus möglich ist. Der erstritt sich ein wunderbares „Meistersinger“-Quintett – es geht halt nicht ohne den „Meesta“! Das rhythmische Klatschen wollte nicht aufhören und gerne hätten der bejubelte Vladar und alle nicht minder mit Beifall bedachten Mitwirkenden eine zweite Zugabe vorbereiten dürfen. Die Lübecker hätten´s ihnen gedankt! Man wünscht den weiteren Vorstellungen ebensoviel Erfolg.

Andreas Ströbl 20.9.2020
Bilder (c) Musiktheater Lübeck / Olaf Malzahn
Die menschliche Stimme/Das Telefon
Monooper von Francis Poulenc/Kammeroper von Gian Carlo Menotti
Besuchte Vorstellung: Premiere am 28. August 2020
Fast fühlte man sich wie in einer der „Kostproben“ im Lübecker Theater, jenen appetitmachenden kostenlosen Einblicken in die Inszenierung einer Oper etwa anderthalb Wochen vor der Premiere, die von interessierten Freunden des Lübecker Theaters sehr gerne wahrgenommen werden. Dann ist naturgemäß höchstens ein Drittel der Plätze besetzt. Aber es war die erste Aufführung nach der Corona-Pause, auf die das opernhungrige Lübecker Publikum sehnlichst gewartet hatte. Das Krisenkonzept der Theaterleitung war durchdacht, sah jeweils eine leere Reihe und zwischen den Zuschauern je zwei freie Sitzplätze vor. Ausgesprochen diszipliniert fügten sich die Lübecker, wobei mehr freie Plätze als der Not geschuldet zeigten, daß viele Respekt vor der zweiten Welle der Pandemie hatten und die Masse meiden wollten. Nun – es gibt noch eine zweite Premiere am Sonntag und angesichts der zunehmenden Überschreitungen des begründet verschärften Regelwerks durch eine Legion von Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen und Ignoranten darf man sich über Zurückhaltung und Vorsicht eher freuen.

Höchsterfreulich und absolut überzeugend in jeder Hinsicht war der mit Spannung erwartete Doppelabend mit zwei Telephon-Opern, wobei dieses Genre durch diese beiden einaktigen Werke allerdings schon ausgefüllt sein dürfte. Gegen die allgemeine Einschränkungsdepression hat das Haus ein erfrischend humoriges Konzept gesetzt. Vom freundlichen Empfang und den ausgesprochen höflich vorgetragenen Hinweisen zur Einhaltung der gebotenen Regeln, über den Duktus der Texte im Programmheft (es gibt wieder richtige Hefte und keine unhandlichen Faltblätter mehr!) bis zur Auswahl der beiden Kurzopern mit ihren ironischen Brechungen („Die menschliche Stimme“) und ausgemachten Lachnummern („Das Telefon“) durchschwebte den kurzen aber intensiven Abend eine auch durch die minimierte Zahl an Mitwirkenden konzentrierte Leichtigkeit in höchster künstlerischer Vollendung.
Leicht ist Poulencs „La voix humaine“ eigentlich nicht, auch wenn man zu Beginn des Telephonats – denn das ist das einzige, was faktisch passiert – immer wieder die Augen gegen die wunderschöne Jugenstildecke dreht, weil man das Gequassel der jungen Frau im Kampf mit Telephonfräuleins und unliebsamen Fernsprech-Teilnehmern, die die Leitung blockieren, zuerst nur als nervend empfinden kann. Wie ernst die Sache tatsächlich ist, wird schnell klar, weil offensichtlich das Telephon die einzige Verbindung zu ihrem Geliebten ist, der sich vor Kurzem von der Dame getrennt hat. Diese Dame wird gesungen und gespielt von María Fernanda Castillo und was sie da am Premierenabend abgeliefert hat, war eine absolut hochkarätige Leistung in perfektem Zusammenspiel aus sehr anspruchsvollem Gesang in den unterschiedlichsten Stimmungsfärbungen und Tonstärken vom verliebten Gurren über den hysterischen Ausbruch bis zur tiefsten Verzweiflung.

Das Phänomen der Hysterie hat ein kluger Kopf einmal als erhöhte Durchlässigkeit der seelischen Membran bezeichnet und diese weniger abschätzig als psychologisch verständnisvolle Definition entspricht dem, was die Rolle verlangt und die Sopranistin geleistet hat: sie hat die angegriffene und verletzte Seele einer liebenden Frau in den Saal gesungen, geweint, geschrien. Diese Psyche ist zum Zerreißen gespannt wie das altrosafarbene Telephonkabel, das sie wie eine Nabelschnur mit der Außenwelt und dem geliebten Menschen verbindet. Daß das Kabel wie das Nornenseil schließlich unter ihrem verzweifelten Zerren reißt, bedeutet nicht Abnabelung, sondern ist der Auftakt zu ihrem Ende. Sie singt den Dialog ohne Verbindung weiter und man bleibt am Ende im Ungewissen, ob sie sich mit dem Kabel erdrosselt und ob es ihr Gegenüber tatsächlich jemals gegeben hat.
So tragisch die Geschichte ist – sie entstand doch aus einem Scherz. Poulenc erlebte in Mailand, wie die Callas am Ende der „Dialoge der Karmelitinnen“ den großen Mario Del Monaco in die Kulisse schubste, um den Applaus alleine genießen zu können. Poulencs Freund und Herausgeber Hervé Dugardin meinte: „Du müßtest etwas für die Callas alleine machen. So könnte sie sich nach Belieben verbeugen. Warum machst Du nicht ‚La voix humaine‘?“ Poulenc erinnert sich: „Ich habe sie gemacht, war mir aber sicher, sie der Callas nicht zu geben.“ Der Komponist entschied sich schließlich für Denise Duval als Uraufführungssolistin. Mit María Fernanda Castillo wäre Poulenc mit Sicherheit völlig einverstanden gewesen. Die „Brava“-Rufe nach dem letzten Takt kamen von Herzen und das zu Recht.

Die gelungene Inszenierung von Bernd Reiner Krieger nach einem Konzept von Vibeke Andersen und Rainer Vierlinger mit dem reduzierten Bühnenbild tat ihr Übriges, um die Vereinsamung der Protagonistin auf einem weißen Quadrat als kargen Raum ihres Lebens zu verbildlichen. Poulencs Musik ist immer wieder schlichtweg schön und ungemein stark. Daß das großartig aufgestellte Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck, von schwarzem Erbstüll schemenhaft verborgen, hinter der Vorderbühne spielte, entsprach klanglich und inhaltlich dem, was dieser kurzen Oper angemessen ist. Kaum hatten sich die Lübecker in den GMD und neuen Operndirektor Stefan Vladar verliebt, da unterbrach das weltbeherrschende Virus die so glückliche Liaison. Daß die Zwangspause an der hervorragenden Zusammenarbeit von Dirigent und Orchester und daraus resultierender Qualität nichts ändern konnte, bewies dieser erste Abend.
Als Zwischengruß aus der Künstlerküche gab Vladar, der ja als Pianist reüssiert hatte, bevor er das Dirigentenpult betrat, aus der Regieloge in der Umbaupause Poulencs „Improvisation Nr. 15 – Hommage à Edith Piaf“ und Eric Saties 1. „Gymnopédie“ zum Besten. Selten hat man das verträumte Stück so sangbar auf dem Pianoforte gehört, mit sensibel eingesetzten Synkopen und feinen Abstimmungen in den Tonstärken.
Und dann Menottis „Telefon“, das im Original treffend „L´amour à trois“ heißt, denn es ist keine Ménage à trois im eigentlichen Sinne; der junge Mann, der seiner Geliebten einen Heiratsantrag machen möchte, muß diese sich mit ihrem Telephon teilen. Die charmante Inszenierung von Rainer Vierlinger mit den farbenfrohen Sitzmöbeln, in denen die zahlreichen Telephone wie Kastenteufelchen plärren und schrillen, entlarvt die Apparate als Fetische. Wunderbarer Einfall, als Lucy das Telephonkabel mit dem Lockenstab in Form bringt. Das ist ein echtes Stück für geplagte Menschen der nicht ganz jungen Generation, deren Kinder, Nichten und Neffen sich zu Knechten der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik gemacht haben und bei denen man sich als Kind der 60er Jahre fragt, wie oft wohl diese Daddeldinger zu einem Interruptus von was auch immer in deren jungen Leben und Lieben geführt haben mögen.

Jeder, der schonmal Theater gespielt hat, weiß, daß es auf der Bühne eher schwieriger ist, lustig zu sein als ernst. Die Sopranistin Andrea Stadel als Lucy und der Bariton Johan Hyunbong Choi als Ben boten in dieser Opera buffa weit mehr als Broadway-Slapstick. Der frische, humorvolle Charakter der Musik mit ihrem zum Telephon-Geplauder passenden dynamischen Rhythmus wird in Gesang und Spiel des Paares großartig aufgenommen. Es macht einfach nur Spaß, anzusehen, wie Andrea Stadel sich wie eine bekiffte Rheintochter laut lachend auf den Fauteuil schmeißt, während Hyunbong Choi dem Wahnsinn immer näherkommt, weil die Angebetete vor lauter oberflächlicher Plauderei nicht mitbekommt, daß er sie zu seiner Frau machen will. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ein Telephon nach dem anderen unschädlich zu machen, indem er die Kabel ausreißt oder durchschneidet. Aber Lucy hat immer noch ein weiteres ihrer Babies im Plüschhocker – letztlich das Smartphone, das Ben ihr zu Beginn geschenkt hat. Die buchstäblich lange Leitung wird wie beim Tauziehen zwischen den beiden überdehnt und versinnbildlicht die Zerreißprobe ihrer Beziehung. Man hätte den armen Ben verstanden, wenn er einfach auf Nimmerwiedersehen den Zug genommen hätte, aber es ist halt wahre Liebe, die den Kommunikationswahnsinn schließlich mit seinen eigenen Mitteln austrickst. Er ruft sie also auf dem Weg zum Bahnhof an und das Happy-End ist perfekt.
Perfekt war dieser erste Premierenabend im Lübecker Theater, das mal wieder gezeigt hat, daß es nicht nur eines der besten Häuser im Norden ist, sondern souverän auch echte Krisen meistert.
Andreas Ströbl, 30.8.2020
Bilder (c) Theater Lübeck / Quast
L´Européenne
„Die Flamme schmilzt das Elend ein“
Musik: Richard van Schoor
Libretto: Thomas Goerge
Besuchte Vorstellung: UA-Premiere am 6. März 2020
Ganz ohne Zweifel ist die Kino-Oper „L´Europénne“ das richtige Stück zum richtigen Zeitpunkt. In der Uraufführung am 6. März im experimentierfreudigen Theater Lübeck erlebte ein begeistertes Publikum den ersten Teil des Doppelpaßprojektes „I like Africa and Africa likes me – I like Europe and Europe likes me“. Die Macher dieser Collage aus Oper und Filmsequenzen gehören zu einem afrikanisch-europäischen Künstler-Kollektiv um Daniel Angermayr, Thomas Goerge, Richard van Schoor, Abdoul Kader Traoré und Lionel Poutiaire Somé; das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt der Oper Halle und des Musiktheaters Lübeck.
Der Titel ist sinnfällig gewählt und der Opernkenner assoziiert sofort Giacomo Meyerbeers Oper „L´Africaine“, die das Team am 3. April in Lübeck aufführen wird. So wird also zuerst von Afrika aus nach Europa geblickt und folglich beschreibt der Begriff des Perspektivwechsels den Charakter der Produktion wohl am treffendsten.
Das Packende dieses Werks liegt in der Verbindung von Sozialkritik mit traditionellen Elementen des Musiktheaters. Das erinnert an den Brecht´schen Ansatz. Kommt noch eine Liebesgeschichte hinzu, sind wir bei Wagner. Hochinteressant ist hier, daß gerade das Vertraute den Zugang zu der Produktion erleichtert, gleichsam als umgekehrter Verfremdungseffekt. Vertrautes wird fremd und umgedreht.
Doch worum geht es eigentlich in „L´Européenne“? Erster Schauplatz ist eine dieser riesigen Mülldeponien irgendwo am Rande einer afrikanischen Großstadt.

Dort klauben die Menschen, darunter viele Kinder, den Elektroschrott auseinander, den ihnen Europa überlassen hat, gleichsam die Müll-Brosamen, die von der Herren Tisch im reichen Norden abgekippt werden. Aber es gibt dort findige Menschen, die mehr als die Rohstoffe sammeln. Bouba ist einer von ihnen; er sucht nach Daten auf den weggeworfenen Festplatten, die er als „Hacker“ nutzt, um an das große Geld derer zu kommen, deren Urgroßväter Afrika zu einem Kontinent gemacht haben, den man am liebsten verlassen will. Wenn man es kann. Auf der Deponie arbeitet die Europäerin Lena, die einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation angehört und verzweifelt immer neue Proben des verseuchten Bodens nimmt. Lena steht für die Hilflosigkeit all derjenigen Europäer, die etwas tun wollen, aber letztlich an den Verhältnissen scheitern. Die beiden verlieben sich ineinander, aber Lena muß wieder in ihre Heimat und läßt Bouba zurück.

Er will nicht ohne sie leben und folgt ihr auf einer dieser mörderischen Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer, das mittlerweile zu einem riesigen Seefriedhof geworden ist, in das gelobte Land, „wo man im Fette schwimmt“. Zuvor befragt er gemäß der Tradition seines Stammes den „Fètischeur“, einen Schamanen, ob er die gefährliche Reise antreten soll. Die zu Rate gezogenen Totemtiere Hyäne und Hase befinden sich im Widerstreit, der seine innere Situation spiegelt.

Bouba findet Lena, aber ihre Liebe hat keine Zukunft, denn der Afrikaner hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Zudem ist Lena psychisch krank, was in einen Suizid durch Tabletten mündet. Schnell wird der Immigrant mit ihrem Tod in Verbindung gebracht und verurteilt. Es ist ja so leicht, nach der Tagesschau, bei der man sich ehrlich betroffen gefühlt hat, weil schon wieder überfüllte Boote mit Afrikanern im Mittelmeer gekentert sind und berichtet wird, daß alle ertrunken sind, innerlich ab- und umzuschalten und sich dem „Tatort“ hinzugeben. Aber im „Tatort“ geht es um das gleiche Thema und bei Anne Will anschließend auch. So war es am Freitagabend im anheimelnden Lübecker Jugendstil-Theater – vorne geschahen Dramen und denen konnte man sich nicht mal während der Pause bei Sekt und Brezeln entziehen, denn eine Pause gab es nicht. Die Filmszenen zeigten, die Handlung begleitend und unterstreichend, entweder die Arbeit der Afrikaner im Müll, Ritualtänze oder bestanden am Ende aus Sequenzen aus dem Kurzfilm „Die falsche Seite“ des burkinischen Regisseurs Lionel Poutiaire Somé. Der Clou des Ganzen ist aber einerseits Thomas Goerges Sprache, die dem Opernliebhaber aus Libretti des 19. Jahrhunderts vertraut ist und so eine ironische Brechung in das Werk bringt. Das Libretto ist angereichert mit zeitgenössischen Begriffen, Ausschnitten aus Medienmeldungen und Twitter-Nachrichten, dann wieder erscheinen Beethoven-, Mahler- und Heine-Zitate. Andererseits ist es die fast durchweg tonal gehaltene Musik des südafrikanischen Komponisten Richard van Schoor, deren manchmal jazzige Rhythmen an Kurt Weill denken lassen. Es ist aber die Mischung aus dieser ungemein farbig schillernden Klangwelt mit sehr starkem Philharmonischem Orchester der Hansestadt Lübeck unter der Leitung von Andreas Wolf und dem präzise singenden Chor unter Jan-Michael Krüger mit Passagen wie „Welcome to Toxic City“, die dem Zuhörer das Gefühl vermittelte, wie es wohl gewesen sein könnte, eine Uraufführung in den 20er Jahren am Berliner Schiffbauerdamm mitzuerleben. Die Musik ist jedoch alles andere als eklektizistisch; Tierlaute, Trommeln und der Lärm der Schrottsammler verleihen den postmodernen Klängen entsprechendes Lokalkolorit. Fast ist die Musik zu schön angesichts all des Elends, das von der Flamme des brennenden Mülls eingeschmolzen wird.

Der Tenor Owen Metsileng gab einen leidenschaftlichen Bouba und Emma McNairy sang und spielte mit großer Überzeugung die engagierte Lena. Das Drama war eigentlich schlimm genug und es hätte nicht noch eine seelische Erkrankung dieser Protagonistin gebraucht. Die führte aber handlungsfunktional zu einem Verdi-haften Selbstmord. Es waren diese vielen Zitate, die auch den eher traditionell ausgerichteten Opernliebhaber immer wieder packten wie die Anrufung des Schamanen („Fétischeur! Erscheine!“), bei der man im Schnürboden sowohl Samiel als auch Loge im Geiste die Ohren spitzen sah. Es erschien als Zauberer Youngkug Jin mit mächtiger Baßstimme, seiner Macht bewußt. Daß diese Schamanen übrigens ein völlig selbstverständlicher Teil des täglichen Lebens in vielen afrikanischen Ethnien sind, verriet Lionel Poutiaire Somé in der „Kostprobe“. Dies ist eine mittlerweile bewährte und immer stärker wahrgenommene Tradition in Lübeck, bei der ein bis zwei Wochen vor der Premiere kostenlos in die Inszenierung eingeführt wird; danach kann man an der Probe einer Szene teilhaben. Er selbst hatte den Familien-Féticheur nach dem Gelingen seiner Inszenierung befragt. Das Textverständnis des deutschen Librettos war bei allen Mitwirkenden, unter denen sich kaum ein Muttersprachler befand, ausgesprochen gut, was die Inszenierung auch brauchte. Musik, Gesang, ein ausgesprochen lebhaftes Bühnengeschehen und die Videos nahmen ohnehin alle Sinne ohne Unterlaß in Anspruch.

Die wurden gefordert, um sich vom bequemen Eurozentrismus zu verabschieden und die Welt mal mit den Augen der postkolonialen Afrikaner zu sehen. „Hic sunt Dracones“ ist eine Formel auf dem Hunt-Lenox-Globus von 1504 (entsprechend dem „Hic sunt leones“ bei den Römern), mit der die Welt jenseits der bekannten Grenzen markiert wurde. Drachen und Seeungeheuer erwartete man im Unbekannten und hier wird die Formel auf Europa angewandt. Bei uns leben also die Monstren, die zu fürchten sind. Diese Ungeheuer sperren die Flüchtlinge, kaum daß sie sie aus dem Wasser gefischt wurden, wie gefährliche Tiere in Lager, wo sie wie Ketzer als Randglieder der Gesellschaft vegetieren. Das illustrieren die Goya´schen Papp-Figuren mit der Carocha, dem spitzen Ketzerhut, und dem Sanbenito, dem Büßergewand der spanischen Inquisition. Daß der Traum vom Europa, in dem Milch und Honig fließen, zum Alptraum wird, enthüllt die englische Sentenz auf den Rückseiten der Ketzerfiguren. In diesem Alptraum marschieren schließlich die Monster, die zum Töten bereit sind, in einer Videosequenz von 2018 durch die Chemnitzer Innenstadt.

Die Totemhyäne (ebenfalls Youngkug Jin) hatte das vorausgesehen, während Caroline Nkwe als Hase zur Reise geraten hatte. Sie, stimmlich ebenfalls sehr präsent, war im schicken Europa der Anzug- und Robenträger zur Richterin mutiert. Das Vertraute ist so für Bouba zum Fremden geworden. Endstation für ihn und zahllose andere, ohne Hoffnung. Das Motto aus Dantes Höllentor im letzten Bild ließ keinen Zweifel daran. Durch begeisterten Applaus zeigte das Lübecker Publikum, daß die Botschaft angekommen war. Ein besonders schöner Einfall von Andreas Wolf war, das gesamte Orchester für den Beifall auf die Bühne zu holen. Nach dieser Vorstellung dürfte auch der Letzte begriffen haben, weswegen all diese Menschen nach Europa strömen. Wer es immer noch verstanden hat, sollte sich „L´Europénne“ in Lübeck ansehen.
Bilder (c) Olaf Malzahn
Andreas Ströbl, 9.3.2020
Montezuma
„Barbaren, die Menschenopfer bringen“ – ein Opernprojekt am Theater Lübeck
Libretto: Friedrich II. von Preußen
Musik: Carl Heinrich Graun
Besuchte Vorstellung: Premiere am 26. Januar 2020
Friedrich II. von Preußen ist eine der liebsten Projektionsflächen der Deutschen. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß er sich selbst in dem Aztekenherrscher Montezuma (eigentlich „Moctezuma“) eine Projektionsfigur ausgesucht hat, um seine Angriffskriege als Präventivmaßnahmen im Rahmen der Selbstverteidigung zu legitimieren.
Um es gleich vorweg zu sagen: Im Theater Lübeck ist mit dieser Collage aus Grauns Oper mit dem Libretto des Preußenkönigs und Passagen aus Heiner Müllers „Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei“ nicht nur ein hochinteressantes Experiment gelungen. Die Produktion ist programmatisch und von der inhaltlichen Umsetzung ein Geschwister von „Christophe Colomb“ (noch drei Vorstellungen bis zum 4. April!); in beiden Fällen geht es um die Instrumentalisierung kolonialgeschichtlicher Inhalte und längst überfälliges kritisches Geraderücken eines fragwürdigen Librettos. Zudem wurde einem interessierten Publikum nahezu vergessene Musik präsentiert.
Ingo Kerkhof hat intelligentes Werkstatt-Theater abgeliefert, wobei eine historische Vorbildung wesentlich zum Verständnis beitrug. Die bewährten und immer stärker wahrgenommenen „Kostproben“, bei denen Regisseur und Dramaturg ein bis zwei Wochen vor der Premiere kostenlos in die Inszenierung einführen und man an der Probe einer längeren Szene teilhaben kann, sind eine ungemein hilfreiche Einrichtung des Lübecker Haues.
Um das komplexe Neben- und Übereinander verschiedener Darstellungs- und Bedeutungsebenen nicht zu überfrachten, beschränkten sich sowohl das Bühnenbild von Anne Neuser als auch die Kostüme von Britta Leonhardt auf Andeutungen und Zitate. Alles andere hätte die Konzentration auf die Inhalte gestört. So hatte man auf der Bühne Brandenburger Reet wachsen lassen, durch das sich die Darsteller raschelnd bewegten und das in seiner Schlichtheit jeglichen überflüssigen Exotismus ausschloß. Es gab nur zwei Hintergrundflächen, einfache Graphiken mit Himmel und Baumsilhouetten, die für den Tag im ersten und die Nacht im zweiten Teil standen.

Friedrich erschien in drei Gestalten, als kleiner Junge, als junger Prinz und alternder Herrscher (wunderbar bissig dargestellt durch die Schauspielerin Magdalene Artelt), mitunter gleichzeitig. Das war sinntragend, hatte doch die brachiale Erziehung des Soldatenvaters und -königs alles Sanfte und geschlechtlich Gesunde in seinem Thronfolger zerbrochen. Friedrich durfte nicht selbstverständlich ein kunstsinniger Schöngeist sein, der nun mal mit Frauen erotisch nichts anfangen kann. Seinen Neffen hatte er später nicht viel besser behandelt als sein Vater ihn, so etwas prägt das ganze Leben.
Daher durfte das Publikum auch in der ersten Szene am „Tabakskollegium“ teilnehmen, einer festen Einrichtung Friedrich Wilhelms I., die Alkohol, Nikotin und Testosteron zu gelungenen Abenden für die Herren machten. Einen unfreiwilligen Hofnarren gab es auch, den Historiographen Jacob Paul von Gundling, immerhin Präsident der Preußischen Akademie der Wissenschaften, und über Jahre hinweg Mobbingopfer des Königs und seiner Spießgesellen. Der Gelehrte aus Mittelfranken starb schließlich an seinen Magengeschwüren, eine Folge der jahrelangen Demütigungen und damit einhergehender Alkoholsucht.
Die Härte des Königs war ebenso die des Vaters und seine militärischen Erziehungsmethoden ließen in dieser Szene den kleinen Friedrich dem geschundenen Gundling sehr nahe sein. Das war aber verboten, ebenso wie die Liebe zu Hans Hermann von Katte, den wohl ebenso der Umstand einer „widernatürlichen“ Beziehung zu Friedrich wie der gemeinsame Fluchtversuch den Kopf kostete.

„Es gibt nichts Schlechteres als den Menschen“, sagt der desillusionierte spätere König in Müllers Text. Mensch ist er selbst. In die Geschichte des bei näherer Betrachtung wenig sympathischen Preußenkönigs sind hier die Szenen aus „Montezuma“ geschickt verwoben bzw. laufen die Stränge nebeneinander her. Das ist umso angemessener, als mit dieser Produktion die Ruhmsucht, Verschlagenheit und menschenmassenverschlingende Risikofreudigkeit von Friedrich, den man später „den Großen“ nennen sollte, entlarvt wird. Gerade die verlogene List ist eine Eigenschaft, die er in seinem Libretto den spanischen Kolonialherren unterstellt, die ihre Verschlagenheit und die millionenfachen Massaker an den Unterworfenen dadurch rechtfertigen, daß es ja nur „Barbaren, die Menschenopfer bringen“ seien.
Anspruchsvolle Unterhaltung schafft eine willkommene Abwechslung zwischen all dem Menschenmorden und so hat Friedrich fast zeitgleich mit Carl Philipp Emanuel Bach den Komponisten und Sänger Carl Heinrich Graun an seinen Hof geholt. Den schickte er nach Italien, um dort Ausschau nach Sängerinnen und Sängern für die geplante Italienische Oper in Berlin zu halten. Dieser Aufenthalt hat ihn offenbar sehr geprägt; seine Musik kommt gerade im „Montezuma“ mediterran und leicht daher. Unter Takahiro Nagasaki spielte das Philharmonische Orchester der Hansestadt ausgesprochen frisch und flott, mit schwungvoller Dynamik. Die Solistinnen – im Original wurden die Rollen teilweise mit Countertenören besetzt – bestachen allesamt durch gestochen-glasklare Wiedergabe der sehr anspruchsvollen Koloraturläufe. Vor allem Emma McNairy als Erissena, Emilia Galotti und Dienerin holte sich völlig verdient brandenden Szenenapplaus ab. Das gilt ebenso für Evmorfia Metaxaki als Eupaforice und Katte, Andrea Stadel als Cortés bzw. Wilhelmine und die charaktertiefe Darstellung von Montezuma durch Julie-Marie Sundal. Stimmfarben und Spiel bildeten bei allen Sängerinnen eine Einheit, das Duett Montezuma–Eupaforice war ein echter Höhepunkt des Abends. Man mag hier ungern die eine vor die andere stellen.

Daß dies in der Lübecker Produktion alles Frauenstimmen sind, trägt zum Brecht´schen Verfremdungseffekt bei, der hier dazu führt, daß man sich immer wieder fragt, was eigentlich passiert und sich eher mit den Inhalten auseinandersetzen kann. Dazu gehört auch, daß die Geschichte des Kolonialismus weitergesponnen wird, indem einige der Ureinwohner als exotische Schaustücke in Kostümen photographiert und ihre Schädel vermessen werden. In der historischen Konsequenz bis zum Staatsrassismus und faschistischen Völkermord ist das sinnvoll, hätte aber nicht unbedingt sein müssen. Die ganze Inszenierung war gerade durch ihre Vielschichtigkeit und Bezüge so klar und kritisch, daß die, die sehen und hören konnten, die Botschaft verstanden. Das ging offenbar nicht jedem im Publikum so, denn gerade die humorigen, durch Überzeichnungen erzeugten Aspekte verstanden manche nicht, wie in den Pausen und nach der Vorstellung mitunter hörbar war. Aber Kerkhof hat seinen Brecht gut und frei in der eigenen Interpretation des Stoffes gelesen.
Zum Schluß hin überschüttet Emma McNairy die nun gemeuchelten Azteken mit Benzin und erzählt wie eine Chronistin, wer beim folgenden Brand im Lübecker Theater alles den Tod in den Flammen findet. „Leute, es geht um euch!“ will das sagen und ja, vielleicht beschäftigt man sich nach der Vorstellung einmal mit Kolonialismus, Friedrich dem Großen und erkennt dann in der Erinnerung an den Deutsch-Unterricht, daß „Emilia Galotti“ einst nicht ganz ungefährliche Kritik am Adel war. Rezeption also der Rezeption – das ist ein anspruchsvoller Ansatz und man mag allen inhaltlich und künstlerisch Beteiligten bescheinigen, daß sie gescheites Theater für gescheite Menschen gemacht haben.
Der Schlußapplaus mit vielen „Bravo“ und vor allem „Brava“-Rufen belegte, daß das Konzept aufgegangen war.
Andreas Ströbl, 27.1.2020
Bilder (c) Theater Lübeck
Rusalka
Machtspiel statt Märchen
Besuchte Vorstellung: Premiere am 15. November 2019
Prima la musica! – Bei allem grundsätzlichen Bekenntnis zum Gesamtkunstwerk thront doch die Musik in der Oper über allem und das gilt auch für die Premiere von Antonin Dvořáks „Lyrischem Märchen“, seiner „Rusalka“, in Lübeck.
Nach zwei herausragenden Dirigaten in der Lübecker „MuK“ (Musik- und Kongreßhalle) mit Mahlers Zweiter und der Fünften von Schostakowitsch im Rahmen der Sinfoniekonzerte 2019/20 stand der neue GMD, Stefan Vladar, nun zum ersten Mal am Lübecker Opernpult. Wie zu erwarten und zu erhoffen, meisterte er auch diese Aufgabe mit Energie und Feinsinn, das heißt: er brachte das Philharmonische Orchester zum märchenhaften Strahlen, entließ die Fortissimi mit Wucht in den Theatersaal und zauberte mit den feinen Nuancen. Die rhythmische Dynamik der ebenso kraftvollen wie seelenvollen Musik Dvořáks war von Beginn her mitreißend und körperlich fühlbar. Vor allem aber drang jede Silbe der Solisten durch und sollte sich eine Tschechin oder ein Tscheche im Publikum befunden haben, hätte er oder sie jedes Wort verstanden. Alle gesanglich Mitwirkenden haben sich offenbar mit Hingabe der Einstudierung einer Sprache gewidmet, die kräftig und charakteristisch, aber nicht in erster Linie sangbar ist.

Es klänge zu sehr nach Dirigenten-Dominanz, wenn man sagte, Vladar hätte das Orchester im Griff. Vielmehr scheint dieses in dem Wiener einen lange gesuchten Leiter gefunden zu haben, der erkannt hat, daß das Orchester der Hansestadt eben keine Provinzkapelle ist, sondern in der ersten Liga spielt.
Rusalkas „Lied an den Mond“ hat man sich zumindest im Sendebereich des NDR eigentlich schon übersattgehört, da es fast jeden Samstagmorgen in Herrn Mendes Mischung aus Carmen-Habanera, Peer-Gynt-Morgenstimmung und der Moldau (offenbar besteht der wunderbare „Vaterland“-Zyklus nur noch aus diesem Stück) gespielt wird. Das zarte Streicherweben meinte man am Premierenabend nach langer Zeit wiederzuentdecken und so ging es böhmisch-leidenschaftlich weiter. Der Applaus für die Harfenistin nach dem zweiten Sinfoniekonzert am 20. Oktober ging unter und daher soll er an dieser Stelle um so herzlicher für ihren Einsatz am 15. November erfolgen.
Mariá Fernanda Castillos Rusalka ist ungemein stark und selbstgewußt, was für die beiden letzten Akte großartig war. Im ersten Akt und gerade beim berühmten Mond-Lied wäre aber gerade für eine junge lyrische Sopranistin etwas mehr sanfte Schmiegsamkeit möglich gewesen. Da hätte sie gerne ein paar Phon leiser sein dürfen, ohne Angst vor dem Klein-Mädchen-Klischee haben zu müssen. Mit der Titelrolle ist nun mal Gestalt gewordene Jugendlichkeit beschrieben und die darf auch Weichheit vermitteln. Romina Boscolo als Ježibaba schaffte es, mit ihrem aufregend-ungewöhnlichen Alt, nahezu häßliche Töne in die durch die anspruchsvolle Bewegungsregie nicht ganz einfache Rolle zu geben, ohne als krächzende Hexe zu erscheinen. Als fremde Fürstin bewältigte Marlene Lichtenberg (Mezzosopran) überzeugend die Aufgabe, eine kalte und unsympathische Frau darzustellen. Der Tenor Tobias Hächler als Prinz sang die Rolle zwar gut, aber er wurde entweder von der Regie alleine gelassen oder war etwas gehemmt. Wer bei einem Satz wie „alles will ich dir geben!“ wie der standhafte Zinnsoldat dasteht, hat das Andersen-Märchen von der kleinen Meerjungfrau mit einem anderen verwechselt. Sollte er aber womöglich insgesamt so kalt wie seine zum Irrlicht gewordene Geliebte sein?

Rúni Brattaberg gab einen wunderbaren Wassermann mit sehr präsenter Baß-Stimmfülle und natürlicher väterlicher Autorität, Steffen Kubach (Bariton) als Heger brachte immer wieder eine schöne ironische Brechung in das Drama.
Ein Drama ist dieses Märchen ja in der Tat; hier geht es um Liebe, Betrug, Männer- und Frauenmacht, sexuelles Ausgeliefertsein und Tod. Die Verwandlung eines jungen Mädchens und seine Initiation in eine andere Welt, nämlich die der Erwachsenen, wird in den Sagen und Märchen von all den Undinen, Meerjungfrauen und eben Rusalken zum brennenden Thema gemacht und daher ist der psychologische Ansatz des Regisseurs Otto Katzameier völlig plausibel. Es geht aber immer auch um eine Wechselbeziehung zwischen dem Mädchen, das sich unter Schmerzen verändern muß, um den verlockenden Bereich von Liebe und Sexualität für sich zu erobern und um den Mann, der dem geheimnisvollen Wesen verfallen ist, um es aus dem gewohnten Milieu der Kindlichkeit und Geborgenheit zu führen – oder zu entreißen. Das englische Verb „to rape“ führt da etymologisch vom Reißen über das Rauben bis zum Vergewaltigen. Daß die Angst vor solchen Übergriffen nicht unbegründet ist, macht Katzameier in mehreren Szenen deutlich, wobei er es glücklicherweise bei Andeutungen läßt. Man weiß als Zuschauer schon, wohin da die Reise besser nicht gehen soll. Das sind schmale Grate und die Grenze zur Übersexualisierung ist ebenso schnell erreicht wie die prüde Angst vor naiver Natürlichkeit. Vor fast zwei Jahren hat das die heftige Diskussion nach dem Abhängen des romantischen Jugendstilgemäldes „Hylas und die Nymphen“ von John William Waterhouse aus dem Jahr 1896 in der Manchester Art Gallery gezeigt.

Bei Katzameier fängt die Welt, in die Rusalka hineinmuß, wenn sie die Frau des geliebten Prinzen sein will, schon bei der Hexe Ježibaba an, denn diese ist eine Mischung aus heruntergekommenem Vamp mit lippenstiftverschmiertem Joker-Mund und einem Krüppel mit Gehhilfen, wobei sie – wie die Meerjungfrau bei Andersen – in der ersten Szene das Laufen lernt und dann die Krücken ablegt. Zugleich ähnelt sie am Ende in dem billigen Glitzerfummel deutlich der Gräfin mit nämlichem Kleid und dem gleichen Schminkgeschmiere. So stellt sie eine bizarre Verbindung zwischen den Wünschen des Mädchens und deren schmerzlicher Erfüllung mit der Folge des Betrogenwerdens her. Rusalka will Menschenleib und Menschenseele und die erhält sie von der Hexe, muß aber in der Konsequenz als Verlassene und folglich Verfluchte in einer ewigen Zwischenexistenz als Irrlicht umhergeistern, denn sie kann nicht mehr zurück in das familiäre Geborgenheitswasser.
Zumindest hat sie am Ende ihre Stimme wiedererhalten, denn die mußte sie opfern, um als stumme Schönheit zu scheitern. Wer keine Stimme hat, kann sich nicht Gehör verschaffen und der flatterhafte Prinz, der noch nie etwas von Verantwortung gehört hat, macht sich auch kaum die Mühe, das Mädchen auf anderer Kommunikationsebene zu verstehen. Dazu ist er zu oberflächlich wie der Rest der Menschenwelt.
Man denkt unweigerlich an den mahnenden Satz von Rusalkas Verwandten, der Rheintöchter aus Wagners „Rheingold“: „Traulich und treu ist´s nur in der Tiefe, falsch und feig ist, was dort oben sich freut!“ Ihr bleibt nur – und auch darin ist sie ganz Mensch geworden – das Vertrauen aus Erlösung durch die Religion, denn die Oper endet mit ihrer Hoffnung, daß Gott den Prinzen trotz all dem, was er ihr angetan hat, lieben möge.
Funktioniert das bei Katzameier? Oder soll es das gar nicht? Farb- und Lichtregie drängten den Zuschauer in die Fragen nach deren Symbolik, was aber immer wieder in den Ansätzen steckenblieb. Klar, wenn Stroboskoplicht eingesetzt wird, dann droht Gefahr. Der Wechsel der Scheinwerferfarben sollte unterschiedliche Emotionen unterstreichen, erinnerte aber zuweilen an Lampen mit Farbwechsel-Funktion.
Wenngleich schließlich die weiße Härte eines einsamen und, was ihre Erlösung angeht, ausgesprochen fraglichen Endes für Rusalka ein schales Gefühl des Mitleids hinterließ, applaudierten die Lübecker begeistert, wohl auch nach der dramatischen Anspannung gelöst. Es blieben aber auch Fragen offen und die konnte man im Premierenpublikum in der Pause und nach der Vorstellung hören: Warum immer wieder Figuren in Unterwäsche auftreten und die Darsteller von Rusalkas nassem Volk bei ihrer Berührung oder auch nur deren Andeutung in ihrer Nähe reihenweise laut polternd umfallen, dann aber wieder aufstehen.

Daß der Wassermann von den drei Elfen zu Beginn getreten und ausgezogen wird, soll wohl seine väterliche und damit männliche Autorität in Frage stellen. Er ist aber von der Figur her so weit von Übergriffigkeit entfernt, daß dieses über das Necken weit hinausgehende Gehabe der drei Mädchen überzogen erscheint. Das gilt auch für die Grapscherei des Hegers, der dem Küchenjungen an die Wäsche will. Offenbar sind für Katzameier eben alle Männer des Stücks potentielle Vergewaltiger, auch die männlichen Gefährten der Wassermädchen, und da droht eine verunklärende Vermengung der Bereiche. Im Programm-Faltblatt wird der Psychoanalytiker Jacques Lacan zitiert und so spielt Katzameier mit dessen Termini des „Imaginären, Symbolischen und Realen“. Spiegeln die fallenden und wiedererstehenden Gefährten lediglich Rusalkas Angst vor der völligen Vereinsamung wider?
Das Gespräch mit einer kritischen weiblichen Stimme aus dem Publikum ließ in eine Furcht vor leichtfertigem Umgang mit der Abbildung der Gewalt gegen Frauen blicken. Sicher – die Inszenierung ist sozialkritisch angelegt, aber grundsätzlich sind diskretere Hinweise oft eindringlicher. Ein inflationärer Gebrauch des zu Kritisierenden schafft da schnell mehr Distanz als im Ansatz gewollt.
Andreas Ströbl, 17.11.2019
Fotos © Olaf Malzahn
Darius Milhaud
Christophe Colomb
Heiligsprechung abgelehnt!
Besuchte Vorstellung: 10. November 2019
„Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.“ Als Georg Christoph Lichtenberg in den 1780er Jahren diesen tiefsinnigen Satz in seine „Sudelbücher“ schrieb, lagen die Massaker an den Cheyenne von Sand Creek (1864) und von Wounded Knee an den Lakota und verwandten Stämmen (1890) zwar noch in Jahrhundertferne. Aber die Spanier hatten im Namen Gottes und von maßloser Gier nach Gold und Silber getrieben mehr als 90% der ursprünglich geschätzt 60 Millionen süd- und nordamerikanischen Ureinwohner innerhalb des ersten Jahrhunderts nach 1492 entweder abgemetzelt, durch Sklavenarbeit vernichtet oder durch die von ihnen eingeschleppten Krankheiten umgebracht. Allein auf Hispaniola, der zweitgrößten der sogenannten Westindischen Inseln, lebten am schicksalsträchtigen 5. Dezember 1492 acht Millionen Indianer. 43 Jahre später waren alle tot. Bedauerlich war das für die Spanier nur deshalb, weil die sogenannten „Wilden“, mit deren zivilisatorischen Errungenschaften übrigens Europa teilweise erst im 19. Jahrhundert mithalten konnte, nun als Arbeitskräfte fehlten. Da lag es nahe, gleich Afrika als Sklavenproduktionsmaschine mitauszubeuten. Aber es gab ja auch im Inneren des Kontinents noch genügend Ureinwohner, die sich zu Zehntausenden in den Silberminen des bolivianischen Potosì zu Tode arbeiten mußten, um den Glanz Spaniens und die Ehre Gottes zu mehren. Da Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon im nämlichen Jahr 1492 alle Juden und Muslime aus Spanien hatten gewaltsam vertreiben lassen, was für die spanische Wirtschaft katastrophal war, kam Kolumbus Wiederentdeckung des Doppelkontinents gerade recht. Fanden die indianischen Sklaven kein Gold, ließ er ihnen die Hände abhacken.

Der Schatten des Kolonialismus ist lang und er fällt auch auf uns. Diskussionen und Verhandlungen um geraubte Kunstschätze und menschliche Überreste bestimmen das Tagesgeschäft vieler europäischer und US-amerikanischer Sammlungen und Museen, und sie sind bitter nötig. Ebenso notwendig ist auch eine angemessene künstlerische Auseinandersetzung und die bietet das Theater Lübeck – nein, nicht eigentlich mit Darius Milhauds Oper „Christoph Colomb“ von 1928, sondern mit ihrer Inszenierung durch Milo Pablo Momm. Er nimmt mit Hilfe einer Videoeinspielung die Zuschauer sofort an der Hand und führt sie gleich wieder aus dem Theater heraus: Hat man es sich auf den Fauteuils gerade gemütlich gemacht, darf die Aufmerksamkeit nicht bequem sitzen bleiben, sondern muß mit durch die Straßen Lübecks bis zum Völkerkundemuseum, wo die Exponate in Regalen und Kartons liegen oder stehen. Und die sind lebendig. Man merkt es manchmal erst auf den zweiten Blick, daß da wie Statuen stehende Schauspieler oder nur ihre Köpfe sichtbar werden und es wird klar, daß es bei vielen der Ausstellungsstücke in unseren Museen, eben nicht beispielsweise ein, wie noch vor Jahrzenten auf Objektbeschriftungen zu lesen, „Negerschädel aus Deutsch-Südwest“ präsentiert wird, sondern daß hier der Kopf des von seinem Stamm hochverehrten Urgroßvaters aus Ohamakari liegt, den der eigene hochverehrte Urgroßvater massakriert und dessen Schädel er als Trophäe nach Hause gebracht hat.

Momms Inszenierung ist von vornherein kritisch bzw. ironisch gebrochen angelegt, wie der bewußt überdrehte Vortrag des Sprechers (Merten Schroedter) unterstreicht, und anders läßt sich weder das Libretto noch die Oper inhaltlich auch nicht ertragen, geschweige denn auf eine Bühne des Postkolonialismus bringen. Dabei ist Milhauds Musik, wenn sie auch mitunter kracht und scheppert, größtenteils wunderschön und verfügt an vielen Stellen über eine mitreißende Rhythmik, die immer wieder an den revolutionären Duktus eines Kurt Weill denken läßt. Man kommt als moderner Mensch überhaupt nicht auf die Idee, daß der Komponist auf Grundlage des Librettos von Paul Claudel das alles ernstgemeint hat. Aber Milhauds enger Freund, der allerkatholischste Diener Ihrer ebensolchen Majestät Isabella, hat tatsächlich eine Art Heiligsprechung des Initiators eines des schlimmsten und langwierigsten Völkermords in der Menschheitsgeschichte angestrebt. Der Schriftsteller und Diplomat war der jüngere Bruder der berühmten Bildhauerin Camille Claudel; er hatte wesentlichen Anteil daran, daß Auguste Rodin sie als einzige Schülerin unterrichtete.

Es wirkt manchmal so, als hätte Momm sich eher von ihr als von ihrem Bruder inspirieren lassen, denn immer wieder verharren die Sänger und der Chor in tableauhaften, wie gemeißelt wirkenden Posen. Die Farbigkeit ist stark reduziert, sowohl im Bühnenbild als auch in den Kostümen und so wirken die wenigen farbigen Gewänder, Requisiten oder auch während der Vorstellung auf die Kulissen gemalten Beschriftungen um so stärker. Das ist zwar nicht neu, aber optisch bezwingend und lenkt die Konzentration auf die wesentlichen Aspekte. Die immer wieder auf den Erbs-Tüll oder die Kulissenwände projizierten Bilder sind schattentheaterhaft reduziert und erzählen die echte Geschichte von den versklavten, hingerichteten und gedemütigten Menschen, denen Leben, Würde und Geschichte geraubt wurden.
Das Orchester unter der Leitung von Andreas Wolf erfüllte das Theater mit Milhauds durchaus nicht einfach zu spielender Musik so kraftvoll und mitreißend, daß die Solisten stellenweise immer wieder untergingen. Der Bariton Johan Hyùnbong Choi in der Titelrolle, eigentlich eine verläßliche Lübecker Größe, war in den Tiefen meist kaum zu hören und es blieb manchmal fraglich, ob er sich nicht gegen das Orchester durchsetzen konnte oder ob dieses einfach zu laut war. Evmorfia Metaxaki, ebenfalls eine bewährte Lokalmatadorin, hatte es als Isabella einfacher, weil ihre Passagen musikalisch sich mehr auf die Sopranistin konzentrieren; sie ist aber auch einfach stimmlich zuverlässig und als Königin glaubhaft strahlend. Am überzeugendsten sowohl vom Gesang her als auch schauspielerisch war der Tenor Daniel Jenz als Teufel mit seinen verschiedenen Unterrollen. Den könnte man sich auch gut als Loge vorstellen.

Der Chor (und Extrachor) des Lübecker Theaters hatte den wohl dankbarsten Part, da das Werk stark chorlastig ausgerichtet ist. Die Chormitglieder sind samt ihren Gesichtern in reduzierte schwarze Kleidung mit nur wenigen weißen Accessoires gehüllt; es wird hier mit Begriffen wie unterdrückter Individualität und Massenbewegung gespielt. Gesang und Ausdruck waren exakt und stark, was angesichts der intensiven und aufeinander abgestimmten Bewegungen große Herausforderungen an die Mitwirkenden stellte und die Musik mit einer fast filmischen Dynamik intensivierte. Die Chorpartien sind oft schrill, was gerade in dieser Inszenierung hervorragend zur problematischen Thematik paßt und den Hörer ein weiteres Mal in die Frage drängt, ob sich bei der Kompositionsarbeit des Juden Milhaud, der später vor den Nazis fliehen mußte, nicht doch ein moralisch-kritischer Unterton in die Noten geschlängelt hat.
Oder genügt hier schon, im Sinne von „wo gehobelt wird, fallen Späne“, die in Claudels Libretto angeführte Einschränkung, daß Columbus Gott zwar versprochen hat, die Welt der Finsternis zu entreißen, aber "nicht dem Leid"? Schließlich wird der Eroberer ja im Stück mit seinen Taten konfrontiert. Möglicherweise hat sich Milhaud auch schlichtweg von der musikalischen Beweglichkeit und Lebendigkeit der brasilianischen Folklore begeistern lassen, die er als Begleiter Claudels in Südamerika kennengelernt hat.

Deutung und Fragen des Werkes an sich und der Realisierung für die Bühne erfordern hier mehr als sich nur in den Theatersessel zu setzen und wahrzunehmen. Seit Jahren gibt es im Theater Lübeck die wunderbare Einrichtung der „Kostprobe“, das heißt, daß Regisseur und/oder Dramaturg die Inszenierung an einem Abend kurz vor der Premiere vorstellen und die Zuschauer gratis an der Probe eines Teils der Produktion teilnehmen können. Ohne diesen mehrschichtigen Einblick, der immer noch von viel zu wenigen Lübeckern genutzt wird, wäre das Verständnis der inszenatorischen Grundidee im Fall von „Christophe Colomb“ den meisten Zuschauern sicher schwergefallen. Erschwerend hinzu kamen technische Probleme mit den Übertiteln, die gerade bei einem nahezu unbekannten Libretto unerläßlich sind. Die mitunter schnell gesungenen und gesprochenen Texte waren zwar bereits für die Projektion (inhaltlich nicht immer ganz geschickt) verkürzt worden, fielen aber zwischenzeitlich völlig aus. Auch bei starker Konzentration war der Text bis auf Fragmente wegen der Überdeckung durch das Orchester oder unklare Artikulation streckenweise nicht verständlich.
Das Nichtverstehen durchzieht als Schriftzug leitmotivisch in der Tat die ganze Aufführung, denn – das erschließt sich dem Zuschauer nur nach entsprechender Recherche, auch das Programm-Faltblatt verrät die Bedeutung nicht – einige Indianer-Darsteller pinseln mit großen Lettern immer wieder „MA C´UBA THAN“ auf die Kulissen. Vielleicht soll der Theaterbesucher selbst auf die Suche gehen und wenn er fündig geworden ist, dann eröffnet sich ein 500 Jahre altes Mißverständnis. Angeblich sollen die Spanier, als sie in Yucatán angekommen waren, die dort lebenden Maya nach dem Namen des Landes gefragt haben, worauf einer antwortete: „ich verstehe dich nicht!“. Das muß gelautet haben wie „yuk ak katán“ oder eben „ma c´uba than“ und daher rührt, der Überlieferung nach, der spätere Name der Halbinsel.

Man verstand die Sprache des anderen nicht und die Eroberer wollten auch die Kultur der indigenen Bevölkerung nicht verstehen, das war für das Plündern und Morden auch nicht notwendig. Geraubt werden immer auch Sprachen, Namen und damit Identitäten. So stahl Kolumbus der Insel Guanahani, dem ersten von ihm angelandeten amerikanischen Boden, ihre indigene Bezeichnung und ersetzte sie durch „San Salvador“, widmete sie also dem Erlöser. Auf der Bühne wird dieser Akt der nominellen Okkupation durch Überhängen der ursprünglichen Bezeichnung realisiert, auf die später „Eldorado“ folgt. Spätestens dann ist klar, daß es den Eroberern nur noch um die Anbetung des Goldes geht.
Ihre modernen Nachfolger sind Typen wie Trump und Bolsonaro, die die Rechte der Ureinwohner mit Militärstiefeln treten, ihnen die letzten Lebensräume rauben und denen in ihrer egomanen Kurzsichtigkeit auch die Zukunft der eigenen Kinder egal ist. Folgerichtig nehmen einige der Videoeinspielungen aktuelle Themen auf und zeigen aufmarschierende Soldateska und überfüllte Flüchtlingsboote.
Angesichts all dieser Dramen können die im Libretto vorgenommenen Assoziationen des Conquistadors mit Noah, Moses, Johannes, der Taube (columba!) des Heiligen Geistes und vor allem Jesus nur als Zumutung empfunden werden und man ist Momm dankbar für die blutige Ehrlichkeit, mit der er sich der Aufgabe der schwierigen Inszenierung eines schwierigen Stückes stellt. Diese Klarheit ist am bildstärksten in der konsequent übersteigerten Schlußszene, als ein gekreuzigter Salvador, der Erlöser Christoph – „Christusträger“ – seiner Verklärung entgegenschwebt. Der Heiligenschrein mit den lebenden Statuen der Märtyrer Sebastian und Jakobus wird von Adorantinnen mit blutigen Lilien gesegnet, auch ihre weißen Gewänder sind voller Blutflecken. Der Hintergrund sieht aus wie eines der riesigen Blutbilder von Hermann Nitsch und erinnert manchen Lübecker an dessen großartige Ausstellung in der St. Petri-Kirche. Der Wiener Aktionskünstler hatte 1991 den Themenkomplex Passion, Verwundung und Heilung ganz ohne Orgien-Mysterien-Theater ins Zentrum seiner Lübecker Präsentation gesetzt. Das Opfer stand und hing hier im Mittelpunkt und ebenso geschieht das bei „Christophe Colomb“. Über eine ästhetisch höchst anspruchsvolle Bildproduktion hinaus schreit das Rot von der Bühne. Die, deren Blut da rinnt, können nicht mehr schreien.
Ausgesprochen schade ist es, daß bei der dritten Vorstellung der Oper das Theater zu höchstens drei Vierteln gefüllt war. Die Lübecker dürfen ihrem Theater gerne etwas dankbarer sein, daß die Leitung des Hauses immer wieder Stücke aus dem Randrepertoire aufnimmt und Mut zu aufregenden Inszenierungen hat.
(c) Jochen Quast
Andreas Ströbl, 13.11.2019
Leonard Bernstein
MASS
Besuchte Premiere am 17.03.17
Lübeck ist immer eine Messe wert
Immer beliebter zwischen den Opernpremieren finden sich Aufführungen von Oratorien oder Zwischenwerken wie Berlioz "Romeo et Juliette" und ähnlichem. Ein ganz besonderes Werk dieser Art ist Leonard Bernsteins "Mass", das jetzt am Theater Lübeck zur Premiere kam. Die Uraufführung fand 1971 zur Eröffnung des John F. Kennedy Centers in Washington statt, im deutschsprachigen Raum gab es wohl das letzte Mal in den Siebziger oder Achtziger Jahren an der Wiener Staatsoper einen szenischen Versuch. Wir haben es also mit einer echten Rarität zu tun, die von Bernsteinfans als besonders persönliches Werk des Komponisten eingeschätzt wird. Der Aufwand ist gewaltig, denn zu dem groß besetzten Orchester kommen noch elektronische Gitarren und Bässe dazu, großer Choraufwand mit Kinderchören, bei den Solosängern werden zu den klassischen auch Rock-und Bluessänger gefordert.

Eine wirkliche "Handlung" existiert auch nicht, denn Bernstein hat zusammen mit Stephen Schwartz ein Libretto noch der römisch-katholischen Messliturgie erstellt, die immer wieder von Einwürfen unterbrochen wird, bis der Priester durch die geäußerten Zweifel zu einem Zusammenbruch kommt, trotzdem endet das Werk innerhalb seiner Kritik zu einem positiven Gotteslob, lediglich die starren Riten einer Konfession brechen auseinander, es könnte auch eine andere Glaubenskonfession sein. Ein Werk, das gerade in unserer heutigen Zeit, recht berührende Denkansätze bietet, ohne den Zeigefinger allzu penetrant zu heben. Bernsteins Musik bietet, außer den kirchlichen Anklängen, eigentlich nichts Neues, was sich nicht auch in seinen Musical-Meisterwerken findet, nämlich eine Polystilistik, für manchen vielleicht verstörender zu hören, weil vieles in diesen Zusammenhängen noch schroffer im Übergang wirkt , als in einer geschlossenen Handlung wie in "West Side Story zum Beispiel. Das Geniale an Bernsteins Musik ist, daß selbst die anschmiegsamen Stellen, denen man einen Kitschfaktor vorwerfen könnte, aufgrund ihrer starken Emotionalität nie banal wirken.

Stefan Rieckhoff stellt in seiner Ausstattung einen klerikalen Raum auf die Bühne des Lübecker Hauses, der mit den Kirchenfenstern und den "Skelettkostümen" Bezug auf den Lübecker Totentanz nimmt, ein bißchen der Stadt geschuldet, ohne wirklich einen wichtigen Bezug darzustellen, doch der Bühnenraum macht in seinen Veränderungen und Falk Hampels Licht einen großen Eindruck. Tom Ryser hatte in der letzten Spielzeit schon mit Purcells "Fairy Queen" einen großen Erfolg mit einem genreübergreifenden Stück in der Hansestadt landen können, bei "Mass" gelingt ihm zwar der große Bogen, aber über einzelne Ideen ließe sich durchaus streiten, es ist halt ein wirklich schwieriger Fall mit diesem Werk. Der Priester versucht also in diesem Raum eine Messe zu feiern, immer wieder tauchen dabei vier Tänzer auf, die sich schwer beschreiben lassen, vielleicht am ehesten als Gottesidee beschreiben lassen; Lillian Stillwell hat eine Choreographie entwickelt, die sich dem klassischen Ballett mit modernen zuschreiben lassen und guten Effekt machen. Gerard Quinn, der Lübecker Hausbariton, beginnt die Liturgie zunächst mit salbungsvollem, runden Ton als Menschenfreund, je mehr er durch die Unterbrechungen verunsichert wird, um so facettenreicher wird sein Gesang, bei jedem "Lasset uns Beten", mit dem er zur Abfolge des Ritus zurückkehrt verpuppt er sich mehr in einen Kokon von klerikaler Messgewänderpracht, aus dem er sich bei seinem Zusammenbruch schier heraussprengt. Mit starker emotionaler Beteiligung berührt er die Zuschauer ungemein, ein echter Ausnahmekünstler.

Ihm gegenüber stehen das Street-Chorus genannte Ensemble von Rock-und Blues-Sängern, die teilweise auch dem klassischen Schöngesangs-Ton verpflichtet sind, zunächst noch etwas einem etwas pauschalen Musical-Ton hingegeben, brechen vor allen die extraordnären Gänsehautstimmen vor allem der "farbigen" Sängerinnen, das "Gelernte" auf, um zu einem wahrhaftigen Gesang zu finden. Nach dem etwas flachen Beginn, gelingt es sämtlichen Solisten einen jeweils sehr persönlichen Ton zu finden. Auch hier die starke physische Beteiligung durch die vielfältigen Tanzszenen, diesmal von mehr musicalhaftem Gestus. Es ist vielleicht gemein, jetzt keine einzelne Namensnennung zu machen, doch jeder Zuschauer hat da seine eigenen Favoriten, gut waren sie alle auf ihre jeweils sehr persönliche Art, was auch den begeisternden Eindruck, der sich beim Applaus, aufzeigt.. Grandios auch die vielen Chöre unter ihren jeweiligen Leitern, nicht immer ganz auf Punkt, aber voller vokaler Emphase: Der Chor und Extrachor des Theaters Lübeck, die Kinder-und Jugendchöre "Vocalino" des Theaters Lübeck und der Musik-und Kunstschule Lübeck, der Phemios Kammerchor Lübeck und die Mitglieder des Nordelbischen Knabenchors, die Bühne war vokal wie räumlich richtig gut gefüllt. Als besondere Erwähnung der Solo-Knabensopran von Ian Jans, der nicht nur schön sang, sondern auch deutlich als Kinderstimme erkennbar war.

Andreas Wolf wurde der Polystilistik Bernsteins mehr als gerecht, sicherlich keine einfache Aufgabe, dazu war stets eine gute Klangbalance gewahrt, zwischen Sängern, , dem fabelhaften Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck und den elektronischen Instrumenten. Insgesamt ein sehr mutiger, teilweise verblüffender Abend, der auch sehr zur Nachdenklichkeit anregt. Für jeden Musikfreund wieder einmal ein guter Grund an die Trave zu fahren. Das Premierenpublikum im ausverkauften Lübecker Haus konnte sich vor lauter Jubel gar nicht einkriegen und das sehr , sehr lange nicht.
Martin Freitag 20.3.2017
Fotos von Olaf Malzahn
HÄNSEL UND GRETEL
Aufführung am 17.12.16
(Premiere am 12.11.10)
Echte Märchenstimmung
In dem eindrucksvollen Jugendstilsaal des Lübecker Hauses gab es eine zauberhafte Produktion aus 2010 von Engelbert Humperdincks berühmter Märchenoper zu sehen. Im ersten Bild die ärmliche Stube des Elternhauses der Kinder, dann ein Wald, in dem man froh nach Beeren suchen, aber auch Angst haben konnte, ein einladendes Knusperhäuschen und – wichtig! – keine Angst vor Kitsch beim Abendsegen, wenn sich die mit großen Flügeln ausgestatteten Engel langsam rund um die schlafenden Kinder gruppierten (Ausstattung: Thomas Döll).
Herbert Adler (als Schauspieler in so fordernden Rollen wie Mephisto oder Othello tätig, als Regisseur vom Publikum u.a. für seine Inszenierungen beim Wagner-Festival Wels geschätzt) nahm die Geschichte ernst und hatte offensichtlich sehr gut mit den Sängern gearbeitet, denn die Vertreterinnen der Titelrolle waren von größter Natürlichkeit und machten nicht diesen unglücklichen Eindruck, den Erwachsene oft vermitteln, wenn sie Kinder spielen. Die Spielfreude war aber auch bei den anderen groß, und selten hat man ein so überzeugendes Zusammenwirken des Besenbinders und seines Weibes gesehen, vom Zorn über bis zur Sorge um die Kinder. Die Charakterisierung der Knusperhexe fiel im richtigen Ausmaß „erschröcklich“ aus (und auch Abendspielleiterin Jennifer Toelstede sei als Double für den Hexenritt vor den Vorhang gerufen).

Musikalisch bewegte sich der Abend auf hohem Niveau, denn das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck erwies sich als ausgezeichneter Klangkörper, der unter seinem mit Ende der laufenden Spielzeit scheidenden japanischen GMD Ryusuke Numajiri schon ab der Ouverture in den rein instrumentalen Momenten aufhorchen ließ, weil er die Wagner nacheifernde Dichte des Klangs mit gleichzeitiger Transparenz zu verbinden wusste. Als interessanteste Stimme des Abends erwies sich der dunkle, weiche Mezzo der Polin Wioletta Hebrowska, die als Hänsel auch in ihrer burschikosen Körpersprache bewundernswert war. Aber auch die Gretel Andrea Stadel bezauberte mit ihrem klangvollen Sopran und temperamentvollen Spiel. Als Mutter Gertrud beeindruckte die Amerikanerin Rebecca Teem mit dramatischen Tönen (kein Wunder, singt sie doch in Lübeck Brünnhilde und Isolde und wird demnächst in Essen als Elektra debütieren). Solide Vater Peter in der Gestalt von Steffen Kubach. Ihnen allen, sowie der Knusperhexe des Charaktertenors Michael Gniffke, ist hohe Wortdeutlichkeit zu bescheinigen, angesichts der vielen Kinder im Haus besonders wichtig. Noch etwas zaghaft klangen das Sandmännchen der Kolumbianerin Fiorella Hincapié und das Taumännchen der Südafrikanerin Caroline Nkwe, die an der renommierten Musikhochschule Lübeck ihre Ausbildung genossen haben. Der Kinder- und Jugendchor Vocalino unter Gudrun Schröder sang ausdrucksvoll und präzise; dazu gesellte sich der Extrachor des Theaters Lübeck.
Am 18.12. konnte man sich neuerlich von der Qualität des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt Lübeck überzeugen, das unter dem Titel Winterträume das vierte Konzert seiner symphonischen Saison gab. Da die Konzerthalle mit ihren fast 2000 Plätzen im Kongresszentrum gerade saniert wird (sie wurde im September geschlossen, weil die Akustikdecke herabzustürzen drohte), müssen die Konzerte derzeit in der zu dem Komplex gehörenden Rotunde stattfinden, die immerhin auch gut 1500 Plätze besitzt und nach einigen Verbesserungen eine recht akzeptable Akustik aufweist.
Das Programm umfasste die symphonische Dichtung FESTKLÄNGE von Franz Liszt, das VIOLINKONZERT a-Moll op. 82 von Alexander Glasunow und nach der Pause Tschaikowskys Symphonie Nr. 1 g-Moll op. 13. Am Pult stand mit Matteo Beltrami ein Dirigent, der in der Lübecker Oper schon mit Verdis „Macbeth“ erfolgreich gewesen war. Er erwies sich auch als versierter Konzertdirigent, der Liszts etwas pompöser Komposition mit einer kleinen Prise Ironie beikam und dem Solisten Carlos Johnson, dem peruanischen Konzertmeister des Orchesters, ein äußerst aufmerksamer Begleiter war. Johnson zeigte sich als ausgezeichneter Techniker, der die Schwierigkeiten des mit Leopold Auer als Solist uraufgeführten Werks bestens im Griff hatte. Als Zugabe spielte er ein inniges Adagio für Streicher einer Komponistin, deren Namen ich leider nicht verstanden habe.
Aus der ihren Weg noch suchenden Arbeit Tschaikowskys, in der dennoch schon viele für den Komponisten charakteristische Stellen aufblitzen, machte Beltrami ein kleines Wunderwerk an melancholischer Stringenz. Es war auch schön, die gespannte Aufmerksamkeit des Publikums zu genießen, die durch keinen einzigen Huster gestört wurde.
Viel Jubel und zahlreiche Hervorrufe dankten dem Orchester und seinem Dirigenten.
Eva Pleus 30.12.16
Bild (c) Staatstheater Lübeck
ATTILA
Besuchte Aufführung am 22.12.16
(Premiere am 21.05.16)
Denn sie wissen nicht, was sie tun
Viele Häuser arbeiten heutzutage mittels Koproduktionen zusammen, um Kosten zu sparen, warum auch nicht, denn Besucher A geht schließlich selten genug in B in die Vorstellung, die Abonnent C in D sieht. Doch es ist schon etwas Besonderes, wenn sich ein Stadttheater wie in Lübeck einfach mal das Theater an der Wien als Partner sucht, und natürlich auch umgekehrt. So kann man in Lübeck Verdis seltene gespielten "Attila" in der Regie von Peter Konwitschny erleben, der als Regisseur auch viel Hamburger Opernfreunde an die Trave locken könnte. Die Regie erinnert im Ansatz zunächst auch an seinen legendären Hamburger "Lohengrin", der ja in einer Schulklasse spielte.

Bei Verdi haben wir zunächst einen Haufen Kinder vor uns , die ihre "Räuber-und Gendarmen"-Spiele zu den schwungvollen Kantilenen spielen. Kinder ,die ihre sozialen Verhältnisse über ihr Spiel lernen; "Kindlich verspielt" nennt die Inhaltsangabe diese Zeit. Wenn der römische Bischof Leone mit seiner prophetischen Warnung auftaucht, so erhalten die Kinder Erwachsenenkleidung und treten in ein anderes Alter, was "Ausgewachsen infantil" bezeichnet wird. Aus Spiel wird Ernst aus spassigem Getümmel wird tragischer Ernst, vor allem wenn die Protagonisten im dritten Teil, "Immer noch nichts gelernt", ihr Verhalten nicht ändern lernten und das anfängliche Spiel bis ins tödliche Finale geführt wird. Alte Menschen, die sich an Krücke , Rollator und Rollstuhl bis ums Verrecken nicht beherrschen lernten. Chor und Sänger agieren die verschiedenen Altersstufen absolut gekonnt aus.Die Ausstattung von Johannes Leiacker gibt ein schlichtes, wie passendes Theaterrund als Spielort vor, der durch das Licht von Manfred Voss abwechslungsreiche Imaginationen erhält. Leiackers Kostüme grundieren mit zunächst kindlichen Kinderverkleidungen, die Jungen von Nimmerland (Peter Pan) sind da nicht weit bis in den erwachsenen Realismus. Mit einem Wort aufklärendes Theaterspiel in bester Manier, eine sehr gelungene Produktion, die der sprunghaften Dramaturgie des Verdischen Frühwerks sehr gerecht wird.
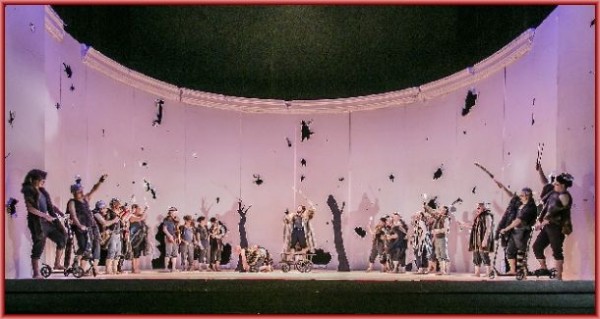
Doch auch musikalisch zeigt Lübeck seine oft beschriebenen Meriten: da die Aufführung nun schon einige Monate im Repertoire ist, klingt das Orchesterspiel des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt, vielleicht nicht mit allen möglichen Finessen, die man auch einem frühen Verdi angedeihen lassen könnte, dazu kommt die etwas knallige Akustik, die manches Detail vergröbert, doch die Aufführung unter der Leitung von Andreas Wolf hat enormen Schwung und geizt nicht an Italianita. Die Sänger haben alle das Gespür für die gesungene Kantilene und ein wunderbar ausgeformtes Legato, so "italienische " Oper hört man nicht alle Tage. Mit Taras Konoshchenko hatte man einen echten Prachtbass in der Titelpartie, Timbre, emotionale Ausformung, Gestaltung alles perfekt, dazu mit dem Hausbariton Gerard Quinn ein adäquater Ezio an seiner Seite, der die Duettszene beider zu einem Höhepunkt werden ließ.

Daria Masiero als Gast gab die Odabella, ein richtiger "lirico-spinto"-Sopran dramatischen Kalibers mit leichtem, doch angenehmen Vibrato toller Durchschlagskraft in der Höhe und der rechten Agilita für die schwierigen Koloraturen. Als Foresto Alexander James Edwards, der zunächst ein wenig durch sein Höhentimbre irritierte, doch gesanglich ein Musterbeispiel für italienischen Operngesang ablieferte. Auf Augenhöhe die kleinen , aber wichtigen Partien des Uldino und Leone von Hyungseok Lee und Seokhoon Moon vom Haus. Dem Chor, Extrachor und Jugendchor machten ihre Aufgaben sicht- und hörbar Spass, wobei die Damen die Nase etwas vorne hatten. Wirklich "Grande Opera Italiana" an der Trave, also einen Besuch der noch wenigen Vorstellungen sei mehr als empfohlen. Dieser Abend war viel zu schnell zu Ende.
Martin Freitag 30.12.2016
Fotos (c) Theater Lübeck / Jochen Quast
ARIADNE AUF NAXOS
Besuchte Aufführung am 18.09.16
Premiere am 10.09.16
Ansicht der Regisseurin
Das Lübecker Theater eröffnet seine Spielzeit mit Strauss`"Ariadne auf Naxos" in der Regie von Aurelia Eggers mit einer sehr eigenwilligen Lösung der Künstlerin: Im Vorspiel ist davon noch nichts zu merken, da werden die artifiziellen Anspielungen von Musik und Libretto auf zeitgenössische Weise bebildert. Ein Kubus aus verschiedenen Materialen (Bühne Andreas Wilkens) betont die Ebenen der Oper : Bühnenholz und weiße Wand, Theatervorhänge und glitzernder Flitter, Veronika Lindners Kostüme bieten dazu postmoderne Stilvielfalt, moderner Anzug neben hippem Second-Hand-Mix, die Opera Seria in übersteigerter Graecomanie. Das Zentrum liegt in der Auseinandersetzung zwischen Kunst und Mäzentum, den Mittelpunkt bildet Wioletta Hebrowska als Komponist, so aus dem Vollen gesungen hört man das selten, bis an die Grenzen der Extase lotet die Mezzosopranistin die Hymne an die Musik aus, allein das lohnt den Abend.

Mit Steffen Kubach hat man die Sprechrolle des Haushofmeisters besetzt, der Sänger macht das so vortrefflich in Diktion und Impertinenz, das er den Gegenpol bildet. Als vermittelnder Musiklehrer gibt Gerard Quinn auf ganz hohem Niveau, diese oft mit Utilitès besetzte Partie. Emma McNairy gibt ihre Visitenkarte als neues Ensemblemitglied gleich mit der schwierigen Partie der Zerbinetta ab, ein eher leichter Koloratursopran von soubrettenhaftem Zuschnitt, das Vorspiel gelingt mit artistischem Gesang und ebensolcher Gestik ganz vortrefflich, in der großen Arie der Oper kommt sie dann doch an ihre Höhengrenzen. Die Kleinpartien sind vortrefflich besetzt, besonders der substanzreiche Tenor von Daniel Jenz gefällt, aber auch Grzegorz Sobczak als Perückenmacher sticht mit kernigem Bariton hervor.
Schon am Ende des Vorspiel streift Gabriela Scherer als Ariadne den Griechenplunder ab und steht dann im geöffneten Kubus als moderne Frau, die wohl auf einer Insel die gescheiterte Beziehung zu Theseus verarbeitet auf einer Terasse, der Hintergrundprospekt könnte auch einen leicht kitschigen Ägäisprospekt einer Reiseagentur zieren. Die Sopranistin überzeugt mit satter Stimme und leichtem Höhentremolo, die Diktion ist manchmal etwas verwaschen.

Begleitet wird sie von ihren Reisegefährtinnen, Andrea Stadel, Annette Hörle und Evmorfia Metaxaki bilden ein sehr homogenes Nymphentrio voller Wohlklang. Nach allem Leiden tritt dann der Gott Bacchus wie aus einem Magritte-Bild in himbeerrotem Bademantel und Melone hinzu und versucht die Apotheose mit billigem Bühnenflitter herbeizuzwingen; Erik Fenton stemmt die durchaus prachtvollen Höhen leider im Dauerforte, lediglich in der Mittellage findet er zu differentiertem Gesang. Doch diese Apotheose wird von Ariadne nicht mehr mitvollzogen, denn sie hat sich zu Zerbinettas Ansprache schon aus dem Leben geschlichen. Da sie immer noch viel zu singen hat, wirkt diese Lösung etwas disparat. Der Umgang mit den Theatermitteln wird leider im Laufe des Abends immer beliebiger, so wollen die Buffoszenen so gar nicht zünden, der Bariton Johan Hyunbong Choi macht seine Sache als Harlekin zwar solide, das übrige Buffonistenterzett mit Manuel Günther, Taras Konoshchenko und Rafael Pauß schließen sich dabei an, doch gibt es vor allem in den Ensembles der Oper immer wieder Unstimmigkeiten.

Leichte Probleme hat Ryusuke Numajiri mit Straussens artifizieller Partitur, denn er leitet das Werk mit einem recht pastosem Strich, musikalisch bringt das eben die Ensembles aus dem Gleichgewicht, nicht wirklich schlimm, doch die bezaubernde Leichtigkeit, die gerade diese Szenen benötigen, bleiben auf der Strecke. Auch die trockene Diktion des Vorspiels wird nicht vollständig erreicht. Zum Schluss erliegt der GMD dann doch der virtuosen Berauschung des Finales, das Orchester müßte hier ein wenig in Zaum gehalten werden, die Extase ein wenig gezügelt, gerade das habe ich von der letzten "Ariadne" am Haus eben noch immer im Ohr. Das Orchester kann das, daran liegt es nicht.
Insgesamt jedoch ein guter Abend, wenngleich mich weder die Inszenierung, noch die musikalische Leitung wirklich überzeugt.
Martin Freitag 22.9.16
Fotos (c) Theater Kübeck / Jochen Quast
WEST SIDE STORY
24. April 2016

Das Theater Lübeck, ein Mehrspartenhaus im besten Sinne des Wortes, zeigt nicht nur erstklassige Opernproduktionen, zumal von Werken Richard Wagners und Richard Strauss‘, sondern konnte an diesem Abend mit der Produktion der „West Side Story“ von Leonhard Bernstein nach einer Idee von Jerome Robbins und dem Buch von Arthur Laurents sowie den Gesangstexten von Stephen Sondheim unter Beweis stellen, dass ihm auch die Kunstgattung Musical gut liegt. Man erlebte eine unglaublich farbige, vielseitige und dynamische Inszenierung von Wolf Widder in den Bühnenbildern und Kostümen von Katja Lebelt und einer Choreografie von Kati Heidebrecht. Sie konnte mit den Jazz-Tänzen und Straßenschlachten mit großer Phantasie und Gefühl für das Innenleben der Mitglieder beider Gangs, der „Jets“ aus New York und der „Sharks“ aus Puerto Rico, ein hohes Maß an Emotion und Authentizität in das Geschehen auf der Bühne einbringen.

Jerome Robbins und Arthur Laurents, die das Stück gemeinsam entwickelten und Leonard Bernstein für die Komposition gewinnen konnten, wollten keine Eins-zu-Eins-Umsetzung des Shakespeareschen Stoffes von „Romeo und Julia“ in Szene setzen. Es sollte ein „Romeo und Julia“ moderner Fassung werden, welcher die täglichen Probleme der oft arbeitslosen Jugendbanden zunächst in der New Yorker East Side thematisieren und den Irrsinn der Feindschaft zwischen zweien von ihnen zeigen sollte, deren Gründe weder den „Jets“ noch den „Sharks“ wirklich klar sind. Es geht hier in gewissem Sinne um eine Feindschaft um der Feindschaft Willen, wobei am Ende der Überlegungen von Robbins und Laurents das rassische Element zwischen den New Yorker „Jets“ und den Puerto Ricaner „Sharks“ zum wesentlichen Erklärungsgrund ihres dramaturgischen Konzepts wurde, der aber eher im Unterbewusstsein beider Gangs verhaftet ist.

Man verlegte die Handlung an die West Side von Manhattan. Dort befehdeten sich gerade Banden junger Puerto Ricaner und junger US-Amerikaner. Ursprünglich ging es Robbins und Laurents um die Thematisierung eines gewissen Konfessionsstreits, also um das jüdisch und katholisch sein, wobei Maria, die noch sehr junge Schwester des Anführers der „Sharks“, Bernardo, jüdisch sein sollte und Tony, der Architekt und frühere Anführer der „Jets“ katholisch. Diese Idee wurde in einem Gespräch mit Leonard Bernstein Monate später in Hollywood „endgültig im Schwimmbecken unseres Hotels versenkt“, wie Arthur Laurents sich im Programmheft erinnert. So sollte die Grundidee Shakespeares zwar beibehalten, aber daraus eine Geschichte entwickelt werden, die für das Wesen der Menschen unserer Tage bezeichnend ist. Das ist ihnen mit diesem klassischen Musical aus der Musical-Blüte der 1950er Jahre voll gelungen. Dabei waren sie im Wesentlichen darauf aus, die künstlerische Illusion der Wirklichkeit zu schaffen. Dieser nicht gerade leichte Spagat gelang dem Theater Lübeck mit der sehenswerten Produktion auf das Beste.

In dem deprimierenden Hinterhofambiente der New Yorker West Side, das wie eine Abschottung von der übrigen Realität dieser Mega-City wirkt, erleben wir die Auseinandersetzungen der beiden Gangs hautnah, wobei das Regieteam mit seiner Dramaturgin Doris Fischer in der Lage ist, ein Höchstmaß an jugendlicher Emotion zu vermitteln. Geschickt werden die großen grauen Betonwände, die natürlich von Graffiti aller – auch und gerade politischer Art – übersät sind, immer wieder gegeneinander versetzt. Sie geben so immer neue Spielebenen und Sichtachsen frei, die ein ständig variierendes Bühnenbild ohne Vorhangfall ermöglichen. Somit bleibt die Spannung ständig aufrecht, und es wird der räumliche Boden für die dann jeweils folgende Gruppen- oder Individualszene bereitet. Dabei nimmt die Lichtregie von Benedikt Kreutzmann stets eine tragende Rolle ein. Natürlich darf die typische New Yorker Hinterhof-Feuerleiter nicht fehlen, die in Assoziation mit dem berühmten Shakespeareschen Balkon von „Romeo und Julia“ die Kussszene und das für einen Moment glückliche Zusammensein von Maria und Tony wirkungsvoll ermöglicht.

Evmorfia Metaxaki singt die Maria mit einem charaktervollen leuchtenden Sopran und großer Empathie - sie kann diese vielseitige Rolle im wahrsten Sinne des Wortes authentisch verkörpern. Ihr Partner Tony, Freund des Bandenführers Riff der „Jets“, wird an diesem Abend von Edward Lee als Gast gespielt. Auch er kann mit dem klangschönen Material seines bestens geführten und wortdeutlichen Tenors und ebenfalls einem hohen Maß an Emotion und Authentizität überzeugen. Herrlich gelingen den beiden die großen Solonummern und Ohrwürmer, die einen sofort in die Ästhetik der 50er Jahre zurückversetzen. In diesen Momenten ging ein großer Zauber von der Bühne aus. Femke Soetenga singt die Rolle von Bernardos Freundin mit einem voll klingenden und wortdeutlichen Mezzo. Sie spielt die Gefühlsausbrüche und emotionalen Klippen dieser Partie mit großem Engagement und ebenfalls viel Emotion. Thomas Christ als Riff und Kai Bronisch als Bernardo können ebenso in ihren Rollen, zumal mit großem körperlichem Einsatz, überzeugen wie Michael Ewig als Chino, Bernardos Freund, und die vielen anderen, die fast zwei Seiten des Abendspielzettels füllen…
Ludwig Pflanz konnte mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck die vom Geschehen auf der Bühne ausgehende Dynamik und Emotion mit einem feurigen Herangehen an die großartige Partitur von Leonard Bernstein auf musikalisch beste Art und Weise untermauern. Man merkte, dass diesem Orchester viel an der oftmals subtilen und dann wieder schwärmerischen und rhythmischen Tonmalerei des großen US-amerikanischen Meisters gelegen war. Ein beeindruckender Musical-Abend am Theater Lübeck, mit einem begeisterten Publikum!
Fotos: Olaf Mahlzahn
Klaus Billand 6.5.2016
ATTILA
Premiere: 21. 5. 2016

Als Peter Konwitschnys Inszenierung des Verdi-„Attila“ im Juli 2013 am Theater an der Wien ihre Premiere erlebte, schlugen die Wellen hoch, denn Fans und Gegner des Regisseurs beschimpften sich während der Aufführung lautstark. Bei der Übernahme dieser Produktion an das Lübecker Stadttheater gab es aber auf allen Seiten nur glückliche Gesichter: Alle Rollen sind optimal besetzt, die Produktion ist frisch einstudiert worden. Das Publikum hatte seinen Spaß und feierte alle Akteure und auch Konwitschny mit einem zehnminütigen Jubelsturm.
Weil „Attila“ ein einziges Intrigen-Gewusel ist, in dem alle Figuren dem Hunnenkönig ans Leben wollen, hat sich Konwitschny gemeinsam mit Dramaturgin Bettina Bartz ein ungewöhnliches Konzept erdacht: Gezeigt wird eine Gruppe von Personen, die sich ihr ganzes Leben lang bekämpfen und bekriegen: Im Prolog und erstem Akt erlebt man eine große Schulhof-Keilerei, bis das erzieherische Erscheinen des Papstes die Akteure reifen lässt. Im zweiten Akt befinden wir uns in einem Mafia-Krieg, bevor das Schreckens-Finale die Figuren altern lässt. Der Schlussakt mündet in einer mörderischen Altenheim-Intrige.

Alle Solisten, Chor und Statisterie setzen dieses Konzept mit so viel Spaß und darstellerischer Überzeugungskraft um, so dass das Publikum von der Aufführung geradezu mitgerissen wird: Der von Jan-Michael Krüger einstudierte Chor tobt ausgelassen und verspielt über die Bühne. Jedoch scheint die runde und durchlöcherte Rückwand, die Johannes Leiacker für die Produktion entworfen hat, einiges an Schall zu schlucken, denn der Chor klingt weniger voluminös, als man es aufgrund der großen Anzahl der Sängerinnen und Sänger vermuten würde.
Auch bei den Solisten stellen sich in den Generalpausen seltsame Echoeffekte ein, die sich wahrscheinlich dadurch erklären lassen, dass das Wiener Bühnenbild nicht optimal den Lübecker Raumbedingen angepasst wurde.

Für kleinen Wermutstropfen bei der Bewertung der Solisten sorgt, dass lediglich Bariton Gerard Quinn das einzige Ensemblemitglied ist und die anderen Partien an Gastsolisten vergeben sind. Quinn verkörpert den römischen General Ezio mit schneidigem Bariton. Ernesto Morillo singt und spielt den Attila mit raumgreifender und leicht angerauter Stimme als knorrigen Typen.
Helen Dix ist eine glänzende Odabella: Trotz wuchtiger körperlicher Erscheinung spielt sie ihre Figur mit koketter Leichtigkeit und begeistert dazu mit ihrer hellen und kraftvollen Stimme. Ihren Liebhaber Foresto singt Alexander James Edwards mit einem mühelos strahlenden Tenor. – Ein großes Kompliment an das Lübecker Besetzungsbüro.

Für frischen Wind sorgt zudem das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck unter dem Dirigat von Ryusuke Numajiri. In den Finali hat die Musik natürlich immer etwas konventionell lärmendes, doch Numajiri zeigt auch wie feinsinnig und experimentierfreudig Verdi in dieser Oper komponiert und instrumentiert hat.
Der Konwitschny-„Attila“ wird übrigens noch weiterziehen: In der nächsten Saison wird die Produktion auch an die Oper Nürnberg übernommen.
Rudolf Hermes 25.5.16
Bilder (c) Theater Lübeck
FIDELIO
Premiere 06.09.2015
Subversiv-amüsante Inszenierung, hörenswerte musikalische Interpretation – und provokanter Denkanstoß über das Kunstformat „Oper“

Im Zentrum steht die Lichtgestalt, auf einer Kugel – wahrscheinlich der Welt – wandelnd. Dem Wahren, Guten und Schönen verpflichtet, wie es auf dem Fries über dem Theaterportal eingemeißelt steht. Der Befreier, Retter, Drachentöter. Typ Siegfried, der in dieser Oper Florestan heißt. Oder, perfekt passend zum heutigen Vormarsch selbstbewusster Weiblichkeit, Leonore. Grundsätzlich könnte es natürlich auch Lohengrin sein, der Heilsbringer. Aber weit und breit kein Schwan. Nur zwei riesige Lindwürmer, rechts und links zu Füßen des auraumstrahlten Helden. Der herabgelassene Schmuckvorhang des Theater Lübeck ist ein Prachtstück aus der Epoche des Jugendstils, bei dessen Betrachtung man mühelos ins Meditieren kommt.
Zum Beispiel darüber, welch enorme identitäts- und einheitsstiftende Bedeutung nicht nur diese Mythen, sondern auch die Musik im 18. und 19. Jahrhundert für die in zahlreiche Kleinfürstentümer zersplitterten deutschsprachigen Lande hatten. Und dass Retter und Befreier immer dann gebraucht werden, wenn eine Bedrohung vorliegt. Zuweilen ist die vermeintliche Gefahr allerdings lediglich Drohkulisse, fast wie im Theater. Man hält die Drachen, die feuerspeiend vor der Welt oder, schlimmer noch, vor der eigenen Haustür liegen, für real. Was eigentlich, sinnt der Betrachter irgendwann, sind heutzutage die Drachen, von denen man sich bedroht fühlen könnte?
Zu einer Antwort auf diese Frage kommt er nicht, weil der Vorhang dann doch, gegen Ende der Ouvertüre, hochgezogen wird. Was irgendwie auch schade ist. Denn in Lübeck könnten sie, im Prinzip, den „Fidelio“ komplett konzertant geben, nur mit Blick auf ihren Schmuckvorhang, den sie eh nicht bei jeder Produktion zeigen. Am Schluss hätte auch der fantasieunbegabteste Besucher begriffen, welche Bedeutung in dieser Oper für uns Heutige steckt.

Andererseits leistet das freigelegte Bühnenbild (von Ulrich Frommhold), wenn auch erschreckend öder Kontrast zur in die Höhe entschwebten Jugendstilherrlichkeit, durchaus wertvolle Hilfe, zum Wesentlichen vorzudringen. Denn die Bewacher – dazu sind salopp außer dem Pförtner Jaquino und Kerkermeister Rocco auch dessen Tochter Marzelline und die under cover hinzugesellte Leonore zu zählen – agieren sämtlich im Halbrund eines wandhohen Stahlzauns in einer Art Camp-Setting. Sie sind am Verdursten, halluzinieren womöglich, was keine schlechte Erklärung für ihr zuweilen merkwürdiges Verhalten liefert. Das dringend ersehnte Wasser wird ihnen endlich, in Plastikflaschen, von außen zugeteilt.
Dieses Schicksal der Abhängigkeit und des Ausgeliefertseins teilen sie übrigens mit den im dunklen Hintergrund, auf der anderen Seite des Zauns dahinvegetierenden Häftlingen. Es ist nicht klar, ob das Ganze in der Wüste spielt, aber die gesamte Bühnengesellschaft hängt offensichtlich saft- und kraftlos am Tropf, der absurderweise und quasi alternativlos ständig mit Sand befüllt wird. Ein Vergleich zum Subventions-Tropf, der die Einrichtung Oper am Leben hält, drängt sich flüchtig auf. Darauf jedoch scheint die Regisseurin nicht abzuzielen, jedenfalls nicht primär. Sondern vielmehr auf die durchaus interessante und geradezu philosophische Frage: Wer sind hier eigentlich die Gefangenen? Diejenigen, die hinter dem Zaun stehen, die, die sich in der vorderen Bühnenhälfte befinden – oder gar jene, die im Auditorium sitzen?
Die Alltagsgesellschaft hat mit den strikt abgezirkelten Zuständen auf der Bühne ja mehr gemein, als einem als Opernbesucher lieb sein kann. Dass alle zum Beispiel ständig, in Kleinkindmanier, an der Plastikwasserflasche nuckelnd durch die Gegend laufen. Dass leere Plastikflaschen, wie in wirtschaftlich schlechten Zeiten einst Zigaretten, zu einer Art Goldersatz mutieren. Oder dass es, außerhalb der Oper, noch andere Arten der Musik gibt, die keinesfalls als „klassisch“, bestenfalls als „Unterhaltung“ – und für empfindsame Ohren als veritable akustische Folter einstufbar sind.

Es liegt also durchaus nahe, die Qualen, die Florestan im Kerker angetan werden, in Form von verzerrten E-Gitarrenriffs zu verabreichen. Der passionierte Operngänger leidet da automatisch mit, der eine oder andere kann – süffisant – darüber lächeln. Und genau hierin liegt der vordergründig erkennbare einzige Makel dieser klugen Inszenierung: Sie übt Verrat an der Rockmusik. Die unerreichte Vehemenz und Leidenschaft des E-Gitarrenspiels, wie beispielsweise Jimi Hendrix es beherrschte, wie er den „Star-Spangled Banner“ regelrecht zerlegte oder schon den Eingangspart von „Vodoo Chile“ zur atombombenstarken Explosion brachte, verursachen dem Hörer zuweilen tatsächlich Schmerzen – aber diese Wirkung ist eine künstlerisch kalkulierte. Die wirklich guten dieser „Rock-Rebellen“ hätten einem unkonventionellen Revoluzzergeist wie Beethoven sehr gefallen – und zwar nicht erst im Stadium der Taubheit. Auch Partien des „Fidelio“, oder seine Neunte, sind stellenweise – beabsichtigter – musikalischer Sprengstoff. Leider klingt das, was in diesem „Fidelio“ an „Rockmusik“ ertönt, wie eine Parodie. Wie auch Jaquino, dem die Rolle des musikalischen Folterknechts zugewiesen ist, das Zerrbild eines Rockstars sein muss.
Rockmusik ist allerdings nicht das einzige, was Regisseurin Waltraud Lehner nicht ernst nimmt. Strenggenommen nimmt sie in ihrem „Fidelio“ so gut wie gar nichts ernst, aber sie macht das so subtil, dass es einige Zeit dauert, um es mitzubekommen. Im ersten Akt gibt es sogar eine Szene, die einen zu Tränen bewegt, wenn man sich wirklich darauf einlässt – und dies ist, wider alle Erwartung, nicht etwa der Gefangenenchor. Während Leonore unter nachtschwarzem Himmel die Hoffnung beschwört, haucht die einzig verbliebene Lichtquelle, eine aus dem Kerkerzelt herausscheinende mickrige Tranfunzel, ihr Leben aus. Ungeachtet ihrer flehentlichen Bitte verbleicht der letzte, nichtmal am Firmament, sondern auf dem Erdboden kauernde Stern dieser Müden. Es gibt nichts mehr auf der Szene, was im mindesten Zuversicht spenden könnte. Und dennoch hört sie nicht auf, sie in Worten zu beschwören. Für das stoische Ertragen dieser totalen Vergeblichkeit muss man sie, in dieser Inszenierung, vollauf bewundern, mit ihr leiden.
Nicht nur die Lichtverhältnisse auf der Bühne sind in diesem bewegenden Moment übrigens katastrophal. Um die Qualität der Luft ist es keinen Deut besser bestellt. Sie wird, durch eine unsichtbare Quelle, mehr und mehr geschwängert von schwefelschwerem Geruch, wie er bei intensiver Raketen- und Knallerzünderei entsteht. Wenn der dann auftretende Chor die wunderbare Luft besingt, die er endlich atmet, kann man im ganzen Auditorium nur den Kopf schütteln. Aber der Text, ebenso wie die Musik, legt es nahe, die ideelle Ästhetik zu genießen. Das tut man auch, lässt sich zumindest nicht anmerken, was wirklich los ist.

Das gilt auch für den Schluss, der die Gefasstheit des Zuschauers in anderer Weise fordert. Der Kerker wird zum Fest-, gar Himmelszelt, und aus der freigelegten Tiefe der Bühne tritt abermals der Chor an die Rampe. Nun gekleidet in schwarzer Robe oder schwarzem Anzug könnten dessen Damen und Herren für eine größere Zahl der im Auditorium Anwesenden (für den Prototyp des Opernbesuchers allemal) glatt als Doppelgänger durchgehen. Sie stehen da, als wären sie aus Holz und verziehen keine Miene, während sie von beglückender Freude, Freiheit und Liebe singen. Auch im Publikum sitzt alles stocksteif, obwohl musikalisch an dieser Stelle exaltierte Jubelstimmung herrscht. Wenn man öfter in die Oper geht, kennt man das Phänomen aus „Traviata“: Selbst beim Brindisi singt oder schunkelt keiner mit. Das gilt als unfein.
Aber im Finale des „Fidelio“ geht es um viel mehr als bloß gutes Benehmen. Da feiern die Menschen die humanistischen Werte ihrer Gesellschaft, die Brüderlichkeit, ihre in Erfüllung gegangene Hoffnung. Dabei müsste man mitjubeln, aufspringen und die Welt umarmen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal, und nicht erst hinterher, sondern im Moment des empfundenen Glücks. In wirklich guten Rockkonzerten passiert das. Aber nie in der Oper. Womit wir bei der tragischen Begrenztheit dieses ansonsten großartigen Kunstformats angelangt sind. In diesem „Fidelio“ wird sie gnadenlos decouvriert.
Die bunten Gestalten jedoch, die zu den letzten Takten das Zaungitter hochklettern, haben das in Musik und Text ausgedrückte Ideal von fern vernommen. Sie glauben, es auf der anderen Seite des Zauns tatsächlich zu finden. Wie sehr sie sich geirrt haben, werden sie spätestens dann merken, wenn sie einmal eine Opernaufführung besuchen.
Wer das nicht sehen will, muss den Lübecker „Fidelio“ dennoch unbedingt hören. Beethoven war keinesfalls grober Klotz, sondern ein äußerst vielschichtiger und entsprechend diffiziler Charakter. Dem „Beethoven-typischen“ symphonischen Geist seiner einzigen Oper werden Dirigent Ryusuke Numajiri und das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck ganz und gar gerecht. Die Herausforderung, die die Gesangspartien enthalten, da der Komponist wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der menschlichen Stimme nahm, meistern die Solisten allesamt bewundernswert gut (in den Hauptrollen Yannick-Muriel Noah als Leonore, Taras Konoshchenko als Rocco, Andrea Stadel als Marzelline, Daniel Jenz als Jaquino, Jean-Noel Briend als Florestan, JoachimGoltz als Don Pizarro). Wunderbar ausdrucksstark auch der Chor und Extrachor des Theater Lübeck.
Christa Habicht, 7. September 2015
Sämtliche Fotos: Jochen Quast
A DAMNATION DE FAUST
Besuchte Aufführung am 29.04.15 (Premiere am 16.01.15)
Der unfaustische Faust
Hector Berlioz`Semi-Oper "La damnation de Faust" ist eigentlich ein recht undramatisches Werk, sehr frei nach Goethes Drama machte der Dichter-Komponist Gebrauch von den Szenen und scheute sich nicht aus einfachen, musikalischen Gründen eine Ungarnreise innerhalb des Stückes zu begehen. Vielleicht kommt diese Mischform unserer heutigen Ästhetik mit offenen Formen, so zum Beispiel Musik-Videoclips, entgegen, denn immer öfter findet die Oper den Weg auf die Bühnen, so in Lübeck.

Anthony Pilavachi hat dort schon viele tolle Produktionen, so auch den vielbeachteten und ausgezeichneten "Ring" herausgebracht, doch der Berlioz-Faust scheint noch einmal ein echter Höhepunkt zu sein. Mit Stefan Heinrichs als Bühnenbildner, dazu noch Franziska Funke bei den Videobildern und Constanze Schuster als Kostümbildnerin, schafft er eine schiere Bilderflut, die von Sinn und Assoziationsgehalt ihresgleichen sucht. Gerade die Videoeffekte sind in einer selten vorgefundenen Professionalität gestaltet und gehen weit über den , sonst oft so modischen Zuckerguss, mit dem dieses Medium in Operninszenierungen ge- und verbraucht wird hinaus.

Berlioz Faust ist eigentlich das gegenbild zu Goethes schaffendem Menschen, er ist passiver Beobachter, so wird er denn auch inszeniert. Die vielen schönen Gedanken der Menschheit, das Miteinander, die Liebe, immer wieder wird es durch gedankenlose Untätigkeit zersetzt und gleitet ins Destruktive, ja Zerstörerische. Aus der Liebe zum anfänglichen Traumbild Margaretes, sie erscheint wie in einer zarten Seifenblase, entsteht Enttäuschung und Ausgrenzung. Pilavachi scheut sich nicht Bezug auf die modernen Medien via "Facebook" zu nehmen, hier sehr passend und anschaulich. Faust selbst vermischt sich figürlich mit seinem Alter Ego, Mephistopheles, zu einer Person, ist auch als Kind, Oskar Eichenberg spielt das hervorragend, den ganzen Abend auf der Bühne anwesend, wie David Winer-Moses, der als Puppentheater-Teufel als negativer Spielleiter durch den Abend führt. Das Lübecker Theater selbst wird als Bildungs- und Unterhaltungsanstalt auf der Bühne gespiegelt und zum Thema. Die Inszenierung bietet viele Bilder, die im Kopf bleiben werden und zum Nachdenken anregen.

Doch auch musikalisch bleiben fast keine Wünsche offen: Jean-Noel Briend gestaltet mit heldisch angelegtem Tenor die Titelpartie mit ihrer heiklen Tessitur, die baritonalen Tiefen gelingen mit dediziertem Ausdruck, die leichten Verhärtungen in den Höhen sind bei dieser Partie marginal, das muß man erst einmal so singen, wie es der, auch schauspielerisch, sehr begabte Künstler macht. Taras Konoshenko setzt mit wuchtigem,aber auch flexiblem Bass seinen Mephisto dagegen. Wioletta Hebrowskas üppig strömender Mezzosopran ist einfach nur ein Traum, hier wird die Partie der Marguerite gesanglich einfach auf den Punkt gebracht, szenisch wird die Entwicklung der Martyrerin intensiv aufgebrochen. Seokhoon Moon als Brander gibt mit angenehmem Bariton seine Visitenkarte ab. Die Chöre klingen, bei diesem gewaltigen Chorstück, wie sie sollen und machen schauspielerisch mit großem Einsatz viel Freude.

Andreas Wolf am Pult des hervorragend aufspielenden Philharmonischen Orchesters der Hansestadt ist der richtige Mann für die manchmal etwas eklektische Partitur und bringt die verschiedenen Seiten von Berlioz`Klangwundern auf das Beste zum Leuchten, den romantischen Überschwang der Kantilene, die Brutaltät des Ungarischen Marsches, die klerikale Süße des Finales, alles findet den rechten Ton.
Eine außergewöhnliche Darbietung, die deutlich ein volleres Haus verdient hätte. Für mich sicherlich einer der Höhepunkte der Saison, wer es noch schafft, eine der wenigen Vorstellungen anzusehen, wird mir zustimmen.
Fotos von Jochen Quast
Martin Freitag 21.5.14
IL PRIGIONIERO & SOUR ANGELICA
Premiere 11.4.15 Theater Lübeck
Bravi unter Tränen
Mit Il prigioniero (Der Gefangene) von Luigi Dallapiccola und Suor Angelica (Schwester Angelica) von Giacomo Puccini stellt sich das Theater Lübeck der Herausforderung zwei Operneinakter verschiedener Epochen in einem Doppelabend miteinander zu vereinen. Das dramaturgische Wagnis, für das sich der scheidende Musiktheaterdramaturg Dr. Richard Erkens verantwortlich zeichnet, zahlte sich am Ende des hochemotionalen Abends aufgrund des sängerischen und darstellerischen Niveaus der Protagonisten, einer detailverliebten Regie sowie der gewohnt verlässlichen Leistung des Lübecker Orchesters unter der souveränen Leitung von Andreas Wolf aus.

Während Il prigioniero ein in sich abgeschlossenes Werk darstellt, steht Sour Angelica in konventioneller Aufführungspraxis in der Mitte des Triyptychons Puccinis zwischen Il tabarro und Gianni Schicchi. Das Lübecker Theater führt an diesem Abend zusammen, was thematisch zusammen gehört, so hat es den Anschein. Beide Werke behandeln die Thematik eines Mutter-Sohn-Verhältnisses und insbesondere die einzigartige Innigkeit der mütterlichen Liebe in einem Spannungsfeld privater Emotionen und politisch-gesellschaftlicher Zwänge, zwischen Hoffnung und Verzweiflung sowie Freiheit und Zuflucht.
Die Regisseurin des Abends, Pascal-Sabine Chevroton, hat gemeinsam mit ihrem Bühnenbildner Jürgen Kirner und der Kostümbildnerin Tanja Liebermann eine inszenatorische Verknüpfung beider Werke unternommen, die durch Transposition des Inhalts in die Moderne und einer Anpassung des Textes teilweise bemüht wirkt, letztendlich aber aufgrund der stringenten Umsetzung funktioniert und vor allem tief berührt.

Im Prigioniero öffnet sich der Vorhang für eine von verrosteten Schiffscontainern verstellte Szenerie, die dem geneigten Zuschauer auch im Bühnenbild Angelicas wieder begegnen soll. Die in Zwölftonmusik gefasste und in der Hinrichtung durch den Strick mündende Erzählung stellt insbesondere im Zusammenhang mit der abstrakten Interpretation des ersten Einakters schwer verdauliche Kost für das Publikum dar. Dies drückt sich auch im betreten wirkenden Zwischenapplaus vor der Pause aus, welcher die sängerisch und darstellerisch herausragende Leistung des Hausbaritons dennoch gebührend zu würdigen weiß.
Der seit langem im Lübecker Ensemble beheimatete Schotte Gerard Quinn, spielt den ausgemergelten Gefangenen mit einer berückenden Empfindsamkeit für seelische und physische Verletzlichkeit, die direkte Betroffenheit im Publikum evoziert. Trotz der strapaziösen Darstellung strahlt Quinns vokale Kunstfertigkeit jenen Hoffnungsschimmer in den Saal, der seiner Rolle als Freiheitskämpfer innewohnt. Er vermittelt gesanglich ebenso die Naivität eines Idealisten wie auch das dumpfe Grollen der Verzweiflung.
Der Mutter des Gefangenen, gespielt und gesungen von Carla Filipcic Holm, stellt die Regie eine scharf gezeichnete Mimik und Gestik in ihrer Arie über die albtraumhafte Gestalt Philipps II. zur Seite. Dunkel raunt das bevorstehende Schicksal in ihrem stimmlichen Ausdruck, präzise gesetzt schrill ihr Entsetzen. Das Zwiegespräch beider Akteure lässt Erinnerungen an die preisgekrönte Don Carlo Inszenierung Sandra Leupolds an diesem Haus mit eben jenen Darstellern aufleben. Mit symbolischer Intensität hebt die Beleuchtung den in seitlichen Containern postierten Chor hervor. Der von Richard Roberts gesungene Großinquisitor gerät vor den Partien Quinns und Holms ins Abseits. Jedoch wird er auch szenisch nicht ausdrücklich hervorgehoben, obgleich er den skrupellosen Geschäftsmann mit der passgenauen abschätzigen Kälte spielt und mit seinem Tenor sowohl den säuselnden Verführer als auch den abgeklärten Henker zielgenau zu treffen versteht.

Suor Angelica verortet sich zwar ebenfalls inmitten jener aus dem ersten Teil bekannten Schiffscontainer, das Bühnengeschehen spielt nun jedoch auf einem Flüchtlingsschiff, wie die Meeresprojektion im Hintergrund verheißt. Realismus in der Ausstattung und detailreicher Naturalismus im Spiel prägen eine Ganzheitlichkeit im Konzept Suor Angelicas.
Das Publikum wird im Vorspiel Zeuge des Abschieds zwischen vielzähligen Müttern (der Damenchor, solide geführt von Josef Feigl) und ihren Kindern (der Kinderchor einstudiert von Gudrun Schröder). Die in der Heilkräuterkunde bewanderte Angelica erscheint nun im Flüchtlingslager als medizinische Helferin, welche einzig ihrem eigenen Leid kein geeignetes Mittel entgegensetzen kann. Ihre Antagonistin – als Spiegel des Großinquisitors im Prigioniero – taucht in Gestalt der Zia Principessa, ihrer Tante, auf. In einer Stimmgewalt, die durch beeindruckendes Volumen in Kombination mit physischer Gefasstheit angsteinflößend sowohl das Opernhaus als auch das Publikum in Mark und Bein durchdringt, verkündet die Altistin Romina Boscolo der verbannten Angelica die vernichtende Botschaft.
Mit herzbewegender Authentizität gibt Carla Filipcic Holm, die das Lübecker Publikum bereits als Tannhäusers Elisabeth und Elisabetta in Don Carlo begeisterte, die verwaiste Mutter. Die Komplexität der Partie meistert die Sopranistin mit facettenreicher Klangschönheit und weiß mithilfe ihrer sicher geführter Stimme zwischen sanftem Wohlklang und durchdringender Dramatik zu changieren ohne ins Larmoyante zu entgleiten. Ihr natürliches Spiel höchster emotionaler Intensität während Angelicas Klage um die heimatlose Liebe zu ihrem verstorbenen Sohn macht die Mater Dolorosa direkt greifbar und fesselt das Publikum in bestürzter Anteilnahme. Man darf eine Künstlerin in ihrer Blüte bewundern, die sich vollständig einer Rolle hingibt, ohne etwas ihrer gesanglichen Professionalität einzubüßen.

Getragen durch Puccinis bis in die religiöse Verklärung reichende Musik löst sich die Bedrängnis im Freitod Angelicas und der erflehten Vereinigung von Mutter und Sohn in himmlischen Gefilden auf.
Mit sichtbarer Ergriffenheit nahmen allen voran Carla Filipcic Holm und ihr Bühnenpartner Gerard Quinn den anschließenden, ausgenommen stürmischen, Premierenapplaus und verdiente stehende Ovationen entgegen. Es bleibt zu hoffen, dass am Lübecker Theater trotz den drohenden Sparmaßnahmen auch weiterhin künstlerische Glanzpunkte dieser Qualität erreicht werden können.
Antonia Alexandra Söllner 14.4.15
Dank für die aussagekräftigen Bilder an Oliver Fantitsch
Opernfreund-CD-Tipp

eine ganz tolle Aufnahme z. Zt nur 12 Euro
Anthony Pilavachi will nie mehr in Lübeck inszenieren
Pressespiegel:
Aufruhr im Theater Lübeck
Regiestar Pilavachi wirft hin
Eklat nach Premiere
Anthony Pilavachi versus Christian Schwandt
DER WILDSCHÜTZ

Besuchte Wiederaufnahme am 18.12.14 (Premiere am 17.01.14)
Der kritische Lortzing
Anthony Pilavachi hat dem Theater Lübeck schon viele Sternstunden der Oper geschenkt, auch mit Albert Lortzings Meisterwerk "Der Wildschütz" ist ihm ein solches gelungen. Lortzing dessen ambivalentes Potential immer noch allzu selten ausgeschöpft wird, dessen Spielopern immer noch unter einer vermufften Fünfziger Jahre Unterhaltungsdoktrin leiden, erfährt hier, neben der Bedienung der Komödie, endlich echte Wertschätzung. Gerade der Wildschütz ist ein richtig böses Stück, wirklich sympathische Persönlichkeiten tummeln sich nicht auf der Bühne, selbst die nette Baronin Freimann wird von einer aufgeklärten Schadenfreude angetrieben und gerät vor allem zur Anwältin ihrer eigenen Dinge; Evmorfia Metaxaki führt das Ensemble siegessicher mit strahlendem Sopran voll ironischer Siegesgewissheit an. Ebenso wichtig ihr Bruder, der Graf von Eberbach, in dieser Inszenierung, die passenderweise in Ostpreussen 1933 spielt ein unangenehmer Gutsbesitzer voller Herrenmentalität. Steffen Kubach führt ihn mit charaktervollem Bariton vor, das Glanzstück "Heiterkeit und Fröhlichkeit" entlarvt die resignative Leere des Schürzenjäger, wie man sie noch nicht gehört hatte, eben ein "Glanzstück" der Interpretation.

Doch noch einmal zurück zur Inszenierung, denn die ist, trotz der kritischen Haltung, einfach wunderschön anzusehen: Markus Meyer hat den ersten Teil in eine Schloßküche gesetzt, der zweite Teil ein privates Salon-Museum mit farbigen Vogelillustrationen, die wie Trophäen eines Sammlers wirken, hier haust auch die exaltierte Gräfin, traurig kinderlos dem theatralischen Griechentum verfallen, Annette Hörle spielt das menschlich nachvollziehbar mit schönem Mezzo. Tatjana Ivchinas Kostüme wissen sowohl zu gefallen, wie Zeit und Charakter herauszustellen. Mit schlankem,ansprechendem Tenor macht ihr der verkleidete Baron Kronthal den Hof, bevor ihn sich die Freimann schnappt. Daniel Jenz scheint an dem Abend stimmlich leicht angekratzt, gefällt aber trotzdem.
Ein weiteres Handlungszentrum ist der großartige Bass Taras Konoshenko, gesanglich ohne Tadel, von hervorragender Verständlichkeit, eigentlich ein Bonus der ganzen Aufführung bei allen Beteiligten, gerät sein Schulmeister Baculus zum Spagat zwischen Heinrich Manns Diederich Heßling ("Der Untertan") und dem Humor eines Louis de Funes, ihm zur zweckmäßigen Ehe an der Seite das süffisante Gretchen von Andrea Stadel, stimmlich echter Sopranluxus für diese gar nicht mal so klein empfundene Partie. Dazu die attraktive Inga Schäfer als recht erotische Nanette, wie der grandiose Charakterschauspieler Dietrich Neumann, dessen Hofmeister Pankratius gesanglich apart und spielerisch ohne Chargieren auskommt.

Auch der Wiederaufnahme merkt man die sorgfältige Einstudierung Andreas Wolfs an, oft lobt man Lortzings Nähe zu Mozart, doch bei Wolfs Dirigat entdeckt man schon in der brilliant gegebenen Ouvertüre eine Affinität zu durchaus Beethovenschen Furor, auch das hatte ich noch nie so erlebt. Das geht natürlich nur mit einem exzellenten Orchester, wie dem Philharmonischen der Hansestadt Lübeck. So pendelt die Musik zwischen moralischer Straffheit und romantisch zelebrierter Ironie. Groß besetzt mit Chor und Extrachor, sowie Kinderchor steht "das Volk" auf der Bühne, szenisch fein und dediziert, musikalisch ohne Wünsche offenzulassen.
Wünschen täte man dem Theater Lübeck nur noch ein besser besuchtes Haus, als an diesem Abend, denn einen Lortzing dieser Güte in jeglicher Hinsicht erlebt man selten, zumal "nur" bei einer Wiederaufnahme. Für mich ein ganz großer Abend, der mir erneut Augen und Ohren für den verkannten Albert Lortzing öffnet. Bitte unbedingt besuchen, diese Aufführung hat es absolut verdient.
Martin Freitag 30.12.14
Bilder: Thorsten Wulff mit frdl. Genehmigung des Theater Lübeck
Alexander von Zemlinsky
DER ZWERG
EINE FLORENTINISCHE TRAGÖDIE
Besuchte Aufführung am 01.06.14 (Premiere am 18.04.14)
Meisterliche Einakter - einfach geniale Werke
Das Theater Lübeck setzt sich seit mehreren Spielzeiten immer wieder für die vernachlässigte Form der Operneinakter jenseits von "Cavalleria/ Pagliacci" ein, dieses Jahr sind die zwei Opern von Alexander von Zemlinsky nach literarischen Vorlagen von Oscar Wilde an der Reihe, beides ausgewiesene Meisterwerke, die aufgrund der Thematik bestens zueinander passen. Zemlinsky hatte das Thema Schönheit/Realität immer wieder in seinen Opern thematisiert, deswegen nimmt Bernd Reiner Krieger auch ein autobiographisches Erlebnis des Komponisten zur szenischen Klammer für seine Inszenierung. Zemlinsky, der wirklich kein Adonis war, verliebte sich nämlich in seine Schülerin Alma Schindler, jene welche später Gustav Mahler und Franz Werfel heiratete, eine gefeierte Schönheit ihrer Zeit, die durchaus mit ihrem Lehrer kokettierte, ihn später jedoch abwies.

So wird der Zwerg des Wildeschen Märchens ebenso zum Doppelgänger Zemlinskys, wie die verwöhnte Infantin, der er zum Geburtstag geschenkt wird zum Spiegelbild Almas; das Bühnenbild des Künstlerheims des Ausstatters Roy Spahn übergangslos zum prunkvollen Palast, die opulente Düsternis läßt sich im zweiten Werk ebenso für den florentinischen Palazzo gebrauchen. In der ersten Oper erliegt Krieger etwas zu sehr der ausgiebigen Feier der Infantin, die bunten Insektenroben sollen wohl an einen Kindergeburtstag mit Verkleiden denken lassen, was optisch zwar etwas hermacht, doch auch recht "operettig" wirkt. Weniger von allem ,auch was die Statisten betrifft, wäre da mehr gewesen. Doch das Stück liegt vorwiegend in der Hand der durchweg trefflichen Darsteller. Noa Danon spielt lebhaft die Infantin Donna Clara, da sie indisponiert ist, gestaltet von der Seite ein Sopran, deren Namen ich mir leider nicht im Eifer des Gefechts aufgeschrieben habe, dafür Asche auf mein Haupt. (Anmerkung Redaktion: Sarah Hershkowitz).
Evmorfia Metaxaki bildet dazu mit hohem Mezzosopran die warmherzige Zofe Ghita als weiblich liebenswerten Gegenentwurf. Taras Konoshchenko mit verspieltem Bariton den schrulligen Haushofmeister Don Estoban. Ebenso erfreulich die Solozofen und Mädchen, wie der toll geführte Damenchor. Doch das Hauptaugenmerk liegt eben auf der Titelpartie des Zwerges, einer heldisch-lyrischen Rolle von sehr schwierig hoher Tessitur mit einem enormen Radius an empathischer Teilnahme bis in zutiefst schmerzliche Bereiche. Für diesen Zemlinsky Zwerg ist Erik Fenton mit einem Wort eine Erfüllung, danke für diese berührende Interpretation.

Die florentinische Tragödie ist ein eigentlich sehr schlichtes Eifersuchtsdrama mit drei Personen: dem Kaufmann Simone und seiner unglücklichen gattin Bianca und dem leichtlebigen Prinzen Guido Bardi, erst nachdem Mord erkennen die Eheleute ihre Qualitäten und Stärken aneinander. Hier gelingt Krieger mit wenig unaufgeregten Mitteln, einem Umschleichen der Protagonisten von einander, ein echter Psychothriller.
Wolfgang Schwaninger ist der tenoral heldische Prinz mit unangenehmen Manieren und betörendem Höhenstrahl, Wioletta Hebrowska mit sehr sinnlich-süffigem Mezzotimbre die Ursache des Dramas und Gerard Quinn mit kernigem Bariton lotet alle Tiefen und Untiefen des unterschätzten Ehemannes aus. Drei ganz tolle Sängerdarsteller, die mit den schwierigen vokalen Aufgaben scheinbar spielend fertig werden. Auch hier grandioses Musiktheater.
Ryusuke Numajiri ist seit dieser Saison der neue GMD in Lübeck und musiziert mit dem Philharmonischen Orchester den üppigen Jugendstilklang der Partituren, atmet mit den Sängern, läßt keine Nuance aus, auch hier eine große Leistung; freilich hat er genau wie sein Vorgänger Brogli-Sacher die Schwierigkeiten mit der sehr trockenen Akustik des Hauses, da gilt es noch am Zurücknehmen der Orchesterwucht zu arbeiten. Insgesamt ein sehr beflügelnder Musiktheaterabend mit zwei viel zu selten aufgeführten Opern, das nicht ganz so zahlreiche Publikum reagierte hingerissen und geizte nicht mit Applaus.
Martin Freitag 9.6.14 Bilder Jochen Quast
ARMIDE
(Gluck)
Premiere 28.02 2014
Die Sopranistin Sabina Martin begeistert als „Armide"
Der Komponist Christoph Willibald Gluck (1714 -1787) gilt in der Musikgeschichte als Reformator. Für diesen Ruf hat er mit „Orfeo ed Euridice“ den Grund gelegt- ein Werk, das bis heute gelegentlich auf den Spielplänen auftaucht. Weit erfolgreicher war er freilich zu seinen Lebzeiten - und darüber hinaus - mit der französischen Oper „Armide“, die er 1777 auf einen Text herausgebracht hatte, den zuvor bereits der Hofkomponist Lully bearbeitet hatte. Und die deutsche Erstaufführung hat 1823 niemand anders als Richard Wagner in Dresden dirigiert.

Die Märchengeschichte von der sarazenischen Zauberin, die sich wider ihren Willen in einen christlichen Kreuzritter verliebt, geht auf ein Vers-Epos von Torquato Tasso „Das befreite Jerusalem“ aus dem Jahre 1574 zurück. Der Stoff hat offenbar die Musiker sehr bewegt. Wie Lübecks Operndirektorin Katharina Kost-Tolmein im Programmheft berichtet, sind mindestens dreiunddreißig Musikwerke überliefert – das letzte 1903 von Antonin Dvorak.
In Lübeck hat der hier wohl bekannte Regisseur Michael Wallner diese Märchengeschichte in Szene gesetzt. Zwar stehen ihm nicht jene Effekte zur Verfügung, mit denen die Barockoper die Zeitgenossen beeindruckt hat. Sieht man davon ab, dass er die Sängerin Wioletta Hebrowska in der Rolle des „Hass“ in den Bühnenhimmel entschweben lässt. Und er hat ein geheimnisvolles Kind (Martha von Götz) „erfunden“, das letztlich von Armide umgebracht wird, bevor sie sich selbst entleibt.
Die feenhafte Handlung vollzieht sich außer mit vielen Lichteffekten und einigen Videos vor allem auf einem fast schwebenden Rundsteg, der sich über die Bühne zieht. In der Rolle der „Armide“ wird die freischaffende Sängerin Sabina Martin zum besonderen Erlebnis dieses Abends. Mit großer volltönender Stimme, die auch in den hohen Lagen nie forciert klingt, kämpft sie gegen ihre Liebe zum Ritter Renaud. Den bietet der neu zum Ensemble gehörende Daniel Jenz nicht minder eindrucksvoll und elegant. Steffen Kubach und Jonghoon You als die „Kollegen“ Ubalde und Dänischer Ritter sind mit ihren Rundschilden mehr oder minder Spottbilder des Rittertums. Eindrucksvoll auch Gerard Quinn als König Hidraot, Marc McConnell als Ritter Artemidore und die Damen Steinunn Soffia Skjenstad, Evmorfia Metaxaki und Leonor Amaral in ihren Rollen als Phénice, Sidonie und Dämon, Sehr geheimnisvoll der von Joseph Feigl einstudierte Choi in den Kostümen vonTanja Liebermann.

Am Pult steht mit Christoph Spering ein Fachmann für historische Aufführungen. Der lässt das Philharmonische Orchester sehr klar- mitunter auch sehr laut! - aufspielen. Den Musikern gilt fast ganz seine Aufmerksamkeit – gut, dass Sänger und Chor recht einsatzsicher sind.
Das Premierenpublikum ist sicht- und hörbar beeindruckt und feiert alle Mitwirkenden begeistert. Ein einzelner Buh-Ruf gegen die Regie war wohl mehr ein Scherz.
Horst Schinzel 01.03.2014 Fotos: Jochen Quast
Besprechungen früherer Aufführungen befinden sich ohne Bilder weiter unten auf der Seite Lübeck des Archivs.