

(c) Nasser Hashemi / Dieter Wushanski
23. April 2022
„Aida“ im Paris von 1870
Der umtriebige Ingolf Huhn inszeniert ein Konzept von Barbe & Doucet.
Der Ägyptologe Auguste Ferdinand Franҫois Mariette (1821-1881) war vom Pariser Louvre im Jahre 1850 nach Ägypten geschickt worden, um koptische, syrische und äthiopische Manuskripte aufzukaufen. Die Pausen der zähen bis 1854 reichenden Verhandlungen nutzte Mariette zur Erkundung historischer Stätten und entdeckte dabei unter anderem die zum ägyptischen Begräbnis-Kult gehörenden unterirdischen Begräbnisstätten der heiligen Apsis-Stiere. Ohne behördliche Genehmigung und mit für heutige Auffassungen unmöglichen Methoden begann er zu graben, setzte dabei selbst Sprengmittel ein, um an die Altertümer zu gelangen. Auch verbrachte er etwa 7000 Fundstücke ohne Genehmigung nach Frankreich.

Nachdem Mariette 1857 wieder zu robusten Grabungen nach Ägypten gekommen war, wurde er im Folgejahr vom osmanischen Vizekönig Ägyptens Said Pascha zum „Director Service des Antiquités de l´Egypte“, Direktor des Altertümer Dienstes ernannt, erhielt damit die Oberleitung aller von der Regierung initiierten Grabungen.
Die Anregungen aus der Beschäftigung mit den Funden des „Alten Ägyptens“ verarbeitete Mariette in der Erzählung „La fiancée du Nil“, frei: die Verlobte vom Nil.
Als der europäisch, sprich Französisch erzogene Khedive für sein Kairoer Opernhaus unbedingt eine Repräsentations- und Prunk-Oper Guiseppe Verdis in Auftrag geben wollte, die Macht und Bedeutung verherrlichte, witterte Auguste Mariette eine Chance. Er ließ die Erzählung als Entwurf eines Opernszenars drucken und schickte ein Exemplar an den Librettisten des „Don Carlo“ und inzwischen Manager der Pariser Opéra-Comique Camille du Locle (1832-1903), der Verdi (1813-1901) für die Handlungs-Skizze interessierte. Bekanntermaßen diente Mariettes Szenarium dem Librettisten Antonio Ghislanzoni (1824-1893) für die intensive Zusammenarbeit mit Guiseppe Verdi für die Komplettierung der Oper.
Mariette war1870 zur Vorbereitung der Kairoer Uraufführung besonders für die Gestaltung der Kostüme nach Paris gekommen.
Hier setzt die Inszenierung der Oper „Aida“ von Ingolf Huhn, dem Opernarchäologen aus dem Erzgebirge, nach einem Konzept des kanadischen Inszenierungs-Duos „Barbe & Doucet“ ein.
Auguste Mariette, in Gestalt Rolf Germeroths, gerät in der französischen Hauptstadt in das Chaos des Deutsch-Französischen Krieges. Nach der Niederlage der Französischen Armee in der Schlacht von Sedan am 1. September 1870 wurde Paris von Truppen Preußens und seiner Verbündeten in der Zeit vom 19. September 1870 bis zum 28. Januar 1871 eingeschlossen und belagert.
Eigentlich wollte Mariette mit der Operntruppe nach Kairo zur Uraufführung der „Aida“ reisen und sollte die Kostüme, Requisiten und Bühnenaufbauten in das „Khedivial-Opernhaus“ begleiten. So aber strandete er mit den Sängerinnen und Sängern, mit Menschen die in seinem Hause Zuflucht gesucht hatten sowie bei den Hausbewohnern.

Irgendwie muss sich jeder der bunten Gesellschaft beschäftigen und vom Kriegsgeschehen ablenken. Als das zunehmend zu Spannungen in der bunten Gesellschaft führt, beginnt die Operntruppe, obwohl bereits in Reisekleidung, ihnen den ersten Aufzug der „Aida“ zu improvisieren.
Das beruhigt die Situation, zumal sich die gesamte Gesellschaft für die Chorszenen engagiert. An den passenden Stellen kommen auch noch verwundete Kämpfer oder kontrollierende Soldaten auf die Szene.
Selbst für die Schwertweihe des Radamès finden sich aus den Anwesenden vier Tänzerinnen.
Für den zweiten Aufzug hatten die Hilfesuchenden das Haus des Mariette Bey verlassen, so dass Platz für ein publikumswirksames Zwischenspiel der Solo-Tänzerin Megum Aoyama mit zwei Kindern der Opernballettschule und dem Zickenkrieg zwischen der Amneris und Aida blieb.
In der Folge löste die Inszenierung den Hergang zunehmend vom Opernszenarium, indem der Hausherr eine Bürgergruppe ins Haus bat, um mit ihnen eine Huldigung für wen auch immer zu organisieren.
Mit der Persiflizierung der Triumphszene führte Ingolf Huhn seine Inszenierung dann geradewegs trotz Einsatz von Tänzern und breiter Chorszene in das Kammermusikalische.
Folgerichtig gab es mit der kompletten Loslösung von der Adaption der Handlung des dritten Aufzuges einen Abstecher in den Innenhof der Kairoer Residenz Mariottes für einen nahezu klassischen intimen Nil-Akt.
Fast zeitlich und örtlich neutralisiert, fast konzertant, bot sich der vierte Akt. Bei der Schlussszene nach der „Steinschließung“ agierten Aida und Radamès vor einem rotfarbig angestrahlten Gazevorhang. Zunehmend Sicht-durchlässig erlaubte er Amneris Schlussarie und den Blick auf eine geisterhafte Personalie in der Dekoration.
Für die Regie hatte diese Deutung des „Aida-Stoffes“ vor allem die Aufgabe, aus den Überfiguren des Librettos Menschen aus Fleisch und Blut im bürgerlichen Umfeld zu gestalten. Als Glücksgriff erwies sich, dass Huhn die Hauptpersonen in ihrer Reisekleidung aus dem Pariser Auftritt bis zum Schluss als eine Klammer um die Inszenierung sicherte. Das gefährdete weder ein gelegentlicher Kopfputz der Amneris noch eine Schärpe für Radamès und Amonasro.
Letztlich zeigt die Regie eindrucksvoll, warum Aida als Konglomerat von ideologischer Zustimmung und sozialer Anklage noch immer faszinierende Aktualität besitzt.
Im Graben gelangen dem Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo mit der hochmotivierten Robert-Schumann-Philharmonie einige gut disponierte impressionistische Klanggemälde mit dem deutlichen Bemühen um jene Tempo- und Klangnuancen, die einer Verdi-Oper ihr Leben einhauchen. Das gesamte Spektrum zwischen einem reduzierten Pianissimo bis hin zu heftig betonten Marschtritt der Aufzugsmusiken, mit deren Trivialität Verdi das pomphafte Machtgehabe seines Auftraggebers artikulierte, wurde geboten.
Die Betonung lag aber doch auf den kammermusikalischen intimeren Szenen des Abends.
Das Orchester bildete gemeinsam mit dem von Stefan Bilz glänzend einstudiertem verstärkten Chor des Hauses die Tragsäulen der Aufführung.

Solistisch wurde im Chemnitzer Opernhaus mit großer Leidenschaft Erstaunliches geboten:
Die Sopranistin Tatiana Larina, seit 2019 Mitglied im Hausensemble, hatte sich in den langwierigen Proben auf ihre Aida-Rollendebüt, das für Oktober 2022 geplant war, vorbereiten können, wurde aber am Mittag des Premierentages mit der Einspringer-Notwendigkeit überrascht. Die vorgesehene Gastsolistin hatte sich indisponiert gemeldet.
Wie die junge Georgierin diese Herausforderungen bewältigte, war absolut bewunderungswürdig.
Fern jeder Routine hörten wir eine dunkel-schlanke zu kultivierter Expression fähige Stimme, die ohne Druck die langen Phrasen ihrer Rolle mit der schwierigsten Arie und den Duetten bewältigte. Die fast ständige Bühnenpräsenz, die Darstellung der Gefühle und des inneren Zwiespalts dürften für die Sängerin eine besondere Herausforderung gewesen sein.
Nach der Aufführung erzählte sie mir, dass für sie die Anpassung des Reisekleides der Aida auf ihre zierliche Figur der größte Vorbereitungs-Stress gewesen sei.
Auch für die Mezzo-Sopranistin Nadine Weissmann war die Amneris ein Rollendebüt, denn bisher kannten wir sie nur als Erda bzw. als Schwertleite in Wagnerpartien. Mit flexiblem Gesang wusste sie das Begehren der verliebten Königstochter, zwischen Suche nach Versöhnung, Ergebenheit und Verzweiflung überzeugend darzustellen.

Der Partie des Radamès gab der mexikanische Tenor Hector Sandoval mit viel Gefühl und Ausdruck. Obwohl bereits Rollen-erfahren, hatte er es zwischen den ordentlich aufspielenden Debütantinnen nicht einfach, sich zu behaupten. Zum Teil kraftvoll, aber auch schön und zart agierte er im Spannungsfeld zwischen den selbstbewussten Frauen.
Letztlich überzeugt Frauendynamik gegen Tenor-Testosteron.
Der Amonasro von Aris Argiris konnte mit stimmlicher Urkraft und gesanglicher Geschmeidigkeit sowie darstellerischer Präsenz statt mit der Autorität des Königs von Äthiopien dank seiner klaren Moralvorstellungen aufwarten. Mit Kaltschnäuzigkeit verfolgt er seine Ziele.
Der Oberpriester Ramfis des Haus-Bassisten Alexander Kiechle agierte durchaus raumgreifend ohne die Orchesterwogen fürchten zu müssen. Prägnant setzt er seine Ziele durch.
Björn Waag nutzte als Ägyptischer König die Möglichkeiten, seinen schönen prägnanten Bass mit Timbre und Stimmkultur zur Geltung zu bringen.
Eine leuchtend singende Oberpriesterin gab Marie Hänsel.
Konrad Furian vom Opernstudio des Hauses konnte mit den wenigen Sätzen des Boten beeindrucken.
Beeindruckend auch die Darbietungen der Mitglieder des Balletts des Hauses, der Gäste eines Koreanischen Trainee-Programms und der Opernballettschule Chemnitz.
Intensiver Beifall des überwiegend heimischen Publikums auch für das Inszenierungsteam krönte den Abend.
Damit erlebten wir einen beeindruckenden Beitrag der Oper Chemnitz, dass auch mit den Mitteln des Regietheaters ein breiteres Publikum zu erreichen ist.
Thomas Thielemann, 25.4.22
Autor der Bilder: © Nasser Hashemi
Tristan und Isolde contra Isolde und Tristan
Elisabeth Stöppler inszenierte in Chemnitz
23. Oktober 2021
Schon der Titel von Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ dürfte für Elisabeth Stöppler der erste Stolperstein gewesen sein, denn Isolde ist zweifelsfrei die spannendere Figur des Bühnenwerks. Das Hauptmotiv ist mit ihr verbunden und mit ihrem Sehnsuchtsmotiv hat sie am Ende des ersten Aktes sowie am Ende des gesamten Dramas das letzte Wort.

Was war somit zu erwarten:
Das Mannschafts-Logis eines auf Tauchstation befindlichen Unterseebootes ist, solange keine Torpedos drohen, gleichzeitig ein sicherer Ort, als auch ein solides Gefängnis. Damit eignet es sich besonders für die gewaltsame Überstellung einer irischen Königstochter an einen Vasallen in Cornwall mit all ihren Konflikten und Auseinandersetzungen. An Bord herrschten Männer und überzogen die beiden Frauen mit verbaler und die Brangäne auch mit physischer Gewalt, dem insbesondere die Gefährtin Massives entgegenzusetzen wusste.
Die Handlungsführung im zweiten Akt verwundert zunächst, benehmen sich doch beide Titelhelden in der fast endlosen Zwiesprache höchst unterschiedlich. Tristan versuchte die Abgründe, die Rahmenbedingungen der skurrilen Situation des doppelten Wortbruchs, durch lockeres, flippiges Benehmen zu bewältigen und mit dem Hantieren mit seinem Revolver zu entschärfen, während Isolde immer wieder versuchte, eine gewisse Intimität herzustellen. Beide verfügten über die notwendige Souveränität, das aberwitzige Notenmaterial Wagners auch geistig zu durchdringen. Aber tiefes Endringen in Wagners emotionale Welten blieb schwierig. Da musste man sich schon entscheiden, ob man der Handlung folgen oder sich der Musik hingeben wollte. Letzteres konnte nach der Rückkehr der vermeintlichen Jagdgesellschaft in die herrschaftliche Villa keinesfalls gelingen, als die Regie die Situation, dem Zeitgeschmack entsprechend, zu wildverbalen und gewaltsamen Eskalation entgleiten ließ. Da konnte selbst ein fast naiver „König“ Marke keine Rettung bringen.

Mit dem dritten Aufzug legte Frau Stöppler noch eine Schippe nach: Annika Haller schickte uns nach dem Familiensitz Kariol in das Zimmer des jugendlichen Tristan mit Fanplakaten an den Wänden, einem Regal mit Sportpokal, Schiffsmodellen und einer Spargeldschatulle.
Der schwer verwundete Tristan erwachte aus tiefer Bewusstlosigkeit, richtete sich auf und berichtete von seinen Nahtot-Erfahrungen. Scheinbar zu Kräften gekommen, möchte er das Heft des Geschehens in die Hand nehmen, wird aber immer wieder in traumatische Verklärungen und zerstörerische Todessehnsucht hineingezogen. Visionen seiner verstorbenen Eltern, ein Kinderwagen, dem Tristan sein kindliches „Ich“ aufzunehmen scheinen, reihten sich mit den Auseinandersetzungen mit Kurvenal und führten zu nahezu unerträglichen Erlösungsphantasien. Das war hervorragend in Szene gesetzt. Als sich dann mit der Ankunft der beiden Schiffe die Szene mit nahezu dem gesamten „Zettel-Personal“ füllte, eskaliert die Situation, so dass binnen kurzen die Bühne voller Leichen in Shakespeare’scher Dimension lag. Nur der Brangäne, Marke und dem Hirten gelang, sich zu entfernen. Auch hat mir Frau Stöppler im Nach-Gespräch versichert, Isolde habe das Massaker überlebt. Die Isolde blieb zweifelsfrei die spannendere Person des Abends.
Die Chemnitzer „Wagner-Kompetenz“ erlaubte, dass das das anspruchsvolle Sujet der Damen mit handwerklicher Meisterschaft und hoher Kreativität auch auf der Bühne umgesetzt werden konnte.

Bereits Anton Richard Tauber, der Vater vom Tenor Carl-Richard, war ein umtriebiger, aber auch einflussreicher Mann. Anfang 1913, als in Bayreuth noch um die Verlängerung der Schutzrechte für den „Parsifal“ über das Jahr 1914 hinaus gerungen wurde, hatte er bei der Stadt Chemnitz einen Zuschuss von 30 000 Mark für eine Inszenierung des Bühnenweihfestspiels erreicht, so dass Chemnitz am 13. Februar 1913 die erste Aufführung außerhalb Bayreuths erlebte.
Seit dieser Zeit hat sich die Oper Chemnitz mit interessanten Projekten den Ruf eines „Bayreuth des Nordens“ erarbeitet und nicht zuletzt mit den Ring-Inszenierungen von 2018 gefestigt.
Die Robert-Schumann-Philharmonie hat sich zunehmend zu einem respektablen Wagner-Orchester entwickelt. Die Musiker folgen ihrem Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo bedingungslos. Der Spanier ist ein engagierter und oft ungeduldiger Orchesterleiter, wenn er wütet, das Geschehen vorantreibt oder einfühlsam agiert. Dabei leitet er sängerfreundlich, schont streckenweise und vermeidet eine Überbelastung der Solisten der Titelpartien.
Das Orchester zelebriert zarte Passagen und Übergänge ebenso souverän wie die eruptiven Ausbrüche der Partitur. Die von Stefan Bilz präzise einstudierten Chöre unterstreichen das Niveau der Chemnitzer Wagnerpflege.
Neben einer soliden wagneraffinen Sängergarde im Ensemble verfügt das Chemnitzer Opernhaus über eine stattliche Garde häufig gastierender Wagner-Sängerinnen und -Sänger. Für die Titelpartien der Tristan- Inszenierung waren die bereits in den Ring-Aufführungen im Haus bewährten Gäste Stéphanie Müther und Daniel Kirch nach Chemnitz gekommen. Von der hochdramatischen Sopranistin wurde ihr Rollendebüt als Isolde mit klarem, ausdrucksstarkem Gesang in den schier endlosen Opernlängen fantastisch gemeistert. Immer wieder fand sie vor allem in den leisen langsamen Stellen neue Stimmfarben. Sie konnte auch durchaus zynisch, bissig oder ironisch sein.

Daniel Kirch hatten wir bereits vor zwei Jahren als einen begrenzten Tristan in Leipzig erleben können. Inzwischen bewältigte er die monströse Partie präsent, strahlend mit ausdrucksstarker gesanglicher Tiefe und ob des originellen Inszenierungskonzepts auch mit Körpereinsatz. Seine Stimme hat seit den letzten Begegnungen durchaus Variationsreichtum und Wandlungsfähigkeit gewonnen.
Ihr Rollendebüt als Brangäne bewältigte die gebürtige Sächsin Sophia Maeno mit einem charaktervoll leuchtendem Mezzosopran und darstellerischer Qualität. Glaubhaft bot sie die Freundin, Warnerin und Unglücksbotin. Großartig waren auch ihre Warnrufe zu hören.
Mit dem aus Island stammen den Oddur Jónsson lernten wir als Kurwenal einen prägnant kräftigen Heldentenor mit darstellerischem Potential kennen, der eindringlich seine Anliegen vorzubringen wusste.
Der König Marke hat zwar nur zwei Auftritte. Das ermöglichte dem Bassisten des Hausensembles Alexander Kiechle seine in den unteren Lagen durchaus noch ausbaufähige Stimme auch wirksam einzusetzen.
Der leichte Bariton Till von Orlowsky als Bösewicht Melot hörte sich gut an, wirkte aber etwas zu sympathisch.
Martin Petzold überzeugte als junger Hirte mit einem sympathischen Tenor. Mit dem amerikanischen Bariton Jacob Schafman, seit Saisonbeginn im Ensemble, waren der Partie des Steuermannes und mit dem Tenor Thomas Kiechle, seit 2020 im Ensemble, der Stimme eines jungen Seemanns ausgesprochene Luxusbesetzungen zugekommen.
Langanhaltender, gewaltiger und zum Teil stehender Applaus für die gelungene Konfrontation der überhöhten Wagnerschen Deutung von Liebe und Tod mit einem klaren Realismus.
Ich halte die von Elisabeth Stöppler vorgestellte Regiearbeit für einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die weitere Entwicklung eines gesellschaftlich akzeptierten Musiktheaters.
Thomas Thielemann 24.10.21
Autoren der Bilder: Nasser Hashemi / Dieter Wuschanski
Footloose
Premiere: 16.09.2021
Besuchte Vorstellung: 19.09.2021
Wir dürfen wieder tanzen!!!

Wie sagte schon Molière sinngemäß: „Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz.“ Getreu diesem Motto zeigt das Theater Chemnitz seit der vergangenen Woche das Musical „Footloose“ als erste große Neuproduktion der neuen Spielzeit im wunderschönen Opernhaus der Stadt. Basierend auf dem Kultfilm aus dem Jahr 1984 feierte das Musical von Dean Pitchford, Walter Bobbie und Tom Snow 1998 seine Uraufführung am New Yorker Broadway. Als Grundlage diente eine wahre Begebenheit in Elmore City im Bundesstaat Oklahoma, wo seit dem Jahr 1889 ein Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen galt, gegen das sich 1980 die Abschlussklasse der örtlichen Highschool erfolgreich erhob. Im Musical zieht Ren McCormack mit seiner Mutter von Chicago in die Kleinstadt Bomont, nachdem sein Vater die beiden verlassen hat. Seit fünf Jahren ist hier das Tanzen verboten, nachdem mehrere Jugendliche nach einem tragischen Unfall ihr Leben verloren. An diesem Tag verlor auch Reverend Shaw Moore seinen Sohn, ein Verlust, der den Reverend zu einem anderen Menschen machen sollte. Seit diesem schrecklichen Ereignis ist er fest entschlossen, die Heranwachsenden der Stadt durch übermäßige Kontrolle vor jeglichem Unheil zu schützen. Rockmusik, Alkohol und Tanzen sind hierbei verboten. Der tanzbegeisterte Ren, eckt entsprechend schnell mit dem Reverend und den Dorfbewohnern an, schließt allerdings nach und nach Freundschaft mit Gleichgesinnten, die sich in Bomont gefangen und erdrückt fühlen. Statt beim Tanzen mal etwas „Dampf ablassen“ zu können, stauen sich die Emotionen in den Jugendlichen zu einem teilweise explosiven Cocktail zusammen.

Jerôme Knols gelingt in Chemnitz eine hervorragende Regiearbeit, welche die Geschichte in ihrer eigentlichen Form erzählt und nur hin und wieder treffende Aktualisierungen vornimmt. So sorgt es für allgemeine Heiterkeit im Saal, als sich Rens Freund Willard beim Betreten des Burger Restaurants erstmal an der bereitstehenden Säule die Hände desinfiziert. Sehr gut gelungen sind auch die Umsetzungen der notwendigen Corona-Regelungen hinsichtlich der Gestaltung der Inszenierung. Hier ist es das beste Lob, wenn man wie in diesem Fall behaupten kann, dass man an dies während der gesamten 2 Stunden und 40 Minuten gar nicht wahrgenommen hat. Erst der Kuss zwischen Ren und Ariel, Tochter des Reverend, der auf der Bühne nur angedeutet wird und dann beim Abgang der Darsteller als effektvolle Projektion auf die Bühne projiziert wird, macht einem wieder kurz deutlich, was bei einer solch großen Inszenierung wie hier alles im Hintergrund bedacht werden muss. Stichwort „große Inszenierung“, sehr beachtlich ist an diesem Abend auch, was Ulv Jakobsen für ein wunderbares Bühnenbild erschaffen hat. Hierbei nutzt er alle technischen Möglichkeiten, die ihm das Haus zur Verfügung stellt. Die große Drehbühne sorgt ebenso für rasche Szenenwechsel wie die aus dem Boden hochfahrenden Räume. Beeindruckend ist es, wie die Dorfkirche immer wieder elegant und ohne sichtbare Hilfe auf die Bühne fährt. Auch für die passenden Kostüme der Inszenierung zeichnet sich Ulv Jakobsen verantwortlich. Abgerundet wird das positive Gesamtbild der Inszenierung von passenden, teilweise wunderbar detailverliebten Projektionen, die meist dezent im Hintergrund eingesetzt werden. Unterstützung bekam Jakobsen in diesem Bereich von Marc Jungreithmeier.

Auch die Darsteller sind treffend besetzt, so überzeugt Richard McCowen mit eindrucksvoller Mimik als Reverend Shaw Moore und bringt auch seine Solo-Songs sehr emotional auf die Bühne. Jannik Harneit gibt einen temperamentvollen Ren McCormack, bei dem sowohl Tanz wie auch Gesang passen. Auch Sophie Mefan als Ariel Moore und Simon Stockinger als Willard Hewitt bleiben sicher noch länger in Erinnerung, stellvertretend für die gut zusammengestellt Cast, bei der jeder in seiner Rolle gefallen kann. Dargeboten wird in Chemnitz im Übrigen die deutsche Fassung von Hauke Jensen, bei der bis auf bekannte Songs wie „Footloose“, „Holding Out For A Hero“ oder „Almost Paradise“ die handlungstragenden Lieder gut ins Deutsche übersetzt erklingen. Die musikalische Leitung der achtköpfigen Band liegt bei Tom Bitterlich, hier ist die vergleichsweise kleine Besetzung zwar durchaus ausreichend, insbesondere „Footloose“ klingt stark aus dem Orchestergraben, an der ein oder anderen Stelle hätte man sich aber vielleicht noch etwas mehr Klangkraft gewünscht.

Dennoch kann man das Theater Chemnitz für diese Musicalproduktion nur beglückwünschen, denn mit einer solch stimmigen Inszenierung in Verbindung mit vielen talentierten jungen Darstellern ist es nicht verwunderlich, dass die besuchte Vorstellung komplett ausverkauft war, auch wenn die Zuschauer derzeit noch im „Schachbrett“ mit entsprechenden Abständen platziert werden. Auch nachdem die Saalbeleuchtung längst wieder eingeschaltet war, wollten die Zuschauer den Saal noch nicht verlassen, sondern forderten mit lautstarkem Applaus einen weiteren Auftritt der Darsteller, den die meisten dann auch nach einigen Minuten spontan folgten. Das dies so nicht geplant war, konnte man gut daran erkennen, dass einige Darsteller zu diesem Zeitpunkt schon in die Umkleide verschwunden waren und hier entsprechend fehlten. Zu sehen ist „Footloose“ noch bis zum 03. Oktober 2021 in Chemnitz, ein Besuch kann hier durchaus empfohlen werden.
Markus Lamers, 21.09.2021
Fotos: © Nasser Hashemi
Mit ionisierten Luftmolekülen gegen Corona
Die Oper Chemnitz eröffnet nach wichtigen Umbauten mit einer Operngala

Der Technische Direktor der Theater Chemnitz Raj Ullrich ist ein höchst kreativer Mann. Als für das Opernhaus Chemnitz im vergangenen Frühjahr dem Opernhaus ein Reinigungsschrank angeliefert worden war, in dem die empfindlichen Kostüme mittels eines ionisierten Luftstroms gereinigt werden sollten, hatte er eine Rückfrage beim Hersteller des Gerätes. Da zu dieser Zeit bereits absehbar war, dass Corona den Opernbetrieb erheblich einschränken werde, fragte Ullrich den Firmenchef Roland Krüger zunächst im Scherz, ob er nicht einen Schrank im Sortiment habe, in dem die gesamte Oper hineinpasse. Nach dem anfänglichen Gelächter kamen die Gesprächspartner ins Nachdenken. In der Folge entstand ein Konzept, wie man mit der Klimaanlage des Opernhauses negativ geladene Luftmoleküle im Zuschauerraum verteilen kann, die ihrerseits Viren, Bakterien, Gerüche und Feinstaubteilchen binden können. Die größere Masse der Moleküle lässt sie zu Boden sinken. Mit dem überschaubaren Aufwand von 30 000 € wurde die Anlage realisiert, mit der die teil-ionisierte Luft über die Rückenlehnen der 714 Besuchersessel in den Raum geblasen wird. Das führte zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität auf der Bühne, im Orchestergraben und im Zuschauerraum, so dass sogar Hustenreize bei den Besuchern unterbleiben. Vor allem hofft das Haus, dass die Sars-CoV-2-Konzentration in der Raumluft so niedrig bleibt, dass die Gefahr einer Corona-Ansteckung über Aerosole weitgehend ausgeschlossen ist.

Zunächst erlaubte das Hygienekonzept die Nutzung von 390 der 714 Plätze für die Neueroberung des Saales am 3. Oktober 2020, gleichsam der „vierten Neueröffnung“ des traditionsreichen Opernhauses Chemnitz. Am Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt zu entscheiden, ob man den Wunsch nach einem großen Museum oder nach einem neuen Opernhaus erfüllen wolle. Gebaut wurde in der 200 000 Einwohner-Industriestadt dann beides. Am 1. September 1909 wurde der Opernhaus-Neubau eröffnet. Im Jahre 1912 übernahm ein Anton Richard Tauber zunächst als Pächter und später als Intendant die Städtischen Bühnen. In seiner bis 1930 ausgedehnten Amtszeit ereignete sich eine Fülle bedeutender künstlerischer Ereignisse. Am Beginn seiner Amtszeit gab im Haus sein Sohn Richard sein Debüt als Tamino, bevor er nach einem Engagement an der Semperoper seine Weltkarriere startete. Bereits 1913, einem Jahr vor dem Ablauf der 30-jährigen Schutzfrist des Bühnenweihfestspiels s, inszenierte Anton Richard Tauber Wagners Parzifal, obwohl unsicher war, ob die Schutzfrist noch verlängert werde. Neben Wagner, Strauss, Mozart, Verdi und Bizet war Tauber stets um Neuaufführungen und hochrangige Gastkünstler bemüht. Dazu gehörten mehrfach Richard Strauss, Eugen d’Albert, Siegfried Wagner und Hans Pfitzner. Auch Gret Palucca und Mary Wigman gastierten und hinterließen Schüler, die dem Chemnitzer Ballettschaffen zu überregionalem Ansehen verhalfen. Im August 1944 musste nach der Proklamierung des „totalen Krieges“ das Haus schließen. Der junge Rudolf Kempe, der mit seiner beherrschten Arbeitsweise bekannte war, wirkte bereits als 1. Kapellmeister in Chemnitz.
Die massiven Bombenangriffe im Februar und März 1945 brachten dem Opernhaus schwere Beschädigungen. Vor allem brannte das Haus vollständig aus, so das Opern- und Konzertbetrieb auf fünf Ausweichspielstätten ausweichen mussten. Bereits am 16. Juni 1945 dirigierte der Generalmusikdirektor Kempe in der ersten künstlerischen Veranstaltung nach dem Kriegsende. Frühzeitig sammelten sich Musiker, Sänger, Schauspieler und Tänzer, so dass die Chemnitzer Theater als erste Bühne in der sowjetischen Besatzungszone einen regulären Spielbetrieb aufnehmen konnten.
Im Frühjahr 1946 begannen im Opernhaus Aufräumungsarbeiten. Der Neuausbau der erhaltenen Bausubstanz verbunden mit der Neugestaltung des Zuschauerraumes streckte sich bis zur Wiedereröffnung am 26. Mai 1951.Eine Vielzahl schöpferischer Theater- und Opernschaffende verschafften den Karl-Marx-Städter Bühnen den Ruf einer hervorragenden Kunstlandschaft. Über 30 Jahre prägte der Felsenstein-Schüler Carl Riha den Charakter der Oper Karl-Marx-Stadt. Von 1962 bis 1966 waren als Intendantin Christine Mielitz und als Oberspielleiter Harry Kupfer im Haus tätig.
Nachdem Gutachter erhebliche Mängel in der Statik der Bausubstanz des Gebäudes monierten und der technische Zustand nicht mehr einem modernen Opernhaus gerecht wurde, begannen 1985 die Planungen und 1988 die Auskernarbeiten. Als Interim-Spielstätte wurde der Luxor-Filmpalast mit genügend großem Orchester- und Bühnenraum ausgerüstet. Bis zum zweiten Halbjahr 1992 entstand in der denkmalgeschützten Hülle ein neues den modernen Ansprüchen entsprechendes Opernhaus.

Die „Städtischen Theater Chemnitz“ gGmbH sind weltweit eines der wenigen Fünfsparten- Bühnenunternehmen. Die Oper, die Robert-Schumann-Philharmonie und das Ballett teilen sich das Opernhaus. Die Philharmonie konzertiert auch in der Stadthalle und Schauspiel sowie Figurentheater haben eigene Spielstätten. Der Spielplan der Opernsparte zeichnet sich durch außergewöhnliche Vielfalt und dem Konzept, Neues schaffen und Vergessenes wieder erwecken, aus. Wagnisse werden nicht um ihrer selbst eingegangen und das Publikum des Hauses nicht als Experimentierobjekt missbraucht. In der merkbar angenehmen Atemluft erlebten Opernschaffende und das Chemnitzer Stammpublikum am 3. Oktober 2020 eine mit ihrer Leichtigkeit und Frische begeisternde Operngala. Abgesehen von den ersten beiden Reihen waren alle Zuschauerbereiche besetzt. Natürlich innerhalb der Reihen jeweils zwei freie Sitze zwischen Paaren, Einzelbesuchern und Familien. Bis zu vier Personen ohne Abstand waren auszumachen. Zwischen den Sängern und den je nach Stück 28 bis 35 Musikern des auf der Bühne agierenden Orchesters waren die Abstände diszipliniert eingehalten. Die engagiert spielenden Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie wurden abwechselnd vom routinierten Generalmusikdirektor der Theater Chemnitz Guillermo Garcia Calvo und dem noch lernenden, seit April 2020 engagierten Katalanen Diego Martin-Etxebarria dirigiert. Das vom Generalintendanten der Theater Chemnitz hochinformativ und kurzweilig moderierte Programm entsprach den Grundsätzen des Hauses: Populäres und weniger Bekanntes sinnvoll zu mischen ohne zu überfordern. Da war eine Demonstration, über welches Sängerinnen- und Sängerpotential Chemnitz verfügt. Magnus Piontek, seit 2016 im Solisten-Ensemble sang einen repräsentativen Gremin aus Tschaikowskis „Eugen Onegin“ und bestimmte weitgehend das Fidelio-Quartett mit seinem kraftvollen Bass. Mit zwei Kompositionen des Hausgottes Richard Wagner, der „Hallenarie“ aus Tannhäuser und „Wie muss ich doch beklagen“ aus des Meisters Jugendsünde „Die Feen“, erfreute mit ihrer wunderbaren Mittellage Maraike Schröter das Auditorium. Seit 2019 ist die aus Georgien stammende vielseitige russische Sängerin Tatiana Larina im Hausensemble beheimatet. Das „Ebben? Ni andrò Iontana“ aus Alfredo Catalanis Oper „La Wally“ bot sie bewundernswert zart, aber auch hochdramatisch. Aus der Zarzuela, eine spanische Spielart der Opéra comique, „El niño judio“ von Pablo Luna entwickelte Tatiana Larina ihr überschäumendes Temperament mit „ De España vengo“.

Als eine vielseitige Sängerin präsentierte sich die in Dresden ausgebildete und seit 2019 im Ensemble engagierte Marie Hänsel, wenn sie mit dem Haus-Bariton Andreas Beinhauer Mozarts „Reich mir die Hand, mein Leben“, mit Siyabonga Maqungo den Kusswalzer aus Luigi Arditis „Il bacio“ sang und auch beim Fidelio-Quartett ordentlich mithielt. Andreas Beinhauer, der uns mit seiner Schubert-Interpretation in Erinnerung bleiben wird, brillierte mit der Champagner-Arie aus dem Don Giovanni.
Der aus Südafrika stammenden Siyabonga Maqungo war in der Spielzeit 2018/19 zum Ensemble der Oper Chemnitz gekommen. Dem Vernehmen nach, holt ihn aber Daniel Barenboim nach Berlin, nachdem er dort mit dem Fidelio-Jaquino, wie auch in Chemnitz, gefallen hatte. Schiere Bewunderung beim Publikum erzeugte der Ensemble-Neuzugang Thomas Kiechle mit der Perlenfischer-Arie „Je crois entendre encore“ mit seinem hochkultivierten schönen Tenor. Die in Radebeul geborene Marlen Bieber aus dem neugegründeten Opernstudio lockerte die Stimmung mit einer naturalistischen Darbietung des Schwips Liedes aus Johann Strauß’ „Nacht in Venedig“ auf. Als Gast war Stéphanie Müther nach Chemnitz gekommen. Eigentlich hatte sie uns versprochen, in den Oster- und Pfingstzyklen der diesjährigen Ring-Aufführungen jeweils alle vier „Brünnhilden“ zu singen. So konnte sie uns in der Operngala mit der Szene der Elvira aus Guiseppe Verdis Oper „Ernani“ und im abschließendem Fidelio-Quartett ihr hervorragendes Können präsentieren.
Mit Beethovens Komposition wurde die „Wiedereroberung des Opernhaus-Saales“ abgeschlossen. Selbst der außergewöhnlich lange Beifall konnte das Ensemble nicht zu einer Zugabe bewegen.
Mit seiner Operngala hat das Opernhaus Chemnitz seinen Ruf als sichere Stütze im Prozess der erfolgreichen Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 gefestigt.
Bilder (c) Nasser Hashemi / Dieter Waschanski (Zuschauerraum)
Thomas Thielemann, 6.10.2020
LOHENGRIN
Premiere 25. Januar 2020
Mit Lohengrin auf dem Rummelplatz
Nach der Fertigstellung der Partitur des „Tannhäuser“ reiste der Königlich Sächsische Hofkapellmeister Richard Wagner mit Frau Minna, Hund und Kanarienvogel am 3. Juli 1845 von Dresden zu einem Kuraufenthalt ins Böhmische nach Marienbad. Kreative Unruhe behinderten die Bäder sowie Brunnenkuren und brachte frühere noch ruhende Projekte zur Geltung. Ein noch unklares Konzept zum Schwanenritter-Motiv des Wolframs von Eschenbach geisterte seit dem Pariser Aufenthalt in seinem Kopf. So begann er, parallel zur Arbeit an einem Meistersinger-Spektakel, die Prosafassung der Lohengrin-Szenen auszuführen. Ohne Rücksicht auf historische Gegebenheiten verschob er Figuren sowie Fürstentümer in Zeit und Raum, bis er „die Berührung einer übersinnlichen Erscheinung mit der menschlichen Natur und die Unmöglichkeit einer Dauer derselben“ wirkungsvoll gestaltet hatte.

Nach Dresden zurückgekehrt, las er am17. November 1845 im Restaurant „Engel“ den Mitgliedern des Montagsklubs, dem u.a. auch Robert Schumann, Adam Hiller und Gottfried Semper angehörten, die Dichtung vor. Bei allem Lob der Freunde für die Dichtung, bezweifelte aber vor allem Schumann, dass Wagner zum Text eine Musik komponieren könne. Wagner aber, gewohnt auf seine Inspirationen zu warten, nutzte einen Urlaubsaufenthalt vom 15. Mai bis zum 30. Juli 1846 im Schäfer´schen Gut des Dorfes Graupa, um die Umrisse der Kompositionsskizze niederzuschreiben. Wagner wanderte oft in der Umgebung, schwamm in der Elbe und ließ sich vom Vogelgezwitscher sowie anderen Geräuschen seiner Umgebung inspirieren.
Das Dorf Graupa ist inzwischen ein Ortsteil von Pirna. Im Schloss von Graupa befindet sich eine sehenswerte Wagnergedenkstätte mit einem interessanten Museum. Das Gut steht dem interessierten Wagner-Freund offen. Auch befindet sich im nahen Liebethaler Grund, einem der damaligen Wanderziele des Komponisten, ein Wagner-Denkmal mit einer Höhe von 12,5 Meter.

Das Auskomponieren des Werkes wurde mehrfach unterbrochen, denn Wagner war kein Eilfertigkeitsapostel. Weil ihn andere Projekte ablenkten, aber auch die Tagesaufgaben als Hofkapellmeister forderten und er sich zunehmend auch politisch betätigte, zog sich die Arbeit lange hin. Somit konnte er erst am 28. April 1848 die Niederschrift der Lohengrin-Partitur abschließen. Seit wir am 19. Mai 2016 in der Semperoper die legendäre Lohengrin-Aufführung in der fast konservativen Mielitz-Inszenierung von 1983 mit Georg Zeppenfeld, Anna Netrebko, Piotr Beczala, Evelyn Herlitzius, Tomasz Konieczny, der Sächsischen Staatskapelle unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann erleben durften, besuchen wir jede Vorstellung der von uns sehr geliebten Wagner-Oper mit etwas gemischten Gefühlen. Dieses, mein Problem konnte auch die musikalisch hervorragende Bayreuther Lohengrin-Premiere am 25. Juli 2018 nicht kompensieren. Auf der Drehbühne des Chemnitzer Opernhauses war von Sebastian Ellrich und seinen Handwerkern dem Regieteam von Joan Anton Rechi eine gewaltige Achterbahn aufgebaut worden. Rechi, 1968 im Fürstentum Andorra geboren arbeitet seit 2011 mit dem aus Magdeburg stammenden Ellrich (Jahrgang 1984) zusammen.

Nun war Richard Wagner ohnehin nicht pingelig, wenn es um die Verschiebung historischer Gegebenheiten in Zeit und Raum ging. Und so muss er sich gefallen lassen, dass die Dramaturgin Carla Neppl seine Texte und seine Musik nutzt, um die sozialen und zwischenmenschlichen Probleme eines ansonsten wenig beachteten Kokons der Rummelplatzbetreiber zu thematisieren, damit aber auch gleichzeitig zu verallgemeinern. Das Theater Chemnitz bildete aus seinen Opernchören, einem Kinderchor und Gastsängern weiterer Chöre sowie der Statisterie eine beeindruckende Menschengruppe gebildet. Die Kostümbildnerin Mercè Paloma hatte die Gruppe mit Kleidung aus allen Bevölkerungsschichten ausgestattet. Mit ausgezeichnetem Gesang und guten darstellerischen Leistungen übernahm die Gruppe eine tragende Rolle in den ersten beiden Aufzügen. Nach ihrer Klassenzugehörigkeit agierten sie mit den Solisten und machten den ersten Akt mit dem sich ständig bewegenden Achterbahn-Vehikel zu einem kurzweiligen Spektakel. Besonders gefiel mir, dass beim Gottesgerichts-Streit der Kampfplatz weggedreht war und man Chormitglieder vom Gerüst, gleichsam wie beim Fußball des Chemnitzer SC, die Kämpfer anfeuerten. Spielstätte des zweiten Aktes war die Unterkunft der Betreiber der Rummelplatzattraktionen. Die Aktionen passten aber über weite Strecken in herkömmliche Inszenierungen, auch wenn die Liegestützaktionen und die Weitergabe eines Befehls des Königs per Smartphone konservative Besucher irritierten. Das löste sich erst auf, als der Schwan wieder auf der Bühne erschien und Telramund vier depressive Rentner von einer Gartenbank aufjagte. Diese vier „Edlen von Brabant“ teilten den Chor in aktive Pro- und Contra-Gruppen, die ihrerseits die Handlung vorantrieben.

Der dritte Aufzug bot trotz interessanter Personenführung wenig Neues. Erst als klar war, dass Ortruds Fluch eine Rückkehr des Bruders der Elsa ausschloss, wurde die Inszenierung richtig zeitgemäß: Lohengrin überreichte seiner Gattin die Macht-Insignien Brabants und ernannte sie zum Herzog. Die Achtung vor Wagners Text ließ leider die aktuelle Sprachgestaltun „zur Herzogin“ nicht zu. Das musikalische Gerüst des Abends lieferte die „Robert-Schumann-Philharmonie“ mit der musikalischen Leitung des bekennenden Wagnerianer Guillermo Garcia Calvo. Dabei erwies sich Calvo als zuverlässiger Partner des Regiekonzepts Rechis. Calvo ließ sich Zeit, jagte weder seine Musiker noch die Sänger durch die Partitur, baute damit aber durchaus auch Spannungen auf, leitete aber nicht immer sängerfreundlich. Neben einer guten Orchesterleistung der Robert-Schumann-Philharmonie begeisterten hörenswerte Gesangsleitungen mit ordentlichen Textverständlichkeiten.Den Lohengrin verkörperte Mirko Roschkowski als einen ziemlich kalten, unsensiblen und weltlichen Partner der Elsa von Cornelia Ptassek. Stimmlich gut ausgestattet, besticht seine Bühnenpräsenz. Aber egal, wie sich Elsa verzweifelt mühte, er gab ihr keinen Halt. Mit Cornelia Ptassek stand Rechi mit ihrem klangschön, kraftvoll geführtem Sopran eine ordentliche Elsa von Brabant zur Verfügung. Mädchenhaft, opulent bühnenpräsent und stolz agierte sie in den ersten beiden Akten. Ebenso überzeugend entwickelte sich ihre Verzweiflung zum Ende des dritten Aktes hin. Aber so sehr ich die Charaktere von Elsa und Lohengrin liebe, meine Lieblingscharaktere der Oper bleiben deren Antagonisten Ortrud und Telramund. Stéphanie Müther, am Haus als Brünnhilde bereits bestens eingeführt, war mit ihrem wilden Hass in jeder Geste und einer Stimme, die Zähne zeigte, eine schreckliche Gegnerin. Mit ihren ersten leisen Tönen im ersten Akt wird bereits deutlich, dass sie Elsa mit ihrem naiven Glauben keine Chance auf ein glänzendes Heldentum lässt. Mit ihrem finalen sich selbst entlarvenden Wutausbruch schuf sie vielleicht den sängerischen Höhepunkt des Abends.

Da war der Telramund des Tschechischen Baritons Martin Bárta mit seiner noblen Stimme doch deutlich zurückhaltender, eher menschlich, aber von der Ortrud abhängig. Mit seiner ehrfurchtsvollen Auftrittsarie zurückhaltend lyrisch, beweist er, dass die Stimme in den Mittellagen durchaus zu umfangreichen Ausbrüchen fähig ist, so dass er den Ausfällen der Ortrud standhalten konnte. Warum er beim Schluss-Beifall so wenig bedacht worden war, hat sich mir nicht erschlossen. Die der Wagner-Figur des König Heinrich zugedachten Episoden waren vom Haus-Bass Magnus Piontek mit ordentlicher Bühnenpräsenz und gut dosiertem Gesang geboten. Ebenso gut präsentierte sich Andreas Beinhauer als Heerrufer. Auch die vier als brabantische Edle ausgeschrieben Rollen waren mit dem kristallklaren Tenor Florian Sivers, dem leichten Haus-Tenor Till von Orlowski, dem zupackend profund dem Bass André Eckert und leichteren Bass Tommaso Randazzo recht opulent besetzt.
Ordentliche Ovationen und die unvermeidlichen vereinzelten Buhrufe feierten Regieteam und die Bühnenbesatzung. Damit wird die Rechi-Inszenierung ihren Platz im interessanten Repertoire der Oper Chemnitz einnehmen.
Bilder (c) Nasser Hashemi
Thomas Thielemann, 27.1.2020
DIE WINTERREISE
Premiere am 6. 09. 2019
Beeindruckende Ballettpremiere
Die Ballettsparte der Theater Chemnitz eröffnete ihre Saison am 6. September 2019 mit der Uraufführung des Tanzstücks „Winterreise“ zur Musik des gleichnamigen Liederzyklus op., D 911 von Franz Schubert.
Die Choreografie und Inszenierung hatte der hochkreative künstlerische Leiter des Teatr Wielki Poznan Robert Bondara übernommen.

Über lange Zeit galt die „Winterreise“ als ein Werk für den altbackenen Konzertsaal zur Ergötzung älterer Besucher über die schönen blumigen alten Zeiten. Aber der Dichter der Verse Johann Ludwig Wilhelm Müller (geboren am 7. Oktober 1794 in Dessau und verstorben am 1. Oktober 1827 ebenda) war ein hochpolitischer Mensch gewesen. Als Student meldete er sich 1813 als Freiwilliger zum preußischen Heer und nahm als Leutnant an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil. Er war Freimaurer der Leipziger Loge „Minerva zu den drei Palmen“, verkehrte als Student in den Berliner literarischen Salons und engagierte sich von Lord Byron beeinflusst im Unabhängigkeitskampf der Griechen gegen die türkische Besatzung.
Neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer und späterer „Herzoglicher Bibliothekar“ in Dessau war er Herausgeber und Redakteur der in vielen Teilen des deutschsprachlichen Raumes verbotenen „Brockhaus-Bibliothek deutscher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts“. Durch seine gesellschaftskritischen, ob der Umgehung der Zensur häufig verbrämten Volkslieder, wurde er bekannt, galt aber als mittelmäßiger Autor der Romantik. Wegen der Eingängigkeit seiner Verse wurden diese mehrfach, unter anderem auch von Franz Schubert (geboren am 31. Januar 1797 bei Wien und verstorben am 19. November 1828 im heutigen Wien), vertont.

Die Gedichte in Wilhelm Müllers „Winterreise“ sind offenbar von zeitgenössischen Umständen und kaum aus autobiografischen Einflüssen in den Jahren 1822 bis 1824 entstanden. Obzwar Zeitgenossen, haben Müller und Schubert sich nie getroffen, und eine ihrer wesentlichen Gemeinsamkeiten war, dass beide bereits am Anfang ihres dreißigsten Lebensjahrzehnts verstorben sind. Während Müller der solide Familienvater war, sagt man dem genialen, aber labilen Schubert nach, dass er viel mit sich selbst zu tun hatte. Auch heißt es, dass er seine bescheidenen Geldeinnahmen für Abende im Freundeskreis in den Altwiener Gasthäusern ausgab. Aber der Umstand, dass Franz Schuberts Freundeskreis vor allem von Dissidenten gebildet war und er Müllers im Österreich Metternichs verbotenen Texte aufspürte und nutzte, beweist seine Distanz zum herrschenden System. Seine exponierte Begabung machte ihn mit gezielt subtiler Kritik zum wichtigen Sprachrohr der Wiener oppositionellen Intellektuellen.
Schubert sei, als er im Februar 1827 die ersten zwölf Lieder komponierte, mürrisch und verschlossen gewesen. Erst im Spätsommer fand er die übrigen zwölf Verse und beendete die Arbeit im Oktober. Die Komposition orientiert sich an dem immer wiederkehrenden Klang der Drehleier, einem vom Rad gestrichenem Saiteninstrument.

Der Titel stammt wahrscheinlich von dem Wiener Musikverleger Tobias Haslinger. Ein durchgehender Handlungsstrang ist nicht erkennbar. Die Eindrücke des jungen Wanderers wechseln zwischen überschwänglicher Freude und hoffnungsloser Verzweiflung. Es wird vermutet, dass Schubert bewusst und gezielt Kritik am Herrschaftssystem übte und der Winter als Metapher der reaktionären Restauration unter dem Kanzler Metternich diente. Die Lieder „Im Dorfe“ (Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten) und „Hoffnung“ (Hie und da ist an den Bäumen manches bunte Blatt zu sehen) spricht für diese Interpretation. Auch dass der Zyklus mit dem „Leiermann“, dem Treffen des Wanderers mit dem frierenden Leiermann endet, lässt eine hoffnungslose Todessehnsucht vermuten.
Während bei den Texten Wilhelm Müllers neben den volkstümlich-romantischen Motiven vor allem die Kritik am politischen System betont waren, richtete Bondara die Blicke auf die derzeitige Gesellschaft. Die Chemnitzer Choreografie und Inszenierung des polnischen Gastes konzentriert sich auf die Suche des Wanderers nach der eigenen Person und auf Begegnungen mit Schatten seiner Vergangenheit. Dieser klaren Ästhetik ist auch die musikalische Gestaltung untergeordnet.
Begleitet von der aus Polen stammenden Pianistin der Robert-Schumann-Philharmonie Anna Beinhauer singt mit ausdrucksvollem, warm timbrierten Bariton Andreas Beinhauer vom Chemnitzer Ensemble die Schubertlieder. Mit der Kondition eines gestandenen Opernsängers bietet er die vierundzwanzig Lieder, abweichend vom üblichen Liedgesang, ohne Pause. Dabei bringt er sich als „der Wanderer“ aktiv in das Bühnengeschehen ein- eine beeindruckende Leistung.

Dazu hat Robert Bondara eindrucksvolle Tanzbilder über Verluste von Individualität, fehlenden gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gewalt, Mobbing und Vereinsamung sowie einer unerfüllten Liebe geschaffen. Die Tänzerinnen und Tänzer des Chemnitzer Ballett-Ensembles bringen den unaufhörlichen Wechsel von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Vergebung und Zorn sowie zehrende Einsamkeit und Reste menschlicher Wärme mit hohem tänzerischem Können auf die Bühne. Wie beim musikalischen Vorbild wurde auch in der Ballettinszenierung auf einen eventuell möglichen Handlungsfaden verzichtet.
Der Hamburger Hans Winkler hatte ein Bühnenbild geschaffen und Kostüme gestaltet, die eine winterliche Situation, eigentlich fast eine arktische Welt assoziieren, so dass die Stimmung der Einsamkeit in ewiger Kälte auf das Publikum im Saal überging.
Mit Annas differenzierter Klavierbegleitung und Andreas sängerisch-schauspielerischen Leistung prägte aber letztlich das Ehepaar Beinhauer den Erfolg der Aufführung. Für einen nicht unwesentlichen Anteil des Publikums hatte allerdings die Leistung der in Chemnitz populären Ballett-Kompanie den Vorrang. So die Diskussionen bei der Premierenfeier.
Diese differenzierte Auffassung schränkte aber den langen und stürmischen teils stehenden Beifall für Robert Bondara und sein Team nicht ein.
Thomas Thielemann 8.9.2019
Bilder (c) Nasser Hashemi
GÖTTERDÄMMERUNG
Premiere: 1.12. 2018. Besuchte Vorstellung: 10.6. 2019
Und wieder müssen es die Frauen richten…
Elisabeth Stöppler, von der ich einen problematischen Guillaume Tell und einen amüsanten Mozart-Salieri-Rimsky-Korsakow-Abend gesehen habe, versteht sich auf Frauenthemen. Im Nürnberger „Tell“ war mit Leila Pfister eine Madame Schweiz zu sehen, in Berlin Angela Winkler als Beuys-Hirte und eine Geigerin als Einstein. Nun, am Ende einer Götterdämmerung, in der, wie die Regisseurin ganz richtig feststellte, bei Wagner alle Mütter fehlen, sehen wir auf sie, weil wir sie, wenn wir denn wollen, zumindest hören: auf Erda, auch auf Brünnhilde, auf die Rheintöchter und auf eine Norn. Selbst Gutrune darf sich, in respektvoller Entfernung, zum Frauenbund gesellen, über den sich Wagners Welterlösungs- und Liebesmusik zärtlich wölbt: die „Melodie des rettenden Lebens“, wie Wagners Urenkelin Nike einst schrieb. Was für ein Schluss-Bild! Zugegeben: dies war nicht die erste Erda, die am Ende einer „Götterdämmerungs“-Inszenierung auftrat, aber frau muss ja nicht das Wagnersche Weltenrad neu erfinden. Sie muss „nur“ die richtigen Impulse geben, um einen Abend zu garantieren, der zuende schlichtweg ergreifend ist: dies nicht durch „Regieeinfälle“, sondern, durch hochmusikalische Interpretationen der im besten Sinne fatalen Szenen.
Man hat also schon schrecklichere „Ring“-Schlüsse gesehen.

Man hat auch schon dümmere, dramatisch plattere, wesentlich spannungslosere „Götterdämmerungen“ als diese erlebt. Der Tipp der Freundin, derzufolge diese „Götterdämmerung“ szenisch an Chéreaus Version des Schlussstücks der Tetralogie heranreiche (hört hört!), war goldrichtig – denn von Akt zu Akt wurde das Geschehen bannender, um nicht zu sagen: konsequenter und zugleich herzzerreißender. Um nur ein paar Markierungen zu nennen: die Nornen wesen im arktischen Eis vor sich hin und halten das Wissen um die Welt nur noch durch Plastiktütensniffen aus. Aus Siegfried, dem unbefangenen Liebsten der Brünnhilde, wird ein nervös vor sich hin stromernder Junkie, immer auf dem Glatteis zwischen Schluck und Schluck. Hagen ist ein Getriebener, kein einschichtig „Böser“, wenn auch böse in seiner Vernichtungssucht. Waltraute predigt ihrer Schwester vergeblich, am Ende kniend das Schicksal der Götter – und Brünnhilde, die von all dem nichts wissen will, bricht plötzlich, als von ihrem Vater die Rede ist, in ein Schluchzen aus, das klüger und beklemmender ist als ihre gesamte Abwehr. Siegfried und Gunther treten wie in einem romantischen Horror-Roman (Wagner liebte E. T. A. Hoffmann) als Doppelgänger in arktischer Schutzkleidung auf, die Frau schrecklich entwürdigend.
Nach dem ersten Akt herrschte im Zuschauerraum mindestens sechs Sekunden Schweigen. Sechs Sekunden!

Der gesamte zweite Akt bot ab dem Auftritt Brünnhildes, dank des äußerst intensiven Spiels und des hohen vokalen Einsatzes aller Gegner, eine nervenzerreissende Spannung: zuerst Siegfried als irre vor sich hin äugelnder und über die Bühne irrlichternder Drogie und Brünnhilde als starke, beleidigte Frau. Was für ein Krimi! Und schließlich der inkommensurable dritte Akt. Nach der hervorragenden, weil ausnahmsweise nicht aufs Schema Siegfried-trifft-Nutten reduzierten Rheintöchterszene wurde es noch einmal richtig spannend: Siegfried, den Tod schon vor Augen, inmitten einer gefährlichen Gesellschaft um sein Leben erzählend. Schier unglaublich: der Trauermarsch. Siegfried singt Brünnhilde, die Frau mit den geschlossenen Augen, an, er glaubt sie und sich wieder wie in alten Zeiten, also gerettet vor dem Albtraum der Gibichungen (und der Zuschauer hofft, obwohl er es besser weiß, dass nun alles alles gut werden könnte), doch schnell begreifen wir: Sie ist die Walküre geblieben, die Todverkünderin, und als Siegfried begreift, nun wird er wirklich sterben, nun wird er gewaschen und muss sich zu den Toten legen, die da schon liegen, und als es Siegfried endlich begreift, dieses verlorene kleine Leben und sein Ende, bricht er in ein Weinen aus, das auf die Musik zurück und in uns hineinwirkt.
Wie nennt der Kritiker so etwas? Unbegreiflich.

Der Rest ist nicht Schweigen, sondern, wie gesagt, konsequent. Hagen erschießt Gunther, Gutrune erschießt Hagen und erstarrt vor den in die Halle hineingefressenen Trümmern des eisigen Walkürefelsens in einem langen, langen Schmerz. Hagen wäre sowieso nicht an den Ring gekommen, denn den hat Brünnhilde schon nach der Totenwaschung an sich genommen, und Brünnhilde singt ihre letzten 20 Minuten in einem irrealen leeren Raum, in den es hinabschneit, und der dem Auge, zumindest von der 5. Parkettreihe aus, den täuschenden Eindruck macht, als würde sie unaufhörlich in die Höhe fahren, bevor sich die Frauen in einem milden, vom Feuer sanft beleuchteten Abendrot wiedervereinen. Brennen tut nur, von Brünnhilde angezündet, Grane, der Schlitten, die Erinnerung an eine Heimat, in der, wie Ernst Bloch so schön sagte, noch nie jemand war: der Kindheit. Jung-Siegfried aber ist schon lange tot.

Was, liebe Leserin und lieber Leser, Ihnen wie eine willkürliche, typisch „regietheaterhafte“ Verunstaltung des Meisterwerks klingen mag, war, so meine ich, in Wirklichkeit ein Abend, der nicht Oper, sondern pures Musik-Theater war. In diesem Theater darf auch der Scherz erlaubt sein, aus Grane einen Kinderschlitten zu machen, weil er noch im Finale mit einer Bedeutung aufgeladen wird, die über einen „Regieeinfall“, also Mätzchen, weit hinaus geht. Würde man die Begeisterung des Publikums für diesen szenisch hochspannenden und vokal packenden Abend als Gradmesser nehmen, so müsste man sagen, dass die szenische Interpretation des Werks das Richtige getroffen hat: bei aller Freiheit gegenüber Wagners Regieanweisungen, in denen weder von der Arktis (der bedrohten!) noch von einem drogenkranken „Helden“ die Rede ist. Wo aber der musikalische Gestus mit der Szene übereinstimmt (gewiss: das mag subjektiv sein), stimmt auch die Inszenierung – so wie hier: im eisigen Reich der verzweifelten Nornen wie am Hof der verbrecherischen, schwächlichen Gibichungen oder der geopferten Gibichungin.
 Und die Hauptsache, die Musik? Zugegeben: Daniel Kirch singt einen relativ dunklen Tenor, trifft am Abend auch nicht jeden Ton, aber nach dem vorgestrigen „Siegfried“ wundert man sich eh über seinen ungeheuren vokalen und szenischen Einsatz. Auch eine Erstaunlichkeit: Stéphanie Müther vermag noch im Finale zu gestalten und in den höchsten Exaltationen der Brünnhilde schön zu singen – ganz abgesehen vom Drama, das sie mit Vehemenz und Subtilität herausspielt. Ich denke nur an ihr Mienenspiel beim Beschluss, ihren treulosen Geliebten zu ermorden. Kirch und Müther sind ein Traumpaar dieses „Ring“: mit einem Zusammenspiel, das auf „Ring“-Bühnen so intensiv und verflochten eher selten zu sehen ist. Die Gutrune der Cornelia Ptassek gehört zu den weiteren Glanzpunkten dieses Abends. Gesegnet mit einer leichten Schärfe, unterstützt ihre Stimme die ein wenig kühle und doch empfindsame Aura dieser betrogenen und szenisch zurecht zur Hauptfigur aufgewerteten Frau, die sich gleich Gunther in der neusachlichen Gibichungenhalle vom ewigen Barkeeper Hagen benebeln lässt (ich kann mich an keine „Götterdämmerung“ erinnern, in der so viel ausgeschenkt wurde…). Ptassek gehört auch zu den Nornen, einem Dreamteam eines Terzetts, für das das Wort „homogen“ erfunden wurde: Anja Schlosser, Sylvia Rena Ziegler und Cornelia Ptassek. Von gleicher Qualität: die Rheintöchter Yang, Ziegler und Sophia Maeno, drei Rheinfrauen, gewandet in Kleider (entworfen von Gesine Völlm) aus Flusstang, drei Wesen zwischen deformierter Natur und halber Kultur. Waltraute ist die phänomenale Anne Schuldt, Alberich der an diesem Abend erstaunlich hoch und dramatisch genau singende Jukka Rasilainen, Marius Bolos sein nicht allzu basslastig, doch dunkel genug dräuender Albensohn und Pierre-Yves Pruvot ein meist seine Stimmorgane pressender, doch angemessen verzweifelter Gunther auf seelischen Hochtouren. Völlig unabhängig also davon, wie hell oder dunkel oder pressend hier gesungen wurde: die Sänger/Schauspieler einte Eines - der Wille zum packenden Musikdrama.
Und die Hauptsache, die Musik? Zugegeben: Daniel Kirch singt einen relativ dunklen Tenor, trifft am Abend auch nicht jeden Ton, aber nach dem vorgestrigen „Siegfried“ wundert man sich eh über seinen ungeheuren vokalen und szenischen Einsatz. Auch eine Erstaunlichkeit: Stéphanie Müther vermag noch im Finale zu gestalten und in den höchsten Exaltationen der Brünnhilde schön zu singen – ganz abgesehen vom Drama, das sie mit Vehemenz und Subtilität herausspielt. Ich denke nur an ihr Mienenspiel beim Beschluss, ihren treulosen Geliebten zu ermorden. Kirch und Müther sind ein Traumpaar dieses „Ring“: mit einem Zusammenspiel, das auf „Ring“-Bühnen so intensiv und verflochten eher selten zu sehen ist. Die Gutrune der Cornelia Ptassek gehört zu den weiteren Glanzpunkten dieses Abends. Gesegnet mit einer leichten Schärfe, unterstützt ihre Stimme die ein wenig kühle und doch empfindsame Aura dieser betrogenen und szenisch zurecht zur Hauptfigur aufgewerteten Frau, die sich gleich Gunther in der neusachlichen Gibichungenhalle vom ewigen Barkeeper Hagen benebeln lässt (ich kann mich an keine „Götterdämmerung“ erinnern, in der so viel ausgeschenkt wurde…). Ptassek gehört auch zu den Nornen, einem Dreamteam eines Terzetts, für das das Wort „homogen“ erfunden wurde: Anja Schlosser, Sylvia Rena Ziegler und Cornelia Ptassek. Von gleicher Qualität: die Rheintöchter Yang, Ziegler und Sophia Maeno, drei Rheinfrauen, gewandet in Kleider (entworfen von Gesine Völlm) aus Flusstang, drei Wesen zwischen deformierter Natur und halber Kultur. Waltraute ist die phänomenale Anne Schuldt, Alberich der an diesem Abend erstaunlich hoch und dramatisch genau singende Jukka Rasilainen, Marius Bolos sein nicht allzu basslastig, doch dunkel genug dräuender Albensohn und Pierre-Yves Pruvot ein meist seine Stimmorgane pressender, doch angemessen verzweifelter Gunther auf seelischen Hochtouren. Völlig unabhängig also davon, wie hell oder dunkel oder pressend hier gesungen wurde: die Sänger/Schauspieler einte Eines - der Wille zum packenden Musikdrama.
Bleibt der kleine gute Chor von nur elf Mann und einigen Frauen (unter Stefan Bilz); bleibt die Robert-Schumann-Philharmonie, die unter dem die dramatische Akzente mit Glut betonenden Guillermo García Calvo leider unter dem Niveau blieb, das die Bühne vorgab. Allzu viele unüberhörbare Patzer zumal im Blech, etliche Verfolgungsjagden zwischen Bühne und Orchestergraben kündeten davon, dass die Musiker für die „Ring“-Aufführungen der letzten Tage und das warme Wetter einen Tribut zahlen mussten, den man bedauern mag. Merke: Wenn Hörner im „Ring“ patzen, liegt's vielleicht auch daran, dass sie durchschnittlich jeden zweiten Takt spielen müssen... Das Wesentliche dieser exzeptionellen „Götterdämmerung“ wurde dadurch jedoch nicht berührt. Mit der Interpretation des Ensembles, das sich sein Material aus der Musik holte, um mit starken Bildern und schauspielerisch wohl durchdachten Charakterzeichnungen Wagners Drama zwischen Gestern, Heute und Morgen zu spielen, hat das Theater Chemnitz der Tetralogie den Glanzpunkt aufgesetzt, was äußerst heftigen Beifall, auch für das Orchester (und nicht ganz zu Unrecht, denn „Götterdämmerung“ ist bekanntlich Schwerstarbeit) nach sich zog.
Frank Piontek, 11.6. 2019
Fotos © Kirsten Nijhof und Nasser Hashemi
SIEGFRIED
Premiere 29. September 2018
Besuchte Vorstellung 8. Juni 2019
Was wollte die Regie wirklich zeigen?
Die gravierende Fehlbesetzung der Titelrolle des Siegfrieds im Oster-Ring der Oper Chemnitz war für mich Veranlassung , den „Siegfried“ des Pfingst-Ringes mit dem Sänger-Darsteller der Premierenrunde Daniel Kirch zu besuchen. Außerdem waren noch Unklarheiten geblieben, was die Frau Hartmannshenn dem arglosen Opernbesucher vermitteln wollte, obwohl die in meiner Rezension bereits erwähnten drei Verbrechen von Männerdarstellern an Frauen schon die Richtung der gewünschten Aussage andeutete.

Aber erst die phänomenale schauspielerische Leistung des Daniel Kirch, die seine geringfügigen sängerischen Rest-Defizite vergessen lässt, führt zum Kern der Inszenierung. Mit fünf Männern konfrontiert uns Richard Wagner, die von der Regie charakterisiert werden müssten: Der Riese Fafner ist bereits im Rheingold als Brudermörder ob seiner Habgier denunziert. Der Zwerg Mime schneidet brutal den Siegfried-Fötus aus Sieglinde und lässt sie verbluten, nur um sich ein Werkzeug zu schaffen, das seine körperlichen Defizite kompensieren soll. Sein Bruder Alberich vergewaltigt eine gesichts- und willenslose Nibelungensklavin, um dem Knaben Hagen die angestrebten Machtverhältnisse zu demonstrieren. Der junge Hagen begreift und tritt nach. Warum der Wanderer, also eigentlich ein Gott, wenn auch auf Abruf, den Waldvogel umbringt, erläutert die Inszenierung nicht so richtig. Ist dem Gott ihre Informationsfreudigkeit und ihr Warnen ein Dorn im Restauge geworden?

Bleibt Siegfried: er ist bereits von Wagner am Beginn als kindlich und naiv angelegt. Aber die Spielfreude des Daniel Kirch, wahrscheinlich von der Sabine Hartmannshenn noch angefeuert, stellt ihn uns kindisch bis zu den Schluss-Szenen vor. Er beherrscht die Bühne, ohne dabei auch nur die geringste Entwicklung zu zeigen. In meiner Rezension hatte ich der Regie mangelhafte Personenführung bescheinigt. Das war aber am Ostersamstag der Notwendigkeit geschuldet, dass der musikalische Leiter alle Mühe hatte, den armen Ersatz-Siegfried über den Spätnachmittag zu bringen und ihn deshalb häufiger an die Rampe holte. Kirch hat uns bewiesen, dass seine Spielfreude Mittel zum Zweck war. Siegfried blieb ein Kindskopf bis er in die Fänge der Brünnhilde geriet.
Das Fazit der Inszenierung ist, alle Männer sind Verbrecher oder naive Kindsköpfe, es sei denn sie werden von einer starken Frau gelenkt und geleitet.

Dabei will ich nicht verschweigen, dass ich Frau Hartmannshenn für eine begabte Regisseurin halte. Wie sie die Oper mit diesem einen Bühnenbild, das eigentlich nur im Bereich des Feuerzaubers abgewandelt ist, ausfüllt, ist schon des Bemerkens wert. Einige Szenendetails, wie die Tafelei des Wanderers mit Mime mit dem abrupten Abbruch und die Drachenszene mit der Statisterie zeugen schon von hoher Kreativität.
Gesungen wurde in der Aufführung recht ordentlich. Arnold Bezuyen fand ich besser als am Ostersamstag. Prachtvoll wieder Jukka Rasilainen, Magnus Piontek und vor allen Guibee Yang und Stéphanie Müther. In Ordnung auch der Wanderer von Ralf Lukas und die Erda von Nadine Weismann.
Die Abendleistung des Orchesters zu beurteilen fällt mir schwer, weil ich noch andere Aufführungen im Ohr habe, fand aber, dass Guillermo Garcia Calvo mit den Blechbläsern recht üppig um sich warf und über weite Strecken das Feuer eines Richard Wagner vermissen ließ.

Um es abzuschließen, die Konzeptionen der Damen Hatmannshenn und Stöppler haben mein Frauenbild zumindest beschädigt.
Bilder (c) Nasser_Hashem
Thomas Thielemann 10.6.2019
FIDELIO
Besuchte Vorstellung am 29. Mai. 2019 (Premiere: 25. Mai 2019)
Eine Inszenierung zum Nachdenken
Die Oper Chemnitz hatte zur zweiten Aufführung ihrer leider wenig beachteten klugen und sensiblen Fidelio-Inszenierung eingeladen, um das desaströse Bild der Stadt in den Medien etwas gerade zu rücken. Eventuell wollte das Haus einen Beitrag zur Deutung des Wahlverhaltens vieler Sachsen am letzten Wochenende leisten.
In einer beliebigen Bananenrepublik unserer Tage ist das Mitglied der Oberklasse Florestan verschwunden. Seine Ehefrau Leonore nutzt skrupellos alle Möglichkeiten, um ihren Mann aufzuspüren und der Gesellschaft zurückzugeben. Da ist für sie auch legitim, in der Verkleidung als Fidelio die Treuherzigkeit des Gefangenenwärters Rocco zu missbrauchen, seine Tochter Marzelline verliebt zu machen und sogar eine Eheschließung vorzubereiten.

Soweit wirkt die Inszenierung von Robert Lehmeier mit ihrer guten Personenführung fast konventionell. Den ersten Akt mit der Vorbereitung einer Grillparty zu verbinden, bis dann die robusten Personenschützer des Pizarro die Bühne übernehmen, ist nicht besonders originell. Aber dass Lehmeier die Geschichte aus der Sicht Marzellines erzählen lässt, fand ich als Zuhörer angenehm. Denn die oft von Sängern gestammelten Rezitative und Dialoge zwischen den Musiknummern waren gestrichen. Stattdessen wurden die Reflexionen der jungen Frau von der guten Schauspielerinnenstimme Christine Gabsch aus dem “Off“ (so die nette Mitarbeiterin im die Einführungsvortrag) eingesprochen.
Lehmeiers Inszenierung schien sich damit auf die eigentlichen Verlierer des Geschehens, nämlich Marzelline, Rocco und Jaquino zu bewegen, als die Robert-Schumann-Philharmonie unter der beeindruckenden Leitung des „assistierenden Kapellmeisters“ Jakob Brenner mit der Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 (von 1805), einem musikalischen Höhepunkt des Abends, das Finale vorbereitete.
Der Vorhang öffnete sich und statt der bis zu dieser Phase des Geschehens dunklen Farben überraschte Robert Lehmeier sein Publikum mit einem vorwiegend vertikal angeordnetem gewaltigen Statisterie-Aufgebot in bunter „Verkleidung“, fast regungslos nur mit einer der Pantomime entlehnten Armbewegung.

Vor diesem offensichtlich desinteressierten aber auch unbeachteten statischen Winke-Volk lässt Lehmeier die berühmte Schlussszene als „Friede-Freude-Eierkuchen“ in zugegebenermaßen hoher musikalischer Qualität ablaufen, indem sich der Minister, Leonore und Florestan mit Chorbegleitung gegenseitig befeiern. Dazu am rechten Bühnenbereich die „Verlierer“ Marzelline, Rocco und Jaquino.
Ein Opernschluss, der mir regelrecht im Halse stecken geblieben ist, denn sind nicht die wahren Verlierer jene, die nicht aus ihrer Beteiligungslosigkeit herausfinden?
Bei jedem unserer Abstecher nach Chemnitz hat uns die Qualität, wie dort musiziert und gesungen wird, gefallen. Die Robert-Schumann-Philharmonie überzeugte wieder als aufmerksamer Sängerbegleiter.

Eine sängerisch-schauspielerisch auch emotional bewegende Leistung bot die Koreanerin Guibee Yang vom Hausensemble als Marzelline. Spröder und gewollt distanzierter war als stimmgewaltige Leonore die finnische Sopranistin Pauliina Linnosaari zu erleben. Der Petersburger Viktor Antipenko ist seit seinen Einsätzen im "Ring" für das Haus ein häufiger und zuverlässiger Tenor-Gast. Stimmgewaltig erwies sich gleichfalls der ungarische Gast Kristián Cser in der Rolle des Pizarro. Über derart zuverlässige Ensemblemitglieder wie Magnus Piontek (Rocco) und Siyabonga Maqungo (Jaquino), verfügt auch nicht jedes Opernhaus. Florian Sievers als erster Gefangener und André Eckert sowie Andreas Beinhauer vervollständigten die Sänger-Riege.
Thomas Thielemann
Bildautor: Nasser Hashemi
Zum Zweiten
DER TEUFEL AUF ERDEN
Eine Koproduktion der Theater Chemnitz und der Volksoper Wien
28.04.2019
Franz von Suppé, dessen 200. Geburtstag wir 2019 feiern, schrieb 1878 mit seinem Teufel auf Erden ein zeitkritisches Bühnenwerk in bester Offenbach – Tradition und traf damit auch inhaltlich seinerzeit den Nerv des Wiener Publikums. In der heutigen Fassung von Alexander Kuchinka wurde dieses Werk komplett neu bearbeitet, dessen dramatische Struktur keineswegs an aktueller – zeitkritischer Attraktivität verloren hat. Ein großartiges teuflisches Verwirrungsspiel zwischen Gut und Böse ist hier entstanden, eine gesellschaftssatirische Zeitreise vom 17. – bis ins 21.Jahrhundert, in dem politische Machenschaften und Korruption, die Bigotterie der katholischen Kirche, hier die teuflische Verlogenheit im Kloster, sich zu einem verräterischen Spiel entpuppen, die von Reliquienfälschung bis hin zur Unzucht reichen. Hier wird wahrlich dem Zuschauer wieder einmal der Spiegel vor Augen gehalten, und dass in einer derart ironischen, grotesken Version, in der alle Dekadenz auch in der heutigen Zeit, so unberührt vom dem Geschehen, aus Fehlern sich doch nichts lernen lässt! Im Teufelskreis der Oberflächlichkeit, in der wir uns heute bewegen, sind wir von einer derartigen Kälte und Gleichgültigkeit befallen, sodass am Ende der Teufel wohl auf alle Menschen gleichermaßen ist verteilt, wo wir nur noch dem Untergang geweiht sind. Und mögen wir auch den Ernst dieser Thematik in der textlichen Neufassung erkennen, so ist dies doch von einer derart sprühenden, satirischen Komik, dass man nicht nur über sich selbst, sondern über das gesamte Werk lachen und sich derart amüsieren kann, sodass dies selbst schon als Burleske erscheinen mag. Durch Satans Hölle im Jenseits und auf Erden – welch himmlisches Entzücken! Denn offenbar hat der Himmel für viele Menschen als Paradies ausgedient. Und so beginnt bereits auch das 1.Bild mit einem ungeheueren Spektakel, wo der Höllenpförtner Haderer, gespielt von Matthias OTTE, ins Schwitzen gerät , weil ein wahres Geriss darum herrscht, in der Hölle aufgenommen zu werden, weil es doch im Himmel so ohne Action total langweilig ist. Allein in diesem Bild sind insbesondere die Ensembleszenen lobenswert hervorzuheben, wo die Damen und Herren des Opernchores mit großer Spiel – und Sangesfreude zur Lebendigkeit der einzelnen Szenenabläufe beitragen.
In dieser großartigen Inszenierung von Hinrich Horstkotte, der auch für Bühne und Kostüme verantwortlich, entsteht ein mit Tempo gespieltes, in Szene gesetztes derart menschliches Tohuwabohu, wo die Charaktere gut herausgearbeitet und ideal besetzt sind. In Alexander Kuchinka in der Titelpartie als Ruprecht und Höllenknecht, erkennen wir die Vielseitigkeit des Wiener Künstlers, der neben seinen autorischen, kompositorischen und gesanglichen Fähigkeiten, ebenso auch schauspielerische Größe auf der Bühne beweist. Mit dieser ungeheueren Bandbreite, auch in der Regiearbeit, könnte man ihn durchaus als den heutigen Schikaneder bezeichnen. Von so einem Ideenreichtum gesegnet findet man nur noch wenige, die ebenso auch wie Kuchinka zu den Fleißigsten seiner Kunst zählen. Sein Gegenspieler Matthias Winter in der Rolle als Rupert, Engel außer Dienst überzeugt mit einer schauspielerischen, aber auch humorvollen Sanftmut, und im Grunde genommen ist er gar kein Gegenspieler, sondern versucht die Bösen doch eher des Besseren zu belehren, und dient ebenso als Liebesengel um verirrte Seelen wieder zusammenzubringen.
Trotz allem wütenden und grotesken Geschickes, begegnen wir hier auch immer einer gewissen Melancholie zwischen zwei Liebenden. Wo gleich in vier Rollen (Amanda, Amalia, Amira, Tanzschülerin) Franziska Krötenheerdt schauspielerisch als auch gesanglich auftrumpft; und ihr so verliebter Isidor, gespielt von Andreas Beinhauer, hier ebenso in den zeitgeschichtlichen Abläufen die Verwandlungsfähigkeit besitzt, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Mit großer darstellerischer Überzeugungskunst, und einer sehr lyrischen Stimme, Beinhauer ein großes Potential an künstlerischer Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Mit welcher Feinfühligkeit hier der Regisseur an die einzelnen Szenen herangeht ist deutlich zu spüren. Im Gegensatz zu der eher sanftmütigen und naiven Schwester, zeigt sich Sylvia Rena Ziegler, die ebenso als Nonne Isabella im 2.Bild/1.Akt den energischen und autoritären Charakter verkörpert, und in den anderen Bildern als Isolde, Iska und Tanzschülerin eine schauspielerische vielseitige Wandlungsfähigkeit zeigt. Des Weiteren zu erwähnen wäre, dass alle Charaktere, als die des Halunken Reinhardt und Kadetten Reinwald, gespielt von Reto Rosin geradezu ideal besetzt sind. Ideal besetzt auch Dagmar Schellenberger als energische Stiftsvorsteherin Mutter Aglaja, die sich zu einer wahren Heuchlerin entpuppt, und wo sich am Ende herausstellt, das sie als Satans Tochter, sogar ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat. Gerhard Etnst ist ein wahres Unikum auf der Bühne, bringt er doch in der Darstellung des preußischen Oberst Donnersbach, Kompaniechef im 3.Bild/2.Akt, das Publikum wahrlich zum Lachen. Auch Matthias Otte als betrunkener Vizeleutnant Nebel, Spieß sorgt für ungeheuren Humor, Höllenpförtner Haderer und Thomas, Klosterpförtnerversteht Pointen richtig zu setzen, so wie sein Kollege Ernst. Als Ballorganisator zeigt er sich charakteristisch dann wiederum von einer ganz anderen Seite, welches ein Beweis dafür ist, dass wir hier es neben Freude am Spiel, mit professionellen, schauspielerischen Größen zutun haben. So wie eben auch Tilo Kühl-Schimmel, Christoph Dittrich, Peter Heber, und der Rest des Ensembles zu diesem gelungenen Abend beitrugen.
Abgesehen von dem opulenten und farbenprächtigen Bühnenbild als auch der Kostüme, so wie die Choreographie von Sabrina Sadowska, so ist hier insbesondere auch das Orchester unter dem Dirigat von Jakob Brenner hervorzuheben. Natürlich gab es auch hier eine revidierte musikalische Fassung, die aber auf Suppés Originalpartitur basiert, und letztendlich vom musikalischem Leiter und Dirigenten in die moderne Notenschrift übertragen wurde. Und obwohl einiger Korrekturen, um eben auch einige Nummern dem Libretto musikalisch besser anzupassen, hier aber trotz einiger Änderungen die musikalische Grundstruktur erhalten geblieben ist. Welches Suppés musikalisches Feuerwerk, gespielt von der Robert – Schumann – Philharmonie voll zum erklingen brachte.
Ein musikalisch, brisantes und höchst unterhaltsames Bühnenspektakel endete mit viel Applaus, Standing Ovations für die Solisten und für das gesamte Ensemble – ein Bravo für Regie und für die musikalische Leitung, als all jenen die ihren Beitrag zu diesem Premierenerfolg beigetragen haben.
Eine verdammt gute teuflische Leistung – und obwohl dieses Thema schon in den verschiedensten Fassungen bearbeitet wurde, so scheint dieses doch wohl die beste Produktion zu sein, welche in den letzten Jahren auf die Bühne gestellt wurde.
Manuela Miebach 7.5.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Bilder siehe unten!
DER TEUFEL AUF ERDEN
Besuchte Premiere am 27.04.19
"Work in progress"

Nicht nur der große Jaques Offenbach hat zweihundertstes Geburtstagsjubiläum, sondern ebenfalls der Begründer der Wiener Operette: Franz von Suppè (1819-1895). Sein "Boccaccio" gehörte einst zum eisernen Operettenrepertoire, wird heute leider nur sehr selten aufgeführt, dabei findet sich hier musikalische Spielopernqualität auf ein reizvolles Libretto nach Boccaccios "Dekamerone". Um so spannender die Zusammenarbeit des Theater Chemnitz mit der Volksoper Wien mit "Der Teufel auf Erden", der aus dem zeitlichen Umfeld von Suppès großen Erfolgen stammt. Die Handlung ist sehr revueartig: dem aus seiner Heimat entwichenen Höllenfürsten Satan wird ein kleiner Höllenknecht Ruprecht hinterhergeschickt, der ihn auf der Erde aufspüren soll, wo er sich, in menschlicher Gestalt verborgen, hinbewegt hat. In der ersten Station begegnet dem naiven Teufel ein ebenso naiver Engel, Rupert, der sich als ungewollter Helfer bei den Abenteuern an die Fersen heftet.

Im Kloster des siebzehnten Jahrhunderts findet sich in der Hauptverdächtigen, Äbtissin Aglaia, lediglich Satans Tochter. Im neunzehnten Jahrhundert in einer Kaserne können sie dann den Leibhaftigen leibhaftig aufspüren, doch er entkommt ihnen. Stets begegnen ihnen dabei natürlich zwei "Liebespaare" in verschiedenen Ausführungen. Im dritten Akt kommt dann die Neubearbeitung von Alexander Kuchinka zum tragen, wir befinden uns um unserer Zeit in einer Tanzschule bei den Vorbereitungen zum Opernball, der sowohl in Chemnitz, wie natürlich erst recht in Wien, ein gesellschaftliches Ereignis bedeutet. "Coole", gelangweilte Handy-Benutzer und hysterische Event-Typen halten unserer Gesellschaft einen Spiegel vor, der Teufel hat sich in unserem Leben eingenistet, ohne das wir ihn immer spüren. Eigentlich eine reizvolle Idee, schöner wäre es elegant satirischer ohne den großen, erhobenen Zeigefinger.

Suppès Musik ist dabei gut gemachte Gebrauchsmusik ihrer Zeit, einzelne Nummern stechen qualitativ heraus, doch versteht man hinterher, warum die großen Erfolge von Suppè eben "Die schöne Galathee", "Boccaccio" oder auch "Fatinitza" hießen. Es ist jedenfalls kein unbekanntes Meisterwerk, doch immer wieder reizvoll etwas unbekanntes erleben zu dürfen, wie wollte man es sonst auch beurteilen, also muss man sich bei den Verantwortlichen für die Möglichkeit bedanken.
Beide Häuser haben anscheinend einen ordentlichen Ausstattungsetat für die Produktion locker gemacht, wie es sich für ein "Schaustück" auch gehört. Engagiert wurde mit Hinrich Horstkotte in Personalunion als Regisseur und Ausstatter jemand , der so etwas auch kann, der Schauwert ist sehr opulent mit richtig schönen, gemalten Hängekulissen, was sich heutzutage ja fast niemand mehr traut. Das Höllenbild erinnert in roter Phantasie an tschechische Märchenfilme, das Kloster zitiert historische Bühnenbilder von Meyerbeers "Robert der Teufel", was der nüchterneren Szene der Kaserne und der Tanzschule entspricht wird jeweils durch die Kostüme und Aktion wieder aufgefangen, grandios das Finale mit dem "teuflischen" Opernball.

Auch die Regie kommt inspiriert und munter daher, doch meines Erachtens fehlen noch zwei Wochen Probenzeit, denn die so wichtigen Tempi stimmen noch nicht, die etwas langschweifigen Sprechtexte bedürfen noch einer Ausdünnung und Straffung. Das ist meinerseits Mosern auf hohem Niveau, denn wer sich im Theater auskennt, sieht wieviel Feinarbeit schon im Vorhandenen steckt, doch gerade das Komische benötigt einen ungeheuren Schliff. Horstkotte kann das, was ich schon in anderen Produktionen von ihm erlebt habe.
Auch musikalisch erleben wir in der Premiere noch einigen Unsicherheiten zwischen Graben und Bühne. Jakob Brenner macht am Pult der Robert-Schumann-Philharmonie, die wirklich inspiriert aufspielt, gute Figur und entfacht das italienische Feuer von Suppès Ideen, wie er auch den gemütvollen Wiener Schmäh der Operette herauskitzelt, doch zwischen ihm und den Sängen entstehen immer wieder Unsicherheiten, die noch zu Wacklern führen. Das Ensemble setzt sich, völlig richtig, aus Sängern und singenden Schauspielern zusammen. Gesanglich gefällt das Quartett der Liebespaare, wie in "Cosi fan tutte" mit Tenor, Sopran, Bariton und Mezzosopran besetzt. Reto Rosin schmeißt sich mit furioser Tenorpose in die irrwitzigen Aufgaben mit leichten Höhengrenzen, Franziska Krötenheerdt ist eine filigrane Edelsoubrette voll Beweglichkeit, Andreas Beinhauer gefällt mit leuchtendem Liebhaberbariton und Sylvia Rena Ziegler mit glutvollem Mezzo, alle szenisch prima, die Damen vielleicht noch etwas "primaer".

Die beiden Hauptrollen jedoch sind Teufel und Engel, entsprungen aus dem Wiener Volkstheater, gerade Alexander Kuchinka (Textfassung) fehlt es noch am rechten Timing, obwohl der Knecht Ruprecht ein sauberes Teufelchen ist, ein reines Entzücken der Engel Rupert in seiner grundgütigen Naivität von Matthias Winter. Eine höllische Abtissin Aglaia mit profunder Präsenz findet sich in Dagmar Schellenberger. Gerhard Ernst vollbringt in drei verschiedenen Partien ein kleines Wandlungswunder und schafft durch superbe Bühnenausstrahlung seine leichten stimmlichen Anstrengungen vergessen zu lassen. Auch Matthias Otte erweist sich in zwei Rollen als enorm wandlungsfähig. Dazu gibt es eine hübsche Choreographie von Sabrina Sadowska mit Balletteleven und Tänzer/innen. Selbst der Intendant hat in den Reihen der Kleindarsteller seinen Auftritt, die Chöre zeigen sich musikalisch wie szenisch von temperamentvoll engagierter Seite.
Das Premierenpublikum zeigte sich uneingeschränkt begeistert von der Welt des opulenten , bunten Operettenzaubers. Meines Erachtens hätte es noch zwei Probenwochen mehr gebraucht, damit aus dem Schuh ein richtig guter Schuh wird. Bis zur Premiere an der Wiener Volksoper ist ja noch etwas Zeit. Für die Liebhaber der raren Operette sei die Aufführung trotzdem ein Muss, wer weiß, wann wir dieses Stück je wieder erleben dürfen.
Martin Freitag 2.5.2019
Fotos (c) Nasser Hashemi

Von Großereignissen und seltenen Opern bringen wir natürlich gleich zwei Kritiken.
DER RING DES NIBELUNGEN
Datum der Premieren: 3. 2. 2018; 24. 3. 2018; 29. 9. 2018 und 1. 12. 2018
Besuchten Vorstellungen: 18. 4. 2019; 19. 4. 2019; 20. 4. 2019 und 22. 4. 2019
Wagner aus feministischer Sicht
TRAILER Rheingold
TRAILER Walküre
TRAILER Siegfried
TRAILER Götterdämmerung
Als aus Chemnitz die Information kam, man werde eine Neuinszenierung von Richard Wagners „ Der Ring des Nibelungen“ von vier unterschiedlichen Regisseurinnen im Zeitraum vom 3. Februar 2018 bis zum 1. Dezember 2018 auf die Bühne bringen, waren wir für die Premierenbesuche aus unterschiedlichen Gründen verhindert. Deshalb nutzten wir die Ostertage 2019 zum komprimierten Besuch der vier Abende, leider mit vielem Umbesetzungen, im Chemnitzer Opernhaus.

Im Vorfeld, auch ob der reichen Berichterstattung in den Medien, gab es für uns die Frage, wie geht das, diese „Männeroper“ in weibliche Hände zu geben und wird es ein weiblicher oder feministischer „Ring“ sein? Die Meininger Arbeit der Christine Mielitz von 2001 gilt als großer Wurf. Das war aber noch vor den extremen Auswüchsen des Regietheaters. Ihre Probleme waren vorwiegend organisatorischer Natur. Leider ist das Meininger Ereignis nicht dokumentiert worden.
Die von August Everding ausgebildete und von der Zusammenarbeit mit Calixto Bieto geprägte Verena Stoiber versuchte ihre Inszenierung von „Das Rheingold“ als eine feministisch geprägte Gesellschaftskritik ohne besondere Verfremdungen zu gestalten.
Ihre Idee, Nibelheim als Hort der Ausbeutung von Frauen als Sexualobjekte und für untergeordnete Arbeiten sowie für Kinderarbeit kann man so darstellen. Auch die Thematisierung des Konsumtionswahns erscheint schlüssig. Trotz der ansonsten vielen Klischees wurde auf den Klimawandel (Wer will, dass die Welt so bleibt wie sie ist, der will, dass sie nicht bleibt) und auf die sozialen Fragen (Mitleid macht wissend ohne Schuld) nur sparsam als Graffiti an der Walhalla-Wand hingewiesen.

Auf der Bühne war ständig etwas los und es gab eine Reihe guter Regieeinfälle. Statt des Tarnhelms fungierte ein Spiegel, der Goldraub wurde dargestellt, indem den Rheintöchtern die blonden Perücken abgerissen wurden. Die Idee, mit einer Travestie von Donner und Froh, die Riesen vom Kaufpreis „Freia“ abzubringen, fand ich fast genial. Die optisch reizvolle Anfangsszene mit den schwingenden Rheintöchtern leidet, weil die Rheintöchter ob der Konzentration auf die Seilbewegung nicht ordentlich singen. Wie gut sie singen konnten, erweist sich im Schlussbild. Leider wissen wir sehr wenig vom Privatleben der Regiedamen, weil sie nicht zu den Gelbseiten-Promis mit Home-Story gehören. Aber ob Frau Stoiber einen so dümmlichen Wotan zu Hause auf dem Sofa sitzen hat, wie sie uns auf der Bühne präsentiert? Ansonsten sind die Männer neben ihrer Unbedarftheit vor allem vertrottelt, Loge schurkisch sowie vom Testosteron gesteuert. Wenn ein männlicher Regisseur so eine Phallusszene mit Jukka Rasilainenen geboten hätte, so wäre das Geschrei riesig gewesen. Die Frauen kamen aber bei Verena Stoiber auch nicht besser weg. Die Freia als Shopping-Girl und ansonsten panisch-ängstlich und die Fricka stand letztlich nur rum. Beeindruckend der präsentable Erda-Auftritt von Bernadett Fodor.

Die Niederländerin Moniquie Wagemakers war mit ihrer Walküre zurückhalternder. Ihr Anliegen war, den Missbrauch familiärer Beziehungen zum Zweck des Machterhalts beziehungsweise zur Machterweiterung als Werkzeug einsetzen. Was natürlich bei der „Familiengeschichte Walküre“, der Vernichtung der Kinder durch den eigenen Vater gründlich schief gehen musste. Inszeniert war die Walküre letztlich „halb-szenisch“ fast ohne Requisiten. Da gab es kein Schwert, da fehlte die Weltesche. Generell wurde von der Rampe direkt in das Auditorium gesungen, was zum besten musikalischen Eindruck der vier Abende führte. Aris Argiris war der beste Wotan- Wanderer des Zyklus in seiner Rolle als gescheiterter Held. Dazu Frau Schuldt mit einer massiv durchgreifenden Fricka. Antipenko bot einen stimmlich sehr guten Siegmund, der seine begrenzten Möglichkeiten beim Wälseruf hätte früher erkennen sollen.

Frau Kesslers statische Sieglinde agierte mit sicherer gut geführter Stimme. Stéphanie Müther war eine exzellente Brünnhilde, auch wenn die gewaltige Partie sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten führte. Auch haben wir selbst an großen Bühnen eine so geschlossene Walküren-Frauenschaft noch nicht erleben können.
Das überwiegend von der Rampe Singen erlaubte dem Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo ein besseres Eingehen auf die Belange der Solisten und ein deutlich differenziertes Musizieren im Orchester. So hervorragend hatten wir die Robert-Schumann-Philharmonie bisher nur in ihren Sinfoniekonzerten gehört; eine deutliche Steigerung des Orchesters gegenüber der Rheingold-Bespielung und der folgenden Abende.
Die Buh-Rufe aus mehreren Publikumsbereichen waren uns absolut unverständlich.

Die Struktur des „Siegfrieds“ machte es der Frau Sabine Hartmannshenn am schwersten, ihren Feminismus auszuleben, kommt doch, wenn man vom Waldvogel absieht, bei Wagner erst in der Mitte des dritten Aufzugs ein weibliches Wesen auf die Szene. Deshalb ging sie noch vor dem eigentlichen Handlungsbeginn aufs Ganze und ließ den Mime mit unglaublich widerlicher Brutalität den Siegfried-Säugling aus Sieglindes Unterleib herausschneiden und diese mit einem Tritt sich ihrem Sterben überlassen. Kaum zarter ließ Frau Hartmannshenn den Alberich eine zufällige Waldbewohnerin vergewaltigen, um dem kindlichen Hagen die Machtverhältnisse in der Männerwelt zu demonstrieren. Hagen nimmt die Belehrung an und tritt nach der Geschändeten. Dass die Regie dem Waldvogel, entzückend von Guibee Yang dargestellt, einen breiten visuellen Rahmen gab, war richtig in Ordnung.

Aber warum der sympathische Vogel dann jedoch vom Wanderer ohne Anlass brutal ermordet wurde? Müssen wir bei der Regie niedere Instinkte vermuten? Die Personenführung der drei Hauptpartien war ob deren Möglichkeiten wegen der Tiefenstaffelung regelrecht mangelhaft. Der Mime Arnold Bezuyen rettete sich mit Extemporieren und der Sänger der Titelpartie bot zwar eine gute Stimme, ist aber(noch) kein Wagnertenor. So musste der Dirigent ihn an die Rampe holen, statt dass er die kraftvolle Brünnhilde anhimmeln konnte. Am Ende des dritten Aufzugs stand der wispernde Martin Iliev am linken und die auch körperlich präsente Stéphanie Müther am rechten Bühnenrand und der Held wurde ohne Gnade niedergesungen.

Die vergleichbar ähnliche Verteilung der sängerischen Qualitäten zwischen den weiblichen und männlichen Partien in der von Elisabeth Stöppler betreuten „Götterdämmerung“ ließ da natürlich böse Vermutungen aufkommen. Die Gutrune der Cornelia Ptassek, die Brünnhilde der Stéphanie Müther und vor allem die die Waltraude der Anne Schuldt waren mit guter Stimmkraft angetreten, während der Siegfried –Iliev, der Gunther von Pierre-Yves Pruvot und vor allem der Hagen von Marius Bolos eher kläglich agierten. Auch visuell waren die Herren eher ausgeschmiert: Waltraute reiste mit Fluggerät und fallschirmrepräsentativ an, während sich der Held mit einem Kinderschlitten begnügen musste.
Mit dem zweiten Aufzug offenbart Elisabeth Stöppler ihr gesamtes Regietalent und ihr Personen-Führungskönnen und schafft eine imposante Chorszene mit all ihrer Dramatik um dann mit dem Schlussaufzug eine regelrechte Massenhinrichtung sämtlicher Testosteron-Träger zu veranstalten.

Wenn dann alle Männer tot sind, kann der Selbstverbrennungs-Kanister zur Seite geschafft werden und, nachdem das Kinderschlitten-Symbol verbrannt werden konnte, zieht allgemeine Freude und Zufriedenheit ein.
Der Fötus in Brünnhildes Gebärmutter ist gerettet und wehe dem Bürschlein, falls es ein Knabe werden sollte!
Nun wissen wir nicht, wie und ob die vier Damen ihre jeweiligen Konzepte miteinander abgestimmt haben. Letztlich bleibt aber Richard Wagners Musik das verbindende Element. Das Haus hat bereits mit früheren Projekten seine Kreativität und Fähigkeit bei der Bewältigung anspruchsvoller Projekte bewiesen und dem Ansehen der Stadt Chemnitz gute Dienste geleistet. Das wäre unbedingt zu würdigen.
Thomas Thielemann 25.4.2019
Bildautoren: Kirsten_Nijhof und Nasser_Hashemi
(Bilder leider nur aus der Premierenrunde)
Etiam altera pars audiatur - die zweite Meinung
DER RING DES NIBELUNGEN
18.-22. April 2019
Bekanntlich hat die Oper Chemnitz 2018, also im Laufe nur eines Jahres, die gesamte Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner auf die Bühne gestellt. Das ist für ein Haus solcher Größe eine nahezu unglaubliche Leistung, die kaum von großen A-Häusern erbracht wird. Zudem blickt man hier auf einen sehr erfolgreichen „Ring“ zurück, der auch von der internationalen Presse vielfach gelobt wurde. Nun entschied man sich, einen „weiblichen Blick“ auf den „Ring“ zu werfen - was immer das heißen mag - und nahm gleich vier Regisseurinnen für die vier Stücke unter Vertrag.
Genau das schwebte Katharina Wagner ja ursprünglich auch für den neuen Bayreuther „Ring“ 2020 vor. Mit Wotan könnte man in Chemnitz also immerhin schon sagen: „Heut‘ hast Du’s erlebt“. In Bayreuth 20 scheint es aber doch wenigstens eine Frau zu werden, Tatiana Gürbaca, die erste überhaupt für den „Ring“ auf dem Grünen Hügel. Was diese allerdings im Frühjahr 2018 mit einem dreiteiligen Verschnitt der Tetralogie „aus der Sicht der zweiten Generation“ am Theater an der Wien anstellte, war nicht unbedingt beglückend. Francesca Zambello ging es mit ihrem „amerikanischen „Ring“ in San Francisco vor einigen Jahren überhaupt nicht um spezifisch weibliche Sichtweisen, sondern eher um das Kopieren von Ideen europäischer Männer-Produktionen. Auch Rosamund Gilmore beabsichtigte mit einer guten Inszenierung in Leipzig in jüngster Vergangenheit scheinbar keine spezifisch weibliche Sicht. Die Neuproduktion von Jasmin Solfaghari in Odense 2018 enthielt im Finale der „Götterdämmerung“ etwas in dieser Hinsicht, aber dazu später. Im Mai wird eine Regisseurin in Bordeaux „Die Walküre“ in Szene setzen - eine signifikante Zunahme von Regisseurinnen, die sich nun Wagners „Ring“ annehmen, ist also unverkennbar. Worin könnte sich also eine spezifisch weibliche Sicht auf den „Ring“ darstellen, wenn man das ausdrücklich für eine Neuinszenierung postuliert, wie nun in Chemnitz?!
„Das Rheingold“ übernahm die junge Regisseurin Verena Stoiber aus der Karlsruhe-Truppe um Peter Spuhler mit ihrer Bühnen- und Kostümbildnerin Sophia Schneider, dramaturgischer Betreuung von Carla Neppl und der Lichtgestaltung von Holger Reinke. Ich dachte zunächst, Stoiber stamme aus der Schule von Frank Castorf, der ja nach eigener Überzeugung seinen Bayreuther „Ring“ gegen die Musik inszenierte. Dann wurde klar, dass sie bei Calixto Bieito und Jossi Wieler in Stuttgart assistiert hatte. So erschloss sich dann doch einiges ihrer trash-artigen und musikalisch ähnlich wie bei Castorf vorgehenden „Rheingold“-Produktion. Es ist eine weitgehend grelle Inszenierung, die streckenweise den Zaunpfahl über tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten unserer natürlich exklusiv als oberflächlich und gedankenlos gezeichneten Gesellschaft schwingt. Wieder einmal ein Versuch, dem Stück mit den Mitteln des sog. Wagnerschen Regietheaters beizukommen, das Theater mit einer ausgefallenen Regie also klar über den musikalischen Teil des Werkes zu stellen. Da gibt es Selfies en masse, selbst mehrere von Wotan mit Fasolt, der ihm als spießiger Bürokrat daraufhin die Leviten zur Vertragseinhaltung liest. Alberich, der wie ein priapismusverdächtiger vertrottelter alter Rübezahl mit Dauererektion daher kommt, holt sich das Gold mit den güldenen Perücken der Rheintöchter und zieht ein Bordell mit jungen Bikini-Mädchen auf. Diese bieten für einen wirklich konkurrenzlosen Flat-Tarif von €9,99 Sex an, während im unteren Stockwerk des Aluminiumgehäuses die Nibelungen billige Turnschuhe mit Schnürsenkeln versehen. Das „Gold“ stellt sich später als ein Haufen leerer Pappkartons dar, die wohl nach dem hastigen Entleeren eines ostasiatischen Schiffskontainers mit dem entsprechenden Billiggut wie TV Screens, Haushaltsgeräten, Damenbekleidung übrig geblieben waren. Natürlich können mittlerweile als poststereotyp zu bezeichnende Inszenierungselemente wie der Putzeimer mit Bodenaufwischen ebenso wie das Outfit Donners und Frohs als Golfspieler und die weithin bekannte Bürokratiedemonstration des Walhall-Vertrags nicht fehlen. Die Akten werden aufgrund ihres Umfangs allerdings diesmal mit der Schubkarre herbeigefahren - das war neu! Fricka und Freia mustern bis zum Abwinken die von der Apfelgöttin mitgebrachten neuen Fetzen. Sollte das etwa spezifisch weiblich sein?!
Vieler, und bei weitem nicht aller Beispiele kurzer Sinn: Das passte meistens nicht zu Wagners Musik und schon gar nicht zur gesanglichen Aussage, ebenso wie die durchaus lebhafte, aber offenbar auch ohne Würdigung der dazu erklingenden musikalischen Botschaft, zumal der Leitmotive. Es führte trotz mancher guter Ideen, die aber selten schlüssig durchdramatisiert wurden, vielmehr zu einer oft fahrigen, ja bisweilen willkürlich anmutenden Dramaturgie, die sich zugunsten eines allzu aktuellen Stoffbezugs allzu leicht über Wagners Postulat des Gesamtkunstwerks hinwegsetzt und damit letztendlich im Flachwasser überzeugender Regiekonzepte bleibt. Ganz ohne Mythos geht es wohl auch in Wagners „Ring“ nicht, und den hat Stoiber wenige Male durchaus angesprochen, wenngleich diese Momente gegen die allgemeine Leichtfertigkeit nicht ankamen. So wogen über den anmutig hereinschwingenden Rheintöchtern grüne Baumkronen. Und bei Erdas schicksalhaft vorgetragener Warnung kommt auch ein gealterter Wotan mit Augenbinde über die Bühne, der den „wagenden Gott“ warnt, den Wanderer schon vorweg nehmend. Auch sieht man in großen blauen Lettern das Wort „Love“, also Liebe, das die abgetakelten Rheintöchter im Schlussbild traurig in die Höhe halten - sicher ein weiterer guter Punkt der Inszenierung.
Folgerichtig gehörte Bernadett Fodors mystischer Auftritt als Erda mit dunkel timbriertem vollem Mezzo auch zu den stärksten Momenten des Abends. Krisztán Cser war ein fescher, aber allzu oberflächlicher junger Gott im Businessanzug mit einem für den „Rheingold“-Wotan noch ausreichenden bassbaritonalen Volumen. Anne Schuldt sang mit einem klar intonierenden hellen Mezzo eine agile Fricka. Bernhard Berchtold war ein sehr aktiver und mit kräftigem tenoralen Ausdruck prägnant singender Loge, immer wieder auch zu erhöhter Deklamation neigend. Der altbewährte Jukka Rasilainen war wie zu erwarten ein exzellenter Alberich, wenn auch nicht grade von Zwergengestalt. Er kennt seine Wagner Rollen in- und auswendig, natürlich auch den Wotan. Man merkte ihm die lange Erfahrung an. Magnus Piontek war eine voll tönender ausgezeichneter Fasolt, dem der alte Haudegen James Moellenhoff stimmlich kaum nachstand. Reto Rosin als Mime, James Edgar Knight als Froh und Andreas Beinhauer als Donner gaben gute Kostproben ihres Könnens bei den kurzen Auftritten. Franziska Krötenheerdt gab die Freia kindhaft und etwas zu albern mit hellem Sopran. Sylvia Rena Ziegler und Sophia Maeno sangen bestens als Wellgunde und Floßhilde, während die junge Koreanerin Guibee Yang mit der Woglinde etwas überfordert schien. Im „Siegfried“ wurde klar, dass der Waldvogel die passendere Partie für sie ist.
Monique Wagemakers, Regisseurin der „Walküre“, sagte in einem Interview mit dem Dramaturgen Lucas Reuter (Dramaturgie gemeinsam mit Susanne Holfter), dass sie nicht wisse, was das sei, der „weibliche Blick“. Sie habe bei ihrer Inszenierung des 1. Abends der Tetralogie aus „einem sehr starken Gefühl heraus gearbeitet“. Was der Unterschied zwischen einem „männlichen Blick“ und einem „weiblichen Blick“ sein soll, habe sie dabei nicht herausgefunden. Sie vermutet eine gewisse Tendenz, beispielsweise in der Beurteilung der Figur des Wotan, der bei Frauen wohl als arroganter Narziss gesehen werden könnte, bei Männern eher als positiv gescheiterter Held. Da ist möglicherweise was dran. Aber Wagemakers hat sich mit ihrer Bühnenbildnerin Claudia Weinhart, der sehr Phantasie- und geschmackvollen Kostümbildnerin Erika Landertinger, sowie der Licht- und Videogestaltung von Mathias Klemm und Constanze Hundt von solchen Festlegungen nicht leiten lassen. Ihr starkes Gefühl für das Stück hat sie offenbar ganz von selbst auf eine emotional intensive Lesart gebracht, wo Wagners Gesamtkunstwerk-Gedanke tatsächlich voll zum Tragen kommt. Hier stimmen Musik, Gesang und Bühnenbild stets überein und geben Wagemakers‘ Inszenierung große Fallhöhe. Im Vordergrund steht - wie bei Tatiana Gürbaca in Wien - die Perspektive der Kindergeneration und die Tatsache, dass Wotan seine Kinder Siegmund und Sieglinde sowie Brünnhilde nicht nur ausnutzt, um wieder an die absolute Macht zu gelangen, sondern sie dabei am Ende auch noch umbringt. Wagemakers sieht die „Walküre“ als Familientragödie, in der enge Beziehungen wachsen, wie zwischen Siegmund und Sieglinde, und gleich wieder zerstört werden. Das war ähnlich auch schon bei der „Walküre“ von Dietrich Hilsdorf 2009 in Essen zu erleben. Wagemakers bringt diese Zerrüttungen aber mit viel größerer Intensität und Plausibilität sowie einer ausgezeichneten Personenregie auf die Bühne als Tatiana Gürbaca 2018 in Wien. Dabei kommt ihr das Einheitsbühnenbild von Weinhart zugute, welches eine Art rechteckigen, aus Säulen und Bogen bestehenden Raum zeigt, welcher sofort an eine gotische Kirchenkrypta erinnert. Der Gedanke an Tod und Ende ist also schon in den Bildern manifest, die sich zudem aufgrund einer niemals übertrieben genutzten Drehbühne in immer neuen Konstellationen zeigen und damit sowie einer guten Lichtregie Stimmungen und Aussage der Szenen unterstreichen. Emotional besonders berührend sind die Momente, in denen Siegmund und Sieglinde sich selbst als Kinder wiedersehen, ein weiterer Verweis auf die Familiengeschichte der „Walküre“
Hier ging also fast alles zusammen, es wurde eine durchwegs eindrucksvolle „Walküre“ unter dem Vorzeichen der zerstörten Beziehungen von Wotan zu seinen Kindern und den Kindern untereinander, bis auf eine - m.E. schwerwiegende - Ausnahme: Die holländische Regisseurin zeigte kein Schwert! Da es für Siegmund und Sieglinde Hoffnung, Rettung und Vertrauen bedeutet, meint sie, dass man etwas anderes zeigen müsse als „das hilflose Hantieren mit einem großen Schaschlik-Spieß“. Und dieses andere war bei ihr ein schwarzer transparenter Vorhang, mit dem die beiden hantierten, um diese Tugenden auszudrücken. Dies erschloss sich ganz sicher nur dem, der das Programmheft las, und zwar vorher! Dass ein Vorhang ein Schwert ersetzt, ist kaum einleuchtend. Natürlich hat Wotan bei Wagemakers auch keinen Speer. Sollte hier vielleicht doch verborgen oder gar unbewusst ein „weiblicher Blick“ zu erkennen gewesen sein, dem sich gegebenenfalls auch als Phallus-Symbole zu interpretierende Requisiten wie Schwert und Speer verbieten?! Meines Erachtens wäre das schon aus Gründen der starken musikalischen Akzentuierung dieser beide Requisiten nicht nachvollziehbar.
Wagemakers und ihrem Team kam bei ihrer dennoch gelungenen Inszenierung ein Sängerensemble zugute, welches sich manches große Haus nur wünschen könnte und diesen Abend zu einem Wagner-Gesangsfest machte. Dabei schließe ich ganz bewusst die Wiener Staatsoper mit ein, insbesondere mit Hinblick auf die Besetzung des Wotan, der mit der ebenfalls exzellenten Brünnhilde, die man hier hörte, ja zentralen Figur der „Walküre“. Und auch diese war absolut Wien-fähig! Der Grieche Aris Argiris spielte den Göttervater, der er hier ja nun mal ist, mit enormer Souveränität, jedem in seinem Umfeld einflößendem Respekt und einer typischen „Walküre“-Wotan-Stimme. Sein kerniger und alle Höhen und Tiefen der Rolle mühelos meisternder Bassbariton machte Argiris zum jederzeit äußerst präsenten und ruhenden Mittelpunkt dieses Abends. Stéfanie Müther stellte sich schon mit einem kraftvollen „Hojotoho“ vor und begeisterte in der Folge mit sehr agilem Spiel sowie einem klangvollen, schon über jugendliche Dramatik hinausgehenden Sopran bei guter Diktion und Phrasierung. Man könnte sagen, mit Fug und Recht, ein neuer Stern ist vom Brünhilden-Himmel gefallen! Viktor Antipenko, den ich hier auch zum ersten Mal hörte, war ein kraftvoll intonierender und ebenso klangschöner Siegmund und legte auch das nötige Charisma dieser Rolle an den Tag. Seine Partnerin Astrid Kessler als Sieglinde passte ideal zu ihm und überzeugte mit einem hellen, ausdrucksstarken Sopran und sowie viel Empathie in der Rollendarstellung. Magnus Piontek spielte seine fast schwarzen Bassfarben für den Hunding voll aus. Anne Schuldt sang diesmal eine noch überzeugendere Fricka, die mit sich nicht scherzen ließ. Auch alle acht Walküren waren jeden großen Hauses würdig. Entsprechend wurde dieses erstklassige Sängerensemble auch vom Publikum gewürdigt. Irgendwie hatte man jetzt schon der Eindruck, dass dieser Abend der Höhepunkt der Chemnitzer Tetralogie war.
Im „Siegfried“, inszeniert von Sabine Hartmannshenn, kam dann nicht nur der dem „Ring“ innewohnende Mythos zu seinem Recht. Sie fand auch Zugang zu einer spezifisch „weiblichen Sicht“, wenngleich es ähnlich auch in Inszenierungen männlicher Regisseure vonstattengeht, ohne dass es dort einer erklärenden Hervorhebung bedarf, ja sogar in der Konzeption des „Siegfried“ bei Wagner selbst. Hartmannshenn hebt in Bezug auf den 1. Aufzug hervor, dass es „weiblich“ und „männlich“ zur Aufzucht der Jungen geben muss. Man denke nur an Mimes Spruch: „Ich bin dir Vater und Mutter zugleich.“ Noch bedeutsamer ist jedoch Hartmannshenns Hervorhebung der Beschreibung der Liebe durch Richard Wagner, die Siegfried ja im Finale erlebt, als das ‚ewig Weibliche selbst‘, denn das ist wohl kaum zu widerlegen. Wir hörten es als allgemeine Weisheit ja schon bei Loges Erzählung im „Rheingold“ - insofern also nicht etwas ganz Neues. Aber es ist wohl schon eine Form „weiblicher Sicht“, wenn die Regisseurin Wagner folgendermaßen zitiert: „Nicht Einer kann Alles; es bedarf Vieler und das leidende, sich opfernde Weib wird endlich die wahre wissende Erlöserin, denn die Liebe ist eigentlich ‚das ewig Weibliche‘ selbst.“
Anders als Wagemakers bei Siegmund hat Hartmannshenn kein Problem mit einer vermeintlich zu männlichen Ausstrahlung eines Schwertes, lässt den Wanderer dafür aber mit einer Art Leuchtstoffröhre durch den Wald wandeln, während sie ausgerechnet Alberich den Wotan-Speer verpasst. Also Lichtalbe gegen Nachtalbe, durchaus sinnvoll. Eine Spitze an des Wanderers Speer wär ohnehin nutzlos gewesen. Die Szene zwischen ihm und Alberich im 2. Aufzug wurde damit, auch weil sie von den zwei alten Wotan-Recken Jukka Rasilainen und Ralf Lukas gespielt wurde, zu einem der Höhepunkte des Abends. Und das ist sie nicht oft.
Siegfrieds Selbsterkenntnis findet hier in einem mythisch wirkenden Bühnenbild von Lukas Kretschmer aus eckigen in Grün und Bläulich gehaltenen Baumstämmen statt, in dem er als Choreograf eine kaum wahrnehmbare Gruppe von Menschen agieren lässt. Hartmannshenns interessante Idee dazu ist, dass das Erwachsenwerden Siegfrieds sich nicht nur mit Mime allein bewerkstelligen lässt, es bedarf auch anderer dazu, natürlich am Schluss der Liebe Brünnhildes. So permutieren diese Statisten im 2. Aufzug zu einem bestechend choreografierten Fafner mit Goldmasken auf ihren verhüllten Gesichtern. Als Siegfried den „Drachen“, der übrigens perfekt verstärkt war, was nicht allen Häuser4n gelingt, klassisch per Schwert besiegt hat, wird klar, dass er und damit der Schatz aus einer unterdrückten Menschenmasse, einer „Verhandlungsmasse Mensch“ besteht, die er nun befreit hat und die ihm deshalb auf seinem weiteren Weg zum Brünhilden-Felsen folgen wird. Ein guter Regieeinfall, der Erinnerungen an den sog. „Colón-Ring“ in Buenos Aires 2012 und den laufenden „Ring“ in Kassel wachruft. Damit charakterisiert die Regisseurin bereits in einem frühen Stadium die Sozialisierung Siegfrieds, an der auch der mädchenhafte und perfekt gesungenen Waldvogel von Guibee Yang eine wesentlichen Anteil hat, die ihm jedoch nicht die Gefahren des Bösen nahebringt, weshalb er später immer noch naiv in die Fänge der Gibichungen geraten wird, wo er sonst aber wahrscheinlich gar nicht erst hingekommen wäre.
Mit der Siegfriedschen Naivität geht die Kostümbildnerin Susana Mendoza zumindest beim Titelhelden zu weit, wenngleich alle anderen Outfits angemessen bis interessant erscheinen. Siegfrieds knielange kurzen braunen Hosen lassen ihn eher wie einen Deppen aussehen als den zwar naiven, aber doch immerhin Enkel eines Gottes. Auch dass er beim Aufstieg auf den Brünnhilden-Felsen Blinde Kuh spielen muss, wirkt doch etwas störend angesichts der dazu erklingenden Musik. Interessant ist dagegen die fantasievolle Körperzeichnung auf der entblößten Brust des Wanderers, die wohl aufgrund des fehlenden Speeres seine Weltrunen darstellen soll. Es sieht jedenfalls gut aus. Runen zeichnen Siegfried und Mime auch auf einige Bäume im 2. Aufzug, hier auch wieder an den Mythos appellierend, der gerade durch den unheimlichen Wald so intensiv mit dem Scherzo des „Ring“ verbunden ist. Mathias Klemm schuf dazu die stets passende subtile Lichtregie. Und man kam ganz ohne die albernen Rucksäcke aus, die Sänger und Publikum in Wien seit Jahren ertragen müssen!
Der Chemnitzer Siegfried „vom Dienst“, Daniel Kirch, hatte an diesen Tagen in Amsterdam als Tannhäuser zutun, sodass der aus dem Sofia-„Ring“ wohlbekannte Martin Iliev für die Titelrolle einsprang. Allerdings singt er dort nur den „Götterdämmerung“-Siegfried, denn er ist eher der geschlagene depressive Held, der ihn auch zu einem guten Siegmund und Tristan macht. Die jugendliche Behändigkeit des jungen Siegfried ist darstellerisch und bis zu einem gewissen Grad auch gesanglich seine Sache nicht so ganz. Aber Iliev überzeugte über langen Stecken mit seinem klangvollen Heldentenor mit schönem Timbre sowie einer interessanten baritonalen Abdunkelung. Arnold Bezuyen gab eine Charakterstudie des Mime mit unglaublicher Spielintensität und Mimik. Sein vokaler Vortrag war nicht unbedingt Schöngesang, muss es für den Mime auch nicht sein, aber es gab doch einige Vokalverfärbungen, was bei seiner Rollengestaltung aber kaum ins Gewicht fiel.
Sowohl Ralf Lukas als auch Jukka Rasilainen, der den kleinen Hagen dabei hat, obwohl der so alt wie Siegfried sein müsste und ihm mal eben zeigt, wie man eine Frau vergewaltigt, waren als Gegenspieler Wanderer und Alberich um den Ring Extraklasse, wenngleich Lukas bei der Erweckung Erdas in der stimmlichen Dynamik an seine Grenzen geriet. Diese wiederum wurde von der bewährten Simone Schröder mit ihrem klangvollen Alt souverän gesungen. Sie tauchte immer wieder auf, ein weiteres Element von „weiblicher Sicht“ in dieser Inszenierung, zu der sicher auch die letzte Geste um Hilfe des Waldvogels (diesmal exzellent: Guibee Yang) bei ihr gehörte, nachdem dieser vom Wanderer tödlich verletzt worden war (!). Warum Erda eine Dornenkrone trug und man gar Blutfluss gewahrte, bleibt wohl ohne genauere Orientierung durch die Regisseurin unerklärlich… Der schon als Hunding beeindruckende Magnus Piontek sang mit prägnantem Bass einen stimmstarken Fafner.
Elisabeth Stöppler mit dramaturgischer Unterstützung von Susanne Holfter und einer guten Lichtgestaltung von Holger Reinke inszenierte schließlich die „Götterdämmerung“ und stellt gleich zu Beginn im Prolog durch die Nornen klar, dass es hier um den Weltuntergang, „Dystopie allerorten“ geht. Denn wir erleben die drei Wissenszuträgerinnen Erdas in vereistem Umfeld, als Charaktere kaum noch erkennbar und sich in dicken Fellen schwerfällig bewegend. Das passt natürlich zu ihrem Bericht vom Untergang der Natur, der sinkenden Weltesche und dem Austrocknen des heiligen Quells, an dem Wotan sich einst ein Auge ausgestochen hatte, um die Weisheit zu gewinnen, die „Ursuppe“ zu einer sinnvollen und geregelten Welt zu gestalten. Annika Haller wartet mit einem kontrastreichen Bühnenbild auf und unterstützt damit die Absicht Stöpplers, einerseits die langsam verkommende Natur anhand eines eisigen und mythisch anmutenden Brünnhildenfelsens zu zeigen, der langsam aber imposant aus dem Nornenbild entsteht. Auf ihm entwickelt Brünnhilde mit ihrer reinen Liebe zu Siegfried gleichwohl noch einmal letzte Kräfte der Menschlichkeit und Empathie, weil sie diese nicht nur bei Siegmund und Sieglinde zuerst erfahren, sondern in der Beziehung zu Siegfried noch weiter ausgebaut hat.
Noch kann Brünnhilde deshalb dem Naturverfall und damit dem drohenden Verlust ihres Mediums trotzen, während Stöppler die Bühnenbildnerin eine Gibichungenhalle bauen ließ, die die Wotanstochter im 2. Aufzug in eine hedonistische Welt voller Oberflächlichkeit, Überdrüssigkeit und Orientierungslosigkeit eintreten lässt, die schockierender für sie kaum sein kann. Nachdem sie durch ein geschickt gelöstes Betrugsspiel von Siegfried und Gunther, die beide identisch wie Weltraumfahrer - in allerdings hellgelben (Neid/Neidspiel?) - Anzügen aussehen, kommt sie in einen eleganten, holzgetäfelten Salon, in dem die wesentlichste Beschäftigung darin besteht, sich von Hagen hochprozentige Drinks machen zu lassen. Wenn die Mannen, natürlich ohne Bewaffnung, und die Frauen kommen, wird einem schnell klar, dass dies eine Welt ist, die auf reinem Schein, menschlicher Missachtung und der Suche nach dem eigenen Vorteil basiert. Gesine Völlm hat nicht nur hier Gelegenheit, ihre facettenreiche Phantasie als Kostümbildnerin zu dokumentieren.
Stöppler zeigt an Hagen eindrucksvoll, wie sehr auch er von seinem Vater benutzt wird, um den Ring der ultimativen Macht zurück zu gewinnen und daran eigentlich schon im 2. Aufzug zerbricht. Siegfried hat er zuvor noch mit einer Droge das Gedächtnis dermaßen zersetzt, dass dieser ständig weiteren Stoff braucht und nie mehr Herr seiner selbst wird, bis zum finalen Gesang auf Brünnhilde, die ihn dabei wie zum Tode vorbereitet. Als Kehrseite der feinen Welt der Gibichungen sieht man die verkommenen Rheintöchter im verschlungenen und verdreckten Geäst der Versorgungsrohre der Gibichungenhalle. Diese Produktion lebt dramaturgisch und optisch von starken Kontrasten, die sich aber immer stringent in der Ausdruckswelt Richard Wagners bewegen.
Wenn es bei Elisabeth Stöppler neben ihrer starken Zeichnung der Brünnhilde als liebender und letztendlich dominanter Frau einen Versuch gab, eine „weibliche Sicht“ auf den „Ring“ zu werfen, dann entstand er aus ihrer Feststellung, dass nirgendwo in der Tetralogie die Mütter der zahlreichen Töchter auftreten, bei denen sich Rheintöchter, Nornen und Walküren, aber m.E. auch Sieglinde, trösten könnten, insbesondere bei der Urmutter Erda. So kommt es im Finale zur großen Wiederbegegnung von Erda mit ihrer Tochter, den Rheintöchtern, der 1. Norn (die anderen beiden waren ja hier im 3. Aufzug anderweitig besetzt), und aus der Ferne auch Gutrune. Erda umarmt Brünnhilde herzlich, ein noch weiblicherer Schluss, zumal angesichts der dazu erklingenden Melodie der Sieglinde zur Mutterliebe, ist wohl kaum denkbar, aber auch nicht ganz neu. Barry Kosky ließ in Essen seine nackte, weit über 80jährige Erda, zu den Schlussakten vom Souffleurkasten ins Publikum starren. Und bei Jasmin Solfaghari waren in Odense 2018 am Schluss die Frauen auf der Bühne, die in den letzten Szenen beteiligt waren, also die trauernde Gutrune, die Rheintöchter und Brünnhilde. Diese luden dann immerhin die bei Wagner vorgesehenen „Männer und Frauen“, also das überlebende Volk (bei Solfaghari der Herrenchor der „Götterdämmerung“) zu sich. So fanden sich in Odense eine Göttin, Nixen, eine Königstochter und das Volk zusammen. Ein wohl auch als „weiblich“ zu charakterisierender Schluss, aber wohl eher im Sinne Richard Wagners als jener in Chemnitz. Denn nur aus Frauen kann sich nun mal keine neue Welt entwickeln. Und dass sie bei aller Mutterliebe ganz untergeht, wollte Wagner ja am Ende doch nicht…
Martin Iliev merkte man an diesem Abend an, dass er sich mit dem „Götterdämmerung“-Siegfried wohler fühlt als mit dem jungen. Er konnte auf seine klangvolle, baritonal abgetönte Mittellage vertrauen und sorgte auch darstellerisch für eindrucksvolle Momente. Stéphanie Müther war wieder eine starke Brünnhilde, sowohl schauspielerisch wie stimmlich, wenn auch manches an diesem Abend etwas metallisch geriet. Sie wurde der am Ende alles Wissenden voll gerecht. Jukka Rasilainen verkörperte den alternden Alberich im Einreden auf seinen Sohn nachdrücklich, und die Fricka der Abende zuvor, Anne Schulte, beeindruckte als emotionale und dramatische Waltraute. Die Sieglinde der „Walküre“, Cornelia Ptassek, war nun auch eine stimmlich wie darstellerisch überzeugende Gutrune. Pierre-Yves Pruvot gab einen etwas unauffälligen Gunther. Der noch recht junge Rumäne Marius Bolos verkörperte eher einen Hagen light, blieb der so zentralen Figur in der „Götterdämmerung“ einiges an Bedeutungsschwere und stimmlichem Volumen schuldig. Aber das passte auch wieder zu der hier gewählten Rollenkonzeption einerseits als Barkeeper und andererseits als vom Vater völlig gebrochener Sohn. Anja Schlosser, Sylvia Rena Ziegler und Cornelia Ptassek waren stimmschön agierende Nornen, und die Rheintöchter Guibee Yang, Sylvia Erna Ziegler und Sophia Maeno verliehen ihrer Enttäuschung über den Geiz des Helden angemessenen stimmlichen Ausdruck. Die von Stefan Bilz einstudierten Damen und Herren des Opernchores und Chorgäste sangen kraftvoll und waren sehr phantasievoll und dynamisch choreografiert.
Der Spanier Guillermo Gracía Calvo, seit der Spielzeit 2017/18 Generalmusikdirektor an den Theatern Chemnitz, leitet diesen „Ring“, der nicht sein erster ist. Er hat auch die Stabführung der Tetralogie am Teatro Campoamor in Oviedo und bereits über 200 Aufführungen an der Wiener Staatsoper dirigiert. In Wien studierte er auch an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Nach einigen anfänglichen Nervositäten im „Rheingold“, die zu einem guten Teil wohl auch der unruhigen Regietheater-Produktion von Verena Stoiber geschuldet sind, lief der junge GMD mit der gewohnt guten Robert-Schumann-Philharmonie zu einer außergewöhnlichen Hochform auf. Man merkte ihm an, dass ihm Richard Wagner etwas ganz Besonderes bedeutet, auf das ich im nächsten Heft bei Wiedergabe eines Interviews mit ihm noch näher eingehen werde. Calvo wurde ab dem „Siegfried“ zu den jeweils 3. Aufzügen mit großem Auftrittsapplaus bedacht. Und das völlig verdient. Er wusste ebenso große dynamische Steigerungen auszuformen und dabei hohe Transparenz der einzelnen Gruppen zu wahren, wie auch die kontemplativen und ruhigeren Passagen ausmusizieren zu lassen. Ein guter Kontakt mit allen Sängern sicherte große Harmonie zwischen Bühne und Graben. Man kann die Theater Chemnitz zu diesem Engagement nur beglückwünschen. Von diesem Musiker wird noch einiges zu erwarten sein, und wohl nicht nur in Chemnitz.
Gibt es also nun eine spezifisch „weibliche Sicht“ auf den „Ring“? Muss es überhaupt eine „weibliche Sicht“ gegenüber einer „männlichen“ geben?! Nach allem, was zuvor und nun in Chemnitz zu erleben war, denke ich, dass Wagner auch diese Komponente in sein Riesenwerk eingebaut hat, zumal das Weibliche ihm doch nur allzu hold war. Es ist eigentlich nur eine Frage, ob, wie und in welcher Intensität man diese Elemente dramaturgisch und konzeptionell hervorhebt bzw. hervorheben will. Und das kann, wie ich glaube, bei gutem Studium dieses Werkes sowohl ein Regisseur wie eine Regisseurin…
Klaus Billand 2.5.2019
Fanco Faccio
HAMLET
Premiere:03. November 2018
Besuchten Vorstellung: 17. März 2019
Nach 132 Jahren aus dem Archiv wieder erweckt
Das Opernhaus Chemnitz hatte zum zweiten Zyklus der deutschen Erstaufführung der Oper „Hamlet“ (Amleto) von Franco Faccio (1840-1891) eingeladen. Der dreiundzwanzigjährige Schriftsteller Arrigo Boito (1842-1918) dichtete in Anlehnung des Shakespeare-Dramas „Hamlet“ für seinen Schulfreund, dem fünfundzwanzigjährigen Komponisten Franco Faccio, in den 1860er Jahren das Amleto-Libretto. William Shakespeare schuf sein Bühnenstück „The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke“ zwischen Februar 1601 und Sommer 1602. Von einer Vielzahl von nordischen Legenden angeregt, die der Chronist „Saxo Gramaticus“ im 13. Jahrhundert in seiner „Gesta Danorum“ aufbewahrt hatte, war über das tragische Schicksal eines dänischen Prinzen sein Bühnenwerk gestaltet worden. Wohl der Tod eines ihm verwandten Mädchens, das im Alter von zweieinhalb Jahren beim Blumenpflücken ertrank und den fünf Jahre alten William tief beeindruckte, verdanken wir die Figur der „Ophelia“ in der Tragödie.

Arrigo Boito hatte das Libretto so eng als möglich an Shakespeare angelehnt, reduzierte die 19 Szenen auf sieben, beließ aber die Zitate der großen Monologe „Sein oder Nichtsein“; „Oh, dass auch dieses feste Fleisch schmelzen würde“; „Der Rest ist Schweigen“ u. a.. Er verwendete auch eine größere Vielfalt von Versformen und Ausdrücken, die sich in seinen späteren Shakespeare-Libretti nicht mehr finden. Franco Faccio komponierte dafür eine hochdramatische, aber wenig poetische Musik. Eingängige Melodien fehlen ebenso wie profilierte Themen für die Neben-Charaktere. Selbst die leidgeprüfte Ophelia bleibt, wie alle Mitspieler des Titel-Tenors, seltsam farblos. Von der Stilistik scheint der späte Verdi vorweggenommen. Mit der Komposition des Librettos haben diese beiden Burschen die erste Vertonung eines Shakespeare-Stoffes in der Reihe italienischer Shakespeare-Vertonungen geschaffen und damit eigentlich die Opernwelt von Kopf bis Fuß erneuert.

Obwohl insbesondere Arrigo Boito an die Tragödie in vier Akten viele Erwartungen und Hoffnungen knüpfte, führte die begeistert aufgenommene Premiere im Teatro Carlo Felice in Genua am 30. Mai 1865 nicht zu einem nachhaltigen Erfolg. „Die Oper sei nicht melodisch genug“. Eine überarbeitete Fassung des „Amleto“ geriet am 12. Februar 1871 an der Mailänder Skala dann zum Misserfolg, weil der Tenor der Titelrolle „vollkommen ohne Stimme und desorientiert“ kaum zu hören war. Entmutigt vernichtete Faccio Teile des Notenmaterials, bemühte sich nicht weiter um seine Komposition und begnügte sich als erfolgreicher Dirigent vor allem Verdi-Kompositionen zum Erfolg zu verhelfen. Auch Boito konzentrierte sich auf seine Schriftsteller–Arbeit, komponierte die Erfolgsoper „Mefistofele“ und ist uns vor allem als Verdi-Librettist ein Begriff geworden. Selbst Bemühungen des Faccio-Schülers Antonio Smareglia um die Partitur blieben erfolglos. Mehr als hundert Jahre haben die Fragmente dieser Arbeit von Arrigo Boito und Franco Faccio in den Archiven des Musikverlages Ricordi geschlummert, bis der amerikanische Musikwissenschaftler und Dirigent Anthony Barrese im Jahre 2003 begonnen hat, diesen Schatz zu heben.

Mit einigen Helfern sichtete er mit erheblichen Mühen das Material, das zum Teil auf Mikrofilm oder als verblasste Autographen zur Verfügung stand. Nach Variantenvergleichen und über die Erstellung einer Klavier-Vocal- Partitur vervollständigte er bis zum Dezember 2004 die Oper „Amaleto“.
Auf die Bühne brachte der Perfektionist Antonio Barrese seine Rekonstruktion nur schrittweise. Erst mit der ersten Wiederaufführung 2014 in Albuquerque (New- Mexiko) war „Amleto“ der Opernbühne zurück gegeben. Nach Europa kam die Opernrekonstruktion am 20. Juli 2016 mit einer opulenten Inszenierung von Olivier Tambosi bei den Bregenzer Festspielen. Aus Unsicherheit, wie das verwöhnte Publikum diese „Neuheit“ aufnehmen werde, gab es in Bregenz nur ganze drei Aufführungen.

Die Oper Chemnitz übernahm die Bregenzer Arbeit mit dem gefragten Regisseur nebst dessen Ausstatter-Team für eine deutsche Uraufführung und brachte eine faszinierende Inszenierung auf die Bühne. Die Handlung springt mit dem Krönungsfest und einem Trinklied des neuen Königs mitten ins Geschehen. Diese Feststimmung mit dem Trinklied kehrte im Schlussakt wieder, wobei sich die Situation zur allseits bekannten skurrilen Mordserie entwickelt. Damit erhält die Handlung einen Rahmen, in dem Olivier Tambosi den traurig-zögerlichen Prinzen als den Rächer, den Liebhaber, den Sohn, den Philosophen, den Intriganten und den Theaterkritiker in jedem Part Glaubwürdigkeit verschafft. Die Bühne des Frank Philipp Schlößmann und die historisierten Kostüme der Gesine Völlm streng in Rot-Schwarz-Weiß sowie eine gekonnte Lichtregie des Davy Cunningham schaffen eine permanent gespenstige Grundstimmung. Eine Ausnahme bietet nur das in Grün-Beige gestaltete Schauspiel, von Boito als Persiflage auf das Opernwesen seiner Zeit gestaltet. Mit gekonnter Personenführung, intensiver Einbeziehung des perfekten Chores, der Tänzerinnen und kreativer Nutzung der Drehbühne schafft er, die übrigen Protagonisten mit Hamlet in Beziehung zu bringen. Da ist vieles konzentriert, bündig und schlagkräftig. Vor allem ab dem dritten Akt steigert sich die Aufführung. Die Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie mit dem Dirigat des Dan Raţiu bringen neben einer ausgereiften Sängerbegleitung vor allem die den Schöpfern der Oper so wichtige sinfonische Ausmalung der Partitur zur Geltung.
Für die Hauptrollen waren ausgezeichnete Sängerdarsteller aufgeboten worden. Mit packend intensivem Spiel und mit nüchtern-heller flexibler Tenorstimme gab der Spanier Gustavo Peña dem zerrissenen Titelhelden die notwendige Struktur. Dem König Claudius in seinem fiesen Denken wurde von Pierre-Yves Pruvot mit seinem dunkel-bedrohlichem Bariton überzeugende Wirkung verschafft. Als Hamlets Mutter Gertrud sang und spielte Katerina Hebelkova mit einem dunklen Mezzo in der Tiefe und gleisnerisch in der Höhe die dramatischen Glanzpunkte der Aufführung. Packend war die Ophelia von Guibee Yang mit ihrem weichen strömenden Sopran in den Szenen ihrer Liebe und Verzweiflung.

Wären noch zu erwähnen: der elektronisch-akustisch verstärkte Bass-Bariton von Noé Colín als bedrohlich tönender Geist des ermordeten Vater Hamlets, das ordentlich besetzte Freundespaar des Titelhelden Horatio - Marcello mit Ricardo Llamas Márques und Matthias Winter sowie der etwas schwächere Laertes von Cosmin Ifrim. Wegen des Ausfalls des Polonius-Darstellers wurden die Partien des Hofmarschalls vom Bass des Hausensembles Ulrich Schneider überzeugend von der Seite zu Gehör gebracht und szenisch vom Statisten Mario Koch auf der Bühne implantiert.
Ein Sonntag-Nachmittag, der wieder einmal unser Verlangen nach Musik abseits des gängigen Repertoires gestillt hatte. Vor allem deshalb, weil diese Neuentdeckungen vor halsbrecherischen Verfremdungen geschützt sind. Letztlich bleibt aber für den von Wagner, Mahler und Bruckner verwöhnten Hörer, dass die Komposition Faccios nicht über die erwartete Dramatik und Tiefe verfügt.
Im Spielplan des Chemnitzer Opernhauses sind noch Vorstellungen der zu empfehlenden Hamlet-Inszenierung
Thomas Thielemann 19.3.2019
Bilder (c) Theater Chemnitz
P.S. Folgevorstellungen am 29. März, am 28. April und am 5. Mai 2019
SIEGFRIED
Vorstellung vom 10.11.2018
Frauenpower für den gesamten Ring
TRAILER

Nachdem in der Staatsoper Stuttgart und im Badischen Staatstheater Karlsruhe der “Ring” von unterschiedlichen männlichen Regisseuren in Szene gesetzt wurde, war es an der Zeit, dieses Projekt in die Hände von Frauen zu geben. Nach der Götterdämmerung wird man erfahren, ob das Konzept ein erfolgreiches Ende gefunden hat.
Die gesellschaftskritische Thematisierung um Machtmissbrauch und Kapitalismus tritt im “Siegfried” in den Hintergrund, dafür wird dem Besucher eine Zeitreise der Titelfigur präsentiert. Im 1. Akt erlebt man den Wissensdrang des pubertierenden Helden um seine Herkunft und das Schmieden des Schwertes Nothung, das mit einem Fluch behaftet ist und man es demzufolge mit herkömmlichen Mitteln nicht zusammenfügen kann. Siegfried befreit das Schwert von dem Fluch, indem er es wieder in den Naturzustand versetzt.

Im 2. Akt räumt er mit diesem Schwert Nothung alle unliebsamen Genossen aus dem Weg und es werden mit Hilfe eines Naturwesen Gefühle für das ihm unbekannte weibliche Geschlecht geweckt. Im 3. Akt kommt es dann zu der erwarteten emotionalen Begegnung, die mit den bekannten Worten “Leuchtende Liebe, Lachender Tod” endet, sofern das in das Konzept der Regie passt.
Zum großen Teil wurden diese Vorgaben von der Regie erfolgreich umgesetzt, wobei die negativen Eigenschaften des männlichen Geschlechtes ein wenig übertrieben dargestellt werden.

Gleich zu Beginn im so genannten Vorspann wird auf der Bühne gezeigt, wie Mime zwar Sieglinde bei ihrer Geburt mittels Kaiserschnitt hilft, aber anschließend das Bündel mitsamt den Schwertstücken an sich reißt und zum Abschied die Sterbende mit Schlägen drangsaliert. Im zweiten Akt kommt es zu einer Art Vergewaltigungsszene zwischen Alberich und einem Nibelungenwesen, was allerdings verwunderlich ist, da er doch im Rheingold nach dem vergeblichen Werben um die Rheintöchter seinen Sexualtrieb in einen Machttrieb umgewandelt hat. Auch der Göttervater zeigt sich gewaltbereit, als er das Waldvöglein kurzerhand tötet, wobei kein ersichtlicher Grund vorlag. Das ist durchaus vertretbar, denn er hat ja seinen eigenen Sohn Siegmund geopfert, als dieser in seinen machtpolitischen Überlegungen keine Rolle mehr spielte. Während Wotan glaubt, mit Siegfried den freien Helden geschaffen zu haben, der eine neue Weltordnung herbeiführen kann, hat sein Pendant Alberich, Hagen gezeugt, der ihm den Ring, als Synonym für die Weltherrschaft, wieder beschaffen soll.

Der kleine Hagen soll hier Erfahrung für sein späteres Wirken in der Götterdämmerung sammeln. Übrigens hat auch aus dem selben Grund, Mime den kleinen Siegfried zu sich genommen. Obwohl Fafner eigentlich keine Funktion ausübt (Zitat: Ich lieg´ und besitz‘), hat er eine Schar von Statisten zwangsweise um sich gesammelt, die vermutlich seinen Schatz bewachen müssen und nach dem tödlichen Kampf von Fafner mit Siegfried, ihre wiedergewonnene Freiheit feiern.
Das einfach gehaltene Bühnenbild, das abgesehen von kleinen Veränderungen, über alle drei Akte besteht, ist funktional, dabei wird weitgehend auf Requisiten verzichtet. Ein großer Teil der Bühnenfläche wird für die abwechslungsreiche Personengestaltung freigehalten. Im 3. Akt beim Auftreten von Brünnhilde zeigt die Regie statt des Feuerzaubers Statisten, die mit brennenden Kerzen Brünnhilde bewachen. Insgesamt handelt es sich um eine transparente, textgetreue und verständliche Inszenierung, die von den Besuchern mit dementsprechenden Beifall belohnt wurde.

Die Verantwortung für die musikalische Leitung der Robert-Schumann-Philharmonie lag in den Händen des GMD Guillermo Garcia Calvo. Während bei den Schmiedeliedern das Forte manchmal zu ausgeprägt war, überzeugte das Orchester im zweiten Akt bei den dramatischen Szenen und konnte beim Waldweben mit ihren einfühlsamen Klängen eine erhebende Stimmung vermitteln, die einen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Im 3. Akt gleich zu Beginn vor dem Auftritt der Erda, gilt es, mit den Tempisteigerungen vorsichtig zu hantieren, um die nötige Spannung zu erhalten, was hervorragend gelungen war. Insgesamt kann man von einer ausgewogenen und eher forschen Interpretation sprechen.
Ralf Lukas als Wanderer, ein bewährter Wagnerinterpret, konnte mit seiner kraftvollen Stimme ebenso überzeugen, wie sein Widersacher, Jukka Rasilainen als Alberich. Gerhard Siegel, stimmgewaltig und mit eigenartiger Interpretation (singt diese Partie auch an der Met) war einer der Höhepunkte. Das Ensemblemitglied Magnus Piontek sang den Fafner mit eher sanftem Bass.

Rebecca Teem, sang ihr Brünnhilde gefühlvoll, mit langem Atem (“Heil dir Sonne!”) und ausdruckstark. Simone Schröder als Erda glänzte mit ihrem voluminösen Alt und den Waldvogel sang Guibee Yang. Daniel Kirch war ein Siegfried mit großer heldenhafter Stimme
Diese Partie gehört zweifelsfrei stimmlich und darstellerisch zu den ganz großen Herausforderungen im Heldenfach. Daniel Kirch besitzt neben seiner guten Technik, eine heldenhafte Mittellage, ist zu einer strahlenden Höhe fähig und verfügt über die nötige Durchschlagskraft, um gegen große Orchester bestehen zu können. Dafür musste er erstmals die berühmte Ochsentour durchlaufen, beginnend mit kleineren Rollen in Oper und Operette, um sich langsam aber stetig für das schwierige Heldenfach hochzuarbeiten. Kein Wunder, wenn Brünnhilde’s Liebe zu dem Helden bis zum Ende der Götterdämmerung mit großer Leidenschaft anhält.
Franz Roos 13.11.2018
Dank für die tolle Fotos von Nasser Hashemi
und
Dank an unseren Kooperationspartner Merker-online (Wien)
Weitere Vorstellungen: 19.01.2019, 20.04.2019, 08.06.2019
Franco Faccio
Amleto
Premiere/deutsche Erstaufführung: 03.11.2018
Aus dem Dornröschenschlaf erweckt
Lieber Opernfreund-Freund,
nicht oft hat man die Gelegenheit, ein über fast eineinhalb Jahrhunderte vergessenes Musiktheaterwerk erstmals auf einer deutschen Bühne zu hören. Dass es sich dabei um eine gelungene Vertonung des shakespearschen Hamlet-Stoffes, bei der einfach alles stimmt, ist ein unglaublicher Glücksfall – und seit gestern in Chemnitz zu erleben.

Der Italiener Franco Faccio, 1840 geboren, gehörte zusammen mit Arrigo Boito der Künstlergruppe La Scapigliatura an, die sich ab 1860 für eine Erneuerung der Kunst einsetzte und den herkömmlichen Stil in Literatur, Musik und bildender Kunst ebenso ablehnte wie die bürgerliche Lebensweise. Nach Jahren in Frankreich, Skandinavien und Deutschland wurde Faccio Direktor der Mailänder Scala und tat sich vor allem als Dirigent hervor, leitete u.a. die italienischen Erstaufführungen von Verdis Aida und Otello. Sein kompositorisches Schaffen beschränkt sich im Wesentlichen auf drei Sinfonien und zwei Opern, deren zweite ein Libretto seines Freundes Boito vertonte. Dieser Hamlet wurde nach seiner freundlich aufgenommenen Uraufführung 1865 noch ein einziges Mal 1871 unter der Leitung des Komponisten aufgeführt, geriet allerdings zum Fiasko, da der Hauptdarsteller krank sang und kaum zu hören war, worauf Faccio selbst die Partitur zerstörte. Erst 2003 begann der Komponist und Dirigent Anthony Barrese mit einer Rekonstruktion des Werkes, die 2014 in den USA erstmal konzertant zu hören war und nun als Übernahme von den Bregenzer Festspielen aus dem Jahr 2016 als deutsche Erstaufführung in Chemnitz zu erleben ist.

Boito verschlankt das Drama Shakespeares, reduziert die 19 Szenen der literarischen Vorlage auf 7, erliegt allerdings nicht der Versuchung, wesentliche Aspekte des Werks zu Gunsten der Liebesgeschichte beiseite zu lassen, wie seinerzeit durchaus üblich, sondern zeigt das Werk in all seiner Komplexität. Faccios Kompositionsstil ist ein origineller Stilmix mit traditionellen Elementen wie Märschen und Tänzen, gespickt mit einfallsreichen Vorspielen und Intermezzi, gewürzt mit nahezu impressionistisch daherkommenden, schwelgerischen Melodienbögen, die teilweise Puccini bereits vorwegnehmen. Er spielt mit den Erwartungen des Publikums, bricht mit diesen und schafft so ein dichtes Werk voller musikalischem Tiefgang.

Der österreichische Regisseur Olivier Tambosi legt bei seiner szenischen Umsetzung den Fokus nicht auf die Titelfigur allein, sondern setzt alle Protagonisten – jeden für sich – ins Zentrum seiner Inszenierung. Er visualisiert die komplizierten Beziehungen der Figuren zueinander gekonnt durch hervorragende Personenführung, bedient sich dabei der herausragenden Lichtregie von Davy Cunningham, die nahezu permanent eine gespenstisch-drohende Stimmung erzeugt, sowie den historisierenden Kostümen von Gesine Völlm, die ganz in schwarz/weiß/rot gehalten unter anderem bedeutungsschwanger mit Augen versehen sind. Jeder steht ständig unter Beobachtung, die ganze Welt ist eine Bühne, auf der jeder seine Rolle spielt – und aus der doch auch wiederum jeder ausbrechen will. Alles ist dauernd in Bewegung auf der spiegelnd-glänzenden Drehbühne, auf der Frank Philipp Schlößmann das Theater im Theater – auch abseits der Schauspielszene im zweiten Akt – darstellt und auf der Tambosi das Drama atmosphärisch dicht in obskuren Farben nachzeichnet.

Und auch die Sängerriege kann sich sehen und hören lassen. Der Spanier Gustavo Peña bringt die für die Gestaltung der Titelfigur nötige Strahlkraft mit, setzt seinen farbenreichen Tenor gekonnt ein – auch wenn er in den Höhen mitunter zu Tremoli neigt – und überzeugt darüber hinaus durch unglaublich packendes, intensives Spiel des zerrissenen Titelhelden. Pierre-Yves Pruvot stattet den Claudius mit dunkel-bedrohlichem Bariton voller Kraft aus, während Katerina Hebelkova Hamlets Mutter Gertrude energisch anlegt und nicht nur in ihrer großen Szene im dritten Akt darstellerisch die Bühne beherrscht. Tatiana Larina ist eine zart-betörende Ophelia, deren weicher Sopran schier endlos strömt und auch die weiteren Partien müssen sich nicht verstecken. Magnus Pionteks Polonius überzeugt ebenso wie Ricardo Llamas Márquez und Matthias Winter als Freundespaar Horatio und Marcellus und Cosmin Ifrim zeigt als Ophelias Bruder Laertes die vielen Facetten seines feinen Tenors. Aus der Riege der kleineren Rollen sticht Tommaso Randazzo mit klaren Farben heraus. Einziger akustischer Kritikpunkt bleibt für mich die völlig überflüssige elektronische Verstärkung von Noé Colíns durchschlagendem Bassbariton. Aber das ist Makulatur.

Der Chor hat gut zu tun im Amleto, singt prägnant und klingt ausgewogen, Stefan Bilz hat ihn hörbar intensiv auf seine Aufgabe vorbereitet. Im Graben erweist sich Gerrit Prießnitz als wahrer Magier am Taktstock. Von den wuchtigen Eingangstakten über die farbenreichen Vor- und Zwischenspiele bis zur gefühlvollen Arienbegleitung will einfach alles gelingen. Sein lupenreines Dirigat macht den Abend so zusammen mit der packenden Regie und der ausgezeichneten Leistung des Vokalensembles zum Gesamtkunstwerk. Das Publikum im nicht ganz voll besetzten Chemnitzer Opernhaus ist entsprechend begeistert – und auch ich kann den Abend nicht genug loben und wälze schon meinen Kalender, ob es mir gelingt, eine der weiteren sechs Aufführungen zu besuchen. Vielleicht treffe ich dabei ja Sie, lieber Opernfreund-Freund, denn ich kann diese Produktion rückhaltlos empfehlen.
Sollten Sie meiner Empfehlung folgen, lege ich Ihnen unbedingt noch die lohnenswerte Einführung von Christiane Dost ans Herz. Fundiert und informativ, mit allerhand Hintergrundmaterial zum Werk und seiner Entstehung gehen Sie danach bestens vorbereitet in die Aufführung.
Ihr Jochen Rüth 4.11.2018
Die Fotos stammen von Nasser Hashemi.
NON(N)SENS
Musical von Dan Goggins
origineller TRAILER
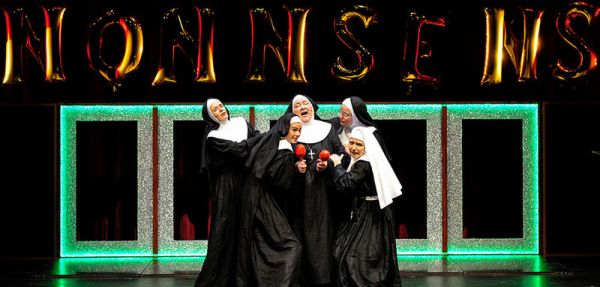
Aufführung am 26. 11.2017
Die Chemnitzer Oper gibt sich zum Auftakt der neuen Spielzeit recht musicalfreundlich, wartet sie doch binnen zweier Monate mit drei Neuproduktionen (allesamt Erstaufführungen) auf, wovon Dan Goggins‘ Off-Broadway-Erfolg die nunmehr jüngste Position einnahm. Leider existiert das Format „Oper auf der Hinterbühne“ nicht mehr, denn hierfür hätte sich das intime Stück weitaus eher angeboten als für den ausladenden Rahmen der eigentlichen Spielfläche des Opernhauses.

So verstand denn Gesamtausstatter Walter Schütze die Not als vermeintliche Tugend, indem er das Geschehen fast durchweg vor dem Vorhang ansiedelte und selbigen vorrangig nur zu einigen Videoeinspielungen lüftete. Linkerhand positionierte der Bühnenbildner ein estradenähnliches Gebilde, auf dessen dem Publikum zugekehrter Rückwand Andeutungen klösterlicher Atmosphäre ablesbar waren. Rechterhand hatte Jakob Brenner, virtuoser musikalischer Leiter der Inszenierung und für die Backing Tracks mit Musikern der Robert-Schumann-Philharmonie und Gästen zuständig, an einem Orgelpositiv Platz genommen. Da stellte sich schon die Frage, ob Schütze mit einem verminderten Budget vorlieb nehmen musste, zumal andererseits Mittel für Videosequenzen mit dem MDR und einen Ausflug der Nonnen durch Chemnitz und Umgebung (einschließlich einer Begegnung mit der Oberbürgermeisterin) zur Verfügung standen. Wieso sprach zudem Gunther Emmerlich den Begrüßungstext, wenn Regisseur Matthias Winter diese Aufgabe problemlos übernehmen könnte?

Da sich die Regie weder auf die Haupt- noch auf die Hinterbühne begeben konnte, ergriff sie Flucht nach vorn, wobei sie das begeistert reagierende Publikum zu fleißigem Mittun animierte, sei es mittels rhythmischen Klatschens oder der Beteiligung an der ausufernden, ohnehin etwas substanzarmen Quizrunde. Da ließen denn doch der Musikanten-Stadel oder andere Perlen der Unterhaltungskunst grüßen, geriet die eigentliche Fabel in den Hintergrund.
Glücklicherweise verfügt die Inszenierung über ein Solistinnen-Quintett, das der Aufführung unentwegt Glanzpunkte garantiert und ein darstellerisches, vokales und tänzerisches Feuerwerk (Choreographie: Peter Schache) zündet. Als „prima inter pares“ sei zunächst Monika Straube, langjährige Altistin des Hauses, genannt, die als Ruheständlerin nochmals den Sprung auf die Bühne wagt und nicht zuletzt mit einer rundum gelungenen Jazz-Einlage als Oberin das Auditorium in ihren Bann zieht.

Wunderbar in ihrer schüchternen Zurückhaltung, der überaus glaubwürdigen Angst vor der eigenen Courage glückt Hanna Moll (Schwester Amnesia) ein prächtiges Chemnitzer Debüt. Dass der über sie hereinbrechende Geldsegen von der Regie nahezu untergebuttert wird, dürfte dem Konto der jungen Dame nicht anzulasten sein. Als „Zweitbesetzung“ Robert Anna errang sich Claudia Müller-Kretschmer mit versiert interpretierten Musical-Hits berechtigten Applaus. Die Schwester Maria Hubert wurde von Sylvia Schramm mit verrucht rauchigen Tönen angereichert, während Katharina Boschmann als verhinderte Ballerina die Lachsalven der Besucher auf ihrer Seite hatte, ohne auf billige Art und Weise um deren Gunst zu buhlen. Mithin erbrachten die genannten Damen (zweifellos vom Regisseur fachkundig geführt) mehr als die Hälfte der Miete.
Bilder (c) Theater Chemnitz
Joachim Weise 1.12.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Aufführung am 16. 3.2017
Mit stupender Beharrlichkeit geht es der Operette seit einiger Zeit ans Leder, häufig wird sie als überlebt diffamiert, ihr gar ein Tod auf Raten prophezeit. Diesen Schwarzsehern boten nunmehr der renommierte Komponist Benjamin Schweitzer und dessen Librettist Constantin von Castenstein eine Steilvorlage, indem sie der gescholtenen Gattung mit ihrer jüngsten Schöpfung quasi ein Begräbnis erster Klasse bereiteten. Als Ausgangspunkt dienten ihnen die diversen Finanzcrashs unserer Tage, und somit gewähren sie ihren beiden historisch belegten Anti-Helden John Blunt und George Caswall eine Art Zeitreise, die die beiden Gauner aus der Gegenwart, hernach assistiert von den Damen Pandora und Lady Hamilton, nach England (18. Jahrhundert) und Holland (17. Jahrhundert) katapultiert, wo sie als Chefs der South Sea Company und später mit der von ihnen initiierten Tulpen-Blase samt den auf sie Setzenden beträchtlichen Schiffbruch erleiden.

Bertolt Brecht und Kurt Weill hätten sich gewiss mit Vergnügen auf eine solche Vorlage gestürzt. Leider führt uns die als Uraufführung in Chemnitz herausgekommene „Operette“ schmerzlich vor Augen, dass deren Autoren weder dem gewieften listigen Augsburger noch dem in allen musikalischen Sätteln beheimateten Dessauer das Wasser reichen können. Bevor wir an den titelgebenden zarten Geschöpfen Floras schnuppern können, müssen wir einen sich ziemlich atonal gebenden 1. Akt überstehen, dem auch das letzte Quäntchen eines nur ansatzweise überzeugenden musikalischen Einfalls abgeht. Nach der Pause schleichen sich dann einige für das Orchester dankbare spätromantische Reminiszenzen in das ermüdende Klangbild ein, soll sich eine bemühte Parodie auf Leporellos Registerarie witzig ausnehmen. Dieser minimale Ausflug ins Unterhaltsame wurde jedoch umgehend mit einem sich bis zum Geht-nicht-mehr dahinschleppenden Holzschuhtanz in sein Gegenteil verkehrt. Verbürgte historische Persönlichkeiten lassen sich z. T. nur identifizieren, wenn man die damit betrauten Darsteller seit Jahren von der Bühne her kennt.

„Wer die Operette liebt, wird sich an den witzigen Dialogen und einigen hinreißenden musikalischen Zugnummern erfreuen, aber auch erfahren, was Operette noch alles kann.“ (Benjamin Schweitzer). Schade nur, wenn dem Rezensenten besagter Witz weitgehend verborgen blieb, er die sogenannten Zugnummern suchte wie die Nadel im Heuhaufen und konstatieren musste, was die Autoren alles (noch) nicht können. Immerhin darf man den Chemnitzer Theaterleuten eine Aufführung attestieren, die alles unternahm, diesem zweifelhaften Musenkind zumindest einen Achtungserfolg zu bescheren.

Regisseur Robert Lehmeier zeichnete gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Tom Musch für eine Inszenierung verantwortlich, die ein bestens funktionierendes Theater auf dem Theater gewährte, die Möglichkeiten der Drehscheibe raffiniert einbezog und alle Darsteller, einschließlich der von Stefan Bilz einstudierten Damen und Herren des Chores, zu, soweit dies die Vorlage einräumte, plausiblen Aktionen anregte. Die historisch fein nachempfundenen Kostüme steuerte Ingeborg Bernerth bei. Auch Choreograph Danny Costello legte Wert auf rasanten tänzerischen Einsatz, bei dem erwähnten Holzschuhtanz allerdings ein aussichtsloses Unterfangen.

Zu den Positiva zählte ferner das beispielhafte Engagement aller Solisten für eine kaum zu gewinnende Schlacht. So gaben Reto Raphael Rosin und Andreas Kindschuh als die beiden Finanzjongleure zwei ausgebuffte Schlitzohren, die das Negative der Figuren beträchtlich in den Hintergrund drängten und ihre musikalisch unergiebigen Aufgaben mit Spielwitz konterten. In den Part der Lady Hamilton teilten sich seit der Premiere Sophia Maeno (Gesang) und Sylvia Schramm als Darstellerin. Als aparte Pandora gefiel Sylvia Rena Ziegler. Hans Gröning präsentierte sich mit rauhem Bariton als Sir Harley und Peter Stuyvesant. Vertretern des hauseigenen Ensembles blieben zahlreiche kleinere Parts vorbehalten. Als stummer Gast gewann die königliche Hündin Hariett Lady of Orplid die ungeteilte Sympathie des Auditoriums. Ekkehard Klemm, gebürtiger Chemnitzer und ausgewiesener Anwalt zeitgenössischer Musik, hatte die musikalische Leitung übernommen und waltete mit beispielhafter Sorgfalt seines, in diesem Fall gewiss nicht überregionalen Erfolg verheißenden Amtes.

Gewiss bedeutete die Klassifizierung dieser „Südseetulpen“ als Operette einen gehörigen Etikettenschwindel. Es wäre jedoch voreilig, Misslungenes mit dem Tod der Gattung gleichzusetzen.
Biulder (c) Theater Chemnitz / Dieter Wuschanski
Joachim Weise 26.3.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

am 13.11.2016
Bühnenhohes graues Gemäuer grenzt den Vorplatz des kaiserlichen Palastes ein. In den Schießscharten ähnelnden Aussparungen des Mauerwerks sind die abgeschlagenen Häupter der glücklosen Freier Turandots postiert. Später erweitern sich diese Nischen, um den Weisen des Landes Platz einzuräumen, die als Schiedsrichter der bislang für die Kandidaten stets letal verlaufenen Rätselshow fungieren. Bei jeder richtigen Antwort des Prinzen senken sich in die Farben Rot und Weiß getauchte meterlange Tücher aus diesen Fenstern zu Boden, das Einheitsgrau muss sich geschlagen geben. Hatte eingangs der Mandarin (Matthias Winter mit kraftvollem Bariton) den bevorstehenden Tod des jungen Persers angekündigt, bestimmen hernach die Vorbereitungen auf diese Hinrichtung äußerst wirkungsvoll en detail die Szene.

Als der gleißende Mond und der überdimensionale Gong ihre Dienste verrichtet haben, geben sie den Blick frei auf ein mit Eis versehenes Rund, aus dessen Mitte Turandot gleich einer Schneekönigin den nächsten Freier ins Auge fasst. Eine steil aufsteigende, sie von Calaf trennende Schräge versinnbildlicht angestrebte Distanz. Nach jeder gelösten Frage die Schräge von beiden Seiten minimierende Stufen brechen diesen Abstand nahezu auf. Und über all dem thront Altoum, der Sohn des Himmels, quasi von diesem an Seilen herabgleitend und auf halber Bühnenhöhe über dem Geschehen schwebend – eine Marionette nur? Dem widerspricht die von Edward Randall der Figur verliehene feste tenorale Kontur, die bei weitem keinem Greise ähnelt. Vielleicht wollte Regisseur Hinrich Horstkotte (in Personalunion auch für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich) sich aber auch nur einen Seitenverweis auf sein ausgesprochen inniges Verhältnis zum Figurentheater erlauben?

Das bisher Beschriebene verdeutlicht, wie genau und überzeugend die Regie das Werk befragt hat und mit ihren Antworten dem Publikum keineswegs einen Bären aufbinden möchte. Wenn trotzdem einige Ungenauigkeiten zu konstatieren sind, mindern diese den Wert der Inszenierung allenfalls marginal. So verwundert, wenn Liu (von Maraike Schröter vokal in allen Belangen beispielgebend gemeistert) während ihrer ersten Arie derart auf den Präsentierteller gelotst wird, dass jedermann ihre Beziehung zu Calaf wahrnehmen muss. Außerdem dürfte manchem Betrachter die dank Hydraulik in eine Art Hexenküche verlagerte umfangreiche Szene der drei Minister (André Riemer, Hubert Walawski, Andreas Kindschuh) sauer aufstoßen, wo mit dem Grauen nach britischem Muster Tollerei getrieben und aus den Gebeinen eines verblichenen Freiers ein fragwürdiger Sud angerichtet wird. Immerhin hatten die beteiligten Herren mit nimmer nachlassendem Spieleifer vollauf zu tun. Und wenngleich ich von dem Gebräu nicht naschen möchte, fand ich dessen Zubereitung recht unterhaltsam. Zweifelsfrei kann man über die sich einem Happy-End verweigernde Anlage des Finales (gegeben wurde die ungekürzte Alfano-Fassung) geteilter Meinung sein. Turandot ersticht den sie begehrenden Mann und danach sich selbst. Ist sie der Annahme, weder mit ihm noch ohne ihn leben zu können? Auch Puccini war sich eines überzeugenden Schlusses durchaus nicht sicher. Hier hätten einige konzeptionelle Gedanken im Programmheft oder zur Einführung dem Publikum gewiss hilfreich sein können.

Unter der anfeuernden Leitung von Felix Bender bot die ihm willig folgende Robert-Schumann-Philharmonie eine Puccini-Interpretation von bestechendem Niveau. Da wurden weder die brutal zupackenden Seiten noch die innigen Momente der Partitur vernachlässigt. Blech (ohne Patzer) und Schlagwerk feierten ihren großen Tag, Holz und Streicher brachten sich gleichermaßen inspiriert ein. Dennoch lief dieses überaus heißblütige Musizieren an keiner Stelle Gefahr, die Solisten zu übertönen. Klangvoll und von Stefan Bilz bestens präpariert meisterte der erweiterte Chor des Hauses seine nicht zu unterschätzenden Aufgaben.

In der Titelpartie war Morenike Fadayomi zu erleben, die den Wandel von der die Show dominierenden Diva zu einer tief verunsicherten Frau glaubwürdig nachvollzog. Den extremen Ansprüchen des Puccinischen Schwanengesanges erwies sie sich vollauf gewachsen, nahm den Zuschauer ebenso mit einem perfekten Forte für sich ein, wie sie andererseits der Wandlung zur liebenden Frau stimmlich emotionale Schattierungen beimengte. Als Timur stellte sich mit MagnusPiontek ein neues Ensemblemitglied vor, dessen sonorer Bass keine Wünsche offen ließ. Leider fiel der Sänger des Calaf (sein Europa-Debüt) gegenüber diesen Leistungen doch beträchtlich ab. JeffreyHartmans baritonal gefärbtem Tenor mangelt es an dem erforderlichen Glanz und der Durchschlagskraft für diese Aufgabe. Sein eher beiläufig interpretiertes „Nessun dorma“ geriet ihm zwar ohne nennenswerte Schwierigkeiten, entbehrte jedoch einer gefühlsmäßig ansprechenden Wiedergabe.
Joachim Weise 28.11.2016
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Bilder (c) Theater Chemnitz
Ausfall in der Hauptrolle
DIE TOTE STADT
Premiere am 25.10.2014
Eine gelungene Inszenierung mit Problemen beim Gesang
"Die tote Stadt" von Erich Wolfgang Korngold ist das einzige Stück des Komponisten, das man regelmäßig auf den Spielplänen deutscher Theater finden kann. Das liegt wohl an mehreren Problemen, zum einen an der Verworrenheit des Stückes, zum anderen an der schweren Besetzbarkeit der beiden Hauptrollen.
Die Handlung ist leicht zusammenzufassen: Der Tenor (Paul) ist Witwer und findet sich mit dem Tod seiner Frau nur bedingt ab. In seiner Wohnung hat er ihr einen Schrein errichtet, inklusive Garderobe und Haare der Verstorbenen. Als er nun auf die Tänzerin Marietta trifft, die seiner Frau Marie zum Verwechseln ähnelt, wächst in ihm Hoffnung auf ein erneutes Aufleben seiner Gefühle. Das kann natürlich nicht funktionieren und letztendlich erwürgt Paul Marietta, weil diese von ihm die Loslösung von der alten Liebe fordert. Paul erwacht - es war alles geträumt - und er beschließt, von seinem Traum belehrt, die tote Stadt (Brügge) zu verlassen. Das Ganze ist von vielen Symbolen durchsetzt (Engel, religiöse Prozessionen und Meyerbeer-Proben), so dass das Stück musikalisch und szenisch für jedes Haus eine große Herausforderung darstellt.

Chemnitz stellt sich dieser mutig - kann aber leider nur teilweise überzeugen. Auf der "Haben-Seite" sind die Inszenierung von Helen Malkowskys und die musikalische Leitung von Frank Beermann zu nennen. Malkowsky inszeniert die Oper in einem kargen, grauen Raum, ohne Fenster und Tapete (Bühne: Harald B. Thor). Bis auf ein Bett, eine Kleiderstange und einem Diaprojektor ist die Bühne leer. Dieses Zimmer wird als Ausgangspunkt für die (Alb)-Träume Pauls genutzt und kann vielfältig verändert werden. Die Operntruppe im zweiten Akt "schwimmt" mit einer großen Gondel auf die Bühne, von den Wänden läuft Wasser herab, und als großer Höhepunkt ist das Zimmer im dritten Akt überflutet; die Sänger laufen auf Wasser.
Die Kostüme von Tanja Hofmann versetzen die Charaktere in ein zeitloses Umfeld; schlicht bei den Hauptakteuren, etwas bunter bei den Schaustellern. Durch die Kombination aus Wasser, Licht, Videoprojektionen und Kostüm kommt so eine surreale Stimmung auf, die zu verzaubern weiß. Niemals rutscht es ins Vulgäre oder Geschmacklose, die dargebotenen Bilder und Szenen sind stets ästhetisch und geschmackvoll. Alles in allem eine Inszenierung, von der man sich "abholen" lassen kann. Man bekommt das Stück stringent erzählt und Bilder vor Augen geführt, die gefallen können.

Genauso filigran und präzise agiert die "Robert-Schumann-Philharmonie" unter Frank Beermann. Niemals ist es zu laut, die Einsätze sind punktgenau, die Akzente scharf und aufbrausend. Man hat nicht den kleinsten Moment das Gefühl, einen Sänger zugedeckt zu hören. Dieser Klangteppich sei Beermann hoch anzurechnen und zeigt, dass die "Robert-Schumann-Philharmonie" sich nicht hinter renommierteren Orchestern verstecken muss. Die Chance, die sich dank eines solchen Dirigats für einen Sänger böte, wird aber leider nur von einem der drei Hauptakteure genutzt, nämlich dem Bariton Klaus Kuttler als Frank / Fritz. Dieser lässt seinen klangschönen Bariton ohne jeden Makel im Legato in den Raum strömen und lässt den Zuschauer jede Note seines Vortrags genießen. Zusätzlich extrem textverständlich agiert er genauso natürlich auf der Bühne und liefert so den gesanglichen Höhepunkt dieses Abends.

Bei den beiden anderen Hauptrollen hingegen sieht es deutlich schlechter aus. Marion Ammann als Marietta bietet keinen "Strauss-Schmelz", keine melancholischen Bögen für "Glück das mir verblieb" und auch keine deutlichen Forte-Akzente. Stattdessen singt sie mit festem, unflexiblem Sopran, die Mittellage wird oft gesprochen, die Höhe meist mühsam gestemmt und dadurch für den Zuhörer nicht immer angenehm. Dennoch hört man über weite Strecken ihr Bemühen die Figur angemessen zu interpretieren, und schauspielerisch liefert sie mehrere Momente, die man zumindest optisch gerne zur Kenntnis nimmt.

Der Ausfall des Abends ist aber Niclas Oettermann als Paul. Zugegeben, er wurde als Einspringer erst sechs Tage zuvor in die Inszenierung "geworfen". Aber hat stimmlich die hohen Anforderungen der Rolle überhaupt nicht erfüllt: eine Fehlbesetzung. Sein Tenor ist ohne Glanz, ohne Legato und ohne Fokussierung. Kein einziger Vokal ist deutlich zu erkennen, und insgesamt klingt die Diktion so verwaschen, dass man nicht glauben möchte, einen deutschen Sänger zu hören. Er hat mit der Pertie zu kämpfen, deren hohe Tessitur bricht ihm (wortwörtlich) den Hals bricht. Viele Noten brachen und kratzten oder stürzten komplett ein. Tiina Penttinen singt die kurzen Auftritte ihrer Brigitta überzeugend und solide und agiert auf der Bühne sicher. Das Quartett der Schausteller bestehend aus Juliette (Guibee Yang), Lucienne (Carolin Schumann), Victorin (André Reimer) und Graf Albert (Edward Randall) setzt einen weiteren kleinen musikalischen Lichtblick. Gut geprobt, sehr ausgewogen und spielfreudig nutzen die vier jede Note ihres kleinen Auftritts im zweiten Akt. Der Chor, einstudiert von Simon Zimmermann ist nur im dritten Akt sichtbar, singt aber präzise, sauber und veredelt zusätzlich die Szene.
So ergibt sich die Frage, ob man überhaupt ein Stück von der Schwierigkeit der toten Stadt auf den Spielplan setzen muss, wenn man die passenden Hauptakteure nicht zur Verfügung hat. Denn auch mit einer Umbesetzung der Hauptpartie darf so ein musikalischer Ausfall nicht passieren.
Insgesamt gerade sängerisch leider deutlich unter dem Niveau, was man sonst von Chemnitz gewohnt ist.
Thomas Pfeiffer, 27.09.2014 Foto Copyright: Dieter Wuschanski
FUNNY GIRL
Musical von Jule Styne
Premiere: 3. Mai 2014

Frederike Haas spielte, tanzte und sang die Titelrolle
Am Theater Chemnitz hatte am 3. Mai 2014 in Koproduktion mit dem Theater Dortmund und dem Staatstheater Nürnberg „Funny Girl“ von Jules Styne Premiere. Das Libretto des Musicals, das auf eine wahre Geschichte zurückgeht und in deutscher Sprache (Übersetzung: Heidi Zeming) gezeigt wird, verfasste Isobel Lennart, die Songtexte stammen von Bob Merrill. Die Uraufführung in Boston im Jahr 1964 mit der jungen Barbra Streisand als Fanny Brice wurde ein sensationeller Erfolg, sodass das Musical postwendend an den Broadway ging und dort bis Juli 1967 insgesamt 1348 Vorstellungen erlebte. Die Verfilmung mit Barbra Streisand und Omar Sharif als Nick Arnstein wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und zählt inzwischen zu den Klassikern der Filmgeschichte.
Die Handlung: Die Revuelegende Fanny Brice bereitet sich in ihrer Garderobe auf ihren Auftritt vor und lässt ihre Vergangenheit an sich vorbeiziehen. Als sie vor zehn Jahren noch in ärmlichen Verhältnissen lebte, träumte sie, ein Showstar zu werden. Als es ihr mit Hilfe ihrer Mutter gelingt, im Theater eine Solonummer zu bekommen, begegnet sie nach der Premiere Nick Arnstein, der auf sie mit seiner charmanten Art einen tiefen Eindruck hinterlässt. Sie hat Erfolg und erhält bald einen Vertrag bei den legendären Ziegfeld Follies. Nach der erfolgreichen Premiere gesellt sich auch Nick Arnstein zu den Gratulanten. Sie lädt ihn kurzerhand zur Premierenparty, die ihre Mutter daheim veranstaltet, ein und verliebt sich in ihn. Nick muss allerdings noch in der Nacht abreisen, um sich seiner Pferdezucht in Kentucky zu widmen. Monate später taucht er in Baltimore unerwartet auf und erobert Fanny endgültig, worauf sie das Ensemble verlässt, um Nick zu heiraten. – Fanny bekommt ein Baby und Nick kauft ein Haus auf Long Island, das Familienglück scheint perfekt. Als Nick in Florida ein Spielcasino zu eröffnen plant, sucht er hiefür Geldgeber. Als Ziegfeld eine Beteiligung ablehnt, investiert Fanny den Großteil ihres Vermögens. Doch der Plan scheitert an einem Hurrikan, der das Casino hinwegfegt. Zwar versucht Fanny, ihm wieder finanziell unter die Arme zu greifen, doch Nick fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und lässt sich auf ein dubioses Schuldscheingeschäft ein, wird des Betrugs überführt und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Als er entlassen wird und Fannys Garderobe betritt, gibt es kein Happyend. Beide müssen feststellen, dass sie weiter voneinander entfernt sind, als je zuvor.
Stefan Huber orientierte sich bei seiner Inszenierung wohl nach amerikanischen Vorbildern und schuf eine flotte Tanzrevue, bei der sich das Tanzensemble bestens in Szene setzen konnte und dabei auch von der kreativen Choreographie (Danny Costello) profitierte. Die Gestaltung der Bühne, wo auch eine Treppe nicht fehlen durfte, oblag Harald B. Thor, die hübschen, teils pompösen Kostüme entwarf Susanne Hubrich.
Dass es eine Vorstellung für Schwerhörige würde, war zu befürchten. Das Orchester, die Robert-Schumann-Philharmonie, spielte unter der Leitung von Tom Bitterlich zeitweise so laut, dass „Ohrenschützer“ notwendig gewesen wären. Leider hat diese Unsitte inzwischen bei fast allen Musical-Produktionen Platz gegriffen, nicht nur in Deutschland! Nebeneffekt war, dass fast alle Sängerinnen und Sänger ihre Arien schrien, obwohl sie ohnehin mit Wangenmikrophonen ausgestattet waren. Dass Lautstärke kein Qualitätsmerkmal ist, sollte sich eigentlich bereits herumgesprochen haben.
Frederike Haas spielte die Titelrolle, den Revuestar Fanny Brice, mit heftiger Leidenschaft und großem Temperament. Hätte der Dirigent die Lautstärke des Orchesters bei ihren Arien zurückgenommen, wären vermutlich ihre „Stimmkrücken“ überflüssig gewesen! Matthias Otte gab die zweite Hauptrolle, den elegant-charmanten Nick Arnstein. Auch er war schauspielerisch sehr gut – mit ausdrucksstarker Mimik und angenehmer Stimme. Gabriele Ramm, eine Vollblut-Musicaldarstellerin – sie spielte einst auch an der Wiener Volksoper – gab Fannys Mutter Rose. Sie legte ihre Rolle sehr humorvoll und komödiantisch an. Desgleichen Marc Seitz als Eddie Ryan, Fannys Freund und Choreograph am Theater, der auch tänzerisch seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Der elegante, großgewachsene Bariton Matthias Winter spielte Florence Ziegfeld jr., den Eigentümer der legendären Ziegfeld Follies souverän und sympathisch.
Aus dem großen Ensemble, das durch ambitionierten Einsatz für den Erfolg der Produktion seinen Anteil hatte, seien noch genannt: Sylvia Schramm-Heilfort, Monika Straube, Kerstin Randall, Susanne Müller-Kaden und Ute Geidel genannt, die alle in mehrfachen Rollen (bis zu fünf!) auf der Bühne standen.
Das Premierenpublikum war von den Leistungen der Akteure angetan und belohnte alle Mitwirkenden sowie das Regieteam minutenlang mit starkem, rhythmischem Applaus. Für Frederike Haas, die Darstellerin der Titelrolle, gab es einige Bravorufe.
Udo Pacolt 27.5.14
Foto: Dieter Wuschanski
DIE HERZOGIN VON MALFI
Besuchte Aufführug: 23.03.13
Kann man ein blutrünstiges Drama wie John Websters „Die Herzogin von Malfi“ heute unkritisch als Oper vertonen? Das Werk des Shakespeare-Zeitgenossen ist ähnlich wie „Titus Andronicus“ ein Mord- und Totschlag-Spektakel im Stile von „Pulp Fiction“, das man heute kaum noch ernst nehmen kann. Trotzdem hat der Dresdner Komponist Torsten Rasch aus dem Schauspiel eine Oper gemacht, die 2010 von der English National Opera uraufgeführt wurde. Die deutsche Erstaufführung brachte jetzt das Theater Chemnitz in einer Inszenierung von Dietrich Hilsdorf heraus.

Nach dem Tod ihrs ersten Ehemanns wird die Herzogin von Malfi von ihren beiden Brüdern Ferdinand und Ludovico gezwungen einen Eid abzulegen, nie wieder zu heiraten. Die Herzogin bricht den Schwur aber noch in der gleichen Nacht und heiratet ihren Haushofmeister Antonio, mit dem sie drei Kinder bekommt. Der Söldner Bosola spioniert die Herzogin aus und verrät sie an ihre Brüder, welche die Familie der Herzogin ermorden lassen. Zwischendurch wird Bruder Ferdinand noch zum Werwolf. Zum blutigen Showdown erwürgen die Brüder ihre Schwester, bevor sie und Bosola sich gegenseitig umbringen. Als Nebenfigur gibt es noch die Prostituierte Julia, die von den Brüdern besucht und natürlich auch ermordet wird. Fazit: Am Ende sind nicht nur alle Hauptfiguren tot, sondern auch diverse Statistenrollen überleben diese Oper nicht.
Komponist Torsten Rasch, der schon 2008 an der Kölner Oper mit „Rotter“ scheiterte, kann auch mit diesem Stück wenig anfangen: Man hätte eine Musik der großen Leidenschaften erwarten können, in welcher das absurde Handeln der Figuren vielleicht glaubwürdig werden würde, oder eine grelle Überzeichnung, welche der Gewaltspirale ein ironisches Augenzwinkern im Stile von „Punch and Judy“ geben würde. Rasch tut nichts von beidem, sondern schreibt eine Musik, die emotionslos dahin plättschert. Wenn am Beginn langsame und schemenhafte Holzbläsersoli ertönen, glaubt man noch, dies sei ein vorsichtiges Herantasten in das Werk, doch Rasch tastet sich fast die ganze Oper am Stück und den Figuren vorbei.
Lediglich bei der aberwitzigen Coutertenor-Rolle des Ferdinand, den Iestyn Morris mit virtuoser Souveränität singt, dreht auch das Orchester auf. Hier schreibt Rasch dann aber einen polyphon-überdrehten Orchestersatz, der total überladen wirkt. Große Gefühle und Aufschwünge verweigert Rasch seinen Figuren, sodass die Musik ermüdend und langweilig wird. Zudem passt sie gar nicht zu den Grausamkeiten, die hier erzählt werden und die auch Regisseur Dietrich Hilsdorf auf die Bühne bringt.
Dietrich Hilsdorf orientiert sich in seiner Inszenierung mehr an Websters Drama als an Raschs Komposition, bringt ein bilderstarkes Theater im Stile der Händel-Oratorien auf die Bühne, die er in Bonn und Essen inszeniert hat. Maßgeblich geprägt wird die Aufführung von den am Barock orientierten Kostümen Renate Schmitzers und den beeindruckenden Räumen Dieter Richters, der hier drei Szenarien entworfen hat: Einen großen Palastsaal mit schmuckvoller Wandtapete, die schäbige Absteige der Prostituierten Julia und eine nackte Ziegelmauer mit dem Skelett eines Gehängten, in dem Ferdinand seine Wahnsinnsanfälle bekommt.
Der Chemnitzer Generalmusikdirektor Frank Beermann beschränkt sich am Pult der Robert-Schumann-Philharmonie weitgehend auf das Schlagen des Taktes und entlockt der Musik keinerlei emotionale Regung, während sich das Sängerensemble, soweit das hier möglich ist, um die Glaubhaftigkeit der Figuren bemüht. Tiina Penttinen singt die Titelpartie mit lyrischem Sopran als geschundene Kreatur auf der Suche nach Glück. Sarah Yorke verkörpert mit dramatischen Klängen die Prostituierte Julia. Kräftige Bariton-Schurken geben Kouta Räsänen als Bruder Lodovico und Andreas Kindschuh als Bosola ab. Dass bis auf Herzog Ferdinand die fünf weiteren Figuren nur von stummen Statisten und Schauspielern gemimt werden, ist auch ein Manko dieser Oper. Mit stummen Personen fühlt man in der Oper nicht mit.
„Die Herzogin von Malfi“ hat in dieser Vertonung nichts auf der Opernbühne zu suchen und hat man würde sich wünschen, dass die Chemnitzer Oper ihre Energien für eine hörenswerte Komposition eingesetzt hätte.
Rudolf Hermes