KONZERTE KÖLN

www.koelner-philharmonie.de
Richard Wagner
Das Rheingold
Rezension der Vorstellung am 18.11.2021
Es ist nicht die erste konzertante Aufführung des „Rheingolds“ in der Kölner Philharmonie, aber eine mit besonderem Anspruch. Das Orchester ist anders aufgestellt als sonst, je zwei Kontrabässe und zwei Harfen auf jeder Seite, die Celli rund um Geigen und Bratschen. Es wird auf Originalklanginstrumenten gespielt und in historischer Aufführungspraxis gesungen.
Mit sehr tiefem Streicherklang erhebt sich das Vorspiel, die Rheintöchter erscheinen und necken den „zankenden Zwerg“ Alberich, der bei keiner von ihnen landen kann. So entsagt er der Liebe und gewinnt die Fähigkeit, aus dem Rheingold, das er den Rheintöchtern stiehlt, einen Ring zu schmieden, der unendliche Macht verleiht. Der Rest ist bekannt: Der Ring des Nibelungen bringt Unglück, dem, der ihn besitzt, und Sorge denen, die nach ihm gieren.
Diese Parabel über den Gang der Weltgeschichte hat Richard Wagner in das Gewand der Figuren der Nordischen Mythologie gesteckt. Generationen von Regisseuren haben sich an der szenischen Umsetzung abgearbeitet, auch kleinere Stadttheater haben sich hin und wieder an diesem 16-stündigen Gesamtkunstwerk mit mehr oder weniger großem Erfolg versucht. Die Tetralogie, die Richard Wagner in einem Zeitraum von 25 Jahren schuf und 1876 im eigens für die Aufführung seiner Werke in Bayreuth erbauten Festspielhauses uraufführen ließ, wird an allen Häusern mit Weltgeltung im Repertoire geführt.
Die Protagonisten sind in Köln absolut typgerecht besetzt. Derek Welton als Wotan mit seinem voluminösen und wohlklingenden Bassbariton ist der charismatische Fürst, der seine Macht aus Verträgen und eben auch aus dem Nimbus seiner sozialen Stellung bezieht. Ihm traut man auch seine zahllosen Amouren zu, aus denen die Walküren und Siegmund und Sieglinde als uneheliche Kinder stammen. Er ist der Herrscher, der im Interesse des Machterhalts mittels Lügen und Intrigen Konflikte aussitzt und die Erneuerung aus eigener Kraft verpasst. Thomas Mohr als Loge, der skrupellose Ausputzer im Dienst dieses Fürsten, ist für mich die zentrale Gestalt dieses Dramas, denn mit technisch perfekter Artikulation verleiht er diesem amoralischen Intellektuellen Kontur. Er, der Gott des Feuers, kann als Identifikationsfigur für Anwälte und Strategen aller Art herhalten, die ihren Intellekt jedem zur Verfügung stellen, der die Macht besitzt, und geht am Schluss zu seinen Taten auf Distanz. Eine faszinierende Charakterstudie!
Daniel Schmutzhard als Alberich ist der vom Schicksal benachteiligte Mann, der sich vergebens um die Gunst der Rheintöchter bemüht. Dass Wagner ihn als „Zwerg“ charakterisiert zeigt eigentlich nur, dass er ein Außenseiter der Gesellschaft ist. Als er des Rheingolds habhaft werden kann raubt er es den Rheintöchtern und wird zum kapitalistischen Ausbeuter, der auch seinen eigenen Bruder Mime, den Schmied, versklavt. Thomas Ebenstein als Mime gibt ein Lehrstück von Kreischen, Wimmern und Schreien, als er von Alberich verprügelt wird. Die Riesen Fafner (bassgewaltig Christoph Seidl als durchsetzungsstarker Bauunternehmer) und Fasolt (anrührend: Tijl Faveyts als verliebter harter Kerl mit weichem Kern, der nicht von Freya lassen möchte und den Deal um den Ring mit dem Leben bezahlt) stehen für das aufstrebende Bürgertum. Auch hier korrumpieren Machtstreben und Gier menschliche Beziehungen.
Gerhild Romberger als Erda warnt Wotan davor, sich an den Besitz des Rings zu klammern, als der Konflikt um die Auslösung Freyas auf der Spitze steht. Ihr Auftritt auf einem der Balkone mit mystischer Beleuchtung ging wirklich unter die Haut.
Die Rheintöchter Ania Vegry, Ida Aldrian und Eva Vogel, naive junge Frauen, die das Geheimnis des Rheingolds arglos verraten und lebhaft seinen Verlust betrauern, fallen durch fast theatralischen Sprechgesang auf. Vor allem am Schluss, als ihre Klage von der oberen Reihe kommt, ist man beeindruckt. Sie können als Fürsprecherinnen der durch die Ausbeutung durch den Menschen geschädigten Natur interpretiert werden.
Stefanie Irányi als Fricka gibt die selbstbewusste Ehefrau, die endlich ihren promisken Gatten in der Häuslichkeit Walhalls domestizieren will, was – wir wissen es – gründlich schiefgeht. Den Klagen der schönen Freya, als Beutestück unter den agierenden Männern verschachert, gibt Sarah Wegener anrührende Kontur, und mit jugendlichem Ungestüm verkörpern Tansel Akzeybek (Froh) und Johannes Kammler (Donner) die Söhne Frickas.
Die Sängerschaft verwendete nicht nur ungewöhnlich viel Sorgfalt auf eine perfekte Artikulation, sie setzte auch Wagners szenische Anweisungen in Gesten um. Forschungsergebnisse der Universität Halle über die korrekte Phonetik und Akzentuierung des korrekten überregionalen Bühnendeutsch wurden berücksichtigt, und es hat wohl selten so lange Probenzeiten für ein Stück gegeben. Es wurde viel mehr als in herkömmlichen Aufführungen sprachlich ungewöhnlich klar gesungen, gekreischt und geschrien. Gerade sehr wichtige Stellen wurden gesprochen, nicht gesungen. Die zwei Stunden 16 Minuten Aufführungsdauer vergingen wie im Fluge, und ich habe mir die szenische Realisation aus dem bildstarken Hilsdorf-Ring in Düsseldorf dazu vorgestellt.
Der Kalifornier Kent Nagano kann als Motor dieses Projekts gelten. Seine internationale Reputation als Experte für Neue Musik hat ihn wohl als Zugpferd prädestiniert. Er hat zum Beispiel 2000 die Uraufführung von „L´amour de loin“ der finnischen Komponistin Kaija Saariaho bei den Salzburger Festspielen dirigiert, Spektralmusik und die erste erfolgreiche Oper, die von einer Frau komponiert wurde. Bis 2015 war er Chefdirigent der Münchner Staatsoper, danach der Hamburger Oper. Seit 2019 ist er Ehrendirigent beim Concerto Köln, einem für seine Aufführungen von Barockmusik preisgekrönten Ensemble, das sich für die „Wagner-Lesarten“ von rund 20 auf fast 100 Musiker vergrößert hat, die alle für die historisch informierte Aufführungspraxis brennen. Noch bis zum 27. April 2022 ist der Stream ihrer Aufführung von Beethovens „Missa Solemnis“ und dem „Gesang der Jünglinge im Feuer“ von Stockhausen im Kölner Dom verfügbar, bei der die Kooperation Naganos mit dem Concerto Köln zu einem der künstlerischen Höhepunkte des Beethovenfests führte.
Das Projekt „Wagner-Lesarten“ wurde federführend von Musikwissenschaftlern der Hochschule für Musik und Tanz, Köln, von einem großen musikwissenschaftlichen Forschungsteam begleitet, und man hat sich sehr viel Zeit genommen, nicht nur historische Instrumente aus Wagners Zeit zu restaurieren oder, unter anderem vier „Münchner Oboen“ und zwei Wagner-Tuben, nachzubauen. Die Streichinstrumente haben Darmsaiten und klingen viel weicher und nicht so laut wie moderne Instrumente. Das Orchester unter der künstlerischen Leitung von Alexander Scherf folgt in der Aufstellung dem Vorbild der Münchner Hofkapelle, die 1882 Wagners Parsifal zur Uraufführung brachte.
Der Kammerton ist auf 435 Hz gestimmt, DIN ist 440 Hz und die Wiener Philharmoniker spielen dennoch mit 444 Hz, wodurch der Klang schärfer wird. Zu Wagners Zeit gab es noch keinen allgemein verbindlichen Kammerton, aber Wagner selbst hat a =435 Hz festgelegt, und man hat auch seine weiteren Anweisungen bezüglich der Orchesterpraxis berücksichtigt. Die „Wagner-Lesarten“ in historischer Aufführungspraxis haben einen wissenschaftlichen Anspruch und sollen als Denkanstoß dienen. Auch Wagners Art des Einstudierens der Partien durch die Sänger wurde erforscht und nachvollzogen. So habe man stundenlang an der Szene der Rheintöchter geprobt. Hilfreich waren umfangreiche Aufzeichnungen von Wagners Starsängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, die von Wissenschaftlern der Universität Halle ausgewertet wurden. Wagner soll darauf bestanden haben, dass die Sänger*innen zuerst ihre Rollen ohne Musik sprechen, dann mit Begleitung sprechen und erst ganz zum Schluss mit Begleitung singen. Jeder solle das gesamte Werk kennen, nicht nur seine eigene Partie. Und es müsse „gutes Deutsch“ gesprochen werden, zum Beispiel in allen Fällen das Zungenspitzen-R gerollt. Es fehlt eigentlich nur die szenische Realisierung, idealerweise in Bayreuth, die Richard Wagner für sein Gesamtkunstwerk plante und 1876 umsetzte. Leider sei Katharina Wagner seiner Einladung zum Konzert nicht gefolgt, merkte Philharmonie-Intendant Langevoort an, aber es liefen bereits Gespräche mit anderen Häusern.
Man kann zu Recht gespannt sein auf die drei weiteren Teile, die im Abstand von jeweils einem Jahr folgen werden, denn die konsequente Textarbeit und das akribische Üben und Proben mit den historischen bzw. historisch informierten Instrumenten führt zu einem sensationellen Theatererlebnis. Die alten Instrumente sind deutlich leiser, die Sänger werden niemals zugedeckt, und daher sind die deklamierten Texte sehr gut verständlich. Die Abwesenheit von Bühnenbildern, Kostümen und Requisiten führt dazu, dass man die politische Brisanz der Konflikte erkennt. Es geht eben nicht um den nordischen Gott Wotan, sondern um den zeitgenössischen Adel, dessen Macht immer mehr verfällt und der vom aufstrebenden Bürgertum, das seine Bedeutung aus dem durch Ausbeutung der Natur und der Mitmenschen erworbenen Reichtum erhält, abgelöst wird. Darüber hinaus sind Erda und die Rheintöchter Fürsprecherinnen der geschundenen Natur, die nur auf eine Art und Weise gerettet werden kann.
Ursula Hartlapp-Lindemeyer, 24.11.21
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
Chicago Symphony Orchestra & Riccardo Muti
Sergej Prokofjew
Romeo und Julia. Auszüge aus den Sinfonischen Suiten op. 64a und b
Sergej Prokofjew
Sinfonie Nr. 3 c-moll op. 44 (1928)
Symphonischer Gipfel
Im Rahmen seiner sehr seltenen Gastspiele in Deutschland präsentierte sich das Chicago Symphony Orchestra mit seinem langjährigen Chef-Dirigenten Riccardo Muti in der Kölner Philharmonie. Auf dem Programm standen ausschließlich Werke von Sergej Prokofjew.
Im Jahr 1938 feierte dessen Ballett „Romeo und Julia“ seine Ur-Aufführung in Brünn, nachdem es wenige Jahre zuvor vom Moskauer Bolschoi-Theater in Auftrag gegeben wurde. Seither ist dieses Meisterwerk ein Klassiker im Repertoire vieler Ballett-Kompanien geworden. Bis 1946 erstellte Prokofjew drei Suiten für Orchester. Seither sind diese Werke auch in symphonischen Konzerten häufig anzutreffen. Ungemein farbenreich ist die Instrumentierung und die melodische Vielfalt, die sich bis zur Atonalität hin bewegt und doch immer wieder den Weg zur Kantabilität zurückfindet.
Ein äußerst effektvoller Einstieg also für den italienischen Maestro und sein Elite-Orchester. Das Publikum konnte staunen und sich an der spieltechnischen Perfektion des Orchesters geradezu berauschen. Alle Orchestergruppen musizierten mit einer atemberaubenden Virtuosität. Riccardo Muti ließ in den gewaltigen Klangballungen sein Orchester völlig entfesselt ausmusizieren und doch blieb dabei alles im dynamischen Lot.
Die Tempi wirkten immer harmonisch aus dem Duktus der Partitur entwickelt. Auffallend und bestechend war die überragende Transparenz im kollektiven Orchesterklang. Selbst im größten rhythmischen Getümmel fächerte Muti mit seinem großartigen Orchester alle Orchesterstimmen auf, so dass Haupt- und Nebenstimmen in der polyphonen Anlage der Partitur stets klar wahrgenommen werden konnten.
Das Chicago Symphony Orchestra vereint großartige Virtuosen in den eigenen Orchesterreihen. Wunderbare Soli in den Holzbläser konnten sich auf einen vollendet tönenden Streicherklangkörper verlassen. Hier zeigte immer wieder der famose Konzertmeiser sein hinreißendes Können. Legendär von jeher bei diesem Orchester die exquisite Klangqualität der Blechbläser, angeführt von deren superben Solo-Trompetern, die auch in extremster Lage blitzsauber intonierten. Und wie vielschichtig ein Schlagzeug-Ensemble klingen kann, zeigten die Damen und Herren des Chicago Symphony Orchestras an ihren verschiedenen Schlagwerk-Instrumenten. Große und völlig berechtigte Begeisterung für diese perfekte Darbietung von „Romeo und Julia“.
Nach der Pause präsentierte Riccardo Muti eine seiner Lieblings-Symphonien. 1928 komponierte Prokofjev seine dritte c-moll Symphonie, die Motive aus seiner Oper „Der feurige Engel“ verarbeitete. Es ist eine kühne Komposition, gerade einmal etwas mehr als eine halbe Stunde dauernd, die in harschen, sehr düsteren Farben daher kommt. Stalin war seinerzeit von dieser Musik entsetzt und forderte vom Komponisten eine „Kurskorrektur“, die sodann die Tonalität und Melodie in den Mittelpunkt stellen sollten. Prokofjev folgte und sicherte sich damit sein Überleben.
Muti wies am Ende des Konzertes in einer kurzen Ansprache an das Publikum auf die musikhistorische Bedeutung dieser Komposition hin, weil es noch den „unbearbeiteten, originalen“ Prokofjev zeigt.
Die Symphonie fordert das Orchester in seinen rhythmischen Exzessen und dissonanten Ballungen extrem. Lediglich im Andante des zweiten Satzes entsteht eine kurze Phase der Ruhe, da die Musik sich plötzlich in eine klerikale Tonsprache verändert. Berückende Soli der Violine verleihen dem Werk besondere Farbtupfer. Es folgt ein rasantes Allegro Agitato für die beiden Schluss-Teile. Hier bietet Prokofjev nochmals alle Klangballungen und bedrohlichen Farben auf, ehe das Werk geradezu infernalisch endet.
Es war Riccardo Muti immer anzumerken, wie sehr ihm dieses Werk am Herzen lag. Hoch wachsam steuerte er mit größter Genauigkeit seine Musiker durch die horrend schwere Partitur. Das Orchester konnte jederzeit frei ausmusizieren und doch war Muti immer seinen Musikern voraus, so dass diese sich jederzeit auf seine perfekte Zeichengebungen verlassen konnten.
Das Chicago Symphony Orchestra mobilisierte in der Ausführung dieser Symphonie außergewöhnliche Reserven, wie sie schwerlich anderswo in dieser Perfektion anzutreffen sind. Alle Orchestergruppen musizierten auch hier auf höchstem Niveau, ohne auch nur im Ansatz einen Hauch der tatsächlichen Schwierigkeiten zu vermitteln. Was für eine beeindruckende Leistungsschau! Ein symphonischer Gipfel der Königsklasse! Und Riccardo Muti agierte in diesem unvergesslichen Konzert als ein wahrer Maestro, der völlig alterslos mit viel Temperament und Aura, Musik zu einer außergewöhlichen Erfahrung werden ließ.
Das Kölner Publikum zeigte in seiner Begeisterung keinerlei Zurückhaltung und jubelte lautstark mit stehenden Ovationen.
Muti bedankte sich mit einer humorvollen und sehr persönlichen Ansprache. Versehen mit Neujahrswünschen präsentierten das Chicago Symphony Orchestra und er ein seltenes Orchesterwerk von Alexander Scriabin als Zugabe.
Ein großartiger, unvergesslicher Auftakt in das Konzertjahr 2020!
Dirk Schauß, 9. Januar 2020
Titanic – The Musical
Premiere Kölner Philharmonie: 23.07.2019
Große Emotionen auf hoher See

Im Jahre 1912 kam es zu einem der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts, dem Untergang der RMS Titanic auf seiner Jungfernfahrt, nachdem das Schiff auf dem Weg nach New York mit einem Eisberg kollidierte. Das Musical basiert auf den vielen verschiedenen Schicksalen der Menschen an Bord und versucht diese möglichst detailgetreu wiederzugeben. Es ist also weit weg von der allseits bekannten Hollywood-Liebesgeschichte. Stattdessen wird der Zuschauer mitgenommen auf die Reise der Passagiere und der Besatzung des Schiffes, stets in dem Bewusstsein, was am Ende passieren wird. Mit diesem Wissen des Zuschauers im Hintergrund „spielen“ Komponist Maury Yeston und Autor
Peter Stone sehr geschickt, so dass ein emotionaler und bewegender Theaterabend mit einer der vielleicht schönsten Musicalkompositionen der letzten 25 Jahre entsteht. Die Broadway Inszenierung wurde 1997 mit insgesamt 5 Tony Awards ausgezeichnet, u. a. als bestes Musical, für die beste Musik und das beste Buch.

Regisseur Thom Southerland legt bei seiner Inszenierung großen Wert auf die vom Libretto vorgesehene Vorstellung der Personen und verzichtet auf unnötiges Beiwerk. Bereits in dem Moment wo der Zuschauer den Saal betritt, erblickt er den Schiffskonstrukteur Thomas Andrews (wunderbar besetzt mit Greg Castiglioni) bei der Arbeit, im Hintergrund hört man aufgeregtes Stimmengewirr kurz vor dem ersten Auslaufen der Titanic. Das eigentliche Musical beginnt dann mit dem Eintreffen der ersten Passagiere, streng unterteilt nach erster, zweiter und dritter Klasse. Im ersten Akt nimmt sich das Stück viel Zeit die einzelnen Rollen sowie deren jeweilige Wünschen und Hoffnungen etwas genauer vorzustellen, die mit dieser Reise verbunden sind. Da wären beispielsweise die drei irischen Kates, die in Amerika ein neues und besseres Leben beginnen wollen oder der Heizer Frederick Barrett (Niall Sheehy), der auf der Titanic anheuert und bereits frühzeitig die Gefahren der ständig höheren Knotenzahl erkennt. Ändern kann er hieran aber auf Grund der strikten Hierarchie an Bord nichts. Der Inhaber der White-Star-Flotte J. Bruce Ismay (Simon Green), ebenfalls an Bord, wenn auch später mit dem ersten Rettungsboot verschwunden, ist stets darauf bedacht, einen neuen Weltrekord für die Überquerung des Atlantiks aufzustellen.

Hierfür schreckt er auch nicht davor zurück Kapitän Edward Smith (Philip Rham) mehrmals unter Druck zu setzen. Ganz anders dagegen, das rührige Seniorenpaar Ida und Isidor Straus (Judith Street und Dudley Rodgers), Isidor weigert sich trotz seiner hohen Position als ehemaliger Abgeordneter und als mehrfacher Millionär später das Rettungsboot zu betreten, bevor nicht alle Frauen und Kinder von Bord sind. Seine Frau will ihn nicht allein zurücklassen, so dass beide sehenden Auges und bei vollem Bewusstsein lieber den gemeinsamen Tod wählen und den Platz im Rettungsboot Jüngeren überlassen. Alle Personen und kleineren Geschichten nun hier aufzuführen würde sicherlich den Rahmen sprengen. Eindrucksvoll in Erinnerung bleiben aus dem 25köpfigen stimmig besetzten Ensemble auch Wendy Ferguson als Passagieren der 2. Klasse, die stehts die Nähe zu den Reichen und Berühmten sucht, Lucie-Mae Summer als Kate McGowan, die sich an Bord in den gutaussehenden Landsmann Jim Farrell verliebt und James Gant als Schiffssteward der ersten Klasse. Ein Highlight des Musicals sind zudem die vielen Chorstücke, die sehr stimmgewaltig daherkommen. Bei „Godspeed Titanic“ stellen sich gleich zu Beginn einige Gänsehautmomente ein. Nach dem eindrucksvoll inszenierten Zusammenstoß mit dem Eisberg zum Ende des ersten Aktes, widmet sich der deutlich kürzere zweite Akt dem unvermeidlichen Verlauf der Dinge hin zur Katastrophe. Beeindruckend hierbei vor allem „The Blame“ bei dem sich Mr. Ismay, Mr. Andrews und Kapitän Smith gegenseitig die Schuld am Unglück geben.

Das Bühnenbild ist recht einfach gehalten mit einem großen Rahmen aus Metall, in dem durch eine verschiebbare Treppe weitestgehend das Geschehen am Schiff auf mehreren Ebenen dargestellt wird. Umso detailreicher dagegen die vielen Kostüme von David Woodhead, die schön der damaligen Zeit angepasst sind und vor allem die Mehrklassengesellschaft gut darstellen. Unterstützt wird das Bühnenbild durch ein gelungenes Lichtdesign von Howard Hudson bei dem der Bühnenraum beispielsweise im unteren Getrieberaum durch einen in rot schimmerndem Rauch dargestellt wird. Auch musikalisch weiß diese Tour zu gefallen. Zum Ende gibt es daher zu Recht großen Applaus des Publikums und schnelle Standing Ovation des gesamten Saales, bei dem auch das ein oder andere Tränchen floss. Nicht zuletzt auch durch die Würdigung aller Opfer des Untergangs auf einer großen Gedenktafel als Schlussbild dieses wunderbaren Musicalabends. Zu sehen ist das Musical Titanic noch bis zum 28. Juli 2019 in der Kölner Philharmonie, ein Besuch dieser gut klimatisierten Spielstätte lohnt sich auch trotz der sommerlichen Hitze draußen. Ein letzter Tour-Stopp ist anschließend noch vom 30. Juli bis 04. August 2019 im Mannheimer Nationaltheater angesetzt. Absolute Besuchsempfehlung.
Markus Lamers, 25.07.2018
Fotos: © Scott Rylander
Jaques Offenbach
Fantasio
21.6.2019
VIDEO
TRAILER der Opera Zuid
Triumph der Narrheit
Punktgenau am Abend nach seinem 200. Geburtstag ehrte nach der Kölner Oper mit ihrer opulenten Aufführung von Offenbachs Operette Die Herzogin von Gerolstein nun auch die Kölner Phiharmonie den in Köln geborenen Wahl-Pariser Jaques Offenbach mit der Aufführung seiner kaum bekannten und lange Zeit in der Versenkung verschwundenen komischen Oper Fantasio. Nach einem Libretto von Paul de Musset, das als Vorlage das gleichnamige Schauspiel von dessen Bruder Alfred Musset nutzte, komponierte Offenbach seine Opéra comíque unmittelbar vor seiner wohl bekanntesten Oper Hoffmanns Erzählungen zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges.
Vor allem der gegenüber dem Schauspiel umgedeutete pazifistische Schluss der Oper stieß nach der Niederlage Frankreichs in der aufgeheizten Stimmung in Paris auf scharfe Ablehnung, sodass die Uraufführung in Paris in der Opéra comique erst im Januar 1872 erfolgte. Diese Pariser Fassung wie auch die deutsche Bearbeitung für Wien im Februar 1872 blieben ohne großen Erfolg. Das Schicksal des Fantasio schien endgültig besiegelt, als die Originalpartitur bei einem Brand der Pariser Oper vernichtet wurde und die einzelnen Seiten der nun einzig verbliebenen handschriftlichen Partitur Offenbachs von den Erben seiner Tochter Jaqueline in alle Welt verramscht wurden. In einer wahren Sisyphusarbeit konnte der englische Offenbach-Enthusiast und Musikwissenschaftler Jean-Christophe Keck auch mit Hilfe eines Klavierauszuges und einer Abschrift der Wiener Partitur aber die ursprüngliche Fassung rekonstruieren, die dann erstmals im Dezember 2013 in London wieder zum Klingen gebracht wurde.
Die recht komplizierte Handlung spielt in München. Der König von Bayern will seine Tochter Elsbeth an den Prinzen von Mantua verschachern, um den drohenden Staatsbankrott abzuwehren. Fantasio, ewiger Student und hochverschuldet, hört vor dem Schlossfenster die klagende Elsbeth, der er gefühlvoll antwortet, sodass sich beide durch den Gesang ineinander verlieben. Als Narr verkleidet gelingt ihm der Zutritt zur Hofgesellschaft, wo der Prinz von Mantua zu einem zahlreiche komische Effekte provozierendem Possenspiel greift. Er tauscht mit seinem Adjudanten Marioni die Rollen, um die wahre Liebe Elsbeths zu testen. Als er sich schließlich als Brautwerber zu erkennen gibt, ist es zu spät. Fantasio hat Elsbeths Hochzeit hintertrieben, indem er als Narr ihr reinen Wein einschenkt und sie vor dem Unglück warnt, in das sie sich mit der Hochzeit begibt. Fantasio büßt für seine Freveltat mit dem Gefängnis, wird aber begnadigt und sogar vom König von Bayern zum Prinzen erhoben, da er den drohenden Krieg zwischen Bayern und Mantua verhindert. Seine Worte „Kämpft untereinander, das geht uns nichts an“ nehmen die berühmte, wohl fälschlich Brecht zugeschriebene Sentenz vorweg: „Stellt euch vor, es ist Krieg, und niemand geht hin.“ Die Narrheit siegt über Chauvinismus und Kriegslüsternheit, Fantasio triumphiert als König der Narren. Das war nicht nur zur Zeit Offenbachs, das ist auch heute noch eine wunderbare Utopie.
Chor der Opera Zuid (Jori Klomp) und die philharmonie zuidnederland unter Leitung von Enrico Delamboye brachten die außerordentlich facettenreiche Musik dieser wunderbaren Opernrarität, die sich mit ihrer großen romantischen Orchesterbesetzung weniger als opéra bouffe denn als opéra lyrique präsentiert, zum Leuchten und Funkeln. Delamboye geizte nicht mit körperlichem Einsatz, um die politische, vormärzliche Attacke gerade der Chorszenen – „Wir sprengen die Monarchie von Innen“ - mit Verve musikalisch ins Bild zu setzen, ihm gelangen aber mit seinem Orchester gerade auch in den drei romantischen, melancholischen Liebesduetten zwischen Elsbeth und Fantasio, die als Strukturelement die dreiaktige Oper bestimmen und bereits in vielem auf Offenbachs Erfolgsoper Hoffmanns Erzählungen vorausdeuten, bewegende und anrührende Klangbilder.
Die Solistinnen und Solisten dieses Abends trugen ihrerseits zu dem großen Erfolg der halbszenischen Aufführung (Regie: Benjamin Prins, Kostüm: Lola Kirchner) bei. An erster Stelle muss hier die junge russische Sopranistin Anna Emelianova genannt werden, die mit glockenklarer, funkelnder Stimme ein Feuerwerk brillanter Koloraturen in das weite Rund der Kölner Philharmonie schickte, aber gerade auch die melancholisch-lyrischen Passagen ihrer Partie mit großer Intensität und Klangschönheit gestaltete.
In der Titelpartie überzeugte Romie Estéves nicht nur schauspielerisch in ihrer Rolle als Hofnarr mit beinahe akrobatischen Verrenkungen, sondern auch stimmlich konnte die französische Mezzospranistin besonders in der Mittellage, aber auch mit ihrem in der Höhe leuchtenden Timbre punkten. Bei manchen Legato-Kantilenen in der Tiefe, vor allem aber in den Ensembleszenen kam sie bisweilen stimmlich allerdings an ihre Grenzen. Thomas Morris (Tenor) als Adjudant des Prinzen, Huub Claessens (Bass) als König von Bayern, Roger Smeets (Bariton) als Prinz von Mantua, Francis van Broekhuizen (Mezzosopran) sowie das aufmüpfige Studentenquartett mit Ivan Thirion, Jeroen de Vaal, Rick Zwart und Jaques de Faber komplettierten ein insgesamt stimmlich bestens aufeinander abgestimmtes Sängerensemble und begeisterten darüber hinaus mit engagiertem, komödiantischem Spiel und im Falle der Studenten mit hochsportlichen Turnleistungen (Radschlag, Rolle vorwärts etc.).
Das Publikum in der recht gut besuchten Philharmonie dankte allen Künstlerinnen und Künstlern mit lang anhaltendem Beifall und zahlreichen Bravos. Manch einer Besucherin und manch einem Besucher wird es vielleicht so gegangen sein wie dem Rezensenten. Würden doch die Politiker unserer Tage Offenbachs wunderbare Oper und die in ihr übermittelte Botschaft an alle Mächtigen zur Kenntnis nehmen, die da lautet: „Schließt Frieden!“, „Kämpft untereinander, das geht uns nichts an“, „Es lebe der König der Narren“
Norbert Pabelick, 23.06.2019
OPERNFREUND CD Tipp

Pläne des Kölner Kammerorchesters 2019/20
Spannende Aktivitäten
Die Saison 2019/20 ist die 97. Spielzeit des Kölner Kammerorchesters. Ja, so lange ist dieser Klangkörper in der Domstadt tatsächlich schon heimisch. Seit der einstige Geiger und Primarius des Cherubini-Quartetts Christoph Poppen als Principal Conductor fungiert (ab 2014), hat sich so manches geändert. Nicht zuletzt sind Aktivitäten und Programme „weiträumiger“ geworden. Die Komponisten von Barock und Klassik bilden zwar nach wie vor den Großteil der aufgeführten Werke (und so möchte es das hauptsächliche Publikum wohl auch haben), aber inzwischen erfolgten diverse Grenzüberschreitungen zum 19. und sogar 20. Jahrhundert. Da ist natürlich etwas pädagogisches Augenmaß vonnöten, um die Freude des KKO nicht ungebührlich zu verschrecken. Mit Tschaikowskys Streicher-Serenade dürfte man freilich kein Risiko eingehen. Auch Serge Prokofjews „klassische Sinfonie“ (Konzert 13.10.) und sein zweites Violinkonzert (Konzert 26.4.) sollte ankommen.

Im übrigen ist auffallend, daß vergangene Auslandsgastspiele sogar auf Namen wie Arvo Pärt oder Nino Rota setzten. Beim Festival im portugiesischen Marvao, von Christoph Poppen ins Leben gerufen und im Juli zum sechsten Male stattfindend, werden Werke von Béla Bartók und Gerald Finzi zu hören sein. Selbst vor den großbesetzten „Carmina Burana“ Carl Orffs schreckt man nicht zurück; allerdings wird man hier von heimischen Musikern und Chören unterstützt.
Details der künftigen Konzertofferten entnimmt man am besten der Saisonbroschüre. An dieser Stelle nur einige appetitanregende Hinweise. Am 15.9. wird der bereits mit einer ganzen Reihe von CDs hervorgetretene Pianist Joseph Moog das fünfte Klavierkonzert von Beethoven interpretieren. Das bereits erwähnte Prokofjew-Konzert spielt die Münchnerin Lena Neudauer. Am 18.12. geht es musikalisch auf Weihnachten zu; diesen Abend übernimmt Konzertmeister Raphael Christ als Dirigent. Das wiederholt sich am 5.1., wenn der aus Bonn stammende Pianist Fabian Müller Bach-Konzerte bietet und Christ beim Violinkonzert BWV 1041 auch als Geigensolist in Erscheinung tritt. Geistliche Musik von Mozart gelangt am 15.3. zur Aufführung. In Kombination mit Werken Franz Schuberts prägt dieser Komponist auch den Abend des 29.5., mit welchem die Spielzeit endet. Die renommierte Pianistin Elena Bashkirova spielt zwei seiner Klavierkonzerte.
Erfreuliche Nachricht: es gibt einen neuen Anlauf für Aufnahmen bei der Phonoindustrie. In der Ära von Helmut Müller-Brühl war das KKO in dieser Hinsicht sehr gut im Geschäft. Aber diese Aktivitäten liefen dann langsam aus. Jetzt ist bis ins Jahr 2021 hinein die Produktion sämtlicher Mozart-Messen (17 an der Zahl) geplant, wobei Kölner Dom und WDR die Chöre stellen. Vermutlich wird die Resonanz auf diese Aufnahmen den Ausschlag dafür geben, ob weitere Projekte folgen.
Christoph Zimmermann 18.4.2019
Foto (c) Sonja Werne
Schirachs Beschwörung westlicher Werte
13.4.2019
Stefanie Irányi , Andreas Bauer Kanabas, WDR Sinfonieorchester: Jukka-Pekka Saraste – Vortrag: Ferdinand von Schirach
Beim WDR Sinfonieorchester steht mit Ablauf dieser Saison ein gravierender, aber letztlich ganz natürlicher Wechsel an. Der Dirigent Jukka-Pekka Saraste wird sein Chefamt, welches er seit 2010 inne hat, an den Rumänen Cristian Macelaru übergeben. Bei seiner Programmgestaltung wurde nordische Musik relativ dezent berücksichtigt. Natürlich hat sich der Finne Saraste immer wieder mal für seinen Landsmann Sibelius eingesetzt, aber er übertrieb diese Akzentuierung nicht. Er setzte bevorzugt auf das deutsch-österreichische Traditionsrepertoire, was sich u.a. in einer Liveaufnahme sämtlicher Sinfonien Ludwig van Beethovens niedergeschlagen hat. Welche Werke sich der Dirigent für sein Abschiedskonzert im Juli aussucht, verrät er nicht.

Sarastes aktueller Auftritt in der Kölner Philharmonie war ein weiterer Abend innerhalb der neu etablierten Reihe „Musik und Dialog“, wo das Musikprogramm von Ansprachen prominenter Persönlichkeiten zäsiert wird. Im vergangenen September hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit Äußerungen zum Thema „Schicksal“ die Reihe eröffnet (Marek Janowski dirigierte Beethovens fünfte Sinfonie und die „Egmont“-Ouvertüre). Bei dem jetzigen Vortrag des als Jurist wie als Schriftsteller überaus erfolgreichen
Ferdinand von Schirach war eine Analogie zu den musikalischen Darbietungen (Beethovens „Fidelio“-Ouvertüre und der Operneinakter „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók) weniger prägend. Schirach referierte über „Freiheit und Würde“ und gab mit seinen Äußerungen zu intensivem Nachdenken Anlaß. Er beschwor „westliche Werte“ und ging, um den in der Historie häufig stattfindenden Dissens zwischen Kirche und weltlicher Obrigkeit aufzugreifen, auf die Auseinandersetzung zwischen Papst Gregor und König Heinrich IV. im elften Jahrhundert zurück, welcher bekanntermaßen mit dem für Heinrich demütigenden Gang nach Canossa endete. Über solch heftige Zwistigkeiten ist man heute natürlich hinaus, doch gibt es zu einigen Themen weiterhin unterschiedliche moralische Auffassungen. Schirach sprach sich jetzt vor allem für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen aus. In seinem jüngsten Theaterstück „Gott“ (Premiere ist am 25. April nächsten Jahres zeitgleich in Berlin und Düsseldorf) geht es um das Recht auf einen freiwilligen Tod, worüber ja gerade stark debattiert wird. Auch wenn die Musikwerke zu Schirachs Gedanken nur eine lockere Beziehung hatten, betteten sie doch das Gesagte emotional ein.
Beethovens „Fidelio“ etwa beschwört die Freiheit wie auch die Tugend unverbrüchlicher Gattenliebe. Die Ouvertüre schrieb der Komponist nach drei eher sinfonisch angelegten „Leonoren“-Ouvertüren. Sie verzichtet auf deren Trompetensignal, welches im Kerkerbild der Oper dann aber zu hören ist. Ein zweimaliges Ertönen dieses symbolisch aufgeladenen Motivs wäre kaum zu rechtfertigen. Auch wenn die „Fidelio“-Ouvertüre somit nichts „verrät“, stimmt sie auf Kommendes doch atmosphärisch schlüssig ein.
Die Widergabe unter Jukka-Pekka Saraste schärfte die dramatischen Umrisse der Musik, unterstrich ihr theatralisches Fundament. Wirkungsvoll das leichte Ritenuto am Ende der die Ouvertüre eröffnenden musikalischen Phrase. Das Lodernde dieser Interpretation wurde durch ein, zwei leicht unkonzentrierte Momente im Orchesterspiel nicht weiter tangiert.

So locker auch die Verbindung zwischen der Schirach-Rede und den Musikwerken: diese waren ihrerseits stark aufeinander bezogen. Beethoven schildert den heroischen Kampf um eine Liebe, bei welcher davon auszugehen ist, daß sie eine seit jeher glückliche war. Bartóks „Blaubart“ schildert hingegen das Kennenlernen zweier Personen, welche die Sehnsucht nach Zweisamkeit vorsichtig, wenn auch begehrlich zueinander führt. Während Blaubart seine Gefühle aber nur andeutungsweise preisgibt, läßt Judith deutlich einen starken erotischen Trieb spüren, welcher mit weiblicher Neugierde einher geht. Aber sie findet letztlich keinen Zugang zum geliebten Mann. Wie die früheren Frauen des Burgherren wird sie zu einer Station des Tagesablaufs entmaterialisiert; Blaubart schmückt sie mit den Insignien der Nacht. Und Nacht wird nun - vermutlich auf ewig - auf ihn selber niederfallen.
Obwohl Bühnenaufführungen von „Herzog Blaubarts Burg“ immer wieder zeigen, daß die handlungsarme Oper von einem wirkungsvollen szenischen Umfeld profitiert, hat auch eine konzertante Aufführung ihre Reize. Dies vor allem, wenn die Sänger echte Bühnenpersönlichkeiten sind. Stefanie Irányis jugendlich leuchtender Mezzosopran bildete die Begehrlichkeiten Judiths ungemein stimmig ab, intensive Körpersprache unterstrich das Brodelnde ihres Charakters. Den Blaubart könnte man sich sicher noch etwas sinistrer vorstellen, als wie ihn Andreas Bauer Kanabas zeichnete, aber sein geschmeidiger, kantabel strömender Baß gab der emotional sich verschließenden Figur dennoch überzeugende vokale Konturen. Saraste arbeitete mit dem Orchester sowohl die dunkel schimmernden wie auch die hell gleißenden Farben der Musik klangmächtig heraus. Eine faszinierende Interpretation.
Christoph Zimmermann 17.4.2019
Bilder (c) Phil. Köln / Broede
Helden, kritisch betrachtet
19.3.2019
Nicolas Altstaedt, Gürzenich-Orchester: Karina Canellakis
Vor wenigen Tagen bot das WDR Sinfonieorchester unter Dima Slobodeniouk ein Konzert, in welchem das Moment der Trauer im Vordergrund stand (Mozarts „Requiem“ und Jörg Widmanns „Trauermarsch“). Sicher ohne gezielte Bezugnahme und ohne kalendarischen Anlaß bot das von Karina Canellakis dirigierte Gürzenich-Orchester ein weiteres Programm mit Tristesse-Charakter, welches primär freilich unter dem Stichwort „Helden“ konzipiert war. Da hätte die Wahl des „Heldenlebens“ von Richard Strauss zunächst einmal nahegelegen. Aber eine Ego-Feier wie bei dieser Tondichtung sollte es nicht sein, sondern eine kritische Sicht auf Weltverläufe.

Richard Wagners „Götterdämmerung“ reflektiert nun freilich keine Realität, sondern einen Mythos. Den Mythos des Helden Siegfried, welcher Gott Wotan in die Knie zwingt, dann aber selber der Rachsucht eines dämonischen Weltenhassers zum Opfer fällt. Bevor Siegfried durch Hagens Speer stirbt, wird ihm seine durch einen Zaubertrank aus dem Gedächtnis gelöschte Liebe zu Brünnhilde neu bewußt. Die nachfolgende Orchester-Szene ist eine Trauer-Extase, freilich ebensowenig Trauer„marsch“ in engerem Sinne wie der von Widmann. Die Musik von Wagner wurde im Dritten Reich für politische Zwecke mißbraucht, wie auch „Les Préludes“ von Franz Liszt. Mittlerweile kann man sie jedoch „entlastet“ hören und sich einzig der musikalischen Sogwirkung hingeben.
Dies dankte man auch der dramatisch furios dahin stürmenden Interpretation durch das Gürzenich-Orchester unter Karina Canellakis. Die New Yorkerin war vor anderthalb Jahren schon einmal zu Gast bei diesem Klangkörper. Ursprünglich wollte sie Geigerin werden und machte als Orchestermusikerin eine gute Karriere, bis sie (u.a. von Simon Rattle) zum Dirigieren ermuntert wurde. Von der kommenden Saison an wird sie dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest vorstehen. Die schlanke Mittdreißigerin ist ein wahres Energiebündel, was in ihre Dirigiergestik deutlich einfließt. Doch selbst wenn sie dramatische Klangentladungen aus dem Orchester förmlich heraus„boxt“, wirkt das nicht als äußerliche, unangenehme Körperartistik.

Das erste Cellokonzert von Dmitrij Schostakowitsch wurde in der Philharmonie vom Gürzenich-Orchester zuletzt 2007 gespielt, mit Truls Mork als Solisten. Diesmal war es
Nicolas Altstaedt, welcher das Werk mit all seinen kapriziösen Schwierigkeiten scheinbar mühelos, mit virtuoser Grifftechnik und festem Ton bewältigte. In dem Konzert gibt es Momente wie die Rolle des Horns im ansonsten ohne Blechbläser auskommenden Orchester, was an Wagner erinnern könnte. Den Tod eines „Helden“ feiert das 1959 entstandene Werk freilich nicht, auch wenn im Finalsatz ein Lied zitiert wird, welches Stalin besonders mochte. Mit Sicherheit bedeutet das Ironie. Der Diktator hatte ja Zeit seines Lebens künstlerisches Schaffen durch vernichtende Begriffe wie „Formalismus“ und „Volksfremdheit“ geknebelt, was Schostakowitsch bereits in jungen Jahren hatte erleiden müssen, massiv bei seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“. Die Angsterfahrung mag sich selbst noch im nach Stalins Tod geschriebenen Cellokonzert niedergeschlagen haben. Aber der Komponist war längst ein Meister dezenter Anspielungen geworden. Karina Canellakis und das Gürzenich-Orchester erwiesen sich als optimale Partner des Solisten.
Der Kopfsatz des Konzertes schließt mit zwei heftigen Paukenschlägen, Ludwig van Beethovens dritte Sinfonie hebt mit einem zweifachen Orchester-Tutti an. Dem muß man nun aber keine tiefere Bedeutung beimessen. Allerdings ist zu sagen, daß Napoleon Bonaparte, welchem der Komponist die Sinfonie zunächst zu widmen gedachte, in seinen Augen zuletzt zu einem fatalen „Helden“ wurde wie Stalin für Schostakowitsch. Trotzdem kann man die „Eroica“ auch ohne mühsame Assoziation anhören. Die unter Karina Cannellakis spannungsvoll aufspielenden Gürzenich-Musiker machten das den Konzertbesuchern nicht schwer.
Christoph Zimmermann 20.3.2019
Bilder (c) Philharmonie Köln
Musik, dunkel gerändert
15.3.2019
Solisten, WDR Rundfunkchor und Sinfonieorchester: Dima Slobodeniou
In dem für sich genommen herrlichen „Amadeus“-Film von Milos Forman sind fast sämtliche romantisierenden Klischees zum Leben Mozarts versammelt., darunter auch die nachträglich hochgespielte Feindschaft mit Salieri, wie sie auch in der Oper „Mozart und Salieri“ von Rimsky –Korsakow Niederschlag gefunden hat. Vor allem die Entstehung des Requiems, über welcher der Komponist verstarb, war lange Zeit von Geheimnissen und Spekulationen umgeben, welche einem „Tatort“-Krimi wahrlich nicht nachstehen. Mittlerweile ist viel aufgeklärt worden. Auftraggeber für das Werk war ein Graf Walsegg, der seiner verstorbenen Frau ein musikalisches Denkmal setzen wollte, sich aber auch als vermeintlicher Urheber mit fremden Federn zu schmücken gedachte. Mit dem Tod Mozarts sah Witwe Constanze das Honorar (bereits zur Hälfte bezahlt) gefährdet. So versuchte sie, unter den Schülern ihres Mannes jemanden ausfindig zu machen, welcher das Requiem vervollständigen konnte.
Franz Xaver Süßmayr leistete diese Arbeit auf fraglos ehrenhafte Weise. Daß er, bei aller Berufung auf seine persönlichen Kontakte zu Mozart auch bezüglich des Requiems dem Meister nicht immer das Wasser reichen konnte, hat die Musikwissenschaft dann bald aufgedeckt. Als ein besonders heikler Satz erwies sich das abgebrochene „Lacrimosa“. Erst im 20. Jahrhundert tauchten handschriftliche Originale auf, welche anzeigten, daß Mozart diese Nummer mit einer Amen-Fuge zu beenden gedachte. Sie wurde von Robert D. Levin nachgeliefert. Helmuth Rilling stellte diese Fassung 1991 erstmals vor, jetzt kam sie auch bei einem WDR-Abend zur Aufführung. Die Süßmayr-Ergänzungen bilden die wesentliche Grundlage dieser Version. Levin lockert allerdings die Instrumentation auf, fügt dem Sanctus Klarinetten hinzu und ergänzt auch das „Hosanna“ im „Benedictus“ mit einer Fuge. Daß selbst diese Fassung noch nicht als der Weisheit letzter Schluß gilt, zeigt alleine die jüngste Bearbeitung von Pierre-Henri Dutron, welche René Jacobs für seine Einspielung des Requiems wählte.
Bei allen Spekulationen um eine adäquate Endgestalt des Werkes mag man mutmaßen, daß der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Die Wahl der Levin- Fassung bei der WDR-Aufführung hatte jedenfalls viel für sich. Bei der spannungsvollen Interpretation durch Dima Slobodeniouk kamen kritische Fragen im Grunde nicht auf. Der aus Moskau gebürtige Dirigent, aktuell Chef beim Orquesta Sinfónica de Galicia und dem Lahti Symphony Orchestra sowie künstlerischer Leiter des Sibelius-Festivals, ließ Mozarts Musik mit seiner ebenso drahtigen wie flexiblen Gestik regelrecht aufblühen. Kleine Unebenheiten verursachten lediglich der Soloposaunist in „Tuba mirum“ sowie Martin Mitterrutzner bei den Höhen seines Tenorparts. Doch das sind lediglich punktuelle Einschränkungen. Christina Landshamer, Marie Henriette Reinhold und Franz-Josef Selig erwiesen sich als ebenso schönstimmige wie expressive Vokalsolisten. Auch der von Robert Blank einstudierte Chor gab den Stimmungen des Requiems beredten Ausdruck.
Der leicht düstere Charakter des Konzertes wurde bereits mit dem ersten Werk des Abends festgelegt: Jörg Widmanns „Trauermarsch“ für Klavier und Orchester. Die Betonung liegt auf dem „und“ - denn so anspruchsvoll der Solopart auch ist, stets bleibt das Klavierspiel eingebettet in den kollektiven Klang des Orchesters. Ursprünglich hatte der Komponist ein viersätziges Konzert vor Augen, blieb dann aber in der verschatteten Atmosphäre des Beginns so stark gefangen, daß er sein musikalisches Konzept verknappte. Mit zwanzig Minuten ist der jetzige Trauermarsch freilich noch immer ein umfangreiches Opus. Es entstand im Auftrag der Sinfonieorchester von Toronto und San Francisco sowie der Berliner Philharmoniker, welche 2014 unter Simon Rattle auch die Uraufführung besorgten. Der damalige Solist Yefim Bronfman hätte auch in Köln spielen sollen, wo er sich erst vor kurzem mit einem Soloabend die Ehre gab, doch war er diesmal krankheitshalber verhindert. Seinen Part übernahm die junge deutsche Pianistin Luisa Imorde, welche regelmäßig mit Jörg Widmann zusammenarbeitet und durch ihn fraglos auch in den Trauermarsch eingewiesen wurde. Auf das Werk des 41jährigen Komponisten (und Klarinettisten) scheint der latente Schmerzcharakter von Gustav Mahlers Musik Einfluß genommen zu haben. Widmann verstärkt ihn u.a. dadurch, daß er bei den Celli und Kontrabässen die tiefe Saite um einen Ton herunter stimmen läßt (Skordatur). „Dieser Ganzton macht enorm viel aus, das gesamte Orchester klingt dunkler.“ Der Trauermarsch hebt mit einem Sekund-Motiv an, schon immer ein Klangsymbol für Schmerz und Klage. Es gibt zwar vereinzelt schwelgerische Aufschwünge und melodische Beruhigung, doch das Düstere, Lastende der Musik wird nie wirklich aufgehoben. Luisa Imorde war dem pianistischen Dauereinsatz (es gibt nur einige wenige Takte Pause in ihrem Part) eindrucksvoll gewachsen. Bestechend auch die Konzentration des Orchesters, mit Widmanns Musik durch zurückliegende Konzerte und Produktionen vertraut, und die Souveränität des Dirigenten.
Christoph Zimmermann 16.3.2019
Schubert, unterschiedlich beleuchtet
im WDR Funkhaus am 8.3.2019
Daniel Behle, WDR Sinfonieorchester & Brad Lubman
Ein „Winterreise“-Abend von dreieinhalb Stunden. Wie das? Nun, der Westdeutsche Rundfunk präsentierte im Großen Saal seines Hauses am Wallraffplatz zum einen den Schubert‘schen Liederzyklus in der „komponierten Interpretation“ Hans Zenders, wo schon mal orchestrale Ausweitungen die Originalkomposition wesentlich strecken. Voraus ging dem Konzert im Kleinen Sendesaal das „Quartett der Kritiker“, welches Aufnahmen der „Winterreise“ verglich. Dieses Quartett besteht aus Mitarbeitern beim „Deutschen Schallplattenpreis“, allen voran die Vorsitzende Eleonore Büning, weiterhin Mitgliedern aus den jeweils passenden Wertungs-Jurys. Besonders interessant wäre Jürgen Kesting als Diskutant gewesen, aber der sagte ebenso ab wie Albrecht Thiemann. Doch es konnten unschwer adäquate Einspringer gewonnen werden, nämlich Wolfgang Schreiber und Michael Stegemann. Weiterhin in der Runde: Stephan Mösch, einstiger Chef der Zeitschrift „Opernwelt“.
In ihrer Anmoderation ließ Frau Büning wissen, daß es von der „Winterreise“, vorsichtig geschätzt, 500 Einspielungen gibt. Das ist nicht nur ein Verweis auf die außerordentliche Beliebtheit des Werkes, sondern auch auf die nahezu unausschöpfbaren Interpretationsmöglichkeiten.
Eines der ersten Musikbeispiele (alle wurden individuell ausgesucht von den Diskussionsteilnehmern) war die Einspielung von Dietrich Fischer-Dieskau und Herta Klust (1951/52). Der „Meistersinger“ in Sachen Lied gehört zu den absoluten Koryphäen im Bereich der Vokalkunst, war und ist aber nicht gänzlich unumstritten. Manche rhetorische Details bei seinen Interpretationen werden als überspitzt empfunden. Mitunter trifft dieser Vorwurf heute auch Christian Gerhaher, der seine ausgepichte Diktion jedoch wunderbar in den Fluß einer Vokallinie integriert und auf diese Weise geradezu magische Wirkungen erzielt. Nicht jeder in der Diskutierrunde empfand das freilich in gleicher Weise. Für die Interpretationsästhetik vor 1945 wurde eine Aufnahme von Heinrich Rehkemper herangezogen (1928 - Begleiter: Komponist Manfred Gurlitt), die emotional einigermaßen hypertroph und damit leicht vergilbt wirkt. Lediglich erwähnt wurde in diesem Zusammenhang Heinrich Schlusnus, der sich von Rehkempers emotionalen Übertreibungen zwar fern hält, aber auch etwas altväterlich wirkt. Besonderen Eindruck machte eine 1945 bei der Reichsrundfunkgesellschaft entstandene Einspielung mit Peter Anders und Michael Raucheisen, die Stegemann freilich als zu opernhaft kritisierte. Den anderen gefiel aber gerade diese Art des leidenschaftlichen, dabei enorm disziplinierten Singens.

Über den Rang der vorgestellten Einspielungen waren sich die Diskutanten auch sonst nicht immer einig, was die Gespräche freilich belebte. Besonders fundiert wirkten die Auslassungen von Mösch, selber ausgebildeter Sänger. Stegemann sieht die Fischer-Dieskau-Zeit als mittlerweile „überwunden“ an, was etwas stark von oben herab kommentiert wirkte. Wesentlich stärker sympathisierte man mit der Erklärung von Frau Büning, welche mit der Interpretation von Christoph Prégardien und dem Hammerflügel-Spezialisten Andreas Staier (1996) ein neues Tor der Interpretation ausgestoßen sieht. Sehr kontrovers wurde die Aufnahme von Christine Schäfer (2003) beurteilt, was aber nicht auf eine generelle Ablehnung von weiblichen „Winterreise“-Interpreten hinauslief. So gab es ausgesprochen positive Voten beispielsweise für Lotte Lehmann/Paul Ulanowsky (1940) und Brigitte Fassbaender/Aribert Reimann (1988).
Stegemann wartete mit einigen außenseiterischen Aufnahmen auf, so der durch Herman van Veen, welche freilich nicht für die gesamte „Winterreise“ gepaßt hätte. Er wies auch darauf hin, daß sich ein Wolf Biermann von Schubert sehr inspiriert sah. Die traditionsverweigernde Annäherung an diesen Komponisten und in Sonderheit seinen „Winterreise“-Zyklus muß nicht partout absolute Überzeugungsarbeit leisten, kann seiner Meinung nach aber entscheidende Überlegungen in Gang setzen. Das letzte Musikbeispiel des Diskussionsabends galt Christoph Prégardiens Sohn Julian, welcher im letzten Jahr die Version Hans Zenders aufgenommen hat. Damit war auf elegante Weise ein Übergang zum nachfolgenden Konzert gegeben.
Es wurde bestritten vom WDR Sinfonieorchester, geleitet von Brad Lubman, einem Spezialisten für zeitgenössische Musik, hier aber ein hellhöriger, eminent feinfühliger Schubert-Interpret. Solist war Daniel Behle. Vor ihm mußte man an diesem Abend niederknien. Was der Mittvierziger an vokaler Schönheit und Wahrhaftigkeit des expressiven Ausdrucks bot, ließ sich die Zuhörer förmlich im siebten Himmel fühlen. Behle besitzt ein warm flutendes, wunderbar schlankes Organ, welches sich irgendwann - so suggerierten es etliche Ausdrucksmomente - auch dramatischere Aufgaben erobern dürfte.
Der Sänger ist selber kompositorisch tätig, hat beispielsweise für die „Winterreise“ eine Fassung mit Klaviertrio erstellt (Youtube: Hirzenberg Festival 2013 mit dem Oliver Schnyder-Trio). Somit hatte er kaum Schwierigkeiten, sich auf die Zender-Version einzustellen, die freilich großorchestral daherkommt. Hin und wieder empfindet man bei ihr Äußerlichkeiten wie die drei Windmaschinen bei „Mut“ oder das Klopfen auf Holzlatten bei „Einsamkeit“. Auch einige Lontano-Wirkungen wirken etwas gewollt. Doch in toto ist die Zender-Nachschöpfung anregend und fantasievoll in der Instrumentation. Es gibt kaum essentielle Eingriffe in den Gesangspart außer ein paar Textsprengungen oder hier und da einen dynamisch angehobenen Orchestersound, welcher den Sänger zum Mikrophon greifen läßt.
Bei alledem wahrte Daniel Behle die Normgesetze der Vokalkunst. Was er in punkto Pianogesang und rhetorischen Finessen bot, war nichts weniger als mirakulös. Behle gehört fraglos zu den begnadetsten Sängern der Gegenwart, auch seine Repertoirevielfalt nimmt für ihn ein. Durch ihn gewann der Kölner Abend fraglos Ausnahmecharakter.
Christoph Zimmermann 12.3.2019
Kammermusikalische Raritäten
24. Februar 2019
Alja Velkaverh (Flöte), Antonia Schreiber (Harfe)
„Wie stark ist nicht dein Zauberton“. Dieses „Zauberflöten“-Zitat kommt einem in den Sinn, wenn man die Flötistin Alja Velkaverh erlebt. Ihr Spiel besitzt enorme Wärme, ihre tonliche Formulierung samtige Einkleidung. Die Höhe leuchtet, die Tiefe vibriert nachgerade erotisch. Seit 2010 kennt man die slowenische Flötisten als Mitglied des Gürzenich-Orchesters, wo sie mit ihren Soli immer wieder auffällt.

Drei Jahre später stieß die Harfenistin Antonia Schreiber (Bild unten) zu diesem Klangkörper, nachdem sie zuvor bei den Wiener Philharmonikern eine gute, strenge Schule durchlaufen hatte. Es war faszinierend nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, mit welcher Musikalität und Eleganz die Künstlerin ihr Instrument handhabte. Bei KammerMusikKöln hat man als Zuhörer im unterirdischen, intimen Sancta Clara Keller ja immer den besonderen Genuß, Musiker in Hautnähe zu erleben.
In der Regel ist die Harfe in den letzten Orchesterreihen plaziert. Soloauftritte wie die von Xavier de Maistre oder Emmanuel Ceysson gibt es so häufig nicht. Das liegt freilich nicht zuletzt an der Begrenztheit des einschlägigen Repertoires. Dabei hat die Duobesetzung Flöte/Harfe eine lange, bis in die Mythologie zurückreichende Geschichte. So sollen die Götter Pan und Apoll in einen musikalischen Wettstreit getreten sein, welcher unentschieden ausging. Was Alja Velkaverh und Antonia Schreiber betrifft, so war ihr gemeinsames Auftreten jedoch eine ganz und gar freundschaftlich wirkende Angelegenheit.
Zu den bekanntesten Werken für Flöte und Harfe gehört das Doppelkonzert von Mozart. Die dem Komponisten nachgesagte Aversion gegen beide Instrumente können bestenfalls punktuelle gewesen sein, sonst hätte diese Wundermusik nicht entstehen können. Das Gürzenich-Orchester sollte das Werk mit beiden Interpretinnen unbedingt einmal in Planung nehmen.

In kammermusikalischer Hinsicht gibt eine Spurensuche nach Werken für Flöte und Harfe besonders in Frankreich viel her, freilich erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und selbst da war von den Interpretinnen umfänglich und penibel nach Vorhandenem zu recherchieren. Kein Wunder, daß die beiden Damen planen, ihr Programm auch auf CD zu veröffentlichen. Von dieser Stelle aus dringliche Empfehlung.
Jean Cras (1879-1932) war ein durchaus erfolgreicher Komponist, nicht zuletzt mit seiner Oper „Polyphème“ (dem heutigen Spielplan freilich gänzlich entschwunden). Seine Eltern drängten auf eine Karriere als Marineoffizier, die Cras brav und erfolgreich absolvierte. In seiner Kajüte stand aber immer ein Klavier, und in dieser Abgeschiedenheit entstand auch seine „Suite en Duo“. Sie enthält schöne Aufgaben für die beiden Instrumente und ihre individuellen Farben. Ohrenfreundlich sind auch die 45 Jahre später entstanden „Deux Impressions“ von Eugène Bozza (1905-1991) mit ihren vielen Soloherausforderungen. Noch stärker an die Gegenwart heran rückt „Toward the Sea“ von Toru Takemitsu (1930-1996), eine Komposition, welche dezidiert eine Altflöte erfordert. Daß Marc Berthomieu (1906-1991) auch Operetten schrieb, scheinen die „Trois Thémes“ zu unterstreichen. Harmonische Modernismen halten sich in Grenzen. Im Klangausdruck geht Bernard Andrès (*1941), selber Harfenist, entschieden weiter. Bei „Algues“ von 1988 läßt er durch eine besondere Zupftechnik „sein“ Instrument sogar fast wie ein Xylophon klingen. Die „Naiades“ von William Alwyns (1905-1985) führen in sanftere Gefilde zurück, was der Werktitel bereits andeutet.
Ein schöner, animierender Abend, welcher bei den Zuhörern sich auch zum Nachdenken anregt. Beiden Musikerinnen für ihre interpretatorische Vielseitigkeit höchstes Lob. Eine Wiederholung des Konzertes tags drauf in Bonn ist längst üblich.
Christoph Zimmermann 25.2.2019
Bilder (c) Gürzenich Orchester
Romantische Orchesterlieder
17.2.2019
Kölner Kammerorchester & Christoph Poppen
Featuring: Christoph Prégardien
Ähnlich wie kürzlich Concerto Köln für ein romantisches Konzert (Vorstufe für den kompletten Wagner-„Ring“) massiv aufgestockt wurde, trat nun auch das Kölner Kammerorchester unter Christoph Poppen in stark erweiterter Besetzung an, notwendigerweise mit Gästen, von denen wenigstens zwei als Mitglieder des Gürzenich-Orchester zu identifizieren waren. Grund für den Aufwand war die Verpflichtung von Christoph Prégardien (Bild unten), welcher mit Orchesterliedern aufwartete. In allen Fällen handelte es sich um Bearbeitungen ursprünglicher Klavierbegleitungen, wobei die Fassung von Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ aus des Komponisten eigener Hand stammen, somit authentisch sind. Die Gesänge von Franz Schubert wurden in der Instrumentation von fremder Hand geboten. Johannes Brahms („Greisengesang“) war noch im von Schubert vertretenen 19. Jahrhundert zu Hause, Max Reger („Nacht und Träume“) ein Postromantiker und Anton Webern ein Vertreter zeitgenössischer Musik, der sich (wie etwa auch Arnold Schönberg) hin und wieder stilpassend an der Bearbeitung fremder Werke delektierte.

Der Grund hierfür muß nicht immer so aggressiv formuliert sein wie im Folgenden: „Für mein Ohr ist es oftmals direkt eine Beleidigung, in einem Riesensaal nach einer Orchesternummer eine Sängerin hören zu müssen, die zu (einer) spindeldürren Klavierbegleitung Lieder singt.“ Die Konzertform, auf welche Max Reger anspielt (Wechsel von Orchester und Kammermusik) gibt es heute nicht mehr, die Umgestaltung von Musik hin zum Üppigen ist also zeitgebunden. Allerdings dürfte mitunter auch eine leichte Eitelkeit der Bearbeiter mitgespielt haben, welche glaubten, das Original auf eine qualitativ höhere Stufe zu stellen. Webern ging bei der Romanze „Der Vollmond strahlt“ aus Schuberts „Rosamunde“ freilich dezent vor, fügte der bereits original vorhandenen Orchestrierung lediglich zwei Flöten hinzu (wozu eigentlich?). Der temperamentvolle, gerne aus dem vollen Orchesterklang schöpfende Hector Berlioz glaubte jedoch zweifelsohne an die Verstärkung von Wirkung.
Über die vom KKO unter Poppen präsentierten Musikbeispiele ist unterschiedlich zu befinden. Der „Wegweiser“ aus Schuberts „Winterreise“, wo Webern vom Klavier auf Streicherklang umschaltet, darf definitiv als Negativbeispiel gelten. Zu breiig tönt es im Orchester, während der originale Klavieranschlag mit seiner Prägnanz wesentlich mehr Wirkung macht. Aber der musikhistorische Exkurs hatte durchaus seine Reize, zumal Poppen die spezielle Klangfarbe der Liedbearbeitungen wirksam werden ließ. Insgesamt erwies er sich als ein rücksichtsvoll auf den Sänger eingehender Klanggestalter.
Trotz seiner 63 Jahre ist Christoph Prégardien ungebrochen aktiv, mittlerweile auch als Dirigent. Die Schubert-Lieder forderten dem Sänger anfangs keine exponierten Tenorhöhen ab, was sich im Verlaufe des Konzerts allerdings änderte. Frappant, mit welch Attacke der Sänger die vielfach ein Piano fordernden Spitzentöne beim „Wegweiser“ meisterte. Die besondere Kunst Prégardiens, der in seinem Sohn Julian übrigens einen gleichrangigen Fachkollegen gefunden hat, war das lyrisch intensive Ausgestalten von Phrasen bei exzellenter Textverständlichkeit. Schuberts „Nacht und Träume“ geriet in all diesen Belangen geradezu mirakulös. Ähnliches ist über Mahlers „Gesellen“-Lieder zu sagen.
Das KKO umklammerte das Liedzentrum des Abends sinfonisch. Joseph Haydn gehört zu den Repertoirekonstanten des Musikerkollektivs. Die Sinfonie Hob. I:26 mit dem Beinamen „Lamentatione“ gehört vielleicht nicht zu den inspiriertesten Werken, aber im Trio des (überraschenderweise finalen) Menuettsatzes ließen die überraschenden Sforzati den typischen Haydn-Kobold erkennen.
„Schubert for ever“ war das KKO-Programm nicht ganz stimmig überschrieben, aber dieser Wunderkomponist prägte den Abend schon besonders nachdrücklich, zuletzt mit der Sinfonie Nr. 7, der „Unvollendeten“ also. Dieser Populartitel ist eine Art Markenzeichen, welches letztlich unüberbietbar ist. Aber es hat immer wieder Versuche gegeben, das als Torso fraglos erkennbare Werk zu ergänzen. Die Version von Brian Newbould regte Neville Marriner und Charles Mackerras zu CD-Einspielungen an. Eine neue Fassung von Nicola Samale und Benjamin Gunnar Cohrs hat der Concentus Musicus vor kurzem eingespielt. Ohne diese Bearbeitungen zu kennen, sind Zweifel an der erweiterten Werkgestalt angebracht. Die „Unvollendete“ wirkt ganz einfach vollkommen. Nur Hörgewohnheit?
Christoph Poppens Interpretation blieb auf traditioneller Spur. Seine angenehm flüssigen Tempi sind auch anderswo zu finden, ebenso die Dramatisierung von Ausdruck. Man fühlte sich aber wohl bei dieser Widergabe, geadelt von der Spielqualität des KKO.
Christoph Zimmermann 18.2.2019
Bild (c) Marco Borggreve
Gürzenich-Orchester & Francois-Xavier Roth
featuring: Isabelle Faust
12.2. 2019
Schwierige Werke?
Vor wenigen Tagen erst war Isabelle Faust in der Philharmonie aufgetreten, und zwar mit dem London Symphony unter John Eliot Gardiner und in Partnerschaft mit dem Pianisten Kristian Bezuidenhout für Mendelssohns Doppelkonzert. Ein selten gespieltes Werk wie auch Robert Schumanns Violinkonzert, selbst wenn eine Reihe von CD-Aufnahmen signalisieren, daß sein früheres Schattendasein weitgehend beendet scheint. Eine besondere Herausforderung bleibt es freilich weiterhin. Ob es sich die Geigerin für ihr Debüt beim Gürzenich-Orchester ausgesucht hat oder der Dirigent Francois-Xavier Roth, ist nicht bekannt. Da Isabelle Faust mit Noten spielte, ist am ehesten an ein Entscheid des Dirigenten zu glauben.

Das Violinkonzert blickt auf eine schicksalsträchtige Geschichte zurück. 1853 neben einer Fantasie in gleicher Besetzung entstanden, wurde die geplante Uraufführung nach den ersten Proben aufgegeben, weil sich der noch sehr junge Joseph Joachim der Bewältigung des Werkes nicht zur Gänze gewachsen zeigte. Eine neue Initiative fand nicht statt, nachdem sich Schumann in den Rhein stürzte und seine aktuelle Kompositionstätigkeit daraufhin als Spiegel für diese Wahnsinnstat angesehen wurde. Schumanns Gattin Clara hatte sich schon zuvor zurückhaltend über das Konzert geäußert, zumal über seinen Introduktionssatz. Sie bat schließlich sogar, von Aufführungen überhaupt abzusehen. Das Notenmaterial ging in den Besitz von Joseph Joachim über, welcher verfügte, daß das Werk erst hundert Jahre nach Schumanns Tod aufgeführt werden dürfe. Aufgrund von Nachfragen durch die Geigerin Jelly d’Arányi, einer Großnichte Joachims, wurde im 20. Jahrhundert jedoch neues Interesse an dem Werk wach. Der Verlag Schott mischte sich ein und erreichte bei den Joachim-Erben eine Annullierung der „Schutz“frist. Für die Nationalsozialisten war dies willkommener Anlaß, das beliebte Konzert des „Juden“ Mendelssohn durch das des „deutschen“ Robert Schumann in der Musiköffentlichkeit zu ersetzen.
Am 26. November 1937 fand in Berlin die Uraufführung statt. Georg Kulenkampff spielte (als „Ersatz“ für den zunächst vorgesehenen Yehudi Menuhin) den Solopart, welchen er leicht modifiziert hatte. Es begleiteten die Philharmoniker unter Karl Böhm. Die Interpretation des Geigers mit dem Berliner Orchester ist überliefert, für lange Zeit allerdings nur in Form einer nachträglichen Studioproduktion, bei welcher zudem Hans Schmidt-Isserstedt statt Böhm dirigierte. Die Tatsache, daß die Premierenaufführung weltweit im Radio übertragen wurde, ließ einen Violinenthusiasten unserer Tage nicht ruhen. Ihm gelang es tatsächlich, über weitverzweigte Kanäle einen privaten Mitschnitt ausfindig zu machen, welcher seit 2016 auf dem Label „Podium“ greifbar ist.
Die Musik von Schumanns Konzert ist kaum als einschmeichelnd zu bezeichnen, einige melodische Themen ausgenommen. Bereits die fast rabiat zu nennenden Doppelgriffe der Introduktion markieren eine über romantische Gefälligkeit hinausführende Energie. Der polonaisenartige Finalsatz wirkt entschieden gelöster, sogar leicht humorvoll. Sein rhythmischer Impetus wurde häufig (und wird vielleicht noch) durch allzu rasche Tempi unbotmäßig nivelliert. Francois-Xavier Roth hielt sich strikt an das „lebhaft, aber nicht zu schnell“, was man vielleicht um einige Grade als zu streng empfinden konnte. Aber Mendelssohn-Grazie ist dem Werk nun einmal per se nicht eigen. Isabelle Faust unterstrich das mit ihrem zupackenden Spiel, intensiviert durch Tonformulierungen mit einem Vibrato, welches erst nach einer Millisekunde wirksam wurde. Das ergab eine leicht harsche Wirkung. Die stilistische Kompetenz der Geigerin frappierte jedoch auf ganzer Linie, das Gürzenich-Orchester bot eine elanvolle Begleitung.
Nach der Pause Gustav Mahlers fünfte Sinfonie. Francois-Xavier Roth hat sie bereits mehrfach aufgeführt und auch aufgenommen, stolz darüber, daß „sein“ Orchester 1904 die Uraufführung bestritten hat. Ein historisches Foto des Gürzenich-Saales aus diesem Jahr im Programmheft zeigt einen durchaus dekorativen Raum, dessen festliche Wirkung durch simple Stuhlreihen freilich leicht ernüchtert wird. Wie auch immer: der Abend des 18. Oktober geriet zum Ereignis, auch durch das persönliche Dirigat von Mahler.
Über sein Werk schrieb der Komponist mit selbstkritischer Ironie: „Was soll es (das Publikum) zu diesem Chaos…, zu diesem sausenden, brüllenden, tosenden Meer … für ein Gesicht machen?“ Heute empfindet man die sich vor Radikalität fraglos nicht scheuende Musik als uneingeschränkt zugänglich. Das traumesselige Adagietto ist dabei nicht einmal ausschlaggebend, wenn auch hilfreich. Die emotional überbordende Interpretationsweise eines Leonard Bernstein ist die Sache von Francois-Xavier Roth nicht. Er machte mit Hilfe seiner sehr belebten Dirigiergestik die Strukturen des Werkes nachvollziehbar, gab der Musik federnde Elastizität. Daß auch diese Art von musikalischer Darstellung starke Gefühlswallungen auszulösen imstande ist, war an den Publikumsreaktionen abzulesen, zumal das Gürzenich-Orchester große Präsenz zeigte.
Inzwischen befinden sich die Künstler auf einer Tournee mit den Stationen Turin, Budapest, Zürich und Wien. Mahlers „Fünfte“ bleibt das zentrale Werk. Das Schumann-Konzert wird freilich durch das von Mendelssohn ersetzt. Auch wenn man dies als historische Erinnerung nachvollziehen kann, ist der Austausch bedauerlich, denn für Schumanns WoO 1 bleibt immer noch viel zu tun.
Christoph Zimmermann 13.23.201
Bild (c) Felix Broede
Ehrgeiziges Ziel: Wagners „Ring“ authentisch
20.1.2019
Shunske Sato, Nils Mönkemeyer, Concerto Köln: Kent Nagano
Es gibt einen aufregenden Plan: die Realisierung von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ in möglichst optimaler Annäherung an das ursprüngliche Klangkonzept des Komponisten. Der Boom im Bereich historisch informierter Aufführungspraxis zeigt ja, wie sehr sich interpretatorischer Geschmack im Laufe von Jahrzehnten verändert hat. Diese Entwicklung muß man durchaus nicht in Bausch und Bogen verurteilen, aber der Wunsch nach Korrektur ist nachvollziehbar. Freilich ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß nicht nur nachprüfbares Notenmaterial, sondern auch interpretatorische Individualität eine gewichtige Rolle spielt, damals wie heute.

Kent Nagano begibt sich mit Concerto Köln nun also auf Spurensuche in Sachen Wagner. Von wem die Initiative ausging, ist nicht bekannt. Aber Nagano beherrscht als erfahrener Operndirigent auch den „Ring“ (zuletzt Aufführungen in Hamburg Ende 2018), Concerto Köln hat sich hingegen in den dreißig Jahren seines Betstehens auf barocke und klassische Werke konzentriert. Die „Ring“-Idee dürfte also letztlich von dem kalifornischen Maestro gekommen sein. Aber natürlich sind auch Wünsche des Orchesters nach Repertoireerweiterung vorstellbar, wie sie vor einiger Zeit beim Concentus musicus Wien beispielsweise mit der CD „Walzer-Revolution“ auch realisiert wurden.
Bis zu den geplanten Aufführungen in den Jahren 2021 bis 2024 bleibt noch Zeit für Forschungen, welche zusammen mit Musik- und Sprachwissenschaftlern durchgeführt werden sollen. Die Libretti Wagners sind nun freilich unumstößlich, aber seine Musik ist ein durchaus noch näher zu erforschender Kosmos. Der Komponist selber mußte bei der „Ring“-Uraufführung Kompromisse schließen, weil er nur teilweise die von ihm gewünschten Musiker zur Verfügung gestellt bekam. So mußte er auf Gast-Instrumentalisten ausweichen, welche z.T. andere Instrumente spielten als die von ihm für ideal erachteten. Er hatte beispielsweise die konische Ringklappenflöte im Sinn, welche inzwischen längst von der Bildfläche verschwunden ist. Concerto Köln benutzt sie allerdings, greift auch sonst auf historisches Instrumentarium zurück. Ein anderes Moment ist der Stimmton. Im Laufe der Zeit ist er bis 440 bis 443 Hertz angestiegen, wäre also historischen Gegebenheiten anzunähern. Concerto Köln ist mit seinen 435 Hertz den einstigen Gepflogenheiten bereits ganz nahe.
Concerto Köln wird sich in (zunächst) drei Konzerten unter dem Motto „Wagner-Lesarten“ dem Komponisten anzunähern versuchen. Das Siegfried-Idyll im aktuellen Programm hängt bereits motivisch mit der Bühnen-Tetralogie zusammen, ist aber - ähnlich wie das Waldweben in „Siegfried“ - primär kammermusikalisch angelegt. Die Wesendonck-Lieder entstanden sogar mit bloßer Klavierbegleitung, erhielten erst durch die Orchestrierung des Dirigenten Felix Mottl ihre heutige Gestalt (sie erklingen am 16.5. zusammen mit Anton Bruckners dritter Sinfonie).
Der aktuelle Abend wurde ergänzt durch das vierte Violinkonzert von Niccolò Paganini sowie „Harold in Italien“ von Hector Berlioz. Von dem Orchesterrevolutionär Berlioz lassen sich Verbindungslinien zu Wagner unschwer ziehen. Bei Paganini fällt dies aber schwer. Kent Nagano weist darauf hin, daß „Harold“ von diesem als kapriolenreiches Bratschenkonzert in Auftrag gegeben wurde, welches Berlioz dann aber nicht schrieb, sondern vielmehr zu einer alternativen „Symphonie fantastique“ ausarbeitete. Der Solopart für eine Viola war damals fraglos ein interessantes Novum, aber letztlich eine Äußerlichkeit. Das Paganini-Konzert besitzt wie seine Schwesternwerke einen primär virtuosen Anstrich, ungeachtet einiger orchestraler Pikanterien. Nagano beharrt jedoch: „Wir wollen nicht nur den künstlerischen, sondern auch den sozialen und anthropologischen Kontext rekonstruieren, aus dem heraus Wagners Ideen entstanden“, so seine Worte in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger.

Shunske Sato, Konzertmeister bei Concerto Köln und anderswo, spielte das Paganini-Konzert quasi „mit links“. Keine noch so ausgepichte Finger- und Bogenakrobatik schien ihm Mühe zu machen, und sein Ton behielt selbst in extremer Lage betörende Leuchtkraft. Über die Behauptung im Programmheft, das Orchester sei „nicht zur Begleitung degradiert, sondern ebenbürtiger Partner“, kann man geteilter Meinung sein. Alleine der rhythmisierende Dauereinsatz des Beckens wirkt leicht militärhaft. Schöne Details wurden freilich bereits oben nicht abgestritten. Die Aufgabe Naganos, welcher das Orchester feurig aufspielen ließ, bestand vor allem darin, die sich oft recht frei entfaltende Agogik des Solisten mit der Begleitung sicher zu koordinieren, nicht zuletzt die vielen Tuttischläge des Orchesters präzise zu plazieren.
Die Sinfonie „Harold in Italien“ - wie schon angemerkt: kein Virtuosenkonzert, wie von Paganini erhofft - weist der obligaten Bratsche eine Erzählerrolle zu. Der aus Lord Byrons „Childe Harold’s Pilgrimage“ entlehnte Titelheld ist ein Alter Ego von Berlioz, ein Träumer, welcher sich seine Idealwelten erschafft. Zu dieser meditativen Figur paßt der sonore, mittellagige Ton der Bratsche bestens, und Nils Mönkemeyer spielte seinen Part nobel und mit Inbrunst. Nagano brachte das Orchester zum Schwelgen, sorgte bei Bedarf aber auch für immensen Klangaufruhr. Alleine durch den Einsatz von neun (!) Kontrabässen mußte der Besetzungsstamm von Concerto Köln mächtig aufgestockt werden. Woher die zusätzlichen Musiker im Einzelnen kamen, wurde nicht angegeben. In der Harfenistin konnte man allerdings ein Mitglied des Gürzenich-Orchesters ausmachen. Mit sieben Kontrabässen war auch das Siegfried-Idyll großvolumig besetzt, was seiner ursprünglichen Funktion (Geburtstagsständchen für Cosima Wagner) eigentlich widersprach. Das weich flutende Spiel von Concerto Köln mit seinen subtilen Schattierungen überzeugte gleichwohl. Effektvolle Schlußzugabe: der Ungarische Marsch aus „Damnation de Faust“ von Berlioz. Stürmisch wie diese Musik auch der Publikumsbeifall.
(c) Philharmonie Köln / Yat Ho Tsang
Christoph Zimmermann 21.1.2019
Aus Böhmens Hain und Flur
18.1.2019
WDR Sinfonieorchester: Semyon Bychkov

Dreizehn Jahre lang, von 1997 bis 2010, war Semyon Bychkov Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, arbeitete daneben aber auch international. Im vorigen Oktober hat er als Nachfolger von Jiri Belohlávek die Leitung der Tschechischen Philharmonie übernommen, eine Bindung, welche er ein wenig zögerlich anging. Aber die besondere Klangqualität des Orchesters und die Möglichkeit, mit ihm neue künstlerische Ziele zu verwirklichen, gaben dann doch einen positiven Ausschlag. Gleichwohl ist die Entscheidung leicht risikobehaftet. Das tschechische Renommierorchester denkt und empfindet nämlich stark national. Ein Ausländer als Chef kommt da schnell an Grenzen der Akzeptanz, wie es Gerd Albrecht von 1993 bis 1996 erleben mußte. Aber inzwischen ist Zeit ins Land gegangen und es hat sich eine tolerantere Stimmung etabliert. Semyon Bychkov wagt also sein neues Amt.
Er hat bereits eine Reihe von Kompositionsaufträgen vergeben, fünf bei ausländischen Musikern, neun bei tschechischen. Die Beschäftigung mit erst noch entstehenden Werken ist freilich eine Herausforderung eigener Art. Wie Bychkov sich bei heimischen “Nationalheiligtümern” schlägt, bleibt abzuwarten. Mit einem von ihnen, Bedrich Smetanas “Mein Vaterland” (“Má vlast”), kehrte er jetzt erst einmal ans Pult des WDR-Orchesters zurück. In der baldigen Wiederbegegnung von James Conlon mit dem Gürzenich-Orchester findet dieser Vorgang eine Parallele.
“Mein Vaterland” ist - der Titel läßt es unverkennbar erkennen – eine Hymne auf Smetanas Heimat. Das war freilich eine nach und nach wachsende Liebe, denn der Komponist wurde mehr oder weniger deutsch erzogen, mußte sich u.a. die tschechische Sprache nach und nach aneignen. Ählich erging es Jean Sibelius in Finnland, wo erst die Oktoberrevolution von 1917 zur Ubnabelung von Rußland führte. Die Enstehung von “Mein Vaterland” fällt in die letzten Lebensjahre des Komponisten, als er bereits ertaubt war. Eine Tinnitus-Erkrankung war voraus gegangen, wovon sein Streichquartett “Aus meinem Leben” mit einem überraschenden, schrillen Diskantton kündet.
Der sechsteilige Orchesterzyklus schwelgt nun aber voll und ganz in romantischen Gefühlen, wobei sogar die musikalisch nicht so leicht zugängliche sinfonische Dichtung “Tabor” (Nr. 5) wichtige Akzente setzt. In der südböhmischen Stadt lebte einst der Reformer Jan Hus, welcher für seine Freiheitskämpfe mit dem Tode bezahlte. Der Hussiten-Choral “Die ihr Gottes Streiter seid” ist das immer wieder neu auflodernde Zentralthema, welches durch Pausen von Bruckner-Länge einen etwas plakativen Anstrich erhält. Der finale Teil des Zyklus’, “Blanik”, zitiert den Choral ebenfalls (der Berg liegt nahe bei Tabor), bindet ihn jedoch in melodische Verläufe ein und mündet zuletzt auch wieder in das Vysherad-Motiv, mit welchem “Mein Vaterland” anhebt.
Schon in dieser einleitenden Tondichtung beschreibt Smetana die wechselvolle Geschichte Tschechiens und läßt sie in seiner Musik dramatisch drängenden Ausdruck finden. Der dritte Teil von “Ma vlast”, nämlich “Sarka”, hat in der Bewertung immer leicht hintan gestanden, was man aber nicht wirklich als gerechtfertigt empfinden kann. Sarka war Anführerin eines Amazonengeschlechts, welches erfolgreich gegen feindliche Ritter kämpfte. Wenn nach 1968, als die Russen in der Tschechei einmarschiert waren, um Alexander Dubceks “Kommunismus mit menschlichem Antlitz” in Grund und Boden zu schießen, beim ”Prager Frühling” dieses Stück endete, stand das Publikum auf und klatschte demonstrativ. Das geschieht heute wohl nicht mehr, aber man empfindet den geschichtlichen Hintergrund durchaus noch mit einer gewissen Gänsehaut. Friedvoll hingegen “Die Moldau” und “Aus Böhmens Hain und Flur”, Naturidyllen, wie sie schöner und bewegender kaum vorstellbar sind.
Semyon Bychkov sorgte mit dem exzellen aufspielenden Orchester für eine farbsprühende Widergabe von Smetanas Musik, welche dem Pathosausdruck keineswegs aus dem Wege ging. Ein etwas schlankerer musikalischer Fluß ware hier und da denkbar gewesen (zumal bei der “Moldau”), aber das Bekenntnishafte der Interpretation machte, verbunden mit souveräner Klangsteuerung, starke Wirkung. Ein, zwei Momente leichter Unkonzentration bei den Blechbläsern in “Tabor” seien nicht moniert, lieber der Weichklang der Hörner, die präzisen Flötenläufe zu Beginn der “Moldau” oder auch die vielen wunderbaren Klarinetten-Terzen hervorgehoben. Bychkovs Tempi gaben sich nirgends extravagant, hingegen verstand sich der Dirigent bestens auf stimmige Ritardanti. Viel Beifall für den “Heimkehrer” Bychkov, aber fraglos auch für Smetanas hinreißendes Werk.
Christoph Zimmermann (19.1.2019)
Bild (c) WDR Sheila Rock
Romantisches aller Arten
14. Januar 2019
Yeol Eum Son, Jennifer Holloway, Michael Nagy, Gürzenich-Orchester: Pablo Gonzáles
Das Hauptwerk der jüngsten Gürzenich-Abo-Reihe war Alexander von Zemlinskys „Lyrische Symphonie“ auf Texte des bengalischen Dichters Rabindranath Tagore. Das ist schon deswegen hervorzuheben, weil die letzte Aufführung (Mai 2000) unter James Conlon stattfand, dem Chef des Klangkörpers (auch in der Oper) von 1989 bis 2003. Er entdeckte in seiner Kölner Zeit Zemlinsky eher zufällig, doch wurde bald daraus eine musikalische Liebesbeziehung. Viele Aufnahmen mit Zemlinskys Werken entstanden damals, von denen derzeit leider nur noch die Oper „Der Zwerg“ greifbar ist, welche Conlon später auch in Los Angeles herausbrachte (Aufführung auf DVD). Der Dirigent wird übrigens in dieser Spielzeit an das Gürzenich-Pult zurückkehren, freilich nicht mit Zemlinsky, sondern der siebten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch.

Die Widergabe der „Lyrischen Symphonie“ oblag jetzt dem Spanier Pablo Gonzáles . Mit seiner schlanken Gestalt und seiner vehementen, auf Exaktheit und Vielfalt des Ausdrucks zielenden Gestik wirkte er wie ein Feuergeist, Emotionen immer neu schürend. Im ersten Gedicht deckte er den Gesang des Baritons
Michael Nagy denn auch einige Male zu, aber die Glut der großorchestrierten Musik ist nun mal kaum zu bändigen. Eine Studioaufnahme mit akustisch steuernden Mikrophonen würde das sicher besser ausbalancieren können.
Die Texte, welche heute fraglos leicht angegilbt wirken, aber gerade deswegen auch einen besonderen nostalgischen Reiz besitzen, sind eine eigentümliche Mischung aus erotischer Extase und Leidenschaftsunterdrückung. Das Mädchen, welches im zweiten Lied einem geliebten, sie aber nicht beachtenden Prinzen ihr Geschmeide lockend vor die Füße wirft (es wird freilich von der Kutsche zermalmt), bewegt sich fast schon im Bereich des Wahnsinns. Der männliche Protagonist der weitgehend zäsurlosen Symphonie (es ist nicht der Prinz) strebt zuletzt auf ein „süßes“ Scheiden zu. „Laß es nicht ein Tod sein, sondern Vollendung.“ Das klingt nach Wagners „Tristan“, dessen harmonisch schillernde Musik von Zemlinsky aufgegriffen, aber in die aktuelle Zeit fortgeführt wird. Für die Zwölftontechnik seines späteren Schwagers Arnold Schönberg war er aber nicht zu haben, was sogar zum Bruch zwischen beiden Männern führte. Das Gürzenich-Orchester gab der Musik starke Impulse, bewährte sich im theatralischen Überschwang ebenso wie in der Intimität etwa des vierten Liedes, welches besonders stark von deinem ausgiebigen Violinsolo lebt.
Nicht erst hier fand Jennifer Holloway zu berückender Tonschönheit. Der Amerikanerin merkt man nicht an, daß sie ihre Karriere im Mezzofach begann, so unforciert bewältigte sie selbst extreme Höhen. Auch bei ihrem Bariton-Kollegen waren immer wieder Spitzentöne gefordert. Michael Nagy bot sie souverän, mit maskulinem Wohllaut. Bestechend dann wieder die subtilen Piani, speziell im finalen Lied. Die hochbeeindruckende Aufführung ließ den Wunsch aufkommen, in Köln auch mal wieder einer Oper von Zemlinsky zu begegnen.
Die vor der Pause gespielten Stücke hatten zu Zemlinsky und auch untereinander eigentlich keinerlei Beziehung. Verbindungslinien, wie im Programmheft („Das Konzert auf einen Blick“) herbei argumentiert, sind eher äußerlicher Art. Romantik und ihre Ausläufer wäre möglicherweise eine passendere Überschrift gewesen.
Den Auftakt des Abends bildete Robert Schumanns Ouvertüre zu „Genoveva“. Die einzige Oper des Komponisten hat sich im Theateralltag leider nicht durchsetzen können. Dabei läßt schon die Ouvertüre viele musikalische Schönheiten erkennen. Und wie bei seiner „Rheinischen“ Sinfonie und dem Konzertstück opus 86 jubeln die Hörner im Orchester unwiderstehlich. Unter der Leitung von Pablo Gonzáles wurde die Musik enthusiastisch ausgeformt
In die Mitte plaziert war Frédéric Chopins zweites Klavierkonzert (f-Moll, opus 21), ein Werk, bei welchem das Orchesters eine etwas sekundäre Rolle spielt, ungeachtet etlicher farbprägender Details wie den Fagott-Passagen im Larghetto. Gonzáles machte daraus so viel als möglich. Als Solistin erlebte man die junge Koreanerin Yeol Eum Son. Sie gab ihren Part mit klarer tonlicher Formulierung und brilliant im Anschlag, ohne auf vordergründige Virtuosität zu setzen. Die Diskantläufe im Finalsatz ließen dann aber ein leichtes erotisches Glitzern spüren. Gleichwohl: eine bei allem manuellen Drive angenehm disziplinierte Interpretation. Bei der zugegebenen „Chopiniata“ von Clément Doucet ließ die Pianistin freilich die Funken sprühen.
Foto (c) Philharmonis / Benjamin Ealovega
Christoph Zimmermann 17.1.2019
Oyayaye – Offenbach-Ausgrabung
Pablo Ferrández, Matthias Klink, Hagen Matzeit, Gürzenich-Orchester: Alexander Bloch
6.1.2019
Offenbach-Wahnsinn auf ferner Insel
2015 wurde die Kölner Offenbach-Gesellschaft gegründet, nicht zuletzt mit Blick auf das nunmehr angebrochene Jubiläumsjahr (200. Geburtstag). Denn der in Köln geborene, dann aber gänzlich französisierte Komponist ist lediglich durch eine Reihe populärer Werke bekannt. Etliches ist lediglich lexikalisch bekannt, Notenmaterial zudem vielfach auf der Welt verstreut. Diese Situation soll sich ändern. Die Kölner Oper wird im Juni „Die Herzogin von Gérolstein“ und eine spezielle Offenbachiade herausbringen sowie Produktionen von „Fantasio“ (Opera Zuid Maastricht) und „Barkouf“ (Opéra Strasbourg) einladen. Bei der Kinderoper wurde bereits die äußerst geglückte Spezialfassung von „Hoffmanns Erzählungen“ wiederaufgenommen. Die Kölner Kammeroper in Pulheim spielt „Orpheus in der Unterwelt“, in der Volksbühne am Rudolfplatz werden die Einakter „Insel Tulipatan“ und „Salon Pitzelberger“ (Pamy Produktion) sowie eine rheinisch gefärbte Offenbachiade präsentiert. Auch sonst ist über das Jahr hinweg viel los.

Die Phonoindustrie hingegen hält sich – die Abschweifung sei erlaubt – in Sachen Offenbach einigermaßen zurück. Eine kombinierte Wiederauflage von „Helena“, „Orpheus“ und „Gérolstein“ unter dem Dirigat von Marc Minkowski bedeutet editorisch nicht eben viel, das etwas anonyme Label Forlane legt ältere Anthologien mit historischen Aufnahmen aus weitgehend unbekannten Werken wieder auf. Darüber hinaus bleiben Gesamtaufnahmen aus jüngerer Zeit (vor allem mit Anneliese Rothenberger & Co) verfügbar. Doch Offenbach-würdig ist das eigentlich kaum.
Köln hat nun aber zugeschlagen, genauer: das Gürzenich-Orchester der Stadt. Es bot ein Neujahrskonzert unter dem feschen und alerten Jung-Dirigenten Alexandre Bloch (Chef in Lille, erster Gastdirigent bei den Düsseldorfer Symphonikern, Gründer des Orchestre Antipodes) mit Bekanntem und Unbekannterem. So bekam man beispielsweise die Barcarolen-durchleuchtete Ouvertüre zu den „Rheinnixen“ ebenso zu hören wie einen harmonisch raffinierten Walzer aus „Barkouf“ sowie „Introduction, Prière und Bolero“ für Cello und Orchester (aus „Grande Scène espagnole“ opus 22), eine von rund 175 Kompositionen für Offenbachs ureigenes Instrument. Die World Premiere fand erst 2007 in Zürich unter Minkowski statt, von Bloch gibt es eine CD-Aufnahme mit der jungen Cellistin Camille Thomas. Der 28jährige Spanier Pablo Ferrández bot das Werk in Köln mit allen notwendigen virtuosen Finessen. Als Zugabe spielte er mit seinem Gürzenich-Kollegen Bonian Tian ein Cello-Duo. Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Ansprachen der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, beide Reden angenehm kurz.

Dann aber der Clou. Seit 1855 war von „Oyayaye ou la Reine des lies“ („Oyayaye oder Die Königin der Inseln“) nichts zu hören gewesen, selbst bei Wikpedia mit ihren stets akribischen Ergänzungen fehlt ein Titelhinweis. Nun aber gibt es einen Jean-Christophe Keck, oberste Autorität in Sachen Offenbach. Seit Jahren ist er weltweit auf Spurensuche nach verlorenem (oder verloren geglaubtem) Notenmaterial. Die Oper „Les contes d’Hoffmann“ kann ein Lied davon singen.
Neueste Rekonstruktion ist nunmehr „Oyayaye“. Hier handelt es sich um eine der ersten vollgültigen „Offenbachiaden“. Die Premiere fand kurioserweise nicht in den Bouffes Parisiennes statt, sondern im Théâtre Marigny beim „Konkurrenten“ Hervé. Das Aufführungsmaterial ist verschollen, Keck erarbeitete das Libretto aus erhaltenen Rollenbüchern und dem Zensurlibretto (französische Nationalbibliothek). Von der Musik existieren lediglich fragmentarische vokale und instrumentale Aufzeichnungen. Das Ganze wurde von Keck im Stile Offenbachs neu orchestriert. Ein „Marche des sauvages“ („Marsch der Wilden“) fand sich in amerikanischem Familienbesitz, die verlorene Ouvertüre ersetzte Keck durch die von „Vent du soir ou L’horrible festin“ („Häuptling Abendwind“), eine durchaus legitime Maßnahme.
Das Sujet der „musikalischen Menschenfresserei“ („Anthropophagle musicale“ - auf ein Libretto von Jules Moinaux) ist wahrhaft verrückt. Der Kontrabassist Ràcle-à-mort (auf deutsch Schrubbdichwund oder Kratzmichtot) wird wegen eines Blackouts bei einem Konzert gefeuert (aus dem Gürzenich-Orchester - diese lokale Pointe gestatteten sich die Übersetzer) und landet flüchtend auf einer fernen Insel. Hier wird sein Leben nun aber bedroht, falls er nicht das Unterhaltungsbedürfnis des Volkes und seiner Queen ausgiebig befriedigt.

Diese Vorgänge sind wie gesagt gänzlich absurd, historisch allerdings äußerst anspielungsreich (Vergnügungssucht der Pariser). Das dürfte heute kaum mehr zu vergegenwärtigen sein, aber eine schrille Komödie ist immer irgendwie denkbar. Ihre Wirkung hängt allerdings von brillianten Sängerdarstellern ab. In der Kölner Philharmonie standen sie zur Verfügung. Zum einen in Person von Matthias Klink. In jüngerer Zeit wurde er besonders für sein sensibles Porträt von Brittens Aschenbach in „Death in Venice“ gelobt und in weiteren anspruchsvollen Partien gefeiert. Aber er ist (wie auch seine Frau, die Sopranistin Natalie Karl) der Operette zugetan. Es fällt schwer einzugestehen, daß dieser großartige Tenor von Hagen Matzeit noch um Einiges überflügelt wurde. Für die Titelpartie war er innerhalb von zehn Tagen eingesprungen (die Deutsche Oper am Rhein gab ihn aus den WA-Proben für „Xerxes“ frei). In dieser Zeit lernte er nicht nur seine herausfordernde Partie auswendig (französischer Gesangstext, deutsche Dialoge), sondern prägte die Aufführung in der andeutenden Regie von Sabine Hartmannshenn (erfrischende Zuarbeit durch die Kostüme von Lena Kremer) auch durch enorme szenische Präsenz. Seine künstlerische Tätigkeit ist ohnehin von einer beispiellosen Weitläufigkeit (Sänger, Filmkomponist, Produzent, Pop-Duo mit seinem Bruder Friedemann). In Köln durchraste er ironisierend all seine Stimmlagen (Bariton, Tenor, Countertenor).

Offenbachs Musik begnügt sich oft mit einer sekundären Funktion, zeigt aber an vielen Stellen, welcher Witz in auch noch so kleinen Details stecken kann. Alexandre Bloch und das Gürzenich-Orchester veranstalteten, wo es sein mußte, eine Riesenshow. Beim zugegebenen „Orpheus“-Cancan natürlich Klatschmarsch. Ohne Szene dürfte bei „Oyayaye“ übrigens kaum etwas laufen, insofern darf man der Inszenierung an den Münchner Kammerspielen am 9. Februar (zusammen mit „Pomme d’api“) mit einiger Spannung entgegensehen.
Bei Offenbach gibt es noch unendlich viel zu entdecken. Umso tragischer, daß der Einsturz des Historischen Archivs in Köln 2009 das dort lagernde Material massiv beschädigte. Wie weit alles restauratorisch aufgearbeitet werden kann, steht noch nicht endgültig fest. Aber man läßt den Kopf nicht hängen. Jean-Christophe Keck beispielsweise, noch keineswegs im Rentenalter, denkt bereits über einen Nachfolger nach. Offenbach-Forschung ist nun einmal ein Langzeitprojekt. Die Kölner Offenbach-Gesellschaft wird ihm dabei womöglich eine Hilfe sein.
© Kölner Offenbach-Gesellschaft / Thomas Kost
Christoph Zimmermann 7.1.2019
Festlich und erhebend
Kölner Kammerorchester: Christoph Poppen
16. Dezember 2018
Alle Jahre wieder, das Weihnachtsoratorium
Das Fest der Geburt Christi ohne Bachs „Weihnachtsoratorium“ - undenkbar. In der Kölner Philharmonie gibt es in diesem Jahr gleich zwei Aufführungen, die des Bach-Vereins unter Thomas Neuhoff (9.12.) und nun die des Kölner Kammerorchesters (KKO). Neuhoff ging, wenn man so will, den Weg des geringsten Widerstandes, indem der die besonders populären Kantaten 1-3 aufführte. Christoph Poppen

Chef beim KKO, gibt das Gesamtwerk, verteilt allerdings auf zwei Abende. Er selber dirigierte jetzt die ersten drei Kantaten; Eberhard Metternich, Leiter des beteiligten Vokalensembles Kölner Dom wird am 6.1. die restlichen übernehmen.
Es ist eine probate Methode, das gesamte dreistündige Werk, bei dem man von „Überlänge“ freilich nicht sprechen möchte, zu präsentieren. Mitunter gibt es unterschiedliche Kombinationsversuche der Kantaten, was dem großartigen Sechsteiler aber nicht gerecht wird. Musikalisch nicht gerechtfertigt war es auch, daß Poppen nach der zweiten Kantate eine Pause machte. Anderthalb Stunden bester Bach sind doch wohl zäsurlos auszuhalten.
Für das „Weihnachtsoratorium“ mußte das KKO natürlich durch Gäste aufgestockt werden. Für die glanzlichternden Chöre sind immerhin drei Trompeten erforderlich (Bruno Feldkircher kam aus dem Gürzenich-Orchester). Die Sinfonia wiederum erfordert vier Englischhörner. Auch hier kam Aushilfe aus dem Gürzenich. Bach, ein wahrhaft fantasievoller Klangkonstrukteur.
Bei einer Interpretation des „Weihnachtsoratoriums“ gibt es eigentlich kaum extravagante Ansätze. Die historisch informierte Aufführungspraxis hat sicher Akzente gesetzt. Was aber dramatischen Ausdruck und Tempowahl betrifft, bestehen über eine richtige Entscheidung kaum Zweifel. Auch bei Christoph Poppens Dirigat gab es keine Besonderheiten oder gar Extravaganzen festzustellen. Er setzte auf flüssige Tempi, stringentes Musizieren, ausdrucksvolle Akzente wie gleich im Eingangschor „Jauchzet, frohlocket“, welchem die mitwirkenden Sänger echte Jubelwirkung bescherten. Eigenwillig verhielt sich Poppen nur bei der Arie „Schlafe, mein Liebster“. Diese Nummer erfordert von der Altistin eine besonders akribische Gesangstechnik, sind doch lange melodische Bögen ohne hilfreiche Atemzäsuren zu bewältigen. Daß sie Ingeborg Danz nicht verfügbar sind, sei nicht behauptet, aber die Entscheidung fiel wohl doch als Hilfestellung für die mittlerweile 57jährige Sängerin. Aber das sei der eindrucksvollern Künstlerin gegönnt.
Wirkliche Hörschwierigkeiten verursachte jedoch der Tenor Martin Mitterrutzner. Er ist, wie seine kommenden Engagements zeigen, stark im lyrischen Fach beheimatet. Aber eine standfeste und gleichzeitig lockere Evangelistenstimme besitzt er nicht wie etwa ein Julian Prégardien. Beim Aufsteigen zu hohen Tönen gab es immer wieder Brüche, und die Koloraturen bei „Frohe Hirten“ kamen ziemlich verschmiert. Die Empfehlung für eine Umbesetzung für den 6.1. kommt vermutlich zu spät.
Bei dem noch immer subtil strömenden Alt von Ingeborg Danz geriet lediglich die Arie „Schließe, mein Herze“ etwas anämisch. Das offizielle Alter von Sibylla Rubens (48) bestätigt die Erscheinung der Sängerin nicht. Pardon, daß dies erwähnt wird, aber das Porträtfoto im Programmheft entspricht so gar nicht der Realität. Auch bei solchen Dingen sollte Sorgfalt walten. Aber der glockenreine Sopran der Sängerin funktioniert nach wie vor feintönig. Beim Duett „Herr, dein Mitleid“ geriet die Sängerin an der Seite von Konstantin Krimmel phonmäßig freilich etwas ins Hintertreffen.
Bei diesem erst 25jährigen Sänger ist zu verweilen. Erst im diesem Jahr wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet - ein Newcomer der allerersten Klasse. Daß er demnächst einen Liederabend mit Helmut Deutsch in Berlin bestreitet, kann als eine Art von Ritterschlag angesehen werden. Konstantin Krimmel besitzt ein in allen Lagen sicher ansprechendes Organ, angenehm timbriert, sinnfällig im Umgang mit dem Text. Als Opernsänger agiert er einstweilen an kleinen Bühnen wie Heilbronn; dort im nächsten Jahr Mozarts „Finta giardiniera“. Aber das dürfte sich in Bälde ändern. Auf Youtube gibt es neben Liedern auch Opernausschnitte (Leporello, Wolfram) zu sehen, die Krimmel auch als animierenden Bühnenakteur zeigen. Sein Einspringen für Konrad Jarnot beim „Weihnachtsoratorium“ führte somit zu einer begeisternden Begegnung.
Christoph Zimmermann (16.12.2018)
credits

Kosmisches Roadmovie
17.12.2018
Gürzenich-Orchester: Francois-Xavier Roth
In den Programmheften des Gürzenich-Orchesters gibt es auf der ersten Seiten stets ein Essay „Das Konzert auf einen Blick“. Dort werden die zur Aufführung anstehenden Werke in Beziehung zueinander gesetzt. Ein musikalisches Programm sollte Kompositionen ja generell dramaturgisch sinnvoll verknüpfen. Dieses Mal gewann man den Eindruck, daß die Verbindungslinien etwas mühsam herbeigeredet wurden, was die zugegeben klugen Formulierungen freilich zu kaschieren versuchten.
Die unter Francois-Xavier Roth diesmal aufgeführten Werke waren von Robert Schumann das Cellokonzert und die vierte Sinfonie sowie „Inscape“ von Hèctor Parra als Deutsche Erstaufführung (Premiere war am 19.5. in Barcelona). Das Stück wurde u.a. vom Gürzenich-Orchester in Auftrag gegeben, wobei allerdings Roth die treibende Kraft gewesen sein dürfte. Bei ihm stehen ja häufiger Novitäten an, mitunter im Rahmen einer besonderen Kontaktpflege wie die zum Komponisten Philippe Manoury. Parra, von dem das jetzt zu hörende „kosmische Roadmovie“ stammt, arbeitet am musikalischen Forschungszentrum IRCAM in Paris, welches 1978, zwei Jahre nach seiner Geburt, von Pierre Boulez gegründet wurde. Wenn in der Partitur Formulierungen wie „Aussendung von Gravitationswellen“ oder „Ballett der zwei Schwarzen Löcher“ auftauchen, dürfte klar sein, daß es sich bei dem halbstündigen galaktischen Werk nicht etwa um eine Variante von Gustav Holsts tonmalerischen „Planeten“ handelt, sondern um eine „Reise ins Innere“, um den englischen Titel „Inscape“ zu übersetzen.

Um seine Klangvorstellungen zu verwirklichen, verlangt Parra ein großes Orchester, vor dem noch ein kleines Instrumentalensemble (drei Holzbläser, fünf Streicher) plaziert ist. Weiterhin sind im Saal noch zwei Duo-Formationen und viele Lautsprecher verteilt, aus welchen elektronische Geräusche schallen, die im IRCAM vorproduziert wurden. Das führt immer wieder zu eindrucksvollen akustischen Wirkungen, wobei die Vorstellung des grenzenlosen Universums die Fantasie des Hörers zusätzlich beflügeln dürfte. Über die musikalische Substanz von „Inscape“ wird man aber wohl unterschiedlich befinden.
Das Publikum des mittleren der drei Abo-Konzerte reagierte begeistert, wobei die Gründe für solchen Enthusiasmus freilich kritisch zu hinterfragen wären. Vieles in der oft sehr lärmigen Musik wirkt etwas selbstzweckhaft. Und wenn von der Harfe und dem mit einem Violinbogen gestrichenen hängenden Becken so gar nichts zu hören ist, bekommt auch die Instrumentationsmasse etwas Fragwürdiges. Die Gürzenich-Musiker engagierten sich mächtig, vehement angetrieben von Francois-Xavier Roth, welcher die Klangstrukturen von „Inscape“ klar vermittelte und für optimalen rhythmischen Zusammenhalt sorgte. Die Repertoirefähigkeit des Werkes bleibt abzuwarten.
Doch zugegeben: dies war einst auch die Frage bei den Schumann-Kompositionen. Beide setzten sich nicht auf Anhieb durch, die Premiere des Cellokonzertes fand sogar erst posthum in der Provinz (Oldenburg) statt. Die Sinfonie wiederum faßte erst nach einer Revision Fuß im Konzertsaal. Roth wählte die Erstfassung von 1841, für die sich auch ein Kurt Masur oder Nikolaus Harnoncourt stark gemacht haben. Die Änderungen sind teilweise auf Anhieb erkennbar. Daß sie wirklich einen „spontaneren, ungeglätteten“ Ausdruck bewirken, möchte man beim ersten Hören nicht unbedingt bestätigen. Immerhin regt Roths Wahl zur Auseinandersetzung an.
An seiner stringenten, pulsierenden Interpretation gab es jedoch keinen Zweifel. Die drängenden Tempi verwischten aber nicht die artikulatorische Klarheit. Interessant und wirkungsvoll die überraschenden Ritardandi im Scherzo. Zu Beginn des Introduktionssatzes gingen kurz die Fagotte in melodische Führung. So wurde man noch einmal auf Klaus Lohrer aufmerksam, der nach 42 Jahren im Gürzenich-Orchester in Pension geht. Aber die Musik wird weiterhin sein Leben bestimmen.
Die Begleitung des Cellokonzertes wirkte nicht immer ganz ausgewogen. Teilweise mochte das damit zusammenhängen, daß der Norweger Truls Mork generell nicht so phonstark agiert wie früher ein Mstislaw Rostropowitsch, auch wenn es ihm an Tonkraft und Elan nicht fehlt. Sein eher verinnerlichtes Spiel wirkte im langsamen Mittelsatz somit besonders überzeugend, und Roth ging mit dem Orchester über weiteste Strecken auf Morks Sensibilität rücksichtsvoll ein.
Foto (c) Philharmonie Köln
Christoph Zimmermann 18.12.2018
Viva Vivaldi! – Viva Cecilia Bartoli!
Kölner Philharmonie 05.12.2018
Die sympathische römische Mezzosopranistin hatte in der Kölner Philharmonie gleichsam ein Heimspiel, als sie ihr neues Album „Viva Vivaldi“ vor ihrer Fangemeinde präsentierte. Das Kölner Publikum lag ihr von Anfang an förmlich zu Füßen. In Sachen Vivaldi hat sich Cecilia Bartoli inzwischen als Expertin und Wiederbelebungskünstlerin einen besonderen Namen gemacht. Auch in ihrem neuen Programm lässt sie aus Vivaldis über fünfzig facetten-reichen Opern bekannte und gänzlich unbekannte Arien erklingen, die eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass der lange Zeit vergessene Venezianer eben nicht nur als Komponist unsterblicher Instrumentalmusik, sondern auch als Opernkomponist in seiner Heimatstadt Venedig in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Furore machte.
Die Perlenreihe elegischer, aber auch virtuos-dramatischer Arien, die Vivaldi z.T. in die Kehle bekannter Kastraten seiner Zeit gelegt hatte, verflochten Cecilia Bartoli und Gianluca Capuano, Dirigent und Cembalist an diesem Abend, mit Sätzen aus Vivaldis berühmtestem Instrumentalwerk, den Vier Jahreszeiten, wobei Capuano noch durch improvisierte Über-leitungen jedes störende Klatschen oder auch Husten im weiten Rund der Philharmonie erfolgreich unterband. So entstand ein spannungsvolles Gegen- und Miteinander orchestraler und gesanglicher Preziosen, die in Tonart, Stimmung und Klangfarbe wunderbar aufeinander bezogen und abgestimmt waren. In der Arie des Farnace Gelido in ogni vena aus der Oper Farnace RV 711 (1727) wird diese Symbiose von Vivaldi sogar selbst vorgegeben, wenn er am Anfang sein berühmtes Winter-Konzert zitiert.
Thema aller Arien, wie könnte es anders sein, ist die Liebe in all ihren Facetten. Es geht in barocker Bildlichkeit um Liebesseligkeit und Liebessehnsucht, um enttäuschte Liebe und Rache, um Liebesschmerz und Liebeskummer, wobei die Sätze aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und die Naturschilderungen in den Texten eine Seelenlandschaft imaginieren, welche die Gefühle des lyrischen Ichs abbilden und spiegeln. Durch die starken Gefühls-kontraste in Musik und Text kommt keine Langeweile auf, auch deshalb nicht, weil Block-flöte, Traversflöte, Oboe oder – wie in den Zugaben – Trompete in einen virtuosen Wettstreit mit der Singstimme eintreten.
Cecilia Bartoli singt die Vivaldi-Arien mit einer Agilität in den Koloraturen, vor allem aber mit der Klangschönheit ihres nicht sehr großen, dafür aber herrlich timbrierten und weichen Mezzosoprans, dass es einem beim Zuhören den Atem verschlägt. Sie braucht nicht - wie einige ihrer großen Kolleginnen- eine Schar von Tänzern, die sich um sie herumwinden, sie braucht keine aufwendigen Videoeinspielungen, um ihrem Gesang Ausdruck und Bedeutung zu vermitteln. Die Natürlichkeit, die unprätentiöse, uneitle Gesangskunst einer Bartoli spricht für sich. Das ist große Gesangskunst ganz im Dienst der Musik.
Begleitet wurde sie durch das Barockensemble Les Musiciens du Prince, das im Frühjahr 2016 im Fürstentum Monaco auf eine Initiative Cecilia Bartolis gegründet wurde und sich in kurzer Zeit zu einem wunderbaren Klangkörper für alte Musik entwickelt hat. Gianluca Capuano ist in Köln als Spezialist für Barockmusik bestens bekannt, da er in der Kölner Oper erst unlängst Cimarosas Il matrimono segreto und Gassmanns Gli ucellatori zu großen Publikumserfolgen verhalf. Er spielte gleichzeitig den Part am Cembalo mit federnder Leichtigkeit. Sein Esprit und seine Spiellaune übertrugen sich auf alle Orchestermitglieder. So kontrastreich, so präzise, so durchsichtig und spannend hat man die Vier Jahreszeiten lange nicht mehr gehört. Andrés Gabetta versah den Solopart in Vivaldis Le quattro stagioni und entlockte seinem herrlichen Instrument, einer venezianischen Geige von Petrus Guanerius aus dem Jahr 1727, mirakulöse Töne. Da stimmte wirklich alles zusammen.
Das Publikum belohnte alle Künstler mit Ovationen und wollte Cecilia Bartoli einfach nicht gehen lassen. Die charmante Römerin dankte mit vier Zugaben, darunter der Arie des Cherubino Voi che sapete aus Mozarts Le nozze di Figaro und einem neapolitanischen Lied ihrer Heimat. Als sie dann sogar in einem auch schauspielerisch fulminanten Wettstreit mit dem Trompetenvirtuosen Thibaud Robin Sumertime aus Gershwins Oper Porgy and Bess anstimmte, kannte der Jubel in der Kölner Philharmonie keine Grenzen mehr. Manch Purist mag in diesem Zugabenpotpourri einen Stilbruch gesehen haben. Sei’s drum! Wer mit einer solchen Freude, mit einer solchen Herzlichkeit und fern aller divenhaften Künstlichkeit Musik lebt und verkörpert wie Cecilia Bartoli, dem gestattet man gerne den zeitlichen und stilistischen musikalischen Spagat!
Fazit: ein beglückender Abend in der Kölner Philharmonie, den auch der Rezensent lange nicht vergessen wird.
Norbert Pabelick 06.12.208
Selina Ott, Anna Vinnitskaya
WDR Sinfonieorchester: Andris Poga
21. Februar 2016
Gänsehaut bei Zarathustra
Von den Ländern, deren Künstler international verstärkt Fuß fassen, gehören die baltischen Staaten. Andris Nelson etwa hat in Leipzig und Boston fest Fuß gefaßt und die Järvis (Vater und zwei Söhne) sind fast allüberall aktiv.

(c) J.-P. Raybaud
Noch im Aufwind befindet sich Andris Poga, derzeit Musikdirektor des Nationalorchesters in Riga. Beim WR war er schon einmal im vergangenen Juni zu Gast.
Bei der erst zwanzigjährigen Selina Ott (Bild unten) gilt „Aufschwung“ noch stärker. Die Trompeterin scheint an eine Alison Balsom oder Tine Thing Helseth anzuschließen. Und man muß ja nur einmal die Besetzung heutiger Orchester in Augenschein nehmen um festzustellen, daß die geschlechtsspezifische Zuordnung von Instrumenten längst keine Gültigkeit mehr hat.

Foto (c) Daniel Delang
Für ihr WDR-Engagement (Debüt) empfahl die junge Österreicherin wohl nicht zuletzt der diesjährige ARD-Wettbewerb, bei welchem sie den ersten Preis davontrug. Das in er Philharmonie vorgetragene Concertino von André Jolivet gehört nicht eben zu den Zugpferden der Trompetenliteratur und ist doch ein musikalisch zeitnahes, dankbares, ein wenig freches und spieltechnisch herausforderndes Opus. Musikalisch zeitnah (1948) gönnt es sich aber doch ein paar melodisch retrospektive Floskeln. Die Streicherbesetzung mit partiell führendem Klavier entsprang den individuellen Klangvorstellungen des Komponisten.
Das Concertino fordert der Trompete alles ab, was ihr an virtuoser Blastechnik zur Verfügung steht, und Selina Ott ließ sich wahrlich nicht lumpen. Bei gelegentlich etwas massiver Lautstärke begleitete das WDR Sinfonieorchester gelenkig und anpassungsfähig.
Um noch etliche Grade virtuoser ist Sergej Rachmaninows drittes Klavierkonzert, von welchem gerne gesagt wird, in ihm gäbe es „die meisten Noten pro Sekunde“. Trotz eines liedartigen Beginns setzt sich Tastenraserei in der Tat bald durch, wobei kompositorisch ausdrucksvolle Detailmomente dem Werk aber nicht versagt werden.

Foto (c) Marco Borggreve
Anna Vinnitskaya bewies Fingerfertigkeit in reichem, ja überreichem Maße. Daß eine Frau am Flügel saß, würde man auch geschlossenen Auges vermutet haben. Die Pianistin nämlich enthielt bewahrte ihrem Spiel bei allem Tastendonner eine gewisse Klangweichheit, welche ihrer Interpretation vielleicht nur letzte Brillanz kostete. Gleichwohl zu Recht Riesenbeifall, für welchen sich Anna Vinnitskaya mit dem „März“ aus Tschaikowskys „Jahreszeiten“ bedankte.
Andris Poga, welcher mit dem hellwachen Orchester der Pianistin aufmerksam zugearbeitet hatte, war dann bei „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauß ganz in seinem Element. Diese hochlodernde Tondichtung ist ein Werk der Sonderklasse, auch wenn man über die Nähe zum Intellekt Friedrich Nietzsches rechten mag. Die Schlußtakte mit ihrem Gegensatz von hohem Bläser-H-Dur und tiefen C-Pizzicato der Kontrabässe sind alleine ein genialer Einfall. Die üppigen, schwellenden Orchesterfarben brachten Dirigent und Orchester hinreißend zur Geltung, wobei gegen Ende nur die Spielexaktheit etwas nachließ.
Christoph Zimmermann (2.12.2018)
Generationen
21. / 22. November 2018
(Das Konzert fand im Staatenhaus statt)
Akiko Edith Mathis und Rafael Fingerlos, Stephanie Lesch und Aiona Padrón
Wie ist es, einer Legende zu begegnen? Edith Mathis (80) ist zweifellos eine solche, für die Kölner sogar in besonderer Weise. Mit 21 Jahren kam die geborene Luzernerin 1959 als lyrischer Sopran an die hiesige Oper. Nach vier Jahren verabschiedete sie sich, arbeitete forthin frei und machte Weltkarriere. Nach Ende ihrer aktiven Laufbahn betätigte sich Edith Mathis pädagogisch. Nun war sie im Staatenhaus nochmals auf dem Podium zu erleben, wie einige Zeit zuvor schon in ihrer Geburtsstadt und beim Schleswig Holstein Festival. Natürlich nicht als Sängerin, sondern als Rezitatorin. Das Singen überließ sie dem jungen österreichischen Bariton Rafael Fingerlos.
Der Abend gehörte Robert Schumann und Heinrich Heine. Neben diversen Einzelliedern war die „Dichterliebe“ zu hören, freilich nicht als chronologischer Zyklus, sondern durchmischt mit den anderen Gesängen. Und Edith Mathis zäsierte das Programm zusätzlich mit Texten aus Heines „Lyrischem Intermezzo“. Die Ironie des Dichters blieb für diesmal marginal, zu hören waren vor allem Herz-Schmerz-Gedichte, poetisch angereichert mit allerlei Naturstimmungen. Über manche biedermeierliche Wortbildungen („Wängelein“ und Ähnliches) war mitunter zu schmunzeln. Die Sängerin a.D. gab die gesprochenen Gedichte engagiert und rhetorisch reizend zum Besten, wobei die Aussprache mitunter ihre schweizerische Herkunft erkennen ließ. Rafael Fingerlos schien sich mit den von ihm vorgetragenen Lieder wirklich zu identifizieren, gab ihren hier übermächtigen, dort zurückgenommenen Gefühlen mit seinem kraftvollen Organ beredten Ausdruck. Pianopassagen kamen voll zu ihrem Recht, wobei das dynamische Changieren nur etwas subtiler hätte ausfallen dürfen. Höchstes Lob für die vorbildliche Textverständlichkeit, welche ohne „Konsonantenspuckerei“ auskam. Am Flügel accompagnierte Sascha El Mouissi anpassungswillig und mit feinen Anschlagsvaleurs.
Den Schluß bildete übrigens ein Lied von Schumann-Gattin Clara, welches ihr Mann (als opus 13,1) gleichfalls vertont hat: „Ich stand in dunklen Träumen.“ Claras Version ist auch auf der CD von Rafael Fingerlos „Stille und Nacht“ enthalten. Hier finden sich zudem Kompositionen von Robert Fürstenthal, welchem ein weiteres Recital („Lieder und Balladen vom Leben und Vergehen“) sogar alleine gewidmet ist. Man darf also davon ausgehen, daß sich Rafael Fingerlos weiterhin um rares Liedgut bemühen wird. Auf der Opernbühne steht er allerdings in Bälde mit bekannten Partien, nämlich dem Harlekin in „Ariadne auf Naxos“ von Strauss (Dresden) sowie dem Mozartschen Papageno an der Wiener Staatsoper, wo er mittlerweile fest engagiert ist.
Beim Auftaktkonzert von „Im Zentrum Lied“ (Oktober) wurde die „schöne, ausdrucksvolle Baritonstimme“ von Michael Daub hervorgehoben. Jetzt, beim zweiten Abend dieser Reihe, macht es leichte Schwierigkeiten, dieses Lob in angemessener Weise zu steigern.

Die Mezzosopranistin Stephanie Lesch verfügt nämlich über ein aufregend verführerisches Timbre: voll und rund, orgelnd in der Tiefe, explosiv leuchtend in der Höhe, alles wie auf Samtschaum gebettet. Gleich der erste Ton „traf“ und gab über ihre künstlerische Persönlichkeit verläßlich Auskunft. Schon jetzt denkt man bei Stephanie Lesch (33) an Wagner, doch soll das beileibe keine vorschnelle Empfehlung sein. Aber auf Youtube gibt es einen Mitschnitt von Gustav Mahlers Auferstehungs-Sinfonie (2014), leider ohne Angabe von Orchester und Dirigent. Doch man lauscht da ja vor allem der opulenten Stimme von Stephanie Lesch, welche mit ihrer Kantabilität die erhabenen Worte von „Urlicht“ auf eine fast schon jenseitige Stufe hebt.
Ingrid Schmithüsen, Leiterin von IZL selbst noch von ihrem fernen Wohnsitz aus, hat im vergangenen Jahr die Mezzosopranistin und ihre ständige Klavierbegleiterin, die Spanierin Ainoa Padrón, beim Internationalen Wettbewerb Lied & Lyrik Rhein-Ruhr in Ratingen kennengelernt und das Duo spontan gebeten, ein Programm für IZL zusammenzustellen. Antonin Dvorak und Arnold Mendelssohn, die damals favorisierten Komponisten, wurden in Köln um Lieder von Mieczyslaw Karlowicz ergänzt. So entstand der Konzerttitel „Schlesisch – polnisch – slawisch“, über den der Moderator des Abends, Andreas Durban, in lebendiger Weise Musikhistorisches verlauten ließ.
Daß ihre üppige Stimme zu opernhafter Expansion drängt, weiß Stephanie Lesch fraglos, gönnte sich ja auch hin und wieder vokale Gipfelstürmerei. Darüber kamen aber Pianowirkungen nicht zu kurz, was sich gleich in Antonin Dvoraks vier Liedern opus 82 zeigte. Der finale Gesang „Am Bache“ ließ dann die Pianistin etwas in den Vordergrund treten; die malerische Begleitung erinnerte sehr an Schuberts „Gretchen am Spinnrad“. Für die „Zigeunermelodien“ opus 55 (originalsprachlich gesungen) besaß Stephanie Leschs Mezzo angemessene Vitalität. Wild Magyarisches fehlte der Widergabe freilich ein wenig. Einiges kompensierte Aiona Padrón mit ihrer ungestümen Virtuosität, so bei „Reingestimmt die Saiten“. Interessant ihre agogischen Akzente.
Neben Dvorak bot das Damenduo ausgesprochene Raritäten. Der bereits erwähnte Arnold Mendelssohn mag vielleicht kein gänzlich Unbekannter sein, schon wegen des Namens (zu einem anderen Familienbereich gehörte u.a. Felix M.) – aber wer weiß etwas über den Komponisten? Der Zyklus „Lieder einer Frau“ läßt gelegentlich progressive Tonsprachlichkeit erkennen, aber eine Verwurzelung in der Romantik bleibt stets evident.
Ein veritabler Anonymus der Musikgeschichte ist Mieczyslaw Karlowicz. Der gebürtige Pole verbrachte einen Teil seiner Jugend in Deutschland und knüpfte Kontakte zu Georges Bizet und Johannes Brahms. Als engagierter Bergsteiger kam er mit nur 33 Jahren bei einem Lawinenunglück ums Leben. Seine Lieder (es gibt sie erstaunlicherweise komplett auf CD), sinfonische Dichtungen, ein Violinkonzert, eine Serenade, die litauische Rhapsodie sowie die Sinfonie „Rebirth“ halten immerhin diskografisch die Erinnerung an Karlowicz wach. Die Liedauswahl von Stephanie Lesch und Aiona Padrón machte mit reizvoller Musik bekannt – und neuer Respekt bezüglich der Originalsprachlichkeit
Bilder (c) Philharmonie Köln
Christoph Zimmermann (23.11.2018)
Schönes Schumann-Gelingen
16. November 20128
Aurélien Pascal, Kölner Kammerorchester: Christoph Poppen
Christoph Poppen, Principal Conductor des Kölner Kammerorchesters (KKO), vermochte im Lauf seiner Karriere schon viele künstlerische Kontakte zu knüpfen, als Dirigent ebenso wie als Geiger (ehemals Primarius des Cherubini-Quartetts). Viele junge, inzwischen längst etablierte Musiker sind bei ihm in die Schule gegangen wie Veronika Eberle, die am zweiten Weihnachtsfeiertag mit prominenten Kollegen in der Philharmonie auftritt.

Das jetzige Engagement von Aurélien Pascal ist fraglos ebenfalls Poppens starker Vernetzung in der internationalen Musikszene zuzuschreiben.
Der französische Cellist ist erst 24 Jahre alt, hat noch bei dem 2013 verstorbenen Janos Starker studiert. In Köln stellte er sich mit dem Schumann-Konzert vor, einem Werk, welches großzügig noch innerhalb der „klassischen“ Repertoiregrenzen angesiedelt werden kann, welche das KKO bis dato weitgehend einhält. Der romantische Gestus ist jedoch eindeutig, und in diese Richtung tendieren Orchester und Dirigent auch langfristig. Schumanns Konzert gehört zu den beliebtesten seines Genres, hatte anfänglich allerdings Akzeptanz-Schwierigkeiten, was allerdings auch anderen heute berühmten Werken nicht erspart blieb (etwa dem Brahms- Violinkonzert). Gattin Clara war von dem Werk auf Anhieb überzeugt, attestiert ihm „Wohlklang und tiefe Empfindung“.
Interpretatorisch ist es enorm anspruchsvoll. Der gesamte Tonbereich des Instruments wird ausgiebig gefordert, besonders die hohen Lagen, was den Solisten zu häufigem Daumenaufsatz nötigt. Hier erwies sich Aurélien Pascal als wahrer Meister. Keine verrutschten Töne, der Klang zudem stets vollmundig. Allerdings scheint der Cellist tendenziell ein Kammermusiker zu sein. Ohne energischen Fortestellen etwas schuldig zu bleiben, ging er das Schumann-Konzert primär mit Piano-Noblesse an. Gerade der Anfang, in welchen andere Cellisten gerne vibrato-intensiv einzusteigen pflegen, nahm Aurélien Pascal mit vornehmer Dezenz. Das Orchester reagierte mit Delikatesse; die Holzbläser erfreuten mit pikanten Akkordtupfern. Solist und Dirigent waren in ständigem Blickkontakt, was auch heikle agogische und dynamische Stellen des Konzertes bewältigen half.
Bei Joseph Haydns Sinfonie Hob. I:59 wirkt der Untertitel „Feuer-Sinfonie“ etwas herbei geredet. Zusatznamen sind ja generell oft nur Schall und Rauch; sie wurden teilweise von den Verlegern hinzugefügt oder kokett auf irgendwelche Vorgänge bezogen. Immerhin: eine Feuersbrunst in der Nähe von Eisenstadt hat es gegeben; sie beschädigte auch Haydns Wohnung. Die Niederschrift der Sinfonie erfolgte bald danach. Dennoch sollte man den mehrfachen Schnell-Langsam-Kontrast im Kopfsatz nicht überinterpretieren. Gestalterische Extravaganzen gehören generell zum Stil des Komponisten. So endet die stürmische Introduktion auch in einem überraschenden Piano. Das Andante wird über weite Strecken von einer etwas drögen Zweistimmigkeit geprägt, im Finale dominieren instrumentatorisch kokett Oboen und Hörner. Echte Ohrwürmer gibt es in der Sinfonie nicht, aber Christoph Poppen gab der Musik animierenden Schwung.
Die Holzbläser sorgten auch bei Ludwig van Beethovens sechster Sinfonie für viel Flair. Besonderes Lob sei Sebastian Payault (Oboe) und Martin Kevenhöster (Fagott) ausgesprochen. Christoph Poppen ging die „Pastorale“ entspannt und atmosphärisch an, versagte sich am Ende (mit den hinzutretenden Posaunen) aber nicht den hier angemessenen Grandioso-Wirkungen.
Bilder (c) Philharmonie / Bé Curveiller
Christoph Zimmermann (17.11.2018)
Russische Vielseitigkeit
12. November 2018
Xavier de Maistre, Gürzenich-Orchester: Dmitrij Kitajenko
Wenn Dmitrij Kitajenko das Gürzenich-Orchester leitet, steht in der Regel russische Musik zu erwarten. Die vor kurzem auf CD veröffentlichte zweite Sinfonie von Jean Sibelius ist da bereits als Ausnahme zu betrachten. Die programmatische Konzentration hat natürlich ihre Reize, doch würde man das künstlerische Bild des Dirigenten hin und wieder gerne durch Mozart, Beethoven u.a. vervollständigt sehen.
Ein Vorteil der bislang gepflegten Werkauswahl liegt natürlich auf der Hand, nämlich eine spezielle Repertoireerweiterung, welche den Erlebnishorizont der Kölner Konzertbesucher erweitert, auch wenn nicht immer gleich exotische Werkentscheidungen zu erwarten stehen. Gesamteinspielungen der Sinfonien von Rachmaninow, Prokofjew, Schostakowitsch und Tschaikowsky sind beispielsweise auch von anderen Orchestern und Dirigenten zu haben. Die jetzt offerierte Streicher-Serenade des letztgenannten Komponisten ist sogar ausgesprochenes musikalisches Allgemeingut, auch wenn beim Gürzenich-Orchester die letzte Aufführung schon zwanzig Jahre zurück liegt. Alexander Skrjabins „Le Poème de l’extase“ war allerdings vor einem Jahrzehnt zu hören gewesen. Noch nie gespielt wurde hingegen Reinhold Glières Harfenkonzert.

Für diese Werkwahl ausgesprochen hat sich zweifellos auch Xavier de Maistre, der smarte Franzose, welcher der Harfe eine neue, vitale Bedeutung im aktuellen Konzertleben verschaffen hat. Bei den von ihm eingespielten Konzerten für dieses Instrument tauchen z.T. unbekannte Komponistennamen auf (Krumpholz, Hartmann, Zabel), und zahllos sind die bearbeiteten Solopiècen (bekanntestes Beispiel: Smetanas „Moldau“). In Köln lernte man (als Zugabe) Gioacchino Rossinis „Karneval in Venedig“ kennen, ein zuckersüßes Virtuosenstück.
Glière ist ein reichlich aus der Zeit gefallener Komponist. Wie Tschaikowsky gehört er zu den „Westlern“, während das „mächtige Häuflein“ eine dezidiert nationale Tonsprache pflegte. Aber auf dieses Idiom schwor sich bei Bedarf auch Glière immer wieder ein, und seine populäre Tonsprache war dem sowjetischen Regime per se sympathisch. Kein Wunder, daß der Komponist immer wieder um patriotische Werke ersucht wurde, so beim Ballett „Der rote Mohn“.
Das vor achtzig Jahren uraufgeführte Harfenkonzert wurzelt tonsprachlich im 19. Jahrhundert, gibt sich harmonisch friedfertig und strahlt Optimismus aus. Der retrospektive Gestus wurde Glière verschiedentlich auch angekreidet, doch darf man in ihm neben der beiläufigen Anpassung an nationale Ideologien auch eine ganz persönliche musikalische Überzeugung erkennen. Selbst im Westen war durchaus nicht jeder Komponist gewillt, der von Arnold Schönbergs Zwölfton-Technik ausgehenden Radikalisierung der Musiksprache nachzukommen, was selbst heute teilweise noch gilt. Wie auch immer: Glières Harfenkonzert ist ein affektgeladenes Wohlfühl-Stück, fantasievoll gearbeitet und die klanglichen Möglichkeiten des Soloinstrumentes geschickt nutzend. Dem Finale eignet Rausschmeißer-Qualität.
Xavier de Maistre griff gewissermaßen mit vollen Händen in seine golden glänzende Harfe, zumal bei rauschhaften Glissandi. Faszinierend zu sehen war, wie der Künstler mit einer fast spinnenhaften Gelenkigkeit seine Finger über das Saitentableau bewegte. Auffallend die Disziplinierung von Hallwirkungen, bei der Harfe oft ein Problem. De Maistres Interpretation geschah in ständigem Blickkontakt zu Dmitrij Kitajenko, „mit dem ich so gerne musiziere“, wie der Harfenist vor kurzem in einem Musikmagazin verlauten ließ. Und das „wunderbare“ Gürzenich-Orchester machte seiner Einschätzung alle Ehre. Irgendwann soll ein CD-Mitschnitt veröffentlicht werden; bis dato gibt es ja keine Glière-Aufnahme von de Maistre.
Dmitrij Kitajenko ist kein Mann großer Gesten. Bei Tschaikowskys Serenade, welche mit ihrem klassizistischen Schwung durchaus zu körperlicher Bewegtheit am Pult hätte animieren können, fiel das ruhige, umsichtige Dirigat besonders auf. Allerdings wurden wichtige Einsätze mit der Rechten knapp, aber unmißverständlich gegeben. Kitajenkos Lesart selber war keine ausgesprochen tänzerisch belebte. Der breite, sämige Beginn ließ fast an Pathétique-Schmerzlichkeit denken, der Elegie eignete etwas religiös Inbrünstiges. Selbst das durchaus tempoforsch genommene Finale besaß eine gewisse Erdenschwere.
Zum Abschluß Skrjabins „Poème de l’extase“. Obwohl der Titel nicht direkt sexuell gemeint ist, gehört körperliche Erregung zu den Ausdrucksintentionen des relativ jung verstorbenen Komponisten. Am wichtigsten war Skrjabin freilich des Menschen Erhebung zu geistigen, spirituellen Höhen. Seine Musik bestätigt das mit einem Blütenmeerteppich an fragilen, erotisch grundierten Klängen, in welchem Instrumentalsoli immer wieder besondere Farbtupfer setzen. Man wird als Zuhörer von dieser sphärischen, gelegentlich auch fortepathetischen Musik förmlich aufgesogen. Das riesig besetzte Orchester (plus Orgel) brauste zuletzt wie ein Donnerhall.
In die Klangmassen mischte sich ein Chor (zu Gast vom WDR), welcher mit seinen Vokalisen für sage und schreibe lediglich 21 Takte zum Einsatz kam. Der Aufwand ist groß, die Wirkung freilich immens. Initiiert hat diese Fassung Yuri Ahronovitch, von 1975-1986 Gürzenich-Chef. Er beruft sich auf eine im Programmheft nicht näher erläuterte „Urfassung“. Oft wird man diese Version sicher kaum zu hören bekommen. Das glückliche Kölner Publikum dankte lautstark für die Aufführung, deren Widergabe keinen Wunsch offen ließ.
Foto (c) Philharmonie / Hohenberg
Christoph Zimmermann (13.11.2018)
Johann Adolf Hasse
Marc‘ Antonio e Cleopatra
Vorstellung am 8.11.2018 in der Kölner Philharmonie
Verwirrspiel in der Kölner Philharmonie
Die nicht in Barockopern versierten Besucher in der leider nur halb besetzten Kölner Philharmonie rieben sich verwundert die Augen. Da trat ein Countertenor als Cleopatra und eine Mezzosopranistin als Marc‘ Antonio auf. Hasses Serenata in zwei Teilen, vom Charakter her bereits eine kleine Kammeroper, nimmt sich, wie dies im Barock beliebt ist, eines historischen Sujets an, nämlich der großen Auseinandersetzung zwischen den Triumvirn Marcus Antonius und Octavian. Die ägyptische Königin Kleopatra steht in der entscheidenden Seeschlacht bei Actium auf der Seite ihres Geliebten Marcus Antonius. Die Niederlage bedeutet für Kleopatra und Antonius, dass sie nur durch den Freitod dem Schicksal entgehen können, als gedemütigte Siegestrophäe Octavians bei dessen Triumphzug in Rom vorgeführt zu werden.
In Hasses Jugendwerk von 1725, das ihm den Start in eine große Karriere als Opernkomponist bescheren sollte, geht es nicht um die dramatischen Kriegsereignisse, sondern der Librettist Francesco Ricciardi stellt die Gefühle der Liebenden angesichts des bevorstehenden Todes in elegischen Texten dar, für die Hasse in Rezitativen in Form des Accompagnato (vom Orchester begleitet) und in den acht Arien und zwei Duetten die kongeniale musikalische Umsetzung schuf. Kontrast- und farbenreich spiegeln die einzelnen Arien die Gefühle der Todgeweihten wider: menuettartiges Liebesschwärmen wechselt mit elegischer Todessehnsucht, auf Verzweiflung folgt banges Hoffen, auf die Klage über den frühen Tod die Gewissheit des Glück im Jenseits.
Das Ende der Serenata wartet dann mit einem besonderen Coup auf. In Vorausdeutung auf die Gegenwart des Komponisten und den Uraufführungsort von Hasses Kammeroper, nämlich das Königreich Neapel, setzt Marcus Antonius zu einem Herrscherlob der Extraklasse an. Einst würden Kaiser Karl VI. (1771 – 1740) und seine Gemahlin Elisabeth Christine die legitimen Nachfolger Octavians und Livias sein. Der Schmerz über den Tod der Liebenden wird dadurch vom Librettisten und Komponisten geschickt umgangen und in ein Lob auf die gegenwärtig das Königreich beherrschenden Habsburger gelenkt.
Die aneinandergereihten Dacapo –Arien könnten schon hier und da beim Hörer das Gefühl von Wiederholung und latenter Langeweile auslösen, wären da nicht in der Philharmonie Künstler am Werk, denen die Barockmusik gleichsam im Blute liegt. Valer Sabadus ist in Köln bestens bekannt. In der Oper sang er Hasses Leucippo, in der Philharmonie glänzte er als Orfeo in Glucks gleichnamiger Oper, und auch in Hasses Frühwerk brannte der Countertenor ein Feuerwerk artistischen Barockgesangs ab, wobei die Stimme besonders dann berückend schön klang, wenn sie weich und geschmeidig ins Mezza voce einschwang. Delphine Galou als Marc‘ Antonio steht Sabadus in nichts nach. Als ausgewiesene Barockspezialistin gab sie die komponierten Gefühle mit einer Leidenschaft und Virtuosität wieder, die vergessen machte, dass diese Serenata eher handlungsarm und undramatisch daherkommt. Ottavio Dantone erledigte nicht nur mit Verve den Cembalopart, sondern leitete gleichzeitig mit großem körperlichem und gestischem Einsatz das Orchester der „Accademia Bizantina“, das seinem feurigen Dirigenten mit einem temporeichen, dabei aber federleichten Spiel bereitwillig folgte.
Das Publikum ließ sich von den in Musik gesetzten Gefühlen und Affekten sichtlich mitreißen und feierte alle Künstler mit großem Beifall. Zum Dank erklang noch einmal ein Duett zwischen Kleopatra und Marc‘ Antonio, in dem es so schön heißt: „Ein Herz, das nicht fürchtet, kann man nicht besiegt nennen.“ Ein Motto, das von seiner Aktualität nichts verloren hat.
Norbert Pabelick 11.11.2018
MAHLER 3
am 1. Oktober 2018
Sara Mingardo, Schola Heidelberg, Mädchen und Knaben des Kölner Doms, Gürzenich-Orchester: Francois-Xavier Roth
Gürzenich-Kapellmeister Francois-Xavier Roth läßt es sich angelegen sein, Werke, welche in Köln ihre Uraufführung fanden, in seiner Amtszeit peu à peu auf den Konzertspielplan zu setzen. Jetzt widmete er sich Gustav Mahlers 3. Sinfonie d-Moll. Dieses monumentale Werk hatte seine Premiere 1902 zwar nicht in der Domstadt, sondern im nahen Krefeld, wurde aber – ergänzt durch die dortige Städtische Kapelle – vom hiesigen Gürzenich-Orchester aus der Taufe gehoben. Der Komponist selber stand am Pult.
Die „Dritte“ gehört zu den Chorsinfonien, doch ist die Mitwirkung von Frauen- und Kinderstimmen auf den kurzen 5. Satz beschränkt, während in der „Auferstehungs-Sinfonie“ (Nr. 2) und der „Sinfonie der Tausend“ (Nr. 8) kollektiver Gesang die gesamte Länge der Werke prägt. Der Text stammt aus „Des Knaben Wunderhorn“. Zwar ist „Armer Kinder Bettlerlied“ leicht tragisch grundiert (Geständnis vom Übertreten der zehn Gebote), dennoch werden „himmlische Freuden“ vom gütigen Gott garantiert. Im Finalsatz der 4. Sinfonie wird Ähnliches vom Solosopran verkündet. Dem „Lustig im Tempo und keck im Ausdruck“ der „Dritten“ geht ein „Misterioso“ voran, in welchem eine Altistin die dunkle Mitternacht beschwört (Text aus Friedrich Nietzsches „Zarathustra“).
Daß die Uraufführung der 3. Sinfonie im kleinstädtischen Krefeld stattfand, hatte wohl auch mit organisatorischen Problemen zu tun. Hinzu kam aber fraglos die Tatsache, daß Publikum und Kritik Mahler in Wien, wo er an der Hofoper wirkte, nicht immer wohlgesonnen waren. Der Komponist hatte für solche Abwehr ein gewisses Verständnis. Hinsichtlich seiner „Dritten“ äußerte er sich beispielsweise: „Das Ganze ist leider wieder von dem schon so übel beleumdeten Geiste meines Humors angekränkelt, und (es) finden sich auch oft Gelegenheiten, meiner Neigung zu wüstem Lärm nachzugeben. (Es) zeigt sich da meine ganze wüste und brutale Natur in ihrer nackten Gestalt. Daß es bei mir nicht ohne Trivialitäten abgehen kann, ist zur Genüge bekannt. Diesmal übersteigt es allerdings alle erlaubten Grenzen.“ Wir, die wir die Musik Mahlers heute fast kultisch verehren, lassen uns auf Skurrilitäten und Weitschweifigkeiten aber gerne ein.
Die „Dritte“ besitzt extreme Dimensionen. Der Introduktionssatz beansprucht über eine halbe Stunde (bei Mozart, Schubert u.a. hat das für eine ganze Sinfonie gereicht). Dennoch befremdete es ein wenig, daß Francois-Xavier Roth nach der 1. Abteilung eine Foyerpause gestattete. Die Tatsache, daß Mahler eine solche Unterbrechung am 19. Juni 1902 ebenfalls zuließ, sollte indes nicht als „heimliche Aufforderung“ verstanden sein. Vor über hundert Jahren war die Präsentation eines derart langen Werkes noch ein veritables Wagnis. Das gilt heute nur noch bedingt, zumal wenn man die Gewöhnung an Wagner-Dimensionen bedenkt. Auch das Betreten der Sänger in die mittlere hintere Empore erst kurz vor Einsatz verlief gänzlich störungsfrei
Gustav Mahlers 3. Sinfonie ist so etwas wie die Beschreibung eines Lebenskosmos, verbal romantisiert als „Sommermittagstraum“, wie es der Komponist in einer Werküberschrift formuliert. Werden und Vergehen werden zu Klang; Blumen, Tiere, Engel, der Mensch und – im seinerseits sehr ausgedehnten Finale – die Liebe erzählen vom Sein. Man spürt in der Musik Mahlers Suche nach neuen Ausdrucksbereichen, grundsätzlich aber bleibt sie tonal grundiert, nicht zuletzt in dem religiös inbrünstigen, emotional atemverschlagenden Schlußsatz. Francois-Xavier Roth forderte das Gürzenich-Orchester speziell hier zu einer narkotisierenden Interpretation heraus, behielt jedoch die Klangverläufe unter intellektueller Kontrolle, verlor sich nicht in einem emotionalem Nirwana. Dennoch ließ ihn die Musik körperlich ungemein vibrieren.
Es wäre kleinlich, die wenigen Liveschwächen des Abends (es handelte sich um das mittlere von drei Abo-Konzerten) zu monieren, im Grunde überhaupt zu erwähnen. Sowohl der führende Posaunist des Orchesters (von Roth beim Schlußapplaus demonstrativ umarmt) als auch der namentlich nicht genannte Solist der mirakulösen Posthorn-Soli (wo man verstohlen zum Taschentuch greifen mußte) waren Top-Interpreten. Die Chöre (Schola Heidelberg, Mädchen und Knaben des Kölner Doms): einwandfrei. Die italienische Mezzosopranistin Sara Mingardo sang “O Mensch” konzentriert und wohllautend. Eine Christa Ludwig oder Jessye Norman haben sich noch etwas pastoser und glühender geäußert, aber dieser Gedanke kam einem erst lange nach der Aufführung.
Christoph Zimmermann (3.10.2018)
Musik und Botschaft
8. September 2018
Igor Levit, WDR Sinfonieorchester: Jukka-Pekka Saraste
Igor Levit ist ein Musiker der besonderen Art. Äußerlich wirkt der 31Jährige zwar mitnichten rebellisch, aber er meldet sich engagiert zu Wort, wenn es um politische Belange geht. Spektakulär war beispielsweise im April die Rückgabe des Echo-Preises wegen der Auszeichnung des Rapper-Teams Bang/Kollegah, welches sich mit antisemitischen Äußerungen gebrüstet hatte. Andere Künstler hatten freilich auch protestiert. Folgender Ausspruch von Levit könnte als Lebensmotto gelten: „Wenn ich mich als Künstler höheren Werten verpflichtet fühle, dann kann ich nicht beim Klavier aufhören.“

Das tat er auch jetzt nicht bei seinem Auftritt mit dem von Jukka-Pekka Saraste geleiteten WDR Sinfonieorchester. Die vom Publikum ekstatisch erklatschte Zugabe war nicht etwa eine romantische Ergänzung zum ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms, sondern ein nach Pablo Picassos berühmten Gemälde „Guernica“ betiteltes Klavierstück von Paul Dessau. Bevor er zu spielen anhob, verlas der Pianist einen Text, der (einmal mehr) gegen politische Mißstände und rassistische Verbalentgleisungen zu Felde zog. Die Anspielungen auf Chemnitz waren unverkennbar.
Da dem Rezensenten ein Sitzplatz in der zweiten Reihe zugewiesen wurde, war eine besondere Sichtnähe zum Pianisten gegeben. Ungeachtet grundsätzlicher Ausstrahlung von Ruhe und Sicherheit fielen kleine Anzeichen von Nervosität vor dem Einsatz also auf, die aber vielleicht auch nur Ausdruck von innerer Anspannung waren: Fingerbewegungen, Handversteifung, rhythmisches Beinzucken, Streichen über das Hosenbein. Hin und wieder aber auch ein lächelnder Blick ins Auditorium.
Das über weite Strecken stürmische Brahms-Konzert dürfte Igor Levit besonders liegen: gehämmerte Oktavgänge, rasantes Laufwerk, eine oft auf die Spitze getriebene Dynamik. Kontemplative Passagen kamen aber auch zu ihrem Recht. Hier gab Levit seinem Anschlag Zartheit mit, ohne aber den Ausdruck zu verzärteln. Ob der Dirigent Jukka-Pekka Saraste der Feuergestik des Solisten mit der seinen entsprach, was nicht festzustellen, da er hinter dem geöffneten Flügeldeckel nicht auszumachen war. Aber die interpretatorische Affinität war akustisch zur Genüge erfahrbar, und das WDR-Orchester spielte sozusagen auf der Stuhlkante sitzend.

Nach der Pause ein Werk von zeitlich ähnlicher Ausdehnung (dreiviertel Stunde): Arnold Schönbergs „Pelleas und Melisande“. Diese sinfonische Dichtung entstand 1903, also exakt zehn Jahre nach der Uraufführung des stoffliefernden symbolistischen Dramas von Maurice Maeterlinck. Zunächst war der junge Komponist für den Vorschlag seines Kollegen Richard Strauss offen, aus dem Bühnenwerk eine Oper zu machen (wobei er die Debussy-Vertonung nicht kannte), doch dann schien ihm eine wortlose Version passender. Schönberg plante auch noch andere Tondichtungen, die aber alle nicht zustande kamen. So blieb bei ihm dieses Genre verwaist, will man ihm nicht das Streichsextett „Verklärte Nacht“ oder die monumentalen „Gurre-Lieder“ hinzurechnen.
Bei der Wahl einer riesigen Orchesterbesetzung (u.a. vier Trompeten und fünf Posaunen) verwundert es nicht, daß Schönbergs „Pelleas“ musikalisch nicht in die Fußstapfen von Debussys eher fragiler Opernmusik tritt. Zwar taucht in den Klangfluten das Oboenmotiv für Melisande gebührend deutlich auf, aber Debussys Partitur gibt sich generell dezenter, zarter und geheimnisvoller. Saraste nahm keine wirkliche „Korrektur“ vor, ließ das bestens disponierte Orchester klanglich blühen und glühen. Erstaunlich freilich, zu welcher Pianoqualität der gewaltige Blechbläserapparat im Finale fähig war.
Die Wiener Premiere des Werkes 1905 hatte Befremden und Verständnislosigkeit ausgelöst; ein Kritiker empfahl sogar, den Komponisten in eine Irrenanstalt zu stecken. Dabei hatte Schönberg die Zwölftönigkeit noch nicht einmal zu seinem musikalischen Prinzip erhoben. Inzwischen empfindet man das frühe Werk als Ausläufer der Spätromantik, noch auf Tonalität fußend, wenngleich an deren Grenzen führend. Heutige Ohren haben damit keine Schwierigkeiten mehr. Und wenn man bedenkt, daß der zu Lebzeiten vielgeschmähte Gustav Mahler heute zu den absoluten Kultkomponisten gehört …
Bilder (c) Philharmonie / Felix Broede / Micha Salevic
Christoph Zimmermann (9.9.2018)
Carmen La Cubana
Gelungene Eröffnung des 31. Kölner Sommerfestivals
am 19.7.2018

Auch in diesem Sommer findet in der Kölner Philharmonie wieder das beliebte jährliche Sommerfestival statt. Den Auftakt hierzu machte am vergangenen Donnerstag, das nach ungeprüften eigenen Angaben „erste kubanische Musical“ Carmen La Cubana. Basierend auf Georges Bizets allseits bekannter Oper entwarf Oscar Hammerstein II mit Carmen Jones 1943 ein Werk, welches die Handlung in den Süden der USA verlegte und nahezu ausschließlich mit afroamerikanischen Darstellern besetzt wurde. Auf dieser Grundlage entstand nun eine neue Version der Autoren Norge Espinosa Mendoza und Stephen Clark, die die Geschichte nach Kuba in die Tage der Revolution transferiert. Carmen La Cubana ist somit im Handlungsablauf etwas näher bei Carmen Jones denn bei Carmen, auf die wunderbare Musik von George Bizet muss allerdings niemand verzichten. Doch liebe Opernfreunde, seid offen für Veränderungen, denn der größte Kniff dieser Aufführung ist parallel zur Handlung auch die Musik nach Kuba zu übertragen. So basiert die Orchestrierung des mehrfachen Tony- und Grammy Award-Gewinners Alex Lacamoire auf viele verschiedene Formen der reichen kubanischen Musiktradition. Es fließen u. a. Rumba, Mambo, Cha-Cha-Cha und Salsa in teilweise auch weniger bekannte Bizetthemen ein, doch dabei hat Lacamoire wie er selber versichert „immer an der Linie festgehalten, die Biszet geschaffen hat“. Dies gelingt weitestgehend nicht nur flott und frisch, sondern sehr überzeugend. Fast könnte man denken, das Grundwerk sei von Beginn an für eine 14köpfige Latin-Big-Band geschrieben worden, die an diesem Abend das Ohr bestens verwöhnt.

Der gewählte Regieansatz des international sehr gefragten Opern- und Musicalregisseurs Christopher Renshaw zieht sich logisch durch den ganzen Abend, so dass man regelrecht eintaucht in die kubanische Welt. Aus Zigarettenfabriken werden Zigarrenfabriken und aus dem Torero wird wie bereits 1943 ein Boxer, welcher sein Geld in durchaus als Spelunken zu bezeichnenden Etablissements verdient. Alles wirkt rund und stimmig. Erzählt wird die Geschichte von „La Senora“, die als eine Art Erzählerin immer wieder in verschiedenen Rollen auftaucht und dem ganzen einen zusätzlichen Rahmen verleiht. Allerdings und dies ist leider selbst bei einem geübten Operngänger der einzige kleine Wehmutstropfen des Abends, die Sprechtexte sind teilweise recht lang und so ist hier oft fleißiges Mitlesen der deutschen Übersetzung notwendig. Aufgeführt wird Carmen La Cubana nämlich durchgängig in spanischer Sprache, was der Authentizität wiederrum sehr entgegen kommt. Viel Arbeit hatte im Vorfeld auch Choreograf Roclan Gonzáles Chávez, denn das spielfreudige Ensemble und die zusätzlichen Tänzer kommen des Öfteren in großen Tanz-Szenen stark zur Geltung. Die Bühne von Tom Piper ist schlicht und zweckmäßig mit einigen liebevollen Details, allerdings im Laufe des Abends auch mit keinen größeren Veränderungen. Sehr prachtvoll ausgestaltet dagegen seine vielen Kostümentwürfe. Das abwechslungsreiche Lichtdesign von Fabrice Kebour rundet das positive Gesamtbild des Kreativteams ab.

Auch die Besetzung zeigte sich bei der Premiere durchweg von beindruckender Qualität. Allen voran verkörperte Luna Manzanares Nardo wie bereits bei der Welturaufführung dieses Werkes 2016 am Pariser Theatre du Chatelet die Titelrolle der Carmen mit ihrem südamerikanischen Temperament und mit einer wunderbaren Stimme. Dass sie in ihrem Wunsch nach Freiheit auch über Männerleichen geht, wurde dem Zuschauer gleich zu Beginn der Inszenierung bildlich deutlich gemacht. Diese Männer sind Saeed Mohamed Valdés als José, Leonid Simeón Baró als Sargento Moreno und Joaquin Garcia Mejias als Boxer „El Nino“. Bleibenden Eindruck hinterlässt auch Albita Rodriguez als „La Senora“ mit einem gewaltigen Stimmumfang, hinein in alle Bereiche der Latin-Music. Dagegen eher klassisch angelegt ist die Rolle der Marilù, die von der Opernsängerin Cristiana Rodriguez Pino mit einem klaren Sopran dargeboten wird. Auch die weiteren Rollen sind toll besetzt und man verlässt die Philharmonie nach langem und lautem Schlussapplaus gut gelaunt mit einem „Habanera“ auf den Lippen.

Bis zum 29. Juli 2018 ist Camen La Cubana noch in Köln zu sehen, nach einem kurzen Aufenthalt in London folgen dann ab dem 21. August 2018 Gastspiele in der Oper Leipzig, der Alten Oper Frankfurt, dem Admiralspalast in Berlin, dem Deutschen Theater München und dem Theater 11 in Zürich, bevor die aktuelle Tour zum Jahresende in Shanghai zu Ende gehen wird. Weitere Informationen sowie einen kurzen Videoeinblick in die Show auf der Homepage zur Tour unter http://www.carmen-la-cubana.de/.
Markus Lamers, 20.07.2018
Fotos: © Nilz Böhme
Flötentöne
2016 9.7.2018
Emmanuel Pahud, Gürzenich-Orchester: Francois-Xavier Roth
Bei einem Konzert pflegt man gerne nach Gemeinsamkeiten zwischen den gebotenen Werken, nach inneren Zusammenhängen zu forschen, seien sie thematischer oder stilistischer Natur. Bei den Kölner Gürzenich-Konzerten bietet der regelmäßige Opening-Text des Programmheftes (“Das Konzert auf einen Blick“) oftmals Erhellendes. Bei Felix Mendelssohns „Hebriden“-Ouvertüre und Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie wurde das Prinzip der Programmusik angesprochen. Das uraufgeführte Flötenkonzert „Saccades“ von Philippe Manoury ließ sich unter diesem Stichwort freilich nicht vereinnahmen. Folgende Bemerkungen sind also unverbindliche persönliche Gedankensplitter. Das Flötenkonzert widmet sich in Gänze einem speziellen Instrument. Die „Hebriden“ enden – genialer Einfall des Komponisten – auf einem hohen unbegleiteten Flötenton. Für seine „Schicksals“-Sinfonie, wo dem Instrument im Andante einige periphere, gleichwohl deutlich vernehmbare Passagen gegönnt sind, setzt Beethoven im Finale die von ihm sonst nie verwendete Piccoloflöte ein.
Obwohl das Manoury-Konzert ein gemeinsames Auftragswerk des Gürzenich-Orchesters, des Orquesta Sinfonica do Estado de Sao Paulo, des Orchestre Philharmonique de Radio France und der Tokyo Opera City Cultural Foundation ist, hatte die Uraufführung in der Kölner Philharmonie unter Francois-Xavier Roth eine besondere lokale Bedeutung. Die Aufführung Konzert bildete den Schlußteil der „Kölner Trilogie“, welcher Manourys Orchesterstücke „Ring“ und „In situ“ vorausgingen. Eine Besonderheit bei diesem Werken war die Orchesteraufstellung. „Ring“ (2016) verwirklichte das im Wortsinn. Die Zuhörer schienen von einzelnen Instrumentengruppen regelrecht um“ringt“, die kommunikative Zielsetzung seines Werkes unterstrich der Komponist zudem dadurch, daß er die anfänglichen Publikumsgeräusche sich mit der eigentlichen Musik verzahnen ließ. Ähnliches gilt, freilich nicht ganz so aufwendig, auch für „In situ“ (2016), wo es genauso wichtig ist, wo „die Klänge herkommen wie die Klänge selber“, so der 1952 geborene Komponist. Die Gruppierung beim Flötenkonzert hingegen ist konventionell. Als Besonderheit der Besetzung fiel freilich auf, daß im reich besetzten Schlagzeugarsenal die Pauken fehlen.

Gemeinhin gilt die Flöte als lyrisch edles, fast sogar elysisches Instrument. Das ignoniert Manoury ostentativ. Gleich die ausgedehnten Anfangssoli erfordern ein Spiel mit Flatterzunge, und an hochgetriebenen, gepreßten, schneidenden Tönen herrscht in der Folge kein Mangel. Erstaunlich die weitgehende Dezenz des Orchesters; zunächst schleicht es sich in das Werk mit leisen Streichertremoli regelrecht hinein. Man empfindet sogar Assoziationen zu den klanglichen Nebelschwaden der „Hebriden“-Ouvertüre. Später sorgen helle Stabspiele und Schellen für sanftes Klangschweben. Insgesamt wird das Orchester zurückhaltend eingesetzt, dominiert gerade mal im zweiten der fünf Abschnitte.
Der Flötenpart mit seinen extremen Techniken ist eine tour de force. Das verwirklicht im Grunde nur ein Ausnahmemusiker. Emmanuel Pahud ist ein solcher. Er spielte das ihm gewidmete Werk mit immenser Energie und zirzensischer Virtuosität - ein fast schon dämonischer Interpret ohne Furcht und Tadel. Die zweifellos vorhandenen Anstrengungen ließ er kaum spüren.
Übrigens hat sich Manoury eine kleine Kapriole erlaubt. An einer Stelle nahm Francois-Xavier Roth, selber ausgebildeter Flötist, eine Piccolo in die Hand und duettierte mit dem Solisten. Vor einiger Zeit hatte er sich im Zugabenteil eines Konzertes auch als Chansonnier präsentiert. Womit wird man ihn noch erleben? Der Musik des von ihm hochgeschätzten Manoury war er ein souveräner Anwalt, und die Gürzenich-Musiker konnten sich auf seine exakten gestischen Weisungen uneingeschränkt verlassen. Die lokalen Rezensionen beurteilten das Manoury-Werk übrigens recht unterschiedlich.
Schon ein dezentes Crescendo der Trompeten zu Beginn der „Hebriden“-Ouvertüre hatte angedeutet, daß Roth der bestens vertrauten Musik individuelle Farbtupfer entlocken würde. Das Dur-Thema in den Celli geriet ausgesprochen sämig und volltönend, Übergänge wurden dynamisch sensibel gestaltet. Insgesamt erlebte man eine klanglich reich illustrierende Interpretation. Mendelssohns geniale Musik gibt sie freilich vor.
Foto Fischnaller / Phil Köln
Christoph Zimmermann (11.7.2018)
Russische Raritäten unter Dmitrij Kitajenko
18. Juni 2018
Solisten, Tschechischer Philharmonischer Chor Brno, Gürzenich-Orchester: Dmitrij Kitajenko
Zu den wenigen deutschen Theatern, welche Nikolaj Rimskij-Korsakows „Die Legende von der Stadt Kitsch und der Jungfrau Fevronija“ auf ihren Spielplan setzten, gehören die Kölner Bühnen. 1968 war das; der unvergessene István Kertész dirigierte, der großartige Hans Neugebauer inszenierte, die Fevronija wurde von Helga Dernesch verkörpert. An dieses Ereignis dachte man zurück, als Dmitrij Kitajenko mit dem Gürzenich-Orchester die Suite aus dieser Oper offerierte. Sie stammt nicht vom Komponisten selber, sondern von seinem Schüler Maximilian Steinberg.

Die Oper kombiniert zwei Stoffe. Da ist zum einen die Sage von der Stadt Kitesch (welche ein wenig an das Schicksal vom pommerschen Vineta erinnert) und eine Liebesgeschichte zwischen dem Waldkind Fevronija und dem Fürstensohn Vsevolod. Dieser fällt im Kampf gegen die Tartaren, welche aber die Flucht ergreifen, als auf Fevronijas Bitte hin die Stadt unsichtbar wird. Die Jungfrau wird zuletzt von den Tieren des Waldes ins Paradies geleitet, wo sie ihren Gatten wiederfindet.
Die Sätze „Hochzeitszug“ und „Schlacht am Kerzenec“ bilden die lebhaften Innensätze der Suite, das „Lob der Einsamkeit“ und „Der selige Tod der Jungfrau Fevronija“ bieten rahmend zu Herzen gehende Verklärungsmusik. Rimskij-Korsakow, Meister im musikalischen Illustrieren, öffnet bei „Kitesch“ wahrlich eine Zauberkiste narkotischer Klänge. Dmitrij Kitajenko gab der Musik durchaus Zügigkeit mit, nahm den „Schlußchoral“ aber apotheotisch breit. Nota bene: der WDR verfügt über eine Studioaufnahme der „Kitesch“-Suite mit Jeffrey Tate als Dirigenten.
Die Glockenklänge, welche die Musik Rimskij-Korsakows eher beiläufig durchziehen, sind bei Sergej Rachmaninows „Die Glocken“ dramaturgisch prägend. Der Komponist ließ sich von einem symbolischen Text Konstantin Balmonts inspirieren, welcher auf Dichtungen von Edgar Allan Poe zurückgeht. Die Stimmungen in Rachmaninows musikalischem Poem sind ähnlich kontrastreich wie die von Rimskij-Korsakow. Mit Schlitten- und Hochzeitsglocken hebt das Werk frohgestimmt an. Es folgte als Nummer drei eine Sturmszene (man denkt unwillkürlich auch an Beethovens „Pastorale“). Im Finale läuten Glocken zur ewigen Ruhe. Der chorische Anteil bei diesem Werk ist groß, die Nummer drei gehörte dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brno (Einstudierung: Petr Fiala) allein – eine ungemein eindrucksvolle Darbietung. Auch die leiseren, kontemplativen Passagen meisterten die Sänger aus der CSSR vorzüglich.

In jedem Werkteil (den „Sturm“ ausgenommen) agierte ein anderer Solist. Zunächst präsentierte Dmytro Popov (er wird im kommenden März der „Rusalka“-Prinz an der Kölner Oper sein) seinen kraftgesättigten lyrischen Tenor; die vor allem an der Berliner Staatsoper auftretende Anna Samuli läßt ihre koloraturgeprägten Opernpartien vermutlich langsam hinter sich. Bei Rachmaninow assoziierte man eher ihre u.a. an der Mailänder Scala zu erlebende Donna Anna. Besonders markant wirkten die Soli von
Vladislav Sulimsky im Finalsatz. Dmitrij Kitajenko, welcher zuvor mit relativ ruhiger Hand dirigierte, gab sich bei Rachmaninow ausgesprochen impulsiv und dramatisch stringent.
Das Raritätenprogramm wurde komplettiert mit der Kantate „Johannes Damascenus“ von Sergej Taneev. Er war ein Außenseiter unter den russischen Komponisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts, beendete u.a. sein Leben in seinem Kloster. Daß er mit dem Chorwerk den Theologen und Kirchenvater würdigte, kommt also nicht von ungefähr. Von der literarischen Vorlage, einen Poem von Aleksej K. Tolstoj, übernahm Taneev nur wenige Zeilen. Sie reichten ihm, um den Leidensweg des gottgläubigen Menschen auf „dunklen Pfaden in Angst“ mit der Hoffnung auf „himmlische Gnade“ stimmig zu schildern.
Der viermalige Aufschrei „O Herr“ markiert das Ende des zweiten Teils, das Finale läßt deutlich Taneevs kompositorisches Leitprinzip, die Verbindung von russischer Volksmusik und barocker Kontrapunktik, erkennen. So eindrucksvoll dieses Werk, so eindrucksvoll auch die Wiedergabe. Die Zuhörer schienen von dem ungewöhnlichen, die Aufmerksamkeit stark beanspruchenden Programm sehr angetan.
Bilder (c) Phil Köln
Christoph Zimmermann (19.5.2018)
Yuja Wang, WDR Sinfonieorchester: Jakub Hrusa
15. Juni 2018
Hochlodernd
Die chinesische Pianistin Yuja Wang ist ein echter Hingucker. Ihre Modelfigur pflegt sie durch eine raffinierte, enganliegende Kleidung hervorzuheben. In der Kölner Philharmonie war das ein extrem beinfreies goldfarbenes Glitzerkostüm, dazu Schuhe mit Mount-Everest-Absätzen. Die schwarze Haarpracht ebenso gepflegt wie virtuos verwuschelt. Bei solch einer fragilen Erscheinung dürfte man vorrangig zarte Pianotöne erwarten (die Yuja Wang auch parat hat), aber Sergej Prokofjews 5. Klavierkonzert ist alles andere als zartbesaitet, fordert vielmehr zu einem Wettstreit von Solist(in) und Orchester auf, im gegebenen Falle dem WDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Jakub Hrusa.

Anders als später Dmitrij Schostakowitsch zog Sergej Prokofjew aus der kommunistischen Entwicklung in seinem Heimatland Konsequenzen und ließ sich in Frankreich nieder. Zwar besuchte er die Sowjetunion hin und wieder, aber selbst großzügige und lukrative Offerten der Regierung konnten ihn nicht dazu bewegen, sein neues Domizil aufzugeben, zumal ihm unverhohlen abverlangt wurde, bei künftigen Werken eine populärere Tonsprache zu bieten.
Bei seinem fünften und letzten Klavierkonzert (G-Dur, opus 55) – ein sechstes blieb unvollendet – rückt Prokofjew vom vorherigen romantisch angehauchten Virtuosenstil in diesem Genre ab. Die Musik klingt nunmehr nüchterner und entschlackter, was sich auch in einer gesteigerten Transparenz des Orchesterklangs niederschlägt. Ein pianistisches Schlachtengemälde mit rauschhaften Glissandi und perkussiven Steigerungen ist das Werk gleichwohl.
Yuja Wang spielte ihren Part mit unerschütterlicher manueller Sicherheit, welche freilich ihre ganze Konzentration erforderte. Auf dem podiumsnahen Sitz ließ ich das vom Rezensenten besonders gut beobachten. Dafür wurde ihm durch den aufgeklappten Flügeldeckel der Blick auf den Dirigenten entzogen. Die Füße von Jakub Hrusa waren immerhin sichtbar und ließen in ihrer quirligen Bewegung erkennen, welche Energie auch am Dirigentenpult waltete. Daß bei solch einem interpretatorischen Hochleistungssport die rhythmische Präzision schon mal in leichte Gefahr geriet, sei nur am Rande bemerkt.
Der enthusiastische Beifall für die bei allem Glamour bescheiden wirkende Yuja Wang führte zu gleich zwei Zugaben. Die Liszt-Bearbeitung von Schuberts „Gretchen am Spinnrad“ ist zwar auch für flinke Hände gedacht, bietet aber dennoch Raum für das lyrische Potential des Liedes. Dem wurde die Pianistin gerecht. Daß virtuoses Feuer in ihren Adern aber besonders glüht, bewies zuvor eine „Carmen“-Fantasie, vermutlich die von Vladimir Horowitz.
Für die Wahl von Richard Straussens „Heldenleben“ läßt sich kein besonderes dramaturgisches Motiv erkennen. Vorsichtige Mutmaßung: das WSO hat diese Tondichtung einfach lange nicht mehr gespielt. Jakub Hrusa, seit zwei Jahren Chef der Bamberger Symphoniker, hat schon mehrfach am Pult dieses Klangkörpers gewirkt. Sein bereits bei Prokofjew zu spürender Elan machte auch bei dieser Tondichtung mächtig Wirkung. Diesem Werk kann man sich ja kaum mit einem Pastellpinsel nähern, hier gilt’s der großen musikalischen Geste. Auch wenn der Komponist die Identität seiner Person mit dem „Helden“ etwas herunter spielte: Strauss war zu sehr ein brillianter Egomane (siehe „Feuersnot“, „Intermezzo“, „Sinfonia domestica“ u.a.), als daß er nicht gerne eine Gelegenheit zur Selbstdarstellung ergriffen hätte. Die Eigenzitate in der Musik von „Heldenleben“ sprechen nachdrücklich dafür.
„Intermezzo“ und „Sinfonia domestica“ besitzen immerhin über weite Strecken Humor und Charme. „Ein Heldenleben“ wuchtet hingegen Marmorblöcke und stellt pathetische Denkmäler auf. Die Geigensoli („Des Helden Gefährtin“) sind redselig, die Generalpausen plakativ. Die Sympathie des Rezensenten für „Ein Heldenleben“ ist erkennbar keine besonders große. Der über weite Strecken wirkende melodische Sog und die opulente Instrumentation bleiben natürlich bewundernswert. Raffiniert im Ausdruck auch die Abrechnung mit „Des Helden Widersacher“ (spröde Quinten der Tuben). Zwanzig Jahre sollte die Kritikerschelte im „Krämerspiegel“ eine Fortsetzung erfahren.
Jakub Hrusa ließ die „Heldenleben“-Musik klangprächtig rauschend am Ohr des Publikums vorbeiziehen, und das WSO legte sich großartig ins Zeug. Besonders schöne Soli gab es bei den Holzbläsern, beim Horn und bei den Soli von Tobias Steymans, hauptamtlich Konzertmeister beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das Publikum reagierte eminent beifallsfreudig. Bei allen Vorbehalten ist die überwältigende musikalische Kunstfertigkeit von Richard Strauss in der Tat enthusiastisch zu loben.
Die Aufführung wurde tags drauf im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr in der Essener Philharmonie wiederholt.
(c) yujawang.com
Christoph Zimmermann (17.6.2018)
Bezwingende Programmwahl
9. Juni 2018
Solisten, KölnChor, Rheinischer Kammerchor: Wolfgang Siegenbrink
Für das jüngste Kölner Chorkonzert hatten sich KölnChor, Rheinischer Kammerchor und ihr beider Dirigent Wolfgang Siegenbrink ein ungewöhnliches, attraktives Programm ausgedacht. Das Hauptwerk des Abends, Carl Orffs „Carmina Burana“, reflektiert das Glücksrad des Lebens, wie es auf Illustrationen im Kloster Benediktbeuren dargestellt ist. Für den Vorpausenteil wählte man als Leitmotiv das oberste Segment dieses Rades: „Regno“ – „Ich herrsche“. Diese Worte sind – heute zumal - weltweit unterschiedlich deutbar. Im British Empire mit der dienstältesten Königin aller Zeiten eignet ihnen eine besonders patriotische Note. Das spiegelte die Werkwahl: Hubert Parrys „I was glad“, Thomas Arnes „Rule Britannia“ sowie Edward Elgars „Coronation Ode“.
Eine Zeit lang galt die Behauptung, der Mangel an bedeutenden englischen Komponisten seit Henry Purcell sei erst durch Benjamin Britten aufgehoben worden. Doch auch Arne und Parry sind als eindrucksvolle Namensstationen anzusehen, und über die immense Bedeutung von Elgar herrscht heute längst kein Zweifel mehr. Das Cellokonzert, die Enigma-Variationen oder auch das Oratorium „Der Traum des Gerontius“ sind zu Stützpfeilern des internationalen Repertoires geworden. In die Herzen seiner Landsleute hat er sich aber vor allem (und wohl auch etwas einseitig) mit „Land of hope and glory“ eingeschrieben.
Die Melodie mit ihren Sekundschritten ist nicht eigentlich spektakulär zu nennen, besitzt aber emotionale Stärke, natürlich auch durch die Anbindung an einen hochgestimmten Text. Man muß sich nur die „Last night oft the Proms“ in der Londoner Royal Albert Hall vor Augen führen, um die nachgerade narkotische Wirkung auf die Zuhörer zu erkennen. Ganz England scheint an solch einem Abend auf den Beinen - im Fernsehen erlebt man auch die Publikumsreaktionen im Hyde Park, im Singleton Park Swansea oder auch beim Castle Cole Enniskillen. Da borden Gefühle einfach über. Ein wenig davon war auch in der Kölner Philharmonie zu spüren, als „Pomp and circumstance Nr. 1“ als (rhythmisch leicht verhedderte) Zuhabe erklang, wo „Land of hope and glory“ ja den krönenden Abschluß bildet. Wolfgang Siegenbrink forderte ausdrücklich zum Mitsingen auf.
Elgar war sich der Wirkung seiner musikalischen Eingebung fraglos bewußt, denn in der „Coronation Ode“ wird die Melodie bereits in der dritten Strophe der Introduktionsnummer intoniert, welche den Frieden besingt. Das Publikum reagierte mit verfrühtem Beifall, was den Dirigenten zu einer kurzen, freundlichen Ansprache an das Auditorium bewog, eine bislang noch nie erlebte Maßnahme. Sie zeigte jedoch, daß für das Musikhören auch eine gewisse Etikette zu fordern ist. Aber für die (vermutlich auch stark familiäre) Hochstimmung muß man auch wieder Verständnis aufbringen. Und sie galt sicher auch den kernig intonierenden Chören, welche das Werk, durchgehend souverän unterstützt vom Staatsorchester Rheinische Philharmonie, kompetent zum Besten gaben. Siegenbrink erwies sich als animierender, versiert steuernder Pultmatador.
Die Werke von Parry und Arne gelten kompositorisch nicht unbedingt als bedeutend. Aber diese Einschätzung hat sich im Laufe der Zeit modifiziert, wobei die Phonoindustrie vielfach ihre Hände im Spiel hat. So ist das CD-Repertoire von Parry im Moment ausgesprochen umfangreich. Auswirkungen auf das öffentliche Konzertleben sind damit aber nicht unbedingt verbunden. Arnes Wirken wiederum wurde zu seiner Zeit nicht wenig von der Londoner Präsenz Georg Friedrich Händels beeinträchtigt. Aber „Rule Britannia“ – Schlußgesang seiner Oper „Masque of Alfred“ – ist in den Herzen der Engländer fest verankert. Es handelt sich um ein Chortableau von vier Strophen mit nachfolgenden Refrains. Die Soli nahm Agnes Lipka mit ihrem ausgesprochen klangvollen Sopran wahr.
In Orffs „Carmina Burana“ verbinden sich melodische Einfachheit und orchestrale Raffinesse, wobei der Wiederholungscharakter vieler Nummern von Orff bewußt anvisiert wurde. Die Instrumentation ist schlagkräftig, raffiniert, farbig und suggestiv. Die beiden anderen Teile des Triptychons – „Catulli Carmina“ und „Trionfi di Afrodite“ – können da nicht mithalten. Dennoch sollte man den Dreiteiler durchaus einmal ins Auge fassen. Sicher läßt sich eine noch schlagkräftigere und klangraffiniertere Widergabe der „Carmina“ vorstellen, als sie sie unter Wolfgang Siegenbrink offeriert wurde. Aber alleine die Probenzeit mit dem Gastorchester dürfte eine limitierte gewesen sein. Ungeachtet kleinerer Mängel: Orffs Musik kam zu ihrem Recht und bestach einmal mehr durch ihre unglaubliche Vitalität.
Agnes Lipka erfreute neuerlich ihrem attraktiven Sopran (bei leichten Höhengrenzen im zweiten „Dulcissime“). Nach seinen schönstimmigen Soli bei Elgars „Coronation Ode“ hatte Bernhard Schneider jetzt nur eine kurze Szene. Die Klage des in der Pfanne brutzelnden Schwanes erfordert Falsett-Versiertheit; da fehlte es dem Sänger ein wenig an entsprechender Kondition. Dem tenoral gefärbten Bariton von Christoph Scheeben wäre mitunter etwas mehr Volumen zu wünschen gewesen, doch in toto bot er eine überzeugende Leistung. Lediglich bei Elgar war die Altistin Rena Kleifeld mit von der Partie und erfreute mit ihrem wohlgerundeten, ausdrucksvollen Organ. Bei Orff wirkte noch der Oberstufenchor des Kölner Hans-Gymnasiums mit.
Christoph Zimmermann (10.6.2018)
Clara-Jumi Kang, Kölner Kammerorchester: Christoph Poppen
1. Juni 2018
Klassisch-romantisch
Im Jahr 1809, als Joseph Haydn starb, wurde Felix Mendelssohn geboren. Dies ist eine (freilich belanglose) Klammer bei den rahmenden Werken im jüngsten Konzert des Kölner Kammerorchesters. Bei seiner Ouvertüre „Das Märchen von der schönen Melusine“ hatte Mendelssohn, einem Besuch von Conradin Kreutzers Oper „Melusina“ nachsinnend, angemerkt: „Da bekam ich Lust, auch eine Ouvertüre zu machen, nach der die Leute nicht da capo riefen, aber die es mehr inwendig hätte.“ Dieses Zitat im Programmheft dürften die Konzertbesucher wohl kaum gelesen haben, denn sie frönten indolentem Zwischenbeifall mehrfach. Nach dem ersten Satz von Ludwig van Beethovens Violinkonzert mochte er - da sehr ausgedehnt – der Leistung von Clara-Jumi Kang gegolten haben. Nach dem Introduktionssatz von Joseph Haydns Sinfonie Hob. I:102 aber war es aber nur noch eine Gewohnheitsreaktion. Kurz und leise tröpfelte es auch nach dem Menuett. Bei Mendelssohn war nichts falsch zu machen, denn die Ouvertüre ist ja durchkomponiert. Diese Anmerkungen mögen nicht als besserwisserische Hinweise verstanden sein, aber manchmal muß man sich gegen fatale Reaktionen einfach zur Wehr setzen.
Beethoven und Haydn entsprachen der klassischen Programmlinie, welche das Publikum schätzt und an welcher KKO-Chef Christoph Poppen nicht vorbei kommt. Daß er vorsichtig auf fortschrittliche Änderungen sinnt, hat er verschiedentlich bekundet. Insofern wird ein Konzert im Februar des nächsten Jahres von Bedeutung sein, wenn nämlich Christoph Prégardien u.a. mit Gustav Mahlers Gesellen-Liedern aufwartet.
Melusine gehört als Nixe zu jenen Zwischenwesen, deren Existenz an das Wasser gebunden sind, die jedoch zu einer beseelten Existenz in der Menschenwelt streben. Doch solche Hoffnungen erweisen sich immer wieder als trügerisch. Melusine (oder auch Undine oder Rusalka) kehrt enttäuscht in ihr nasses Lebenselement zurück. Auf dieses finale, traurige Moment verzichtet Mendelssohns Konzertouvertüre. Sie schildert vielmehr Momente des anfänglichen Glücks, kontrastiert das wellenartige Melusinen-Motiv mit dem heldischen Charakter ihres geliebten Ritters. Die reichen Emotionen dieser wunderbaren Musik (was wäre bei Mendelssohn eigentlich nicht wunderbar?) holte Christoph Poppen aus dem klangwilligen Orchester bezwingend hervor. Zwei, drei unstete Takte des Beginns müssen korrekterweise erwähnt sein, waren freilich ohne Belang für die insgesamt feingetönte Interpretation.
Die einleitenden Paukenschläge von Beethovens Violinkonzert geben meist einen ersten Hinweis auf die Gesamtinterpretation des Werkes. Unter Poppen erklangen sie zurückgenommen und weich. Eine gewisse Dezenz prägte dann in der Tat den gesamten ersten Satz. Diesem Trend schloß sich Clara-Jumi Kang an (sie studierte u.a. bei Poppen), bot dabei Filigranes vielleicht etwas einseitig. Etwas mehr Nachdruck, etwas weniger Verhaltenheit hätte der Musik gut getan. Umso erfüllter erklang das warmherzige Larghetto. Hier wartete die die junge koreanische Geigerin mit großartiger Klangintimität auf, ausgedehnt bis in extreme Höhenlagen hinein. Im finalen Rondo offerierte die Geigerin dann freilich moussierendes Giocoso-Temperament, bestens unterstützt vom KKO, welches Christoph Poppen animierend steuerte. Historisches nota bene: Mendelssohn dirigierte das Konzert 1844 in London, Solist war der zwölfjährige Joseph Joachim, nachmaliger Brahms-Freund.
Die Sinfonie Hob. I:102 ist einmal mehr Zeugnis für die individuelle, immer wieder mit geistreichen Überraschungen aufwartende Kompositionsweise Haydns, wie sie sich beispielsweise in der schweifenden Harmonik des Adagio manifestiert. Den Reichtum der Musik ließ Christoph Poppen mit seinem sehr animiert spielenden Orchester ausgesprochen lustvoll spüren.
Christoph Zimmermann (3.6.2018)
Moderne Musik in unterschiedlicher Ausprägung
15. Mai 2018
Kartäuserkantorei: Paul Krämer
Heiterkeit und Fröhlichkeit, wie es in Albert Lortzings Oper „Der Wildschütz“ heißt, wird mit Bernd Alois Zimmermann und Johann Wolfgang von Goethe kaum jemals in Verbindung gebracht. Dabei gibt es von dem Komponisten eine ganze Reihe von Fotos, welche ihn entspannt lächelnd zeigen. Aber man assoziiert mit ihm, schon mit Blick auf sein tragisches Ende, eher tiefgründigen Lebensernst. Das bestätigen Aufführungen aus jüngster Zeit - die „Soldaten“ im Staatenhaus oder die „Ekklesiastische Aktion“ (Philharmonie-Gastspiel des Berliner Rundfunk-Sinfonieorchesters) - besonders nachdrücklich. Insofern war es eine sinnvolle Entscheidung der Kartäuserkantorei und ihres Dirigenten Paul Krämer, auch mal den „anderen“ BAZi vorzustellen.

Der Komponist seinerseits hatte mit der Vertonung von Goethe-Gedichten (zusammengefaßt unter dem von Erasmus von Rotterdam entliehenen Titel „Lob der Torheit“) eine Korrektur bzw. Ergänzung beim überaus seriösen Bild vom Weimarer Dichterfürsten im Auge. Gerade das Goethe-Jahr 1949 schien ihm geeignet, auch mal den „augenzwinkernden Weisen“ zu beleuchten.
Der Chorliederzyklus ist deswegen aber nicht einseitig hinsichtlich der Stimmungen. So stehen sich alleine die mittleren Nummern, „Pastorale giocoso“ und „Pastorale serioso“, stark kontrastierend gegenüber. Das zuletzt genannte Gedicht, zu einer Koloraturszene gestaltet, war für den gläubigen Zimmermann wegen seiner „Naturfrömmigkeit“ wohl besonders wichtig. Freilich wählt er keinen elegischen Tonfall, sondern gestaltet ein virtuoses Stück mit überaus vertrackten Sopranhöhen. Superb, wie Anna Herbst (Bild unten) all diese vokalen Katarakte bewältigte, ohne besondere Anstrengungen spüren zu lassen.

Ein besonders drastischer Text ist die Nummer vier, mit „Tonalität“ überschrieben (im Programmheft steht „Toalität“, in der Werkerläuterung „Totalität“). Das Wort „Hintern“ wird mit Wiederholungen der ersten Silbe in eine akrobatische Komik hinein getrieben. Der Chor sang, gut geführt von dem erst 27- oder 28jährigen Dirigenten, ausgesprochen lustvoll. So einfach, wie BAZi seine Musiksprache bezeichnet („fröhliche Tonalität“), ist sie aber denn doch nicht und geht auch über die Kategorisierung „einem Laienchor füglich zumutbar“ um Einiges hinaus. Zumindest empfindet man das als Zuhörer bei einer Erstbegegnung mit dem Werk. Kompliment also für die sichere Ausführung durch die Sänger, zu denen bei den Solisten auch noch der klarstimmige Tenor Patrick Grahl und Sebastian Seitz mit seinem mehr robusten Bariton gehörten.
Das Gürzenich-Orchester, mit Zimmermann-Werken derzeit ausgiebig beschäftigt, bot in der vorgeschriebenen kleinen Besetzung ein filigranes instrumentales Umfeld. Die Flöten sorgten für besonders aparte Stimmungen. Gewaltig allerdings das Schlagzeugarsenal mit sage und schreibe zehn Spielern.
Auch die Orchesterbesetzung von Igor Strawinskys „Symphonie des Psaumes“ gibt sich nicht ganz traditionell. Violinen und Bratschen fehlen komplett, was dem Werk einen gewissen Dunkelklang gibt. Da hätten Klarinetten eigentlich nicht gestört, aber auch sie wurden vom Komponisten ausgespart. Die Psalmen-Sinfonie entstand 1930 zum 50jährigen Bestehen des Boston Symphony Orchestra Sein Dirigent Sergej Kussevitzky, Freund und Verleger des Komponisten, hatte sich zwar ein Stück von etwas populärem Zuschnitt gewünscht, aber Strawinsky bestand auf seiner Idee eines Chorwerkes, welche er schon lange mit sich herum trug.
Die drei Sätze gehen ineinander über. Dennoch gibt es so etwas wie finale Zäsuren, welche in unverhohlene Dur-Akkorde münden. Grundsätzlich befleißigt sich der Komponist jedoch eines neoklassizistischen Stils, welchem er damals anhing. Das heißt freilich nicht klassisch geglättet. Die Harmonik etwa ist durchaus heikel, was die Kartäuserkantorei viele Proben gekosten haben dürfte. Die Bewältigung beeindruckte nachhaltig.
Nur kurze Zeit nach „Lob der Torheit“ schrieb Francis Poulenc sein „Stabat Mater“. Erstaunlich, wie stark zeitgleich geschriebene Werke in ihrem Stil, ihrem musikalischen Habitus differieren können. Zwar war Poulenc in früher Zeit mal das, was man einen „jungen Wilden“ zu bezeichnen pflegt. Dann aber führte ein bestimmtes Erlebnis dazu, daß er sich der Religion zuwandte, was sich in einem Spätwerk, der momentan häufiger gegebenen Oper „Les Dialogues des Carmélites“, besonders ausprägt. Einige Jahre zuvor war ein intimer Freund des homosexuellen Poulenc gestorben. Für ihn schrieb er sein „Stabat Mater“, dessen schmerzbewegter Text seinem starken Trauergefühl entgegen kam.
I.G. zu den etwas radikal konzipierten Werken von Strawinsky und Zimmermann klingt Poulencs Musik friedfertig. Dieser Eindruck rührt fraglos auch von der Tatsache her, daß sich der Komponist in einer erweiterten Tonalität ausdrückt, zwar ohne harmonische Anbiederung, aber doch irgendwie „seelentrösterisch“. Paul Krämer dirigierte umsichtig, manchmal fast andächtig. Der Chor konnte nicht zuletzt in diversen A-Cappella-Passagenseine interpretatorische Kultur unter Beweis stellen. Den expressiven Solopart übernahm Anna Herbst und überzeigte erneut mit ihrer souveränen Stimmführung.
Foto (c) Uta Konopka / annaherbst.com
Christoph Zimmermann (16.5.2018)
Gürzenich-Saison 2018/2019
Wenn man Francois-Xavier Roth gut gelaunt und mit dem Charme seines noch nicht perfekten Deutsch die neue Saison des Gürzenich-Orchesters erläutern hört, wird leicht nachvollziehbar, dass der Kontakt zu seinen Musikern als herzlich und entspannt gilt (aber auch hartnäckig in der Probenarbeit (Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=5aWbt_R--5c –). Zusammen mit seinem künstlerischen Mitarbeiter Patrick Hahn, welcher die Pressekonferenz am 8.5. ergänzend moderierte, hat er ein vielgestaltiges Programm zusammengestellt, welches auch wieder auf besondere Gürzenich-Ereignisse Bezug nimmt. So wird in einem saisoneröffnenden Festkonzert Max Regers vor 111 Jahren uraufgeführte Variation und Fuge über ein Thema von J.A. Hiller erklingen. Weiterhin die Haydn-Variationen von Johannes Brahms und das Cellokonzert von Edouard Lalo. Bei diesem wird auch wieder eine alte Tradition aufgegriffen, nämlich Musiker des Gürzenich-Orchesters solistisch brillieren zu lassen. Diesmal ist es Bonian Tian.
Zu den besonderen Ereignissen in der Geschichte des Klangkörpers zählt die Premiere der 5. Sinfonie von Gustav Mahler unter der Leitung des Komponisten (1904). Das Werk taucht jetzt in den Februar-Konzerten erneut auf und steht darüber hinaus im Mittelpunkt der Tourneen nach Turin, Budapest, Zürich und Wien. Auch die 3. Sinfonie findet Berücksichtigung (im September). Zwar wurde sie nicht in Köln, sondern in Krefeld uraufgeführt, aber Mahler dirigierte wiederum das Gürzenich-Orchester. Der „Zweiten“ geht das selten gespielte Violinkonzert Robert Schumanns voraus (Solistin: Isabelle Faust).
Schumann bildet einen Schwerpunkt in der Saison 2018/19 (bei 8 Terminen incl. Kammerkonzerte). Die Sympathie von Francois-Xavier Roth für diesen Komponisten wird durch die Tatsache akzentuiert, dass Schumann die Domstadt verschiedentlich besuchte und von ihr, wie auch seine Frau Clara, entzückt war. Niederschlag im Liederzyklus „Dichterliebe“ („Im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Well‘n, mit seinem großen Dome, das große, heilige Köln“). Neben dem Konzert für Violine sind im Laufe der Saison auch die für Klavier (Solist Jean-Frédéric Neuburger – er liefert auch eine Komposition mit Schumann-Bezug) und Cello (Truls Mork) zu hören. Besondere Reverenz ist ein Auftragswerk, bei dem Stefano Gervasoni Lieder und Duette zu einem vokal-orchestralen Zyklus „Liebesverrat“ zusammenfasst. Philipp von Steinaecker wird dirigieren.
Als Francois-Xavier Roth sein Kölner Amt antrat (2015), empfand er das Publikum als leicht konservativ. Das hat sich in seinen Augen geändert, sicher auch durch seinen konsequenten Einsatz für zeitgenössische Musik. Am „glattesten“ läuft das freilich immer noch, wenn ein neues Stück in ein traditionelles Rahmenprogramm eingebettet ist. So bleiben die Dezember-Konzerte beispielsweise trotz der Deutschen Erstaufführung von Hèctor Parras „Inscape“ ausgesprochen Schumann-dominiert (Cellokonzert, 4. Sinfonie). Und der im kommenden Mai erstmals ans Gürzenichpult tretende Emilio Pomàrico, vorrangig im 20. und 21. Jahrhundert zu Hause, lässt auf das 2015 geschriebene Akkordeon-Konzert von Georges Aperghis Anton Bruckners 6. Sinfonie folgen. Einem Favoritkomponisten Roths, Philippe Manoury, wird hingegen – ebenfalls im kommenden Mai – ein kompletter Abend gewidmet sein. Zu erleben ist „Lab.Oratorium“ für Stimmen, Orchester und Live-Elektronik - inszenierte Musik. Zu den Sängern treten zwei Schauspieler, Nicolas Stemann führt Regie. Dieses Opus kommt auch bei Gastspielen in Hamburg und Paris zur Aufführung.
Wie immer ist eine Reihe von Gastdirigenten eingeladen. Der sensationellste Name: James Conlon. Von 1889 bis 2003 war er Gürzenich-Chef (letztes Konzert, bereits als Gast, 2005). Mit Conlons Namen verbindet sich nicht zuletzt eine nachhaltige Renaissance der Werke Alexander Zemlinkys. Von den vielen damals entstandenen, einschlägigen CD-Aufnahmen ist, so weit zu sehen, derzeit nur noch die Oper ´“Der Zwerg“ (1996) greifbar. Bei seinem Köln-Besuch will der mittlerweile 68jährige Dirigent übrigens nicht an jene Jahre anknüpfen, vielmehr präsentiert er mit der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch Musik eines Komponisten, welcher in seinen Augen in der Vergangenheit etwas zu kurz kam, sieht man von „Lady Macbeth von Mzensk“ im Opernhaus ab.
Der erste Gastdirigent des Gürzenich-Orchesters, Nicholas Collon, leitet zunächst am ersten Advent ein Sonderkonzert zugunsten von „Wir helfen“ (Komponisten: Thomas Adès, Max Bruch, Benjamin Britten). Im finalen Saisonkonzert sind unter seiner Stabführung u.a. Alfred Schnittkes Bratschenkonzert von 1985 (Solist: Lawrence Power) und die gigantische „Alpensinfonie“ von Richard Strauss zu hören. Eine Wiederbegegnung mit Dmitrij Kitajenko, dem Ehrendirigenten des Klangkörpers, gibt es im November. Das Programm ist (natürlich) stark russisch geprägt: Peter Tschaikowskys Streicher-Serenade und Alexander Skrjabins „Poème de l‘extase“ für großes Orchester. Auch Reinhold Glière ist Russe, trotz seines französisch klingenden Namens. Für sein 1938 geschriebenes, aber völlig tonales Harfenkonzert wurde Xavier de Maistre engagiert. Es gibt wohl kaum einen Besseren. Ein Januar-Konzert unter dem jungen französischen Dirigenten Alexandre Bloch ist ganz und gar Jacques Offenbach gewidmet, welcher 2019 rechtens ausgiebig zu feiern ist (200. Geburtstag).
Der Spanier Pablo Gonzáles (nicht zu verwechseln mit diversen Fußballspielern gleichen Namens) bietet kurz danach ein romantisches Konzert mit Schumanns „Genoveva“-Ouvertüre Frédéric Chopins 2. Klavierkonzert (Yeol Eum San) sowie Zemlinskys „Lyrische Sinfonie“ (Jennifer Holloway, Michael Nagy). Von der jungen amerikanischen Dirigentin Karina Canellakis hält Francois-Xavier Roth sehr viel. In einem Sonderkonzert war sie schon einmal in der Philharmonie zu erleben. Im März leitet sie das Gürzenich-Orchester in einem pompös gerahmten Konzert (Richard Wagners Trauermusik aus „Götterdämmerung, Ludwig van Beethovens „Eroica“). Im Mittelpunkt steht das von Nicolas Altstaedt interpretierte 1. Cellokonzert von Schostakowitsch. Roth selber wird übrigens wieder Johann Sebastian Bachs „Johannes-Passion“ leiten. Eberhard Metternich, für den mitwirkenden Domchor verantwortlich, ist im September noch mit einem geistlich geprägten Konzert als Orchesterdirigent im Dom zu erleben.
Viel war während der oben erwähnten Pressekonferenz über Öffnungen zum Publikum zu hören. Kinder, Familien und Senioren werden auch weiterhin mit separaten Veranstaltungen bedient. Den digitalen Medien gilt verstärkte Aufmerksamkeit, wie es auch beim Westdeutschen Rundfunk geschieht. Mit allen Zusatzangeboten hat man positive Erfahrungen gemacht und verstärkt Breitenwirkung erzielt. Das traditionelle Abo-Publikum verliert man deswegen aber nicht aus den Augen. Eine anhaltend über 90%ige Platzausnutzung darf als Erfolg gelten.
Die Veranstaltungsreihe „Ohren auf“ oder auch die Kammerkonzerte in der Philharmonien und der Flora bedürften eigentlich einer detaillierten Betrachtung, aber an dieser Stelle fehlt dafür der Platz. Aber es gibt ja die üppige Saisonbroschüre, welche auch sonst akribischer Lektüre anempfohlen sei.
Christoph Zimmermann 9.5.2018
Neuer Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters
Cristian Macelaru
Eine zeitbegrenzte Tätigkeit in künstlerischen Spitzenpositionen ist normal, auch bei Dirigenten. Willem Mengelberg (Concertgebouw Orkest) und Eugene Ormandy (Philadelphia Orchestra) gehören zu den seltenen Ausnahmen; eine besonders stimmige Kommunikation mit den Musikern mag ausschlaggebend gewesen sein. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass gegenseitige künstlerische Befruchtung von regelmäßigem personalen Wechsel profitiert. Was beim WDR Sinfonieorchester den noch amtierenden Jukka-Pekka Saraste betrifft, so ist er seit neun Jahren Cheftätigkeit weit über die übliche Zeit hinaus beim WDR tätig. Ohne sich zu spezialisieren hat er seine sinfonischen Programme durch die Berücksichtigung finnischer Komponisten (vor allem Jean Sibelius) nachhaltig geprägt, was nachvollziehbar ist. Ohne dass dabei von abstumpfender Übersättigung gesprochen werden könnte, dürfte das Orchester nun aber doch neugierig auf eine veränderte Farbgebung im Repertoire sein.

Bei Sarastes Nachfolger, dem Rumänen Cristian Macelaru, stellt sich verständlicherweise die Frage, ob er Komponisten seines Landes (etwa Georges Enescu) besonders favorisieren wird. Aber da winkt der 38jährige Maestro ab: „I like to conduct everything“, lässt er bei der offiziellen Pressekonferenz wissen. Und gerade das breite Spektrum seiner musikalischer Neigungen lassen ihn als Leiter eines Rundfunkorchesters besonders geeignet erscheinen, welches in auf Ausgewogenheit und Breitenwirkung seines Wirkens zu achten hat.
Im übrigen ist es so, dass Cristian Macelaru seine musikalische Grundausbildung zwar in seinem Heimatland erhielt (gut präpariert durch instrumentalen Unterricht innerhalb der Familie, was auch für seine neun Geschwister gilt). Die Übersiedlung in die USA förderte und festigte dann Macelarus künstlerische Vielseitigkeit. Begonnen hatte er seine musikalische Karriere als Geiger (bereits mit 19 Jahren Auftritt in der Carnegie Hall); wichtige Stationen danach waren Konzertmeisterstellen in Miami und Houston. Im Opernhaus der letztgenannten Stadt debütierte er als Dirigent mit Puccinis „Madame Butterfly“. In der Folge stand Macelaru an den Pulten fast aller großen amerikanischen Orchester. Auch in Europa gastierte er erfolgreich.

Das WDR Sinfonieorchester dirigierte Cristian Macelaru erstmals im Februar 2017; es folgten zwei weitere Auftritte (bei einem war er Einspringer für Alan Gilbert). Die gebotenen Werke (u.a. Mozart, Tschaikowsky, Mahler, Strawinsky und Avner Dorman) bewiesen seine breite stilistische Kompetenz. Obwohl sich der Dirigent über seine künftigen Werkschwerpunkte zurückhaltend äußert, darf doch davon ausgegangen werden, dass das Spektrum ein großes ein wird. Und man würde es ihm sicher danken, wenn er dabei das Musikland Rumänien nicht außer Acht lassen würde.
Von den WDR-Musikern wird berichtet, dass sie die bisherige Zusammenarbeit mit Cristian Macelaru begeistert genossen hätten. Vielleicht war alles tatsächlich Liebe auf den ersten Blick bzw. den ersten Ton. Auf jeden Fall wurde in besonderer Weise der „kooperative Stil“ des jungen Dirigenten registriert, welcher sich in ausführlichen Gesprächen mit dem Hauptabteilungsleiter Musik beim WDR, Christoph Stahl, und dem Orchestermanager Siegwald Bütow bestätigte. Das Engagement Macelarus gilt zunächst für drei Jahre.
Zu den besonderen Erwartungen, welche an Cristian Macelaru gestellt werden, gehört eine publikumsnahe Vermittlung von Musik, wozu auch und in besonderer Weise die Öffnung für digitale Techniken gehört, wie von der Hörfunkdirektorin Valerie Weber unterstrichen („Aufgabe des neuen Jahrzehnts“). Das rezeptionelle Verhalten des Publikums hat sich nun mal verändert, darauf gilt es einzugehen, gerade für eine weit ausstrahlende Sendeanstalt. Regional gestreute Konzerttätigkeit soll diese Ambitionen ergänzen.
Bilder (c) WDR
Christoph Zimmermann 3.5.2018
Beethovensche Klangparadiese
Konzert am 21. April 2018
WDR Sinfonieorchester & Jukka-Pekka Saraste
featuring:
Arabella Steinbacher
Wie schon häufig fand auch das aktuelle Konzert des WDR Sinfonieorchesters nicht nur live in der Philharmonie statt, sondern wurde auch per Radio und Video-Livestream übertragen. Der zweite (und besuchte) Abend mit Ludwig van Beethovens Violinkonzert und der zweiten Sinfonie von Jean Sibelius „konkurrierte“ hingegen mit der optisch erweiterten Adaption von Gustav Mahlers „Neunter“ im Fernsehen aus dem Jahre 2017, ebenfalls von Jukka-Pekka Saraste geleitet. Bildgewaltig geriet in gewisser Weise auch die jetzige Philharmonie-Aufführung, denn die Solistin Arabella Steinbacher war nicht nur eine exquisite Interpretin, sondern darüber hinaus eine Augenweide. Und Saraste gab vor allem seiner Liebe für die Musik seines Landsmannes Sibelius gestisch vehementen Ausdruck.

Auf das Violinkonzert könnte man (wie auf viele andere Werke Beethovens freilich auch) Robert Schumanns Charakterisierung „hohe Lieder des Schmerzes und der Freude“ anwenden. Ein wirklicher Schmerzakzent ist in der Musik des Konzertes freilich nicht zu spüren, auch sollte man ihr nicht den Ausdruck von des Komponisten Erschrecken über den sich ankündigenden Hörverlust unterstellen. Dem Werk fehlt auch schwerlastiges Pathos, in welchem sich Beethoven sonst schon mal gerne ergeht.
Die Introduktion beginnt vielmehr mit leisen Paukenschlägen, welche im Verlauf des Satzes eine fast leitmotivische Bedeutung gewinnen. Beethovens Opus setzt weiterhin auf dialogische Strukturen, nicht auf einen über Gebühr dominierenden Solopart. Das lässt dennoch Raum für gelegentliche virtuose Einsprengsel. Und das Larghetto mit seiner eminenten Leuchtkraft bietet ganz besondere Möglichkeiten für eine „personal note“.
Arabella Steinbacher führte in diesem über weite Strecken ätherisch klingenden Satz zu wahren Klangparadiesen, um es bewusst euphorisch auszudrücken. Klarheit, Reinheit und eminente Pianokultur zeichneten das Spiel der Geigerin aus, die aber auch eines entschiedenen, markanten Ausdrucks fähig war. Letzteres unterstrich sie mit ihrer Zugabe, dem ersten Satz aus Serge Prokofjews Solosonate opus 115. Das Orchester begleitete Beethovens Konzert ausgesprochen stimmig, mit bester Koordination nicht zuletzt bei einigen individuellen Temporückungen. Jukka-Pekka Saraste ließ immer wieder auch Sturm und Drang zu.
In der Sibelius-Sinfonie wuchs sich das zu einem veritablen Pathos aus, was die Musik freilich nicht nur zulässt, sondern geradezu fordert. Auch wenn der Komponist in seinem Werk nationale Gefühle nicht dezidiert auszudrücken beabsichtigte, eignet der Musik doch ein emotionales Lodern, welches das zur Zeit der Uraufführung (1902) noch von Russland abhängige finnische Volk als patriotisches Signal verstand. Saraste ließ mit seiner spannungsgeladenen, dramatischen Interpretation die Erinnerung daran lebendig werden.

Ergänzende Anmerkungen aus aktuellem Anlass … Mit dem WDR Sinfonieorchester verbindet die Münchner Geigerin Arabella Steinbacher eine langjährige Zusammenarbeit. Besonderes Dokument hierfür ist eine vor einem Jahrzehnt entstandene Aufnahme ebenfalls des Beethoven-Konzertes, damals aber unter Andris Nelsons. Ebenfalls eingespielt wurde Alban Bergs Konzert „Dem Andenken eines Engels; die CD ist nach wie vor erhältlich. Im kommenden Monat begibt sich die Geigerin mit dem Orchester auf eine Tournee durch Korea.
Der Klangkörper (bis 1999 war sein Name Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester) blickt mittlerweile auf siebzig Jahre seiner Existenz zurück. Bevor der junge Christoph von Dohnányi sein Chef wurde, arbeitete man ausschließlich mit Gastdirigenten. Namen wie Karl Böhm, Sergiu Celibidache, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Dimitri Mitropoulos oder auch Georg Solti lassen verstehen, dass viele der im Funkhaus (ehemaliges Hotel Mondial) entstandenen Aufnahmen besonders der fünfziger Jahre auf CD in Umlauf gekommen sind und weiterhin kommen. Jüngste Veröffentlichung ist Anton Bruckners siebte Sinfonie unter Hans Knappertsbusch (1963). Vom Eröffnungsjahr des Funkhauses 1951 dürfen zwei attraktive Operneinspielungen nicht unerwähnt bleiben: Igor Strawinsky dirigiert seinen „Ödipus Rex“ (mit Peter Pears und Martha Mödl), der Deutschland-Heimkehrer Fritz Busch Verdis „Maskenball“ (u.a. mit dem ganz jungen Dietrich Fischer-Dieskau).
Christoph Zimmermann (22.4.2018)
Bilder (c) Philharmonie Köln / Peter / Broede
Mendelssohn macht glücklich
21. Februar 2016
Kirill Gerstein, Gürzenich-Orchester: Francois-Xavier Roth
Zwischen den Werken im jüngsten Gürzenich-Konzertes könnte man diverse Verbindungslinien ziehen. Mediterrane Heiterkeit wie in Felix Mendelssohns „italienischer“ Sinfonie spiegelt sich auch in Ferruccio Busonis „Romanza e Scherzoso“, das kompositorische Tasten des zwölfjährigen Felix in seiner ersten Streichersinfonie korrespondiert mit der Arbeit von Arnold Schönberg an seinem Klavierkonzert von 1942, bei dem sich der bestenfalls leidliche Pianist mit den Spielmöglichkeiten des Instruments erst einmal näher auseinandersetzen musste, was Interpreten bis heute zu spüren bekommen. Es gibt auch sehr viele äußerliche Parallelen: bis auf die „Italienische“ hat das Gürzenich-Orchester alle Werke zum ersten Mal gespielt. Man muss es GMD Francois Xavier Roth wirklich danken, dass er mit seiner unorthodoxen Programmgestaltung sein Orchester herausfordert, das Publikum aber nicht minder.

Seit Kurt Masur 1972 mit dem Gewandhausorchester Mendelssohns Streichersinfonien auf Tonträger gebannt hat, haben diese einen bescheidenen, aber doch effektiven Stellenwert im öffentlichen Konzertleben gefunden. Ihre Musik, so auch die der ersten, ist „nach Art der Alten“ geschrieben, wie es die Mutter von Felix ausdrückte. Doch selbst zur Stiladaption gehört ein gewisses Maß an Könnerschaft, und die war dem adoleszenten Komponisten als Himmelsgeschenk ganz einfach gegeben. Und seine individuelle Fantasie zeigt sich selbst im Rahmen einer retrospektiven Musiksprache, etwa bei den Reflexionen über B-A-C-H im Eingangs-Allegro oder den raffinierten Pizzicato-Wirkungen im Andante. Francois Xavier Roth machte in seiner drängenden Interpretation unzweifelhaft deutlich, wie stark es bereits im Kind Felix kompositorisch gärte. Eine dankbare Aufgabe war die Sinfonie auch für das Orchester.

Speziell bei Mendelssohn und Busoni gibt es einige Gemeinsamkeiten. Da ist zum einen das Wunderkind-Image, weiterhin das fördernde Elternhaus (wobei Busoni allerdings an der Überstrenge des Vaters zu leiden hatte) und die beiderseitige Bewunderung für Johann Sebastian Bach. Busonis „Romanza e Scherzoso“ beginnt orchestral leicht melancholisch mit einer Oboenmelodie, um dann heiter bewegt dem Ende zuzustreben, Stimmungen, welche sich auch im Klavierpart niederschlagen. KIRILL GERSTEIN ließ im Verein mit dem Gürzenich-Orchester nach anfänglichen Moll-Tönungen die Musik regelrecht perlen, gönnte sich bei den Solostellen nur etwas zu viel Pedal. Einen Perpetuum-mobile-Charakter besaß auch seine Zugabe, Busonis virtuos glitzernde Bearbeitung von Bachs Orgelchoral „Nun freut euch, liebe Christen“.
Auch dem etwas strengeren Schönberg-Stil wurde Gerstein überaus gerecht. Das Konzert opus 42 entstand im USA-Exil des Komponisten. Dass er mit seiner Flucht vor den Nazis noch haderte, lassen die Satzüberschriften des Werkes erahnen.

Zwischen „Life was so easy“ und „But life must go on“ bewegt sich das autobiografisch getönte Werk, dessen Korrespondenz zwischen „lyrischer Freiheit“ und „strenger Logik“ der Komponist Virgil Thompson einmal bewundernd hervorhob. Das Furioso des jazzversierten Pianisten korrespondierte stimulierend mit dem zupackenden Spiel des Orchesters, von Francois Xavier Roth mächtig angestachelt.
Eine noch gesteigerte Entflammtheit prägte die Widergabe von Mendelssohns mit Recht über die Maßen beliebter vierter Sinfonie. Die Moll-Färbung zweier Sätze ändert nichts am sanguinischen Grundcharakter des Werkes. Mendelssohns Musik macht ganz einfach glücklich. Unter Roths gestisch feuriger Leitung versprühte das Gürzenich-Orchester temperamentvolle Klangkaskaden, realisierte aber auch die raffinierten Pianissimo-Direktiven des Dirigenten (Ende des Andante).

So heiter und gelöst die Stimmung des Konzertes auch war: die vergiftete Atmosphäre zwischen dem Dirigenten und der Kölner Opernintendantin Birgit Meyer, welche die Öffentlichkeit derzeit in Atem hält, darf nicht unerwähnt bleiben. Die „Schuld“ an dieser Situation ist von außen nicht verbindlich zu bewerten. Aber bestimmte Forderungen und Verhaltensweisen von Francois Xavier Roth sprechen nicht gerade für seine kommunikative Fairness. Die Gürzenich-Musiker sind über ihren Chef jedoch weiterhin voll begeistert.
Christoph Zimmermann (17.4.2018)
Bilder (c) Talinski / Borggrewe
WAR REQUIEM
6. April 2018
ein breit gestreutes Konzertprojekt
Eine Aufführung von Benjamin Brittens „War Requiem“ hat natürlich zu jedwedem Zeitpunkt Berechtigung, aber der besondere moralische Appell des Werkes ist derart auf ein historisches Darum fixiert, dass jede Darbietung darüber hinaus gehende spezielle Querverweise erwarten lässt. Im (vorbildlichen) Programmheft des Kölner Bach-Vereins äußert sich die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters. Sie greift bis auf den Prager Fenstersturz 1648 zurück, welcher den dreißigjährigen Krieg auslöste (Beendigung durch den Westfälischen Frieden) und kommt dann notwendigerweise auf den Ersten Weltkrieg zu sprechen, die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, wie auch den Zweiten. Dieser führte u.a. zur Zerstörung der Kathedrale im englischen Coventry, ein Ereignis, an welches Brittens Requiem nachdrücklich erinnert und auch seine Entstehung verdankt. Die gegenwärtigen Weltereignisse zeigen übrigens, dass nicht oft genug erinnert werden kann.

Der Bach-Verein gab sich mit einer Aufführung in der Philharmonie nicht zufrieden. Zwei Tage präsentierte man das Werk im National Forum of Music in Wroclaw (Breslau), danach auch in der Berliner Philharmonie. Die große Chorbesetzung gelang durch den auch symbolischen Zusammenschluss von Coventry Cathedral Girl’s Choir, Polnischem Nationaljugendchor, belgischem Knabenchor „Les Pastoureaux“, dem Jugendchor der Bonner Lukaskirche und natürlich dem Chor des Kölner Bach-Vereins. Für den instrumentalen Part wurde das Bundesjugendorchester verpflichtet (es wird von den Berliner Philharmonikern gefördert), ergänzt durch Mitglieder des Orchestre Francais des Jeunes. Die Solistenbesetzung entsprach zwar nicht vollständig ganz den Intentionen des Komponisten (Sänger von einst verfeindeten Nationen), aber das war auch bei der Uraufführung 1962 in Coventry nicht der Fall. Die Mitwirkung des Engländers Peter Pears und des Deutschen Dietrich Fischer-Dieskau warf keine Probleme auf, doch die Russin Galina Wischnewskaja erhielt keine Ausreisegenehmigung und musste kurzfristig durch die Engländerin Heather Harper ersetzt werden. An der ein Jahr später erfolgten Schallplatteneinspielung durfte sie dann aber mitwirken. Die deutsch-türkische Sopranistin Banu Böke konnte man jetzt als stimmige Alternative betrachten. Tenor James Gilchrist und Bariton Erik Sohn entsprachen der „nationalen Idee“ voll und ganz.

Die mit größtem Enthusiasmus aufgenommene Kölner Premiere des „War Requiems“ ließ fast vergessen, dass die Entstehung des Werkes von mancherlei Schwierigkeiten belastet war, beginnend mit immer wiederkehrenden Selbstzweifeln Benjamin Brittens. „Manchmal scheint es das Beste zu sein, was ich je geschrieben habe, weitaus öfter allerdings auch das Schlechteste. Aber so ist das immer mit mir.“ Für die Tiefenwirkung der Musik und die gesamte Werkkonzeption mag indes sprechen, dass Dietrich Fischer-Dieskau, der nicht gerade für emotionales Überschäumen bekannte Sänger, später einmal eingestand, „innerlich völlig aufgelöst“ gewesen zu sein. „Die gefallenen Freunde standen auf und die vergangenen Leiden.“
Die dramaturgische Anlage des „War Requiems“ ist eine ungewöhnliche. Britten kombiniert Teile der traditionellen Totenmesse mit Anti-Kriegs-Gedichten von Wilfried Owen, der mit nur 25 Jahren im Ersten Weltkrieg sein Leben verlor. Die Messteile werden von Sopran, gemischtem Chor und großem Orchester wahrgenommen; ein orgelbegleiteter Kinderchor steht für die Imagination des Jenseitigen und für das Symbol von Unschuld. Die Owen-Gedichte sind den männlichen Solisten in den Mund gelegt und werden von einen Kammerensemble mit eigenem Dirigenten begleitet. Zu den ergreifendsten Texten gehört fraglos der letzte im „Libera me“, vorgetragen vom Bariton. In einer imaginären Szene trifft ein Soldat auf seinen ehemaligen Gegner. „Ich bin der Feind, den du getötet hast, mein Freund.“ Dann vereinigen sich beide Stimmen: „Lass uns jetzt schlafen.“ Sopran und Chor beenden das Requiem mit den Worten „Sie mögen ruhen in Frieden. Amen.“
Der enorme Aufwand für die Aufführung des „War Requiems“ (300 Mitwirkende) wurde in Köln mit großem Publikumsandrang belohnt, später auch mit enthusiastischem Beifall. Und man darf wohl davon ausgehen, dass der pazifistische Impetus des Werkes gerade jetzt besondere Wirkung machte, wo sich Krieg und Gewalt auf das Leben der Menschen verstärkt und weltweit auswirken. Die Initiative von Thomas Neuhoff, Leiter des Bach-Vereins und schon immer aktiv in der Erarbeitung ungewöhnlicher musikalischer Projekte, war also absolut zeitpassend. Neuhoff hat Brittens Requiem schon mehrfach dirigiert, jetzt bot er mit dem wirklich fantastischen Bundesjugendorchester eine hochkompetente, klangbohrende Interpretation. Dem Kammerensemble stand Daniel Spaw souverän vor. Er ist derzeit am Theater Hof/Franken engagiert. Die Chöre, platziert auf den Rängen hinter dem Konzertpodium, sangen ohne Fehl und Tadel. Solches Pauschallob dürfte angemessener sein als eine sezierende Beurteilung
Bei den Solisten bestach Banu Böke mit jugendlich-dramatischen Sopran und sicherer Höhe (immerhin gibt es einige C’s zu bewältigen). Erik Sohn bot eine noble, lyrisch grundierte Stimme, über die auch James Gilchrist verfügt. Aber er raute seinen Gesang mit überaus plastischer Diktion auch immer wieder leicht auf – eine faszinierende Leistung.
Es darf auf keinen Fall die Erwähnung des umfänglichen Rahmenprogramms versäumt werden. Mehrere Schulen im Köln-Bonner Raum nahmen an einem Projekt teil, wo sie aufgefordert waren, sich zum Thema Krieg in künstlerischer Form zu äußern. Bei den offiziellen Veranstaltungen machte in der Trinitatiskirche ein Konzert über verfemte Musik im Nationalsozialismus den Anfang. Es folgte eine umfängliche Einführung in Brittens Requiem unter dem Titel „Abraham opfert Isaak und die Jugend Europas“, diverse musikalische und theologische Betrachtungen sowie eine Ausstallung von Kriegsfotografien. Allerhöchster Respekt für das gesamte Großereignis
Christoph Zimmermann (9.4.2018)
Bilder vom Bundesjugendorchester (c) Selina Pfruener
Passionskonzert des Gürzenich-Orchesters
Bejun Mehta, ChorWerk Ruhr, Ltg. Nicolas Collon
30. März 2018
Meditativ gestimmtes Publikum
Die Philharmonie hat es geschafft, die vorösterliche Zeit mit passionsnahen Veranstaltungen termindicht auszufüllen. Bachs Johannes-Passion unter Philippe Herreweghe war, mit dem Aufführungsdatum etwas zurückliegend, eine Art „Vorspiel“, wurde dann am Karsamstag abgerundet mit der Matthäus-Passion (Kölner Kammerorchester: Christoph Poppen). Am Gründonnerstag bot zu vorgerückter Stunde und bei (elektrischem) Kerzenschein das Ensemble Arte Musica das Programm „Tenebrae Responsoria“ mit Werken von Carlo Gesualdo. Den Karfreitag wiederum besetzte das Gürzenich-Orchester mit einem Passionskonzert, dem ersten des Klangkörpers, wenn die Erinnerung nicht täuscht. Vielleicht war bereits dieses Konzert eine alleinige Idee von Nicholas Collon, dem ersten Gastdirigenten des Klangkörpers (Rezension seines letzten Auftritts im Februar gleich unten). Auf jeden Fall aber entsprach die Werkwahl seinem ausdrücklichen Wunsch. Während der Nachpausenteil vollständige Werke enthielt (ein kurzes und ein langes), gestaltete Collon zuvor eine Art Passions-Pasticcio, von zwei Ausschnitten aus Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ nachdrücklich markiert.

Obwohl im Titel von „Worten“ die Rede ist, handelt es sich bei dieser Komposition um ein reines Instrumentalwerk, deren (natürlich sieben) Teile von Haydn als Sonaten bezeichnet sind. Der Introduktionssatz beinhaltet Jesus‘ Anrufung „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“, eine sinnvolle Einleitung für den Abend. In der Folge bot das Programm allerdings nicht eine chronologische Abfolge des Kreuzigungsgeschehens, wohl aber Rückgriffe auf einzelne Situationen, auch noch einmal mit Haydns Musik. Gegenüber der etwas pathetischen Introduktion bietet das „Sitio“ („Mich dürstet“) sanfte Geigenschwingungen zu Pizzicato-Begleitung im Pianissimo. Diese „abgehobene“ Sphäre wird dann freilich unterbrochen von rabiaten Orchesterschlägen, welche den körperlichen Schmerz des am Kreuz leidenden Gottessohnes schildern. Das Gürzenich-Orchester ließ sich von Collon zu differenzierter Klangentfaltung animieren.
Die Ausschnitte aus Werken Johann Sebastian Bachs waren sicher auch auf den Gesangssolisten des Abends, Bejun Mehta, zugeschnitten, allerdings nicht vordergründig. Die Texte der Kantate „Widerstehe doch der Sünde“ (BWV 54) hatten mit dem Thema des Abends nur peripher zu tun, waren mehr allgemeine Warnung davor, sich Gottes Geboten zu verweigern. Seine beiden, durch ein Rezitativ getrennten Arien gestaltete Bejun Mehtas eminent kerniger Altus mit großen vokalen Dimensionen, wobei die stark geforderte Tiefe (fast schon untere Tenorlage) bruchlos bewältigt wurde. Beeindruckend der vehemente Affektausdruck des Sängers.

Das „Es ist vollbracht“ aus der Johannes-Passion forderte die Sopranregionen von Mehtas Stimme heraus. Sie wurden sicher bewältigt, doch vielleicht nicht ganz so souverän, wie man sie sich beispielsweise von einem Philippe Jaroussky vorgetragen vorstellen könnte. Doch ist dies kein gravierender Einwand, sondern ein - möglicherweise überempfindliches - Abwägen.
Bei der Sinfonia der Bach-Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ (BWV 12) trat der von Sebastian Breuing einstudierte ChorWerk Ruhr nur relativ kurz in Erscheinung. Die große Stunde für dieses außerordentliche Vokalensemble schlug dann nach der Pause bei Antonio Lottis „Crucifixus etiam pro nobis“. Die harmonischen Wagnisse der Komposition können es mit denen von Carlo Gesualdo („Tenebrae“ am Donnerstag) ohne weiteres aufnehmen. Bei dieser A-Cappella-Motette bewunderte man die exzellente Intonationssicherheit und Stilversiertheit des Chores. Um noch mindestens einen Schwierigkeitsgrad höher waren die Ansprüche bei „Seven last words from the cross“ von James Macmillan (Jahrgang 1959), besonders für die in der Höhe extrem geforderten Soprane. Obwohl das Werk (Uraufführung 1994 in Glasgow) häufig an krass-dissonante Grenzen gerät, wagt die Musik immer wieder auch impressionistisch tonale Wendungen. In der Korrespondenz dieser Stile liegt die Eigenart und Suggestivität dieser Kantate begründet, welche auch dann überredet, wenn sich die Ohren zunächst vielleicht etwas sträuben mögen. Nicolas Collon führte den Chor sicher durch das Werk und entlockte dem Gürzenich-Orchester selbst extremste Klangfarben und Spielweisen mit dirigentischer Souveränität.
Der Bach-Coral „Wenn ich einmal soll scheiden“ beendete den Abend, welchen das Publikum meditativ gestimmt verfolgte, ohne dann am Schluss mit Beifall zu geizen. Für die abgehenden Soprane brandete er noch einmal gesondert auf.
Bilder (c) Jim Hinson, Josep Molinam / Philharmonie Köln
Christoph Zimmermann 31.3.2018
Gürzenich-Orchester & Nicholas Collon
featuring: Nils Mönkemeyer
19. Februar 2018
Erotische Fantasien
Der junge Brite Nicolas Collon hat das Gürzenich-Orchester vor zwei Jahren zwar schon einmal geleitet, aber seine Berufung zum ersten Gastdirigenten des Klangkörpers bestätigten erst jetzt „offiziell“ die aktuellen drei Abo-Konzerte. Dass Collon gewillt ist, künftig auch in der Oper tätig zu werden, unterstreicht sein nachdrückliches Engagement vor Ort.

Das jetzige Programm frappierte durch Vielgestaltigkeit, obgleich es sich auf die Moderne konzentrierte. Claude Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ von 1891/94 ist mit seinem Aufbruch in neue Klangwelten dieser noch hinzuzurechnen, sogar Richard Wagners romantisches Musikdrama „Tristan und Isolde“ (Vorspiel und Liebestod) bedeutet Zukunftsmusik. Nicht von ungefähr dient es zeitgenössischen Komponisten nach wie vor als inspirative Orientierung. Maurice Ravels Ballett „Daphnis et Chloe“ (zweite Suite von 1913) ist bereits ein Kind des 20. Jahrhunderts. Mit seiner trotz starker Dur-Verhaftung vorwärts weisenden Musik vertiefte es den Abend darüber hinaus mit dem unerschöpflichen Thema Eros.
Im „Faune“ ist es - anders als bei „Daphnis“ – waltet eher noch der Gedanke bzw. die Erinnerung als die Tat. Das Pianissimo-Gemurmel der Flöte kontrastiert extrem zu den Extasen von Ravels finalem „Danse génerale“, bei welchem nicht weniger als zehn Schlagzeuger gefordert sind. Zwischen diesen beiden Werken Wagners „Tristan“-Musik, wo Klangrausch von Verklärungsmilde gebändigt wird.

Auch Béla Bartóks Bratschenkonzert ist in diesem Themenkomplex zu verankern. Die entsprechenden Assoziationen im Programmheft gehen vielleicht ein wenig zu weit, auch wenn der Musik partieller Sehnsuchtscharakter sicher nicht abzusprechen ist (so gleich beim Soloauftakt des Introduktionssatzes). Aber der Komponist dachte bei seinem allerletzten Werk vor allem wohl an Erwartungen des vorgesehenen Uraufführungs-Interpreten William Primrose. Und das virtuos konzipierte Finale mit seiner folkloristischen Tönung ist ein unzweideutig fröhlicher Kehraus. Ob Bartók beim Schreiben seine Leukämieerkrankung verdrängte, welche ihm eine Vollendung des Konzertes versagte (die übernahm sein Schüler Tibor Serly)? Am ehesten wird man beim Dur-gemilderten Adagio religioso an tiefer lotende Emotionsschichten denken wollen.
Offen bleibt weiterhin die Frage, ob sich Nicolas Collon seinerseits für das Werk nicht auch als ehemaliger Bratscher ausgesprochen hat, wobei die Aussicht auf eine Musizierpartnerschaft mit Nils Mönkemeyer zusätzlich stimulierend gewesen sein könnte. Dass diese Vermutung nicht ganz abwegig ist, zeigt die dem Konzert vorgeschaltete Pentatonic Etude“ von Esa-Pekka Salonen, welche mit ihren Rückgriffen auf Bartóks Konzert musikdramaturgisch als Präludium für dieses angesehen werden könnte. Es handelte sich übrigens um die Deutsche Erstaufführung des Sieben-Minuten-Stückes. Selbst die Zugabe, „Dream“ von John Cage (Solo-Bratsche und Bratschen-Ensemble), ist als Konzeptergänzung anzusehen.
Wie Salonen/Bartók wurden auch György Ligetis „Atmosphères“ und Ravel attacca gespielt, wobei das fast tonlose Ende des nur aus breit gestreuten Klangflächen bestehende Ligeti-Werk sich mit dem „Lever du jour“ bei Ravel akustisch ideal verzahnte. Ansonsten wäre der Titel „Atmosphères“ im Grunde auf das gesamte Konzertprogramm anzuwenden.

Nils Mönkemeyer bewältigte das extreme Spieltechniken fordernde Bartók-Konzert mit eminenter Bravour und tonsatter Emotion, unterstützt vom sicher steuernden Nicholas Collon und den sattelfesten Gürzenich-Musikern. Die atmosphärisch individuellen Stimmungen bei Debussy und Ravel wurden mit vorbildlicher Sensibilität ausgekostet, wobei hier wie dort der Flötist Sunghyun Cho mit narkotischen Spiel hervortrat. Bei Cages „Dream“ avancierte Junichiro Murakami (Gast aus dem WDR Sinfonieorchester) zum besonderen Solopartner von Nils Mönkemeyer.
Bei den „Tristan“-Ausschnitten lenkte Nicholas Collon das Orchester in einen bestechenden Klangrausch, wobei die Themenübergaben innerhalb der Streichergruppen ohne akustische Zäsur verliefen, wie es nicht immer so perfekt zu erleben ist. Der Gedanke dürfte übrigens nicht zu weit hergeholt sein, dass die finale Extase von Ravels Musik (sie evozierte großen Jubel) und der Pianissimo-Beginn bei Debussy von den Veranstaltern auch als konzeptioneller Akzent verstanden wurde.
Christoph Zimmermann 20.2.2018
Bilder (c) Holger Talinski, Benjamin Ealovega
DIE ALPENSINFONIE
Frank Peter Zimmermann, WDR Sinfonieorchester: Marek Janowski
Konzert am 2.2.2018
Dezenz und Gigantismus
Porträtfotos geben spiegeln nicht unbedingt die reale Erscheinung eines Menschen, noch seltener seinen Charakter. Die Abbildungen von Frank Peter Zimmermann und Marek Janowski im Programmheft zum Konzert des WDR Sinfonieorchesters (WSO) besitzen gleichwohl einige Triftigkeit. Der Geiger lächelt, der Maestro blickt ungnädig. Vom Gürzenich-Orchester (wo er von 1986 bis 1990 GMD war – im ersten Jahr Einweihung der Philharmonie mit Gustav Mahlers „Achter“) und aus Kreisen von Musikern im Bayreuther Festspielorchester („Ring“ 2016ff) hörte man von menschlich schwierigen Arbeitsprozessen. Immerhin: die offenkundig angenehme musikalische Kommunikation mit Zimmermann nötigte Janowski beim Beifall doch den Anflug eines Lächelns ab, wenn das aus der 20. Reihe richtig gesehen wurde.
Janowski ist gebürtiger Pole (Jahrgang 1939), verbrachte seine Kindheit in Wuppertal, studierte an der Kölner Musikhochschule u.a. bei Wolfgang Sawallisch. Mit der Domstadt ist er also seit frühen Jahren verbunden, auch mit ihren beiden großen Klangkörpern. Von Gürzenich war bereits die Rede, beim WDR machte Janowski, wenn die Erinnerung nicht täuscht, Anfang der siebziger Jahre erste Aufnahmen. Nichts Groß-Sinfonisches, sondern Ausschnitte aus selten gespielten Opern wie Albert Lortzings „Regina“. Die Oper pflegt der Dirigent bis heute, wenn auch nur noch marginal. Der „Ring“ in Bayreuth war es dem Wagner-Fan wert, sich mit der Inszenierung Frank Castorfs zu arrangieren. Carl Maria von Webers „Euryanthe“, welche er vor über vier Jahrzehnten in prominenter Besetzung für die Platte einspielte, leitete er jüngst noch einmal konzertant in Dresden.
In der Philharmonie bot er mit dem WSO ein Haydn-Hindemith-Strauss-Programm, angesiedelt also zwischen Klassik und gemäßigter Moderne. Dieses Spektrum prägt Janowskis Repertoire auch sonst weitgehend. Sein eigentlicher Schwerpunkt (19. Jahrhundert) lässt eine Hinwendung zu historisch informierter Aufführungspraxis natürlich nicht zu, aber Joseph Haydns Sinfonie „La Reine“ ging er ebenso schlank (Staccati der Violinen) wie feurig an, reizte die dynamischen Forderungen der Partitur voll aus, wobei man einige Pianissimi als fast schon überpointiert empfinden mochte. Die Bläser waren vorzüglich in den Streicherklang integriert.
Seine Sinfonie schrieb der reife Haydn für Paris, die Königin Marie Antoinette war besonders entzückt von der Romance (Variationen über das französische Volkslied „La gentille et jeune Lisette“). Sie spielte diesen Satz gerne auf dem Cembalo, sogar noch im Gefängnis, wo sie (Französische Revolution!) auf ihre Hinrichtung wartete.
Paul Hindemith und Richard Strauss vertraten unterschiedliche musikalische Standpunkte. Trotz erster Bürgerschreck-Jahre legte Strauss Wert auf Wohlklang und harmonische Friedfertigkeit. Hindemith hingegen suchte nach neuem Ausdruck jenseits des als Ballast empfundenen romantischen Vokabulars, und das mitunter radikal. In seiner Kammermusik Nr. 4 für Violine und Kammerorchester sind hingegen barocke Vorbilder auszumachen. Harmonik wie auch Instrumentation sind bisweilen harsch, aber ungemein witzig und kapriziös, die Solo-Violine agiert weniger solistisch (trotz manch effektvoll ausgestellter Virtuosität) denn als prima inter pares. Frank Peter Zimmermann bewältigte diese Aufgaben technisch perfekt und mit Gusto. Seine singuläre Kunst wurde in der Zugabe noch deutlicher. Bei einem Satz aus Johann Sebastian Bachs a-Moll-Sonate ließ er die manuellen Höchstanforderungen vergessen, spielte mit einer Leichtigkeit und musikalischen Noblesse, dass es einem den Atem verschlug. Janowski dirigierte die Kammermusik souverän und sorgte beim etwas eigentümlich besetzten Orchester für beste klangliche Auffächerung. Übrigens werden in Kürze andere Hindemith-Werke mit dem WSO unter seiner Leitung auf CD erscheinen.
Nach der leicht filigran strukturierten Kammermusik bot das WSO (mit Gästen, z.T. aus dem Gürzenich-Orchester) die gigantische Alpensinfonie von Strauss. Hindemith bezeichnete das Werk als „Mords-Hokuspokus“. Aber die minutiös geschilderte Wanderung durch die Berglandschaft (Hörner einer fernen Jagd, glitzernder Wasserfall etc.) bieten melodiösen Reichtum und einen verschwenderischen „Sound“, dessen Opulenz und Raffinesse man sich nicht entziehen kann. Janowski kennt das Werk bestens, hat es vor einem Jahrzehnt mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra aufgenommen und bot es vor einiger Zeit live mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg in der Elbphilharmonie. Breite, aber nicht über Gebühr gedehnte Tempi sowie ein forte-intensiver, gleißender Klang machten klar, dass der Dirigent in der Alpensinfonie nicht nur Äußerlichkeiten einer Bergwanderung geschildert sieht, sondern diese auch als Abbild von der Schönheit dieser Welt, vielleicht sogar von göttlichem Walten versteht. Prägnante Einsätze und starker gestischer Kontakt zu den einzelnen Instrumentengruppen (speziell den Violinen) ließen bei Janowski nichts zufällig erscheinen. Dennoch blieb viel Raum für großen Atem und emotionale Entfaltung, was vom hinreißend disponierten Orchester optimal genutzt wurde.
Christoph Zimmermann 4.2.2018
Vom Konzert liegen uns leider keine Bilder vor.
Gergiev & Münchner Philharmoniker
featuring: ANNA HARTEROS
23.Januar 2018
Heroisches und Intimes
„Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt“. Diese Worte aus Schillers „Der Taucher“ kamen einem in den Sinn, als die Münchner Philharmoniker unter ihrem Chefdirigenten Valery Gergiev mit Peter Tschaikowskys „Francesca da Rimini“ anhoben. Der Komponist hatte die tragische Geschichte in einer Ausgabe von Dantes „Divina Commedia“ gelesen, welche mit Bildern von Gustave Doré geschmückt war. Diese beeindruckten Tschaikowsky besonders. Er fand sogar, dass der die Unterwelt durchbrausende Wirbelsturm von dem Zeichner besser dargestellt wurde als von der eigenen Musik (eine fraglos zu bescheidene Bemerkung). Aber die Schilderung der Liebe von Francesca und Paolo schien ihm gelungen.
Paolo ist der Bruder von Francescas Gatten, einem düsteren Menschen, was Francesca zu Paolo doppelt leidenschaftlich entbrennen lässt. Wie weit das Tête-à-tête letztendlich ging, lässt Dante offen, auch Doré enthält sich einer Festlegung. Aber ein inbrünstiger Kuss kann ja eigentlich nur ein Anfang sein … Dem von einer Jagd heimkehrenden Gatten reicht ohnehin, was er sieht. Mit einem Dolch ersticht er das Paar. Die Toten werden, irgendwie doch schuldig, in die Unterwelt verbannt, wo sie ständig dem besagten Wirbelsturm ausgesetzt sind. Dante folgt ihren Spuren, und Francesca erzählt ihm ihre Liebes- und Leidensgeschichte so dringlich, dass der Dichter, von Mitleid ergriffen, ohnmächtig zu Boden sinkt.
Tschaikowsky kostet alle Stimmungen der Erzählung aus, lässt das Orchester düster vibrieren, gibt aber auch einzelnen Instrumenten (Klarinette mit Pizzicato-Begleitung, Celli, Englischhorn mit Harfe) Gelegenheit, das Lichtvolle in dem schattenreichen Drama zu schildern.
Valery Gergiev hatte das musikalische Geschehen voll im Griff, ungeachtet seiner fingerflattrigen Gestik und einer nicht immer ganz taktgenauen Einsatzgebung. Tschaikowskys aufgewühlte Musik lässt sich vom Orchester im Grund nur auf der Stuhlkante sitzend angemessen absolvieren. Die Münchner Philharmoniker taten dies mit vollem Körpereinsatz, die Soli gelangen ausdrucksvoll und innig.
Als Überleitung zu Richard Wagners Wesendonck-Liedern (in der großartigen Orchesterfassung Felix Mottls) könnte die Zeile „Sausendes, brausendes Rad der Zeit“ dienen. Und es ist ja auch daran zu erinnern, dass Tschaikowsky die Bayreuther Festspiele besuchte und vom „Ring des Nibelungen“ nachhaltig fasziniert war. Dieser Eindruck könnte mit ein Auslöser für die Komposition seiner Orchesterfantasie „Francesca da Rimini“ gewesen sein.
Die leicht hypertrophen Liedtexte der verheirateten Mathilde Wesendonck lassen vielleicht hier und da lächeln, aber sie entsprangen nun einmal der Gefühlseuphorie im Leidenschaftsverhältnis zu Wagner. Eine Dreiecksgeschichte wie bei Dante, freilich ohne tödlichen Ausgang. Die „Tristan“-Atmosphäre sind in Mathildes Zeilen nahezu trunken eingefangen („Sanft an deiner Brust verglühen, und dann sinken in die Gruft“). Die Musik zu diesem Gedicht „Träume“ bezeichnete Wagner als Vorstufe zu seinem Musikdrama, was auch für „Im Treibhaus“ gilt. Von der Inbrunst und dem Pathos, aber auch dem Ausdruck von Intimität wird man als Hörer regelrecht narkotisch vereinnahmt. Gergiev wählte moderate Tempi, was Wagners süffigen Klängen einen äußerst breiten Raum gab. Und der will mit Gesang erfüllt sein.
Die Solistin des Wesendonck-Zyklus‘ war Anja Harteros, Elsa bei den diesjährigen Bayreuther Festspielen. Trotz ihrer verstärkten Hinwendung zu reiferen Opernfiguren in jüngerer Zeit (etwa der „Rosenkavalier“-Marschallin) und dem Zuwachs an dunkleren Vokalfarben ist sie nach wie vor eine jugendlich-dramatische Sängerin, wobei die Betonung auf dem ersten Wort liegt. Ihr Vortrag gab, denkt man an eher heroinenhafte Interpretationen zumal der Vergangenheit (Kirsten Flagstad, Astrid Varnay, Martha Mödl), der Musik etwas überraschend Irdisches – weniger Weltflucht als Welt-Wollen, gleichwohl geöffnet für höhere Sphären. Am beeindruckendsten wurde dieses changierende Klima Wirklichkeit im mittleren Lied „Im Treibhaus“, mit dessen Musik der dritte „Tristan“-Akt anhebt. Zu den bestechenden Pianohöhen (Smaragd, Luft, Duft) bot Anja Harteros viel weiches vokales Fließen. Eine weniger erotisch getönte als keusche Interpretation. Zwei kleine Unebenheiten oder auch die Zuhilfenahme von Noten konnten dem faszinierenden Eindruck nichts anhaben.
Bayreuth spielte auch im Leben von Richard Strauss eine bedeutsame Rolle, freilich noch nicht 1899, als er sein „Heldenleben“ uraufführte. Die Operndominanz späterer Jahre war noch nicht ausgeprägt, noch überwogen Tondichtungen. Beim „Heldenleben“ waltet eine fast schon hybride Lust an überdimensionalem Orchesterklang. Das Werk war (und ist bis heute) nicht unumstritten, was Strauss durchaus bewusst war. Immerhin erkannte die Öffentlichkeit, besonders eine spezifische, wer mit „Des Helden Widersacher“ gemeint war und mit leicht karikierenden Spielanweisungen für die Holzbläser auf die Schippe genommen wurde.
Der Begriff „Held“ mag mit dem Vokabular bei Wagner parallel laufen, aber Richard Strauss wollte ihn (bei allem Selbstbewusstsein) nicht auf sich geprägt sehen. „Ich ziehe es vor, Frieden und Ruhe zu genießen“, erklärte er einmal. Den etwas komplizierten Charakter seiner Frau Pauline schildert er im „Heldenleben“ hingegen ausgiebig. Dem Konzertmeister der Münchner Philharmoniker dankte man, dass die oft so ausschweifend wirkenden Passagen der Solovioline konzentriert wirkten. Valery Gergiev entwarf mit seinen Musikern ein üppiges Klangpanorama von großer emotionaler Variationsbreite. Hinreißend die Schlussapotheose.
Christoph Zimmermann 26.1.2018
Solisten, Kölner Kammerorchester, Thomas Gould
Einspringer aus England
13. Januar 2018
„Mit Bach ins Neue Jahr“ ist eine lockende, verlockende Konzertüberschrift. So nahm die gut gefüllte Philharmonie beim jüngsten Auftritt des Kölner Kammerorchesters (KKO) nicht wunder. Das auf Bach Vater und Söhne konzentrierte Programm hätte auch in den Zeiten von Helmut Müller-Brühl stattfinden können. Der jetzige Chefdirigent des Orchesters, Christoph Poppen, weiß um die damit vielfach verbundenen traditionellen Erwartungen des Publikums, willfährt ihnen auch. Aber er erweitert Grenzen, manchmal durch Werke der Nach-Barock-Zeit oder auch durch ungewohnte Besetzungen, wie es in Bälde bei der „Matthäus-Passion“ der Fall sein wird. Mit Joseph Haydns „Der Apotheker“ wird Mitte Februar erstmals die Aufführung einer Oper gewagt, sogar halbszenisch, wie es in der Vorankündigung heißt. Ein definitiver Brückenschlag ins 19. Jahrhundert erfolgt dann Anfang Juni: Haydn-Sinfonie, Beethovens Violinkonzert und Mendelssohns „Melusinen“-Ouvertüre. Ein festliches Benefizkonzert zugunsten des Orchesters findet mit überaus prominenten Solisten am 11. März statt. Auch hier ein weit gespanntes Programm.
Für diesmal aber ausschließlich Bach. Bedauerlicherweise ohne den vorgesehenen Geiger José Maria Blumenschein, welcher nach vielen Konzertmeister-Jahren beim WDR Sinfonieorchester zu den Wiener Philharmonikern wechselte. Über die Gründe seiner Absage war nichts in Erfahrung zu bringen, doch gibt es folgende Meldung auf www.news.at: „José Maria Blumenschein, der erst im Herbst 2016 sein Amt als Konzertmeister der Wiener Philharmoniker angetreten hat, verlässt das Elite-Orchester bereits 2018. Aus informierter Quelle ist zu hören, Blumenscheins Entscheidung habe mit Überlastung und internen Problemen zu tun: Innerhalb des Orchesters gibt es Stimmen, die das Amt zwecks Pflege des „Wiener Klangs“ aus den eigenen Reihen besetzen möchten.“ Beim Neujahrskonzert hatte man Blumenschein noch in seiner aktuellen „Rolle“ erleben können.

Für das Kölner Konzert wurde ersatzweise Thomas Gould gewonnen, offenbar so rechtzeitig, dass – wie der Abend bewies – ein Musizieren wie mit gemeinsamem Atmen zustande kam. Der junge Engländer ist Violinist und Dirigent zugleich, sein Repertoire reicht bis in die Jetztzeit. Er spielt auf historischen Instrumenten, verfügt aber auch über eine sechssaitige elektronische Geige. Schlank und hoch gewachsen, ist er in seiner freundlichen Art von sehr einnehmendem Wesen, was sich auf den Konzertabend auswirkte
Viele Fingerzeige müssen bei Aufführungen von Barockmusik eigentlich nicht gegeben werden, angemessene Proben natürlich vorausgesetzt. Aber Tempi sind weitgehend genormt und werden von versierten Musikern quasi intuitiv umgesetzt. Die Mitglieder des KKO sind solche, wie immer wieder erlebt. Das leicht tänzerische Agieren von Thomas Gould hatte andererseits etwas sehr Belebendes.
Bei dem solistisch besetzten Brandenburgischen Konzert Nr. 6 (BWV 1051) wirkten u.a. Matthias Buchholz und Oren Shevlin mit, Künstler, welche häufig auch bei KammermusikKöln auftreten. Trotz aller Versiertheit wirkte die Interpretation etwas matt. Vielleicht fehlte Thomas Goulds sportives Temperament am Pult. Die Ouvertüre Nr. 1 BWV 1066, welche das Finale des Abends bildete, wirkte nämlich ungleich belebter, obwohl es keine überzogenen Tempi gab.
Von Carl Philipp Emanuel Bach hörte man u.a. das Cellokonzert Wq 172. Der Komponist hat die originale Cembalostimme eigenhändig transkribiert. Das Werk bietet sicher nicht nur starke Musik, freilich etliches Virtuosenfutter, welches Oren Shevlin, hauptamtlich beim WDR Sinfonieorchester tätig, auch bei den abenteuerlichsten Griffeskapaden keinerlei Schwierigkeiten bereitete. Das Publikum zeigte sich nachhaltig enthusiasmiert. Bei der finalen Ouvertüre verfügten sich Shevlin wie auch sein Kollege Buchholz wieder ins Ensemble.
Eine „Doppelrolle“ nahm auch Tom Owen ein, Oboist im Gürzenich-Orchester und bei KammermusikKöln besonders aktiv. Sein schwingender, schmeichelnder Ton erfreute bei Vater Bachs Doppelkonzert BWV 1060 (welches auch in einer Cembalo-Version existiert). Thomas Gould korrespondierte mit relativ zartbesaitetem Spiel, in welches einige wohl spontane Vibrati einflossen, die bei historisch informierter Spielweise ja eigentlich verpönt sind. Beide Solisten spielten oft Aug‘ in Aug‘.
Carl Philipp Emanuels Sinfonie Wq 179 als auch die seines Bruders Johann Christian mit der Opus-Zahl 6,6 ergänzten das Programm. Beide Werke lassen barocke Ausdruckstopoi hinter sich, die „fortschrittlichen“ Elemente gestalten sich indes unterschiedlich. Thomas Goulds Animation als Geiger wie als Dirigent unterstrich den Aufbruch in eine neue musikalische Welt.
Christoph Zimmermann (14.1.)
Bild (c) Philharmonie Köln
Alice Sara Ott, WDR Sinfonieorchester
featuring:
Aziz Shokhakimov
12. Dezember 2018
Verinnerlichung und Extase
Obwohl Alain Altinoglu sein Dirigat beim WDR Sinfonieorchester krankheitsbedingt absagen musste, gab es das geplante künstlerische Doppeldebüt beim Kölner Klangkörper. Die Pianistin Alice Sara Ott trat wie erwartet und erhofft auf. Am Pult war indes Azis Shokhakimov der Ersatzmann für Altinoglu. Er ist 29 Jahr jung und stammt aus Taschkent (Usbekistan), einer Kulturmetropole mit städtischem Sinfonieorchester und Nationaloper. Hier wie dort war Shokhakimov an führender Stelle tätig. Ob er es immer noch ist, war in den biografischen Notizen des WDR-Programmheftes nicht zu lesen. Die sich offenkundig anbahnende internationale Karriere dürfte dort aber in jedem Falle zu häufiger Abwesenheit führen.

Im Moment ist Aziz Shokhakimov >>>>
Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein, konzertiert darüber hinaus mit diversen Orchestern von Rang (Dresden, London, Houston). Diese Engagements resultieren sicher nicht zuletzt aus der Tatsache, dass Shokhakimov 2016 Preisträger des Young Conductors Award der Salzburger Festspiele war. Bereits 2010 hatte er den zweiten Preis beim Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb der Bamberger Symphoniker gewonnen.
Das WDR-Programm (besucht wurde der zweite Abend) übernahm Aziz Shokhakimov ohne Veränderungen. Sein Repertoire scheint also schon einigermaßen umfangreich. Mit dem ersten „Lohengrin“-Vorspiel Richard Wagners, dem zweiten Klavierkonzert Franz Liszts und der Orgel-Sinfonie von Camille Saint-Saens (c-Moll, opus 78) enthielt es allerdings keine extravaganten Werke, sondern relativ populäre aus dem Zeitalter der Romantik, die es interpretatorisch freilich in sich haben. Bei „Lohengrin“ waren denn auch kleinere Klangdefizite feststellbar. Die Übergänge bei den ätherischen Streicherpassagen hätten noch sublimer ausfallen dürfen, der erste Einsatz der Holzbläser kam eher Mezzoforte als Piano. Großartig jedoch die mächtige Steigerung zum Fortissimo mit krönendem Beckenschlag und das verdämmernde Schluss-Pianissimo. Der „Lohengrin“ gehört übrigens neben der „Daphne“ von Richard Strauss zu den wenigen kompletten Opernproduktionen des WDR in der jüngeren Vergangenheit, beide von Semyon Bychkov geleitet.
Indem das Programmkonzept trotz der Einspring-Situation beibehalten werden konnte, blieb auch sein dramaturgisches Konzept bestehen. Die Werke von Wagner und Liszt spiegeln beispielsweise das familiäre Verhältnis beider Komponisten (durch Liszt-Tochter Cosima); künstlerische Kontakte und gegenseitige Hilfen hatte es aber schon vorher gegeben. So führte Liszt den „Lohengrin“ 1850 in Weimar zur Uraufführung. Der Nummerncharakter früherer Wagner-Opern ist hier nicht mehr vorhanden, auch Liszts einsätziges, wenn auch deutlich zäsierendes Klavierkonzert rückt von Formtraditionen ab, was auch für die Saint-Saens-Sinfonie gilt. Mit dem jungen französischen Komponisten verband Liszt nota bene ein ebenfalls gutes Verhältnis. Dessen Oper „Samson und Dalila“ brachte er, abermals in Weimar, zur Weltpremiere (1877).

Liszts Klavierkonzert ist ein eigenwilliges Konglomerat aus Virtuosität und Verinnerlichung, lässt dabei immer wieder den großen Klangzauberer erkennen. Das Soloinstrument wird bei aller Dominanz nicht vordergründig herausgestellt, sondern häufig lediglich stützend in den Orchesterklang eingebunden. Markante Fingerfertigkeit ist beim Interpreten gleichwohl gefragt. Die deutsch-japanische, in München geborene Pianistin Alice Sara Ott, an diesem Abend barfüßig auftretend (was man bislang nur von der Geigerin Patricia Kopatchinskaja kennt), fand sowohl im filigranen Diskant wie in donnernden Bassregionen den adäquaten Tonfall. Manche Passagen spielte sie ostentativ dem Orchester zugewandt. Das Zusammenspiel, von Aziz Shokhakimov zudem mit klarer wie feuriger Zeichengebung sicher gesteuert, geriet denn auch optimal. Mit einer versonnenen Schumann-Romanze bedankte sich die höchst attraktive Künstlerin für den immensen Applaus.
Den heimste auch Aziz Shokhakimov ein, nicht zuletzt für die Widergabe der Orgel-Sinfonie von Saint-Saens. Dieses Werk führt im Adagio-Teil in Bereiche fast religiöser Verzückung (dunkler Orgelklang als Basis satter Streicher-Kantilenen) wie auch in solche der Extase beim monumentalen Dur-Schluss. Hier wie dort ließ Aziz Shokhakimov die Musik glühen – faszinierend. Den Beifall beendete der Dirigent, indem er seinen Konzertmeister an der Hand nahm und ihn vom Podium zog. Das Orchester folgte.
Christoph Zimmermann (13.1.2018)
Bilder (c) Tonhalle.de / Deutsche Grammophon

Auch wenn Silvester-Extasen derzeit nur mit immensem Polizeitaufgebot in Schach zu halten sind, gibt es offenkundig viele Menschen, die sich einen stilvollen, deswegen aber durchaus nicht temperamentlosen Jahresübergang wünschen. In der ausverkauften Philharmonie gab es, ähnlich wie in Berlin und Venedig, ein klassisches Festkonzert, zu Neujahr sind anderswo weitere gefolgt.
Eingeladen hatte das Gürzenich-Orchester, welches am Silvesterabend zeitgleich im Staatenhaus die letzte Vorstellung der „Fledermaus“-Serie zu absolvieren hatte. Eine ganze Reihe von Gästen signalisierte, dass die Musikereinsätze akribisch aufteilt wurden.
Etwas Diabolisches hat ein Jahreswechsel durchaus an sich. So war es stimmig, dem Teufel Einlass ins Programm zu gewähren. Luigi Boccherinis Sinfonie „La casa del diavolo“ (Glucks Unterwelt nachahmend) hält sich im Ausdruck noch einigermaßen im Zaume. Die Widergabe unter Lukasz Borowicz hätte eine Spur mehr an ätzender Schärfe vertragen können, aber an Temperament und vorwärtstreibender Verve ließ es der polnische Dirigent nicht fehlen.
Beim ersten Violinkonzert des „Teufels“geigers Niccolò Paganini wurde bei den Zuhörern jedenfalls mehr Gänsehaut erzeugt, doch nicht etwa wegen dämonischer Konturen der zwar konventionellen, aber ungemein wirkungsvollen Musik, sondern wegen dem 28jährigen taiwanesischen Geiger Ray Chen und seinem Spielfuror. Keine virtuosen Kapriolen, welche er nicht mit fester, aber doch lockerer Hand meisterte (Läufe, Doppelgriffe, Spiccati, Flageoletts). Frenetischer Applaus, welcher sicher auch dem außerordentlichen Charme des jungen Künstlers galt. Zugabe: die von ihm besonders geliebte Paganini-Caprice Nr. 21. Lukas Borowicz übrigens dirigierte ganz vom Kontakt mit dem Solisten her – vorbildlich.
Für Astor Piazzollas „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ (Fassung mit Streichorchester von Leonid Desyatnikov) benutzte Ray Chen digitale Notenblätter, welche sich nicht ohne Grund immer stärker durchzusetzen scheinen. Die Musik des Zyklus‘ klingt sicher kaum teuflisch, ist aber eine dem Paganini-Konzert durchaus vergleichbare Herausforderung an geigerische Technik und Impulsivität erzeugt Dauerhitze. Ray Chen ließ in dieser Hinsicht nichts vermissen. Kapriziös die Vorschrift des Komponisten, die Instrumente innerhalb der ersten Violingruppe peu à peu auszutauschen, den Solisten eingeschlossen.
Franz Liszts Mephisto-Walzer Nr.2 bat Herrn Mephisto dann aber wirklich noch einmal dezidiert auf die Musikszene. Bei „Orpheus in der Unterwelt“ bezauberte die Ironie von Jacques Offenbachs Tonsprache. Lukasz Borowicz ließ das Gürzenich-Orchester rasen, zumal im infernalischen Höllengalopp. Zum Schluss kollektive Glückwünsche der Ausführenden zum Jahreswechsel, wie in Wien üblich. Als Zugabe konnte da nur ein Strauß-Walzer folgen.
Christoph Zimmermann (1.1.2018)
Keine Bilder
WDR Sinfonieorchester & Cristian Macelaru
featuring: Rudolf Buchbinder
am 16. Dezember 2017
Begegnung mit einem aufregenden Dirigenten
Eigentlich hätte Alan Gilbert dieses Konzert des WDR Sinfonieorchesters dirigieren sollen, doch verhinderte eine Krankheit sein Köln-Debüt. Viele Jahre wirkte er als Leiter der New Yorker Philharmoniker (bei denen seine Eltern als Geiger tätig waren bzw. noch sind). Ab 2019 wird er in Hamburg Chef der NDR Elbphilharmonie, bei der er bereits gastierte, als sie noch den Namen NDR Sinfonieorchester trug. Gerne hätte man diesen Alan Gilbert also auch in Köln erlebt. Aber Cristian Macelaru war mitnichten bloßer Ersatz, im Gegenteil. Seine Anwesenheit in Köln – kurz zuvor leitete er Gustav Mahlers „Titan“-Sinfonie bei „WDR Happy Hour“ – erwies sich zudem logistisch als überaus hilfreich. Erstmals hatte man ihn beim WSO im Februar erleben können.
Macelaru, gebürtiger Rumäne, ist ausgebildeter Geiger (es gibt aus dem Jahr 1992 eine Youtube-Aufnahme des damals noch sehr adoleszenten Künstlers), wirkte als Konzertmeister beim Miami Symphony Orchestra, wurde dann Mitglied des Houston Symphony Orchestra. Später ließ er sich als Dirigent ausbilden, wobei ein Einspringen für Pierre Boulez in Chicago 2012 als sein Durchbruch bezeichnet werden kann. Inzwischen hat Macelaru mit vielen renommierten Klangkörpern gearbeitet. Sein Engagement für zeitgenössische Musik wird durch die Leitung des Cabrillo Festivals nachdrücklich unterstrichen. Bemerkenswert ist auch sein Engagement für den künstlerischen Nachwuchs. Bei seinem aktuellen Kölner Auftritt übernahm er das für Gilbert vorgesehene Programm. Dessen klassisch-romantische Note fand am zweiten Abend der beiden angesetzten Konzerte enormen Anklang, besonders die finale Widergabe von Peter Tschaikowskys vierter Sinfonie wurde vom Publikum enthusiastisch bejubelt.
Begonnen hatte der Abend mit „Der verzauberte See“ von Antolij Ljadow, Mitglied des berühmten „mächtigen Häufleins“. Dieses stand dem als westlich dekadent angesehenen Tschaikowsky nicht eben wohlwollend gegenüber, während dieser wiederum über die „russischen Fünf“ die Nase rümpfte. Mit Ljadow ergab sich dann aber doch eine persönliche, fast freundschaftlich zu nennende Beziehung. Kompositorisch unterscheiden sich beide freilich.
Tschaikowsky badete stets ausladend in seinen (vor allem schmerzlichen) Gefühlen, Ljadow beschränkte sich auf miniaturhafte Werke wie etwa den „Verzauberten See“. Das achtminütige Werk ist eine klanglich dem französischen Impressionismus nahestehende Tondichtung. Der Titel signalisiert sanfte Wellengeräusche in nächtlichem Dunkel. Die Musik beginnt mit einem Klangteppich der tiefen Streicher, durchsetzt von einzelnen Tönen der Harfe. Erstaunlicherweise kommt auch die große Trommel mit Pianissimo-Schlägen farbprägend zum Einsatz. Cristian Macelaru ließ die Musik hier dämmern, dort leuchten, das Orchester verwirklichte den sanften Schimmer der Komposition vorbildlich.
Zum meditativen Charakter von Ljadows Musik passte besonders gut der Mittelsatz von Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert KV 466. Die Musik dieser Romance gehört selbst bei dem eigentlich immer göttlichen Mozart zu den besonderen Eingebungen. Und hier fand der Pianist Rudolf Buchbinder zu einem eminent luziden Spiel, während die Rahmensätze stilistisch zwar einwandfrei gerieten, einer letzten Magie aber doch entbehrten. Etwas vom Perlenglanz des zugegebenen Schubert-Impromptus wäre wünschenswert gewesen. Aber Mozart ist für alle möglichen interpretatorischen Ansätze ohne weiteres offen. Erst eine gute Woche zuvor war Lars Vogt bei einem Benefizkonzert des Gürzenich-Orchesters das Konzert entschieden maskuliner angegangen.
Den Abschluss des Abends bildete wie schon erwähnt Tschaikowskys vierte Sinfonie, deren massive Dramatik über den Gestus von Beethovens „Schicksals“-Sinfonie um ein Wesentliches hinaus geht. Cristian Macelaru, dem bei seinem Berlin-Debüt 2015 von einer lokalen Zeitung beeindruckende „Unerschütterlichkeit“ attestiert wurde, war auch dem virtuosen WSO ein heroischer Führer durch die hochexpressive Musik des Werkes. Bestechend, wie er den Forterausch vieler Passagen mit sensiblen Deutungen im Bereich von Dynamik und Agogik kontrastierte und damit eine aufregende Musikdramaturgie schuf. Diese war nicht auf äußerliche Wirkungen aus, sondern Ergebnis einer außerordentlich planvollen und sinnstiftenden Gestaltung. Im rasanten Finalsatz entfachte Macelaru dann freilich so etwas wie einen Vesuvausbruch und sorgte damit beim Publikum für eine fast schon hysterische Beifallseuphorie.
Pressebilder liegen leider nicht vor.
Christoph Zimmermann 17.12.2017
credits

Chen Reiss
Gürzenich-OrchesterLahav Shani
21. 12.11.2017
Musikalische Botschafter aus Israel
Dass ein Dirigent vom Gürzenich-Orchester ein halbes Jahr nach seinem Debüt erneut eingeladen wird, ist ungewöhnlich. So erfolgreich die Konzerte von Lahav Shani Ende Juni auch waren, so sehr der junge Israeli die Musiker auch zu beeindrucken wusste: Auslöser für das Reengagement kann das nicht gewesen sein. Vielleicht eine überflüssige Überlegung. Und das aktuelle Konzert rechtfertigte die Maßnahme ohnehin nachdrücklich.

Es ist sicher keine zwingende Notwendigkeit, dass Dirigenten mit Kompositionen ihres Heimatlandes aufwarten. Doch alleine im Falle des Gürzenich-Ehrendirigenten Dmitri Kitajenko führt das immer wieder zu starken Eindrücken wie auch zu Begegnungen mit Werkraritäten. Shani hatte seinerzeit u.a. Serge Prokofjews „Ouvertüre über hebräische Themen“ und Ernest Blochs „Schelomo“ ins Programm genommen. Diesmal betonte die Mitwirkung der Sopranistin Chen Reiss den nationalen Akzent.

Aber auch bei den zwei Komponisten war jüdischer Hintergrund vorhanden. Von Felix Mendelssohn hörte man „Meeresstille und glückliche Fahrt“, von Gustav Mahler die vierte Sinfonie. Die Wahl von Wolfgang Amadeus Mozarts Konzertarie „Ch’io mi scordi di te? – Non temer, amato bene“ mit obligatem Klavier trug hingegen der Tatsache Rechnung, dass Lahav Shani auch ein exzellenter Pianist ist, der beim Spiel seine dirigentischen Aufgaben jedoch nicht aus den Augen verliert. Sämtliche Kompositionen bot das Gürzenich-Orchester übrigens zuletzt im September 2008 unter Markus Stenz.
Mendelssohns Konzertouvertüre ist, mit einem Goethe-Gedicht als literarischer Vorlage, eine sinfonische Dichtung, deren teils nebelhafte Klänge bereits an Claude Debussys „Le mer“ denken lassen. Bei Lahav Shani kamen diese fast schon impressionistischen Wirkungen ebenso stimmig zur Geltung wie später die Kapriolen der Holzbläser und das festliche, freilich wieder in einem Pianoraunen endende Finale. Der sehr körperhaft agierende Dirigent vermittelte seine musikalischen Vorstellungen mit teilweise äußerst vibrierender Gestik. Aber er ging auch souverän und gelassen mit ruhigen, gedehnten Passagen um.

Die Mozart-Arie ist eine mehr oder weniger offene Liebeserklärung des Komponisten an die Sängerin Anna Selina Storace, das Miteinander von Gesangsstimme und Klavier quasi ein zärtlicher Dialog. Am Beginn freilich steht ein schmerzdurchzogenes Rezitativ (Textübernahme aus „Idomeneo“). Der Klavierpart wirkt nicht als entbehrlicher Zierrat, sondern ist integraler, klanglich stimulierender Bestandteil der Orchestrierung. Chen Reiss war den heterogenen Ausdrucksforderungen wie auch der durchaus heiklen Tessitura blendend gewachsen.
Bei Mahler schien ihre Stimme um Grade lichter zu klingen, was den besungenen „himmlischen Freuden“ gut bekam. Lahav Shani wiederum fesselte nicht zuletzt mit orchestraler Ausdrucksvielfalt und der Fähigkeit, Musik atmen zu lassen.
Fotos (c) Marco Borggreve / Holger Talinsky / Paul Marc Mitchel
Christoph Zimmermann 12.11.2017
Riccardo Muti & Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks
4.11.2017
In jeder Hinsicht beschwörend
Dem einst gegenüber Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ erhobenen Vorwurf einer für Sakralmusik überdramatisierten Tonsprache dürfte heute niemand mehr zustimmen. Eine ausverkaufte Philharmonie zeigte vielmehr, dass der glutvolle Stil des „Requiems“ eine ganz besondere Faszination ausübt. Sie wurde gesteigert durch eine Interpretation auf allerhöchstem Niveau:

Riccardo Muti dirigierte Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie ein erlesenes Solistenensemble. Dass Elina Garanca, vor einiger Zeit eine hinreißende Eboli in Paris, ihre Mitwirkung krankheitsbedingt absagen musste, war zwar sicherlich bedauerlich, hätte man doch gerne die neuerliche Facherweiterung der lettischen Künstlerin in Richtung Verdi erlebt. Freilich zeigte sich Anita Rachvelishvili nicht als simpler Ersatz, sondern als aufregende Alternative. Durch sie fügte es sich auch, dass sämtliche Gesangssoliten ein Köln-Debüt absolvierten. Neben der georgischen Mezzosopranistin waren dies Krassimira Stoyanova , Francesco Meli und
Riccardo Zanellato
Sein eigenes Debüt beim Bayerischen Rundfunk hatte Riccardo Muti 1981 gegeben – mit Verdis „Requiem“. Gemäß einem Bericht von damals war dies ein „legendäres Konzert“, wie es der Dirigent auch selber empfand. Wie würde die jetzige Aufführung vor solch verklärender Bewertung bestehen? Sie bestand auf wahrhaft grandiose Weise, auch wenn für diese Behauptung reale Hörerfahrung als letzter Beweis fehlt.

Was bei der aktuellen Darbietung von Verdis singulärem Werk sogleich auffiel, war die gegenüber anderen, extatisch vorwärtstreibenden Interpretationen die Wahl partiell abgebremster Tempi, so etwa beim „Dies irae“, welches als donnerndes Mahnmotiv das Werk durchzieht. Von „langsam“ ist freilich nicht zu sprechen, eher von einer durch solch agogische Reduktion gesteigerte Innenspannung. Über die Aufführung drei Tage zuvor in München hieß es über Muti in einer Rezension: „Klangliche Expansion begriff der 76-Jährige nicht als Effekt, sondern als Notwendigkeit.“ Das zeigte sich auch bei den gegenüber früheren Jahren fraglos breiter genommenen Ritardandi. Diese erweckten freilich nicht den Eindruck einer altersbedingt reduzierten, sondern vielmehr einer alterweise beflügelten Haltung gegenüber dem Werk. Andererseits gaben die wuchtigen, geradezu niederschmetternden Schläge der großen Trommel im konvulsivischen „Dies irae“ Raum zu dramatisch größtmöglicher Ausdrucksentfaltung.

Das Orchester (mit erstaunlich vielen jungen Damen in der Reihe der ersten Violinen) sorgten bei Verdis hochemotionaler Musik für eine Dringlichkeit es Ausdrucks, welche sich in die Nerven der Zuhörer geradezu hinein bohrten. Die vielen ätherischen Tremoli erklangen wiederum wie ein Gruß von anderen Planeten. Besonders hervorzuheben wären die lichtvollen Unisono-Passagen der Celli zu Beginn des „Offertoriums“. An instrumentatorisch bestechenden Stellen zu erwähnen ist auch das Frauen-Duett des „Agnus Dei“ mit der Begleitung von lediglich drei Flöten.
An die erstaunliche Entstehungsgeschichte des Werkes wäre mit einigen Worten noch zu erinnern. Als 1868 Gioacchino Rossini starb, regte Verdi eine Totenmesse an, zu welcher Italiens renommierteste Tonsetzer je einen Abschnitt beitragen sollten. Die Komposition (Verdis Anteil war das „Libera me“) wurde zwar vollendet, doch die Uraufführung scheiterte an bürokratischen Hindernissen. Erst 1988 (!) fand in Stuttgart unter Helmuth Rilling die Premiere statt. Als 1873 der allseits verehrte Schriftsteller Alessandro Manzoni starb, kam Verdi auf die Totenmesse zurück, nun aber mit der Absicht einer vollständig eigenen Komposition. Dieser gelang ein Siegeszug durch die ganze Welt, welcher bis heute anhält.

Riccardo Mutis kritisches Verhältnis zum sogenannten Regietheater ist bekannt. Dass er sich für die von ihm dirigierte „Aida“ im diesjährigen Salzburg (weitgehend abgelehnte Regie: Shirin Neshat) positiv ausspricht, hat noch einmal irritiert, doch darf man sein Votum auch als Stachel im Fleisch verstehen. Bei Verdis „Requiem“ ging es jetzt aber ausschließlich um Musik, ohne visuelle „Störungen“. Der Kölner Abend geriet zu einem Glückserlebnis, einer „Sternstunde“, als welche kürzlich auch die Widergabe von Gustav Mahlers dritter Sinfonie durch den mittlerweile an den Rollstuhl gefesselten James Levine und die Staatskapelle Berlin empfunden wurde. Die magische Ausstrahlung der frenetisch bejubelten Kölner Verdi-Aufführung wirkte noch lange nach.
Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zeigte sich allen Herausforderungen der differenzierten Partitur aufs Glücklichste gewachsen, ebenso der von Howard Arman einstudierte Chor. Die Bulgarin Krassimira Stoyanova, mittlerweile jenseits der fünfzig, frappierte mit ihrem nach wie vor klangvollen und höhensicheren Sopran (bei plausibler Ausdrucksintensivierung im „Libera me“), Anita Rachvelishvilis erotisch pulsierender Mezzo zeigte sich zwischen Diven-Aplomb und hauchzarten Piani jedweder Anforderung gewachsen, Francesco Meli bot tenoralen Glanz, aber auch hinreißende Mezza-Voce-Kunst („Ingemisco“). Bei Riccardo Zanellatos bassrundem, stilvollem Gesang mochte man allenfalls ein Quentchen jener Timbreautorität vermissen, wie sie in der Vergangenheit einem Cesare Siepi oder Nicolai Ghiaurov eigen war.
Muti (c) Silvia Lelli by courtesy of www.riccardomutimusic.com
zanellato (c) Luciano Siviero, Stoynaova (c) Brescia e Amisano © Teatro alla Scala
meli (c) Künstleragentur
Christoph Zimmermann (5.11.2017)
Gürzenich-Orchester & Hartmut Haenchen
Konzert am 30.10.2017
Das große Konzert zur Reformation

Foto (c) lutherstadt-wittenberg.de
Allüberall wird derzeit der Reformation durch Martin Luther vor 500 Jahren gedacht. In seinem zweiten saisonalen Konzert ließ sich auch das Gürzenich-Orchester diese Erinnerung nicht entgehen. Das hier beschriebene Konzert war das mittlere der üblichen drei Abo-Termine, ein Tag vor dem offiziellen Reformationsfest, an welchem das letzte Konzert auch live auf WDR 3 übertragen wurde. Die Montags-Veranstaltung hingegen verlief als „Festakt des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region und der Stadt Köln“, mit Ansprachen von OB Henrieke Reker und dem Stadtsuperintendenten Rolf Domning.

In den Reden wurde mehrfach Luther zitiert. Ein gewichtiger Satz: „Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.“ Mit dieser Aussage war man im Grunde von der Verpflichtung befreit, Werke aufzuführen, welche die Reformation unmittelbar reflektieren wie etwa Felix Mendelssohns „Reformations-Sinfonie“.
Die Zusammenstellung von Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“, sowie Bernd Alois Zimmermanns Sinfonie in einem Satz und Mendelssohns „Lobgesang“ waren eher als Gedankenspiele zu dem historischen Ereignis zu werten: Händel als festliche Friedensbestätigung nach dem österreichischen Erbfolgekrieg, Zimmermann als skeptische Reflexion nach dem Zweiten Weltkrieg über die Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Befriedung, Mendelssohn hingegen als Dokument des unverbrüchlichen Glaubens an gottbestimmtes Erdenglück.
Die Opern-Air-Premiere von Händels „Music for he Royal Fireworks“ war eine spektakuläre Veranstaltung, die übrigens fast mit einer Katastrophe geendet hätte (Feuerausbruch). Mit 24 Oboen, 12 Fagotten und auch sonst enorm starkem Bläserarsenal (neben Streichern und reichem Schlagwerk) wartete die Gürzenich-Aufführung zwar nicht auf, bot aber doch eine überproportional erweiterte Besetzung. War die Mitwirkung einer Orgel historisch korrekt? Massiver Klang ergab sich bei alledem automatisch.

Hartmut Haenchen steuerte die Klangfluten mit sicherer Hand, freilich auch ziemlich breitflächig und schwerlastig. Ohne die historisch informierte Aufführungspraxis als für die Barockmusik alleine selig machend zu erklären: hier wäre eine schlankere, luftigere Darbietung doch vorteilhafter gewesen. Dass die überaus pompöse Interpretation gleichwohl starke Wirkung entfaltete, was den Reaktionen des Publikums allerdings unschwer zu entnehmen.
Der Kölner Komponist Bernd Alois Zimmermann, mit seinem Geburtstagsdatum 1918 Jubilar des kommenden Jahres, war stets ein Grübler, in musikalischen wie auch gesellschaftlichen Dingen.
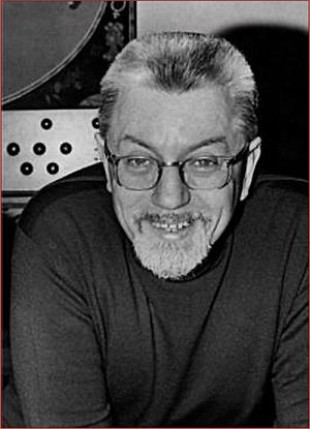
Seine Eindrücke über den Zweiten Weltkrieg spiegeln sich auch in seiner Sinfonie in einem Satz. „Das Werk gehört zusammen mit dem Violinkonzert in einen Abschnitt meiner Entwicklung, die wesentlich vom Ausdruck bestimmt ist“, so Zimmermann mit eigenen Worten.
Von dieser Ästhetik nahm der Komponist in der Folge verstärkt Abstand, radikalisierte seine Musiksprache, was sich u.a. in den „Soldaten“ manifestierte, welche die Oper Köln 52 Jahre nach der lokalen Uraufführung demnächst noch einmal zur Diskussion stellt. Haenchen war dem 18minütigen Werk ein bestechend sicherer, souverän klangsteuernder Anwalt; das Gürzenich-Orchester spielte gewissermaßen auf der Stuhlkante.
Als Höhepunkt des Abends durfte man indes die Aufführung von „Lobgesang“ empfinden. Sieht man von den (in jüngerer Zeit verstärkt beachteten) Streichersinfonien aus den Jugendjahren Mendelssohns ab, existiert ein Konvolut von fünf Sinfonien. Einen optimalen Beliebtheitsgrad haben eigentlich nur die dritte („Schottische“) und vierte („Italienische“) erreicht. Die „Reformations-Sinfonie“ (Nr. 5) steht ihnen (ungebührlicherweise) nach, Nummer 1 (c-Moll, opus 11) fristet sogar ein Schattendasein. Auch „Lobgesang“ taucht relativ im Konzertsaal auf. An der chorisch erweiterten Besetzung der „Symphonie-Kantate“ kann es eigentlich nicht liegen, da stellt u.a. Beethovens „Neunte“ gleiche, sogar noch gewichtigere Ansprüche, von bestimmten Werken Gustav Mahlers ganz zu schweigen.
Grundsätzlich gilt: „Lobgesang“ ist ein Werk von höchster Inspiration mit faszinierender Ausdrucksvariabilität und einem mitreißend hymnischen Schwung, welchen Hartmut Haenchen und das Gürzenich-Orchester strahlend und lichtvoll, dabei stets differenziert, zu realisieren wussten. Stärkste Wirkung ging auch von dem riesigen Chor aus, welcher diverse Kölner Kollektive vereinte. Es hat ja immer etwas besonders Faszinierendes und Erhebendes, wenn vom rückwärtigen Hochparkett der Philharmonie ein derart kompakter Gesang ertönt. Das Publikum ließ sich von Mendelssohns Werk und der packenden Interpretation merklich faszinieren. Es feierte angemessen auch die Solisten.
Anna Lucia Richter mit ihrer feenhaften Erscheinung und ihrem klaren, lichten Sopran beeindruckte besonders nachhaltig. Ihre Stimme verband sich im Duett „Ich harrete des Herrn“ mit dem etwas weicheren Organ ihrer Fachkollegin Esther Dierkes ausgesprochen harmonisch. Patrick Grahl nahm mit seinem jünglingshaften, feinsinnig geführten Tenor für sich ein.
(c) Gürzemichorchester.de / stadt-koeln.de
Original-Bilder vom Konzert liegen uns leider nicht vor!
Christoph Zimmermann 31.10.2017
Gürzenich-Orchester & Francois-Xavier Roth
featuring:
Christian Tetzlaff
am 2. Oktober 2017
Wahrscheinlich hat Francois-Xavier Roth, der in seinen Programmen mit dem Gürzenich-Orchester gerne Köln-Bezüge herstellt, solche auch beim jetzigen Saisonauftakt beabsichtigt. György Ligetis Violinkonzert erlebte seine Uraufführung nämlich 1992 in der Philharmonie (dieser Ort wird im Programmheft freilich nicht ausdrücklich genannt). Der Interpret war Saschko Gawriloff (heute 87), welcher das Werk auch in Auftrag gegeben hatte. Ihn begleitete das Ensemble Modern unter Peter Eötvös, ein angemessener Klangkörper für das recht kammermusikalisch konzipierte Werk (mit reichlich Schlagzeug allerdings). Zwei Jahre zuvor waren schon die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden drei Sätze (von den geplanten fünf) zur Aufführung gekommen. Etliches Notenmaterial wurde erst kurz vor der Premiere fertig. Der Solist musste es wahrlich mit „hängender Zunge“ einstudieren. Auch Gary Bertini, damals Chef des WDR Sinfonieorchesters, dürfte Schweißperlen vergossen haben.
Das Ganze ist nun ein Vierteljahrhundert her, und das Konzert hat sich offenbar gut etabliert. Francois-Xavier Roth wandte sich am Ende des erlebten mittleren Abo-Konzertes jedenfalls mit dieser Feststellung an das Publikum, wie immer ein liebenswürdiger Anwalt in Sachen Moderne. Er hat das Werk offenkundig minutiös im Kopf (trotz aufgeschlagener Partitur), dirigierte die heikle und teilweise aggressiv dissonante Musik mit rhythmischer Akkuratesse, mit Elan und Hellhörigkeit für ihre klangfarblichen Finessen.

Solist war Christian Tetzlaff. Er elektrisierte von Anfang an, machte mit seiner grifftechnischen Sicherheit vergessen, was der Komponist mal mit ironischer Selbstkritik über sein Werk sagte: „Für die Geige zu schreiben, war für mich wie Japanisch zu sprechen.“ Ligeti tobt sich kompositorisch also gewissermaßen aus, bündelt seine manchmal unspielbar erscheinenden Einfälle ein letztes Mal in der virtuosen Kadenz des finalen Agitato molto. In der an zweiter Stelle platzierten Aria gibt es freilich auch ausdrucksvoll lyrische Passagen wie dann nochmals im Lento intenso der Passacaglia (4. Satz), die freilich durch Einwürfe des Schlagzeugs und grell aufblitzenden Tönen von Okarinas und Lotusflöten partiell zerfurcht werden.
Christian Tetzlaff war, so konvulsivisch er sich auch gab, eine Art Fels in der Brandung von Ligetis Musik, mal virtuos attackenhaft, mal den Klangaufruhr melodisch glättend. Dass ihm sein Part volle Konzentration abverlangte, war aus seiner Körperspannung abzulesen, die man von ihm freilich auch bei klassischen Werken erlebt. Bei seiner Bartók-Zugabe faszinierten nicht zuletzt die vielen mitunter fast in die Unhörbarkeit mündenden Pianissimi.

Mit schwierigen Annäherungen an die Endgestalt eines Werkes hatte auch Anton Bruckner zu kämpfen, zumal er - bescheiden und über Gebühr unsicher - immer wieder allen möglichen Einflüsterungen nachgab. 1874 war die Premiere seiner dritten Sinfonie war ein Desaster, was Bearbeitungen zur Folge hatte. Die Schlussversion von 1889 wurde gar von 2056 auf 1644 Takte gekürzt. Die Urfassung liegt erst seit 1977 gedruckt vor. Der akribische Francois-Xavier Roth wählte sie für sein Kölner Konzert. Wer Aufführungen oder Aufnahmen der Sinfonie im Ohr hat, dem fielen Veränderungen vor allem in den Rahmensätzen auf.
Prägend ist bei dieser „Wagner-Sinfonie“ allerdings nach wie vor der Monumentalstil der Musik, welchen Roth mit zugespitzter Dynamik und sehr breiten Generalpausen unterstrich. Dass er im Moment im Staatenhaus auch den „Tannhäuser“ dirigiert, bedeutet freilich nicht unbedingt eine Beeinflussung. Auf jeden Fall aber ließ er das hinreißend konzentrierte Gürzenich-Orchester mit emotionalem Nachdruck musizieren und gönnte sich bei Höhepunkten den einen oder anderen „Bernstein-Sprung“. Roths äußerst dringliche Interpretation hielt die Zuschauer in Atem, und die von ihm aufgebaute Spannung verwehrte quasi fast automatisch störendes Husten, ermöglichte ein voll konzentriertes Musikerlebnis.
Christoph Zimmermann 3. Oktober 2017
Fotos © Giorgia Bertzzi, Holger Talinski
Premysl Vojta & WDR Sinfonieorchester
featuring:
Clemens Schuldt
Konzert am 22. September 2017
Konzerte des WDR Sinfonieorchesters (WSO) an zwei hintereinander folgenden Tagen: zum einen ein Mozart-Haydn-Programm, zum anderen Zeitgenössisches, auch wenn Erik Saties „Uspud“ von 1892 nur bedingt dazu gerechnet werden kann. Allerdings ist die Orchestrierung von Johannes Schöllhorn eine Uraufführung. Vielseitigkeit und Rundumversiertheit gehören zu den Eigenschaften besonders von Rundfunkorchestern, welche eine große Hörerschaft zu bedienen haben. Nur en passant sei gesagt, dass das Funkhausorchester (der zweite Klangkörper des Hauses) ähnlich verfährt, nur auf dem eher unterhaltenden Sektor.
Die Musik des 18. Jahrhunderts gehört natürlich zum ständigen Repertoire eines Sinfonieorchesters, also auch dem des Westdeutschen Rundfunks. Aber inzwischen hat die historisch informierte Aufführungspraxis gewaltige Spuren in der Musikrezeption hinterlassen, was nicht ignoriert, andererseits nicht in Gänze kopiert werden kann. Aber man lädt gerne hin und wieder einschlägige Dirigenten ein. Ton Koopman stand beispielsweise einige Male am WSO-Pult, auch Reinhard Goebel, der im kommenden Juni wiederkehren wird. Bernard Labadie, Leiter des Kanadischen Barockensembles, hätte ebenfalls seine Visitenkarte erneut abgeben sollen, doch fiel er krankheitsbedingt aus. Für ihn sprang Clemens Schuldt ein. Seit vorigem Jahr ist der 34Jährige Leiter des Münchener Kammerorchesters, welches ein größeres Repertoire abdeckt als beispielsweise das Kölner (mit diesem arbeitet derzeit Christoph Poppen, früher leitete er die Münchener) und der Moderne nicht aus dem Weg geht. Den Streichern des WSO verordnete Schuldt das Non-Vibrato, wobei hier und da leichte Zuckungen zeigten, dass diese Spielweise nicht zum Alltag gehört. Und ehrlich gesagt: eine spezifische Klangindividualität vermittelte das Orchester damit ohnehin nicht. Man sollte bei „historisch“ die Kirche ruhig im Dorf lassen. Aber das Orchester spielte differenziert und spannungsreich.

Das rührte nicht zuletzt vom federnd agierenden Dirigenten her. Auch das als Introduktion gewählte Werk machte starke Wirkung. Bei den vier Zwischenspielen aus Mozarts Schauspielmusik zu „Thamos, König in Ägypten“ handelt es sich um musikalische Füllsel für ein Drama (Tobias von Gebler), welches schon bei seiner Uraufführung 1774 nicht sonderlich zu überzeugen vermochte und heute nur noch eine Aktennotiz der Theatergeschichte bildet. Um die mit ihm letztlich mit verschwundene Musik ist es jedoch schade, denn die im Funkhaus gebotenen Piècen sind durchaus „erste Ware“ eines nur 17jährigen Komponisten. Drei schwere Orchesterakkorde zu Beginn deuten an, dass das freimaurerisch geprägte Sujet später in der „Zauberflöte“ wieder anklingt. Im Andante (Nr. 3) dominieren farblich häufig die Fagotte. Das war auch mehrfach der Fall bei Joseph Haydns Sinfonie Hob. I:96 („The Miracle“) wie auch beim zugegebenen Finalsatz aus der Sinfonie Nr. 68, wo sich Haydn mal wieder als kompositorischer Kobold zeigt.
Der Beiname „The Miracle“ gehört eigentlich nicht zu I:96, sondern zu einer anderen Sinfonie, hat sich an seinem falschen Platz aber bis heute behauptet. Er verweist im übrigen darauf, dass das Werk zu den „Londoner Sinfonien“ gehört, mit welchen der reife Komponist in Großbritannien nochmals besondere Erfolge errang. Bei diesem Werk erwies sich Clemens Schuldt erneut als ein vibrierender, dramatisch drängender Dirigent, welcher mit großen Gesten seine interpretatorischen Absichten unterstrich. Schön, dass bei aller Impulsivität die filigranen Passagen des Werkes nicht zu kurz kamen. Aber in toto ist Schuldt schon ein rechter Springinsfeld.

Im Mittelpunkt des Abend stand Mozarts Hornkonzert KV 495, welches der Tscheche Premysl Vojta zum Besten gab, Solohornist des WSO seit 2015. Er liebt das Stück nicht zuletzt wegen diverser musikalischer Kapriolen, die aber nicht alle auf den ersten Blick zu erkennen sind. Als attraktivster Satz dürfte fraglos das heiter bewegte Rondo-Finale empfunden werden, welches Vojta mit stupender Perfektion bewältigte. Anders als Alec Frank-Gemmill vor zwei Wochen mit KV 417 bei Musica Saeculorum verwendete er kein Naturhorn, was die technische Sicherheit enorm erhöhte. Wiederum ein Beispiel dafür, dass “historisch” nicht immer ein Vorteil ist. Der pastose Tonansatz Vojtas freilich wirkte leicht romantisch, da ware mehr Schlankheit noch wirkungsvoller gewesen. Aber dies ist nur ein kleiner Einwand gegenüber einer großen Interpretation.
Christoph Zimmermann 25.9.2017
Fotos © WDR
Gürzenich-Orchester & Francois-Xavier Roth
featuring
EDGAR MOREAU
3. September 2017
Zu den allseits geschätzten Tugenden von Francois-Xavier Roth gehört auch seine musikalisch-emotionale Bindung an Köln, wo er seit 2015 als Gürzenich-Chef amtiert. Wie schon sein Vorgänger Markus Stenz ist er aufgeschlossen für edukative Einsätze, und gerne probiert er neue künstlerische Konzepte aus. Die jeweils neue Saison mit einem Festkonzert zu eröffnen war beispielsweise eine Idee von ihm. Bei dieser Gelegenheit wird an historische Ur- bzw. Erstaufführungen des Gürzenich-Orchsters erinnert. Nachdem in den beiden vergangenen Jahren das Doppelkonzert von Johannes Brahms, der „Till Eulenspiegel“ von Richard Strauss, Béla Bartóks „Wunderbarer Mandarin“ und sein 2. Violinkonzert sowie Gustav Mahlers 5. Sinfonie (demnächst CD-Veröffentlichung) auf dem Programm standen, wurde jetzt mit „Don Quixote“ erneut Strauss berücksichtigt, dessen gute Beziehung zur Domstadt nicht zuletzt von der Freundschaft mit Franz Wüllner herrührte, welche in München begonnen hatte.
Seine Affinität zu Strauss hat Francois-Xavier Roth bereits in seinen Jahren beim Sinfonieorchester des Südwestrundfunks (nach der Fusion mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart: SWR Symphonieorchester) unter Beweis gestellt. In der Philharmonie beeindruckten bildhafte Intensität, klare Farbzeichnung und Luzidität. Nicht immer hielt sich Roth freilich nicht zurück. So kostete er die Forteepisoden in „Don Quixote“ genüsslich aus, beim Ritt des Titelhelden mit seinem Diener Sancho Pansa durch die Luft so sehr, dass die Windmaschine akustisch lediglich zu ahnen war. Auch die dynamische Abstimmung mit dem Cellosolisten geriet nicht gänzlich ausbalanciert. Edgar Moreau wurde hin und wieder von den Klangfluten verschluckt. Vermutlich ist das ein Dauerproblem von Liveaufführungen dieses Werkes, während eine Studioaufnahme durch Mikrophonpositionierung ausgleichen kann. Leider gibt die Erinnerung nicht mehr her, wie vor sieben Jahren Markus Stenz das Werk an gleichem Ort bewältigte.

Diese Einwände sollen nun freilich nicht verkleinern, dass Francois-Xavier Roth die Tondichtung von Strauss ausgesprochen plastisch gestaltete, wobei ihm das großartig aufgelegte Gürzenich-Orchester (besonderes Lob für Horst Eppendorfs himmlischen Oboengesang) ohne Fehl und Tadel folgte. Der neue Solo-Bratscher des Orchesters, Nathan Braude, hatte die nicht sehr ausgedehnten Passagen des Sancho-Pansa-Porträts souverän inne.
„Hauptperson“ war ohnehin der gerade mal 23jährige Edgar Moreau. Sein Ton ist nicht so satt-vital wie der eines Mstislav Rostropowitsch, tendiert eher zur Noblesse eines Pierre Fournier, was ihn für die von ihm geschätzte Kammermusik besonders pröädestiniert. Bei seinen „Quixote“-Soli faszinierten nicht von ungefähr die zart gesponnenen Lyrismen sowie die makellose Intonation im Diskant. Wie auch sein Bratschen-Kollege ist Moreau häufiger Partner von Martha Argerich, was als Auszeichnung besonderer Art anzusehen ist.

Bei der „Rheinischen“ Sinfonie Robert Schumanns drehte Francois-Xavier Roth besonders auf. Nun ist das Werk des von Posaunen nur vorübergehend etwas düster gefärbten 4. Satzes (nach Schumann eine „feierliche Ceremonie“) ein musikalisches Dokument von Lebenslust und Daseinsbegeisterung, fraglos mitinspiriert von rheinischer Mentalität. Schumann war ja damals Musikdirektor in Düsseldorf und lernte auch Köln ausgiebig kennen. Doch dem anscheinend Unbeschwerten sollte bald das Tragische folgen. Das bittere Lebensende Schumanns ist bekannt. Die Widergabe der Sinfonie durch Francois-Xavier Roth ließ Gedanken daran freilich nicht aufkommen. Sie verbreitete puren Sonnenglanz.
Ein Erlebnis von besonderer Art brachte „Rêve“ von Claude Debussy, der 3. Satz seiner im Jugendalter geschriebenen „Premiere suite d’orchestre“. Zunächst gab es für das Werk viel Anerkennung, doch dann versank es in Archiven. Erst 1977 (!) tauchte es in einer New Yorker Bibliothek wieder auf. Die weiterhin verschollene Orchestrierung von „Rêve“ holte Philippe Manoury („Komponist für Köln“) nach, und Roth führte mit dem von ihm gegründeten Orchester „Les Siècles“ (es wechselt bedarfsweise von historischer zu moderner Spielpraxis) das komplette Werk 2012 in Paris auf und machte auch eine Aufnahme, wo - sicher nicht von ungefähr - auch „La mer“ zu hören ist. Der rauschhaften Atmosphäre dieses Stückes ähnelt „Rêve“ fast spektakulär. Ein retrospektiver Zug ist in der Musik zwar noch ablesbar, aber der für Debussy typische Impressionismus bricht sich bereits eindeutig Bahn: ständiges Flirren, Fluten und melodiöses Schwärmen. Das Gürzenich-Orchester überbot sich in Schönklang.
Christoph Zimmermann 4.9.2017
Fotos © Julien Mignot, Daniel Herendi
WDR Sinfonieorchester & Eivind Aadland
featuring:
CHRISTIAN GERHAHER
Aufführung am 7. Juli 2017
Ursprünglich war Christian Gerhahers jüngster Auftritt mit dem WDR Sinfonieorchester unter der Stabführung von Kent Nagano vorgesehen. Frank Martins „Cornet“ sollte bei dieser Gelegenheit Beethovens 5. Sinfonie gegenüber gestellt werden. Aber der Maestro sagte ab. Ersatz fand sich in Eivind Aadland, den WDR-Musikern durch eine Gesamteinspielung der Orchesterwerke Edvard Griegs vertraut, auch auf CD erfolgreich.

Das Einspringen bot dem 61jährigen, aber sehr viel jünger aussehenden Norweger Gelegenheit zu zeigen, dass Überzeugendes nicht nur bei nationaler Affinität zustande kommen kann. Die ursprünglich geplanten, sozusagen „schicksal“haft aufeinander bezogenen Werke wurden jetzt ersetzt durch die chronologisch nachfolgende Sinfonie („Pastorale“) sowie den Liederzyklus „Les nuits d’été“ von Hector Berlioz, bei dem naturhafte Atmosphäre ebenfalls eine Rolle spielt.
Die Berlioz-Lieder opus 7 weisen eine komplizierte Entstehungsgeschichte auf, darüber hinaus divergieren ihre verschiedenen Fassungen hinsichtlich der Besetzung. Zunächst entstand eine Version mit Klavierbegleitung, welche der Komponist wohl mit Überzeugung peu à peu durch eine mit Orchester ersetzte. Die ursprüngliche Verteilung auf vier Frauen- und zwei Männerstimmen macht dramaturgisch wenig Sinn, die atmosphärisch primär düsteren Lieder wirken bei einem einzigen Interpreten stimmungsdichter. Das „Meine Liebste“ in „Auf der Lagune“ nimmt man selbst bei Sopran/Mezzo unschwer hin. Und Frauenstimmen dominieren bei diesem Werk auch im Phonobereich. Nur eine einzige „männliche“ Aufnahme (von 1993) existiert derzeit, aber da ist ein Countertenor am Werk
Ein Bariton (auch Berlioz original) korrigiert das eben erwähnte marginale Detail automatisch. Christian Gerhaher hat den Zyklus sowohl mit Klavier als auch mit Orchester verschiedentlich aufgeführt. Für die sich oft genug in tonlose Kontemplation verlierenden Lieder besitzt er einen idealen Piano- besser: Pianissimo-Stil, der von Fall zu Fall mit markanten Ausbrüchen kontrastiert wird. Die einleitende „Villanelle“ mochte einem zwar etwas überpointiert erscheinen, doch ansonsten vermittelte der vom Publikum heftig akklamierte Sänger das Herz-Schmerz-Spektrum der Berlioz-Musik zutiefst berührend. Neuerliches Fazit: ein wahrhaft singulärer Künstler.
Eivind Aadland entlockte dem Orchester alles notwendige Kolorit, ließ den Klang aber nicht überborden, achtete auf dynamische Ausgeglichenheit und subtile Farben (Flöten). Überraschend dominant freilich die Trompeten in „Die unbekannte Insel“.
Auch bei der Beethoven-Sinfonie überzeugte die Interpretation in ihrer Ausgewogenheit, welche musikalisch Prozesse überzeugend steuerte und Naturschilderungen malerisch umsetzte. Doch nirgends Übertreibung oder gar eitle Vordergründigkeit. Keine spektakuläre Beethoven-Deutung, aber eine auf lebendige Weise dienende.
Christoph Zimmermann 8.7. 2017
Foto © Knut Bry
Gürzenich-Orchester & Lahav Shani
featuring:
NICOLAS ALTSTAEDT
21. Februar 2016
Mit Peter Tschaikowskys vierter Sinfonie, namentlich mit ihrem wie ein Vesuv lodernden Finalsatz, siegt man beim Publikum eigentlich immer. Aber der außerordentliche Beifall am Ende des sonntagvormittäglichen Gürzenich-Konzertes galt auch und besonders nachdrücklich dem israelischen Dirigenten Lahav Shani. Die Karriere des 1989 Geborenen begann erst vor kurzem und wird ihn in Bälde als Chef zum Rotterdams Philharmonisch Orkest führen.
Jetzt aber stand er (und steht nochmals heute und morgen) vor den Gürzenich-Musikern, welche die Sinfonie zuletzt unter Dmitrij Kitajenko präsentierten (und auch auf CD einspielten). Dass der russische Maestro vor allem für die Musik seines Heimatlandes immer wieder nach Köln geholt wird, liegt an seiner eminenten Autorität und seiner interpretatorischen Authentizität. Das heißt jedoch nicht, dass es neben ihm keine anderen Götter geben könnte. Und Lahav Shani erwies sich als ein junger Gott, wenn dieses euphorische Wort gestattet ist.

Im Auftreten sicher nicht schüchtern, aber doch leicht jungenhaft, wird Lahav Shani am Pult zu einem Imperator. Der Körper strafft sich, man spürt, wie sofort Energie in seine Arme fließt. Tschaikowsky (und Sergej Prokofjews „Ouvertüre über hebräische Themen“, das einleitende Stück des Programms) hat er auswendig im Kopf. Jede Einsatzgeste ist ein Befehl, aber kein unduldsamer, sondern freundschaftlich anregender. „Gebt euer Bestes, Leute“ scheint er dem Orchester stumm zuzurufen. Die Gürzenich-Musiker taten es (zwei Flüchtigkeiten in der Horngruppe: geschenkt) und trieben sich und die Zuhörer, bildlich gesprochen, fast bis zum Herzinfarkt.
Das zugespitzte Tempo des Finales lief aber nicht auf einen äußerlichen Geschwindigkeitsrekord hinaus, sondern blieb (wie auch der mit hochdramatischer Intensität ausgekleidete Introduktionssatz) Bekundung einer Musik mit vielen Wundmalen. Tschaikowsky als tragische Figur - Lahav Shani und das Gürzenich-Orchester machten dies tönend begreifbar.

Wie dieser Komponist war auch Ernest Bloch ein Außenseiter, und zwar durch seine jüdischen Wurzeln. Aber in seinen Werken bekannte er sich zu ihnen, so etwa in der hebräischen Rhapsodie „Schelomo“. Cellist Nicolas Altstaedt adelte sie bei seinem Gürzenich-Debüt durch sein grifftechnisch lupenreines und nobles Spiel zusätzlich, das Orchester legte ihm unter Lahav Shani einen warm getönten Klangteppich aus. Lange Stille vor dem Beifall; Pianissimo-Bach als Zugabe des Solisten.
Die Prokofjew-Ouvertüre, tags zuvor beim Gürzenich-Kammerkonzert im Original als Sextett zu hören, ist weniger „Glaubensbekenntnis“ als kompositorische Hommage an jüdische Freunde. Aber auch sie überzeugt als Werk mit Seele und wurde musikalisch seelenvoll vermittelt.
Christoph Zimmermann 18.06 2017
Fotos © Marco Borggreve