


www.landestheater-coburg.de
DIE WALKÜRE
Premiere: 18.4. 2022. Besuchte Vorstellung: 6.6. 2022
Schroff und sehr, ja ungewöhnlich akzentuiert klingen die Streicher mit ihren detonierenden Spitzen in den Raum hinein. Das stürmende Vorspiel lässt keinen Zweifel darüber, dass es zur Sache geht – kein Wunder: wir sitzen in Coburg, einem kleinen Haus, in dem die Nachhallzeit so kurz ist, dass ein halbes Hundert Musiker in einem äußerst engen Orchestergraben genauso viel und genügend Druck zu geben vermögen wie ein Riesenorchester in einem großen Haus. Insofern war die Frage, ob es nicht gewagt sei, mit einem vergleichsweise kleinen Orchester an den „Ring“ zu gehen, eher naiv: denn Coburg tönt per se anders als die Metropolitan Opera, braucht also viel weniger Streicher, Bläser und Schlagzeuger, um den von Wagner intendierten Zauber ins Werk zu setzen. Im Gegenteil: diese „Walküre“ klingt, durch die Verschlankung des Klangs, an manchen Stellen ausgesprochen modern, als hätte Francis Poulenc die Partitur überarbeitet. Also: Die Kombination von „Coburger Fassung“ (1906/07 vermutlich geschaffen von Alfons Abbas) und „Lessing-Fassung“ von 1943 (mit den „Sonderinstrumenten“ Wagnertuba und Basstrompete) reichte, von ganz wenigen Passagen abgesehen, völlig aus, um ein schönes Klangerlebnis zu schaffen. Von ganz wenigen Passagen abgesehen? Zugegeben: Im Ritt der Walküren hätte ich mir mehr militärische Rundheit, mehr Massivität gewünscht (auch wenn das Corps der in der Luft sitzenden Frauen dynamisch seine Probleme hatte, vom Rang aus die Streicher kaum zu hören waren und mehr Druck im kleinen Haus nun wirklich nicht notwendig ist).

Was bleibt, stiften, neben dem Orchester unter der zügigen, dem Drama angemessenen und doch die lyrischen Inseln auslotenden Dirigat des GMD Daniel Carter, die Sängerinnen und Sänger. Siegmund und Sieglinde, Wotan und Brünnhilde, Fricka und Hunding, nicht zuletzt 8 „kleine“ Walküren – das muss erst einmal besetzt werden. Es spricht viel für Coburg, wenn von den Sängern der Hauptpartien immerhin Wotan, Fricka und Hunding aus dem Ensemble heraus besetzt werden können – und mit Åsa Jäger eine große Brünnhilde auf der kleinen Bühne steht, um die die Coburger manch großes Haus beneiden würde. Soviel Zartheit bei soviel dynamischer Bandbreite und -höhe, soviel damenhafte, dabei jugendliche Vokal-Eleganz bei so viel dramatischer Inständigkeit: so muss eine junge Brünnhilde klingen. Ob sie auch so aussehen muss, bleibt eine Geschmacksfrage, aber der erfahrene Opernbesucher und freund darf bezweifeln, ob eine überaus korpulente Frau in einem von Julia Kaschlinski entworfenen, infantil anmutenden Kostüm 1. der Rolle angemessen ist und 2. die Sängerin glücklich macht, ihr also gerecht wird.

Der Spagat zwischen behaupteter Symbolik und versuchtem Realismus, der diese „Ring“-Konzeption auszuzeichnen scheint, findet spätestens dann ein Ende, wenn der Illusionismus, der durch die Wagnerschen Originalfiguren transportiert werden soll, durchs Nachdenken über die Lächerlichkeit körperschädigender Kostüme gebrochen wird – gebrochen wird die Szene schon dadurch, dass der Regisseur Alexander Müller-Elmau wieder seine „Besucher*innen“ in den Ring, d.h.: ins Museum schickt, wo sie nicht mehr zu tun haben, als sich gelegentlich die ausgestellten Ring-Relikte (Schwert, Raben etc.) anzuschauen, lange auf Stühlen zu sitzen, die Szene zu beobachten und gelegentlich aufzustehen, wenn sie im Weg stehen. Man kennt diese Vergegenwärtigung des „tua res agitur“ inzwischen so zur Genüge (als letzte Beispiele nenne ich nur die „Ring“-Inszenierungen in Kassel und Berlin), dass man nur noch mit Siegfried ausrufen kann: „Ich mag es nicht mehr sehen“ – denn es bringt dramaturgisch-dramatisch absolut nichts, ja: es stört dort, wo die Intimität der Begegnungen zwischen Wotan und Brünnhilde, Siegmund und Sieglinde, die totale Konzentration aufs einzig Wesentliche gebietet. Also bitte: im Coburger „Siegfried“, den wir sehnlichst erwarten, sollten die nutzlosen Statisten die Bühne verlasssen haben, auch wenn man den Damen und Herren und dem Kind (Symbolik!) gönnt, so etwas Schönes wie Jessica Stavros und Roman Payer quasi hautnah bei der Arbeit zu erleben.

Wir verstehen auch so, daß Wagners „Ring“ zugleich ein historisches wie modernes Werk ist; weniger verständlich, zumindest im Kontext der „Walküre“, ist die Projektion eines renaissancehaften Christus-Kopfs während der Todverkündigung, hat Wagner doch dem Sohn, nicht dem Vater, während der Konzeption von „Siegfries Tod“, also der späteren „Götterdämmeung“, erlöserähnliche Züge verliehen – aber bitte: Assoziationen sind, gerade in Wagners gewaltigem Kosmos, erlaubt. Wo ein archaisch anmutender Hirsch, dem Wotan zu Beginn des 2. Akts das Herz ausnimmt, von der Decke hängt, ist die Erinnerung an eine diffuse „nordische“ Mythologie, auf die sich der Regisseur im Programmheft bezieht, durchaus logisch: als erste Stufe einer Ringmenschheitsentwicklung, der ein humanisierender, von Siegmund, Sieglinde (und Brünnhilde) ausgehender Prozess ja folgen könnte.

Jessica Stavros, ein griechisch-amerikanischer Gast aus Köln, singt und spielt diese Sieglinde, deren Stimme so bezaubert wie stets ihre Geschichte. Hausend in einem dunklen, denkbar unattraktiven Loch, dessen einziger Schmuck ein an der Seitenwand hoch applizierter Wolfskopf ist, womit sich wieder symbolische mit dem realen Raum überschneidet, weil auch dieser „Ring“ zuerst auf dem Theater spielt, hausend in einer unwirtlichen Atmosphäre, empfängt sie den ins Haus taumelnden Siegmund wie ihren „Erlöser“. Schön also, wie sich die Begegnung der beiden zart und knisternd erotisch - sagt man nicht so? - vollzieht: also zwischen der empfindsamen weiblichen und der zugleich heldischen wie lyrischen Stimme. Roman Payers. Payer bringt alles mit, um den jugendlichen Kämpfer stimmschön, groß und kontrolliert ins Bild zu setzen. Verkündet Brünnhilde ihm den Tod, wickelt sie ihn in ein schwarzes Tuch ein – der Wink mit dem Zaunpfahl, hin zu einer großen „Ring“-Inszenierung, ist überdeutlich, denn selbst die, die 1976 bis 1980 nicht das Glück hatten, eine Karte für den Chéreau-Ring-Zyklus zu ergattern, kennen die Inszenierung durch den Film: in dem immer noch und unvergesslich, Peter Hofmann von Gwyneth Jones, buchstäblich, so eingewickelt wird wie Payer durch Jäger. Ganz abgesehen vom (Foucaultschen) Pendel, das in Richard Peduzzis Walhall-Imagination und mit dem exzeptionellen Wotan namens Donald MacIntyre eine zugleich symbolische wie reale Bedeutung hatte, die von Alexander Müller-Elmau mit seinem Wotanschen Kugelpendel anzitiert wird. Nennen wir‘s: eine Hommage an die wohl berühmteste „Ring“-Inszenierung des 20. Jahrhunderts und deren Regisseur.
Wotan ist in Coburg, wie schon im „Rheingold“, Michael Lion. In der Höhe stets leicht gefährdet, arbeitet er sich mit größtem Anstand, mit interpretatorischer Genauigkeit und einer Fülle von nuancierenden Tönen durch die vielfältige, aber auch mörderische Partie, die einem Sänger am Abend alles und am Ende, nach den exzessiven Wutausbrüchen, noch die sensibelsten Töne abverlangt. Mit Lion hat dieser Ring eine „sichere Bank“, und auch hier gilt: Größere Häuser als Coburg könnten sich auch von dieser Besetzung eine Scheibe abschneiden – was schlussendlich auch für die genau artikulierende, spitzenscharf spielende Fricka der Kora Pavelić und den Hunding des Bartosz Araszkiewicz gilt. Bleiben die Walküren, allesamt kriegerische, uniforme Barbiepuppen, die die Regie mehrere Minuten lang, in einem wie von Hermann Nitsch zurückgelassenen, rötlich-weißen Farbschüttraum auf ihren Schaukeln szenisch verhungern lässt und sie dann doch noch ins sinnlose Gefecht mit dem Sturmgott zu schicken: bis auf die Knie. Das aber ist dann tatsächlich ziemlich gut, weil es die Beziehung zwischen dem Vater und seinen Töchtern so genau in eine Geste bringt, wie überhaupt die nachfolgende Begegnung zwischen Wotan und Brünnhilde delikat gezeigt wurde: mit Liebe zum Detail – und mit tiefem Verständnis für die Eigenheiten der Figuren: ihrem Stolz wie ihrer Trauer. Dies ist die wahre Stärke der Inszenierung: menschliche Befindlichkeiten verständnisvoll zu zeigen und die Schwächen der Figuren nicht zu denunzieren.

Also: Großer Beifall für einen in großen Teilen inszenatorisch gelungenen, bei den Statisten unbedingt nachbesserungswürdigen und musikalisch packenden Abend.
Frank Piontek, 6.6. 2022
Fotos: ©Annemone Taake
next to normal – fast normal
Premiere: 02.10.2021
Auch ernste Themen finden Platz in einem Musical

Ein Vorurteil, welches dem Musical immer wieder angelastet wird, ist oftmals, dass es vor allem um seichte Unterhaltung, Tanz und einer Menge guter Laune geht. In vielen Stücken ist dies sicher auch richtig und im Übrigen gar nicht verwerflich. Doch das Genre bietet so viel mehr. Dies bewiesen u. a. auch Brian Yorkey (Buch und Liedtexte) und Tom Kitt (Musik) mit der Broadway-Premiere von „next to normal“ im April 2009. Das Stück handelt von Diana Goodman, die an einer bipolaren Störung leidet und den vielfältigen Auswirkungen, die dies auf das alltägliche Familienleben hat. Zudem wird die Frage aufgeworfen, welche Probleme plötzliche Schicksalsschläge auslösen können, die von der Seele nicht richtig „verarbeitet“ wurden. Ausgezeichnet wurde „next to normal“ im Jahr 2009 mit mehreren Tony Awards und im Jahr 2010 mit dem Pulitzerpreis in der Kategorie Drama. Seit der deutschen Erstaufführung im Jahr 2013 bei der Titus Hoffmann nicht nur Regie führte, sondern gleichzeitig eine exzellente deutsche Übersetzung ablieferte, wird diese immer wieder mal in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufgeführt, seit dem vergangenen Wochenende nun auch am Landestheater Coburg.

Um es vorwegzunehmen, lautstark bejubelte das Premierenpublikum nach gut 2 ½ Stunden Aufführungsdauer alle Darsteller, Musiker und das gesamte Kreativteam. Die Inszenierung von Matthias Straub liefert hierbei neben einem Einblick in das Familienleben der Goodmans einen ebenso spannenden Einblick in die Seele von Diana. Hierzu entwickelte Till Kuhnert ein Bühnenbild, welches wie in nahezu allen bisherigen Inszenierungen selbstredend das Eigenheim der Familie in den Mittelpunkt stellt. In einigen ausgewählten Szenen, beispielsweise beim eindringlichen „Mir fehl´n die Berge“ dreht sich die Bühne zu einer inneren Landschaft aus dunklen Wellen, Strudeln und allerlei gefährlich aussehenden Brandungen. Eine hochemotionale und gelungen Regiearbeit, die auch dadurch überzeugen kann, dass das traute Eigenheim im Verlauf des zweiten Aktes immer mehr Löcher und Risse bekommt und am Ende nur noch wenig hiervon übrigbleiben soll. Zur gelungenen Inszenierung gesellt sich die wunderbare Musik von Tom Kitt, der aus den unterschiedlichsten Genres ein einheitliches Gesamtwerk geschaffen hat, wie dies selten zu finden ist. Unter der musikalischen Leitung von Roland Fister glänzt die Band aus Violine, Keyboard, Cello, Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug und bringt die einfühlsamen ebenso wie die rockigen Nummern des Abends treffend zu Gehör.

Auch bei der Besetzung kann sich die Coburger Inszenierung sehen und vor allem hören lassen. Die Rollen der Eltern wurden mit erfahrenen Musicaldarstellern besetzt. Als Diana ist Kerstin Ibald zu erleben, ihren Ehemann Dan verkörpert Christian Alexander Müller. Mit beiden leidet man stellenweise regelrecht mit, gesanglich sind beide erwartungsgemäß auf höchstem Niveau anzusiedeln. Die weiteren Rollen wurden aus dem hauseigenen Ensemble besetzt und auch hier zeigt das Landestheater ein gutes Gespür für die richtige Besetzung. Benjamin Hübner kann als Sohn Gabe ebenso überzeugen wie Lilian Prent als Tochter Natalie. Natalies Freund Henry wird von Lean Fargel treffend dargestellt, während Florian Graf die beiden Rollen des Dr. Madden und Dr. Fine übernimmt und hierbei beide Rollen entsprechend den Vorgaben sehr unterschiedlich anlegt. Wie steht es so schön im Programmheft: „Selten erlebt man in einer Arbeit eine solch clevere Verschachtelung von Texten, Musik und Handlung.“ Wenn eine solche Arbeit dann auch in der hier gebotenen Qualität auf die Bühne gebracht wird, dann kann man nur eine uneingeschränkte Besuchsempfehlung aussprechen. Bei vielen Musicalfans ist „next to normal“ ohnehin ein beliebtes Werk, aber auch dem ein oder anderen Operngänger, der sich bislang von den inzwischen oftmals sehr hochwertigen Musicalproduktionen landauf landab noch ferngehalten hat, sollte hier über einen Besuch nachdenken, es erwartet ihn ein hochemotionaler Theaterabend.

Markus Lamers, 04.10.2021
Fotos: © Annemone Taake
DAS RHEINGOLD
Premiere: 29.9. 2019. Besuchte Vorstellung: 9.1. 2020
Die Frage war, glaube ich, nicht ob, sondern wie sie es schaffen: Wagners „Vorabend“ so auf die Bühne und in den Orchestergraben zu bringen, dass er klingt. Das Landestheater Coburg hat es, nach 55 „Ring“losen Jahren, tatsächlich geschafft – das „Rheingold“ klingt ungefähr so, wie man es gewohnt ist, und wo es leicht anders tönt, weil 57 Musiker eben keine 107 Instrumente spielen können (wenn man einmal die 16 Ambosse abzieht, die hier eh, wie auch an größeren Häusern, vom Band kommen), klingt es nicht schlechter. Denn in einem kleinen Haus wie dem Coburger vermögen ein halbes Hundert Musiker in einem äußerst engen Orchestergraben genauso viel und genügend Druck zu geben wie 100 Mann in einem großen Haus. Insofern war die Frage, ob es nicht gewagt sei, mit einem vergleichsweise kleinen Orchester an das „Rheingold“ zu gehen, eher naiv: denn Coburg klingt per se anders als die Metropolitan Opera, braucht also viel weniger Streicher, Bläser und Schlagzeuger, um den von Wagner intendierten Zauber ins Werk zu setzen.

Im Gegenteil: gerade die Reduktion schafft im Coburger „Rheingold“, das unendlich viele kammermusikalische Stellen besitzt, immer wieder bezwingende subtile Instrumentalmomente. Wenn sich wenige tiefe Streicher verbünden oder ein paar wenige Holzbläser miteinander in Kontakt geraten, sind wir akustische Zeugen eines modernen musikalischen Theaters, das Wagners bekannter Forderung nach Deutlichkeit optimal entgegenkommt, ohne indes den Klang zu verdünnen. Also: Die Kombination von „Coburger Fassung“ (1906/07 vermutlich geschaffen von Alfons Abbas) und „Lessing-Fassung“ von 1943 (mit den „Sonderinstrumenten“ Wagnertuba und Basstrompete) reichte, von ganz wenigen Passagen abgesehen, völlig aus, um ein Klangerlebnis zu schaffen, das freilich deutlicher ausfällt als im verdeckten Graben, für den das „Rheingold“ bekanntlich nicht geschaffen wurde. Also hört man vom ersten Takt alles so deutlich heraus, wie es – meist – gewünscht wurde: allem unreflektierten Gerede vom angeblich idealen Bayreuther Mischklang zum Trotz. Und klingen dynamisch herausragende Passagen wie der brachiale Auftritt der Riesen oder die Kulmination des Aufschichtens des Horts nicht noch beeindruckender, wenn wir zuvor ein paar Instrumente weniger gehört haben? Zugegeben: das Vorspiel könnte indirekter, gleichsam mystischer, also weniger analytisch anheben, aber man kann als aufmerksamer Musikhörer nun wirklich nicht alles haben. Das bewusst bombastische Finale, das den Untergang der Götter mit brutaler Ironie schon ankündigt, klingt auch in Coburg, so, wie es klingen soll – der Rest ist, unter der genauen Leitung von Roland Kluttig, ein schönes, präzis austariertes musikalisches Hörspiel mit genauesten Akzenten und einem manchmal erstaunlich schnellen, dem Konversationsstil des Werks angemessenen Tempo: vor allem in der Riesenszene des 2. Bilds.

Die Qualität liegt freilich auch bei den Sängern. Selten hört man einen Alberich, der seine Meinungs- und Schmerzensäußerungen so wenig bellend herausbringt wie Martin Trepl, der bis vor kurzem noch als 1. Bass im Chor des Landestheaters sang. Wagner wäre schon deshalb glücklich gewesen, auch dieses „Rheingold“ zu hören, wenn er Trepl wahrgenommen hätte, der mit größter Deutlichkeit seinen Part singt und spielt, insofern Wagners Ideal des singenden Schauspielers bzw. schauspielernden Sängers nahe kommt. Gleiches gilt für den gestisch und vokal beweglichen Loge des Gastes Simeon Esper. Nur wenige Rollen mussten mit Gästen besetzt werden; aus dem Haus kommt daher auch der Wotan: Michael Lion erfährt damit eine Krönung seiner Laufbahn, auch wenn der sensible Hörer bei manchen seiner Tremoli bei einzelnen dramatischen Spitzenpassagen (andere nennen das „Schollern“) leicht zusammenzucken mag. Es verschlägt nur wenig, denn zusammen mit der Fricka der Kora Pavelic bietet er das Bild eines verzankten Götterpaars, dem das Beziehungsende schon eingezeichnet ist: er, ein Mann noch im archaisierenden Pelzmantel, der sich die Tür nach draußen offen hält, sie eine Lady, die bei offiziellen Anlässen die Weißhaarperücke aufsetzt, um mehr zu scheinen als sie ist.

Die Aufführung wurde übrigens gerettet von einem Sänger einer kleinen, aber doch nicht ganz unwichtigen Partie. Auch das ist bisweilen Theateralltag: Theodore Brown kam erst 90 Minuten vor Beginn der Vorstellung im Haus an, um den Froh szenisch einzustudieren; gesungen hat er dann so, wie man sich den Gesang des geborenen Playboys und Bruder der Sexgöttin Freia (Olga Shurshina) vorstellt: schlicht schön. Unter den beiden Riesen ragt, was bei den beiden Riesen so üblich ist, der Fafner, also Bartosz Araskiewicz, in bassmässiger Hinsicht heraus, während sein Bruder Fasolt mit Felix Rathgeber eher bassbaritonale Statur hat: ein guter Kontrast. Auch der Mime des Dirk Mestmacher ist nicht nur unter der Prämisse, dass die Partei einem Tenor gehört, leicht(er) gefügt, gleichwohl ein würdiger Bruder seines Bruders. Marvin Zobel singt einen ausgeglichenen, durchaus nicht donnernden Donner, und die drei Rheintöchter – Laura Incko, Dimitra Kotidou und Emily Lorini – passen nicht nur optisch zusammen.

Bleibt die wunderbar timbrierte, samtdunkle, noble Erda der Evelyn Krahe. Auch sie ist ein Gast auf der Coburger Bühne, und zwar: buchstäblich. Denn sie gehört zu den Besuchern des Museums, die sich im ersten Bild zusammenfinden, um sich die in den Vitrinen stehenden Rheintöchter anzuschauen. Der Regisseur Alexander Müller-Elmau hat sich als sein eigener Bühnenbildner eine Welt zusammengebaut, in der Mythos und Moderne, unsere Gegenwart und Wagners mythische Vergangenheit auf der Drehbühne, die mit bewusst offener Verwandlung die Illusionen reduziert, zusammentreffen. Der Meinung der Dramaturgie, dass Wagner diese Anti-Illusion gefallen hätte, muss wieder einmal mit dem Hinweis auf Wagners Überzeugung von der Überwältigung des Publikums widersprochen werden, aber man wird sehen, wie sich dieser „Ring“ weiter entwickelt. Dass gefährliche Szenen wie die Selbstverwandlung Alberichs in einen „Riesenwurm“ problematisch sind, ist ja nichts Neues; Ulrich Strohauer sagte in seinem Ring-Buch „Wolken über Walhall“ anlässlich dieser Szene, die selten überzeugt, dass „Klamauk und Klassiker gutnachbarlich nebeneinander liegen“. In Coburg erhebt sich einfach das Riesengehirn – Symbol des Rheingolds als intellektueller Verstand – mit einem immer länger werdenden Sack in die Höhe. Was soll man auch sonst mit dem Gehirn als Symbol machen, das später auch – und auch dies ist handwerklich fragwürdig – als Hort für Freias Lösung dient. Frage: Wo ist da die „Klinze“ im geschlossenen Hirnmantel? Wohingegen die Kröte tatsächlich eine schöne Kleinigkeit ist, die man unter einen Tarnhelm und in die Tasche stecken kann.

Wenn aber Szenen wie der Auftritt der Erda so gelingen wie hier, darf man als mündiger Zuschauer, der zwischen behaupteter Symbolik und versuchtem Realismus gerade dort unterscheiden kann, wo sich die von Wagner vorgeschriebenen Aktionen mit den szenischen Neudeutungen schlicht und einfach kaum vertragen – man darf also glücklich nach Hause gehen, wenn man gesehen hat, wie Erda auf- und wieder abtritt: als Besucherin des Museums. Denn Erda vermag, so der Regisseur, als Personifikation der Erde in vielen Gestalten zu erscheinen. Also zuckt es durch sie, die sich die Schmierenkomödie vom mehrfachen Raub des Rheingolds bzw. des Rings als Außenstehende so lange ansah, bis sie unbewusst (?) begriff, dass sie eingreifen müsse, um das Schlimmste zu verhindern. Und sie verschwindet wieder aus der Handlung: rätselnd über das, was sie, in der Nähe von Wotans Rabenjunge, gerade wie in Trance verkündet hat. Wir aber dürfen gespannt sein, wie sich Mythos und Moderne auch weiterhin beim Coburger „Ring“ begegnen werden, der seine musikalische Feuertaufe bestanden hat. Was die Szene betrifft, bleibt festzuhalten, dass ein widerspruchsfreier „Ring“, der Wagners Vorgaben und die nötigen modernen Interpretationen elegant verschmilzt, bislang noch kaum zu sehen war. Coburg macht da schon vieles richtig, denn der „Ring“ spielt bekanntlich nicht in irgendeiner Wirklichkeit, sondern auf dem Theater, wo nicht alles, aber vieles möglich ist – nicht zuletzt dank eines äußerst engagierten musikalischen Ensembles und einer optischen Ästhetik, die mit relativ wenigen Mitteln szenische Akzente setzt. Also: Auf in die Winterstürme!
Frank Piontek, 10.1. 2020
Fotos: © Sebastian Buff
ZUM ZWEITEN
DIE STUMME SERENADE
Premiere: 25.02.2017
besuchte Vorstellung: 19.03.2017
Filmreife Ausgrabung mit dem OPERNFREUND-Stern bewertet
Lieber Opernfreund-Freund,
regelrecht begeistert darf ich Ihnen von der Korngold-Rarität berichten, die derzeit am Landestheater Coburg zu sehen ist. Seine lange vergessene Operette „Die stumme Serenade“ hatte dort bereits am 25.02.2017 Premiere, aber da man als (Wahl-)Kölner die Domstadt am Karnevalssamstag unmöglich verlassen kann, hatte ich erst am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, ins Oberfränkische zu reisen. Das Landestheater überzeugt unter Intendant Bodo Busse immer wieder durch einen klugen Mix aus bewährtem Standard-Repertoire und so hörens- wie sehenswerten Ausgrabungen und Raritäten wie beispielsweise „Riders to the Sea“ von Ralph Vaughan Williams in der Saison 2015/16 oder „King Arthur“ in der Spielzeit zuvor. In der nun letzten Spielzeit von Busses Intendanz hat man sich einem Werk von Erich Wolfgang Korngold, von dem sich auf den Bühnen der Welt lediglich die hinreißende „tote Stadt“ dauerhaft hat behaupten können, angenommen.

„Die stumme Serenade“ entstand in den Jahren 1946 bis 1950 und ist eigentlich als Oper konzipiert, Korngold selbst nannte sein Werk aber eine „musikalische Komödie“ und genau das ist es. Ein unvergleichlicher Mix an eingängigen Melodien mit Schlagerqualitäten im besten Wortsinne, spritzigen Texte, einer operettentypisch vertrackten Handlung, Jazz-Elementen und mitreißenden Tanznummern haben mir den vielleicht vergnüglichsten Musiktheaternachmittag seit Jahren beschert. Mit dazu beigetragen haben neben der außerordentlichen Qualität der Komposition das hohe künstlerische Niveau und die schlicht genial zu nennende Umsetzung durch Tobias Materna. Aber der Reihe nach: „Die stumme Serenade“ spielt in den 1820er Jahren, in denen in Neapel auf Frauenraub die Todesstrafe steht. Die umjubelte Schauspielerin Silvia Lombardi, Verlobte des neapolitanischen Ministerpräsidenten Lugarini, wird nachts überfallen und zeitgleich wird unter Lugarinis Bett eine Bombe deponiert. Die Polizei unter Führung des Polizeiministers Caretto tappt im Dunkeln, verhaftet aber schließlich den Schneider von Silvia Lombardi, Andrea Coclé, der in seine Kundin verliebt ist. Ihm droht nun die Todesstrafe und als Caretto ihm verrät, dass der König anlässlich seines 80. Geburtstags den Bombenleger in jedem Fall begnadigen will, gesteht Coclé beide Verbrechen und wird verurteilt. Doch ehe es zur rettenden Amnestie kommt, stirbt der König plötzlich. Das aufgewiegelte Volk stürzt in einer Revolution den verhassten Lugarini und setzt Coclé als neuen Ministerpräsidenten ein. Der Schneider hat eigentlich keine Lust auf Politik und überlässt den Posten gerne dem plötzlich auftauchenden wahren Bombenleger. Nun kann er mit Silvia Lombardi, die sich während der gemeinsam eingenommenen Henkersmahlzeit in ihn verliebt hatte, in eine glückliche Zukunft starten.

Erich Wolfgang Korngold war während des Krieges in die USA emigriert und musste dort sein Dasein als Komponist von Filmmusiken fristen, von denen die zum Erol Flynn-Streifen „Robin Hood, König der Diebe“ hierzulande zu den bekanntesten zählen dürfte. Dieses Umstands eingedenk verlegt Regisseur Tobias Materna die Handlung in die Emigrationszeit des Komponisten, die von 1934 bis 1949 dauerte, und bettet die Handlung an ein Filmset um. So kommt der Zuschauer nicht nur in den Genuss der wunderbaren, von Art Deco-Elementen dominierten Filmkulissen auf der wandelbaren Bühne, die Lorena Diaz Stephens und Jan Hendrik Neidert ihm gebaut haben, sondern vor allem dazu, deren Kostüme zu bestaunen. Die sind in der Tat wahre Kunstwerke, farbenfroh, gewagt, an Haute Couture erinnernd und alleine schon den Theaterbesuch wert. Materna schafft auf Basis der spritzigen Sprech- und Liedtexte von Bert Reisfeld, Raoul Auenheimer und Korngold selbst durch gekonnte Personenführung und immenses Gespür für Timing und feine Komik einen wahrhaft bunten Operettennachmittag. Die Choreografie von Dirk Mestmacher und Daniel Cimpean und das filmreife Licht von André Fischer tun ein Übriges dazu, dass keine Sekunde Langeweile aufkommt.

Das Produktionsteam kann sich aber auch auf ein motiviertes Ensemble verlassen. Anna Gütter verkörpert Silvia Lombardi als Diva mit Herz mit entsprechender Attitüde und überzeugt mit ausdrucksstarkem Sopran. Der junge Salomón Zulic del Canto legt als Couturier Andrea Coclé eine gute Portion balsamischen Schmelz in seinen schmeichelnden Tenor. Felix Rathgeber ist ein wunderbarer Carletto mit profundem Bass und echten Parlando-Qualitäten, Dirk Mestmacher ein solider Reporter voller Spielwitz und Jelena Banković hört man die angesagte Erkältung keine Sekunde an, so schwingt sie ihren beweglichen Sopran in schwebende Höhen und beglückt mit wunderbaren Piani. Auf der schauspielerischen Seite überzeugen der Vollblutkomödiant Thorsten Köhler, der mit charaktervoller Stimme den Despoten Lugarini verkörpert und Stephan Ignaz, der in Travestiemanier als Geschäftsführerin des Modehauses, Laura, für Lacher und Szenenapplaus sorgt. Tief beeindruckt hat mich auch Kerstin Hänel als schüchterne Assistentin Bettina. Die Rolle ist beinahe stumm, aber was sie allein mit ihren ausdrucksstarken Augen, ihrer kompletten Mimik und ihrer Körperhaltung an Komik über die Rampe schickt, ist oscarreif. Auch der Rest der Schauspieler- und Sängerriege bis hin zum letzten Statisten ist ohne Fehl und Tadel und macht aus der Geschichte eine runde Sache. Korngold hat für das Orchester ein kleines Salonorchester, bestehend aus zwei Klavieren, zwei Violinen, Celesta, Cello, Flöte, Klarinette und Schlagwerk vorgesehen. Unter der Leitung von Roland Fister laufen die nicht einmal zwei Handvoll Musiker zu Höchstform auf, erzeugen einen beinahe intimen, stellenweise an Filmmusik erinnernden Klang und erwecken Korngolds wunderbare Melodien mit viel Herzblut zum Leben.

Wenn eine mitreißende Story mit Texten voller Witz, schwelgerisch-wogende Melodien, geniale Garderobe und durchdachte Regie mit beherzt aufspielenden Musikern und talentierten Sängern und Schauspielern zusammen kommt, gehen die zweieinhalb Stunden viel zu schnell vorbei. Sie haben noch bis in den Mai hinein Gelegenheit, sich diese Rarität in Coburg anzuschauen. Ich habe letzteres leider nicht und hoffe deshalb auf eine Wiederaufnahme in der kommenden Spielzeit, damit sich auch für Auswärtige vielleicht noch einmal ein Samstagstermin bietet. Ich komme in jedem Fall. Neugierig macht die Produktion auch auf das, was Tobias Materna und der scheidende Hausherr gemeinsam ab dem 13.05. auf die Bretter des Landestheaters bringen. Dann Inszenieren die beiden Poulencs „La voix humaine“ und die deutsche Erstaufführung von Toshio Hosokawas „The Raven“, ehe Bodo Busse Coburg Richtung Saarland verlässt.
Ihr Jochen Rüth / 21.03.2017
Die Fotos stammen von Andrea Kremper.
KORNGOLD
DIE STUMME SERENADE
Premiere: 25.2. 2017
Vielleicht doch ein Meisterwerk
Gehörte Erich Wolfgang Korngold nicht auch zu den „One-Work-Composern“, die sich mit nur einem Geniestreich in die Operngeschichte eingeschrieben haben? „Die tote Stadt“ ist seit ihrer Wiederentdeckung in den 80er Jahren so etwas wie ein Repertoirestück geworden – der Rezensent kann sich noch an die Sensation erinnern, die die Erstaufführung an der Deutschen Oper Berlin damals bei ihm und beim enthusiasmierten Publikum machte. Herrliche Zeiten…
Doch hat Korngold, den als „Wunderkind“ zu bezeichnen falsch wäre (obwohl er schon als Jüngling erstaunlich reife Werke wie das Ballett „Der Schneemann“ komponierte), mehr als ein schönes Stück geschrieben. Auch „Das Wunder der Heliane“ und „Violanta“ haben ihre Meriten, doch kein Werk hat den Namen Korngolds so befestigt wie „Die Tote Stadt“. An Korngold aber lässt sich eine interessante Beobachtung machen: Große Meister können nicht unter ihrem Niveau komponieren. Das beweisen nicht nur seine hervorragenden Filmscores, die er für Hollywood komponierte, dies beweist auch sein letztes Bühnenwerk. „Die stumme Serenade“ ist kein Meisterwerk, aber man spürt, dass sie nur ein Meister komponiert haben kann.

Korngold hat seine zweiaktige „Komödie mit Musik“, die zugleich Operette, Singspiel und Musical ist, kurz nach dem Krieg geschrieben; uraufgeführt wurde sie 1951: doch nur konzertant (von dieser Aufführung hat sich ein Mitschnitt unter Korngolds eigener Leitung erhalten). Nach der Dortmunder Uraufführung, die erst drei Jahre nach der konzertanten Wiener Premiere und kurz vor Korngolds frühem Tod stattfand, verschwand das Werk von der Bühne. Erst vor etwa 10 Jahren hat man sich in München des Werks erbarmt – und nun kam sie in der Johann-Strauss-Stadt Coburg, die schon deshalb an Korngold erinnert, weil der geniale Komponist einst Strauss' Werke bearbeitet hat, wieder hervor.
Gab es damals gute Gründe, das Werk von den Bühnen zu verbannen? Wenn man es mit Theodor W. Adornos Fortschrittsdogma im ideologischen Gepäck ausdrücken möchte: Selbstverständlich! Denn soviel nostalgischer Charme und harmonische Wohltönung gehörte 1951, im Jahr der Darmstädter Kurse und des grassierenden Serialismus, vulgo: Brutalismus á la Boulez einfach verboten, mochte das Premierenpublikum auch über diese musikalisch und dramaturgisch aus der Zeit gefallene Komödie hoch erfreut sein. Die Kritiker waren es nicht: sie nöhlten – und die hübsche Serenade wurde über 50 Jahre lang zur wahrhaft stummen.

Wer allerdings Vergnügen hat an so etwas Kostbarem wie einem charmanten, zugleich wienerischen und pariserischen Mannequin-Quartett, an wundersam seligen, also im tiefsten Grunde wahren und eben nicht lügenhaften Operettenliedern (das bewegendste: „Freund, du lebst vorbei am Glück“), die so talmihaft wie authentisch klingen und den goldenen Geist der Operette der 20er Jahre ganz ungebrochen in die 50er Jahre und noch in die Gegenwart brachten und bringen: der dürfte sich nicht an der akademischen Frage stoßen, wie „modern“ das Stück im Jahre 1951 war. Selbst die Handlung, die auf den ersten Blick reichlich gemeinplätzig anmutet, besitzt bei genauer Betrachtung den satirischen Biss einer Operette immerhin der 30er Jahre. Da geht es in einem halb fantastischen, halb realen Neapel um den Widerstreit zwischen Liebe und Politik in einer Gesellschaft, die anarchistische Bombenleger geradezu provoziert. Da geht es um Todesurteile und lächerliche Diktatoren, um einen Typen, der halb Mussolini, halb Groucho Marx ist. Da geht es, pointiert ausgedrückt, um eine freilich weniger blutige Variante der „Tosca“, um zwei Operettenpaare „hoher“ und „niedriger“ Prägung und um „schicksalhafte“ Eingriffe in eine Handlung, die natürlich in einem Happy end mündet. Doch hätte das Werk früher geschrieben werden können? Vermutlich haben Korngold und seine Librettisten Raoul Auernheimer, William Okie und Bert Reisfeld kurz nach dem Krieg, als Hitler und Mussolini endlich tot waren, durchaus das Rechte getroffen. Die stumme Serenade oder Eine satirische Operette, die vielleicht ein bisschen zu spät kommen musste.
In Coburg kommt sie nicht zu spät – denn die fabelhafte Anna Gütter ist eine Silvia Lombardi (das Objekt der Anbetung des Damenschneiders Andrea Coclé), die mit ihrer fein timbrierenden und leicht edelmetallischen Stimme Korngolds wunderbare Lieder vollkommen bringt. Anna Gütter ist das, was man früher „eine Erscheinung“ nannte: eine capriziös agierende Operettendiva mit menschlichem Antlitz – und einer bezwingenden Stimme. Ihr Lied „Freund, du lebst vorbei am Glück“ - mit dem sie den komischen Diktator, der seltsamerweise ihr Verlobter ist, um den Kopf des Couturiers bittet – gerät zu einem der emotionalen Höhepunkte der denn doch nicht so banalen Komödie, in dem sich die Tiefe unter der Oberfläche verbirgt.
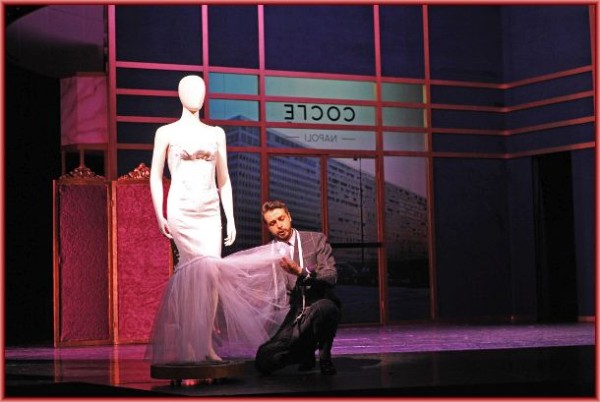
Dass beispielsweise der Modeschöpfer schon schnell einsieht, dass das Amt des Ministerpräsidenten Opfer fordert, die man nicht unbedingt aus Vaterlandsliebe bringen muss, wenn man nicht dazu berufen ist, ist so eine Weisheit, die trivialer daherkommt als sie klingt.
Kein Wunder also, dass Andre Coclé alias Salomón Zulic del Canto sich lieber den Freuden des Modeschöpfens und Minnens hingibt als hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Del Canto singt diesen sympathischen Operettentenor selbst dann mit Verve und strahlendem Ausdruck, wenn er vor einer – freilich mit dem Kleid der Geliebten Schauspielerin fetischistisch drapierten – Schaufensterpuppe steht. Dass die Aussprache bei diesem Stück, das doch auch ein Sprechstück (mit den professionellen Mitgliedern der Abt. Schauspiel des Landestheaters Coburg) ist, bei del Canto ein wenig hapert, ist schade, aber unvermeidlich. Auch sog. Große Häuser können diese anspruchsvollen Partien in sprachlicher Hinsicht nicht immer optimal besetzen. Der Operettenfreund erinnert sich gern daran, dass er einmal eine Silvester-Fledermaus in Coburg sah, die eine kurz zuvor besuchte Wiener Aufführung in Sachen Witz und sprachlicher Kompetenz schlichtweg schlug. Von wegen „Provinz“…

In Coburg enttäuscht Tobias Maternas Inszenierung an diesem enorm umjubelten Abend nicht. Hier besann man sich darauf, dass Korngold auch als Filmmusikkomponist in die Geschichte einging – also spielt die Handlung zum einen vor einem (im übrigen von Jan Hendrik Neidert und Lorena Diaz Stephens herrlich gebauten) Kino der 30er, 40er, 50er Jahre. Dass man mit der „Stummen Serenade“ gleichzeitig einen Film dreht, ist dramaturgisch zu vernachlässigen: Die Andeutungen eines Filmsets bringen für die Handlung so wenig wie sie auch nicht stören. Wenn einmal die Illusion gebrochen wird, dann auf ganz andere, wirklich witzige Weise: als sich das Büro des amtierenden Ministerpräsidenten Lugarini dank Hubpodium um ein Stockwerk hebt, um den darunter liegenden Knast samt unmodisch gestreiftem Schneider zu zeigen, schaut der Mann ziemlich blöd aus der Wäsche: Was passiert da gerade? Hat er etwa zu viel getrunken?
So etwas nennt man, glaube ich, sophisticated oder Der Geist der Komödie der 30er, 40er, 50er Jahre.

Heutig aber sind die kabarettistischen Anspielungen auf einschlägige Sprüche des amtierenden US-Präsidenten: „Looser!“ „Die italienische Presse ist ein Feind des italienischen Volkes“ - das gibt natürlich zurecht Szenenapplaus. Thorsten Köhler spielt den Ministerpräsidenten mit dem zahnbleckenden Lächeln eines Wolfs, dem Schnurrbart eines Machos und der Stimme eines sonoren Reibeisens: ein betörend ruppiger Auftritt samt Türenschlagen und In-offene-Türen-hineinbrüllen. Das ist roh, aber gut. Auch Travestie muss sein: Stephan Ignaz macht Laura, die in den Couturier verliebte Geschäftsführerin des Modesalons, als Charlys Tante: souverän, beifallprovozierend, witzig, wie in den 20er Jahren. Das „komische Paar“, das ganz im Stil der Schlagerzeit der 20er singt („Louise, Louise, du hast was...“) und tanzt, hört auf die Namen Sam Borzalino. Wwer dachte sich diese Namen damals eigentlich aus?… Der Klatschreporter und die „Probierdame“ Louise, das sind Dirk Mestmacher und Jelena Banković. Er spielt gut, sie singt besser; zusammen ergeben sie ein Ganzes. Felix Rathgeber ist ein amüsanter und wohltönend singender Sicherheitschef Caretto, und Kerstin Hänel hat die komische Aufgabe, als Kammerfrau Silvia sich vom Ministerpräsidenten die seltsamsten, weil gerade herumliegenden Gegenstände schenken zu lassen. Was wohl heißen soll: Zwischen Mussolini und einem testosterongesteuerten Berlusconi scheint kaum ein Unterschied zu bestehen…
Und „Die letzte Nacht“? Das amouröse Abschiedssouper, das Bekenntnis der Operettendame „Ich bin zum ersten Mal verliebt“? Auch dies klingt ganz superb. Korngold hat seine Partitur für ein winziges Kammerorchester von nur 8 Musikern eingerichtet. Unter der Leitung Roland Fisters blüht der bekannte, aus Gold und Silber gewirkte Korngold-Klang aus dem Graben auf: samt Klavier und Celesta. Ja, „Die stumme Serenade“ ist ein feines Werk. Sie ist, wie gesagt, kein Meisterwerk – aber je länger der Operettenfreund darüber nachdenkt und den Abend wirken lässt, desto mehr kommt er zur Überzeugung, dass Werke, die von Meistern komponiert werden, unmöglich nicht Meisterwerke sein können. Man muss sie „nur“ adäquat, also mit Charme, Kompetenz und Witz auf die Bühne bringen.
So wie am Landestheater Coburg.
Ps: Auch die Freunde der „Toten Stadt“ dürfen am Abend einmal schmunzeln. Da verkündet die kesse Pariserin Louise vor dem Gericht - das gleich den Schneider aufgrund des Frauenraubs, genauer: des Kussraubs (der in einer entzückenden und durchaus erotischen Szene – wie gesagt: Anna Gütter ist eine „Erscheinung“ - quasi rekonstruiert wird) - zum Tode verurteilen wird, dass Paris eine „Tote Stadt“ wäre, würde man alle Frauenräuber zum Tode verurteilen. Und schwupps! wird die Szene in Blaulicht getaucht, bevor die gesamte Mann- und Frauschaft zu summen beginnt: „Mein Sehnen, mein Wähnen...“
Es muss also nicht immer „Glück, das mir verblieb“ sein…
Frank Piontek, 26.2. 2017
Fotos: Andrea Kremper.
Weibliche Albträume
„Dido & Aeneas“ und „Riders to the Sea“
Premiere: 18.06.2016
Lieber Opernfreund-Freund,
vielleicht fühlt man sich in Coburg deshalb dem englischen Musiktheater so verbunden, weil Albert, der Gatte der englischen Königin Victoria, von hier stammte. Schon in der Spielzeit 2013/14 hatte man hier in Oberfranken dem Gluckschen „Orfeo ed Euridyke“ die nahezu vergessene Kammeroper „Sāvitri“ von Gustav Holst zur Seite gestellt und präsentierte am vergangenen Samstag die gelungene Kombination von Henry Purcells „Dido and Aeneas“ aus dem Jahr 1689 mit dem 1937 uraufgeführten „Riders to the Sea“ des in unseren Breitengraden allenfalls als Sinfoniker und Liedkomponist bekannten und geschätzten Ralph Vaughan Williams. Bei aller Unterschiedlichkeit der beiden Werke lassen sich doch genügend Gemeinsamkeiten finden, um diese Paarung als durchaus gelungen zu bezeichnen: Beide Werke stammen von englischen Komponisten, beide wurden in eher laienhaftem Rahmen uraufgeführt – Purcells Werk wurde an einem Pensionat für Edelfräulein in Chelsea, Vaughan Williams' Oper 1937 von Studenten aus der Taufe gehoben – beide Werke haben thematisch mit dem Meer zu tun und behandeln den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen: Die Titelheldin bei Purcell, Dido aus Vergils „Aeneis“, verliert ihren geliebten Aeneas ebenso an das Meer wie Maurya, die Mutter aus „Riders to the Sea“ ihren Mann, ihren Schwiegervater sowie all ihre Söhne.

Der junge Regisseur Tobias Heyder versucht dennoch nicht, den beiden Opern mit Gewalt eine künstliche Klammer zu geben, sondern zeigt sie als eigenständige Werke. Dabei wählt er jeweils einen Einheitsbühnenraum auf von Tilo Steffens mit wenigen Requisiten genial entworfener, schräger Bühne, auf der bei Purcell Didos Bett dominiert. Denn das Schicksal der Gründerin Karthagos, die Liebe zu Aeneas, die ihr Halt zu Geben scheint, sowie der Abschied von ihm, der sie in dermaßen große Verzweiflung stürzt, dass sie stirbt, zeigt er als Albtraum. Die Traumwelt Didos ist bevölkert von einer skurril anmutenden Zirkustruppe, die einem Fellini-Film entsprungen sein könnte und von Verena Polkowski in so zauberhaft verträumte wie alptraumhafte Kostüme gesteckt wurde. Die Zauberin und die Hexen, die der Königin ihr Glück nicht gönnen und eine Intrige spinnen, erscheinen gleichsam als Alter Egos von Dido und ihren beiden Dienerinnen, allerdings in schwarz gekleidet, blutverschmiert und mit jokerhaftem Grinsen. Hier geht es nicht mehr um die vordergründige, von Vergil erzählte Geschichte, sondern um das innere Dilemma einer Frau, die, zur Witwe geworden, mit sich selbst um ein neues Glück mit einem neuen Partner ringt, um ihre Unsicherheit und ihre Ängste und ihren letztendlichen Entschluss, trotz aller Gefühle für einen anderen Mann und aller Sehnsucht nach Zweisamkeit, alleine zu bleiben – eine wahrlich fesselnde Lesart, die das musikalische Team trefflich umzusetzen weiß.
Zwar hat die Art des Musizierens wenig mit der so genannten „historisch geschulten Aufführungspraxis“ zu tun, zu beschwingt, zu blumig ist das Dirigat von GMD Roland Kluttig, und erinnert eher an die weichgespülte Aufnahme des Werkes, die in den 1950er Jahren unter Benjamin Britten mit Claire Watson für die BBC entstand, als das, was man seit Ende des 20. Jahrhunderts von Nikolaus Harnoncourt & Co. gewohnt ist. Da gibt es eher romantisch anmutende Ritardandi denn nüchtern zurückhaltende Barockmusik, doch meines Erachtens kann man heutzutage ein barockes Werk noch immer so präsentieren, sollte allerdings zumindest in den Schlüsselmomenten einen Gang zurückschalten, um die Musik ihre Wirkung entfalten zu lassen – und das gelingt Kluttig nicht immer. Abstriche muss man leider auch bei der Interpretin der Titelheldin machen. Ensemblemitglied Verena Usemann verfügt über eine wunderbare Stimme mit intensiven Nuancen und präsentiert nach anfänglichen Intonatiosschwierigkeiten, die sicher dem Premierenfieber geschuldet sind, eine entschlossene und starke Frau. Das passt zwar zu Kluttigs musikalischer Interpretation, allerdings ist mir ihre Stimme für die Dido als verwundete wie verwundbare Frauenfigur fast zu groß. So verpufft die Wirkung des Lamento, da die durchaus talentierte und genial schauspielernde Sängerin nicht einmal da ein Piano findet. Schade. Ihr „inneres Gegenstück“, Gabriela Künzler als Zauberin, spielt überzeugend auf und weiß ihrem Mezzo beinahe androgyne, bedrohliche Farben beizumischen, die bezaubernde Belinda von Ana Cvetkovic-Stojnic überzeugt mit ebenso einfühlsamem, farbenreichem Sopran wie Nadja Merzyn als 1. Hexe, Stefanie Schmitt als zweite Frau und ihr Pendant Heidi Lynn Peters als zweite Hexe sind einfach wunderbar. Vom Opernstudio Weimar ausgeliehen und ab der kommenden Spielzeit festes Ensemblemitglied in Coburg ist der 29jährige Salomón Zulic del Canto – und als Aeneas eine echte Entdeckung. Sein geschmeidiger Bariton ist wie gemacht für den smarten Helden, der Didos Herz erobert, und macht den jungen Sänger zu einer meiner persönlichen Überraschungen des Abends. Bravo! Jan Korab glänzt in seinem kurzen Auftritt als Seemann, warum man aber die klangschöne Stimme von Luise Hecht als Geist durch blechern klingende Lautsprecher einspielen muss, wo man die Sängerin doch gut und durchaus sinnvoll unter den Gauklern hätte platzieren können, bleibt mir ein Rätsel. Wahrlich als zusätzliche Person nach barockem Vorbild tritt der von Lorenzo Da Rio gründlich einstudierte Chor auf und überzeugt nicht nur stimmlich sondern auch darstellerisch und bildet – ein toller Regieeinfall – an so mancher Stelle an Renaissancegemälde erinnernde Kulisse.

Hat mir der erste Teil des Abends bei aller Begeisterung noch den einen oder anderen Wermutstropfen beschert, konnte der zweite auf ganzer Linie überzeugen. Die Partitur von Ralph Vaughan Williams kommt naturgemäß wesentlich schroffer und düsterer daher als Purcells Werk und scheint Roland Kluttig und dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg auch mehr zu liegen. Hier können sich die Musiker in schwelgerischen Bögen ebenso suhlen, die den schicksalshaften Wogen des Meeres gleich aus dem Graben erklingen, wie die Passagen auskosten, die beinahe an Filmmusik erinnern oder von fast groben Dissonanzen geprägt sind. In Ralph Vaughan Williams' Werk, dessen Libretto er fast wörtlich dem gleichnamigen Stück des Iren John Millington Synge entnommen hat, leben Maurya und ihre Töchter Cathleen und Nora auf einer Insel vor der Westküste Irlands. Maurya hat nicht nur ihren Mann und Ihren Schwiegervater an das Meer verloren, auch vier ihrer sechs Söhne sind beim Fischen ertrunken. Nun wird ihr Sohn Michael seit mehr als einer Woche vermisst und Sohn Bartley schickt sich an, mit dem Pferd aufs Festland überzusetzen, um es dort zu verkaufen. Die Mutter kommt um vor Sorge und weiß noch nicht, dass ein Priester die Kleidung von Michael an die beiden Töchter übergeben hat. Sie wurde an Land gespült. Sie macht Bartley Vorwürfe und er geht ohne Proviant und ohne Abschied. Die Töchter überzeugen die Mutter, dem Sohn nachzugehen. Sie berichtet nach Ihrer Rückkehr, sie habe die Söhne Michael und Bartley zusammen auf zwei Pferden gesehen. Just als die Töchter ihr sagen, dass das unmöglich ist, weil Michael tot ist, tragen Männer die Leiche von Bartley herein: Das Fohlen hatte ihn von der Klippe gestoßen und er ist ertrunken.
 Die Trostlosigkeit der Situation der Inselbewohner zeigt sich nicht nur in düsteren Orchesterfarben und der schwarzen und grauen Kleidung. Die Frauen sind mit dem Falten von Männerwäsche beschäftigt, die ihren verstorbenen Brüdern und Kindern gehörte. Die lange Tafel, die einmal elf Erwachsenen Platz bot beherrscht das Bühnenbild. Die Verstorbenen sind so omnipräsent, die Hinterbliebenen können nicht loslassen. Die Frauen sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Trauer. Jede versucht auf ihre Art, mit dem Schicksal umzugehen: Maurya scheint ihr Schicksal schlicht anzunehmen und zu ertragen und findet in Kora Pavelic eine geniale Sängerdarstellerin, die der Mutter mit unvergleichlicher Intensität und Wahrhaftigkeit Leben einhaucht – stimmlich wie darstellerisch. Wow! Ensemblemitglied Anna Gütter verkörpert im wahrsten und besten Wortsinn Nora, die am verzweifelsten scheint. Nadja Merzyn, ebenfalls im Ensemble des Landestheaters, ist Cathleen, die erst dann ihre Verzweiflung und Trauer zu zeigen vermag, als der Tod des sechsten Bruders traurige Gewissheit ist. Auch bei diesem Werk zeigt sich das Talent von Tobias Heyder, ohne viel Schnickschnack auf das Wesentliche zu reduzieren und eine besondere Form des Realismus zu erzeugen, die einem unter die Haut geht. Salomón Zulic del Cantos Auftritt als Bartley ist hier vergleichsweise kurz, doch zeigt der junge Chilene eine ganz andere, nicht weniger überzeugende Stimmfarbe als noch als Aeneas eine halbe Stunde zuvor. Tomoko Yasumura und Joanna Star ergänzen als Chorsolisten in kleinen Rollen.
Die Trostlosigkeit der Situation der Inselbewohner zeigt sich nicht nur in düsteren Orchesterfarben und der schwarzen und grauen Kleidung. Die Frauen sind mit dem Falten von Männerwäsche beschäftigt, die ihren verstorbenen Brüdern und Kindern gehörte. Die lange Tafel, die einmal elf Erwachsenen Platz bot beherrscht das Bühnenbild. Die Verstorbenen sind so omnipräsent, die Hinterbliebenen können nicht loslassen. Die Frauen sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnung, Verzweiflung und Trauer. Jede versucht auf ihre Art, mit dem Schicksal umzugehen: Maurya scheint ihr Schicksal schlicht anzunehmen und zu ertragen und findet in Kora Pavelic eine geniale Sängerdarstellerin, die der Mutter mit unvergleichlicher Intensität und Wahrhaftigkeit Leben einhaucht – stimmlich wie darstellerisch. Wow! Ensemblemitglied Anna Gütter verkörpert im wahrsten und besten Wortsinn Nora, die am verzweifelsten scheint. Nadja Merzyn, ebenfalls im Ensemble des Landestheaters, ist Cathleen, die erst dann ihre Verzweiflung und Trauer zu zeigen vermag, als der Tod des sechsten Bruders traurige Gewissheit ist. Auch bei diesem Werk zeigt sich das Talent von Tobias Heyder, ohne viel Schnickschnack auf das Wesentliche zu reduzieren und eine besondere Form des Realismus zu erzeugen, die einem unter die Haut geht. Salomón Zulic del Cantos Auftritt als Bartley ist hier vergleichsweise kurz, doch zeigt der junge Chilene eine ganz andere, nicht weniger überzeugende Stimmfarbe als noch als Aeneas eine halbe Stunde zuvor. Tomoko Yasumura und Joanna Star ergänzen als Chorsolisten in kleinen Rollen.

Das Publikum, das wohl Fussball-EM- und sonnenscheinbedingt nicht ganz so zahlreich erscheinen ist, applaudiert begeistert und zu Recht, zeigt sich doch an diesem Abend, wie viel es wert ist, wenn ein Theater den Nachwuchs fördert – und fordert. Das Landestheater Coburg erweist sich als regelrechte Talentschmiede und der Zuschauer bekommt dank dieses Ansatzes von Intendant Bodo Busse einen durchaus lohnenden Abend geboten mit jungen, frischen, engagierten Sängern voller Spielfreude und einer überzeugenden Regie. Bleibt zu hoffen, dass den folgenden Aufführungen mehr Besucherzuspruch zuteil wird – EM hin oder her. Zur Not besuchen sie eben eine Aufführung in der kommenden Spielzeit – denn da wird die Produktion wiederaufgenommen!
Ihr Jochen Rüth / 20.06.2016
Die Bilder stammen von Andrea Kremper.
DER ROSENKAVALIER
Besuchte Aufführung: 10.4.2016
Premiere. 6.3.2016
Schöne Erzählweise ohne innovativen Anspruch
Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ stellt mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen für jedes Opernhaus dar. Das aufzubietende Personal ist beträchtlich und der Orchesterapparat sehr ausgedehnt. Dennoch kommen immer wieder auch an sog. kleinen und mittleren Häusern beachtliche Aufführungen des Werkes zustande, wie jetzt am Landestheater Coburg. Dass dieses lobenswerte kleine Theater die Fähigkeit besitzt, dieses gewaltige Stück auf die Bühne zu bringen, wurde schon im Jahre 1911 deutlich. Bereits einige Monate nach der umjubelten Dresdener Premiere wurde es von dem damaligen Coburger Intendanten Oscar Benda auf den Spielplan gesetzt und Strauss höchstpersönlich als Dirigent in den Orchestergraben geschickt.

Verena Usemann (Octavian), Betsy Horne (Feldmarschallin)
Von dieser Aufführung waren im Fundus des Coburger Landestheaters noch zahlreiche Kostüme und Figurinen vorhanden, auf die Sven Bindseil dann auch für die Neuproduktion zurückgriff. Er hat die vorgefundenen Kostüme in einer Art und Weise bearbeitet, dass es eine Freude war. Alt und verstaubt haben diese dem Rokoko verpflichteten Kleider in keinster Weise gewirkt, sondern frisch und farbenreich. Besonders der Detailreichtum, mit dem Bindseil ans Werk ging, war sehr bemerkenswert. Diese Kostüme waren eine wahre Augenweide und trugen nicht zu knapp zum Erfolg der Vorstellung bei.

Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau), Verena Usemann (Octavian), Betsy Horne (Feldmarschallin)
Was an diesem Nachmittag über die Bühne des Landestheaters Coburg ging, war in hohem Maße publikumswirksam. Die überaus zufriedenen Zuschauer sparten dann am Ende auch nicht mit herzlichem Applaus und einigen begeisterten Bravorufen. Geistig und intellektuell wurde den Besuchern allerdings nicht viel abverlangt. Es konnte sich gemütlich zurücklehnen und die Aufführung genießen, denn Jakob Peters-Messer, der in Coburg kein Unbekannter mehr ist, stellte bei seiner Neuproduktion an das Auditorium nicht zu hohe Ansprüche, hat aber den Kern des Stückes voll und ganz getroffen. Er versteht Strauss’ Werk, in dem es u. a. um das gnadenlose Verrinnen der Zeit geht - die Feldmarschallin spricht es deutlich aus -, als „Komödie mit Trauerflor“, die er mit Hilfe einer ausgefeilten, spritzig-lebendigen Personenregie und einer gelungenen Massenchoreographie auch genauso in Szene setzte.

Betsy Horne (Feldmarschallin)
Markus Meyer hat ihm einen von Schwarz-Weiß-Gegensätzen bestimmten Raum geschaffen, der von teils prächtigen, teils etwas marode wirkenden weißen Wänden dominiert wird. Mit Hilfe der Drehbühne lassen sich immer wieder neue Räume herstellen, so das Schlafzimmer der Marschallin, ihr Vorzimmer, das Palais des von der Regie reichlich schnöde gezeichneten Herrn von Faninal sowie das Wirtshaus des Schlussaktes. Ein visueller Höhepunkt der Aufführung war die Überreichung der silbernen Rose, in der Octavian vor einer Spiegelwand auf einem mannshohen künstlichen Ross sitzt. Elegant hält er die Rose in die Höhe während Sophie entzückt in sich zusammensinkt. Es sind schon recht vielfältige Eindrücke, die dem Auge hier geboten werden, die aber durchweg recht gefällig wirken. Diese wohltuende Optik war wahrlich ein Labsal für die Sinne.

Sophie, Verena Usemann (Octavian)
Schade war nur, dass Strauss’ Werk auf diese Weise etwas zum reinen Ausstattungsstück verkam. Bei aller Schönheit des äußeren Rahmens wäre etwas mehr Interpretation seitens des Regisseurs wünschenswert gewesen. Darauf hat er aber leider verzichtet. Zwar bieten er und sein Team dem Auge viel, dem neugierigen Intellekt aber gar nichts, was schade ist. In dem geschilderten konventionellen Rahmen bewegt sich Peters-Messer durchweg nah am Textbuch, ohne das in dem Werk zweifellos enthaltene Auslegungspotential zu berücksichtigen. Er erzählt technisch perfekt und schnörkellos eine kurzweilige Geschichte, setzt sich mit dieser aber nicht auseinander und deutet deren Subtext nicht aus, was schade ist. Etwas mehr Tiefgang wäre schon schön gewesen. Hier ist eine Chance vertan wurden.

Sophie, Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau), Verena Usemann (Octavian), Chor des Landestheaters Coburg
Gesanglich hat das Landestheater Coburg einmal mehr sein hohes Niveau nachhaltig unter Beweis gestellt. An erster Stelle ist hier Betsy Horne zu nennen, die in der Rolle der Feldmarschallin voll aufging. Darstellerisch gab sie eine mal melancholische, mal leidenschaftliche, aber stets ganz über den Dingen stehende Frau, die vergeblich gegen das Verrinnen der Zeit ankämpft. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem hervorragend fokussierten, differenzierten, farben- und nuancenreichen jugendlich-dramatischen Sopran zu begeistern. Schauspielerisch sehr vielseitig zeigte sich Verena Usemann, die dem Octavian mit ihrem emotional angehauchten, bestens gestützten und wandelbaren Mezzosopran auch vokal gut entsprach. Eine äußerlich recht temperamentvolle und energiegeladene Sophie war Ana- Cvetkovic-Stojnic. Gesanglich stand sie mit in jeder Lage gut verankertem und über eine schöne Pianokultur verfügendem lyrischem Sopran ihren beiden Mitstreiterinnen in nichts nach. Kein Wunder, dass das Terzett der drei Damen im dritten Aufzug zum Höhepunkt der Aufführung wurde. Ausgezeichnet war auch Michael Lion, der mit markantem, vorbildlich italienisch fundiertem und differenziert eingesetztem Bass einen äußerlich ungehobelten, nichtsdestotrotz aber auch lustigen und nicht unsympathischen Baron Ochs auf Lerchenau sang. Schönes sonores Bariton-Material brachte Peter Schöne für den Herrn von Faninal mit. Trefflich mit locker ansprechendem Sopran bewältigte Heidi Lynn Peters die Höhenflüge der Marianne Leitmetzerin. Solide sang die Annina von Emily Lorini, während Dirk Mestmachers darstellerisch tadelloser Valzacchi reichlich dünn und kopfig klang. Feinen lyrischen Wohlklang verbreitete Milen Bozhkov mit der Arie des Sängers. Nach mehr hörte sich David Zimmer an, der mit frischem, breit klingendem Tenor die kleinen Rollen des Haushofmeisters bei Faninal und des Wirtes aufwertete. Flachstimmig präsentierte sich dagegen Sascha Mai als Haushofmeister der Marschallin. In der Doppelrolle des Polizeikommissars und des Notars gefiel mit tadelloser Bassstimme Felix Rathgeber. Monika Tahal (Modistin) und Marino Polanco (Tierhändler) rundeten das Sängerensemble ab. In der stummen Rolle des hier zur alten Frau umgedeuteten Mohammed war Christa Fedder zu erleben. Als Ochs’ Sohn Leopold erschien Ruslan Wacker auf der Bühne. Wieder einmal in überzeugender Form präsentierte sich der von Lorenzo da Rio einstudierte Opernchor des Landestheaters Coburg. Leider war im dritten Akt der Kinderchor mit seinen „Papa“-Rufen kaum zu hören.

Verena Usemann (Octavian), Michael Lion (Baron Ochs auf Lerchenau)
Bei GMD Roland Kluttig war Strauss’ Oper in besten Händen. Zusammen mit dem brillant aufspielenden Philharmonischen Orchester Landestheater Coburg entfaltete er einen opulenten Klangrausch voller Intensität und schwelgerischer Inbrunst. Bezeichnend war, dass der Dirigent trotz der manchmal sehr imposanten Klangwogen die Sänger/innen nie zudeckte. Das war wahrlich ein Fest für die Ohren.
Fazit: Ein schöner, wenn auch nicht sonderlich aufregender Opernnachmittag, der sich aber wegen der größtenteils hervorragenden Sänger und dem ausgezeichneten Dirigenten gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 11.4.2016
Die Bilder stammen von Andrea Kremper
NORMA
TRAILER
Premiere am 19.9. 2015.
Bayreuther Gastspiel (Stadthalle) am 17.11. 2015
So weiß man, was gemeint ist
Normalerweise ist in Bayreuth das Haus knallevoll, wenn Richard Wagner auf dem Programm steht – es sei denn, dass das Haus nicht auf dem Hügel steht….
Theoretisch hätte dies auch am Dienstag, dem 17.11. 2015, der Fall sein können, als ein Werk „unseres“ Komponisten hier nicht nur auf-, sondern sogar erstaufgeführt wurde. Freilich erfuhr man dies erst aus der Lektüre des Programmhefts – wer Bellinis Oper „Norma“ besucht, erwartet nicht, damit auch eine Nummer Richard Wagners zu hören. Hier aber war's der glückliche Fall: denn das Theater Coburg integrierte in seine Aufführung von Bellinis Meisteroper die dramaturgisch bedingte wie wirkungsvolle Einlegearie Norma il predisse, o Druidi, die Wagner 1839 in Paris komponiert hat. Nein, leer war die Stadthalle diesmal nicht. Für ein Werk, das zwar ein Schlüsselwerk der Oper ist, aber nur selten gespielt wird, war das Haus sogar ordentlich gefüllt. Vielleicht ahnten die Opernfreunde ja, dass Bellini der einzige Opernkomponist war, den Wagner von seinen Jugendjahren bis in die letzten Tage vorbehaltlos schätzte. Er wusste, dass Bellini mit „Norma“ kein austauschbares Werk, also eine unter tausend anderen „italienischen Opern“, geschrieben hatte. Berühmt wurden seine Zeilen, die er schon 1837 dem sizilianischen Genie gewidmet hatte: die Deutschen sollten sich ein Vorbild an seiner Gesangskultur nehmen. „Norma“ ist ein Werk im Übergang zum Musikdrama, das noch über alle Reize der romantischen Oper des Südens verfügt. Bellini und sein Librettist Felice Romani schufen mit der „Tragedia lirica“, trotz aller Schlankheit des Stimmsatzes, trotz aller Linearität der berühmten wie nicht allein von Verdi gerühmten „langen, langen, langen“ Melodien, ein Werk im Vorfeld des Wagnerschen Musikdramas, in dem schon Elsa (Ihr Gerichtsauftritt), Tristan und Isolde (die Exzesse des 2. Akts) sachte ahnbar werden. Ebenso wie die Vorläuferschaft zu Verdis frühen Meisterstücken. „Was Norma zu etwas Außergewöhnlichem macht“, schrieb John Rosselli in seiner Bellini-Biographie, „ist, dass das Werk durch seine musikalische Organisation tragische Größe erreicht.“

Wer „Norma“ sagt, denkt vielleicht zugleich auch „Callas“, denn Maria Callas war bekanntlich die Norma des 20. Jahrhunderts. In keiner Rolle stand sie häufiger auf der Bühne: in insgesamt 90 (von 500) Callas-Opernauftritten. In Coburg ist die Intendanz tatsächlich n der Lage, diese höchst anspruchsvolle Partie, die vom Lyrischen bis zum kontrolliert Dramatischen über alle Nuancen verfügen muss, ausgesprochen gut zu besetzen. Celeste Siciliano besitzt ein Timbre und eine Durchschlagskraft, die in einigen wenigen Momenten tatsächlich an die Callas denken lässt, den dramatischen Spitzen räumt sie genügend Platz ein, der berühmte Bellinische Schönklang kommt auf seine Kosten – und die berühmte „Nummer“ „Casta diva“ kommt mit seinem ganzen Weihetonfall traumhaft gut. Ihr zur Seite steht mit der Adalgisa Kora Pavelics eine Partnerin, deren Sopran sie in den wirklich glänzend gemachten Duetten geradezu schwesterlich ergänzt. Selbst das Charakterschwein Pollione, der militärische und sexuelle Okkupant der gallischen Unterdrückten, singt bei Milen Bozhkov einfach schön. Freilich artikuliert er bisweilen so „heldenhaft“ wie ein Verdi-Tenor, doch muss Richard Wagners berühmtem Wort - Bellinis Melodien seien schöner als Träume – nicht widersprochen werden. Bellinis Musik zielt auch in Coburg auf eine ästhetische Qualität, der sich die Zuhörer nicht entziehen können. Sie vollzieht auch orchestral das musikalische Drama: hat Bellini seinen Orchestersatz bewusst schlicht angelegt, so spielt das Philharmonische Orchester des Landestheaters Coburg unter der Leitung Alexander Merzyns einen kräftigen Bellini, der den rechten Ausgleich zwischen delikater Lyrik und jenem Temperament findet, das der Normalzuhörer von der italienischen Oper der Romantik erwartet. „Gemetzel, Vernichtung, Rache“, der bewusst primitiv komponierte „Guerra“-Chor, der später zu einer Hymne der Aufständischen gegen die Habsburger werden sollte, wird angemessen roh, das letzte, rauschhafte Finale wunderbar gebracht.

Die Inszenierung Konstanze Lauterbachs entspricht der Genauigkeit, mit der Bellini die Worte vertont hat, auf sehr detaillierte Weise. Ohne das Drama mit allzu aktualisierenden Bildern zu knechten, holt die Regie die Geschichte von der unkeusch kollaborierenden Priesterin und dem Volksaufstand in eine eher symbolische Gegenwart. Es reicht, dass wir auf einen von Karen Simon erdachten Prospekt mit Öltürmen und einen stilisierten Turm, dann auf einen Prospekt mit einer kaputten Winterlandschaft schauen, um zu begreifen, dass das Thema von Macht und Wirtschaft nicht von gestern ist. Es beginnt mit der Auspeitschung eines Aufständischen und endet, naja, auf einem Scheiterhaufen, der von den berühmten schwarzen Müllsäcken umrankt wird, die wir aus dem sonnigen Süden kennen. Schwachsinn mit Musik, wie man zu sagen pflegt – und dann Norma und Pollione gemeinsam auf den Haufen steigen, macht das Finale nicht besser, sondern nur falscher. Musik und Text sagen nämlich, pardon, dass hier kein „Liebestod“ stattfindet, sondern eine entfremdete Frau zum Tode geht, die am Ende nur noch ein Interesse hat: ihre Kinder im Sinne einer matrilinearen Geschlechterordnung in Sicherheit zu wissen. Polliones letzter Satz aber ist reines Wunschdenken. Man mag auch darüber rätseln, welche Bedeutung das Logo der Freiheitskämpfer hat. Wird hier ein (gallischer) Schnurrbart auf einer Art Stecken abgebildet? Haben wir es mit einer stilisierten „Irminsäule“ zu tun? Hat das Zeichen überhaupt eine konkrete Bedeutung?

Das Wesentliche aber, da hat Frau Lauterbach recht, spielt sich in Bellinis sensitiver Musikdramatik auf einem ganz anderen als dem politischen oder historischen: dem emotionalen Gebiet ab. Die unvermeidlichen Regieeinfälle wirken nicht aufgesetzt, auch wenn manch Symbolismus eher schlicht wirkt. Manches wird vielleicht im Gedächtnis bleiben: das junge Mädchen, das Norma in ihrer Arie an den Mond (diesem Symbol des Matriarchats) als Double ansingt, die blutrot gewandete Frau, die während Polliones Arie mit einem 20 Meter langen Schleier über die Bühne läuft. Konstanze Lauterbach gönnt, in der fatalen Begegnung von Norma, Adalgisa und Pollione, sogar dem untreuen Bigamisten einige Momente des Schmerzes: der Einsicht – oder der Qual eines unseligen Verführers. Kommt Besuch in Normas Haus, so werden die Kinder in den Kasten gesteckt, und freut sich Norma, so tanzt ihre Vertraute Clotilde im Kreis. Sonst läuft Norma rückwärts, wenn es ganz und gar nicht mehr vorwärts zu gehen scheint. Der Einfall (eine „Laus der Regie“, wie der gute Regisseur Heiner Müller gesagt hat) könnte von Peter Paul Pachl stammen: als Auswuchs eines Dramaturgentheaters, das solche Einfälle doch kaum nötig hätte.

Indes: Man hat schon Schlimmeres gesehen. Die Hauptsache in dieser musikdramatisch inspirierten Oper aber bleibt doch die Musik, bleiben die feinen Züge der Emotionen, die von der Regie nicht denunziert werden. Singt Norma auch im gewichtigen Terzett (das das Wort vom alleinigen „Lyriker“ Bellini Lügen straft) ihre Rache gegen den Geliebten in die Luft, so weiß man, was gemeint ist.
Auf jeden Fall aber wird des strengen Vaters Oroveso Einlegearie bleiben, die von Michael Lion zusammen mit dem Chor beeindruckend gebracht wird. Wagner diente sich seinem musikalischen Gott an und blieb doch Wagner. Faszinierend zu hören, wie sich der Komponist der „Norma“, des „Rienzi“ und des „Liebesverbots“, vor allem im Nachspiel der Arie mit Chor, hier begegnet sind. Der Rest war purer Bellini – ein musikalisch hinreißendes und szenisch meist intelligentes Drama, das nicht nur deshalb gut ist, weil Wagner es so geliebt hat.
Frank Piontek
Fotos: Andrea Kremper
LA BOHÈME
Besuchte Aufführung: 15.11.2015 (Premiere: 13.6.2015)
Frohsinn im zerstörten Paris
Zu einem einhelligen Erfolg für alle Beteiligten geriet die Aufführung von Puccinis „La Bohème“ am Landestheater Coburg. Mit diesem Stück, dessen Premiere bereits im vergangenen Juni über die Bühne ging, ist Ks Brigitte Fassbaender an den Ort ihrer ersten Regiearbeit überhaupt zurückgekehrt. Was sie und ihre Bühnen- und Kostümbildnerin Bettina Munzer auf die Bühne gebracht haben, war durchaus beachtlich.

Ensemble, Chor und Kinderchor
Die Damen Fassbaender und Munzer haben die Oper in eine karge, nüchterne Trümmerlandschaft verlegt. Das Einheitsbühnenbild dominieren die Ruinen ehemals ansehnlicher Häuser, in die die verschiedenen Szenen einfühlsam eingepasst werden. Regisseurin und Bühnenbildnerin lassen das Stück in einem zerstörten Paris kurz nach der Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft spielen. Nun mag so mancher diesen Regieeinfall mit der Begründung für verfehlt halten, dass Paris den Zweiten Weltkrieg doch heil überstanden und keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Das ist indes nur teilweise richtig. So ganz ungeschoren davongekommen ist die französische Metropole nicht. Zwar wurde Paris von Kommandant Dietrich von Choltitz am 25. 8.1944 nahezu unbeschädigt an die vorrückende Zweite französische Panzerdivision übergeben, aber bereits wenig später, in der Nacht von 26. 8. auf den 27.8.1944, unternahm die deutsche Luftwaffe einen Bombenangriff auf Paris, bei dem cirka 600 Gebäude zerstört oder beschädigt wurden. Demgemäß hat der Einfall des Regieteams, Paris in Trümmern liegend vorzuführen, durchaus seine Berechtigung. Vordergründiger Kitsch wird auf diese Weise vermieden.

Celeste Siciliano (Mimi), Michael Bachtadze (Marcello)
In diesem düsteren Ambiente entfaltet sich der Frohsinn der Bohèmiens nur umso stärker. Den kargen Verhältnissen treten sie mit ausgemachter Ausgelassenheit gegenüber. Dieser wirkt in Frau Fassbaenders Deutung im Gegensatz zu anderen Inszenierungen an keiner Stelle aufgesetzt, sondern stets wahrhaftig. Dabei besteht eigentlich kein Grund zur Heiterkeit. Die Protagonisten leben in größter Armut. Ihr bescheidenes Heim besteht lediglich aus einem Doppelbett mit Nachttisch, einem Stuhl und einer Tonne, in der ein Feuer brennt. Ein im Hintergrund aufgestellter Tisch samt Stühlen symbolisiert das Café Momus. Hier haben Marcello, Colline und Shaunard im ersten Bild bereits Platz genommen, während sich im Vordergrund die Szene zwischen Rodolfo und Mimi abspielt. Offensichtlich kennen sich die beiden seit geraumer Zeit und haben sich schon längst ineinander verliebt. Ihr jetziges Verhalten spricht Bände. Damit befreit Brigitte Fassbaender diese Szene von dem Ballast der Unglaubwürdigkeit.

Anna Gütter (Musetta), Statisterie
Auch diese Absage der Regisseurin an die Liebe auf den ersten Blick ist ein überzeugender Regeinfall, der sich von herkömmlichen Deutungsmustern etwas entfernt, was dem Werk indes gut bekommt. Frau Fassbaender wartet hier schon mit einigen modernen Ideen auf, die ganz im Widerspruch zur Tradition stehen, aber herrlich erfrischend wirken. Das hätte man von ihr nicht erwartet. Durchaus nachvollziehbar lässt sie im demolierten Paris Schmuggler im Trenchcoat und mit Aktentaschen auftreten, die versuchen, ihre illegalen Waren an den Mann zu bringen, was aber gar nicht so einfach ist. Der von der Regie hier nicht zur Karikatur degradierte, sondern ernst genommene Pariser Polizeichef Alcindoro scheint ein scharfes Auge auf die Schwarzhändler zu haben. Mehr Glück hat der Weihnachtsmann Parpignol, der seine Süßigkeiten problemlos an die französische und amerikanische Fahnen schwingenden Kinder loswird. An die Stelle der herkömmlichen Zollstation tritt im dritten Bild eine simple Parkbank, auf der am Ende der Szene die beiden Liebespaare gemeinsam Platz nehmen. Nicht ganz der Konvention entspricht auch der vierte Akt, in dem die Bohemièns in ihrer Ausgelassenheit kurzerhand das Bett abbauen und es auch dann nicht wieder herrichten, als die todkranke Mimi hereintritt. Ihr wird aus Laken und Kissen eine Lagerstatt auf der Erde im linken Teil der Bühne bereitet - auch das war ein Einfall, der für Frau Fassbaender eher untypisch ist. Sie hat ihre Produktion schon mit mancher ungewöhnlichen Idee angereichert, die viel szenische Abwechslung in den Nachmittag brachte.

Michael Bachtadze (Marcello)
Gesanglich bewegte sich die Aufführung auf hohem Niveau. Celeste Siciliano sang die Mimi mit einem in allen Lagen sauber ansprechenden und ebenmäßig geführten lyrischen Sopran, der neben zarten lyrischen Ergüssen auch zu großer Expansion fähig war. Neben ihr war José Manuel ein junger, frisch und aufgeweckt spielender Rodolfo, der seinem Part mit hellem, differenziert und nuancenreich geführtem Tenor auch stimmlich voll gerecht wurde. Lediglich das hohe c am Ende von „Che gelida manima“ hätte man sich noch etwas runder gewünscht. Nichts auszusetzen gab es an Michael Bachtadze, der einen profunden, bestens fokussierten Bariton für den Marcello mitbrachte, den er auch ansprechend spielte. Nicht durchweg schnippisch legte Anna Gütter die Musetta an, vielmehr setzte sie mit ihrem ausgereiften, voll und sonor klingenden Sopran auf lyrische Eleganz, was der Partie gut bekam. Hier wächst eine gute Mimi heran. Einen geradlinigen, solide verankerten Bass brachte Felix Rathgeber für den Colline mit. Sehr ordentlich schlug sich auch der über beachtliches Bariton-Material verfügende Jiri Rajnis als Schaunard. In der Doppelrolle des Benoit/Alcindoro gefiel Michael Lion. Marino Polanco hätte den Parpignol mit etwas runderem Stimmklang singen können. Martin Trepl (Sergeant), Marcello Mejia-Mejia (Zöllner) und Valentin Fruntke (Kellner) rundeten das homogene Ensemble ab. Auf hohem Niveau bewegte sich der von Lorenzo Da Rio exellent einstudierte Opernchor und Extrachor des Landestheaters Coburg.
Am Pult schöpfte Roland Fister aus dem Vollen. Er animierte das bestens disponierte, konzentriert aufspielende Philharmonische Orchester Landestheater Coburg zu einem feurigen, intensiven und temperamentvollen Spiel, das indes leider manchmal etwas zu laut ausfiel und die Sänger in den Klangmassen nicht nur einmal untergehen ließ.
Fazit: Ein in jeder Hinsicht gelungener Nachmittag, der die Fahrt nach Coburg wieder einmal voll gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 17.11.2015
Die Bilder stammen von Andrea Kremper
DER VOGELHÄNDLER
Vorstellung 11.10.2015
Premiere 02.05.2015
Operette wie im Märchenwald verzaubert das Publikum
Gastregisseur Volker Vogel zeigt, dass die Operette – wenn sie richtig verstanden und inszeniert wird – unsterblich ist und „Der Vogelhändler“ wird zum sorgenfreien Vergnügen. Ich habe mich gefreut, wieder einmal in das kleine, wunderschöne Theater Coburg zu fahren. Das lag daran, dass ich viele Coburger Inszenierungen in der Vergangenheit in Bamberg erleben konnte, da aber die neue Bamberger Intendantin das Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater als musikfreie Zone erklärt hat, finde ich wieder den Weg in die Vestestadt.

Mitte Dirk Mestmacher, Adam und Ensemble
Und er hat sich, das kann man gleich zu Beginn sagen, wahrlich gelohnt. Ich habe schon viele Vogelhändler-Aufführungen erlebt, aber eine solche bunte, farbenprächtige, lebendige und stimmige, wie hier in Coburg fast nie. Der Gastregisseur, der Schweizer Volker Vogel, der als früherer Tenor-Buffo genau weiß, wie Operette gespielt werden muss und dies als Regisseur bei den Operettenfestspielen in Hombrechtikon, als Oberspielleiter der musikalischen Komödie Leipzig auch immer wieder aufs Neue eindrucksvoll beweist, hat alle Register einer überzeugenden Inszenierung gezogen. Er verknüpft die Musik aufs beste mit der Szenerie, alles ist aufeinander abgestimmt und er inszeniert so wunderbar herrlich altmodisch. Und das Publikum geht begeistert mit, es will keine Neudeutung der Operette, keine Selbstverherrlichung eines übergeschnappten Regisseurs, sondern es will genießen und in der Musik schwelgen – und genau das kann es bei diesem eindrucksvollen Vogelhändler.

Mitte Julia Klein Briefchristel
Die Kostüme, bunt, teilweise herrlich schrill und überzogen und das Bühnenbild, welches ebenso bunt ist, werden eindrucksvoll von Andreas Becker auf die Theaterbretter gebracht. Die Choreinstudierung von Lorenzo Da Rio ist ebenfalls überzeugend, der Chor ist hervorragend eingestellt und immer präsent. Er füllt die Bühne des Landestheaters mit Leben aus und dies recht stimmkräftig.
Als Dirigent erlebt man heute Dominik Tremel, der das Philharmonische Orchester gefühlvoll und einfühlsam dirigiert. Ihm merkt man auch seine Zeit als Gesangskorrepetitor an, denn er unterstützt mit dem Orchester die Sänger in jeder Weise.

links Michael Lion als Baron Weps und David Zimmer als Stanislaus
Er nimmt die Orchesterfluten behutsam zurück, wenn die Solisten dadurch Probleme bekommen könnten. Eine sehr gute Leistung vom Orchester und seinem Leiter. Zum Inhalt der vergnüglichen Operette braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, denn sie dürfte hinlänglich bekannt sein. Zum großen Teil sind auch die Solisten der Aufführung hervorragende Singschauspieler. Julia Klein ist eine ausgezeichnete Briefchristel. Sie ist keine Soubrette, wie die Christel vielfach angelegt ist, sondern ein warmer leuchtender und stimmschöner durchschlagskräftiger flirrender Sopran. Es macht einfach Spaß ihr zuzuhören und zuzusehen. Ihr Adam wird von Dirk Mestmacher dargeboten. Darstellerisch voll überzeugend, einen Tiroler Burschen auf die Bühne stellend, kann er mich leider stimmlich nicht überzeugen. Zu klein, zu wenig durchschlagskräftig ist sein Tenor, von klangvoller strahlender Höhe ganz zu schweigen. Er ist mit einer Indisposition angekündigt worden, dies mag einiges entschuldigen. Ich kann mir aber bei ihm auch im Vollbesitz seiner stimmlichen Kräfte, keinen rollendeckenden Adam vorstellen. Vielleicht tue ich ihm hier auch unrecht, ich habe ihn zum ersten Mal gehört und werde bei einer nächsten Gelegenheit vielleicht mein Urteil revidieren müssen.

David Zimmer und Julia Klein – Stanislaus + Briefchristel
Anna Gütter ist eine überzeugende Kurfürstin, mit silberhellem, in den höchsten Koloraturen sich beweglich tummelnd, bietet sie eine ausgezeichnete Leistung, auch ihr Spiel kann voll überzeugen. Exzellent auch der Baron Weps von Michael Lion. Verschlagen agierend, mit einem profunden kräftigen und stimmschönen Bass ausgestattetem und mit sehr viel Spielwitz versehen, kann er zu Recht viel Beifall einheimsen. Ihm zur Seite als sein Neffe Stanislaus David Zimmer. Er hat einen hohen, klaren, durchschlagenden und stimmschönen hohen Tenor, der keinerlei Höhenangst zu besitzen scheint, und fast hätte ich ihn mir als Adam der heutigen Aufführung gewünscht. Die Schweizer Mezzosopranistin Gabriela Künzler bietet ein Paradebeispiel in der Rolle der Hofdame Baronin Adelaide. Nicht nur das Trinken einer Maß auf einen Zug, welches ihr natürlich Zwischenapplaus beschert, weiß zu überzeugen, ihr ganzes Spiel ist bis auf die letzte Nuance durchdacht und kann das applausfreudige Publikum überzeugen. Freimut Hamman bringt als Dorfschulze Scheck eine solide Leistung auf die Bretter und Joanna Stark als Comtesse Mimi, sowie Sascha Mai als Hoflakai Quendel, Eva Maria Fischer als Kellnerin Jette und Jan Korab als Bote vervollständigen das Ensemble solide ohne jeglichen Ausfall. Bleiben noch Markus G. Kulp (als Gast) als Professor Süffle und Stephan Ignaz als Professor Würmchen. Sie singen ihr „Ich bin der Prodekan“ ohne Fehl und Tadel, sie geben aber ihrem Gaul ein bisschen zu viel Zucker. Etwas weniger wäre sicher mehr gewesen. Wo man am Anfang noch herzhaft lachte, verstummt das Lachen, je länger die Szenen und Wiederholungen dauern. Aber sicher bin ich da wieder etwas beckmesserisch, denn dem Publikum hat es weit überwiegend gefallen, was man am starken und langen Beifall ablesen konnte.

Adam Dirks Mestmacher + Christel Julia Klein + Stanislaus David Zimmer
Ein Nachmittag, der zu einer der schönsten Operettenerlebnisse der letzten Zeit führte und eindrucksvoll vor Augen hielt, dass Operette, wenn man sie ernst nimmt und auch die entsprechenden Solisten dafür zur Verfügung hat, mit Sicherheit auch in Zukunft sein Publikum finden wird. Für mich war das Resümee am Ende, dass ich wieder verstärkt das Coburger Landestheater aufsuchen werde, gelohnt hat es sich diesmal weit über das normale Maß hinaus.
Manfred Drescher, 19.10.2015
Fotos Andrea Kremper
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
Besuchte Aufführung: 23.4.2015
(Premiere: 21.3.2015)
Pubertäre Nöte und Sehnsüchte im Westöstlichen Collegium
Man hat sie noch in bester Erinnerung, die Coburger Inszenierung von Puccinis „Madama Butterfly“ des grandiosen Regieduos Alexandra Szemerédy/Magdolna Parditka, die damals auch eine Nominierung für den FAUST erhielt. Angesichts des enormen Erfolges dieser Produktion hat Intendant Bodo Busse die beiden jungen Regisseurinnen erneut nach Coburg eingeladen und damit wieder einmal einen Volltreffer gelandet. Was die beiden Damen aus Mozarts „Entführung aus dem Serail“ machten, war in hohem Maße frisch und neu und sehr gefällig, um es mal mit Goethe zu sagen, dem in Szemerédys/Parditkas fulminanter Neudeutung eine zentrale Rolle zukommt. Um es vorwegzunehmen: Diese Inszenierung ist eine Sensation!

Ensemble
Weitab von jeglichem altbackenen, vordergründig exotischen Türkenkitsch verpassen die beiden Regisseurinnen Mozarts Singspiel ein gänzlich neues Gewand, für das sie auch eine eigene, neue Dialogfassung schufen. Gekonnt setzen sie bei den erotischen Wünschen pubertierender junger Menschen an, die sich an der Verwirklichung ihrer Sehnsüchte durch äußere Umstände gehindert sehen. Worin diese bestehen, ist klar: In dem strengem Regelwerk eines Internats, in das Szemerédy und Parditka die Handlung verlegen und sich damit in das Fahrwasser eines Peter Konwitschny begeben. Dieser wendete bei seiner Hamburger „Lohengrin“-Inszenierung von 1998 denselben Kunstgriff an. Der originelle Ansatzpunkt war mithin nichts Neues mehr, ging aber dennoch voll auf. Die beiden Regisseurinnen haben das Werk nur scheinbar gänzlich gegen den Strich gebürstet, der Kern wurde voll und ganz getroffen. Was sie an diesem überaus gelungenen Abend auf die Bühne des Landestheaters brachten, war ausgesprochen stimmig und mit hohem technischem Können auch äußerst kurzweilig, munter und temporeich umgesetzt. Darüber hinaus wird der Spagat zwischen ausgesprochen heiteren und tief ernsten Momenten aufs Beste eingehalten. Das macht ganz hohe Regiekunst aus.

Frederik Leberle (Bassa Selim), Ana Cvetkovic-Stojnic (Konstanze)
Mit Hilfe der emsig eingesetzten Drehbühne erschließt sich dem Zuschauer ein reger Querschnitt durch das Schulgebäude. Nacheinander ziehen an seinem Auge ein Klassenzimmer, ein Schlafsaal, ein Badezimmer und eine Turnhalle vorüber. Ständig präsent bleibt eine im rechten Bühnenbereich aufgehängte Goethe-Büste. Sie ziert eine Schultafel, auf die zudem mit Kreide ein Gedicht des Dichterfürsten aus dessen „Westöstlichem Diwan“ aufgeschrieben ist. Auszüge aus diesem 1819 erstmals erschienenen Gedichtzyklus, mit dem Goethe seinem persischen Kollegen Hafis seine aufrichtige Reverenz erwies, ziehen sich durch die ganze Aufführung und bilden die Grundlage des humanistisch geprägten Lehrplans von Schuldirektor Bassa Selim. Warum er sein Internat gerade „Westöstliches Collegium“ genannt hat, wird nur allzu offenkundig. Bereits vor dem Einsetzen der Ouvertüre hört man bei noch geschlossenem Vorhang, wie Selim seinen Schülern Goethes Gedicht „Gottes ist der Orient“ beibringt.

Anna Gütter (Blonde), Statisterie
Es ist schon ein sehr gut aussehender, junger Deutschlehrer, der hier versucht, seine Schüler für Goethe zu begeistern. Kein Wunder, dass die in der letzten Reihe sitzende, reichlich introvertiert wirkende Konstanze ihn stark anhimmelt. Sie ergeht sich während des Unterrichts in Liebesphantasien, wobei Fetzen der ursprünglichen Dialoge zwischen ihr und dem Bassa rudimentär und bruchstückhaft in ihren Wunschträumen aufschimmern. Während die anderen mit ansprechenden Schuluniformen ausgestatteten Teenager emsig die ihnen vom Direktor gestellten Aufgaben lösen, ist Konstanze unaufmerksam. Richtige Antworten muss man ihr einsagen und schließlich scheitert sie sogar an der Tafel. Es ist höchste Zeit, dass ihr alter Liebhaber Belmonte sie wieder in die Realität zurückholt. Im Schreiben von Gedichten für die Geliebte versteht er sich blendend, weswegen er von Selim gegen den Willen von Osmin, der eigentlich über die Einschreibung von neuen Schülern zu entscheiden hat - neben ihm gibt es noch zwei weitere weibliche Pädagogen -, sofort in die Schule aufgenommen wird. Am Ende ist es dann auch sein enormes poetisches Können, das ihn das Klassenziel gerade noch erreichen lässt.

Anna Gütter (Blonde), Ana Cvetkovic-Stojnic (Konstanze), José Manuel (Belmonte)
Bis dahin geht es freilich recht turbulent zu, woran auch das Buffopaar einen gehörigen Anteil hat. Pedrillo ist ein ganz schöner Angeber, dessen empfindsame Seite dem aufgeweckten, rasanten Wesen seiner Freundin Blonde diametral entgegengesetzt ist. Aber dass die beiden sich dennoch heiß und innig lieben, daran kann kein vernünftiger Zweifel bestehen. Und dass es zwischen ihnen auch körperlich funktioniert, wird spätestens dann deutlich, wenn sie sich zum Sex in eine Toilettenkabine zurückzuziehen, sich eines Kleidungsstücks nach dem anderen entledigen und hinauswerfen. Zwischen Konstanze und Belmonte geht es in dieser Beziehung eher ruhig zu. Zumindest fühlt sie, dass sie bei Belmonte den richtigen Partner gefunden hat und die Liebe zu ihrem Lehrer nur eine Jungmädchen-Schwärmerei ist. Schließlich verlässt sie aufgebracht Selims Politikunterricht und begibt sich lieber in Osmins Sportstunde, in der dieser seine Schüler/innen stark fordert. An einer der von ihm verlangten Übungen, die von den übrigen Bewegungsstatisten versiert ausgeführt werden, scheitert sogar die sonst sehr bewegliche Blonde. Auch beim Klavierspielen - diese Szene haben die beiden Regisseurinnen völlig neu geschaffen - versagt sie auf der ganzen Linie, nachdem eine Mitschülerin sehr anständig Stücke von Mozart zum Besten gegeben hat.

José Manuel (Belmonte), Ana Cvetkovic-Stojnic (Konstanze)
Zunehmend fühlen sich die vier Schüler nicht mehr so wohl in ihrem Internat, gegen dessen im Programmheft abgedruckte Schulordnung sie ständig verstoßen, rauchen, Alkohol trinken und in Straßenkleidung den Duschraum betreten. Schließlich entscheidet man sich, zu fliehen und dazu eine Schüleraufführung zu nutzen, bei der Szemerédy und Parditka dann doch noch ein wenig mit türkisch-exotischen Klischees spielen. Obwohl es Blonde und Pedrillo, die sich zuvor durch eine Zuschauer-Loge davonmachen wollten - mit Brecht können die Regisseurinnen umgehen - gelingt, den diensthabenden Pädagogen Osmin zu überwältigen und zu fesseln, misslingt die Flucht. Der fehlgeschlagene Versuch, den sie beengenden Verhältnissen zu entkommen, mündet bei Konstanze und Belmonte in einen Selbstmordversuch. An dieser Stelle warten die regieführenden Damen erneut mit einem Kunstgriff auf, der ebenfalls Konwitschny nachempfunden sein könnte: Nachdem sich die Liebenden die Pulsadern aufgeschnitten haben, fällt ein Zwischenvorhang. Das Stück scheint zu Ende zu sein, einen tragischen Ausgang genommen zu haben. Über Lautsprecher vernimmt man die entsetzten „Konstanze“-Schreie Selims und ein allmählich ersterbendes Röcheln. Dann geht der Vorhang aber auf einmal wieder auf. Man sieht wie der Schuldirektor seine Zöglinge nach bestandenem Schuljahr in die Freiheit entlässt. Auch Konstanze und Belmonte gesellen sich dazu, wieder völlig unversehrt. Befanden sie sich aber überhaupt jemals auf der Schwelle des Todes? Das ist zumindest zweifelhaft. Eher nicht. Die ganze Selbstmordszene war vielmehr eine der Phantasie des Mädchens entsprungene letzte Hommage in Richtung des immer noch verehrten Lehrers, den sie nun verlassen muss. Selims Gnade, seine Huld, besteht bei Szemerédy und Parditka in der Zuerkennung des erfolgreichen Schuljahrabschlusses trotz nur schwacher Leistungen. Aber genau das macht ja den humanen Faktor aus. Schuldirektor Selim setzt auch in die Tat um, was er lehrt. Dieser Ansatzpunkt der beiden genialen Regisseurinnen war sehr überzeugend. Fern der Tradition haben sie hier mit einem modernen Mantel das zeitübergreifende, in allen Ären gültige Zentrum getroffen: Humanität. Und gerade darum geht es ja nicht nur in der „Entführung“, sondern auch in einigen anderen Opern Mozarts. Dementsprechend kann man diese in jeder Hinsicht gelungene Produktion, zu der man den beiden Regisseurinnen nur herzlich gratulieren kann, sogar als werktreu bezeichnen. Dieses Musterbeispiel hochkarätigen Musiktheaters ist regelrecht preisverdächtig.

Ensemble
Ungewohnter Natur war auch die Herangehensweise von Anna-Sophie Brüning, der Ersten Kapellmeisterin des Landestheaters Coburg, an Mozarts Partitur. Sie knüpfte bei ihrer Interpretation zusammen mit dem versiert aufspielenden Philharmonischen Orchester Landestheater Coburg ebenfalls nicht an herkömmliche Deutungsmuster an, sondern näherte sich dem Ganzen von der analytischen Seite her. Bereits die Ouvertüre entsprach unter ihrer musikalischen Leitung durchaus nicht konventionellen Hörgewohnheiten. Grelle Farben und spitze Akzente prägten die Einleitung, woraus ein recht aggressiver Charakter resultierte. Auch im weiteren Verlauf des Abends wirkte der von Dirigentin und Orchester erzeugte Klangteppich recht rational, zeichnete sich indes durch eine gute Transparenz aus.
Die Sängerliga wurde von Ana Cvetkovic-Stojnic angeführt, die in der Konstanze eine ihrer besten Rollen gefunden haben dürfte. Mit ihrem sauber durchgebildeten, tiefgründigen sowie voll und rund klingenden lyrischen Sopran, der zudem über ein großes Ausdrucksspektrum verfügt, zog sie famos sämtliche Register ihrer anspruchsvollen Rolle. Sowohl die extrem hoch gehenden, hervorragend gemeisterten Koloraturen der Martern-Arie als auch die mit sehr gefühlvoller, warmer Tongebung wiedergegebenen Emotionen des jungen Mädchens hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. Die taffe Blonde von Anna Gütter war darstellerisch in demselben Maße überzeugend wie ihr bestens fokussierter Sopran kräftig und prägnant. Der Belmonte von José Manuel hatte seine besten Momente in den Arien, wo er seinen Tenor gut gestützt und mit schönem appoggiare la voce dahinfließen lassen konnte. Hier konnte er mit durchaus hoher Klangkultur punkten. Bei schnellen, rezitativartigen Passagen verlor die Stimme indes öfters an tiefer Fokussierung und rutschte in den Hals, woraus eine Verflachung des Klangs resultierte. Das begann schon bei seinem Duett mit Osmin, dem der junge Tapani Plathan mit solide gestütztem, bis in tiefste Regionen reichendem Bass ein ansprechendes Profil zu geben wusste. Schauspielerisch famos, gesanglich nur mit einem Hauch von dünner Tenorstimme gesegnet gab Dirk Mestmacher den Pedrillo. Als Bassa Selim machte der gut aussehende Schauspieler Frederik Leberle Konstanzes Zuneigung glaubhaft. Nichts auszusetzen gab es an dem von Lorenzo Da Rio perfekt einstudierten Opernchor des Landestheaters Coburg.
Fazit: Wieder einmal ein Abend, der die Fahrt nach Coburg voll gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 25.4.2015
Die Bilder stammen von Andrea Kremper
Sehens- und hörenswert
SALOME
Besuchte Aufführung: 20.2.2015 (Premiere: 7.2.2015)
Die Göre im goldenen Käfig
Es war nicht das erste Mal, dass die „Salome“ am Landestheater Coburg zu sehen gewesen ist. Bereits im Jahre 1907 war Strauss’ zwei Spielzeiten zuvor in Dresden uraufgeführte Oper als Gastspiel des Stadttheaters Nürnberg dem Coburger Publikum präsentiert worden. Das sensationelle Werk hinterließ damals bei den Besuchern einen starken Eindruck - genau wie die aktuelle Neuproduktion, die einmal mehr beredtes Zeugnis von dem enormen szenischen, musikalischen und stimmlichen Niveau ablegte, das in Coburg seit Amtsantritt von Intendant Bodo Busse herrscht. Von dem, was an diesem bemerkenswerten kleinen Theater geleistet wird, kann sich so manches andere, auch größere Opernhaus einen gehörigen Teil abschneiden.

KS Ute Döring (Salome)
Für die Inszenierung konnte Tobias Theorell gewonnen werden, dessen grandiose Coburger „Freischütz“-Interpretation von 2012 man noch in hervorragender Erinnerung hat. Im Gegensatz zu dem Werk Webers, das er sehr ungewöhnlich anging und mit zahlreichen neuen Einfällen garnierte, bewegte sich seine Deutung der „Salome“ in etwas traditionelleren Pfaden. Sie wies keinen gänzlich neuen Zugang zu dem Geschehen auf und bewegte sich stark am Textbuch entlang, hatte aber dem Auge viel zu bieten und wusste nicht zuletzt durch eine intensive, logische Personenführung für sich einzunehmen. Demgemäß fiel der Schlussapplaus des begeisterten Publikums dann auch äußerst herzlich aus.

Page, Ks Ute Döring (Salome), Thomas de Vries (Jochanaan)
Bei Theorell spielt sich die Handlung nicht auf der Terrasse des Herodes’ schen Palastes ab, sondern in einer von Alejandro Tarragüel de Rubio - von ihm stammen auch die blendenden, verschiedenen Ären entlehnten Kostüme - Grotte, in der alles aus Gold ist. Sogar die Zisterne, in der Jochanaan gefangen gehalten wird, ist keine „schwarze Höhle“, sondern golden. Auch die dramaturgisch wichtige Silberschüssel, in der der jüdäischen Prinzessin in der letzten Szene der Kopf des Propheten serviert wird, besteht hier entgegen der Vorlage aus blankem Gold und ist zudem mit Wasser gefüllt. All der äußere Glanz und Prunk soll indes nicht auf den großen Reichtum von Herodes hindeuten, sondern steht vielmehr für eine vordergründige, sinnentleerte und auf reinen Genuss ausgerichtete Welt, in der man Feste feiert - im konkreten Fall einen Maskenball - und sich zügellosen Ausschweifungen hingibt. Es ist eine sehr dekadente Gesellschaft, die der Regisseur den Zuschauern hier vor Augen führt und deren herausragender Vertreter der mit rotem Königsmantel, gold schimmerndem Anzug und Lorbeerkranz ausgestattete Herodes ist, der aus seiner Lüsternheit auf Salome keinen Hehl macht.

Page, José Manuel (Narraboth), Ks Ute Döring (Salome), Thomas de Vries (Jochanaan)
Diese erscheint im schwarzen Glitzerkleid und in dunklen Leggins und bleibt stets, sogar bei dem von Mark McClain choreographierten, ganz ohne Schleier ausgeführten Tanz, in den Herodes einbezogen wird, bis oben hin zugeknüpft. Sie ist ganz Tochter des Hauses, eine verwöhnte, ungezogene Göre, die gewohnt ist, alles zu bekommen, was sie sich wünscht, und trotzig aufbegehrt, wenn man ihrem Begehren mal nicht nachkommt. Erotik versprüht diese Salome eher wenig; wenn sie doch mal ihre sexuellen Reize ins Spiel bringt, wirken diese etwas aufgesetzt. Bei Herodes hat sie dennoch Erfolg, nicht aber bei dem eine schwarze Kapuze tragenden, ein kleines Gebetbuch mit sich führenden Religionsfanatiker Jochanaan, der am Ende seines Ausflugs an die Tageswelt doch noch Zweifel bekommt, ob er mit seinem Fluch auf sie nicht doch übertrieben hat. Zaghaft nähert er sich der regungslos am Boden liegenden Prinzessin, geht dann aber doch freiwillig in sein Gefängnis zurück.
Da müssen die beiden schwarz gekleideten Soldaten, von denen der jüngere ihn zum Unwillen des älteren einmal mit starken Fußtritten attackiert, gar nicht nachhelfen. Dominiert im ersten Teil noch das Maskenfest den Abend, legt Theorell im zweiten den Fokus ganz auf die Familiengeschichte des Hauses Herodes, deren Abgründe er gekonnt freilegt. Allgemein werden die zwischenmenschlichen Beziehungen von ihm mit großer Akribie und einfühlsam herausgearbeitet. Das gilt auch für die kleineren Rollen, so etwa für das Verhältnis zwischen dem sich zu guter Letzt mit einem Messer die Pulsadern aufschlitzenden Narraboth und dem als Frau vorgeführten Pagen. Am Ende ist Salome ganz allein auf der Bühne. Keiner legt Hand an sie. Trunken vor Glück, die Lippen des abgeschlagenen Hauptes des Propheten geküsst zu haben, möchte sie am liebsten sterben. Herodes’ Befehl „Man töte dieses Weib“ ist lediglich eine innere Stimme der jüdäischen Königstochter.

Christian Franz (Herodes), Ks Ute Döring (Salome)
Für die Hauptpartien wurden von Bodo Busse einige phantastische Gäste engagiert. Ks. Ute Döring hatte in dieser Produktion vor kurzem ihr Debüt als Salome gegeben und vermochte auch an diesem Abend rundum zu überzeugen. Darstellerisch war die über eine ausgezeichnete schauspielerische Ader verfügende Sopranistin, die man noch aus Ulm und Wiesbaden in bester Erinnerung hat, stets präsent. Mit großer Spiellust lotete sie die verschieden Facetten der judäischen Prinzessin aus, war bockig und setzte auch zielgerichtet ihre weiblichen Reize ein. Auch stimmlich entsprach sie der Partie voll und ganz. Sie verfügt über einen fein durchgebildeten, sauber fokussierten und ausdrucksstarken, vom Mezzo herkommenden Sopran, der sogar noch bei den eklatanten hohen h’ s einen guten Focus aufwies und an keiner Stelle schrill klang. Auch das tiefe ges gelang ihr tadellos. Als Idealbesetzung für den Herodes erwies sich Christian Franz. Es ist lobenswert, dass sich dieser international berühmte Tenor nicht zu schade ist, an einem kleinen Haus wie dem Landestheater Coburg zu singen. Auch er war schauspielerisch voll in seinem Element und zog gekonnt alle Facetten des auf seine Stieftochter lüsternen Herrschers, dem er auch eine etwas zaghafte Seite verlieh. Stimmlich vermochte er mit frischem, eine gute Fundierung aufweisendem Tenor, den er differenziert und nuancenreich führte, ebenfalls trefflich zu überzeugen.
Dritter im Bunde der Gäste war der ebenfalls von Wiesbaden her bekannte Thomas de Vries, der ein in jeder Beziehung ausgezeichneter Jochanaan war. Die große Anziehungskraft, die der Prophet auf Salome ausübt, machte der junge, gut aussehende Sänger nur zu glaubhaft. Die fanatische Seite Jochanaans hat er trefflich vermittelt. Und gesanglich stellte sein puren Wohlklang verströmender, sonorer und bestens italienisch geschulter Bariton eine Luxusbesetzung für die Partie dar.
Monica Mascus, an deren Stuttgarter Mary man sich noch gerne erinnert, war eine markant intonierende Herodias. Schönes, trefflich verankertes Tenormaterial brachte José Manuel für den Narraboth mit. Neben ihm wertete Kora Pavelic mit profundem, tiefgründigem Mezzosopran die kleinen Rollen des Pagen und des Sklaven auf, die sie auch ansprechend spielte. Als erster Nazarener kündete Tapani Plathan mit edel timbriertem Bass gefühlvoll von den Wundertaten Christi und gefiel auch als zweiter Soldat gut. Solide sangen Jiri Rajnis den zweiten Nazarener und Thomas Unger den Cappadocier. Michael Lion bewährte sich mit elegantem, geradlinig geführtem Bass, der den Sotin-Schüler verrät, in den Rollen des ersten Soldaten und des fünften Juden. Im Judenquintett war ihm David Zimmer (vierter Jude) ebenbürtig. Ordentlich auch Sascha Mais dritter Jude. Ausgesprochen flach klang dagegen der erste Jude von Dirk Mestmacher. Und Jan Korab (2. Jude) sang so dünn, dass man ihn kaum hörte.

Ks Ute Döring (Salome), Christian Franz (Herodes)
Gastdirigent Adrian Müller modulierte am Pult einen farben- und kontrastreichen Klangteppich, der es in sich hatte. Da flimmerte, glitzerte und funkelte es gewaltig. Spannungsgeladen, fulminant und in sehr zügigen Tempi führte Müller das prächtig aufspielende und seine Intentionen perfekt umsetzende Philharmonische Orchester Landestheater Coburg durch den Abend und durfte sich am Ende über den großen Publikumszuspruch zurecht freuen.
Fazit: Eine in erster Linie gesanglich und musikalisch, aber durchaus auch szenisch zu empfehlende Aufführung, für deren beeindruckende Realisation dem Landestheater Coburg großes Lob gebührt.
Ludwig Steinbach, 23.2.2015
Die Bilder stammen von Andrea Kremper
Mit psychologischem Einschlag
HÄNSEL UND GRETEL
Besuchte Aufführung: 11.12.2014 (Premiere: 6.12.2014)
Die Mär vom Erwachsenwerden
Ein schönes Vorweihnachtsgeschenk hat sich das Landestheater Coburg mit seiner Neuproduktion von Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ selbst gemacht. Es war insgesamt ein gelungener Abend, der einerseits durchaus kindgerecht anmutete, andererseits aber auch Denkanstöße für innovative Gemüter bereithielt.

Dirk Mestmacher (Hexe), Valentin Fruntke (Hexengehilfe)
Die vom Tanztheater kommende Regisseurin Jean Renshaw, an deren Coburger Inszenierung von Donizettis „L’ elisir d’ amore“ von vergangener Spielzeit man sich noch gut erinnert, hat das Werk weder modernisiert noch dekonstruiert. Sie hat das Märchen ernst genommen und zusammen mit ihrem Bühnen- und Kostümbildner Christof Cremer in ästhetisch-schönen Bildern auf die Bühne des Landestheaters gebracht. Garniert wurde der ansprechende äußere Rahmen mit einem gut durchdachten und trefflich durchgezogenen geistigen Band. Ganz nebenbei wird von Frau Renshaw über das äußere Geschehen hinaus die Frage nach der allgemeinen Funktion von Märchen aufgeworfen, wobei sie das Ganze geschickt in psychoanalytische Tiefendimensionen abgleiten lässt. Für sie ist das Märchen nicht nur ein Märchen, sondern beredter Ausdruck der kindlichen Entwicklung bis hin zur vollen Reife. Der Focus liegt bei ihr dabei nicht auf äußeren, sondern auf inneren Prozessen.

Kora Pavelic (Hänsel), Gretel
Einfühlsam nimmt sie den Zuschauer bei der Hand und begleitet mit ihm Hänsel und Gretel auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden, wobei für sie in Anlehnung an die Märchendeutung C. G. Jungs die psychischen Vorgänge in den Kindern essentiell sind. Teilweise atmet ihre Inszenierung ausgemachten, krassen Realismus. Der in nüchterne Grautöne getauchte Bühnenraum des kärglichen Zuhauses der ebenfalls grau gekleideten Besenbinder-Familie unter einem schräg aufgerichteten Tisch, der sich mit Hilfe der Drehbühne um die eigene Achse drehen kann, ist als Sinnbild des ständig präsenten Hungers und damit des sozialen Elends der Protagonisten zu verstehen. Strenggenommen dreht sich hier alles nur um das Essen. Dieser Ansatzpunkt der Regisseurin ist zwar nicht mehr neu - Richard Jones ging an der Bayerischen Staatsoper ähnlich vor -, aber effektiv und ausgesprochen stückimmanent. Nachhaltig zeigt Frau Renshaw auf, wie in derart ärmlichen Verhältnissen Selbstsucht gedeiht, sich Aggressionen entwickeln können und Verhaltensweisen sich den Weg an die Oberfläche bahnen, die sich unter angenehmeren Lebensbedingungen wohl nicht in dieser radikalen Weise offenbart hätten. Das wird in erster Linie an der Figur der Gertrud aufgezeigt, die an sich eine gute Mutter sein will, sich aber aus purer Verzweiflung zu einer Strafmaßnahme gegenüber den Geschwistern hinreißen lässt, die sie später bitter bereut. Wenn dann auch noch die Hexe die vom Besenbinder mitgebrachten Lebensmittel stiehlt, scheint alle Hoffnung auf ein besseres Leben verloren. In der Pantomime am Ende des zweiten Aufzuges werden die Eltern nach einer erfolglosen Suche nach den Kindern verzweifelt am Tisch sitzend gezeigt, bevor die Szene wieder zu Hänsel und Gretel wechselt, die im Schlaf nicht etwa von vierzehn Engeln, sondern von einer gleichermaßen streng gekleideten Kinderschar besucht werden. Die Tristesse des Alltags verfolgt sie bis in ihre Träume. Ein Schicksal, das von vielen anderen Kindern geteilt wird.

Kora Pavelic (Hänsel), Gretel
Dass die Regisseurin hervorragend mit Tschechow’schen Elementen umzugehen versteht, wird bereits während des Vorspiels deutlich, wenn sie der als wahrer Struwelpeter gezeichneten, in grelles Pink gekleideten Transvestiten-Hexe schon hier einen Auftritt zubilligt. Begleitet wird sie von einem katzenartigen Diener mit schwarzer Melone, pinkfarbenem Hemd und dunkler Hose, der auch mal eine Maus verspeisen darf. Das Böse hat eben immer irgendwelche Gehilfen und auch auf der maliziösen Seite spielt Essen augenscheinlich eine große Rolle. Eine von den beiden mitgeführte Kiste mit der Aufschrift „100% Zauber“ lässt den Schluss zu, dass es sich hier lediglich um faulen Varietézauber handelt, obwohl die Hexe auch zweimal auf ihrem Besen durch die Luft sausen darf - das führt ein Statist aus -, beim zweiten Mal dabei aber vor lauter Übermut abstürzt. Entscheidend ist für Jean Renschaw aber nicht das durchaus erheiternde, oft recht komisch wirkende Gehabe der Hexe, sondern das, wofür sie steht. Von der psychologischen Warte aus betrachtet symbolisiert sie die mannigfaltigen Ängste der Kinder - diese werden zudem durch den stilisierten Wald versinnbildlicht -, ist also weniger realer als vielmehr seelischer Natur. Indem die Geschwister die Zauberin am Ende in den Ofen schieben, zu dem ihr Miniatur-Knusperhäuschen mutiert ist, befreien sie sich von ihrer Furcht und überschreiten so eine weitere wesentliche Schwelle auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Das macht jedes Kind einmal durch. Die allgemeine, für die Entwicklung notwendige Angst ist ein Stadium, das jeder durchläuft, sei es nun in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder auch in der Zukunft. Das Prinzip bleibt dabei immer dasselbe, nur die Situationen ändern sich. Dementsprechend ist es nur konsequent, wenn die Hexe am Ende wieder auftaucht und bedrohlich über der Szene schwebt. Die Gefahr bleibt irgendwie bestehen. Das ist indes auch notwendig, denn ohne die Hexe wäre den Menschen eine existentielle Entwicklungsstufe genommen. Die müssen sie bewältigen, um ganz erwachsen zu werden. Das muss immer von neuem geschehen. Dieser Spagat zwischen schöner Märchenhandlung und innovativer Durchdringung des Stücks ist in hohem Maße gelungen.

Kora Pavelic (Hänsel), Dirk Mestmacher (Hexe), Gretel
Ana Czetkovic-Stojnik war mit frischem, aufgewecktem Spiel und solide gestütztem Sopran eine überzeugende Gretel. Rein vom Darstellerischen her war sie dem Hänsel von Kota Pavelic überlegen, die dafür vokal mit etwas fülligerem und tiefgründigerem Mezzosopran mehr punkten konnte. Eine ausgezeichnete Leistung erbrachte Jiri Rajnis, der einen sonoren, bestens fokussierten und ausdrucksstarken Bariton für den Besenbinder Peter mitbrachte. Als Gertrud verfiel Gabriela Künzler Gott sei Dank nicht in pures, grelles Keifen, wie es bei anderen Vertreterinnen dieser Rolle oft vorkommt, sondern wahrte stets eine gute Verankerung der Stimme im Körper. An dieser fehlte es dem ausgesprochen dünn und kopfig intonierenden Dirk Mestmacher in der Partie der Hexe voll und ganz. Schauspielerisch war der über eine ausgeprägte komödiantische Ader verfügende Tenor weit überzeugender. Ausgesprochen flach sang auch die häufig in den Orchesterfluten regelrecht untergehende Luise Hecht das Taumännchen. Da schnitt Emily Lorinis voll und rund vokalisierendes Sandmännchen erheblich besser ab. Den stummen Hexengehilfen gab der wendig spielende Statist Valentin Fruntke. Ordentlich präsentierte sich der von Daniela Pfaff-Lapins einstudierte Kinderchor.

Ensemble, Kinderchor, Statisterie
Am Pult wartete Anna Sophie-Brüning mit einem symphonischen, kompakten Zugriff in zügigen Tempi auf Humperdincks herrliche Musik auf. Hier haben wir es mit einer Theaterdirigentin zu tun, die einerseits die Wagner’schen Aspekte der Partitur trefflich betonte, andererseits aber auch für das Volksliedhafte und die vielfältigen Klangfarben ein gutes Gespür bewies. Manchmal hätte sie aber das versiert aufspielende Philharmonische Orchester Landestheater Coburg dynamisch etwas zurücknehmen können. Insbesondere Frau Hecht und Herrn Mestmacher hätten davon profitiert.
Ludwig Steinbach, 12.12.2014 Die Bilder stammen von Andrea Kremper
Singspiel „Bar jeder Vernunft“
IM WEISSEN RÖSSL
Besuchte Aufführung: 7. 6. 2014 (Premiere: 29. 3. 2014)
Schwungvoll, ironisch und grotesk
Etwas anders, als man es von sonstigen Aufführungen des Werkes her gewohnt ist, präsentierte sich die Neuproduktion von Ralph Benatzkys Singspiel „Im weißen Rössl“ am Landestheater Coburg. Das Stück wurde in einer von der Instrumenten-Besetzung her stark reduzierten Form gegeben, die im Jahre 1994 in der Berliner „Bar jeder Vernunft“ aus der Taufe gehoben wurde. Von dem ursprünglichen Orchesterapparat ist praktisch nichts mehr übrig. Nur ein Streichquartett, Schlagzeug und ein Klavier benötigt diese Fassung. Neben so beliebten Musiknummern wie „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Es muss was Wunderbares sein“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“ und „Die ganze Welt ist himmelblau“ drangen an diesem Abend aus dem zum Swimmingpool umfunktionierten kleinen Orchestergraben noch etliche andere Klänge an das Ohr des Zuhörers, die man nicht in Benatzkys Partitur findet. Lorenzo da Rio, der auch den Chor trefflich einstudiert hatte, kam dieses Mal auch die Funktion des Dirigenten zu. Vom Klavier aus führte er die wenigen Musiker des Philharmonischen Orchesters Landestheaters Coburg geschickt und temporeich durch den Abend. Indes wurde man mit dieser doch sehr reduzierten Bearbeitung nicht so recht glücklich.

David Zimmer (Leopold)
Da war die Regie von Tobias Materna schon viel überzeugender. Dem Regisseur ist in Zusammenarbeit mit seinen beiden Ausstattern Lorena Diaz Stephens und Jan Hendrik Neidert eine ungewöhnliche, angenehm gegen den Strich gebürstete Inszenierung gelungen, die weit entfernt von aller kitschgefährdeten Heimatfilm-Betulichkeit, wie man sie aus diversen Verfilmungen des Stoffes kennt, ziemlich nüchtern daherkommt. Das altehrwürdige Rössl erscheint hier zunächst als karger, kühl anmutender Kachelbau, der im weiteren Verlauf des Stückes peu à peu eine zunehmend wärmere Ausleuchtung erfährt. Erst am Ende, wenn sich dem Publikum mit Hilfe der Drehbühne die Hinterfront des Bühnenbildes offeriert, bricht sich dann aber doch noch ein kitschiges Ambiente Bahn, das einem Gott sei Dank vorher erspart geblieben war. Diese Vorgehensweise hatte ihre Berechtigung und wurde von dem zahlreich erschienenen und mit Applaus wahrlich nicht geizenden Auditorium auch bereitwillig akzeptiert.

Sofia Kallio (Kathi)
Materna ist ein Regisseur, der sich trefflich auf den Umgang mit Brecht’schen Elementen versteht. So bezieht er immer wieder den Zuschauerraum in das Geschehen mit ein. Die Briefträgerin Kathi, der hier die Funktion einer Spielleiterin zukommt, lässt er zu Beginn durch das Parkett auftreten und unter den erst nach ihr erscheinenden Musikern Briefe mit zum Schmunzeln verleitenden aktuellen Bezügen verteilen. Hier dürfte es sich um Extemporés handeln, die von Aufführung zu Aufführung etwas variiert werden. Auch Coburg’sches Lokalkolorit lässt Materna in seine Deutung einfließen. Kronach scheint er besonders zu lieben, jedenfalls äußert Leopold den Wunsch, dahin auswandern zu wollen. Dr. Siedler und Giesecke rufen sich am Ende des ersten Aktes ihre gegenseitigen Frotzeleien erst aus dem oben gelegenen Spiegelsaal bei geöffneten Türen zu, danach von verschiedenen Seiten des Ranges. Das Aufsteigen in die Höhen des Theatersaales als Bergwanderung: ein gelungener Einfall.

David Zimmer (Leopold), Ulrike Barz (Wirtin)
Auch sonst ist Materna um heitere Regieeinfälle nicht verlegen. An erster Stelle haben es ihm die Personen angetan, die er in liebevoller Detailarbeit und mit großem technischem Können köstlich vorführt. Die Frisuren insbesondere der Damen sind reichlich übertrieben. Auch sonst sind köstliche Überzeichnungen an der Tagesordnung, so dass das „Weiße Rössl“ manchmal geradezu zu einer Groteske zu mutieren scheint. Ein Fehler ist das indes nicht. Die Originalität der viele parodistische Elemente aufweisenden Inszenierung wird dadurch nur noch gesteigert. Sie erreicht ihren Höhepunkt, wenn der Kaiser Franz Joseph herrlich überspitzt im Taucherlook aus dem Swimmingpool steigt und sich im Folgenden insbesondere der Sympathie von Kathi, jetzt in ihrer Funktion als Jungfrauenpräsidentin, erfreuen darf. Zum Schluss steigt sie mit ihm bereitwillig ins kalte Wasser. Auch über sonstige ironisch eingefärbte Zutaten der Regie konnte man schmunzeln, so über die vergnügliche Wasserskieinlage von Dr. Siedler und das Erscheinen eines Haifisches im Wolfgangsee. Insgesamt bewies Materna ein gutes Händchen für zündende Gags, mit denen er das Auditorium schnell auf seiner Seite hatte.

Sofia Kallio (Kathi), Thomas Straus (Kaiser), David Zimmer (Leopold)
Das Ensemble setzte sich aus Sängern und Schauspielern zusammen. Von den Gesangssolisten war es insbesondere David Zimmer, der voll begeistern konnte. Noch nie hat man einen so phantastischen Leopold erlebt wie diesen jungen Tenor, der seine Stimme bestens italienisch zu führen versteht und substanzreich und ausdrucksstark intoniert. Das sehr emotional und intensiv gesungene „Zuschau’n kann i net“ war der vokale Höhepunkt des Abends. Dass er am Ende dieses Liedes etwas zu sehr in die Kopfstimme ging, war wohl beabsichtigt. Wenn dann noch eine imposante schauspielerische Leistung dazukommt, ist das Glück vollkommen. Diesem vielversprechenden Sänger steht eine große Karriere bevor. Neben ihm gab Ulrike Barz eine darstellerisch sehr resolute Wirtin Josepha Vogelhuber, die stimmlich zwischen trefflich fokussiertem Opern- und weniger gut gestütztem Musical-Gesang hin und her wechselte. In puncto italienischem Stimmfluss und Sonorität des Vortrags war ihr die bis zu den Spitzentönen fulminant singende Ottilie von Anna Gütter um Längen überlegen. Auch den äußerst dünn und kopfig vokalisierenden Dr. Siedler Dirk Mestmachers sang sie an die Wand. Als Kathi Weghalter wurde Sofia Kallio von der Theaterleitung völlig unter ihrem Wert verkauft. Zwar hat die Regie ihre Rolle, die sonst von Choristinnen oder auch Schauspielerinnen gegeben wird, und die sie mit einer ausgeprägten komödiantischen Ader auch sehr aufgedreht spielte, etwas aufgewertet. Mit einigen wenigen, von ihr selbst und dem Dirigenten komponierten Verzierungen konnte sie die enormen Qualitäten ihres höhensicheren Prachtsoprans auch noch mal bestens unter Beweis stellen. Man hätte Frau Kallio, die mit Ende der Saison das Landestheater verlässt, aber einen etwas würdigeren Abschied von Coburg in einer ihrer großen Opern-Rollen gegönnt.

David Zimmer (Leopold), Anna Gütter (Ottilie)
Bei den Schauspielern war es insbesondere Thomas Straus, der als Kaiser Franz Joseph im Taucherlook nachhaltig auf sich aufmerksam machte. Einfach köstlich gab Stephan Ignaz den Sigismund Sülzheimer als ausgemachten Beau. An seiner Seite bewährte sich in der Rolle des Klärchen Sandrina Nitschke. Zurecht viele Lacher erntete der stark berlinernde Helmut Jakobi in der Rolle des Wilhelm Giesecke. Gefällig war Stephan Mertls Professor Dr. Hinzelmann. Als hier entgegen der Konvention nicht als Teenager, sondern als gestandener Mann gezeichneter Piccolo gefiel Marcus G. Kulp. Die gelungene Choreographie besorgte Tara Yipp.
Ludwig Steinbach, 9. 6. 2014
Die Bilder stammen von Henning Rosenbusch.
LOHENGRIN
Besuchte Aufführung: 21. 4. 2014
Demontage einer Lichtgestalt
Einen verspäteten Beitrag zum Wagner-Jahr 2013 stellte die Neuproduktion des „Lohengrin“ am Landestheater Coburg dar, mit der das hohe Niveau dieses kleinen Opernhauses wieder einmal offenkundig wurde. Man weiß wirklich nicht, wo man bei dieser rundum gelungenen Aufführung zu schwärmen anfangen soll: Bei der überzeugenden Inszenierung, den musikalischen oder den sängerischen Leistungen? Alles war wie aus einem Guss und formte sich zu einer nahtlos ineinander übergehenden Einheit von großer Eleganz zusammen, wie man sie auch an größeren Häusern nur selten findet. Der begeisterte Schlussapplaus des zahlreich erschienenen Publikums - es waren nur noch wenige Plätze frei - war nur zu berechtigt.

Mit Carlos Wagner, der in Coburg kein Unbekannter mehr ist, hat Intendant Bodo Busse einen Regisseur verpflichtet, der es ausgezeichnet verstand, das Werk weitab von aller Märchenhaftigkeit auf seine aktuelle Relevanz hin zu untersuchen. Nicht Romantik in schönen ästhetischen Bildern war angesagt, sondern krasser Realismus. Dabei goss Wagner die Handlung trefflich in eine politische Form und wartete zudem mit einer gelungenen Hinterfragung des Titelhelden auf. Unter seiner trefflichen Ägide wurde die ursprüngliche Lichtgestalt des Lohengrin nach allen Regeln der Kunst demontiert - ein sehr überzeugender Ansatzpunkt, der indes nicht mehr neu ist. Das haben Regisseure/innen wie Andrea Moses in Dessau, Tilman Knabe in Mannheim und Frank Hilbrich in Freiburg ähnlich gemacht. Wagner tritt in Coburg nachhaltig in das Fahrwasser seiner Kollegen/innen und lässt ebenfalls keinen Zweifel daran, dass er von dem Gralsritter nicht allzu viel hält und ihm misstraut.

Lohengrin ist bei ihm kein gottgesandter Gralsritter, kein von einer höheren Macht gesandter Retter der Unschuld. Das fließend weiße Gewand, das ihm von Christof Cremer verpasst wurde, ist nur schöner Schein, ein Blendwerk für das Auge, unter dem sich das wahre Gesicht des Protagonisten versteckt. Er betritt hier als weltlicher Machtpolitiker den von Rifail Ajdarpasic eingerichteten, mit Abgeordnetenbänken und Rednerpult samt Mikrophon eingerichteten Parlamentssaal, in dem Recht und Gesetz augenscheinlich keine große Rolle mehr spielen. Das wird durch die unter dem Schnürboden gerade noch sichtbaren, in der Luft schwebenden Fundamente der konventionellen Gerichtseiche nur zu deutlich. Zahlreiche Regale voller angehäufter Akten geben beredtes Zeugnis von so manchem Rechtsfall, der für den oder die Angeklagte sicher nicht immer positiv ausging. Das Parlament als Einheitsbühnenbild ist in Carlos Wagners Deutung gleichzeitig auch Gerichtssaal, der sich bei Lohengrins Auftritt zum Hintergrund hin öffnet. Hier fühlt man sich auch visuell an Frank Hilbrichs grandiose Freiburger Interpretation des Stoffes erinnert, der in einer riesigen Bibliothek spielte, in dem die Brabanter die Überlieferungen der Geschichte aufbewahrt haben.

Um Historie geht es nicht zuletzt auch bei Carlos Wagner. Und zwar um das schwärzeste Kapitel der deutschen Geschichte, den Nationalsozialismus, der gerade mit dieser Oper bei den Bayreuther Festspielen 1936 starken Missbrauch trieb. Dabei wendet der Regisseur nicht die Holzhammermethode an, sondern beschränkt sich auf Andeutungen. Unterstützt wird er von Kostümbildner Christof Cremer, der mit der braunen Einkleidung der mit Gewehren bewehrten Brabanter zwar einen deutlichen Bezug zur NS-Zeit herstellt, aber die Uniformen der Nazis nicht original zitiert. Die geistige Parallele ist indes offenkundig. Es machen sich faschistische Auswüchse breit, als deren Folge der Glaube an ein irgendwie geartetes (Grals-) Wunder nur noch bloße Makulatur ist. An die Gottgesandtheit des Titelhelden glaubt eigentlich keiner mehr so richtig. Man sieht ihn ihm nur einen neuen weltlichen Führer, nach dem das Volk aus innerer Not heraus flehend die Hände ausstreckt. Seine Verbindung mit Elsa entspringt letztlich nur politischem Kalkül, ist reine Zweckmäßigkeit und nur auf den Machtgewinn ausgerichtet. Den Kampf mit Telramund, der in gegenseitigem Vorbeilaufen und Anrempeln der beiden Gegner besteht, gewinnt Lohengrin nur mit Hilfe des Schwertes, das ihm Elsa reicht. Im Brautgemach unternimmt der auf einmal im Hintergrund auftauchende und dort ruhig verweilende brabantische Graf keinen Versuch, seinen Kontrahenten zu töten. Lohengrin metzelt ihn dennoch grausam nieder. Das ist alles andere als Notwehr, sondern glatter Mord. Hier erreicht seine Dekonstruktion zum Anti-Helden ihren Höhepunkt. Er geht über Leichen, um seine Macht zu erhalten, was ihn letztlich auch die Liebe Elsas kostet. Das Stellen der verbotenen Frage erscheint als von ihr erkannte letzte Möglichkeit, den unliebsamen Retter, in dem sie sich getäuscht hat, wieder loszuwerden. Dieser gibt die Macht am Ende an den jungen Herzog Gottfried ab, der als Schwan bereits durchaus überzeugend die Gestalt eines in Ketten gelegten Jugendlichen hatte. Ob er einen starken Herrscher abgeben wird, ist aber recht zweifelhaft. Eher nicht.

Musikalisch vermochte die Aufführung nachhaltig zu begeistern. GMD Roland Kluttig breitete Wagners Partitur mit aller ihm zur Verfügung stehenden Raffinesse vor den Ohren des begeisterten Publikums aus. Er hatte das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg hervorragend im Griff und animierte es zu einem Spiel, das in puncto Intensität und Prägnanz kaum zu überbieten war. Ob es nun die phantastische Klangkultur der geradezu sehrend aufspielenden Streicher oder die schweren Akzente der unheilverkündenden Blechbläser waren, alle Instrumentengruppen entledigten sich ihrer Aufgabe mit größter Hingabe, was zu einem geradezu berauschenden Klangerlebnis führte. Dass entsprechend der beschränkten Größe des Coburger Grabens nur eine reduzierte Orchesterfassung für cirka 40 Musiker gespielt wurde, fiel unter diesen Voraussetzungen gar nicht auf. Leider hatte der Dirigent öfters mal den Rotstift in der Partitur angesetzt, was nicht hätte sein müssen. Entsprechend den beengten Verhältnissen auf der Bühne, die auch eine etwas statische Chorführung zur Folge hatten, ließ der Regisseur manchmal die Fanfaren aus dem Rang herunter spielen und den Brautchor im Spiegelsaal des Coburger Theaters - dieser liegt im ersten Stock - bei geöffneter Tür singen. Letzteres ging gut, wenn das Orchester nicht gerade dazu spielte. Sobald die Musiker im Graben aber einsetzten, war von den Choristen im ersten Stock - zumindest von meinem Platz aus - nichts mehr bzw. nicht mehr viel zu hören.

Auf durchweg hohem Niveau bewegten sich auch die sängerischen Leistungen. Es muss für einen Intendanten einen ausgemachten Horror bedeuten, wenn ihm gerade während der Feiertage gleich beide Sänger des Lohengrin kurzfristig ausfallen. Mit diesem Problem sah sich Bodo Busse an diesem Tag konfrontiert. Gerade zu Ostern, wenn die meisten Rollenvertreter im Regefall irgendwo den Parsifal singen, einen Ersatz für den Gralsritter zu finden, dürfte der Theaterleitung nicht leicht gefallen sein. Schließlich führte eine heiße Spur in das ferne Bremen, wo Heiko Börner gerade frei hatte und sofort bereit war, in Coburg einzuspringen, wofür ihm großer Dank auszusprechen ist. Dieser Sänger verfügt über bestens fokussiertes, kräftiges und höhensicheres Tenormaterial, mit dem er dem Lohengrin differenziert und nuancenreich singend in jeder Beziehung gerecht wurde. Auch in die Inszenierung hatte er sich gut eingefunden und vermochte auch darstellerisch voll zu überzeugen. Eine absolute Glanzleistung erbrachte Betsy Horne, die in der Elsa ihre bisher beste Rolle gefunden haben dürfte. Was diese Sängerin, die zu den ersten Kräften des Landestheaters Coburg gehört, an diesem Abend insbesondere gesanglich, aber auch schauspielerisch, bot, nötigt nachhaltig Bewunderung ab. Schon darstellerisch schnitt sie mit intensivem, nuanciertem Spiel phantastisch ab. Und ihre vokale Leistung war einfach überwältigend. Mit warmem und sonorem Sopran italienischer Schulung, der über großes Differenzierungsvermögen und Farbenreichtum verfügt, und in der Höhe schön aufblühte, gelang ihr ein sehr vielschichtiges Rollenportrait. Die dramatischen Ausbrüche der Herzogstochter gelangen ihr ebenso überzeugend wie deren träumerische, lyrische Momente, in denen sie ihre Stimme wunderbar innig und emotional eingefärbt und zudem mit vorbildlicher Pianokultur zu führen verstand. Kein Wunder, dass sie sich über den größten Zuspruch des Auditoriums freuen dürfte. Diese Elsa war bayreuthwürdig. Voll in ihrer Partie ging auch Martina Langenbucher auf, die ihr als Ortrud eine in jeder Beziehung ebenbürtige Gegenspielerin war. Bei dieser aufstrebenden Sopranistin paarten sich in perfekter Weise darstellerische Kraft und Dramatik ihres gut fundierten Gesangsvortrags. Vokal mit robustem, tiefgründigem Bariton ansprechend gab Juri Batukov den Telramund. Indes ist die deutsche Diktion des russischen Sängers noch verbesserungsfähig. Mit noblem, voll klingendem Bass bewältige Michael Lion die unangenehm hoch liegende Tessitura des König Heinrich tadellos. Falko Hönisch sang den Heerrufer zwar technisch unanfechtbar, indes hätte man sich von seinem lyrischen Bariton etwas mehr Durchschlagskraft gewünscht. Als Schwan/Gottfried machte der junge Mariusz Czochrowski einen nachhaltigen Eindruck. Prächtig präsentierte sich der von Lorenzo da Rio famos einstudierte Chor und Extrachor des Landestheaters.
Fazit: Eine wahrlich hochkarätige, festspielwürdige Aufführung, die dem schon oft bewährten Landestheater Coburg alle Ehre macht und deren Besuch sehr zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 23. 4. 2014 Die Bilder stammen von Andrea Kremper.
DIE LUSTIGE WITWE
Besuchte Aufführung: 9. 2. 2014 (Premiere: 8. 1. 2014)
Heitere Millionenjagd
Endlich kann das Landestheater Coburg nach dem beseitigten Wasserschaden wieder bespielt werden. Und nun fand auch die Neuproduktion von Lehars Erfolgsoperette „Die lustige Witwe“, die umständehalber verschoben werden musste, den Weg auf die wieder instand gesetzte Bühne. Es wurde ein recht vergnüglicher Nachmittag. Francois de Carpentries, dessen Würzburger „Don Giovanni“-Inszenierung man noch in bester Erinnerung hat, setzte das Stück heiter beschwingt und kurzweilig in Szene. Seine Personenregie war unaufgesetzt und flüssig. Darüber hinaus wartete er auch dieses Mal wieder gekonnt mit Tschechow’schen Elementen auf. So ließ er das in zwei Teile aufgespaltete zweite Duett zwischen Valencienne und Rossilon von einem Dialog Hannas und Danilos, die auf der Bühne geblieben waren, unterbrechen. Der Zauber, dem sich das erste Paar hingibt, springt an dieser Stelle auch auf die beiden Protagonisten über. Besonders im zweiten Akt nicht ganz glücklich muteten die im Sprechtext vorgenommenen Kürzungen an.

Sofia Kallio (Hanna)
Den äußeren Rahmen des Geschehens bildet eine von Andreas Becker entworfene Säulenhalle, in dem die pontevedrinische Botschaft ihr Domizil aufgeschlagen hat. Man ist augenscheinlich noch nicht gänzlich in der neuen Residenz angekommen, die Möbel sind teilweise noch verhängt. Der Hintergrund wird von einem Bild des Landesvaters von Pontevedrino eingenommen, rechts neben diesem erhebt sich die Statue eines alten römischen Kaisers. Man merkt, Baron Zeta ist ein Anhänger antiker Werte. Zu Beginn des zweiten Aufzuges ist es dann eine Solotänzerin, die gekonnt die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich zieht.

Sofia Kallio (Hanna), Falko Hönisch (Danilo)
In diesem Akt beherrscht eine Art Guckkastenbühne mit einer projizierten, sehr naturalistischen Sträucher- und Gebirgslandschaft die Bühne, die - einmal um die eigene Achse gedreht - auch den Pavillon bildet. In ihm residiert das von Karine van Hercke prächtig eingekleidete Naturkind Hanna wie eine Bergkönigin. Während des Duetts vom „dummen Reitersmann“ nimmt sie verspielt auf einem im linken Bühnenbereich platzierten Schaukelpferd Platz. Im ersten Akt erscheint sie gänzlich unkonventionell als mit den Pariser Salonregeln anscheinend noch nicht sonderlich vertraute Winterreisende mit Pelzmütze und modischem Blazer. Die Art, wie sie immer wieder lässig und salopp die Hände in die Taschen ihrer schicken weißen Hose steckt, macht auf vergnügliche Art und Weise deutlich, dass sie die Benimmregeln der in feine schwarze Abendanzüge gekleideten High Society, auf die sie etwas herunterblickt, noch nicht gänzlich verinnerlich hat. Zunehmend lernt sie, sich dieser feinen Gesellschaftsschicht anzupassen. Am Ende mischt sie sich dann gutgelaunt unter die Grisetten.
Dirigent Roland Fister und das gut gelaunt aufspielende Philharmonische Orchester Landestheater Coburg waren in guter Verfassung und präsentierten einen locker dahinfliessenden, spritzigen und farbenreichen Klangteppich, der aber auch einfühlsame emotionale und bedächtige Momente aufwies. Lustvolle Ausgelassenheit korrespondierte mit schöner Walzerseligkeit, und auch in dynamischer Hinsicht war die Leistung der Musiker abwechslungsreich und ausgeglichen. Insbesondere beim Lied der Grisetten, dessen Schluss mehrmals wiederholt wurde, sprang der sprichwörtliche Funke über.

Sofia Kallio (Hanna), Falko Hönisch (Danilo)
Insgesamt zufrieden sein konnte man auch mit den sängerischen Leistungen. Allen voran vermochte Sofia Kallio in der Titelpartie nachhaltig für sich einzunehmen. Sie hatte das Regiekonzept vollständig verinnerlicht und mit einer guten schauspielerischen Ader temporeich und gewitzt umgesetzt. Auch gesanglich bewies sie erneut, dass sie zu den ersten Kräften des Coburger Theaters gehört. Mit wunderbar italienisch focussiertem, mezzohaft anmutendem Sopran gestaltete sie die Hanna sehr tiefgründig und glänzte insbesondere in dem mit herrlicher Linienführung, warm, gefühlvoll und bestens sitzenden Pianissimi dargebotenen Vilja-Lied. Leider hatte sie die Rechnung ohne den verstaubten, aber von der Handlung her unentbehrlichen Fächer gemacht, der sie manchmal etwas husten ließ und einmal leider auch eine kleine vokale Indifferenz erzeugte. Das ist aber nicht Frau Kallio, sondern der Requisite anzulasten. Neben ihr bewährte sich als Danilo Danilowitsch Falko Hönisch. Schon äußerlich war der gut aussehende, fesche Sänger für den Grafen trefflich gewählt. Auch stimmlich bewältigte er mit insgesamt gut verankertem Bariton, der indes in der Höhe noch etwas profunder hätte klingen können, seinen Part solide. In puncto Stimmkraft und Volumen seines klangvollen Baritons war ihm indes Benjamin Werth überlegen. Es war etwas verwunderlich, dass dieser prachtvolle Sänger, der mit der kleinen Rolle des Vicomte Cascada eindeutig unterbesetzt war, nicht den Danilo singen durfte, den er sicher ganz brillant gegeben hätte. Als Camille de Rossilon machte mit sonorem, frischem Tenor italienischer Schulung David Zimmer nachhaltig auf sich aufmerksam. Neben ihm fiel die mit zu hoher Stütze und maskig singende Julia Klein in der Partie der Valencienne ab. Eine Fehlbesetzung stellte Michael Lion für den Baron Zeta dar. Dieser sonst vorzügliche Bassist kam mit den bis zum hohen g reichenden Höhen des pontevedrinischen Gesandten nicht zurecht und transponierte hoch liegende Stellen ständig nach unten. Diese Rolle sollte mit einem Bariton oder einem Tenor besetzt werden. Ein eher mäßiger Vertreter des letzteren Stimmfaches ist Freimut Hamman, der als Raoul de St. Broche ausgesprochen dünn klang. Köstlich war der Njegus des Schauspielers Stephan Ignaz, der besonders mit einem zwischen dem zweiten und dem dritten Akt angesiedelten heiteren Extemporé die Lacher auf seiner Seite hatte. Sascha Mai (Bogdanowitsch), Gabriele Bauer-Rosenthal (Sylviane), Martin Trepl (Kromow), Joanna Stark (Olga), Jan Korab (Pritschitsch) und Patricia Lerner (Praskowia) rundeten das homogene Ensemble ab.
Ludwig Steinbach, 10. 2. 2014 Die Bilder stammen von Andrea Kremper.
Stimmig
UN BALLO IN MASCHERA
Besuchte Aufführung: 19.11.2013 (Gastspiel in der Stadthalle Bayreuth) Premiere in Coburg: 26.10.2013 - zweite Kritik
Dem Schicksal ausgeliefert
Sie war schon ein würdiger Beitrag des Landestheaters Coburg und seines erfolgreichen Intendanten Bodo Busse zum Verdi-Jahr 2013, die Neuproduktion von „Un ballo in maschera“, die in jeder Beziehung einen gefälligen Eindruck hinterließ. Da die Coburger Bühne derzeit aufgrund eines Wasserschadens nicht bespielbar ist, liegt der Besprechung das Bayreuther Gastspiel des Landestheaters am 19. 11. 2013 zugrunde.

Milen Bozhkov (Gustavo), Leila Pfister (Ulrica)
Verdis Oper basiert auf dem historischen Mord an dem Schwedenkönig Gustav III. am 16. 3. 1792. Auf einem in der Stockholmer Oper stattgefundenen Maskenball war der Monarch vom Grafen Anckarström tödlich verwundet worden. Auslöser der Tat war das Vorhaben Gustavs III., den schwedischen Adel seiner Privilegien zu berauben, was diesem naturgemäß gar nicht recht war. Ein Königsmord auf der Bühne stellte zu Verdis Zeit ein ausgesprochenes Sakrileg dar, weswegen die Zensur die Aufführung des Werkes dann auch in der ursprünglichen Form verbot. Dabei dürfte die Erinnerung an den im Dezember 1856 verübten Anschlag auf König Ferdinando II, der das Attentat überlebte, noch ziemlich frisch gewesen sein. Notgedrungen verlegte Verdi die Handlung in das amerikanische Boston und änderte einige der aus der Geschichte überlieferten Namen. Aus Gustav III. wurde Riccardo und aus Graf Anckarström Renato, die Grafen Ribbing und Horn nannte er Samuel und Tom. Die Namen Amelia, Ulrica und Oscar ließ er dagegen unverändert, denn sie waren ein Produkt der Phantasie des Komponisten und seines Librettisten Eugène Scribe. Darüber hinaus ist die Dramaturgie der Oper mit ihrem Gemisch aus Politik, Liebe und Eifersucht frei erfunden. Den Pagen, der mit dem homosexuell veranlagten schwedischen König eine Beziehung pflegte, hat es indes tatsächlich gegeben. Der hat aber mit dem Oscar des Verdi’schen Werkes gar nichts zu tun. Die Coburger Produktion knüpft an das geschichtliche Ereignis an und stellt demgemäß Gustav III. in den Vordergrund. Sein Mörder heißt hier als Namenskombination aus den beiden Fassungen Renato Anckarström. Die Verschwörer sind hier aber keine schwedischen Grafen, sondern heißen traditionell Samuel und Tom.

Milen Bozhkov (Gustavo), Celeste Siciliano (Amelia)
Regisseur Volker Vogel, der nach den Operetten „Maske in blau“ und „Die Csardasfürstin“ in Coburg zum ersten Mal eine Oper in Szene setzte, geht es weder um eine Rekonstruktion der Historie noch um die Nachzeichnung einer operntypischen Dreiecksgeschichte. Sein Ansatz ist vielmehr übergeordneter weltgesetzlicher Natur und thematisiert das Unterworfensein des Menschen unter das Schicksal, dem sich keiner entziehen kann und das hier in Gestalt der gänzlich unkonventionell gezeichneten, in einer umzäunten eisernen Militäranlage hausenden jungen, hübschen und sexy anmutenden Wahrsagerin Ulrica erscheint. Wenn sie im Lauf des Abends immer wieder auftritt, zeugt das von dem trefflichen Umgang des Regisseurs mit Tschechow’schen Elementen. Den Mächten des Geschickes ist jeder in allen Ären gnadenlos unterworfen. Es handelt sich um eine zeitlose Problematik von allgemeiner Gültigkeit. Dem entspricht es, dass Norbert Bellen bei seinem nur spärlich mit einem romanischen Rundbogenportal, zwei verschiebbaren Wänden, Tisch und Stuhl sowie Kronleuchter ausgestatteten Bühnenbild sowie den ansprechenden Kostümen in zeitlicher Hinsicht nicht genau Farbe bekennt. Da gibt es Elemente verschiedener Epochen, so beispielsweise aus der Entstehungszeit des Werkes und der Weimarer Republik.

Celeste Siciliano (Amelia), Leila Pfister (Ulrica)
Die eher spärliche Ausstattung leistet einer exakten Figurenkonstellation Vorschub. Nichts lenkt von den Beziehungen der Handlungsträger untereinander ab. Vogels Regie bewegt sich insgesamt in konventionellen Bahnen, und auch die Führung der Personen hätte an manchen Stellen etwas stringenter ausfallen können. Aber was die Erzeugung von einfühlsamen Stimmungen in Form von Licht- und Schattenspielen angeht, ist er ein Meister seines Fachs. Solche gibt es in seiner Inszenierung reichlich. Sie verleihen der Produktion eine ganz eigene Ästhetik. So macht es beispielsweise einen tiefen Eindruck, wenn die Schatten der Stützpfeiler der transparenten Gardinen, durch die die Umrisse der einzelnen Personen oft schemenhaft durchschimmern, Gitterstäbe bilden. Diese eindrucksvolle visuelle Impression ist indes weniger real, sondern vielmehr symbolisch zu begreifen. Sie intendiert den Blick in die tiefsten Gründe der menschlichen Seele und macht deutlich, dass die Bestimmung des Menschen ein Gefängnis ist, aus dem kein Entkommen möglich ist. Alles ist vorbestimmt. Das offenbart sich am Ende mit unbarmherziger Konsequenz, wenn Ulrica als das Schicksal in Person hinter dem sterbenden König erscheint. Dieser geistige Überbau, den Vogel seiner Inszenierung angedeihen ließ, war durchaus überzeugend und insgesamt ansprechend umgesetzt.

Eine gute Leistung ist GMD Roland Kluttig am Pult zu bescheinigen. Sich über die Vielschichtigkeit der Partitur sehr im Klaren, präsentierte er sie in großer Differenziertheit und mit einer Vielzahl an Nuancen. Nicht allein auf Klangschönheit kam es ihm und dem versiert und intensiv aufspielenden Philharmonischen Orchester Landestheater Coburg an, sondern mehr noch auf eine deutliche Unterstreichung der verschiedenen Stile, von denen Verdis Musik geprägt ist. Das ist dem Dirigenten und den Musikern ausgezeichnet gelungen.

Auf hohem Niveau bewegten sich auch die sängerischen Leistungen. Wieder einmal wurde offenkundig, über was für ein hochkarätiges Sängerensemble das Landestheater Coburg doch verfügt. Da könnten so manche andere, auch größere Häuser neidisch werden. Das begann bereits bei Milen Bozhkov, der als Gustavo III. auf der ganzen Linie überzeugte. Schon von seinem einfühlsamen Spiel her, aber auch mit seinem schön italienisch focussierten, frischen und höhensicheren Tenor zog er jeder Facette seiner Partie, für die seine Stimme gut geeignet ist. Ihm zur Seite stand die wohlbeleibte, über einen ausgesprochen guten, fülligen und emotional angehauchten jugendlich-dramatischen Sopran verfügende Celeste Siciliano als Amelia. Ihre Arie im zweiten Akt sowie das anschließende Duett mit Gustavo gerieten zu Höhepunkten der Aufführung. Dem Liebespaar in Nichts nach stand Michael Bachtadze, der als Anckarström sowohl durch seine packende Darstellung als auch durch einen bestens sitzenden, elegant geführten Bariton nachhaltig zu gefallen wusste. An das hohe Niveau ihrer Kollegen/innen vermochte Sofia Kallio in der Partie des Marlene Dietrich nachempfunden Oscar in jeder Beziehung anzuknüpfen. Schon darstellerisch wurde sie dem munter herumtänzelnden Pagen, der gerne auch mal dem Richter frech die Zunge herausstreckt, ihn wie ein Hündchen an der Leine führt und schließlich auf seinem Rücken Platz nimmt, voll gerecht. Gesanglich verlieh sie ihm bei aller Spritzigkeit und Lockerheit ihres Vortrages sowie einer bis zu den eklatanten Spitzentönen der Rolle reichenden hervorragenden Koloraturgewandtheit ihres herrlich dunkel timbrierten, bestens italienisch gestützten Soprans eine sehr lyrische, gefühlvolle Note. Gut vermochte auch Leila Pfister zu gefallen, die sich den Ansatzpunkt der Regie trefflich zu Eigen gemacht hat. Sie legte die Ulrica fernab von allen Klischees an und gab dieser durch ihr durchsichtiges beiges Abendkleid, das oftmals ihre nackten Beine durchschimmern ließ, einen sehr erotischen Anstrich. Auch vokal war die Wahrsagerin bei ihrem voll und bis zu der ausgeprägten Tiefe hin rund und ausdrucksstark klingenden Mezzosopran in besten Händen. Gefällig präsentierte sich der solide verankerte Bariton von Martin Trepl als Silvano. Von den beiden Verschwören gefiel der sonor und profund singende Michael Lion (Tom) besser als Rainer Scheerer (Samuel), dessen Bass manchmal ziemlich im Hals saß. Mit weit besserem Stimmmaterial als man es bei dieser Mini-Partie sonst gewohnt ist, stattete Marino Polanco den Diener Amelias aus. Sehr dünn sang Jan Korah den Richter. Wieder einmal eine imposante Leistung erbrachte der von Lorenzo da Rio einstudierte Chor.
Ludwig Steinbach, 22. 11. 2013 Die Bilder stammen von Andrea Kremper.
UN BALLO IN MASCHERA
Besuchte Aufführung: 19.11. 2013 (Bayreuth, Stadthalle) Premiere in Coburg: 26.10.2013
Gut und ehrlich
Mehr als ein Musikwissenschaftler hat auf die Nähe des „Melodramma“ „Un ballo in maschera“ zu Wagners gleichzeitig komponierter „Handlung“ namens „Tristan und Isolde“ hingewiesen. Hier wie dort trifft sich ein Liebespaar im nächtlichen Dunkel des zweiten Akts, hier wie dort stört ein Dritter das Rendezvous, aber damit hat es sich auch schon mit den Ähnlichkeiten. Wer sich die geradlinige, allem Ornament abholde Inszenierung anschaute, die das Landestheater Coburg mit einer glänzenden Solisten-, Chor- und Orchesterbesetzung unter der erstklassigen, schlanke, aggressive und höchst sensible Klänge organisierenden Leitung Roland Kluttigs- in die Bayreuther Stadthalle schickte, wird kaum an das Werk des Antipoden des Genies der Oper gedacht haben.

Verdis Genie der Zuspitzung dramatischer Ereignisse, der Entwicklung von dramatisch motivierten Kantilenen, Ensembles und Tableaus – dieses Genie erfuhr mit der Aufführung eine schöne Bestätigung. Man hat erst vor 14 Tagen mit der Hofer „Aida“ gesehen, dass eine Oper Giuseppe Verdis keinen Ausstattungsprunk, auch keinen Aktionismus benötigt, um ihren affektiven Kern zu enthüllen. Wenn Großtalente wie Milen Bozhkov (in einer der schönsten verdischen Tenorrollen) und Celeste Siciliano (als wahrhaft „himmlisch“ intonierendes Sopranglück) in den Hauptrollen zu erleben sind, erledigt sich die Frage nach der gesellschaftspolitischen Relevanz einer ins Heute gedrehten azzione teatrale.

Volker Vogel hat die Geschichte des latent todesverfallenen Königs (dessen Mutter eine Schwester der Wilhelmine von Bayreuth war), der sich mehr für das Vergnügen als die Wohlfahrt von Staat und Volk interessiert, mit scheinbar leichter Hand als gelind psychologisches Stück im kostümlich vielfältigen Raum arrangiert. Im Interessenkonflikt zwischen ihm und der Adelsclique, die sich todeswütig gegen ihn verschworen hat, gewinnt der Tenor durch eine unerhörte Präsenz, der seine erste Stellung nicht durch allzu viele Lagrimoso-Töne belastet – bewegend aber ist sein Tenorschmelz dort, wo es darum geht, seine Playboygefühle in den tiefernst emphatischen Höhepunkt des „Liebesduetts“ und des endlosen Abschieds (im wahrhaft „himmlisch“ intonierten Des-Dur-Addio) zu verwandeln.
Der Dritte – sozusagen eine Mischung aus König Marke und Kurwenal – heißt Renato, also Michael Bachtadze. Vokal etwas harscher, wenn auch nicht hässlicher angelegt als der Tenor, begeistert der ins Helle aufgelichtete Bariton durch Emphase, Durchschlagskraft, gestalterische Intelligenz. Intelligent ist übrigens schon die Kostümgestaltung Norbert Bellens, der auch für die Bühne verantwortlich ist: trägt Renato uniformes, dem späten 18. Jahrhundert verhaftetes Schwarz, so tritt das Schicksal auf und zwischen den käfigförmigen Kuben ganz in modernem Weiß auf (daran erinnernd, dass Weiss, wie in Japan, eine Trauerfarbe und eine Farbe der Reinheit sein kann). Verdis „Maskenball“ ist auch aufgrund seiner Kontraste zwischen schicksalsschwerem Melodramma und offenbacheskem Coupletton - den der clowneske, an Offenbachs „Contes-Hoffmann“-Muse erinnernde Oskar der Sofia Kallo glänzend trifft – unvergleichlich geworden.

Hier agiert die Seherin Ulrica als Fatum, das noch im zweiten Teil, todverkündend, über die Bühne geistert. Leila Pfister (ein Ensemblemitglied des Staatstheaters Nürnberg) schenkt ihren dunklen, rotsamtenen Alt einer Rolle, die sie bis in die höheren Mezzo-Regionen bruchlos gestaltet.
„Die Welt wird reicher durch unsere Liebestaten“, heißt es bei Rudolf Steiner; man liest es im Programmheft. Die Welt wird auch reicher durch derart gute wie ehrliche Opernaufführungen.
Frank Piontek, 20.11. 2013 Fotos: Andrea Kremper
L’ ELISIR D’AMORE
Besuchte Aufführung: 6. 10. 2013 (Premiere: 21. 9. 2013)
Konventionelle Heiterkeit
Mit Schwung und guter Laune startete das Landestheater Coburg in die neue Saison. Auf dem Programm stand eine Neuproduktion von Donizettis „L’ Elisir d’ amore“, die einen heiteren, unbeschwerten Nachmittag bescherte und von dem zahlreich erschienenen Publikum voll akzeptiert wurde. Jean Renshaw ist eine solide, aber harmlose Inszenierung zu bescheinigen, die mit dem Bühnenbild und den Kostümen von Christof Cremer eine gelungene Symbiose einging.

Modernes Musiktheater scheint Frau Renschaws Sache nicht so sehr zu sein. Sie setzt vielmehr auf konventionelle Mittel und siedelt das Ganze in einem etwas surreal anmutenden Einheitsbühnenraum an, der sowohl Innen- als auch Außenbereich ist und an dessen Decke eine stattliche Anzahl Stühle hängt. Eine ausgedehnte, häufig benutzte hölzerne Rutsche führt vom Hintergrund bis in den vorderen Bereich der Bühne. Auf ihr rutscht auch Dulcamaras von einem Assistenten gelenkter Verkaufskoffer, dem der Quacksalber schließlich selber entsteigt, geradewegs in das Geschehen. Mit lockerer Hand beschwört die Regisseurin ein Stück unbeschwerten toskanischen Lebensgefühls herauf, lässt aber auch geschickt soziologische Aspekte in ihre Deutung einfließen.

Sie legt den Focus auf eine überalterte Dorfgesellschaft, deren Kinder längst in die Städte abgewandert sind. Adina ist aus so einer Metropole gerade zurückgekehrt und geht in ihrem Heimatort nun nicht so ganz eindeutigen Tätigkeiten nach. Sie kann einen Hof geerbt haben, andererseits aber auch Sozialarbeiterin oder Altenpflegerin sein. Eine genaue Antwort liefert die Regisseurin - bewusst? - nicht. Jedenfalls bringt sie das Leben im Dorf ganz schön auf Trab. Sie, Nemorino und Gianetta sind die einzigen jungen Leute in dieser Gemeinschaft von Senioren, die von der Regisseurin gekonnt in individuell gezeichnete Charaktere aufgespaltet wird, so beispielsweise in den alten Chordirigenten, einen Pfarrer und einen Blinden, der glatt in den Orchestergraben stürzen würde, wenn Adina nicht ein wachsames Auge auf ihn hätte. Diese gelungenen Individualisierungen trugen viel zum Gelingen des Nachmittags bei.

Es ist ganz offensichtlich, dass Frau Renschaw mit dem Chor hervorragend umzugehen versteht. Auch bei der Führung der Solisten wurde ihre choreographische Vergangenheit merkbar. Ihre Personenregie war ausgezeichnet. Sie ging äußerst versiert ans Werk, führte die Figuren sehr kurzweilig und heiter-beschwingt, wobei sie szenische Akzente in genauem Einklang mit der Musik setzte und auch mit zahlreichen witzigen, aber nie überzogen wirkenden Einlagen nicht sparte. Da steckte so mancher Gag im liebevoll herausgearbeiteten Detail. Für komödiantische Effekte hat die Regisseurin wahrlich eine gute Ader. So hinterließen beispielsweise das Tauziehen an einer aus BHs bestehenden Wäscheleine und die Attacke der mit Unterhöschen winkend auf den reichen Neuerben Nemorino eindringenden Alt-Weiber-Liga einen gefälligen Eindruck - desgleichen die Szenen, in denen Gianetta sich recht erotisch präsentieren und Teile ihrer Unterwäsche zeigen darf. Jean Renschaw versteht es schon, das Auditorium zu unterhalten. Als letztes Mittel diente ihr dazu der unter reger Einbeziehung der Rutsche durchinszenierte Applaus. Eine tiefgehende kritische Hinterfragung des Inhalts bzw. eine intellektuell-geistvolle Auseinandersetzung mit dem Stück blieb sie aber leider schuldig.

Bei Lorenzo Da Rio, der auch den Chor famos einstudiert hatte, war Donizettis Werk in guten Händen. Er animierte das Philharmonische Orchester Landestheater Coburg zu einem spritzigen, locker aufgefächerten Spiel von großer Klarheit und prägnanten, nie zu stark gesetzten Akzenten.
Zum größten Teil zu begeistern vermochte auch das aufgebotene Sängerensemble. Allen voran die wunderbare Sofia Kallio, die mit immenser Spiellust eine herrlich kokette und quirlige Adina gab und mit ihrem dunklen, mezzohaft anmutenden, bestens italienisch geschulten, sehr gefühlvoll und flexibel geführten und dabei äußerst koloraturgewandten Prachtsopran auch stimmlich hundertprozentig überzeugen konnte. Neben ihr lief David Zimmer ebenfalls zu großer Form auf. Er gab den Nemorino als sympathisches, schüchternes und leichtgläubiges Bürschchen, dem man seine große Liebe zu Adina ohne weiteres abnahm. Mit seinem bestens gestützten und nuancenreichen lyrischen Tenor wusste er auch gesanglich sehr für sich einzunehmen. Herrlich gelang ihm das sehr emotional und ausdrucksstark dargebotene „Una furtiva lacrima“. In dem Belcore hat Benjamin Werth eine neue Paraderolle für sich gefunden, der er in jeder Beziehung voll entsprach. Einfach köstlich, wie er diesen aufgeblasenen, selbstverliebten Macho von Sergeanten auf die Bühne brachte und mit sonorem, tiefgründigem hellem Bariton auch perfekt sang. Gianetta, zu der er sich am Ende hinwendet und die er kurzerhand schultert, wurde von der mit guter Körperstütze und substanzreich singenden Anna Gütter stark aufgewertet. Das hohe Niveau seiner Kollegen vermochte Rainer Scheerer in der Rolle des Dulcamara nicht ganz zu erreichen. Rein darstellerisch war er sehr glaubhaft. Indes müsste er seinen in der Mittellage insgesamt gut sitzenden, in der Höhe aber etwas flach und halsig klingenden Bass noch besser in den Körper bekommen. Als stummer Diener des Quacksalbers war Valentin Fruntke zu erleben.
Ludwig Steinbach, 12. 10. 2013 Die Bilder stammen von Andrea Kremper
Frühere Kritiken befinden sich weiter unten auf der Seite Coburg unseres Archivs (ohne Bilder)