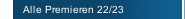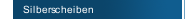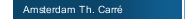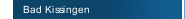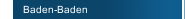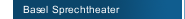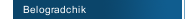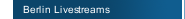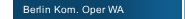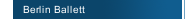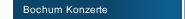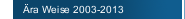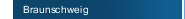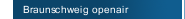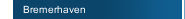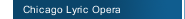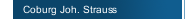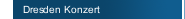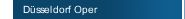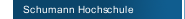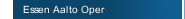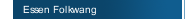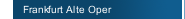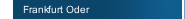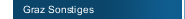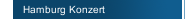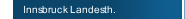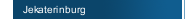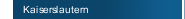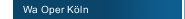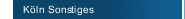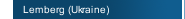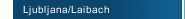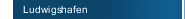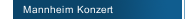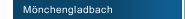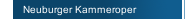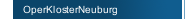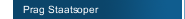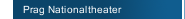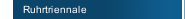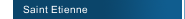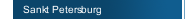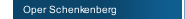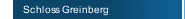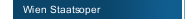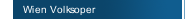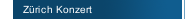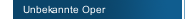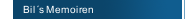ERL Festspiele 2022
LE ROI ARTHUS
Passionsspielhaus
Aufführung am 23.7.22 (Premiere)

Ernest Chausson (1855-1899) ist in den Konzertsälen bekannt, und da vor allem wegen der zarten Schönheit seiner mélodies. Die dem Sagenkreis um König Artus und seine Tafelrunde entnommene Handlung goss der Komponist selbst in einen Text, was angesichts seiner Verehrung für Richard Wagner nachgerade selbstverständlich erscheint. Das Werk blieb seine einzige Oper, deren Brüsseler Uraufführung 1903 er nicht mehr erlebte, war er doch mit nur 44 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls verstorben.
Warum aber konnte sich das dreiaktige Werk nicht im Repertoire halten? Dafür gibt es mehrere Gründe, nicht zuletzt, dass das Sujet im Schatten von Wagners "Tristan" steht. Die Geschichte um die Liebe von Lancelot und Genièvre, letztere die Gattin von König Arthus, ist in dieser Konstellation praktisch parallel zu Wagners "Handlung in drei Aufzügen", und Chausson hat sich wohl bewusst dafür entschieden (in der Gestalt von Lyonnel gibt es sogar eine Art Kurwenal). Dennoch ist die Liebe der beiden nicht mit der zwischen Tristan und Isolde zu vergleichen - sie ist irdischer, diesseitiger. Das zeigt sich vor allem an der Figur der Genièvre, die Lancelot, der ob des Verrats an seinem König leidet, Szenen macht und ihn beschwört, sie nicht zu verlassen. Der Ritter wird sich schließlich dennoch für seinen Untergang entscheiden und waffenlos in die Schlacht ziehen, um zu sterben. Die Frau erwürgt sich mit ihrem eigenen, langen Haar.

Schwerer scheint mir zu wiegen, dass Chausson offenbar der Sinn für dramaturgischen Aufbau fehlte. Es gibt im zweiten Teil des 2. Akts ein hochdramatisches, mitreißendes Liebesduett, eine jener Szenen, nach denen der Vorhang fallen müsste, um den Zuschauer atemlos zurück zu lassen. Hier aber folgt ein philosophischer Monolog des Königs, der nicht an die Untreue der zwei ihm am nächsten stehenden Personen glauben will. (Die Liebenden wurden von seinem Neffen Mordred, der selbst den Thron besteigen will, verraten). Ähnliches begibt sich am Schluss der Oper, wenn Arthus klar wird, dass seine und die Zeit seiner utopischen Tafelrunde vorbei ist und er in einer Art Apotheose symbolisch die Ewigkeit erreicht (was den Titel des Werks erklärt bzw. rechtfertigt, denn das Liebespaar hat viel mehr zu singen).
Chausson hat sieben Jahre lang mit diesem Stoff gerungen (und sich bei seinem engen Freund Debussy wiederholt über die damit verbundenen Schwierigkeiten beklagt), ohne dass es ihm gelungen wäre, die beiden Stränge - Liebesgeschichte und Überlegungen des Königs - dramaturgisch miteinander zu verbinden. Dies scheint mir der eigentliche Grund für die mangelnde Popularität des Werks, denn an der Musik kann es nicht liegen, ist sie doch trotz Wagners Einfluss durchaus nicht epigonal, sondern im besten Sinne französisch. Man denkt mehrfach an Berlioz und Bizet oder an Chaussons Lehrer César Franck, aber auch hier ohne das Gefühl von Epigonentum oder Zitaten. Die Instrumentation ist zudem in ihren Nuancierungen genial.

Die im Passionsspielhaus, das ohne Orchestergraben auskommt, angesiedelte Produktion war absolut auf der Höhe ihrer Aufgabe. Das Bühnenbild erschien wie eine Abwandlung von Wieland Wagners Bayreuther ellipsenförmiger Scheibe und wurde für die Auftritte der Solisten bestens genützt. Im Schlussbild wird sie von Feuer umzingelt - eine passende Verbeugung des Teams vor Wagner. Für die Bühne, wie auch für die mittelalterlich inspirierten, aber phantasievollen Kostüme zeichnete takis, für eine Regie, die die Solisten immer in spannende Beziehung zueinander setzte und auch den Chor sehr gut führte, war Rodula Gaitanou verantwortlich. Die hervorragende Beleuchtung von Simon Corder sei nicht vergessen und für das aufregende, die jeweilige Atmosphäre hervorragend übermittelnde Videodesign sei Dick Straker speziell gedankt.
Auch die musikalische Seite der Aufführung befand sich auf hohem Niveau. Karsten Januschke leitete hinter einem durchsichtigen Vorhang ein hellwaches Orchester der Festspiele Erl und erzielte meisterlich klingende, magische Momente. Die auf der Vorderbühne agierenden Solisten zeigten sich nicht nur sattelfest, ohne den Dirigenten sehen zu können, sondern gefielen sowohl stimmlich, als auch im Ausdruck. Der slowenische Bariton Domen Krizaj litt bei seinem ersten Auftritt vielleicht etwas unter Lampenfieber, da er ein wenig forcierte, gefiel dann aber mit schön gerundeten, expressiven Tönen. Beeindruckend die heldische Stimme des Iren Aaron Cawley, der dem Lancelot aber auch den Leidensdruck mitgab, der ihn an Genièvre kettet. Diese für einen Mezzosopran geschriebene Rolle wurde von der Sopranistin Anna Gabler gesungen, wobei es nicht so sehr um ein paar fehlende tiefe Töne geht, sondern um die der zwiespältigen Figur geschuldete Stimmfarbe.

Abgesehen davon gelang Gabler eine beeindruckende Leistung. Dem amerikanischen Tenor Andrew Bidlack gelang ein schönstimmig-intensiver Lyonnel. Merlin, die Sagengestalt, die Arthus über seine Aufgabe belehrt, hatte einen überzeugenden Vertreter in dem südafrikanischen Bariton Kabelo Lebyana. Auch Kleinstrollen waren nicht nur international, sondern auch überzeugend besetzt, so Anthony Robin Schneider (Bass, Neuseeland), Carlos Cárdenas (Tenor, Kolumbien) und Bozidar Smiljanic (Bassbariton, vermutlich Kroatien). Der Chor der Festspiele Erl, einstudiert von Olga Yanum (Weißrussland), gefiel durch homogenen Klang und Spielfreudigkeit.
Trotz der dramaturgischen Einwände dem Werk gegenüber wäre es interessant, wenn das Publikum sich öfter damit auseinandersetzen könnte. Dies schon auch der mehr als herzliche Beifall seitens des leider nicht voll besetzten Hauses zu bestätigen.
BIANCA E FALLIERO
Festspielhaus
Aufführung am 24.7.22 (Derniere)
Nach den großen Erfolgen von Gioacchino Rossini an der Mailänder Scala, und vor allem seiner "Gazza ladra" 1817, vertraute die Leitung des Hauses dem Komponisten die Saisoneröffnung 1819 an. Rossini versicherte sich für das Textbuch des Librettisten Felice Romani, der schon bei "Il turco in Italia" für ihn gearbeitet hatte.
Als Basis bediente sich Romani der französischen Tragödie "Blanche et Montcassin" aus 1798. Es geht um die wegen einer Erbschaft verfeindeten großen venezianischen Familien Contareno und Capellio; ersterer will aus Gründen der politischen Karriere dieser Lage ein Ende setzen und verspricht die Hand seiner Tochter Bianca dem in sie verliebten Capellio. Dieser geht auf den Handel ein, aber als der nicht aus großem Hause stammende Falliero von einer für Venedig ruhmreich geschlagenen Schlacht zurückkehrt, muss Contareno entdecken, dass Bianca die Heiratspläne zurückweist, weil sie und Falliero ein heimliches Paar sind. Contareno setzt heftige Mittel - vor allem psychischen Druck - ein, um Bianca umzustimmen, die zwischen der Liebe zu ihrem Vater und der zu ihrem Gefährten hin- und hergerissen ist. Falliero glaubt, an Biancas Standhaftigkeit zweifeln zu müssen, ein Fluchtversuch der beiden wird vereitelt und Falliero wegen Hochverrats vor das dafür zuständige "Gericht der Drei" gestellt. Bianca fleht für den Geliebten, und zum Erstaunen ihres tobenden Vaters entscheidet Capellio, das Urteil dem Senat vorzulegen, der den jungen Mann freispricht. Das führt zu einem Happyend, in dem Bianca das aus "La donna del lago" (im selben Jahr entstanden) stammende finale Rondo singt (wieder einmal hatte sich Rossini bei sich selbst bedient). Offen bleibt die Frage, warum Romani sich für einen der Vorlage nicht entsprechenden glücklichen Ausgang entschieden hat. (Im Vorwort zur gedruckten Ausgabe lässt der Autor die Möglichkeit durchscheinen, in einer Art vorauseilenden Gehorsams der österreichischen K.k.-Zensurbehörde zuvorgekommen zu sein).

Das Werk hatte an der Scala zunächst einen lauwarmen Empfang erfahren, doch bald tat der Mundfunk seinen Dienst, und es kam in der selben Spielzeit zu einer hohen Zahl von neuerlichen Vorstellungen. Es sollte die letzte für die Scala geschriebene Oper bleiben, aber vor Rossinis endgültigem Umzug nach Paris schrieb er noch zwei Werke für Neapel, eine für Rom und eine für Venedig, nämlich "Semiramide". Vergleicht man letztere kühne Arbeit mir der hier besprochenen, so muss festgestellt werden, dass diese auf klassischeren Bahnen entwickelt ist, aber dennoch Neues enthält, vor allem das den ersten Teil beschließende Quartett der vier Protagonisten.
Festspieldirektor Bernd Loebe, bekanntlich auch Intendant der Frankfurter Oper, hat diese Produktion aus seinem Haus importiert, wo sie im Frühjahr 2022 Premiere hatte. Das Bühnenbild von Karoly Risz besteht aus kreisförmigen Wänden, die sofort das Gefühl der Eingeschlossenheit und Beklemmung Biancas transportieren. In den zwischen modern und zeitlos changierenden Kostümen von Susanne Uhl lässt Regisseur Tilmann Köhler ein Psychodrama in stringenter Personenführung ablaufen, in dem auch der Chor als seine Meinung je nach Anlass wechselnde Masse einen zentralen Platz einnimmt. Nicht nur überflüssig, sondern sogar störend waren die Videos von Bibi Abel, die aus unerfindlichen Gründen sich verkrampfende Hände, die mit Lippenstift hantierende Bianca und Ähnliches zeigten. Ohne diese könnte man von einer perfekt gelungenen Regie sprechen.

Ganz ausgezeichnet war das musikalische Niveau, beginnend beim Dirigenten Simone Di Felice, der das Orchester der Tiroler Festspiele Erl zu einer brillanten, federnden Interpretation von Rossinis Musik führte. Überzeugend kompakt der Festspielchor, wieder von Olga Yanum einstudiert. Großen persönlichen Erfolg hatte Heather Phillips als Bianca. Die Amerikanerin ist im Besitz eines sehr reinen lyrischen Soprans, mit dem sie auch die virtuosen Stellen souverän bewältigte. Dazu gesellte sich eine sehr expressive Darstellung, was sie mit ihrem Falliero, der russischen Mezzosopranistin Maria Ostroukhova, verband. Auch hier stieß hochinteressantes stimmliches Material auf eine überzeugende technische Leistung. Die für heutige Ohren schwierigste Rolle hatte der Amerikaner Theo Lebow als rachsüchtiger Vater Contareno, den Rossini einem Tenor anvertraut hat, der seinen Zorn in Koloraturen und heute oft als unsingbar betrachtete sovracuti packen muss. Eine von dem Künstler vorzüglich bewältigte Aufgabe. Der Bass von Giovanni Battista Parodi (Capellio) klang ziemlich ermattet, doch stellte er szenisch seinen Mann. Als Doge ergänzte verlässlich Bozidar Smiljanic, in mehreren Kleinstrollen fiel Carlos Cárdenas mit hellem Tenor und viel Spielfreude auf.

Ganz großer Jubel eines fast ausverkauften Hauses.
Eva Pleus 29.7.22
Bilder: Xiomara Bender (Roi Arthus); Bender/Tiroler Festspiele Erl (Bianca e Falliero)
LOHENGRIN
Vorstellung am 31. Juli 2021
Statt Schwanenritter Rittertum für den Glauben
Die Tiroler Festspiele Erl haben unter ihrem Präsidenten Hans Peter Haselsteiner und dem Intendanten Bernd Loebe von der Oper Frankfurt in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorn getan. Nach den „Königskindern“ von Engelbert Humperdinck und Richard Wagners „Rheingold“ in der Neuinszenierung von Brigitte Fassbaender kam als drittes Werk nun „Lohengrin“ in einer Neuinszenierung von Katharina Thoma hinzu. Für sie ist diese „romantische Oper“ vor allem ein Stück über den Glauben. Und so zieht sie eine interessante und stimmige Parallele zum Spielort Erl, dem kleinen Ort in Tirol, der nicht zuletzt seit dem ersten Passionsspiel vor über 400 Jahren stark vom Glauben geprägt ist. Ohne diesen Glauben gäbe es die Tiroler Festspiele nicht, mit denen einst Gustav Kuhn ein international bekanntes Opernfestival mit einem sehr guten Orchester geschaffen hat. Und Glaube hat hier auch viel mit Vertrauen zu tun, dem Vertrauen Elsas zu Lohengrin, und damit dem Vertrauen der Menschen auf gutgemeinte Hilfe von außen…

Diesem Credo, welches auch immer wieder Statisten aus Erl eine begrenzte Mitwirkung bei den Aufführungen ermöglichte, ist Thoma auch mit ihrem Regiekonzept gefolgt. Denn es findet schon vor und zum Vorspiel mit rustikal gekleideten Erler Kindern unter der Gerichtslinde des Dorfes mit einem alten Segelkahn, der Assoziationen an das Narrenschiff von Hieronymus Bosch oder jenem in den Darstellungen von Albrecht Dürer hervorruft, ein kindliches Versteckspiel statt. In seinem Verlauf tritt auch Elsa das erste Mal auf. Mit dem 1. Akt beginnt eine Wanderung durch die vergangenen Jahrhunderte bis zur Gegenwart. Statt der Brabanter kommen Menschen als allen Epochen vom Mittelalter bis heute herein – ein sinnvoller Bogen über die mehr als eintausend Jahre alte „Lohengrin“-Geschichte. Neben Unternehmern, Handwerkern, Landstreichern unserer Tage und mittelalterlichen Mönchen in braunen Kutten tummeln sich Figuren, die aus Bildern von Dürer oder Pieter Brueghel d. Ä. entstiegen sein könnten. Bei Brueghel könnte man an seine Bilder „Rückkehr der Jäger“ sowie „Bauern, Narren und Dämonen“ denken. Im Narrenschiff von Albrecht Dürer sitzen Typen mit der gleichen Kopfbedeckung wie die des Heerrufers mit seinen eigenartigen Eselsohren… Dazu König Heinrich als würdevoll royal in Purpur gekleideter Monarch. Mit einer interessanten Choreografie führt Katharina Thoma diese bunte und agile Truppe, die die Universalität des Glaubens an sich und des Glaubens an Erlösung im „Lohengrin“, aber auch die Manipulierbarkeit der Massen eindringlich widerspiegelt.

In so eine Umgebung passt ein elegant im weißen Frack aus dem Orchester kommender Lohengrin als Geiger aus einer anderen Welt natürlich nicht hinein. So kann es kaum verwundern, dass er Telramund trotz erhobenen Schwerts mit dem Geigenbogen besiegt. Die Kostüme von Irina Bartels werden zu einem zentralen Element der Inszenierung im schlichten, aber im Laufe des Abends sinnvoller werdenden Bühnenbild von Johannes Leiacker, in dem Stefan Bolliger mit dem Licht einige Akzente setzt. Am Ende steigt Gottfried aus der Gerichtslinde herab und übernimmt die Insignien Lohengrins.
AJ Glueckert ist ein darstellerisch etwas behäbiger, aber herrlich lyrisch singender und phrasierender sowie musikalischer Lohengrin, der auch mit den Spitzentönen keine Mühe hat. Die junge Schwedin Christina Nilsson, die erst in der Saison 2018/19 mit ihrem Master-Abschluss als Ariadne auf Naxos in Stockholm debutierte, singt die Elsa mit einem glockenreinen Sopran und viel Ausdruckskraft in den entscheidenden Momenten des 3. Akts. Dshamilja Kaiser spielt eine finstere und arrogante Ortrud und singt sie mit ihrem kraft- und klangvollen Mezzo Bayreuth-reif. Andreas Bauer Kanabas ist ein mit königlich orgelndem Bass musikalischer König Heinrich. Domen Krizaj spielt sehr agil einen ebenso beeindruckend singenden Heerrufer mit klangvollem Bariton. Allein für Andrew Foster-Williams erscheint die Rolle des Telramund stimmlich eine Nummer zu groß. Samuel Levine, David Kerber, Oliver Sailer und Nicolas Legoux sind gute Brabantische Edle.

Titus Engel dirigiert das wieder in beachtlicher Größe auf der Empore hinter der Bühne und einem leicht durchscheinenden Vorhang postierte Orchester der Tiroler Festspiele Erl mit einem filigranen und transparenten Klang, aus dem er Wagners mit dem Werk verbundene Utopie betonen will. Das ist ihm an diesem Abend mehr als gelungen. Der stets präsente und ebenso transparent wie kräftig singende Chor der Tiroler Festspiele Erl wurde von Dmitri Khliavitch einstudiert. Ein zu Erl und seiner Geschichte passender „Lohengrin“ bei den Tiroler Festspielen und damit auch ein würdiger Abschluss der Sommersaison 2021.
Fotos: Xiomara Bender
Klaus Billand/12.8.2021
www.klaus-billand.com
Zweiter Premierrenbericht:
DAS RHEINGOLD
Ein großer Abend im Erler Passionsspielhaus!

Die Rheintöchter mit dem Gold
Nun fand die lang erwartete Premiere des Vorabends des neuen Erler „Ring des Nibelungen“ in der Inszenierung von Brigitte Fassbaender unter der musikalischen Leitung von Eric Nielsen statt. Wir erlebten am Abend nach der nicht ganz so überzeugenden Premiere der „Königskinder“ von Engelbert Humperdinck, die im Festspielhaus stattfand, ein die Erwartungen noch übertreffende erstklassige Aufführung des „Rheingold“ im Passionsspielhaus, wo auch Gustav Kuhn immer schon seine Wagner-Produktionen aufführen ließ.

Rheintöchter und Alberich
Selbst mit den eher beschränkten Mitteln dieser Spielstätte kam einem zu keinem Zeitpunkt in den Sinn, dass es sich eher um eine halbszenische Inszenierung der weltberühmten Mezzosopranistin Fassbaender handelt, deren Bühnen- und Kostümbildner Kaspar Glarner mit dem Licht von Jan Hartmann für zeitweise fantastische Momente sorgt, die einen tief in die „Rheingold“-Dramaturgie und -Ästhetik eintauchen lassen. Geschickt wird auf drei breiten Projektionsflächen mit dezenter Videotechnik gearbeitet. Vor der mittleren hinter den Sängern ist das Riesenorchester schemenhaft zu erkennen. Eine ausgezeichnete Personenregie mit ein paar speziellen und so noch nicht erlebten Momenten, die vielleicht gerade eine weibliche Handschrift zeigen, schafft Fassbaender eine ungewöhnlich hohe Intensität in der Schilderung der Erlebnisse, Schicksale und Charaktere der Protagonisten, bis bin zu den Rheintöchtern, sodass ihr „Rheingold“ in der Tat wie eine „Kriminalkomödie“ daher kommt, wie sie im Programmheft schreibt. Ein szenisch und dramaturgisch ungewöhnlich fesselnder Abend mit überwiegend neuen Sängern im Wagnerfach, von denen ich neben der bewährten Dshamilja Kaiser als Fricka besonders den Loge von Ian Koziara, den Alberich von Craig Colclough, die allenfalls etwas zu hell singende Erda von Judita Nagyová und den Mime von George Vincent Humphrey hervorheben möchte. Simon Bailey als Wotan agiert zwar sehr überzeugend, lässt es aber etwas an vokalem Volumen fehlen.

Die Riesen in Verhandlung mit den Göttern
Dass es auch musikalisch ein großer, ja eigentlich sensationeller Erfolg werden würde, war schon am ersten Raunen des tiefgründigen Es-Dur-Akkords aus der Tiefe der Bühne zu vernehmen, mit dem das wohl nach Wagner originalbesetzte Orchester der Tiroler Festspiele eine nahezu fantastische „Rheingold“-Performance hinlegte, unter der offenbar höchst kenntnisreichen Hand von Eric Nielsen.

Das Leben, doch nicht den Ring!
Wer dieses Werk noch nicht kennt und in seiner Essenz kennen lernen will, der sollte nun nach Erl kommen, oder im Juni 2022 in den Palast der Künste MÜPA in Budapest, wo Hartmut Schörghofer seine ohnehin schon gelungene halb-szenische „Ring“-Inszenierung überarbeiten wird. Der „Tristan“ von Simon Stone beim laufenden Festival d’Aix en Provence sei hingegen nur hartgesottenen Kennern im Endstadium empfohlen. In Erl kann man wieder einmal erleben, wieviel Aussagekraft in Wagners Musik steckt und in welchem Maße sie ein Über-Inszenieren ad absurdum führt.
Klaus Billand
https://www.klaus-billand.com
Fotos: Xiomara Bender/Festspiele Erl
DAS REHINGOLD
10. Juli 2021 Premiere

Zunächst wirken die Tiroler Festspiele jenen von Bayreuth gar nicht mal so unähnlich. Auch die Spielstätte im idyllischen Erl liegt abseits einer Metropole in der Provinz, das Festspielhaus thront auf einem grünen Hügel – ganz wie in der fränkischen Kleinstadt. In Erl pflegt man eine Wagner-Tradition und das Orchester bleibt für das Publikum hinter der Szene platziert unsichtbar und die Holzbänke im Passionsspielhaus, der Spielstätte für den neuen Ring-Zyklus, sind sicherlich so unbequem wie jene in Bayreuth. Und doch sind die Tiroler Festspiele Erl erfrischend anders, denn hier singen nicht die üblichen Wagner-Stars, sondern junge und besonders ambitionierte Sängerinnern und Sänger, die sich mitunter erst am Ausgangspunkt ihrer möglichen Weltkarriere befinden. Sie erproben sich hier in Wagner-Rollendebüts.
Der Intendant der Oper Frankfurt, Bernd Loebe, leitet seit zwei Jahren die Tiroler Festspiele Erl und beweist dort die Festspieltauglichkeit seines Frankfurter Erfolgsrezepts. An der Oper Frankfurt hat sich Loebe über die letzten zwei Jahrzehnte als Stimmenkenner schlechthin bewiesen und eines der weltbesten Opernensembles aufgebaut. Auch dieses neue „Rheingold“ in Erl bestach durch zahlreiche schon in Frankfurt beliebte Solisten. Loebe weiß genau, wann welcher Sänger oder Sängerin für eine Rolle bereit ist, schont deren Stimmen und vermeidet somit Fehlbesetzungen.

Als erfahrene Regisseurin steht ihm die legendäre Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender für den neuen Ring-Zyklus zur Seite. Sie verzichtet in ihrer Inszenierung auf ausufernde und aufwendige Regietheater-Ideen und erzählt sehr librettogetreu die Geschichte vom Raub des Rheingolds und der Misere der Göttersippschaft Wallhalls, jedoch nicht ohne das Geschehen visuell in die Neuzeit zu holen und die Götter nur allzu menschlich darzustellen. So verdeutlicht sie die immanente Aktualität des Werks. Auf der Bühne dienen lediglich einige wenige Requisiten als Unterstützung – beispielsweise Koffer, die den Einzug nach Walhall verbildlichen. Ansonsten stellt Fassbaender ganz die Mimik, Gestik und das Spiel in den Vordergrund ihrer Deutung. Dabei entwickelt sie mit zahlreichen Seitenhandlungen vertiefte Charakterstudien für alle noch so kleinen Partien dieser Oper. Beispielsweise hat sich Froh in ihrer Inszenierung in die Göttin Freie verliebt, Loge scharwenzelt mit so ziemlich jeder weiblichen Gestalt herum und Freia gibt dem Gott Donner die Inspiration zum Wolkenverzug.
„Das Rheingold“ ist eine Ensembleoper wie keine andere Richard Wagners, sodass die 15 kleinen bis mittelgroßen Rollen – die richtigen Mörderpartien wie Brünnhilde folgen erst in den drei weiteren Teilen – mit zahlreichen Rollendebüts junger Sängerinnen und Sängern besetzt werden konnten.

Der Dirigent Erik Nielsen und die Regisseurin Brigitte Fassbaender haben gute Arbeit geleistet und sämtliche Rollen akribisch mit ihren Ensemble einstudiert. Die meisten Sängerinnen und Sänger haben deutsch zur Fremdsprache und überzeugten dennoch durchwegs mit verständlicher Aussprache und einem sicht- und hörbar manifestiertem Rollenverständnis.
Simon Bailey in der Rolle das Göttervaters Wotan zeigte sich als ein Sänger auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit seiner rauen Stimme und einer deutlichen Aussprache liegt ihm die Partie des Rheingold-Wotans schlicht ideal. Aber auch optisch mit seinen grauen Haaren und Bart nahm man ihm die Darstellung seiner Rolle vollends ab.
Herrlich selbstsicher und Zwietracht stiftend trat Ian Koziara im neongelben Kostüm als Feuergott Loge auf. Auch wenn seine Stimme nicht ganz den Anforderungen des Charakterfachs entsprach, überzeugte er mit souveräner Darstellung. Koziara verfügte über eine glänzende Stimme mit wunderschönem Timbre, dank welcher er sicherlich in wenigen Jahren als Parsifal oder Lohengrin die Herzen des Opernpublikums erobern kann.

Thomas Faulkner schien als Riese Fasolt mit einer samtenen und klangschönen Stimme fast schon ein wenig zu harmoniebedürftig – man empfand gar Sympathie mit ihm! Faulkner gegenüber gab Anthony Robin Schneider mit düsterer Klangfarbe einen erbarmungslosem Riesen Fafner.
Zum Höhepunkt der Aufführung wurde die Darstellung von Craig Colclough in der Rolle des Zwerg Alberichs. Bei sicherer Stimmführung mit einem furchteinflößenden Timbre, dabei unübertroffen in Mimik und Gestik, verkörperte er zwischen Hohn, Pein und Scham jede Gefühlswallung dieser wohl tragischsten Figur Richard Wagners.
Erst in der letzten Woche dirigierte Erik Nielsen “Das Rheingold“ bei den Münchner Opernfestspielen in Starbesetzung. Im Passionsspielhaus Erl entstand unter seiner Leitung ein schöner Mischklang, in welchem er einen Sinn für die großen musikalischen Bögen demonstrierte. Durch die präsente Darstellung des Solistenensembles, das abgetrennt durch einen schwarzen Vorhang vor dem unsichtbaren Orchester sang und spielte, gerieten die Details seiner Orchesterarbeit jedoch etwas in den Hintergrund.

Die Besetzung der in den nächsten Jahren folgenden Premieren von Wagners Ring-Zyklus wird sicherlich eine Herausforderung werden, denn alles steht und fällt mit den überaus anspruchsvollen Partien von Brünnhilde, Siegmund und natürlich Siegfried. Wir vertrauen aber weiterhin auf das glückliche Händchen von Bernd Loebe im Casting und das gründliche Rollenstudium mit Regisseurin Brigitte Fassbaender und Dirigent Erik Nielsen.
Noch sind einzelne Karten für die weiteren Festspielvorstellungen erhältlich. Die An- und Abreise nach Erl ist auch ohne eigenen PKW mit Shuttle-Bussen von den umliegenden Bahnhöfen Kufstein und Oberaudorf möglich. Von dort verkehren Anschlusszüge nach München, Rosenheim und Innsbruck.
Phillip Richter, 15.7.2021
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
@ Xiomara Bender
Credits
Orchester der Tiroler Festspiele Erl
Musikalische Leitung Erik Nielsen
Regie Brigitte Fassbaender
Bühnenbild & Kostüme Kaspar Glarner
Licht Jan Hartmann
Video Design Bibi Abel
Dramaturgie Mareike Wink
Wotan: Simon Bailey
Loge: Ian Koziara
Alberich: Craig Colclough
Mime: George Vincent Humphrey
Fricka: Dshamilja Kaiser
Erda: Judita Nagyová
Fasolt: Thomas Faulkner
Fafner: Anthony Robin Schneider
Donner: Manuel Walser
Froh: Brian Michael Moore
Freia: Monika Buczkowska
Woglinde: Ilia Staple
Wellgunde: Florence Losseau
Floßhilde: Katharina Magiera
ERL 2019

Foto: Xiomara Bender/ Tiroler Festspiele
DIE VÖGEL
Premiere am 20.7.2019
Ein Kunstwerk, dem keine Regie etwas anhaben kann…
Endlich fand eines der stärksten Werke des Komponisten Walter Braunfels, „Die Vögel“, seinen Eingang in die Tiroler Festspiele Erl, nachdem im Jahre 2014 die südkoreanische Regisseurin Yona Kim am Theater Osnabrück eine m.E. wegweisende Inszenierung und auch die Volksoper Wien in den 1990er Jahren eine prachtvolle Produktion herausbrachten. Der interimistische Erler Künstlerische Leiter, Andreas Leisner, dem Braunfels immer schon ein Anliegen war, machte es nun möglich. Und zwar in dem herrlich gelungenen Festspielhaus mit seiner glänzenden Akustik und hervorragenden Sicht von allen Plätzen. Es erinnert angesichts des Stücks an diesem Abend auch optisch an einen Vogel, denn so könnte man das dunkle, weit ausladende Dach seiner kühnen architektonischen Konstruktion interpretieren. Die äußeren Rahmenbedingen war also perfekt, und man konnte sich bei dieser nicht wie die diesjährige „Aida“ zum Mainstream gehörenden Oper auch eines ausverkauften Hauses erfreuen - und dass offenbar gleich zweimal (auch 27.7.).

Walter Braunfels bezeichnete in seiner Rundfunkrede anlässlich der Frankfurter Neuaufnahme der „Vögel“ 1948 sein Meisterwerk als „lyrisch phantastisches Spiel“. Das ist unmittelbar aus der facettenreichen und bisweilen spätromantisch schillernden sowie hymnisch klingenden Partitur zu entnehmen. Inhalt und Aussage der Oper hängen eng mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen, die 1913 vor dem 1. Weltkrieg begann und mit der UA 1920 danach endete. Der Komponist fühlte sich wohl durch das mit einer gewissen Großmannssucht verbundene „satte Behagen, da es kaum einen Genuss zu geben schien, der nicht … erreichbar“ war, zum Sujet nach Aristophanes (415 v. Chr.) angeregt, wo das Spiel allerdings fröhlich endet. Die Gräuel des 1. Weltkriegs sowie Braunfels‘ Kriegsverwundung ließen ihn, dem „der Krieg die Feder aus der Hand nahm“, das Stück auf eine phantastische Ebene heben, eben auf jene der Vögel ,die als Metapher für die Menschheit stehen, die erleben muss, welch grässlichen Folgen eine gedankenlose Selbstüberschätzung haben kann, wenn man sich ohne viel Reflektion, demagogisch inspiriert (von Ratefreund) und gar trotz eindrücklicher Warnungen (durch Prometheus) in ein überhebliches militärisches Abenteuer stürzt. Denn genau diesem Rat des Tatmenschen Ratefreund fallen die dafür aber auch schon aufgeschlossenen Vögel anheim und erkennen erst, als es schon fast zu spät ist, die Bedeutung der Götter. Oder wie es Tina Lanik, eine Schauspiel-Regisseurin mit vielen Engagements am Residenztheater München, in der Prometheus-Szene mit einer subtilen Anspielung auf die Erhaltung der Umwelt als übergeordnetem Gut interpretiert, also einem momentan zu relevanter Bedeutung gekommenen Grundsatzthema.

Allerdings greift ihre Inszenierung durch die Kostüme der Vögel, die hier eben gar keine sind, sondern wie Ratefreund und Hoffegut als Menschen in Form eines Opernensembles dargestellt werden, empfindlich zu kurz. Denn es ist ja gerade die Metapher der Vögel, eben diese Braunfelsschen Phantasiegebilde, die den Charakter des „lyrisch phantastischen Spiels“ ausmachen und indirekt auf die Schwächen und das Schicksal der Menschen hinweisen, um die es natürlich geht. Daneben gibt es nach Braunfelsscher Darstellung zwei weitere Ebenen, die der Menschen in Ratefreund und Hoffegut und jener der Götter in Zeus und seinem Boten Prometheus. Wenn man daran denkt, dass der Komponist ein großer Verehrer des Wagnerschen Oeuvres war, kommen einem hier sofort die drei Ebenen des „Ring des Nibelungen“ in den Sinn, nämlich die Nibelungen (unter der Erde) die Riesen (auf der Erde) und die (Götter) über der Erde, wie der Wanderer sie im „Siegfried“ besingt.
Im Verzicht auf die Vögel zeigt sich wieder einmal die fast schon „standesgemäße“ Berührungsangst modern bzw. zeitgenössisch orientierter Regisseure und Kostümbildner mit vermeintlich oder tatsächlich traditionellen Werkelementen, wie beispielsweise der bühnenreifen Darstellung von Vögeln in einer Oper. Für Kostümbildnerin Heidi Hackl wäre, wie sie im einzigen Aufsatz im Programmheft schreibt, denn die Regisseurin enthält sich hier, „die naheliegende naive Übersetzung des Begriffes VOGEL in eine artifizielle Form in Tina Laniks Inszenierungen ohnehin fehl am Platz.“ Hackl stellt sich aber gleichwohl die Frage, „wo da eine Denknische für den Zuschauer bliebe“ und ihr „klar wurde, dass bei meinen Überlegungen zu den Kostümen ein Balanceakt zu bewältigen ist.“ Und bei allem Respekt für viele interessante und auch spannende Aspekte dieser Produktion ist für mich dieser Balanceakt gescheitert. (Es gab aber sicher ein Netz unten…). Wenn es auch etwas banal und plakativ klingt: Wenn man in der Oper „Die Vögel“ keine wie auch immer stilisierten oder phantasierten Vögel zeigen will, verliert das Stück seine entscheidende Dimension. Vielleicht sollte man dann „Die Vögel“nicht inszenieren. Erst durch den Einbruch der beiden gelangweilten bzw. mit ihrer Gesellschaft überdrüssigen Menschen in die Vogelwelt und die Konflikte bzw. Annährungen, die dann zwischen diesen beiden Ebenen entstehen, werden die Dinge, um die es hier geht, klar erkennbar. So wird auch nicht offenbar, warum das „bunte Völkchen“ sich über die Anwesenheit zweier Menschen als „Verrat“ ereifert und beide töten will. Dass die Nachtigall ein Vogel ist und deshalb die menschlichen Liebesschwüre von Hoffegut nicht versteht, ist natürlich schwer nachvollziehbar, wenn sie als attraktives Vollweib auf die Bühne kommt...

Sind die Protagonisten bereits die Menschen selbst, fällt also die wichtige phantastische Ebene der Vogelwesen weg. Das Stück wird zu einem normalen Musiktheaterstück, in dem nur Menschen agieren und die Spannungen an Kraft verlieren, wenn sie überhaupt entstehen. Beideoben genannten Inszenierungen hatten damit kein Problem und waren gerade zum Verständnis von Nichtkennern des Werkes, deren es ja (noch) sehr viele gibt, entscheidend. Dazu gehört natürlich auch die hier wieder einmal zu erlebende Inszenierungstechnik des auch schon etwas abgegriffenen Topos‘ „Theater im Theater“, sich im geometrischen Bühnenbild von Stefan Hageneier spiegelnd, in dem dieses Opernensemble werkelt, die Nachtigall als Primadonna während ihres herrlichen Auftaktgesangs im Prolog von einer servilen Garderobiere als vermeintlichem Zaunschlüpfer ein bombastisches Ballkleid angepasst bekommt und der Wiedehopf des Öfteren als abgewrackter Theaterdirektor in Turnhose oder im Bademantel herumstolziert.
Auch zur Darstellung einer Stadt konnte man sich nicht durchringen. So wurden große graue Müllsäcke platziert, womit die Idee der Zerstörung der sorgsam und systematisch aufgebauten „prächtigen“ Stadt samt ihrer paramilitärischen Organisation durch das Gewitter des Zeus unverständlich bleibt und bedeutungslos verpufft - denn es gab ja gar nichts zu zerstören. Zudem mussten die Säcke noch in aller Eile vor dem Finale weggeräumt werden…
Dass in Erl im 2. Akt das attraktive nachkomponierte Ballett ‚Taubenhochzeit‘ entfällt, wird angesichts der hier maßgebenden Ästhetik der Dunkelheit mit ebenso düsteren Gestalten, die mit Taschenlampen im Nichts suchen, unmittelbar einleuchtend. Das hatte eher etwas Forensisches. Dazu taucht ein Sensenmann auf, der zwei Bräute mit Totenmasken an den Händen führt - wohl Prokne und Philomela aus der griechischen Mythologie. Immerhin bekommt man im wabernden Nebel des Dunkels einen stilisierten tanzenden Raben zu sehen, der nach überholten Vorstellungen ja auch ein Todesbote war. Die auch dem 2. Akt durchausinnewohnende Komik kam nicht zur Geltung. Auch verstörte das oftmalige Herein- und Hinausgehen von (stummen) Ensemblemitgliedern durch einige Seitentüren, um zu sehen, was sich auf der Bühne abspielt. Diese Türen bekamen eigentlich erst ganz am Ende einen Sinn, wenn sie für Hoffegut versperrt sind.
Das ist sehr stimmig: Während der kunstverschlossene, ebenso demagogische wie spießige Rategut sich wieder an seinen warmen Ofen in die Gemütlichkeit zurückzieht, scheitert der Poet Hoffegut zutiefst getroffen und verzweifelt an seiner Liebe zur Nachtigall, dem gewissen Fremden, das er sich immer ersehnte. Leider verschenkte die Regie auch die letzten Töne der Nachtigall: Statt dass sie als Sehnsuchtsbild ganz hinten steht - Hoffegut vernimmt ein letztes Mal ihre Stimme, wendet sich um nach ihr, kann sie aber nicht mehr verstehen und geht verzweifelt ab - steht sie hier vorne an der Rampe, singt viel zu laut und fällt kurz vor dem Vorhang (ohnmächtig?) um... Eine zu platte - in des Wortes wahrster Bedeutung - Lösung für eine so große Botschaft des Stücks!
 Julian Orlishausen spielte einen aufdringlichen Ratefreund und sang ihn mit klangvollem Bariton, obwohl er bei der Premiere etwas indisponiert gewesen sein soll. Marlin Miller konnte als romantisch Verliebter und bei allgemein guter Personenregie auch exzellent darstellender Hoffegut überzeugen. Sein Tenor klang vielleicht etwas zu metallisch. Bianca Tognocchi sang die Nachtigall mit einem für die Rolle an sich zu dramatischen Sopran. Zu der Rollenkonzeption in dieser Art der Inszenierung passte die Stimme jedoch, denn von Romantik war nur fallweise etwas zu spüren. Dennoch erschien mir der Auftritt des Prometheus, den Thomas Gazheli im Gewühl der grauen Müllsäcke nicht von der Bedeutungsschwere, die er in den o.g. Inszenierungen hatte. Schade auch, dass der finale Lobgesang auf Zeus (die Natur) von einem Chor im Orchestergraben (!) gesungen wurde - statt von geläuterten - vom Sturm zerzausten - Vögeln alias Opernsängerinnen auf den Trümmern der vom Krieg zerstörten Stadt!
Julian Orlishausen spielte einen aufdringlichen Ratefreund und sang ihn mit klangvollem Bariton, obwohl er bei der Premiere etwas indisponiert gewesen sein soll. Marlin Miller konnte als romantisch Verliebter und bei allgemein guter Personenregie auch exzellent darstellender Hoffegut überzeugen. Sein Tenor klang vielleicht etwas zu metallisch. Bianca Tognocchi sang die Nachtigall mit einem für die Rolle an sich zu dramatischen Sopran. Zu der Rollenkonzeption in dieser Art der Inszenierung passte die Stimme jedoch, denn von Romantik war nur fallweise etwas zu spüren. Dennoch erschien mir der Auftritt des Prometheus, den Thomas Gazheli im Gewühl der grauen Müllsäcke nicht von der Bedeutungsschwere, die er in den o.g. Inszenierungen hatte. Schade auch, dass der finale Lobgesang auf Zeus (die Natur) von einem Chor im Orchestergraben (!) gesungen wurde - statt von geläuterten - vom Sturm zerzausten - Vögeln alias Opernsängerinnen auf den Trümmern der vom Krieg zerstörten Stadt!
Adam Horvath sang die Stimme des Zeus und den Adler, James Roser den Wiedehopf, Sabina von Walther den Zaunschlüpfer, Attila Mokus den Raben und Giorgio Valenta den Flamingo. Die Tänzerin des Raben im 2. Akt war Anastasiya Maryna. Der quirlige „Vögel“-Chor der Tiroler Festspiele Erl sang klar, sehr engagiert und war auch gut choreografiert.
Musikalisch litt der 1. Akt (quasi eine Konversationsoper mit wenig Handlung) unter der musikalischen Leitung von Lothar Zagrosek daran, dass er zu wenig zwischen lyrischen, (Nachtigall, Hoffegut), und (tragi-)komischen (Ratefreund, Wiedehopf), Passagen Unterschied und alles gleich laut und gleich schnell klang. Im 2. Akt bewies die grandiose Musik von Walter Braunfels jedoch, dass sie nicht kaputt zu kriegen ist, von welcher Inszenierung auch immer. (Das sagt man ja auch, und zu Recht, von Richard Wagner…). Das liegt auch daran, dass die Kontraste im Gegensatz zum feingliedrigen ersten Akt groß auskomponiert sind. Das Orchester der Tiroler Festspiele Erl zeigte sich von seiner besten Seite.
Man ist auf mehr von Walter Braunfels in Erl gespannt. Es muss ja nicht unbedingt gleich wieder eine Oper sein, sondern man könnte auch einmal eines seiner großen Orchester- und Chorwerke wie die „Große Messe“ oder das „Te Deum“ aufführen.
Fotos: Xiomara Bender/ Tiroler Festspiele
Klaus Billand, 31.7.2019
GUILLAUME TELL
WA am 13.7.2019
Für nur eine Aufführung studierte man eine drei Jahre alte Produktion des Rossinischen Spätwerkes ein, im Gegensatz zur Premiere, die in italienischer Sprache gezeigt wurde, nun diesmal im originalen französich. Nun ist dieses Werk eine wirklich „große Oper“ mit enormen Anforderungen an Solisten, Chor und auch die szenische Umsetzung ist so einfach nicht. Erfreulicherweise kann ich von einer wahrhaft gelungenen, festspielreifen ( im besten Sinne des Wortes) Aufführung berichten!
Nach einer Produktion von „Furore di Montegral“ – so ist es im Programm zu lesen. Die Regie hatte Gustav Kuhn, der die Geschichte schlicht und ohne Mätzchen auf die Bühne stellte, in einem stimmungsvollen, einfachen Bühnenbild, mit dem Alfredo Troisi die einzelnen Schauplätze gut charakterisiert und auch teils großer, verschiebbare Figurinen in schönen Farben einfache Szenenwechsel ermöglicht. Die kleidsamen Kostüme stammen von Lenka Radecky, die Choreographie des Ballets, das auch teilweise zur – unaufdringlichen – Illustration der Handlung herangezogen wird ( etwa der Flug des Pfeiles in der Apfelschussszene wurde durch Tänzerdargestellt ), besorgte Katharina Glas.
Das Orchester und die Chorakademie der Tiroler Festspiele Er ( Chorleitung: Olga Yanum) erschienen zum Vortag wie ausgewechselt! Plötzlich war aus dem Graben ein differenzierter Klang zu Vernehmen, die Konzentration schien um ein Vielfaches mehr, die stark geforderten Chöre gelangen präzise und mit voller Klangpracht, es wurde auch weit animierter mitgespielt und agiert. Wer war nun dieser „Zauberer“, der dieses Kunststück zu Wege gebracht hat? Nun es war Michael Güttler am Pult, der aber überhaupt nicht zaubern musste, sondern durch seine offensichtliche Beherrschung und auch Liebe zum Werk Zeit hatte sich einfach um alles zu kümmern! Ich sage es erfreut, ein Maestro im Stile der hervorragenden „Concertatori“, der „Kapellmeister“ der guten alten Schule, die so selten geworden sind! Da wurde dem Graben genauso viel Zuwendung entgegengebracht, wie dem Mitatmen mit den Solisten auf der Bühne, die sich mit ihren Bedürfnissen nie verlassen , sondern bestens aufgehoben fühlen konnten, oder der Chor, der mit perfekten Einsätzen bedient und unterstützt wurde. Immer wieder gab es anerkennende, aufmunternde Blicke und Gesten für die Musiker im Graben, es wurde beglückend miteinander musiziert – es war eine Freude für alle im Hause anwesenden. Bereits mit der mitreissend interpretierten Ouverture konnte man die positive Energie spüren, und einen großen Abend erwarten, der er auch wurde.

Foto: Xiomara Bender / Tiroler Festspiele
Die erste – sehr heikle – Soloszene gehört dem „Fischer“: eine Tenor mit blendender Höhe wird für die kleine Canzone benötigt – Matteo Macchioni – hat diese demonstriert, seine nicht zu großer, aber angenehm timbrierte Stimme war bestens dafür geeignet. Der „primo uomo“, der Arnoldo lag beim jungen Koreaner Sung Min Song in besten Händen. Der am Saarländischen Staatstheater im Ensemble beheimatete Künstler hat einen durchschlagskräftigen und höhensicheren Tenor aufzuweisen, der sich durch sicheren Vortrag und gefühlvolle Phrasierung auszeichnet. Während er in den Duetten mit Tell und Matilde restlos überzeugen konnte, und auch seine Arie eindrucksvoll gestaltete, zeigte er leider gerade in der Cabaletta mit den „hohen Cs“ Nerven, tippte hier die Noten , bis auf das letzte nur jeweils kurz an, und verschenkte dadurch einen noch größeren Erfolg. Die Mathilde von Sophie Gordeladze stellte eine sympathische Habsburgerin auf die Bühne, führte ihre – für mich für die Partie etwas zu wenig breite – aber gut geführte Stimme sicher und mit guten Koloraturen durch den langen Abend. Ein Wiederhören wäre sicher interessant! Den Vogel abgeschossen aber hatte der Jemmy, Tells Sohn. Schon in den Ensembles mit glockenhellem Sopran darüber strahlend und ihrer lieblichen Bühnenerscheinung positiv hervorstechend, räumte sie mit ihrer – nicht wie sonst meist gestrichenen – Bravourarie vor dem Apfelschuss regelrecht ab. Bianca Tognocchi aus Como brannte ein wahres Feuerwerk an elektrisierenden Tönen bis in höchste Höhen ab – Brava! Tells einzige Soloszene „Resta imobile“ , wo er Jemmy auffordert beim Schuss ruhig stehen zu bleiben, die unmittelbar darauf folgte, und die Andrea Borghini wirklich gut und empfindsam gelungen ist, blieb leider ohne Applaus. Mir tat der junge Künstler darob direkt leid, weil er den verdient gehabt hätte. Er verfügt über einen sehr schön timbrierten , edlen Bariton, der leider vom Volumen her begrenzt und in der unteren Lage nur eher schwer vernehmbar ist. Da er auch von Gestalt eher klein ist, konnte er die Dominanz des Protagonisten nicht so ganz ausfüllen – trotzdem unterm Strich durch seine schöne Linienführung und sein Stilgefühl eine positive Bilanz für ihn. Die eher kleinere Rolle seiner Frau Hedwige wurde durch die Südtirolerin Anna Lucia Nardi stark aufgewertet. Ein interessanter, samtener Mezzo, mit Stilgefühl eingesetzt und dank ihrer blendenden Bühnenerscheinung ( warum sollte Tell keine jung wirkende, attraktive Frau gehabt haben? ) konnte sie bestens reüssieren, und nutzte das herrliche Damenterzett vor dem Finale zum Vorzeigen ihrer Möglichkeiten. Mit Zelotes Edmund Tolivergab es für Staatsopernbesucher der 80 er Jahre ein Wiederhören als Melchthal, Nicola Ziccardi gab den Leuthold, Adam Horvath den Walter Fürst – alle rollendeckend. Als Bösewicht Gessler passte Giovanni Battista Parodi ganz gut mit seinem trockenen Organ, sein Gefolgsmann Rodolphe wurde von Giorgio Valenta mit typischem Charaktertenor interpretiert, Ferederoik Baldus ergänzte als „Chasseur“.
Mit einem der für mich schönsten hymnischen Finali der Opernliteratur endete dieser beglückende Opernabend! Großer Jubel und Beifallstürme des Publikums, diesmal interessanterweise genau den Leistungen entsprechend fein abgestuft!
Man muss den sympathischen Festspielen und den überwiegend regionalen Mitarbeitern und Helfern alles Gute für die neu anbrechenden Zeiten wünschen, und am Besten gleich zur Wintersaison im Dezember zu „Elisir“ und „Rusalka“ fahren. Es ist schön unterhalb des beeindruckenden Kaisergebirges…
Michael Tanzler 28.7.2019
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)




 Julian Orlishausen spielte einen aufdringlichen Ratefreund und sang ihn mit klangvollem Bariton, obwohl er bei der Premiere etwas indisponiert gewesen sein soll. Marlin Miller konnte als romantisch Verliebter und bei allgemein guter Personenregie auch exzellent darstellender Hoffegut überzeugen. Sein Tenor klang vielleicht etwas zu metallisch. Bianca Tognocchi sang die Nachtigall mit einem für die Rolle an sich zu dramatischen Sopran. Zu der Rollenkonzeption in dieser Art der Inszenierung passte die Stimme jedoch, denn von Romantik war nur fallweise etwas zu spüren. Dennoch erschien mir der Auftritt des Prometheus, den Thomas Gazheli im Gewühl der grauen Müllsäcke nicht von der Bedeutungsschwere, die er in den o.g. Inszenierungen hatte. Schade auch, dass der finale Lobgesang auf Zeus (die Natur) von einem Chor im Orchestergraben (!) gesungen wurde - statt von geläuterten - vom Sturm zerzausten - Vögeln alias Opernsängerinnen auf den Trümmern der vom Krieg zerstörten Stadt!
Julian Orlishausen spielte einen aufdringlichen Ratefreund und sang ihn mit klangvollem Bariton, obwohl er bei der Premiere etwas indisponiert gewesen sein soll. Marlin Miller konnte als romantisch Verliebter und bei allgemein guter Personenregie auch exzellent darstellender Hoffegut überzeugen. Sein Tenor klang vielleicht etwas zu metallisch. Bianca Tognocchi sang die Nachtigall mit einem für die Rolle an sich zu dramatischen Sopran. Zu der Rollenkonzeption in dieser Art der Inszenierung passte die Stimme jedoch, denn von Romantik war nur fallweise etwas zu spüren. Dennoch erschien mir der Auftritt des Prometheus, den Thomas Gazheli im Gewühl der grauen Müllsäcke nicht von der Bedeutungsschwere, die er in den o.g. Inszenierungen hatte. Schade auch, dass der finale Lobgesang auf Zeus (die Natur) von einem Chor im Orchestergraben (!) gesungen wurde - statt von geläuterten - vom Sturm zerzausten - Vögeln alias Opernsängerinnen auf den Trümmern der vom Krieg zerstörten Stadt!