
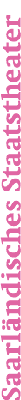

www.theater-saarbruecken.de/
Il Trovatore
Premiere: 06.09.2020
besuchte Vorstellung: 25.09.2020
Jeder in seiner eigenen Welt
Lieber Opernfreund-Freund,
in einer orchestral reduzierten „Saarbrücker Fassung für 14 Musiker“ ist derzeit Verdis Trovatore am Saarländischen Staatstheater zu erleben – und das meine ich wörtlich: Die sinnfällige Inszenierung von Tomo Sugao ist mit die beste Interpretation des an sich wirren Stoffes, die ich in den vergangenen Jahren habe sehen dürfen, und gerät dank der packenden musikalischen Umsetzung in der Tat zum Erlebnis.

Schon Verdi sah in Azucena die Hauptfigur der Geschichte – und das setzt der aus Japan stammende Sugao stringent um, zeigt die „Zigeunerin“ (diese Vokabel ist auch in den Übertiteln konsequent in Anführungszeichen gesetzt) omnipräsent und als Außenseiterin. Jede Figur hat ihre eigene (Innen-)Welt, ist in ihr gefangen. Die Welten ähneln sich im Aufbau, sind jedoch von unterschiedlicher individueller Erscheinung. Nur Azucena irrt als Obdachlose dazwischen umher, pflegt die Reliquien ihrer eigenen Geschichte – einen Kinderschuh beispielsweise oder den Lautenhals ihres Ziehsohnes Manrico, den sie großgezogen hat, nachdem sie geistig umnachtet ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen hat. Manrico ist auch gleichzeitig der Sohn des Mörders ihrer Mutter – darüber ist sie wahnsinnig geworden, hin- und hergerissen zwischen Liebe zu ihm und Rachegedanken, schiebt einen alten Kinderwagen vor sich her. Und diesen Wahn merkt man auch der intensiven Interpretation von Judith Braun vom ersten Ton an an. Düsteres Timbre und wahnhafte Höhen zeichnet ihren ausdrucksstarken Mezzo aus – und doch hätte ich mir vor der bildgewaltigen Kulisse ein wenig mehr Gänsehaut gewünscht.

Die zweite Frauenfigur der Oper lebt in einer eher heilen Welt. Das überaus gelungene Licht lässt Leonoras Innenwelt wie aus feinstem Biskuitporzellan erscheinen. Die Regie zeigt die Ines als eine Art Alter Ego Leonoras und Carmen Seibel gerät mit ihrer betörend warmen Stimme für mich zur Überraschung des Abends. Zum ersten Mal nehme ich dank ihrer einfühlsamen Interpretation diese Figur als mehr als eine Stichwortgeberin wahr. Pauliina Linnosaaris kraftvoller Sopran hingegen mag am gestrigen Abend nicht so recht ansprechen, die Höhen gelingen nur mit recht viel Druck; hier fehlt mir oft eine Prise Gefühl, so dass mich die Finnin als Leonora vor allem durch ihre hingebungsvolle Darstellung und die satte Mittellage überzeugen kann. Manrico ist Titelfigur und ein forscher, junger Mann und das sieht man auch der Kulisse an: in seinem Raum bricht sich die Natur Bahn und im Gefängnis im letzten Bild findet er sich, durchaus nachvollziehbar, in Leonoras Porzellanwelt wieder. Entsprechend dieser Interpretation geht Angelos Szamartzis die Rolle an, wie ein wagemutiger Naturbursche wirft er sich der anspruchsvollen Partitur entgegen, stellt sich angstlos den Spitzentönen, die er mühelos nimmt, als würden sie gerade am Wegesrand liegen, und gefällt durch seinen weiches, enorme Emotionen transportierendes Timbre.

Peter Schöne ist ein Luna wie aus dem Bilderbuch: er verfügt über ausreichend Kraft, um diesen Machtmenschen kalt und von emotionaler Härte anzulegen, zeigt aber dermaßen viele Facetten und entblättert alle Farben seines klangschönen Baritons, so dass ihm das Kunststück gelingt, Mitgefühl für seine sonst recht unsympathische Figur zu wecken, deren Innenwelt von der Regie als Stein gewordene Wüste gezeichnet wird. Grandios! Der Ruiz von Algirdas Drevinskas ist der Outlaw der Geschichte, sein Gesicht ist ebenso bemalt, wie seine Welt graffitibesprüht ist; der Litauer ist seit beinahe 30 Jahren am Haus und doch klingt sein Tenor frisch und jung. Ferrando erzählt zu Beginn die Vorgeschichte und wird von Tomo Sugao als detailverliebter Chronist mit Buchhalterseele gezeichnet; Hiroshi Matsui steuert seinen ausdrucksstarken Bass bei und komplettiert so das durch die Bank beachtenswerte Solistenensemble.

Massenszenen fehlen in Coronazeiten, der Chor singt weitestgehend aus dem Off, wird allenfalls da und dort mitsamt der Bühne aus dem Untergrund emporgefahren. Unter der Leitung von Jaume Miranda entfalten die Damen und Herren ihre fein aufeinander abgestimmten Stimmen, während Justus Thorau im mit nur 14 Musikern besetzten Graben die Fäden zusammenhält. Und doch fehlt seiner Interpretation das kammermusikhafte, das man bei dieser Besetzung vermuten würde. Im Gegenteil: einen Verdi voller Esprit und Klanggewalt präsentiert uns der 1. Kapellmeister, schlägt sportliche Tempi an und befeuert das Saarländische Staatsorchester zu Höchstleistungen, ohne dabei die Sänger aus den Augen zu verlieren, erzeugt so Gefühl ohne übertriebene Sentimentalität. Das Publikum im ausverkauften Haus ist hingerissen und applaudiert begeistert – und auch ich ermuntere Sie nach diesem überzeugenden Abend zu einem Besuch im Saarland. Die Lesart Sugaos und die musikalische Qualität lohnen jede Reise.
Ihr
Jochen Rüth
26.09.2020
Die Fotos stammen von Martin Kaufhold
LE NOZZE DIE FIGARO
Premiere am 8.September 2019
Als rundweg gelungen darf man die Spielzeiteröffnung am Staatstheater in Saarbrücken bezeichnen. Mit viel Schwung und kluger Hand führt EVA- MARIA HÖCKMAYR Regie. Sie gewichtet manche Beziehungen erfrischend anders, lässt die Damen durchwegs aktiv bleiben und die Herren reagieren. Ungewöhnliche Anwesenheiten anderer Figuren in Einzelszenen bringen Spannungen und stellen Fragen. Auch ästhetisch ist die Produktion äußerst animierend. JULIA RÖSLER entwirft sinnliche Kostüme, die eine Zeitreise rückwärts vom Jetzt in das Rokoko machen. VOLKER THIELEs Bühnenraum auf dreifach sich teilweise gegensätzlich drehender Bühne wird zum unüberschaubaren Labyrinth an Zimmern und Fluren. Gelegentlich könnte es fast eine Verwandlung weniger sein, aber der Raum bietet schöne Spielmöglichkeiten und ist stimmig geleuchtet.

Es fällt auf, das die Personenregie kleinteilig und konsequent gearbeitet ist und sich dabei das Ensemble voll entfalten kann.
Die Krone gebührt dabei der Susanna, die von MARIE SMOLKA hinreißend interpretiert wird. Sie ist Dreh- und Angelpunkt, stimmlich äußerst delikat in perfektem Mozartklang und darstellerisch vielfarbig, alle Fäden in den Händen haltend.
Zu ihr passt vokal und szenisch ideal die Contessa von VALDA WILSON. Ebenfalls jung, attraktiv und mit großer Stimmkultur hat sie den Mut zu innigen, berührenden Piani in der großen Arie. So wird das kurze Brief- Duettino dieser beiden zum sinnlich- glühenden Höhepunkt der Aufführung.
MARKUS JAURSCH legt seinen Figaro als stets Aufbegerenden an, sowohl in seiner Beziehung zu Susanna wie in der zu den Herrschenden. Dabei gestaltet er sehr detailiiert und farbenreich, läuft aber bei den Gewaltausbrüchen zuweilen Gefahr, seine Gesangslinien dabei zu wenig zu entfalten.

Völlig unzureichend leider in Stimm-Material und Gesangstechnik ist als Graf Almaviva ein junger Sänger, dessen klangvoller Name zu seinem Schutz besser nicht erwähnt wird. Diese Besetzung führt leider dazu, dass das Kräfteverhältnis im Stück unausgewogen ist, und derjenige, an dem sich die anderen abarbeiten müssten, mehr oder minder kaum vorhanden ist. So vermisst man schmerzlich zum Beispiel im gesamten zweiten Finale eine Autoritätsperson. Bei der Leistungsdichte an guten Baritonisten wundert man sich nur über diese Fahrlässigkeit.
Großartig dagegen die Charakterstudien des Basilio und Don Curzio von ALGIRAS DREVINSKAS, der auch eine optimal geführte, edle Tenorstimme ins Feld führt. JUDITH BRAUN als Marcellina und HIROSHI MATSUI als Bartolo stellen ein solides Elternpaar dar, VADIM VOLKOV poltert rollendeckend als Antonio und BETTINA MARIA BRAUER als Barbarina macht neugierig auf größere Aufgaben.
Der Chor das Staatstheaters wird durch zusätzliche Auftritte aufgewertet und singt homogen.

Der neue GMD SÉBASTIEN ROULAND zeigt bereits in der schmissigen Overtüre, dass er eine hervorragende Intuition für Mozarts Musik besitzt. Die Tempi, die Farben und die mit den Sängern subtil gestalteten geschmackvollen Fioraturen gelingen und lassen einen frischen, immer musikantischen Klangreichtum entstehen. Das Orchester des Staatstheaters macht im Miteinander den besten Eindruck.
Das ausverkaufte Opernhaus spendet ungetrübt starken Beifall. Man darf sich auf weitere interessante Premieren freuen und eine weite Reise nach Saarbrücken hat sich in jedem Fall gelohnt.
Damian Kern 12.9.2019
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (WIEN)
(c) Martin Kaufhold
DIE TOTE STADT
Zweite Aufführung am 11. Oktober
(Premiere am 6. Oktober 2018)
Erste Kritik
Mariettas Triumph
Erich Wolfgang Korngolds lange vergessene Oper „Die tote Stadt“ hat seit einigen Jahren wieder Konjunktur. Frankfurt, Hamburg und Dresden haben sie im Repertoire. In diesem Jahr sind beinahe gleichzeitig Neuinszenierungen an der Komischen Oper Berlin und am Staatstheater Saarbrücken herausgekommen. Gerade die Saarbrücker Produktion zeigt, daß das Werk auch von einem mittleren Haus gut bewältigt werden kann.
Die Inszenierung von Aaron Stiehl erweist sich als werkdienlich. Gerade bei einem dem breiten Publikum weniger bekannten Stoff ist es von Vorteil, wenn wie hier in flüssigen Abläufen der Handlungsstrang klar herausgestellt wird. Dabei profitiert das über weite Strecken konventionelle szenische Arrangement ganz wesentlich von den Schauwerten des Bühnenbildes (Nicola Reichert) und der Kostüme (Sven Bindseil). Der vom Protagonisten „Paul“ eingerichtete kuriose Raum, der als „Kirche des Gewesenen“ mit Devotionalien seiner verstorbenen Frau Marie vollgestellt ist, wird hier an beiden Seiten von überdimensionierten Setzkästen gesäumt. Vor der Rückwand ist ein Altar samt Reliquienschrein mit dem Haar der Verstorbenen aufgebaut. Die im Text allgegenwärtigen Bezüge zur katholischen Frömmigkeit und ihrer Formwerdung in der Liturgie werden sinnfällig vom Bühnenbild aufgenommen. So ist es auch konsequent und nicht bloß ein Spiel mit dem Namen, wenn „Marie“ tatsächlich als Marienerscheinung auftritt, samt Strahlenkrone und blauem Madonnenmantel. Daß sie allerdings auch noch ihrem Gatten die Kommunion reicht, ist ein wenig zu viel des Guten.

Das Inszenierungsteam hat sich dafür entschieden, die ausgedehnten Traumszenen, die den wichtigen Mittelteil ausmachen, in dem nur leicht modifizierten Einheitsbühnenbild spielen zu lassen. Der Katholizismus kippt dabei ins Satanische. Pauls Freund Frank erscheint sogar mit Bocksbein und Hörnern. Die Schaustellerszene wird dann als buntes Intermezzo lustvoll ausgespielt und mit morbidem Humor serviert. Über wechselnde Schauvorhänge am Rückprospekt erlaubt man sich sogar einen Kalauer: Während vorne der „Pierrot“ in seinem traurigen Lied vom „Rhein“ singt, ziehen per Gemälde Szenen aus Wagners „Rheingold“ vorbei.
Mit Pauliina Linnosaari in der Doppelrolle als Tänzerin „Marietta“ und Marienerscheinung hat das Staatstheater Saarbrücken einen Besetzungscoup gelandet. So frisch gespielt und so souverän gesungen hat man die Partie selten erlebt. Alleine schon die Mühelosigkeit, mit der sie in dem berühmten Lied „Glück, das mir verblieb“ die Spitzentöne ohne jede Schärfe in die Gesangslinie zu integrieren weiß, ist große Bewunderung wert. Die junge Sopranistin verfügt über genau den saftig-vollen Ton, den eine Verführerin benötigt. Zugleich ist ihre Stimme so erstaunlich wandelbar, daß die sirenenhaften Rufe der im Traum erscheinenden Marie etwas faszinierend Jenseitig-Narkotisches haben.

Michael Siemon bleibt dagegen an ihrer Seite als „Paul“ recht steif und blaß. Die Töne seines ersten Auftritts klingen noch verheißungsvoll. Ein lyrisch grundierter Tenor mit leicht baritonaler Färbung läßt aufhorchen, offenbart aber bald seine Hauptschwäche: Die Höhenlage, die in dieser Partie stark gefordert wird, ist bei ihm unausgeglichen. Oft versucht er es mit dem Hochziehen des Brustregisters, was nur unter Druck im Fortebereich gelingt und gelegentlich zu Intonationstrübungen führt. In leiseren Passagen muß er dagegen vollständig in eine dünn und fistelnd klingende Kopfstimme umschalten. Eine Registerverblendung im Passagio ist kaum vorhanden.
Die anderenorts häufig anzutreffende Aufwertung der Rolle des „Frank“, indem man den betreffenden Sänger auch den „Pierrot“ singen läßt, findet in Saarbrücken nicht statt. Einerseits ist das schade, weil man von Peter Schöne, dem „Frank“, mit seinem kernigen, gut geführten Bariton auch gerne das Pierrot-Lied gehört hätte, anderseits präsentiert Salomón Zulic del Canto den Wunschkonzert-Schlager so geschmackvoll und sicher, daß diese Produktion gleich zwei gute Baritone auf der Habenseite verbuchen kann.

Die übrige Besetzung weist keine Schwächen auf. Die heikle Aufgabe, Korngolds üppig instrumentierte Partitur in einem eher trocken klingenden Raum zur Geltung zu bringen, löst das Saarländische Staatsorchester unter der Leitung von Justus Thorau souverän. Der junge Dirigent setzt mit den gut vorbereiteten Musikern mehr auf Durchhörbarkeit als auf Opulenz. Den Sängern kommt das zugute. Allerdings werden für Klangkulinariker, die an Korngold das Rauschhaft-Übersteigerte schätzen, letzte Wünsche offen bleiben.
Insgesamt ist eine kurzweilige Aufführung in einer werkdienlichen Produktion zu erleben. Die musikalische Qualität ist gediegen. Herausragend jedoch ist Pauliina Linnosaari in der weiblichen Hauptrolle. Der Abend gerät zu ihrem persönlichen Triumph.
Michael Demel, 20. Oktober 2018
© der Bilder: Andrea Kremper
Zum Zweiten
DIE TOTE STADT
Premiere: 06. Oktober 2018
besuchte Vorstellung: 21. Oktober 2018
Theaterzauber mit Seltenheitswert!
Hoch erfreulich, dass in den letzten Jahren viele Opernhäuser Erich Wolfgang Korngolds Geniestreich „Die Tote Stadt“ präsentierten. Immer wieder ist es überwältigend, diesen Melodien- und Farbreichtum eines gerade mal 23jährigen Komponisten zu erleben. In der Musikgeschichte kommt diesem Solitär eine Sonderstellung zu, da das Sujet als auch die besondere Klangsprache Alleinstellungsmerkmale sind, die kein anderer Komponist schuf. Die genialische Instrumentations-Begabung, gepaart mit einem Füllhorn an Melodien verfehlte auch in dieser Nachmittagsvorstellung nicht ihre Wirkung!
Nun also „Die Tote Stadt“ am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken. Regisseur Aron Stiehl erzählt erfreulich gradlinig und musikkonform die Handlung. Der Zuschauer erlebt Paul in seinem Haus als Mix aus Mausoleum und Grabkammer. Der Zuschauer sieht ein Zimmer, begrenzt durch hohe Wände mit endlos vielen Fächern, in welchen die Reliquien Maries und zahlreiche Kerzen untergebracht sind. An der Bühnenrampe steht ein Grablicht, auf der rechten Seite ein großes Bett, vorne links zwei Sessel nebst kleinem Tisch. Die Bühnenmitte wird für bühnenwirksame Effekte genutzt. So erscheint hier Marie als Jungfrau Maria und segnet Paul. In der Pantomime fährt das mittlere Hubpodium nach oben und gibt ein venezianisches Lagunenpanorama frei. Im dritten Akt gibt es wahrlich eine surreale Prozession zu bestaunen, als aus den vielen Regalfächern viele Hände nach Paul greifen wollen. Dabei verengen sich die Wände bedrohlich. Nicola Reichert schuf dazu ein eindrucksvolles, akustisches (welche Seltenheit!) Bühnenbild, in welchem die Handlung gut nachvollzogen werden konnte. Zu loben sind die hinreißenden Lichtstimmungen, die André Fischer gekonnt einrichtete. So wird die Bühne immer wieder in rubinrot, violett oder warmes Sonnenlicht getaucht.
In einer stimmigen Personenführung wirken die Protagonisten klar charakterisiert. Belebt wird die Szene von der spielfreudigen Gauklertruppe. Stiehl vertraut der Musik, so dass es hier am Ende der Oper tatsächlich und endlich einmal wieder einen positiven Schluß zu sehen gibt! Die mittige Bühnenwand klappt herunter und es tut sich ein sonnenfarbener Lichthorizont auf. Auf diesen schreitet Marietta zu, bis sie nur noch schemenhaft wahr genommen wird. Paul folgt ihr mit langsamen Schritten ins Licht. Ein ergreifender, unvergesslicher Schluss. Alles in allem eine geschlossene und absolut überzeugende Regiearbeit mit Seltenheitswert. Bravo!
Korngolds Oper stellt an seine Protagonisten höchste, kaum erfüllbare Anforderungen. Seine Oper steht und fällt mit dem Sänger des Pauls, der die Hauptlast des Werkes zu schultern hat. Die Tessitura ist extrem, sehr hoch, häufige geforderte Wechsel ins Falsett, Fortissimo-Exzesse, kontrastiert durch vielerlei Pianissimo und dazu mit einer Dauerpräsenz auf der Bühne. In Saarbrücken war als Paul Michael Siemon zu erleben. Darstellerisch wirkte er kontrolliert und etwas gebremst. Hierdurch erschien er eher verstockt, was aber letztlich gut mit dem Rollencharakter korrespondiert. Sein heller Tenor schaffte es immer, sich durch die Klangballungen durchzusetzen. Dabei nutze er klug die endlosen dynamischen Möglichkeiten seiner forderndern Partie. Staunenswert die große stimmliche Sicherheit, die lediglich in den Ausbrüchen des 2. Aktes („Erlöst bin ich!“) hörbar strapaziert wurde. Bewegend dann der Schluss „O Freund...“, in welchem es ihm gelang, mit hörbarer Anteilnahme und überraschend viel Schmelz in der Höhe, seine Partie abzuschließen. Die Textbehandlung wirkte hingegen viel zu monochrom und brav. Hier wäre eine konstrastreichere Artikulation wünschenswert. Davon abgesehen eine herausragende Leistung.
An seiner Seite spielte sich Pauliina Linnosaari als Marietta in die Herzen des Publikums. Sie war weniger femme fatale, sondern eine ungemein lebensbejahende, positive Gestalt, die ihre besondere Wirkung aus ihrer Natürlichkeit gewann. Auch sie hat außergewöhnliche stimmliche Anforderungen zu bewältigen. Bereits im „Schlager“ „Glück, das mir verblieb“ gefiel sie mit ruhevoller Tongebung, um dann in der Retrospektive des dritten Aktes „Und der erste...“ die volle Schönheit und Sicherheit ihrer Sopranstimme zu entfalten. Besonders herausragend ihre obertonreiche Höhe, die immer wohlklingend und niemals scharf geriet. Verschwiegen sei nicht, dass sie ihre leuchtende Höhe unter dem Weglassen der Konsonanten erzielte.
Judith Braun als Brigitta zeigte sich empathisch, mutierte in der Vision Pauls gar zur hohen geistlichen Würdenträgerin und überzeugte durch die hohe Textverständlichkeit. Schade, dass ihre Stimme in der hohen Lage nicht hinreichend mit dem Körper verankert schien, so dass ihr Vortrag durch Schärfen getrübt wurde.
Ein wichtiger Aktivposten war Bariton Peter Schöne als Frank, der seine Freundgestalt gut charakterisierte, dazu raumgreifend mit viel Noblesse sang und im zweiten Akt als Teufel höchstselbst agieren darf.
Salomon Zulic del Canto als Fritz/Pierrot nutzte gekonnt die Gelegenheit, in „Mein Sehnen, mein Wähnen“, nachhaltig auf seine stimmlichen Qualitäten aufmerksam zu machen. Ungemein kultiviert mit endlosen Legatobögen kostete er jeden Moment seiner Paradearie aus.
Leichtfüßig und spielfreudig agierten die Gaukler Olga Jelinkova (Juliette), Carmen Seibel (Lucienne), ungewöhnlich stimmstark die beide Tenöre Sungmin Song (Victorin) und Algirdas Drevinskas (Graf Albert). Jaume Miranda realisierte eine klar konturierte Choreinstudierung.
Kaum ein Werk wird so häufig durch Striche verunstaltet, wie „Die Tote Stadt“. Besonders oft fällt dabei z.B. das so wichtige Vorspiel des zweiten Aktes weg oder wird krude zusammengestrichen. Ein Frevel, der den Entscheidern eine stark begrenzte Intelligenz bescheinigt. Paul nimmt ja in seinem Arioso „Was ward aus mir“ explizit Bezug auf die Klänge dieses Vorspiels. Ob Wien, Salzburg, Barcelona, London oder Frankfurt. Das Vorspiel gab es nur verstümmelt!
Großartig, dass die Saarbrücker Produktion nicht nur diese so wichtige Musik komplett spielte, sondern auch sonst nahezu alle üblichen Striche aufmachte.
Dirigent Justus Thorau überzeugte mit einem mitreißendem Dirigat. Mit hörbarer Begeisterung fegte er durch die Partitur, ließ immer wieder berauschend ausmusizieren, ohne die Sänger aus dem Blick zu verlieren. Staunenswert, dass er jederzeit die Balance zwischen Bühne und Graben gewährleisten konnte. Ob in „Glück, das mir verblieb“ oder in Pierrots Tanzserenade, in beiden Gusto-Stücken schuf Thorau ungemein berührende Momente der Kontemplation. Das groß besetzte Orchester begeisterte in allen Gruppen; süffige Streicher, delikate Holzbläser, attackierendes Blech und farbreich aufspielendes Schlagzeug formten einen homogenen Gesamteindruck, der begeisterte und überwältigte. Dazu kamen dann im dritten Akt noch zusätzliche Posaunen und Trompeten, postiert im 2. Rang, die mit dem beherzt aufspielendem Staatsorchester für einen süffigen Klangrausch sorgten. Viel berechtigte Begeisterung für den fabelhaften Dirigenten und das Saarländisches Staatsorchester.
Die Nachmittags-Vorstellung war erfreulich gut besucht. Viel Jubel im Haus. Ein großartiges Erlebnis!
Jedem Opernfreund sei diese besondere Produktion empfohlen!
Dirk Schauß 22.10.2018
Weitere Vorstellungen gibt es am:
28.10., 31.10., 09.11., 14.11., 20.11., 11.12. und 21.12, jeweils um 19.30 Uhr
DON GIOVANNI
Premiere: 19. September 2015
Besuchte Vorstellung: 1. November 2015
Mozarts „Don Giovanni“ gehört zu den unverwüstlichen Hits des Opern-Repertoires. Kein Wunder also, dass auch die von Intendantin Barbara Schlingmann inszenierte Aufführung am Saarländischen Staatstheater beim Publikum gut ankommt, zumal die Regisseurin das Stück nicht auf den Kopf stellt und das Bühnenbild von Sabine Mader viel Abwechslung bietet.
Der Bühnenraum besteht aus verschiedenen Wänden, die von den zwei Ringen der neu installierten Saarbrückner Drehbühne in viele verschiedene Variationen angeordnet werden können. Im Zentrum steht ein Kubus mit aufgemaltem Theatervorhang, vor dem sich meistens der Adel trifft. Die Zerlina-Masetto-Szenen spielen vor einer Wand aus übereinander gefügten Baumschnitten.
Im Hintergrund blickt man auf der abschließenden Wand eine herbstliche Friedhofslandschaft. Wird diese Wand nach vorne an die Rampe gedreht, so sieht man eine riesige Spiegelfront, in der sich das Publikum auch selbst sieht. Die Anordnung der einzelnen Raumelemente sorgt zwar für viel Abwechslung, wirkt aber auch beliebig.
Die Personenführung von Dagmar Schlingmann ist sehr lebendig und turbulent: Don Giovanni ist hier ein junger und wilder Lebemann mit langen Harren, der sich selbst kaputt macht und trotzdem selbstbewusst von einer Szene in die nächste tänzelt. James Bobby sieht aus, als sei er einem Dickens-Roman entsprungen und gestaltet den Frauenheld mit beweglicher Stimme. Wenn er sich über die anderen Personen lustig macht, gewinnt die Figur auch an stimmlicher Schärfe.
Christoph Woo vom Theater Kiel gibt an diesem Nachmittag den Leporello als Einspringer und gefällt mit seinem leichten beweglichen Bass. Er verleiht der Rolle eine augenzwinkernde und humoristische Note.
Viel dramatisches Feuer bringt Yitian Luan als Donna Anna ein. Ihr merkt man die Zerrissenheit der Figur, die Don Ottavio anfangs dominiert und sich immer weiter von ihm distanziert, sehr gut an. Luan verfügt dazu über ein fein gestaltetes Piano, so dass sie die ganze Bandbreite ihrer Rolle überzeugend verkörpert.
Als Don Ottavio kann der von einer Erkältung genesene Carlos Moreno Pelizari den Glanz seiner Stimme noch nicht voll entfalten. Teresa Andrasi gefällt mit schönem lyrischen Sopran als Donna Elvira, gegen Ende der Oper geht ihr aber etwas die Puste aus. Mit jungen und frischen Stimmen singen Herdís Anna Jónasdóttir und Markus Jaursch Zerlina und Masetto. Einen düster sonoren Komtur singt Hiroshi Matsui.
Kapellmeister Christopher Ward lässt ebenso flott musizieren, wie auf der Bühne gespielt wird. Sein Mozart ist zupackend gestaltet und permanent in Fahrt. Das Saarländische Staatsorchester spielt die Einsätze aber nicht immer punktgenau.
Am Ende dieser Aufführung ist Don Giovanni zwar mit dem Bühnenbild in die Hölle gefahren, hat aber die Beziehungen ordentlich durcheinander gewürfelt: Donna Anna interessiert sich für Leporello, Ottavio für Elvira, lediglich Zerlina und Masetto haben fester zusammen gefunden.
Diese Aufführung erfindet „ Don Giovanni“ nicht neu, bietet aber drei unterhaltsame Stunden.
Rudolf Hermes 4.11.15
Bilder folgen
(c) P. Klier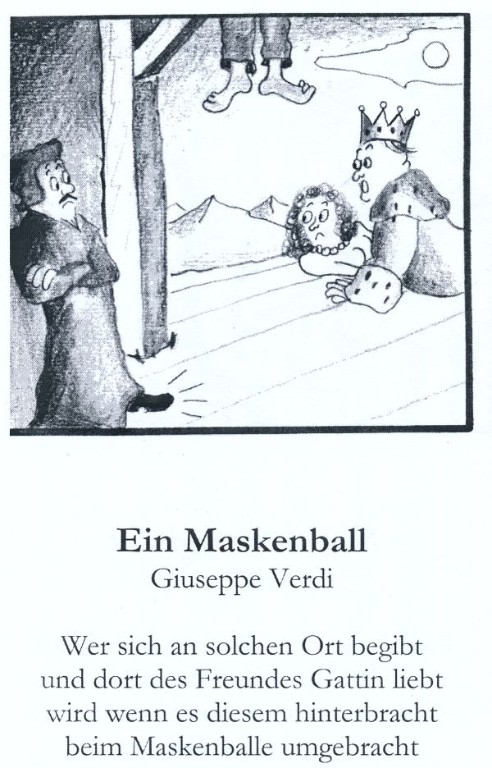
EIN MASKENBALL
Zweite Kritik
Premiere: 13. Juni 2015
Besuchte Vorstellung: 30. Oktober 2015
Schöne Bilder und eine starke Sängerbesetzung sind die Erfolgsgaranten des Saarbrückener Maskenballs in der Inszenierung von Tom Ryser. Im Staatstheater erlebte die Aufführung nun ihre Wiederaufnahme.
Die Bühnenbilder von Stefan Riekerhoff machen diese Aufführung zu einem optischen Genuss. Zentrales Element ist das monumentale Porträt des schwedischen Königs Gustav III., der das historische Vorbild der Oper liefert. Vor diesem steht nun Herrscher Riccardo (warum bleibt man in Saarbrücken nicht beim echten Namen des Königs?) in heutiger Kostümierung und fantasiert sich in die historische Geschehnisse hinein. Die Drehbühne lässt den Chor und die anderen Figuren des Stückes in den Raum hineinfahren und schon befinden wir uns in der Geschichte um Liebe und Eifersucht.
Regisseur Tom Ryser entwickelt eine unspektakuläre, aber solide Personenregie, die das Stück verständlich erzählt. Mit wenigen Veränderungen wird der sängerfreundliche geschlossenen Raum als Bühne genutzt: In der Ulrica-Szene klappt von oben ein Nachtbild mit Mond und Sternen hinein. Für die Szene am Galgen werden die Podeste hochgefahren, so dass sich die Verschwörer im Vordergrund mit Taschenlampen bewaffnet anschleichen können. Ein besonders starker Moment gelingt im letzten Bild, wenn sich der geschlossene Raum zu einem dunklen Ballsaal mit Sternenhimmel und Kronleuchter öffnet.
Kappellmeister Christopher Ward gestaltet die intimen Passagen mit viel Sinn für das Detail. In den dramatischen und leidenschaftlichen Szenen feuert er das Saarländische Staatsorchester zu knalligen Effekten an. Die Sänger führt er gut durch ihre Partien. Sopranistin Susanne Braunsteffer hat die Amelia bereits in erfolgreich in Dortmund gesungen und begeistert nun auch an der Saar. Ihre Stimme klingt hell und besitzt eine große dramatische Schlagkraft, mit der sie mühelos das Orchester übertrumpft.
Eine echte Entdeckung ist Andrea Shin als Riccardo. Der an der Staatsoper Hannover engagierte Tenor glänzt mit strahlendem Tenor. Immer wieder staunt man über die Schönheit und Farbigkeit seiner Töne, zumal man ihm gar keine Anstrengung ansieht oder –hört. Von diesem Sänger darf man noch einiges erwarten. Bariton James Bobby als Renato hat im ersten Akt wenige Möglichkeiten zu zeigen, dass seine Figur der beste Freund des Königs ist. Sehr stark sind dann aber die Szenen, in denen er die Untreue seiner Frau entdeckt und beschließt, zum Mörder am König zu werden. Da kann er seine Stimme voll strömen lassen.
Sopranistin Herdís Anna Jónasdóttir gefällt als Oscar mit funkelnd-leichter Koloraturstimme. Einen starken Auftritt als Ulrica hat Romina Boscolo vom hessischen Staatstheater Wiesbaden. Ihre volltönende, manchmal etwas röhrende Stimme, wirkt fast schon tenoral. Zudem besitzt sie die Körperspannung und Ausstrahlung einer Balletttänzerin, so dass ihr Auftritt sehr suggestiv gelingt.
Am Ende der Aufführung thront sie zwischen dem Streichquintett, das den tödlichen Maskenball musikalisch gestaltet. Der Regie-Einfall, dass die die Drahtzieherin der Geschehnisse und des Attentats ist, hätte aber szenisch noch stärker unterfüttert werden müssen.
Insgesamt gelingt dem Saarländischen Staatstheater mit dieser Produktion ein sehens- und hörenswerter „Maskenball“, für den es viel Beifall gibt.
Rudolf Hermes 3.11.15
Bilder siehe Erste Kritik unten!
OPERNFREUND-Silberscheiben-Tipp

Immer noch das Maß der Dinge und für den Preis geschenkt.
Gleiches gilt für diese Bluray, die auch für 11 Euro ebd. angeboten wird.
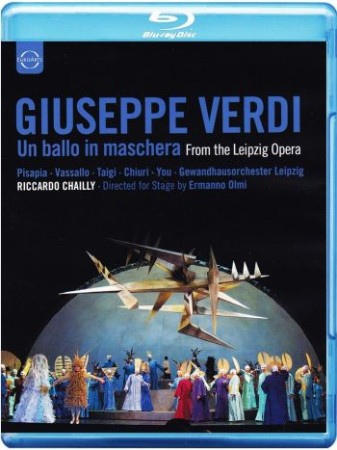
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere am 13.06.2015
Wiederaufnahme am 30.10.2015
Ambivalente Eindrücke an der Saar
Lieber Opernfreund-Freund,
über das Schicksal Gustavs III. von Schweden, der 1792 auf einem Maskenball hinterrücks erschossen wurde, ist schon allerhand geschrieben worden. Verdis Probleme mit der Zensur im Zuge der Verarbeitung des Schicksals des Schwedenkönigs in seiner Oper „Un Ballo in Maschera“, die ihn veranlassten, die Handlung nach Amerika zu verlegen, sind hinreichend bekannt. Vielleicht ist deshalb das Portrait des historischen Vorbildes omnipräsent in der gefälligen Produktion am Saarländischen Staatstheater aus der vergangenen Spielzeit, die am gestrigen Freitag Wiederaufnahmepremiere in Saarbrücken feierte.

Überlebensgroß hängt es da im Einheitsbühnenraum, den Stefan Rieckhoff gebaut hat für den schweizer Regissuer Tom Ryser, und ist über weite Strecken fast einziges nennenswertes Requisit. Indes wird der Sinn der Abbildung nicht wirklich klar, setzt doch die Regie die Opernhandlung in keinerlei Kontext zur historischen Vorlage. Ryser kehrt vielmehr die Maskerade um: zu Beginn ist der komplette Hofstaat in historische Gewänder gekleidet, maskiert sich und seine Absichten vor Riccardo, der als einziger als Gestalt des 21. Jahrhunderts auftritt – inklusive Satinanzug und Gangnam-Style-Choreografie. Die Damen kommen in eher zeitlosem Gewand daher, Hosenrolle Oscar trägt einen Tweed-Anzug samt Reiterstiefeln, Ulrica erscheint in sündig rotem Samt und die angebetete Amelia ist in grünen Brokat gehüllt (Kostüme ebenfalls von Stefan Rieckhoff).

Interessant ist dieser Ansatz – aber leider nicht zu Ende gesponnen – dazu müsste beim eigentlichen Maskenball nicht nur der Adel in zeitgemäßem Outfit auftreten, sondern eben auch Riccardo im Kostüm, was er nicht tut. Zudem ist das alles, was Ryser eingefallen zu sein scheint. Die Personenregie ist quasi nicht vorhanden, konsequent kommt es zu keinerlei Interaktionen zwischen den Handelnden, stetig wird das Publikum angesungen, selbt in den innigsten Momenten der Liebesduette. So kann die Regie nicht wirklich überzeugen, dennoch gelingen vor allem mittels ausgefeilter Bühnentechnik, sich herab senkendem Firmament und wunderbar stimmungsvollem Licht eindrucksvolle Bilder, die aber eher der Ausstattung, denn der Inszenierung zu verdanken sind und eher das Auge des Zuschauers erfreuen, als ihm eine spannende Umsetzung zu bieten.
Ähnlich heterogen ist auch der akustische Eindruck des Abends: Der südkoreanische Tenor Andrea Shin singt in der Wiederaufnahme den Riccardo, überzeugt mit strahlendem Tenor, metallischem Klang und sicherer Höhe. Allein sein Spiel vermag nicht immer, die entsprechende Gefühle zu transportieren. Der dunkel gefärbte Sopran von Ensemblemitglied Susanne Braunsteffer ist fast zu kräftig für die Amelia. Man mag ihr trotz überzeugenden Spiels die verängstigte Frau auf dem Galgenberg oder die flehende Mutter im dritten Akt nicht recht abnehmen, so wie sie einem die Töne entgegenschmettert. Das ist an passender Stelle imposant, aber eben auch oft nicht ganz passend. Schade, zeigt die aus Niederbayern stammende Sängerin doch in den Schlussphrasen der Arien in den Akten 2 und 3, dass sie auch die leisen Töne sehr wohl beherrscht.
 Als Idealbesetzung hingegen erscheint Romina Boscolo in der Rolle der Zauberin Ulrica. Ihr bedrohlicher, dunkler, bisweilen fast androgyn klingender Alt macht die kurze Rolle zu einem Ereignis. So eine Stimme muss Verdi im Ohr gehabt haben, als er die großen Mezzopartien wie Eboli, Amneris, Azucena oder eben Ulrica schrieb. Das sinnliche Spiel der jungen Italienerin unterstreicht den überzeugendsten Auftritt des Abends. Weniger vom Hocker reißt mich James Bobby als Amelias Gatte Renato. Im Vergleich zu seinen stimmgewaltigen Kollegen bleibt er recht blass, singt den sich betrogen fühlenden Ehemann, der vom besten Freund zum Mörder wird, technisch zwar einwandfrei, jedoch mit zu viel Pathos und dafür mit zu wenig Verdi in der Stimme. Der Oscar der Isländerin Herdís Anna Jónasdóttir besticht durch sichere Höhe, jedoch wünscht man sich hier ein wenig mehr Leichtigkeit auch außerhalb der Koloraturen, die sie gekonnt meistert. Einen bemerkenswerten Eindruck hinterlässt Stefan Röttig als Silvano. Hiroshi Matsui und Markus Jaursch überzeugen als Intrigantenpaar Tom und Samuel.
Als Idealbesetzung hingegen erscheint Romina Boscolo in der Rolle der Zauberin Ulrica. Ihr bedrohlicher, dunkler, bisweilen fast androgyn klingender Alt macht die kurze Rolle zu einem Ereignis. So eine Stimme muss Verdi im Ohr gehabt haben, als er die großen Mezzopartien wie Eboli, Amneris, Azucena oder eben Ulrica schrieb. Das sinnliche Spiel der jungen Italienerin unterstreicht den überzeugendsten Auftritt des Abends. Weniger vom Hocker reißt mich James Bobby als Amelias Gatte Renato. Im Vergleich zu seinen stimmgewaltigen Kollegen bleibt er recht blass, singt den sich betrogen fühlenden Ehemann, der vom besten Freund zum Mörder wird, technisch zwar einwandfrei, jedoch mit zu viel Pathos und dafür mit zu wenig Verdi in der Stimme. Der Oscar der Isländerin Herdís Anna Jónasdóttir besticht durch sichere Höhe, jedoch wünscht man sich hier ein wenig mehr Leichtigkeit auch außerhalb der Koloraturen, die sie gekonnt meistert. Einen bemerkenswerten Eindruck hinterlässt Stefan Röttig als Silvano. Hiroshi Matsui und Markus Jaursch überzeugen als Intrigantenpaar Tom und Samuel.
Der von Jaume Miranda einstudierte Opernchor ist glänzend besetzt, singt nuanciert und spielt überzeugend. Und auch das Saarländische Staatsorchester glänzt. Unter der Leitung von Chrisopher Ward, dem 1. Kapellmeister am Haus, erklingt die farbenreiche Partitur in brillanter Weise – von den schwelgerischen Bögen der Ouvertüre über das leidenschaftliche Vorspiel zum zweiten Akt bis zum fulminanten Finale.

Das Haus ist gut besucht, das Publikum freut sich an Verdis Melodien und applaudiert eifrig. Und ich? Soll ich Ihnen den Besuch trotz ambivalenter Eindrücke empfehlen? Ja, soll ich; schon allein die unglaubliche Ulrica und das tolle Orchester machen den Abend zu einem eindrucksvollen Erlebnis – und optisch ansprechend untermalt ist er auch.
Ihr
Jochen Rüth aus Köln / 31.10.2015
Fotos (c) Thomas M. Jauk zeigen die Besetzung der Spielzeit 2014/15.
DER FLIEGENDE HOLLLÄNDER
Zwiespältiger Regieansatz
Premiere: 30.11.2014
Rückblick der alten Senta
Zuerst liegt die ganze Bühne im Dunkeln. Zunehmend erhellt sich sie sich und der Raum gewinnt an Profil. Das war ein recht stimmungsvoller Beginn der Saarbrückener Neuproduktion von Wagners „Fliegendem Holländer“, die indes in szenischer Hinsicht einen zwiespältigen Eindruck hinterließ.

Emma Vetter (Senta), Olafur Sigurdarson (Holländer)
Regisseurin Aurelia Eggers geht es nicht darum, eine traditionelle romantische Spukgeschichte zu erzählen. Vielmehr befragt sie das Werk nach seiner Relevanz für die Gegenwart. Dabei wartet sie nicht mit einer vom modernen Geschäfts- und Wirtschaftsleben geprägten Inszenierung auf, die Wagners Oper in letzter Zeit häufig zuteil wurde, sondern setzt bei den vielfältigen Emotionen der Handlungsträger an. Da die Gefühle damals wie heute dieselben sind, hat dieser Ansatzpunkt durchaus seine Berechtigung. Stephan Mannteuffel hat ihr einen kargen, fast leeren Gedankenraum auf die Bühne gestellt, der auf beiden Seiten von einer Vertäfelung begrenzt wird und gleichermaßen den Innen- und den Außenbereich bildet. Die Abgrenzung zwischen drinnen und draußen erfolgt auf recht beeindruckende Weise durch Projektionen. Immer wieder fluten videomäßig auf einen Gaze-Vorhang geworfene Wellen durch den Saal, der von einem Heizungsrohr und zwei riesigen Türen dominiert wird. Manchmal scheint die ganze Spielfläche unter Wasser zu stehen und der wilde Ozean hereinzubrechen. Dieser löst die Konturen eines im Vordergrund befindlichen zweiten, kleineren Raumes allmählich auf. Das zunehmend verzerrte, zerfließende Zimmer hat gegenüber der Macht des Meeres keine Chance.

Olafur Sigurdarson (Holländer), Emma Vetter (Senta)
Trotz der realistischen Aufzeigung ist der Ozean aber dennoch eher symbolisch aufzufassen, und zwar als bildlicher Ausdruck von Gefühlswogen. Letzten Endes ist es Frau Eggers aber nicht um ausgeprägten Realismus zu tun, sondern um eine Wanderung durch die Psyche der Protagonisten, die vielfältige Assoziationsmöglichkeiten eröffnet. Ein über der Szene schwebender riesiger Spiegel, dessen Stellung geändert werden kann, versinnbildlicht den Blick in die Seelen der beteiligten Personen, insbesondere Sentas. In Freud’scher Manier dringt ihr Unterbewusstes an die Oberfläche und gebiert den Wunsch, aus der sie beengenden Welt des von Veronika Lindner sehr elegant eingekleideten Vaters Daland auszubrechen. Von ihm kurzerhand zur Ware degradiert und damit zum bloßen Objekt gemacht, kommt es auch mal zu Handgreiflichkeiten zwischen Vater und Tochter. Und zwar genau in dem Augenblick, als sie sich dazu aufrafft, sich zu wünschen, den Holländer durch ihre Treue erlösen zu können.

Olafur Sigurdarson (Holländer), Emma Vetter (Senta)
Dieses Tschechow’sche Element mag auf manchen Zuschauer im Hinblick auf den Gesamtkontext unlogisch gewirkt haben, ergibt aber durchaus Sinn, wenn man das Folgende als (Wunsch-) Traum Sentas auffasst, in dem sie sich einen zärtlich mir ihr umgehenden Retter herbeisehnt. Bezeichnenderweise liegt sie dabei in ihrem Bett. In der Tat lässt Frau Eggers die beiden Hauptdarsteller liebevoller und inniger miteinander verfahren, als es andere Regisseure oft tun. Diese visionäre Deutung erklärt auch, dass im dritten Aufzug keine Aufteilung des Chores stattfindet und die Norweger bei ihrem ausgelassenen Festlied auch den Part der holländischen Matrosen übernehmen.
Hier geht es nicht um die traditionelle Erlösung des Holländers von einem Fluch, sondern um diejenige von Senta durch die Eröffnung der Möglichkeit zur freien Selbstbestimmung. Diese sieht Aurelia Eggers aber nicht im Freitod des Mädchens, sondern in einer erfüllten Ehe mit dem Holländer. Beide überleben und werden glücklich miteinander - ein dem Kern der Oper zutiefst widersprechender Schluss. Dieses Ende ließ sich indes bereits ganz zu Beginn vorausahnen, als ersichtlich wurde, dass die Regisseurin das Ganze aus der Perspektive einer alten Senta erzählt, die auf den entscheidenden, Freiheit stiftenden Augenblick in ihrem Leben zurückblickt. Oder war das immer noch ein Traum, an den sich die betagte Senta da erinnerte? Die Frage bleibt offen. Hier wäre eine etwas deutlichere Zeichengebung von Frau Eggers tunlich gewesen. Insoweit blieb ihr konzeptioneller Ansatz zwiespältig.
Insgesamt zufrieden sein konnte man mit den Sängern/innen. In der Titelparte begeisterte Olafur Sigurdarson, hinter dessen grandioser vokaler Leistung alle seine Partner in den Hintergrund rückten. Hier haben wir es mit einem Heldenbariton zu tun, der den Holländer nicht nur mit purer Stimmkraft angeht, sondern ihm auch alle Vorzüge eines bestens fundierten, italienisch geschulten Singens zukommen lässt. Bestens das appoggiare la voce und die einfühlsame Linienführung seines klangvollen, ausdrucksintensiven Baritons. Diese Aspekte ergaben zusammen mit einer vorbildlichen Diktion ein hervorragendes Rollenportrait. Wann kann man diesen ausgezeichneten Sänger endlich einmal in Bayreuth erleben? Sein hohes Niveau erreichte Emma Vetter als Senta nicht ganz. Zwar wartete sie mit einem kraftvollen jugendlich-dramatischen Sopran auf, den sie differenziert einzusetzen wusste. Leider gab es gerade bei der Ballade Unebenheiten in der Tongebung, weil Frau Vetter da etwas auf die Stimme drückte. Das kann man wohl der Premierennervosität zuschieben. Es bleibt abzuwarten, wie sie sich bei den Folgevorstellungen entwickeln wird. Gut zu gefallen vermochte Timothy Richards’ Erik, dem die Regie seinen Beruf als Jäger beließ und dessen Szenen mit Senta zu zeitgemäßen, alltäglichen Streitereien unter Pärchen ausarteten. Mit seinem gut fokussierten, höhensicheren Tenor, der auch über eine treffliche Tiefe verfügt, entsprach er seiner Rolle voll und ganz. In nichts nach stand ihm Hiroshi Matsui, der sich mit sonorem, tiefgründigem Bass als gute Besetzung für den Daland erwies. Solide schnitt die Mary von Judith Braun ab. Als absoluter Schwachpunkt des Abends erwies sich János Ocsvai, der den Steuermann nur mit einem Hauch von dünner, kopfiger, nicht eben klangvoller und nur halb ausgebildeter Tenorstimme mehr säuselte als sang. Prächtig präsentierte sich der lustvoll und prägnant intonierende Chor, den Jaume Miranda vorzüglich einstudiert hatte.
Das Saarländische Staatsorchester brauchte bei der Premiere einige Zeit, um warm zu werden. Dass die Konzentration der Musiker zunächst noch nicht sehr ausgeprägt war, belegt das Auseinanderdriften der Instrumente beim ersten Einsatz des Erlösungsmotives während des Vorspiels. Statt des vorgeschriebenen Gemeinschaftsklangs ertönten die Fagotte kurz vor den Hörnern und dem Englischhorn. Im Lauf des Abends bekam man diese Schwierigkeiten aber in den Griff. Nicholas Milton fasste Wagners Partitur nicht als durchgehende Sturmmusik auf, wie es andere Dirigenten oft tun, sondern verlieh dem Ganzen eine etwas bedächtigere Note, wobei er insbesondere die vielfältigen Zwischentöne betonte.
Ludwig Steinbach, 1.12.2014
Die Bilder stammen von Björn Hickmann
Das Beste aus
LA FINTA GIARDINIERA
WA am 08.10.14 (Premiere am 05.07.2014)
Extremkürzung vermag trotz Regie-Qualität den Opernfreund nicht zu überzeugen
Entgegen einer Feststellung im Programmheft ist die Finta Giardiniera (auf Deutsch fälschlich: die Gärtnerin aus Liebe; eigentlich aber etwa: die verstellte Gärtnerin) keine selten gespielte Oper; vor allem seit dem Mozart-Jubiläumsjahr 2006 hat man häufiger deren verrückten Charme mit neuen Inszenierungen honoriert. Operabase listet von 2012 bis 2015 (unvollständig) allein 16 Neuproduktionen auf, dazu Wiederaufnahmen und Koproduktionen. In Originalfassung gespielt würde die Finta fast vier Stunden dauern, mit der Handlung einer so verworrenen semiseria, bei der man sich am Ende wohl nicht mehr an den Anfang erinnern würde. Von dem Dutzend Ton/Bildträger-Aufnahmen und Finta-Opernbesuchen Ihres Kritikers rangiert von der Länge die Zürcher Produktion von 2006 (Regie: Tobias Moretti) mit 190 Minuten zeitlich am obersten und die Arbeit von Lydia Steier am Theater St. Gallen mit 120 Minuten reine Spielzeit am untersten Ende. Dabei ist die Länge der Moretti-Arbeit ausnahmsweise nicht einem typisch langsamen Dirigat Harnoncourts geschuldet, denn es wird zügig und inspiriert musiziert, sondern der Tatsache, dass der Dirigent die wenigsten Kürzungen zugelassen und viele, teils ermüdende secco-Rezitative muszieren ließ. Die kann erfahrungsgemäß ohne große Probleme einkürzen. Lydiac Steiers Arbeit erschien dagegen schon sehr gedrängt und in der musikalischen Ausbeute grenzwertig.

Algirdas Drevinskas (Contino Belfiore); Elizabeth Wiles (Marchesa Violante Onesti)
Die Gruppe Ulrich Cornelius Maier (musik. Ltg.), Tom Ryser (Regie) und Brigitte Heusinger (Dramaturgie) legt in Saarbrücken gar eine Fassung in 90 Minuten vor. Da sind die Rezitative fast vollständig gestrichen, kurze deutsche Dialoge eingeführt, und die Oper endet nach einer Auswahl von Arien und Ensembles ganz abrupt. Der Handlungsstrang mit den sieben Protagonisten ist auf ein Minimum eingedampft. Wer Mozarts Finta Giardiniera noch nicht kennt, erlebt in Saarbrücken einen unterhaltsamen Abend; aber er kennt die Oper hinterher immer noch nicht. Wer die Finta aber kennt, wird, wenn er das Haus verlässt, viel nicht gehörter Musik, aber auch ganz entscheidenden Szenen nachtrauern, die mit der traumhaft einfachen und schönen Musik des jungen Komponisten auch etwas interessanten Quertrieb in der Handlung belassen hätten. Ein weiteres Mal Fernsehformat statt Oper am Saarländischen Staatstheater! Geht es um Zeitgewinn für das Publikum? Dann hier noch ein Tipp an das Leitungsteam: streichen Sie doch auch die 30 Minuten Pause; denn die ist genauso überflüssig wie ein secco-Rezitativ. Dann käme man noch früher nach Hause. Denn der kleine Umbau hätte beim Stil dieser Inszenierung in wenigen Minuten vom Bühnenpersonal auf offener Bühne bewältigt werden können. „Unsere schnelllebige Zeit ist von Film und Fernsehen geprägt und verlangt ein anderes Tempo“ schreibt Ulrich Cornelius Maier im Programmheft. Eben! Warum dann die Pause? Aber: gehen wir etwa in eine Oper des 18. Jhdts., weil wir uns von der neuen Zeit getrieben fühlen? Das Ganze hinterlässt einen sehr zwiespältigen Eindruck.

Ulrich Cornelius Maier, Herdís Anna Jónasdóttir (Serpetta)
Wenn man es nicht anders kennt oder sich mit diesem Zuschnitt abfindet, dann kann man allerdings eine durchaus originelle und respektable Regiearbeit erleben, bei der allerdings Ulrich Cornelius Maier auch musikalisch einige recht gravierende Änderungen vorgenommen hat, die das Stück stilistisch deutlich von einer musikalischen Komödie des settecento unterscheiden, während der Inszenierungsstil gerade auf dieser Zeit aufsetzt. - Die opera buffa hatte sich zur 1775 (Jahr der UA) schon durchgesetzt. Haydn schrieb zur gleichen Zeit in Esterháza eine ganze Reihe von musikalischen Komödien. (Die werden wirklich nur noch ganz selten aufgeführt!).
Noch vor der Einführungsmusik wird hinter einem Vorhang im Schattenspiel des Gegenlichts die Vorgeschichte gezeigt. Zwei verschiedengeschlechtliche Personen lieben sich eigentlich, wollen gar heiraten, geraten aber in Streit, einer sticht auf die andere ein. Die verletzte Violante fällt durch den Vorhang auf die Vorderbühne; das „Gräflein“ (Contino Belfiore) ergreift die Flucht. Der Kinder- und Jugendchor (alle hübsch in weißen Rüschenkleidern) ist traumatisiert; man versucht mit allen erdenklichen ungeeigneten Mitteln zu helfen. Der Vorhang wird zur Seite gezogen, die Bühne bevölkert sich weiter. Man fühlt sich genau in den Park von Esterháza versetzt, wo in einem Park mit kleinen Bäumen und alten Gartenbänken vor einer großen halbrunden laubenartigen und begehbaren Holzkonstruktion wie in einem Heckentheater eine Oper aufgeführt wird. Zum Einstudieren wird die Musik der sinfonia leise aus einem Grammophon zugespielt; der Chor verstärkte sie mit Lalala und Vokalisen, während die Musiker nacheinander auf der Bühne in zwei Gruppen Platz nehmen. In der Mitte bleibt ein Gang nach vorne frei, vorne eine nur kleine Spielfläche. „Wir spielen eine Oper“ heißt das Thema. Die Personen werden teilweise wie in der klassischen Komödie vorgestellt. Sie sind in Rokoko-Gewändern verkleidet (Contino Belfiore) oder in hübsche zeitlose oder auch ganz moderne Kostüme gesteckt. (Die gesamte Ausstattung hat Stefan Rieckhoff beigesteuert.) Die Regie entwickelt ein recht munteres Spiel mit vielen gelungenen Einfällen auf dem wenigen freien Platz der Bühne, was hier und da aber zwangsläufig zu Rampensingen führt; insbesondere auch bei den Ensembles, die so typisch für die Buffen sind, sind die Protagonisten an der Rampe aufgereiht.

Ulrich Cornelius Maier, Elizabeth Wiles (Sandrina/Violante), Saarländisches Staatsorchester
Vor der Verwandlung in zweiten Akt liegt die Pause; die Musiker hatten schon ihre Plätze verlassen und spielten die letzten Takt ganz von hinten. Dann begann ein echter Bühnenzauber. Die Drehbühne zerteilte die große Laube, zeigte sie von hinten mit Aufgang, die Seitenelemente fuhren nach vorne. Die Beleuchtung schaffte schaurig schöne Effekte mit Bäumen; denn befand sich Violante verlassen im Wald. Das Orchester, gruppiert die Violinen und Violen links, die tiefen Streicher und Bläser rechts, hatte wieder seinen Platz auf der Bühne eingenommen. Die Regie hatte zum Kinderchor noch gleich gekleidet das Kind Sandrina und das Kind Belfiore gesellt; deren Rollen waren an sich unbeachtlich. Aber sie schoben ihre jeweils großen Pendants zwecks schnellerer Versöhnung aufeinander zu (die retardierende und verwirrende Verwechslungsszene war als solche gestrichen), was zum schnellen abrupten Ende der Vorstellung beitrug: anders als im Original jubelten nicht nur die sieben Darsteller bei der Mehrfachhochzeit, sondern die Kinder sangen das auch im Chor.

Elizabeth Wiles (Sandrina Violante) mit Anna Ocsovai (Kind Sandrina); Kinderchor des SST
Knapp dreißig Musiker des Saarländischen Staatsorchesters bildeten die Kapelle. Der Dirigent Ulrich Cornelius Maier war sich natürlich der Tatsache bewusst, dass das auf der Bühne platzierte Orchester stärker in den Saal schallte als aus dem Graben, und nahm es durchweg ziemlich zurück. Aber er nahm es zu weit zurück. Es fehlte an fuoco, Inspiration und Dynamik. Da hätte er sich ruhig vorher einmal Harnoncourt mit La Scintilla anhören können, wo Emotion und Energie der frühen Mozart-Musik in ganz anderer Weise freigesetzt werden, und seinem sauber ohne Fehl und Tadel aufspielenden Orchester mehr Glanz verleihen können. Parodistisch wurden Eigen- und Fremdzitate mit hohem Bekanntheitsgrad frei in die Partitur gemischt. Mauro Barbierato und Hans-Joachim Hofmann hatten den Kinder- und Mädchenchor des Staatstheaters genau vorbereitet. Er wirkte auch stumm als Bewegungskörper, der anregend durch die Szene schwappte und wuselte. Besonders beziehungsreich stellen sie mit großen Zweigen einen sich nach vorne bewegenden Wald dar. (Plötzlich ist man in Schottland.)

Stefan Röttig (Nardo), Herdís Anna Jónasdóttir (Serpetta), Elizabeth Wiles (Marchesa Violante),Rupprecht Braun hinten: Podestà Don Anchise), Algirdas Drevinskas (Contino Belfiore), Tereza Andrasi (Arminda), Judith Braun (Don Ramiro); Kinderchor des SST
Alle Sänger waren aus dem Saarbrücker Ensemble besetzt. Dadurch, dass sie meistens dort sangen, wo normalerweise der Orchestergraben ist, waren Sie stimmlich und darstellerisch sehr präsent nahe beim Publikum. Dazu kam die sängerfreundliche Personenführung, so dass insgesamt ein sehr positiver Eindruck des Solistenensembles entstand. Wenn allerdings (erst Ramiro, dann Sandrina) ganz hinten und oben auf der Holzwand standen, hätten sie ihren Stimmausdruck der stark vergrößerten Distanz zum Theatersaal anpassen müssen. Die Fassung war von den Ensembles mit großem Musikreichtum beherrscht; es waren nicht viele Arien übrig geblieben. Elizabeth Wiles gab die Sandrina/Violante mit reizender Bühnenpräsenz ausdrucksstark mit silbrig klaren Höhen. Tereza Andrazi gefiel als Arminda mit ihrem kräftigen, auch dramatisch eingesetzen Sopran. Als Serpetta (einer dieser hübschen Namen der italienischen Buffa für das Dienstmädchen), eine weitere Sopranrolle, gefiel Herdís Anna Jónasdóttir mit beweglicher klarer Stimme und ansprechendem Spiel. Beim Sprechen kam sie nicht so deutlich rüber wie ihre Kollegen, dazu waren ihr noch ungarische Worte in den Mund gelegt worden. Judith Braun als Ramiro war die einzige verbliebene seria-Arie zugefallen; ihr klarer kräftiger Mezzo mit schöner Strahlkraft verlieh der Hosenrolle das optimale stimmliche Profil. Mit Algirdas Drevinskas als „Gräflein“ Contino Belfiore von stattlicher Figur stand ein feiner, gut geführter Mozart-Tenor zur Verfügung. Lediglich Rupprecht Braun in der Rolle des Podestà Don Anchise fiel ab, sein wenig fokussierter Tenor wirkte halsig.
Das Opernhaus war recht gut besetzt, wozu offensichtlich auch viel Jugend vom Theater angelockt wurde. Es gab lang anhaltenden Beifall für den (angebrochenen) Abend.
Manfred Langer, 09.10.2014 Die Fotos sind vom Thomas M. Jauk
Unmotivierte Strichfassung
LUCIA DI LAMMERMOOR
Premiere am 04.10.2014
Eine Lucia im Fernsehformat – aber der Gesang stimmt

The Bride of Lammermoor ist eine von Walter Scott 1819 veröffentlichte Erzählung, die einer damaligen Mode folgend im „romantischen Schottland“ des späten 16. Jhdts. spielt. Die Handlung der Geschichte läuft vor dem bekannten historischen Hintergrund der Zeit ab: Französische und englische Interessen spalten das Land. Die verfeindeten Ashtons und Ravenswoods sitzen aus verschiedenen Gründen beide in der Klemme; die versuchte Zwangsverheiratung von Lucia durch ihren Bruder Lord Enrico Ashton führt zur Katastrophe weil sie den Familienfeind Sir Edgardo di Ravenswood liebt. Donizettis Oper auf dem Libretto von Salvatore Cammarano war nicht die erste Vertonung des noch jungen Stoffs, als sie 1835 in Neapel uraufgeführt wurde, aber es ist die einzig überlebende, dazu eine der beliebtesten Opern Donizettis überhaupt und ein Paradebeispiel, wie sich der italienische Belcanto-Stil mit der Romantik amalgamiert. Man findet die typische Dreierkonstellation vor: das Liebespaar mit Sopran und Tenor sowie Enrico als stimmfinsterem Gegenspieler. Der ist von beiden Widersachern der Abgefeimtere und verfügt im Plot der Oper noch über Helfershelfer, die ihm bei einer gemeinen Intrige helfen. Edgar und Lucia müssen zugrunde gehen. Das alle spielt in herber düsterer Landschaft, auf Friedhöfen vor der Kulisse finsterer Schlossgemäuer. Zusammen mit der unentrinnbaren Handlung macht das den Reiz der Oper aus, bei der Inszenierungen der letzten Zeit immer mehr soziokulturelle Facetten an die Oberfläche bringen. Eine einfache Geschichte der Schauerromantik mit finsteren Schlössern, Burgruinen und herber Hochmoorlandschaft wird heute zumindest nördlich der Alpen kaum noch inszeniert.

Xavier Moreno (Edgardo), Yitian Luan (Lucia), im Hintergrund: Judith Braun (Alisa)
Eine starke Frauengestalt Lucia mit einem vergeblichen Befreiungsversuch aus ihrer Situation zwischen den zwei verfeindeten Männern (Bruder und Geliebter), die aber beide gleichermaßen Exponenten des männlichen Herrschaftsanspruchs darstellen, wollte der Regisseur Ben Baur in Saarbrücken auf die Bühne bringen. Das ist ihm aber nur teilweise gelungen, denn Baur und die Dramaturgin Caroline Scheidegger verheddern sich in den dramaturgischen Abläufen einerseits und überflüssigen Mätzchen des Regietheaters andererseits. Schon bald nach ihrem Herauskommen hat man an den etwa zweieinhalb Stunden reiner Spielzeit der Oper zu kürzen begonnen, bis sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wieder eine regelmäßige Spielpraxis für die italienische und französische Fassung des Werks durchsetzte. Eine der frühen Streichübungen war, die Oper nach der Wahnsinnsarie der Lucia zu beenden. Da konnte sich die Primadonna sich mit diesem Bravourstück am Ende gebührend feiern lassen, was ganz in ihrem Sinne lag, und dem Tenor im Schlussbild keine weitere Gelegenheit mehr zur Profilierung gab. Diese Spielweise lag aber auch in den romantischen Gepflogenheiten, die Handlung spektakulär enden zu lassen – wie etwa beim Don Giovanni mit der Höllenfahrt des Titelhelden.

Xavier Moreno (Edgardo), Chor
Solche Motivation für eine radikale Kürzung kennt unsere heutige Zeit nicht mehr. Dennoch nahm die das in Saarbrücken auf, wollte aber die letzte Szene mit Edgardos Arie „Tu che a dio spiegasti l’ali“ nicht opfern und stellte diese Szene an den Beginn der Oper. Damit sind Lucia und Edgardo beim Beginn der Originalhandlung also schon tot, und das Ganze kann nur noch als eine Art Retrospektive ablaufen. Die Änderung zieht aber einen Rattenschwanz von anderen dramaturgisch veranlassten Modifikationen (sprich: Schnitten) nach sich, so dass nun eine Strichfassung im Fernsehformat von eindreiviertel Stunden mit Kürzungen von deutlich über einer halben Stunde präsentiert wurde. Da muss schon bei der Ouvertüre gekürzt werden, da die Überleitung nicht mehr passt (später wird die Passage wieder eingeflickt); das erste Bild aus dem dritten Akt ist ganz gestrichen. Das ist zwar zugegebenermaßen ohnehin eine dramaturgische Verirrung des Stücks; aber mit zehn Minuten überflüssigem Cammarano verschwinden auch zehn Minuten Donizetti. Die Streichung des ersten Auftritts aus dem zweiten Akt lässt hingegen die folgende Szene zwischen Enrico und Lucia in der Luft hängen. Mit weiteren kleinen Strichen wird der Zuschauer dann im Schweinsgalopp durch die Oper getrieben.
Das in den letzten Jahren in der Oper ohnehin stark überstrapazierte Konzept der Retrospektive wird zudem nicht konsequent realisiert. Zwar wird zu diesem Zweck mit einer „kleinen Lucia“ eine stumme Figur eingeführt, die aber bald wieder verschwindet. Dafür wird aus der Alisa, deren Rolle szenisch stark aufgewertet ist und die jeweils in der gleichen Kleidung wie Lucia auftritt, eine Art Alter Ego der Titelfigur gemacht. Am Brunnen reißt Lucia ihr die Perücke vom Kopf, so dass sie kahlköpfig dasteht. Sollte sie so das Gespenst der ermordeten Urahnin darstellen? Lord Arturo Buklaw tritt als wandelnde Leiche (oder als Gevatter Tod) auf. Eine solche Gestalt hätte doch Lucia ruhig heiraten können; Arturo hätte es ohnehin nicht mehr lange getan... Aber vielleicht wollte die Regie ausdrücken, dass nicht zuletzt durch diese Nebenfigur Tod und Unglück eintreten konnten.

Yitian Luan (Lucia); James Bobby (Enrico); "drei lteWeiber"
Ben Baur, gelernter Szenograph, hat auch das Bühnenbild für die Produktion entworfen. Das ist so einfach wie wirkungsvoll. Auf dunklen, zunächst bühnenbegrenzenden Wandelementen sind Kreuze vor finster drohenden, schemenhaften Burgruinen aufgemalt. Durch Rotation der beiden konzentrischen Drehbühnen werden diese Elemente bei Szenenwechsel in immer neue Positionen gedreht und erzeugen neue geeignete Spielflächen. Im Hintergrund der ersten Szene der Oper, die ja in Wirklichkeit die letzte ist, ist hinten auf der Bühne der kerzenübersäte makabre Traualtar aufgebaut, Albtraum und Wahn der Lucia. Da der am Ende wieder auftaucht, wird hier der Bogen zu ihrem Wahn auch szenisch gespannt In Uta Meenens Kostümen spiegelt sich die Mode der Entstehungszeit von Erzählung und Oper wieder: das beginnende bürgerliche Zeitalter nach der Restauration. Als allerdings Lucia für die Zwangsehe eingekleidet wird, muss sie sich über ihr klassizistische langes weißes Gewand ein schwarzes Renaissancekostüm mit Krinoline und Stickelementen überziehen lassen; sie wird also in eine 200 Jahre zurückliegende Vergangenheit zurückversetzt. Da fragte man Frauen schon gar nicht nach ihren Wünschen. Das widerfährt spiegelgleich auch mit der Kleidung der Alisa, die aber ihren Kahlkopf behält. Die ganze Hochzeitsfeiergesellschaft ist ebenfalls in Schwarz gekleidet. Hochzeitsfeiern gehen anders.
Die Personenführung wirkt streckenweise statisch. Die ersten beiden Chorszenen (der Chor soll Jagd auf Edgardo machen) sind vergeben. Da hätte man die Jäger besser gleich zur Jagd tragen können, so undynamisch und undramatisch müde wirkte das. Ganz im Gegenteil dazu gelangen die Chorszenen im zweiten Akt; der Jubelchor wird dramatisch bewegt und wandelt sich zum Todeschor. Den Darstellern werden keine ungemütlichen Posen zugewiesen; im Gegenteil, es darf auch an der Rampe gesungen werden. Bei Lucias großem Schlussgesang (kein weißes Nachthemd mit Blutflecken) kommt als Verfremdungseffekt der Inszenierung eine Kulisse mit prächtig gemaltem, italienischem Theatervorhang herunter; davor darf Lucia im schwarzen Renaissancekostüm ihre zur Schlussarie gewordene Wahnsinnszene überwiegend im Stehen singen und kann sich ganz auf die Musik konzentrieren. Denn, wie schon gesagt, der Zweck der Umordnung ist, dass die Primadonna zuletzt produziert und den größten Beifall entgegen nehmen darf.

Yitian Luan (Lucia)
Das tat an diesem Abend auch völlig verdient die hochgewachsene chinesische Sopranistin Yitian Luan in der Titelrolle. Nach Ablegen anfänglicher Premierenanspannung, die sich in einem leichten Flackern der Stimme äußerte, lief sie im Verlauf zu großartiger Form aus. Sie war der Star des Abends mit ihren warmen Koloraturen, leuchtenden Höhen und sicherer Stimmführung; dazu treffsicher mit ihren aus den Ensembles heraus tönenden Oktav-erhöhten Spitzentönen. Aber auch die anderen Rollen waren gut besetzt. James Bobby gab den Enrico mit kraftvollem Bassbariton. In seiner Stimme hat er zwar nicht die Schwärze des Bösen, aber das konnte er mit einem etwas härteren Ausdruck gutmachen. Hiroshi Matsui fügte seinem großen Repertoire mit dem Raimondo Bidebent eine weitere Rolle hinzu, die er mit seinem bis in die Tiefe voluminös strömenden Bass überzeugend gestaltete. Xavier Moreno gab mit seinem kraftvollen Tenor einen Edgardo von fester Strahlkraft und klaren, sicheren Höhen. János Ocsovai sang mit verlässlichem Tenor die noch kleiner gewordene Rolle des Normanno. Rupprecht Braun verlieh dem leichenähnlich ausgestalteten Arturo Buklaw die passende schwankende Tenorstimme. Judith Braun gefiel mit gut fokussiertem klaren Mezzo in der hier merkwürdigen Gestalt der Alisa.
Wenige Opern verfügen über eine so dichte Folge von eingängiger Melodik wie die Lucia. Einfachheit, Emotion und Inspiration; man hat das gerade einmal gehört, und schon kommt es einem bekannt vor. Das Saarländische Staatsorchester musizierte die Partitur unter der Leitung von Araldo Salmieri ohne Fehl und Tadel. Allerdings wirkten die Tutti-Passagen des Orchesters recht holzschnittartig und waren teilweise sehr laut. Salmieri ließ es teilweise ordentlich krachen, vor allem im Kontext mit Enrico und dem Chor. Da gaben Becken und Pauken den Ton an. Dazu kontrastierten aber (zu Lucia) feine Passagen. Die viel gesetzten Hörner zeigten schöne piano-Kultur; nuancierte Färbungen der Holzbläser, teilweise solistisch eingesetzt, wirkten im emotionalen Bereich mit. Auch die Harfe spielte schöne Solo-Passagen und duettierte fein mit Horn oder Flöte. Dorothee Strey, die das Flötensolo zur Wahnsinnsarie spielte, wurde vom Dirigenten auf die Bühne gerufen. Den großen klangschönen Opernchor hatte Jaume Miranda einstudiert.
Es versteht sich von selbst, dass der Regisseur das Werk kennt. Die meisten Zuschauer werden die Oper schon gesehen haben. Aber einige sehen sie immer zum ersten Mal. In diesem Falle haben sie etwas gesehen, was sie nun für die Lucia di Lammermoor halten. Das Publikum dieses Premierenabends war aber äußerst zufrieden mit dem Gesehenen: davon zeugte eine Viertelstunde begeisterten Beifalls aus dem vollen Haus. Die Lucia kommt wieder am 10., 16. 19., 21., 25. und 30. Oktober und dann noch weitere sechs Mal bis zum 01.04.15.
Manfred Langer, 05.10.14 Fotos: Björn Hickmann
MACBETH
Besuchte Vorstellung: 22. Juni 2014 (Premiere: 12. April 2014)
Giuseppe Verdis „Macbeth“ bietet viele Möglichkeiten der Aktualisierungen und kann in jeden beliebigen aktuellen Krieg verlegt werden. Sebastian Welker verortet das Stück in Saarbrücken jetzt im Mafia-Milieu und macht aus dem Kampf um den schottischen Thron einen internen Bandenkonflikt. Welkers Regie ist weitgehend schlüssig und stilsicher. Gleich während des Vorspiels wird ein Mafiaboss beerdigt und seine Mörder kondolieren der Witwe am Grab. Hauptschauplatz der Inszenierung ist der große Salon in Macbeths Villa. Hier wird der neue Boss Duncan von Macbeth erstochen, und das Bankett, bei dem sonst der gerade ermordete Banco erscheint, ist die Trauerfeier für Duncan.

Ein Hauptproblem jeder Macbeth-Inszenierung ist die Frage, wer oder was die Hexen sind? Welker macht aus ihnen die Geistererscheinung dreier Mädchen in weißen Kleidchen und Schleife im Haar. Diese Idee erinnert an die zwei Mädchen, die Regisseur Stanley Kubrick immer wieder in seinem Klassiker „Shining“ erscheinen lässt.
Von diesen scheinbar niedlichen Kindern geht in dieser Inszenierung tatsächlich eine latente Bedrohung aus. Dafür nimmt Welker in Kauf, dass die Frauenchöre aus dem Off erschallen. Unlogisch ist jedoch, dass der Regisseur dann zu den Geisterscheinungen des dritten Aktes doch den ganzen Frauenchor im Kleinmädchenkostüm auf die Bühne holt. Sehr schön und mehrdeutig gelingt der Übergang vom dritten zum vierten Akt: Macbeth und seine Lady nehmen die drei Mädchen als Kinder an und spielen mit ihnen. Dann läuft den Kindern Blut aus dem Mund und sie sterben, worauf Macduff in seiner großen Arie den Tod seiner eigenen Kinder betrauert. Eine logische Schwäche der Inszenierung betrifft die Titelfigur: Wie könnte ein Macbeth, der so stark von Gewissenbissen und moralischen Skrupeln geprägt ist, in der Mafia solch eine wichtige Rolle spielen? Macbeth wird im Original erst durch die Prophezeiung der Hexen und die Beeinflussung durch seine Frau zum Mörder. Ein Mafia-Macbeth darf aber kein Gewissen haben.

Der englische Bariton James Bobby singt den Macbeth so, als sei die Rolle für ihn komponiert worden. Die Stimme lässt er in den Arien frei strömen und setzt dabei kluge Höhepunkte. Die Zerrissenheit der Figur zwischen Machthunger und schlechtem Gewissen spielt und singt er auf den Punkt genau. Besonders eindringlich gelingen ihm die Hexenszene des dritten Aktes und seine große Arie vor der finalen Niederlage.
Die Lady Macbeth wird von Melba Ramos mit großem dramatischem Impetus gesungen. Ihr würde man auch hochdramatische Wagner-Partien wie Isolde und Brünnhilde zutrauen. Hiroshi Matsui singt einen sonoren Banco. Das Saarländische Staatsorchester wird von Marzio Conti zu einer starken musikalischen Leistung angespornt. Die lyrischen Passagen werden leicht ausmusziert, aber die Dramatik und permanente Bedrohung stehen im Zentrum der Aufführung.
Rudolf Hermes 24.6.14 Bilder Thomas M. Jauk
Musikalisch traumhaft
DIE FRAU OHNE SCHATTEN
Premiere am 07.06.2014
Statt Märchen auf „südöstlicher Insel“ realitätsnah: Erster Weltkrieg im verfallenden Habsburger-Reich
Es war die vierte Strauss-Oper in Folge, für die Hugo von Hofmannsthal das Libretto schrieb. Nach dem Rosenkavalier und der nachgebesserten Ariadne wollte sich aber Erfolg der früheren Werke der beiden Autoren nicht recht einstellen, worauf es zu gegenseitigem Murren kam. Strauss meinte, Stoff und Text seien zu schwer verständlich; richtig, meinte von Hofmannsthal, zu schwer verständlich, weil die gesungenen Texte nicht durchkämen. Denn damals gab es keine Übertitelungsanlagen. Hofmannsthal veröffentlichte zur Selbstrechtfertigung sofort seine gleichnamige Erzählung. Strauss schrieb sich das Libretto für seine nächste Oper („Intermezzo“) selber mit besonderer Beachtung Textverständlichkeit – als „Lückenbüßer bis zum nächsten Hofmannsthal.“ Langfristig gram waren sich die beiden kongenialen Autoren indes nicht. Es handelte sich postnatale Reibungen bei dieser letzten großen romantischen Feenoper, die auch heute noch weithin als symbolisch verklausuliert, sperrig und schwer spielbar gilt.

Kaiser; Onur Abaci (Falke)
Aber es gab auch etliche vorgeburtliche Wehen, von denen einige auf den Ausbruch des ersten Weltkriegs zurückzuführen waren. So konnte der eingezogene von Hofmannsthal den dritten Akt des Librettos nicht zügig fertigstellen, und schließlich sah sich Strauss nach Fertigstellung der Oper veranlasst, die Uraufführung des Werks bis nach dem Schlachten zu verschieben, das so gar nicht zu den hehren Themen der Oper passt. Im Herbst 1919 kam die Oper in kurzem zeitlichem Abstand in Wien und Dresden heraus. Die Entstehungszeit des Werks und die 100. Jährung des Kriegsausbruchs mögen den Regisseur Dominik Neuner mit veranlasst haben, das Geschehen der Fr. o. Sch. in die Donaumonarchie und in die Zeit des Ersten Weltkriegs zu verlegen, statt es im Kaiserreich einer fiktiven „Südöstlichen Insel“ zu belassen. Mit einiger Sicherheit ist anzunehmen, dass diese Verortung und Verzeitung den beiden Autoren nicht gefallen hätte. Aber es ist erstaunlich wie reibungslos das Konzept aufgeht, bei dem Neuner noch sehr eng am Libretto und dessen Regieanweisungen entlang inszeniert und manchen Textteilen eine veränderte und klarere Bedeutung zu geben versteht, statt sich am Originallibretto zu reiben.
Die Amme (über die Menschen):
Uns riecht ihre Reinheit
nach rostigem Eisen
und gestocktem Blut
und nach alten Leichen!
Dazu hat Neuner auch selbst ein geeignetes Bühnenbild entworfen, das aus einem breit über die Bühne reichenden Gemäuer mit drei Ebenen besteht. Es könnte ein vom Krieg beschädigter Industriebau oder auch verfallende Herrschaftsarchitektur sein. Susanne Hubrich hat die Akteure überwiegend in schlichte Kostüme oder schmuddelige Uniformen gesteckt. Der Einäugige, der Einarmige und der Bucklige sind Kriegsinvaliden. die irgendwie ihr Leben fristen. Das von Barak organisierte Festmahl besteht aus einer bescheidenen Menge zusammenorganisierter Lebensmittel. Der Kaiser und sein Falke fallen aus dem Rahmen, aber nicht ganz: der Falke kriecht in historischer Uniform mit einer zerfetzten österreichischen Kriegsfahne über die Bühnenstrukturen, wenn er sein „der Kaiser muss versteinen“ singt; letzterer ist in einen noblen Renaissance-Mantel gekleidet. Hier wird sichtbar, wie weit es im Habsburger-Reich von Carolus Quintus bis Kaiser Franz-Joseph gekommen ist. Die Bevölkerung vegetiert im Dreck des Kriegs. Vor dem Gemäuer liegt ein toter Soldat mit dem Kopf neben der Kriegsadler-Fahne und seinem Stahlhelm in einem Wassergraben, der dem Färber auch zum Spülen seiner Ware dienen könnte. Geisterbote, Amme, Kaiser und Kaiserin treten auf den oberen Ebenen auf, die normalen grauen Menschen müssen unten um ihre Existenz kämpfen. Das versöhnliche Ende mit dem klassischen Jubelgesang (es darf sogar die verjagte Amme hier zumindest szenisch mittun) findet vor dem Parterre im „Abgrund der Menschenwelt“ statt; Gleichheit lässt sich eben immer nur auf unterstem Niveau verwirklichen...

hinten: Dalia Schaechter (Amme); und Marion Amann (Kaiserin) auf dem Abstieg zu: János Ocsovai (Buckliger), Markus Jaursch (Einäugiger), Hiroshi Matsui (Einarmiger)
Obwohl die Inszenierung mit der Beziehungssetzung zum Krieg eine weitere Ebene von Symbolik schafft, rückt der symbolhafte Gesamtgehalt des Stoffs, „für den Hofmannsthal ausgiebig im Motivfundus der Weltliteratur plünderte“ (die Dramaturgin Caroline Scheidegger im Programmheft), durch die wahrhaftige, wenig märchenhafte, und leider real existierende Welt, die auf der Bühne gezeigt wird, in den Hintergrund. Der tote im Wasser liegende Soldat entpuppt sich szenisch als der verführerische Jüngling (von irgendwo her gesungen), Märchenfiguren werden nur annäherungsweise gezeigt: die Amme als böse Fee mit Zylinder und von Fuchspelzen umbaumelt, die Kaiserin hell gekleidet als gute Fee. Diesem Dualismus ist das niedere Paar mit seinen Begleitfiguren ausgesetzt. Das gute Ende wird durch die richtigen Entscheidungen der Kaiserin und der Färberin herbeigeführt. Aber der Ausblick bleibt trüb. Weiterhin laufen Figuren mit Gasmasken über die Bühne, die von grauen Flüchtlingsgestalten bevölkert ist, von denen eine gar mit einem alten Kinderwagen Kinderleichen eingesammelt hat. Sollte die wiedergewonnene Liebe und Fortpflanzungsfähigkeit (beide Frauen haben ja am Ende einen eigenen Schatten) nun nur dazu dienen, dass die (noch) ungeborenen Kinder wieder Kanonenfutter werden? Aber wir wollen lieber an den Jubelgesang glauben: „Nun will ich jubeln, wie keiner gejubelt, nun will ich schaffen, wie keiner geschafft“ (Barak). Krieg und Not finden nur noch auf den südöstlichen Inseln statt, nicht mehr im schönen Mitteleuropa. Neuner kann in seiner Inszenierung die Protagonisten durchaus im Sinne der „Erfinder“ charakterisieren und legt eine stringente, überzeugende Personenführung vor.

Olafur Sigurdarson (Barak), Hiroshi Matsui (Einarmiger), Markus Jaursch (Einäugiger), János Ocsovai (Buckliger), Marion Amman (Kaiserin), Dalia Schaechter Amme), Sabine Hogrefe (Färberin)
Die „Frau ohne Schatten“ hat sich auf den Opernbühnen erst allmählich durchgesetzt und wegen der hohen Ansprüche an Solisten, Orchester und Bühne bleibt sie den kleinen Bühnen unzugänglich. Fünf große und schwierige Hauptrollen sind zu besetzen, ein großes Strauss-Orchester muss zur Verfügung stehen und auch untergebracht werden, die szenische Umsetzung der verschiedenen Schichten des Stücks bleibt eine heikle Aufgabe zwischen kitschendem Märchen und unverständlicher Abstraktion oder tief „psychologisierender“ Dekonstruktion. Christoph Loy hat sich dem vor zwei Jahren in Salzburg durch Inszenierungsverweigerung entzogen; in Neuners herb-realistischer Bebilderung wird die Gratwanderung bestanden. Die zunehmende Beliebtheit des Stücks nun auch im Ausland ist bestimmt nicht der beziehungsreichen Bedeutung des Schattens, dem Thema Ehe und Kinderkriegen oder den allgemeineren Themen von Prüfung und Erlösung à la Zauberflöte geschuldet, sondern überwiegend der grandiosen Musik, die sich im Spannungsfeld zwischen Romantik und Neutönerei bewegt.

Sabine Hogrefe (Färberin), Dalia Schaechter (Amme)
Auch hier hat das mittelgroße Haus in Saarbrücken „bestanden“ und sogar mit Prädikat. Strauss spricht bei seinen Opern über die „sorgfältigster Ausarbeitung der ... peinlich genau bezeichneten Dynamik“, die „dem Orchester diejenige Durchsichtigkeit verleiht, die ich bei der Komposition vorausgesetzt ... und auch erzielt gesehen habe“. Gerade das ist auch dem Saarländischen Staatsorchester unter Toshiyuki Kamioka bestens gelungen. Fein ziselierte, kammermusikalische Passagen mit ihren betörenden Färbungen gelangen ebenso wie die in die Musik übertragenen Verwerfungen und Zuspitzungen der Dissonanzen-Kultur im zweiten Akt. Zarte Soli der Celli und Geigen überzeugten ebenso wie der feierliche Ausdruck der Wagner-Tuben und Posaunen, auch wenn bei den Piano-Einsätzen der Hörner und Trompeten nicht alles gelang. Kamioka erzeugte Spannung nicht durch zu schnelle Tempi, sondern im Gegenteil durch lang gespannte Bögen bei meist gemessenem Tempo. Im dicht bevölkerten Graben hatten nicht alle Musiker Platz gefunden; das Schlagwerk in die Glasharmonika wurden aus einem Nebenraum zugespielt, was die musikalische Leitung nicht einfacher machte. Auf gut dreieinhalb Stunden reine Spielzeit kam die Oper ohne die üblichen Schnitte im dritten Aufzug. Kamioka, der sein Amt als GMD in Saarbrücken zugunsten des Amts als GMD und Opernintendant in Wuppertal tauscht, wurde für sein letztes Dirigat in Saarbrücken gebührlich gefeiert. Vor Begeisterung wurde sogar in die Aktschlüsse hinein geklatscht (versehentlich nach dem ersten, mit Absicht nach dem dritten Aufzug). Neben dem Orchester hatten der Opern- und der Kinderchor des Saarländischen Staatstheaters (Einstudierung: Jaume Miranda) weniger Möglichkeit sich zu profilieren.

Dalia Schaechter (Amme), Marion Amman (Kaiserin)
Auch beim Solistenensemble konnte das Staatstheater punkten. Für den erkrankten Marco Jentzsch konnte in der Rolle des Kaisers Torsten Kerl einspringen, der auf dem Wega nach Bayreuth zu den Tannhäuser-Proben kurzfristig aus irgendeinem Flugzeug geholt werden konnte. Es ist die einzige Rolle in der Oper, bei welcher Strauss mit dem Orchester nicht auf die Stimmbänder des Solisten Rücksicht genommen hatte (bei „Tenoristen“ fiel Strauss das nicht ein); Torsten Kerl hatte das auch nicht nötig; sein Heldentenor verfügt über eine überaus durchschlagskräftige baritonale Mittellage, auf welcher er seine klaren, leuchtenden und kraftvollen Höhen entwickelt. Die drei weiblichen Hauptrollen waren ebenfalls gut besetzt. Dabei hinterließ Dalia Schaechters dramatischer Mezzo in der Rolle der Amme mit seiner betörenden samtig-weichen dunklen Mittellage und schöner Strahlkraft in der Höhe den komplettesten Eindruck. Die Kaiserin von Marion Ammann zeichnete sich durch überirdisch schöne klare Linien in der Höhe ab, eine Paradebeispiel für einen jugendlich-dramatischen Sopran. Sabine Hogrefe als Frau des Färbers überzeugte hingegen am meisten mit ihrem tieferen Register, in welchem sie warm und innig klang, wohingegen die Höhen etwas eng wirkten. Eine Glanzpartie sang ein weiteres Mal Olafur Sigurdarson als Färber Barak. Fast als Ironie wirkt bei der untersetzten Statur des Bassbaritons seine Charakterisierung als „Breitspuriger“. (AMME zur Färberin: „Hat es dich blutige Tränen gekostet, dass du dem Breitspurigen keine Kinder geboren hast?“) Nun, Sigurdarson ist in der Tat kein Schmalspur-Bariton, sondern wusste auch weit über das Saarland hinaus schon in einer beachtlichen Vielzahl von Rollen in etlichen Sprachen zu überzeugen. Den Barak sang er an diesem Abend in Saarbrücken mit körperlich tief sitzender Kraft, einwandfreier Diktion und dem leichten Schuss Melancholie, der dieser Rolle zu Eigen ist. Im letzten Aufzug musste er allerdings der Riesenrolle hörbar Tribut zollen.
In der Rolle des Falken war mit Onur Abaci eine helle männliche Sopranstimme gesetzt. Da der Falke sich auch zum Gesang der „Stimme von oben“ (von geschmeidiger Leuchtkraft: Judith Braun) scheinbar qualvoll auf der Bühne bewegte, gelangte man zu dem Eindruck, dass szenisch diese beiden Rollen vereinigt werden sollten, was einer gewissen Logik nicht entbehrt. Mit kraftvoll hellem Bass gestaltete James Bobby seine Auftritte als Geisterbote. Die drei „Invaliden“ waren stimmlich kompetent mit Markus Jaursch (Einäugiger), das „Urgestein“ des Saarländischen Staatstheaters Hiroshi Matsui (grundsolide wie immer als Einarmiger) und Janós Ocsovai (Buckliger) besetzt.
Das Haus konnte für die Premiere dieser immer wieder viel beachteten Oper keinen besonders großen Publikumszuspruch verbuchen. Das sollte sich aber bei den Folgevorstellungen am 14.06., 19.06., 18.07. und 26.07. noch ändern. Der Applaus der Zuschauer für diesen Opernabend hoher Qualität fiel überaus stürmisch aus, war sehr lang anhaltend und galt ausnahmslos allen Mitwirkenden.
Manfred Langer, 09.06.2014 Fotos: Björn Hickmann
Viele Särge
MACBETH
Vorstellung am 23.05.2013 (Premiere 12.04.2014)
Ein Mafioso als König Duncan und niedliche Mädchen als Hexen
Stoffe aus der italienischen Literatur hat die italienische Oper des 19. Jhdts. in aller Regel nicht verarbeitet; sei es, weil sie nicht interessant waren, sei es weil es kaum etwas gab. So basieren die meisten Opernstoffen auf literarischen Vorlagen der „cugini“ (das sind die Franzosen); aber man griff auch weiter nach Norden und wurde in Deutschland und England fündig. Dort waren es neben den romantischen Stoffen vor allem die Shakespeare-Dramen, die Interesse erweckten. MacBeth war Verdis erster realisierter Shakespeare Stoff. (Etwa 50 Jahre hat er sich mit Lear beschäftigt; seine beiden letzten Opern waren wieder Shakespeare Stoffe: Othello und Falstaff). Verdi hat sich selbst sehr intensiv mit der Vorlage befasst und dessen Komprimierung auf die Opernhandlung selbst vorgenommen, ehe er seinen Librettisten Francesco Maria Piave mit der Erstellung der gereimten Fassung beauftragte. Da er mit dieser nicht zufrieden war, zog er mit Andrea Maffei noch einen zweiten Librettisten hinzu, um die textliche Grundlage für das zu schaffen, was Verdis bis dato außergewöhnlichste Oper werden sollte. Der Stoff gab nämlich das nicht her, was bislang in Italiens Opern üblich war: die Dreierkonstellation mit einem Liebespaar (Primadonna und 1. Tenor) und einem Gegenspieler mit tiefer Stimme. (Möglicherweise hat das bei der Auswahl des Stoffs schon eine Rolle gespielt; denn beim Teatro alla Pergola in Florenz, für das Verdi diesen Stoff unter mehreren anderen ausgesucht hatte, gab es keinen geeigneten 1. Tenor für eine Liebhaber-Rolle.)

vorne: Olafur Sigurdarson (Macbeth); Melba Ramos (Lady Macbeth)
So kam es dazu, dass die Titelrolle einem tiefen Bariton übertragen wurde. Und die Lady MacBeth ist nicht im lyrischen oder Koloratursopranfach, sondern im dramatischen Fach angesiedelt. (Deren Rolle ist im Vergleich zur Shakespeare-Vorlage aufgewertet; ihr Einfluss auf das Geschehen wird wesentlich präsenter, daher ihre dramatische Wirkung.) Das zog weitere Änderungen in der Konzeption nach sich. Denn Verdi, bei seinen Gesangspartien bislang noch im Einfluss der Belcantisten stehend, wollte hier keinen Schöngesang mehr als l’art pour l’art haben, sondern im Sinne eines Gesamtkunstwerks ein Zusammenwirken von Stimme und Text mit deklamatorischer, weniger sanglicher Diktion erreichen. Diesen Weg zu einem realistischen Musiktheater ist Verdi dann zunächst nicht weiter gegangen, wies aber später darauf hin, dass er schon mit dem 1847 uraufgeführten MacBeth eine Verschmelzung von Musik und Drama angestrebt hatte, die in Deutschland der ihm immer wieder vorgehaltene Wagner schon umzusetzen begonnen hatte. Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass Verdi 40 Jahre später mit seinem Otello und danach mit seinem Falstaff ausgerechnet wieder an zwei Shakespeare-Stoffen bewies, dass ihm noch in hohem Alter diese Verschmelzung mit ganz eigenen Mitteln gelang.
Wegen seiner Wucht und seiner Bühnenwirksamkeit wurde MacBeth vom Publikum gut aufgenommen und verbreitete sich schnell in ganz Europa, während die konservative Kritik dem Werk entgegen hielt, dass es keine Liebesgeschichte enthält... Knappe zwanzig Jahre später hat Verdi den MacBeth für eine französisch-sprachige Aufführung in Paris umgearbeitet. In dieser neuen Fassung wurde den Hexen eine stringentere dramaturgische Funktion zugewiesen, der Todesmonolog des MacBeth durch den Jubelchor der Sieger „Salve, o re!“ ersetzt, und es musste ein Ballett her. Vier Jahre nach dem Tannhäuer-Skandal setzte Verdi den brav an den Beginn des dritten Akts... In dieser Fassung – rückübertragen ins Italienische – wird diese Oper heute meistens gegeben, so auch jetzt in Saarbrücken. Trotz seiner Originalität und dramatischen Schlagkraft gehört Macbeth heute nicht zu den Rennern unter Verdis 26 Opern.

Olafur Sigurdarson (Macbeth)
Der Regisseur Sebastian Welker siedelt das Geschehen der Oper im Mafia-Milieu der Vorkriegszeit an. Damit kommt er von Schottenröcken, herben Landschaften und finsteren schottischen Gemäuern von historischer Handlungszeit und -Ort weg und riskiert a priori kaum Reibungen mit dem Text. Allerdings wäre es konsequenter gewesen, das Stück dann gleich in der Jetztzeit zu verorten, weil dann die peripheren Regieeinfälle vom heutigen Publikum besser verstanden würden. Ein Mafia-Boss anstelle eines Königs, ein Obermafioso anstelle seines Generals; ein machtgetriebenes Mafioso-Gespons – das alles lässt sich passend umsetzen. Hexen und wandernde Wälder gab es damals wie heute nicht... Aber Welker versucht nicht, diese 1:1-Umsetzung in eine andere Zeit und ein anderes soziokulturelles Umfeld konsequent durchzuziehen, sondern er dreht noch an etlichen anderen Schrauben, was leider nicht im Sinne einer stringenten Dramaturgie liegt und – vor allem im zweiten Teil der Oper - zu schlechterer Verständlichkeit des Geschehens führt. Das sind einmal die Kinder, Knaben und Mädchen, die teilweise mit Symbolkraft versehen über die Bühne wuseln und Stellvertreter-Mord und –Totschlag aufführen (auf die Kinderlosigkeit des Ehepaars MacBeth soll hier wohl nicht angespielt werden), aber vor allem die Inszenierung der Hexen. De facto spielen diese Hexen die Rolle einer dritten handlungstreibenden Person. Aber Welker setzt sie nicht fokussiert in Szene, sondern lässt sie auf der Bühne erst stumm durch drei nette kleine Mädel in weißem Kleid, weißen Strümpfen und weißer Haarschleife darstellen (Kostüme: Doey Lüthi), wozu drei Sängerinnen von irgendwoher den Text singen; beim zweiten Auftreten hingegen durch den gesamthaft in besagter Mädchenkleidung gesteckten großen Frauenchor, der langsam von hinten auf die drei Mädchen zuschreitet; auf diese Weise wird die dramaturgische Rolle der Hexen zerfasert, und deren Impetus wird nicht recht klar. Besagte drei Mädchen wirken dann auch bei MacBeth‘ Erscheinungen mit und fallen dann in die Rollen des von MacBeth wegzumordenden Macduff-Nachwuchses.

Hiroshi Matsui (Banco)
Der Obermafioso MacBeth betreibt ein Beerdigungsunternehmen. Da gibt es natürlich keine Probleme, ihn seitens der Organisation mit Geschäft zu versorgen. So spielt die erste Szene vor einem ausgehobenen Grab mit einem großen Sarg auf freier Fläche. Zur zweiten Szene senkt sich darüber ein aufwändiger und liebevoll im Detail gestalteter klassizistischer Saal mit moderner Möblierung (Bühnenbild: Friedrich Eggert). Das ist das Heim der Macbeths, hier werden der „König“, der in Weiß gekleidete Mafia-Boss empfangen, die Body-Guards betrunken gemacht und der Boss in einem Nebenraum abgemurkst. Durch eine breite Schiebetür gelangt man auf ein Podest weiter hinten, auf welchem der Bankett-Tisch errichtet wird, auf dem aber zuletzt die prachtvollen Särge des Gastgeber-Ehepaars aufgestellt sind. --- Die Personenführung bleibt sehr zurückhaltend. Die Sänger werden sich freuen, dass sie sich auf ihren Gesang konzentrieren können; aber dafür ist meistens etwas mehr Bewegung in die gleichzeitig anwesenden Nebenfiguren gebracht. Das erscheint immerhin darstellerisch und musikalisch vorteilhafter als das Gegenteil, wenn sich die Sänger in Verrenkungen abmühen müssen und das Nebenpersonal stocksteif in den Ecken herumsteht. Zu wenig ist dem Regisseur allerdings bei der Bewegung der Chöre eingefallen. Wenn die nicht ohnehin aus dem Verborgenen singen, dann nehmen sie auf der Bühne „Aufstellung“, motorische Dramatik wird nicht erzeugt. Dennoch ist die Inszenierung gesamthaft betrachtet durchaus interessant, originell und vor allem bühnenwirksam.

Statisterie (Hexen)
Das Saarländische Staatsorchester stand unter der Leitung von Gastdirigent Christopher Ward und verlieh der nicht eben sehr raffinierten, sondern teilweise etwas holzschnittartigen Partitur einen erfrischenden Verdi-Klang. Ward bevorzugte flotte Tempi, setzte die dramatischen Tutti sehr prägnant von den reflektierenden Passagen ab und verlieh den Soli der die Holzbläser schönes Profil. Stimmgewaltig und klangschön präsentierten sich Chor und Extrachor des Staatstheaters, von Jaume Miranda einstudiert. Die Damen des Hexenchores entwickelten allerdings bei ihrem Auftritt von ganz hinten eine gewisse Eigengesetzlichkeit. Der staccato-Chor der Banco-Mörder erklang aus dem Untergrund und konnte so naturgemäß nicht sehr präsent klingen; aber schließlich konnte man ihn nicht durch den Salon der Macbeths ziehen lassen, wo sich Bancos Sohn versteckt hatte.

Melba Ramos (Lady Macbeth); Olafur Sigurdarson (MacBeth); Opernchor des Saarl. Staatstheaters
Die beiden Hauptrollen der Oper waren prächtig besetzt. Als Gast von der Wiener Volksoper sang Melba Ramos die Lady Macbeth. Sie verfügt über einen kräftigen, aber samtig ansprechenden, satten Sopran mit einer mezzo-artigen Eindunkelung. Sie ist die eigentlich treibende Kraft im Stück, kaltblütig wie sie ihre blutigen Hände im Sektkübel zu waschen versucht, emotional und leidenschaftlich im Gesang mit leuchtenden Höhen ohne jede Schärfe bei den immer sicheren Spitzentönen. Mit Olafur Sigurdarson stand ihr ein Macbeth zur Seite, der mit seinem gewaltigen Bariton nicht weniger überzeugte, den Krafteinsatz nie scheute, aber seine nachdenklichen und zweifelnden Passagen dennoch mit Ausdruckskraft gestaltete. Als Banco war mit Hiroshi Matsui ein voll strömender Bass besetzt. Als Macduff gefiel Jevgenij Taruntsov mit geschmeidigem bronzenem Tenor, der sich gut von János Ocsovais hellem Tenor in der Rolle des Malcolm abhob. In den Nebenrollen Herdís Anna Jónasdóttir als Gesellschaftsdame der Lady, Fjölnir Òlafsson als 1. Erscheinung und Arzt sowie Diener, Mörder und Bote. Die stumme Rolle des Mafia-Bosses Duncan spielte Gaetano Franzese, dem auch die Abendspielleitung anvertraut war. Das Terzett der Hexen wurde zuerst aus dem Untergrund gesungen, während die Mädchen AntoniaDi Rosa, Feliciana Solander und Mira Yazici dazu auf der Bühne Seilchenspringen übten.
Aus dem fast vollbesetzten Hause in Saarbrücken bedankte sich das Publikum mit lang anhaltendem Beifall für den gelungenen Opernabend, der noch am 12.06. , 22.06., 27.06., 06.07., 12.07. und am 20.07.2014 zu sehen sein wird.
Manfred Langer, 24.05.2014
Fotos: stage picture GmbH, Thomas M. Jauk
Auf das Wesentliche reduziert
WERTHER
Besuchte Vorstellung: 11.05.2014 (Premiere am 22.02.2014)
Schonungslos aufgedeckte Charaktere auf fast leerer Bühne
Werther ist Massenets beliebteste Oper; nach der Fertigstellung blieb sie fünf Jahre lang liegen, da in Paris gerade das zuständige Opernhaus abgebrannt war. Aber Massenet und seine Freunde erinnerten sich an die freundliche Aufnahme seiner Manon in Wien und brachten Werther dort 1892 in deutscher Sprache zur Uraufführung. Inspiriert wurde Massenet zu dieser Oper, die er für seine beste hielt, auf der Rückfahrt von den Bayreuther Festspielen bei einem Besuch in Wetzlar, dem Ort der Handlung. Allein diese Tatsache sagt über den kulturhistorischen Stellenwert des Werks viel aus. Die Oper Werther, die sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut, hat man in vielen opulenten Bebilderungen gesehen. Darauf verzichtet die nun vorgelegte Inszenierung am Saarländischen Staatstheater und fokussiert sie auf das Innenleben der drei Hauptfiguren.

Werther II und Werther I (Mickael Spadaccini) bei Familienidylle
120 Jahre liegen zwischen Goethes Dichtung und Massenets Komposition, weitere 120 Jahre verstrichen bis zur Jetztzeit. Die niederländische Regisseurin Jetske Mijnssen verzeitet die Oper in die Mitte, also die Entstehungszeit der Musik, was sich vor allem an den sehr genauen kalten, prüden Kostümen des Ausstatters Ben Baur sowie an der spärlichen Möblierung seines kahlen Bühnenraums festmachen lässt, in welchem die ersten drei Akte ablaufen. Von einem Hof am Hause des Amtmanns oder einem Platz vor der Kirche oder gar Bierschwaden in einem Wetzlarer Biergarten ist nicht die Rede, sondern das Geschehen um die drei Hauptpersonen ist in den bedrückend und trostlos schmucklosen Innenraum verlegt. Überflüssige Verzierungen haben Dramaturgie und Regie auch aus dem zweiten Akt gestrichen: Brühlmann und Käthchen kommen nicht vor. Zwischen den kahlen Wänden, die gegen Ende auch noch eingeengt werden, wird das Unentrinnbare in den Beziehungen der Dreierkonstellation verdeutlicht: keiner kann aus seiner Haut. Das Ergebnis dieses Unentrinnbaren wird vorab in einem kurzen Bild vor der Ouvertüre gezeigt: da steht Werther im Schneefall unter zwei großen Friedhofsglocken neben einem ausgehobenen Grab.

Hiroshi Matsui (Amtmann); Vadim Volkov (Johann); Sophie; János Ocsovai (Schmidt); Kinder
Mit diesem Bild wird eine zweite Verklammerung zwischen Anfang und Ende des Stücks geschaffen. Die erste ist im Werk selbst angelegt. Das einzig Komische am Geschehen ist die Tatsache, dass der Amtmann mitten im Sommer zu Beginn des ersten Akts Weihnachtslieder übt. Dass genau diese Lieder am Ende hinter Werthers Sterbeszene, die gleichzeitig die letzte Liebesszene zwischen ihm und Charlotte ist, aus dem Bühnenhintergrund wiedererklingen, gemahnt an das halbe verflossene Jahr immer problematischer werdender Beziehungen, bei denen auch der sonst so korrekte und biedere Albert durch das kalte Aushändigen der Pistolen mithilft, die Handlung zur letzten Konsequenz zu treiben. Um die Hauptcharaktere der Oper im ausgehenden 19. Jhdt. noch intensiver beleuchten zu können, doppelt die Regisseurin Charlotte und Werther mit Schauspielern. Das ist zwar heutzutage eine fast zu viel benutzte Regiezutat, um Personen in der Innen- und Außensicht, als alter ego oder in der Vor- und Rückschau zu zeigen, aber hier wird sie dazu benutzt, um die doppelten gesellschaftlichen Funktionen des Paars zu zeichnen. Daher braucht auch Albert nicht gedoppelt zu werden; denn er ist einfach nur er, der sich aufgrund der Vorgeschichte eine attraktive Frau an seine Seite stellen konnte, mit der er aber außer Repräsentation kaum etwas anzufangen weiß; vielmehr führt er mit Charlotte ein sprach- und gefühlloses Leben, merkt aber immerhin, dass sein Frau nicht glücklich ist.

Charlotte I, Charlotte II; James Bobby (Albert)
Ganz anders die beiden Facetten in Charlottes Leben: schwärmerische Liebe, auch sexuelle Sehnsucht nach dem attraktiven Werther einerseits, klaglose Pflichterfüllung andererseits. Das kann mit zwei gleichzeitig auf der Bühne vorhandenen Personen besser verdeutlicht werden, wobei die eine das ausdrückt (singt), was gerade im Libretto vorgeschrieben ist, und die andere stumm die andere Seite ausdrückt. Bei Werther ist das ähnlich, wenn auch nicht so ausgeprägt. Seine Rolle des braven Hausfreunds ist nicht in dem Maße im Libretto angelegt wie seine exaltierte schwärmerische und zum Schluss tödliche Liebe zu Charlotte. Da es auf der Bühne an Requisiten kaum mehr zu sehen gibt als einen Esstisch, einen Teetisch und einen Spiegel, wird des Zuschauers Aufmerksamkeit unausweichlich auf das Beziehungsdreieck konzentriert, das die Regie meisterhaft verdeutlicht. Die „Position“ Amtmann ist noch mehr marginalisiert als sonst. Zur „Auflockerung“ der streng wirkenden Inszenierung hat die Regie Schmidt und Johann als dunkel und diabolisch wirkende Clownsfiguren ausstaffieren lassen. Die Tatsache, dass diese beiden (anstelle des Amtmanns) die kurzen Worte am Ende des ersten Akts singen: „Charlotte, Albert est de retour!“ (Lotte, Lotte, Albert ist zurück) verleiht diesen beiden eigenartigen Figuren das Wort beim ersten bedeutenden Handlungsumschwung der Oper und wertet somit ihre sonst eher komischen Rollen im Sinne des düsteren Stücks auf. Werther stirbt am Schluss der Oper neben seinem offenen Grab stehend; Statisten tragen vom Amtmann und Albert angeführt den Sarg herbei; Charlotte bleibt in dieser Schlussszene von Werther weit entfernt.

Charlotte; James Bobby (Albert); Sophie
Die Werther-Partitur ist melodisch und harmonisch ein Meisterstück der damaligen Epoche, von dem sich auch Puccini reichlich beeinflussen lassen hat. Und etwas in diesem Sinne interpretierte sie Ulrich Cornelius Maier, Solorepetitor am Staatstheater, der an diesem Abend das Zweitdirigat innehatte, aber zuvor schon für die musikalische Einstudierung verantwortlich gezeichnet hatte. Das tadellos aufspielende Saarländische Staatsorchester spielte die farbenprächtige Musik wie aus einem Guss; die Dynamik wurde weit ausdifferenziert, wobei die Sänger nicht zugedeckt wurden. Von fein gewobener Transparenz bis zur hochfahrenden schwärmerischen Emotion wurde das Dirigat den vielen Facetten der Partitur gerecht.

Charlotte
Zwar musste das Staatstheater die Erkrankung und Verhinderung beider Sängerinnen der Charlotte verkünden. Aber Glück im Unglück: vom nicht weit entfernten Nationaltheater in Mannheim konnte kurzfristig Anne-Theresa Møller als Gast einspringen, die diese Rolle in der dortigen Produktion singt. Wenn man einmal von ihrer fast vollständigen Textunverständlichkeit absieht (man könnte den Werther ja auch auf Italienisch bringen, und dann wären alle diesbezüglichen Probleme weitestgehend beseitigt – die Gesangslinien sind voller Italianità und nicht streng auf die französische Prosodie gesetzt), hat sie stimmlich und darstellerisch die Rolle bestens ausgestaltet. Von nobler Bühnenerscheinung (bestens stand ihr das ganz hochgeschlossene schwarze Kleid) begeisterte sie über den ganzen Stimmumfang ihres warmen, farbenreichen Soprans. Mickael Spadaccini als Werther war ihr ein ebenbürtiger Partner, der naturgemäß mit der Aussprache des Französischen gar keine Probleme hatte. Er brachte eine enorme tenorale Leuchtkraft auf die Bühne und wirkte unbedingt glaubwürdig in der Rolle des unglücklichen Liebhabers. Das Staatstheater kann sich ob dieses italienischen Tenors glücklich preisen. Wenn er die zuweilen auftretenden leichten Eintrübungen beim Forcieren noch beseitigen könnte, würden sich auch größere Häuser um ihn reißen. Die erdverbundene Rolle des Albert sang James Bobby mit kraftvollem kultiviertem und gut verständlichem Bariton; die ungerührte Kälte dieses Charakters brachte er gut rüber. Mit Hiroshi Matsuis mächtigem Bass war auch der Amtmann gut besetzt, und Elizabeth Wiles‘ sauber geführter, silbriger Sopran passte gut zu der Mädchenrolle der Sophie, die in dieser Inszenierung ein bisschen reifer ausgestattet war. Wie die Orgelpfeifen rührend abgestimmt waren die sechs Kinder als kleiner Kinderchor der Geschwister und sangen ihn klar und frisch: Amélie Clemens, Lilli Eck, Hannah Schnepp, Liliane Kriewald Aaron Zachow und Wendelin Clemens. Der Tenor János Ocsovai im hohen Charakterfach als Schmidt und Vadim Volkov vom Opernchor als Johann rundeten das Ensemble ab.
Der Abend war schlecht besucht; verloren hatten auf jeden Fall alle die, die „vielleicht“ hätten kommen wollen, aber zu Hause geblieben sind. Der Saal spendete nach Ende der Vorstellung allen Beteiligten sehr herzlichen Beifall. Weitere Aufführungen dieser unbedingt sehens- und hörenswerten Produktion nur noch am Sa 17.05. Sa 31.05.2014
Manfred Langer, 13.05.2014
Fotos: stage picture GmbH, Björn Hickmann (Die Fotos zeigen Charlotte und Sophie jeweils in der abweichenden Premierenbesetzung)
Emotion und Aggression
TOSCA
B-Premiere am 04.12.13 (A-Premiere am 24.11.13)
Glanzvolle Wiedereröffnung des Staatstheaters mit viel Bühnentechnik
Das Saarländische Staatstheater feiert 75-jähriges Jubiläum. Man erinnere sich: „Heim ins Reich“ war eine der Parolen anlässlich der Volksabstimmung 1935 im Saargebiet über dessen Zukunft. Der Ausgang der Abstimmung ist bekannt: 90% der Saarländer stimmten für „Heim ins Reich“. Um ein Zeichen germanischer Kultur gen Westen zu senden, wurde sogleich ein neues Theater erbaut, das 1938 fertig gestellt wurde. Bereits 1942 wurde es in einem Luftangriff zerstört – in dem vom „Reich“ entfesselten Krieg. Eine Foto-Ausstellung im Foyer dokumentiert die erste, nur vierjährige Lebenszeit des Theatergebäudes. So wird die Neuinszenierung der Tosca, in der Gewaltherrschaft und Unterdrückung thematisiert werden, am Saarländischen Staatstheater zugleich zu einem Mahnruf.

Viktoria Yastrebova (Tosca), Mickael Spadaccini (Cavaradosis)
Vor dem 75-jährigen Jubiläum war das Theater indes einige Monate geschlossen, da die Landesregierung in anderen Ländern wäre das eine Kreisverwaltung) als Geburtstagsgeschenk eine neue Bühnentechnik „spendiert“ hatte. 15 Mio.Euro durften ausgegeben werden, und der Kostenrahmen wurde sogar eingehalten! Zwischenzeitlich wurde im Opernzelt gespielt. Mit der Tosca-Premiere am 24.11.13 wurde zugleich der feierliche Wiedereinzug ins Staatstheater gefeiert. Aber wegen des Ausfalls einer sicherheitsrelevanten Komponente dieser Bühnentechnik musste die zweite Vorstellung "Tosca" am 30.11.13 leider ganz kurzfristig abgesagt werden. Besucher konnten ihre Karten eintauschen – zum Beispiel für die hier besprochene Vorstellung am 04.12.13, die somit zur B-Premiere avancierte.

Viktoria Yastrebova Tosca
Tosca ist wohl die Oper, die geschichtlich an genauesten verortet ist und in der gar ein historisch präzises Ereignis eine wesentliche dramaturgische Bedeutung spielt: die Schlacht von Marengo am 14. Juni 1800. Auch die Spielorte der drei Akte sind historisch verbürgt und können noch heute in Rom besichtigt werden. Diese Spielorte (Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese, Castello Sant’Angelo) werden in der Inszenierung auch zitiert. Aber die Handlung wird dennoch in eine zeitlose Gegenwart verlegt, denn Gewaltherrschaft und Unterdrückung sind leider bis heute nicht abgeschafft. Erst wenn das allenthalben erreicht werden sollte, wird der Tosca-Stoff museal. Der Handlungsablauf der Oper ist vom mittäglichen oder abendlichen Angelus-Gebet bis zum nächsten Morgen um vier Uhr in drei quasi in Echtzeit ablaufenden Akten extrem gedrängt: von einem eher heiteren Eröffnungstableau bis zur totalen Katastrophe. Die drei Hauptpersonenmachen in dieser kurzen Zeit fatale Entwicklungen durch: der liberale, lebenslustige Maler Cavaradossi gerät in eine Geschichte, die zu seiner Exekution führt; Scarpia lässt in seiner Begehrlichkeit die Vorsicht außer Acht und wird erstochen. Am schlimmsten trifft es Tosca: Liebe, Eifersucht, Verrat, drohende Vergewaltigung, Mord, Selbstmord in kaum mehr als einem halben Tag.

Olafur Sigurdarson (Scarpia), Viktoria Yastrebova (Tosca)
Auf diesen Absturz der Tosca bezieht sich die Regisseurin Dagmar Schlingmann, Intendantin des Saarländischen Staatstheaters, mit dem Gedanken einer im Bildhaften bestehenden Rahmenhandlung. Zu den wenigen Schlägen der Ouvertüre und jeweils den einleitenden Takten der drei Akte wird auf den Schleiervorhang vor der Bühne das Bild einer im taumelnden Fall befindlichen, prächtig gekleideten Frau projiziert (Video: Heiko Kalmbach) Tosca fällt von der Engelsburg; in Sekunden erlebt sie Nahtod-ähnlich das abgelaufene Geschehen: Die Tosca-Geschichte aus der Rückschau. Neugierige Gaffe strömen herbei. Die gibt es dann auch auf der reellen Bühne im dritten Akt, als die Leute sensationsgeil auf Cavaradossis Exekution warten und dabei auch die Schnapsflasche nicht vergessen haben. Dramaturgisch fällt diese Szene deutlich hinter die Stringenz des Gesamtwerks zurück: wo kommen diese Leute oben auf der Engelsburg denn her? Haben die Eintritt bezahlt? Vor der Exekution werden sie weggescheucht; wohin? Das in Auftrag und Interesse des Staates handelnde Personal kommt jeweils ganz brav die Treppe herauf.

Mickael Spadaccini (Cavaradossi)
Ansonsten inszeniert Frau Schlingmann die Oper überwiegend sehr nahe am Libretto und dessen sehr detaillierten Szenenanweisungen und geht mit der Bebilderung kein weiteres Risiko ein. Sabine Mader hat das Bühnenbild gebaut. Für den ersten Akt sehr originell ein Kirchenraum auf dem großen Drehteller mit Altar Kerzentisch und locker verteilten Kirchenstühlen. Durch Drehen erscheint hinter dem Altar Cavaradossis Gemälde der Magdalena überlebensgroß mit einem dreigeschossigen Gerüst davor; für zusätzliche Abwechslung sorgt, dass die Drehbühne angehoben und abgesenkt werden kann. Die Kapelle wird mit ihren schmiedeeisernen Gittern dargestellt, daneben die notorische Muttergottesstatue. Im zweiten Akt gibt es Scarpias Saal im Palazzo Farnese; bühnengroß und bühnenhoch mit Renaissance-Gemälden. Hinter einem Schleiervorhang hinten auf der Bühne kann durch Beleuchtungseffekte (Nicol Hungsberg) der Chor sichtbar gemacht werden, der die Kantate anstimmt. Musikalisch führt das zu einer wesentlichen dramatischen Schärfung der Szene, da der Chorgesang mit Toscas Stimme nun viel präsenter ist, als wenn er gedämpft durch eine Tür aus dem Off kommt. Tosca sticht nicht nur einmal zu und beschließt den vor Emotion und Gewalt knisternden Akt, ohne Scarpia das Kruzifix auf die Brust zu legen oder den Kerzenständer neben ihn zu stellen. Die Seitenwände des Palazzo krachen herunter. Der letzte Akt spielt vor der schwarz bedrohlichen Kulisse des Petersdoms auf einer kargen Spielfläche, zu der eine nüchterne Treppe hinaufführt. Dass das Erschießungskommando nicht in historischen Uniformen antritt, versteht sich, mafiöse Gestalten agieren mit Pistolen. Inge Medert hat die Akteure in modern-zeitlose Kostüme gesteckt; lediglich Scarpia und Spoletta sind angesichts ihrer reaktionären Gesinnung mit einer goldenen gestickten Weste ausgestattet worden; Scarpia dazu mit einem Gehrock über Stiefeln, die den Gewaltmenschen charakterisieren. – Die Bewegung des Bühnenpersonals ist stets gut durchdacht, teilweise auch spannungsgeladen, obwohl das eine oder andere in der Realisierung noch etwas unbeholfen ist. Zur quasi-Perfektion hätten wohl noch ein paar Proben gehört. Insgesamt hinterlässt die Inszenierung einen guten geschlossenen Eindruck.

Mickael Spadaccini (Cavaradossi)
Sie wurde in der Qualität der musikalischen Realisierung noch deutlich übertroffen. Das Saarländische Staatsorchester musizierte unter der Leitung von Will Humburg eine dramatische, spannungs- und emotionsgeladene Tosca-Partitur mit ihrer über die ganze Spannbreite der Facetten immer typischen tinta. Vom feinen, ans süßlich grenzenden Violinenschmelz bis zu den Gewalttaten der großen Trommel, von den energetisch aufgeladenen unisono-Formeln der tiefen Streicher zum Angriff der Posaunen mit zwei Bass-Instrumenten oder den Farbgebungen der makellos intonierenden Hörner und der Holzbläser, bei denen auch jeweils die tiefen Instrumente (Bassklarinette und Kontrafagott) ihre Wirkung nicht verfehlten. Alles kam mit großer Präzision und bester Plastizität, ob zart-filigrane kammermusikalische Passagen oder die Ausbrüche der tutti, bei denen Humburg den Sängern viel abverlangte. Der zweite Akt mit vielen dramatischen Schärfungen, mit dem Chorgesang quasi auf offener Bühne, mit Energiefreisetzungen in der Musik wie in dem teilweise gewalttätig ausgetragenen Konflikt Tosca-Scarpia stellte musikalisch wie dramatisch den Höhepunkt dar. Klangschön und präzise dazu der Opernchor des Staatsorchesters; quirlige-lebendig der Auftritt des Kinderchors (jeweils eine dankbare Aufgabe für die Regie) (Choreinstudierung: Jaume Miranda).

Dazu konnte das Staatstheater mit einer prächtigen Besetzungsliste aufwarten. Olafur Sigurdarson vom Ensemble des Theaters, der prominente Bassbariton-Partien schon in ganz Europa gesungen hat, verlieh mit untersetzter Gestalt dem Macht- und Gewaltmenschen Scarpia Profil. Sein kultiviertes stimmliches Material schien zuerst fast zu nobel für den Schurken, aber im zweiten Akt trat zu seinem szenisch-emotional geschärften Auftreten auch zunehmend die stimmliche Gewalt und Schwärze hinzu. Diesem Potential war Victoria Yastrebova als Gast vom Mariinsky Theater szenisch nicht gewachsen und musste zwangsläufig zum Messer greifen (in dieser Inszenierung ein etwas klägliches Instrument). Frau Yastrebova, von überwältigender Bühnenerscheinung, gab eine szenisch völlig überzeugende Floria Tosca von der romantisch Liebenden, zur Eifersüchtigen und ohnmächtig Verzweifelnden in der Auseinandersetzung mit Scarpia. Ihr betörend eingedunkelter jugendlich-dramatischer Sopran hat eine schöne Leuchtkraft, allerdings – wahrscheinlich muttersprachlich bedingt – von etwas monochromer Farbgebung. Wie eine kurze Ruhe im dramatischen Sturm des zweiten Akts wirkte ihr „vissi d’arte“, das sie mit inniger Hingabe gestaltete. Auf auftrumpfende Durchschlagskraft verzichtete sie ohnehin. Dafür stand vielmehr Mickael Spadaccini, seit dieser Spielzeit fest im Ensemble, der sich als Cavaradossi mit kraftvollem, bronzenen Tenormaterial bestens in Szene setzte. Ganz bewusst powerte er mit seinem „Vittoria“ im zweiten Akt. Sein Portamento und die zart angedeuteten Schluchzer verliehen seinem Gesang auch noch den richtigen Schuss Italianità. Glückwünsche ans Staatstheater zu diesem Tenor! Mit Hiroshi Matsuis mächtigem Bass war die Rolle des Angelotti besetzt; Markus Jaursch mit hellem Bariton verlieh dem Mesner jugendliche Gestalt. Algirdas Drevinskas sang die kurzen Passagen des Spoletto mit gut geerdetem Tenor.
Aus dem nur mäßig gut besuchten Haus erhielten die Mitwirkenden lang anhaltenden, herzlichen Beifall mit Bravi für Mickael Spadaccini und den Dirigenten – hier natürlich auch stellvertretend für das famose Orchester. Vom 06.12.13 bis 26.03.14 noch vierzehn Mal: TheaterSaarbrücken.
Manfred Langer, 05.12.13 Fotos: Thomas M. Mauk
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN
besuchte Vorstellung: 30. Oktober 2013 (Premiere: 22. September 2013)
Da die Bühnentechnik im großen Haus des Saarländischen Staatstheaters erneuert wird, spielt das Ensemble noch bis Mitte November im Theaterzelt vor dem großen Haus. Als Oper steht Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ auf dem Spielplan und Regisseur Immo Karaman nutzt das besondere Ambiente des Raumes, um das Stück an Vaudeville und Varieté anzunähern.

Bereits zum eröffnenden Chor der Weingeister lässt Choreograph Fabian Posca diese im Varietéstill über die Vorbühne hüpfen, was für eine Opernaufführung anfangs etwas unbeholfen und unfreiwillig komisch wirkt, sich dann aber im Laufe des Abends logisch in das Konzept fügt. Jedoch muss man sich fragen, was hier gut sechs Wochen nach Premiere noch von Originalregie übrig ist, denn auf dem Programmzettel wird der Abend als Inszenierung und Choreografie nach Immo Karaman und nach Fabian Posca angekündigt.
Judith Braun als Muse ist ein Varieté-Mädchen und führt durch das Stück, wobei das Regieteam seine ganz eigene und fantasievolle Sicht auf „Hoffmanns Erzählungen“ präsentiert. Da die Aufführungen aus Lärmschutzgründen spätestens um 22 Uhr beendet sein muss, sind Prolog und Epilog sehr stark gekürzt. Am Beginn gibt es den Chor der Weingeister, eine kurze Einführung der Muse und dann geht auch schon der Vorhang auf und wir befinden uns in der heruntergekommenen Wohnküche des Dichters Hoffmann.

Der Autor döst gerade an seiner Schreibmaschine, während daneben seine von ihm ermordete Frau sitzt, die schnell im Kühlschrank entsorgt wird. Doch Hoffmann scheint die Beziehung zu der Getöteten aufarbeiten und literarisch verarbeiten zu müssen und erinnert sich schreibend an die Tote. Karaman und Posca teilen Olympia und Antonia in eine spielende und eine singende Frau auf, was den Eindruck, dass Hoffmann sich seine Frau nur erinnert oder diese herbeifantasiert, verstärkt.
Auf der Bühne verkörpert die spielfreudige und quirlige Jennifer Mai Hoffmanns Frau, während Yitian Luan immer aus einer Öffnung in der Vorderbühne auftaucht, wenn es etwas zu singen gibt. Ihr Sopran ist nicht allzu groß, aber leicht und beweglich. In den Olympia-Koloraturen springt ihre Stimme gut an und die Antonia singt sie mit weichen Lyrismen. Mickael Spadaccini singt den Hoffmann zuverlässig, wirkt aber auch etwas blass. Darstellerisch kann er in dieser verrückt- fantasievollen Inszenierung stärker überzeugen als sängerisch.

Was sich Karaman und Posca hier alles haben einfallen lassen, ist kaum zu beschreiben: Im Antonia-Akt verwandelt sich der besorgte Vater Crespel plötzlich in die Muse, welche die Partie singt, die eigentlich für Antonias Mutter vorgesehen ist. Hoffmanns Frau darf sich als schwebende Jungfrau vom Tisch erheben und im Giulietta-Akt, in dem Yitian Luan ihre Rolle auch spielt, erleben wir die Hauptfiguren verdreifacht. Die Ebenen des Varietés, die Geschichte um den mordenden Literaten Hoffmann sowie viele surreale Elemente durchmischen sich hier. Der Zuschauer bekommt eine Menge geboten, ist aber gefordert, diese Aufführung zu enträtseln.
Führt die Muse hier nur durch das Stück oder kämpft sie um Hoffmann? Sind Hoffmanns Erzählungen eine Aufarbeitung der Realität? Welche Rolle spielen die Bösewichter, die von James Bobby mit markantem Bariton und sehr einschmeichelnd gesungen werden. Ist diese Figur nur eine Fantasie Hoffmanns, ein Kommissar, der ihm auf der Spur ist oder ein Literaturagent, der ihn bei seinem mörderischen Treiben unterstützt? Trotz der vielen Nüsse, die es zu knacken gilt, macht die Aufführung eine Menge Spaß.

Dafür sorgt auch Gast-Dirigent Gregor Bühl am Pult des Saarländischen Staatsorchesters. Ihm gelingt das Kunststück zwischen dem Orchester, das in großer Besetzung direkt vor der Bühne sitzt, und den Sängern, die nicht immer über die größten Stimmen verfügen, eine gute Balance herzustellen. Wo nötig setzt er auf Dramatik und Emotionen der Musik, aber ebenso wie die Regie weiß er um die heiteren und tänzerischen Seiten von Offenbachs Partitur.
Rudolf Hermes Bilder: Thomas M. Jauk
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich ohne Bilder weiter unten auf der Seite Saarbrücken des Archivs