


http://www.landestheater-linz.at/
The Wave (Die Welle)
Uraufführung digital: 20.03.2021

Nachdem auch am Landestheater Linz seit einigen Monaten die Türen für Besucher verschlossen bleiben müssen, hat man hier nun die Netzbühne ins Leben gerufen, bei der ausgewählte Vorstellungen online zu sehen sind. Den Anfang machte hierbei das Tanzensemble und das Junge Theater. Am gestrigen Samstag, den 20.03.2021 fand auf dieser Plattform allerdings auch die digitale Uraufführung des Musicals „The Wave“ statt, die eigentlich vor einigen Monaten hätte im Theater stattfinden sollen. Das Musical basiert auf dem Experiment des Geschichtslehrers Ron Jones von 1967 an einer amerikanischen Highschool, welches vor allem durch den Roman von Morton Rhue berühmt geworden ist. Hierzulande ist sicherlich die Verfilmung „Die Welle“ u. a. mit Jürgen Vogel aus dem Jahr 2008 bekannt. Insgesamt zweieinhalb Millionen Zuschauer locke dieser Film seinerzeit ins Kino. Ende 2019 erschien basierend auf dieser Geschichte auch die Netflix-Serie „Wir sind die Welle“. Das Musical stammt aus der Feder von Or Matias und wurde 2019 an der Johnny Mercer Writers Colony bei Goodspeed Musicals entwickelt.

Für alle, die mit der Handlung nicht vertraut sind, nachfolgend die kurze und sehr gelungene Inhaltsangabe des Landestheater Linz: „Der Geschichtslehrer Ron Jones stößt in seiner Klasse beim Thema Nationalsozialismus auf Unverständnis. Die Jugendlichen können nicht verstehen, wie sich das faschistische Regime etablieren konnte und warum so viele Deutsche angeblich nichts vom Holocaust wussten. Er entschließt sich, ein Experiment durchzuführen. Er gründet „The Wave“, eine Organisation, in der die Schüler verschiedene Rollen übernehmen und sich strengen Verhaltensnormen unterwerfen. Die drei Prinzipien „Macht durch Disziplin“, „Macht durch Gemeinschaft“ und „Macht durch Handeln“ setzt er Schritt für Schritt um. Als die Dinge außer Kontrolle geraten und die eingeübten Strukturen immer totalitärere Züge aufweisen, will der Lehrer das Experiment abbrechen – doch die Mitglieder von „The Wave“ stellen sich ihm entgegen.“ Die gelungene Inszenierung von Christoph Drewitz konzentriert sich hierbei gekonnt auf den Lehrer Ron sowie die fünf Schüler Ella, Robert, Jess, James und Stevie. Während Jess und Stevie aus einem familiär durchaus prekären Umfeld stammen und diverse Probleme mit sich herumtragen, stammt James aus einem wohlhabenderen Elternhaus. Allerdings scheint es auch hier um die nicht materielle Zuwendung der Eltern nicht zum Besten bestellt zu sein. Zudem liebt James seine Mitschülerin Ella, die zu den besten Schülerinnen der Schule zählt. Und dann ist da noch Robert, der von allen nur gehänselt wird und der sich durch die Welle erstmals nicht komplett ausgestoßen vorkommt und hierdurch ein gefährliches Potential entwickelt. Verkörpert wird diese Rolle von Lukas Sandmann der diesen Charakter exzellent auf die Bühne bring. Auch die weiteren Darsteller wissen zu gefallen, Hanna Kastner spielt Ella, Celina dos Santos übernimmt die Rolle der Jess, James wird dargestellt von Samuel Bertz und Malcolm Henry verkörpert Stevie. In der Rolle des Lehrers Ron weiß Christian Fröhlich zu überzeugen. Abgerundet wird die Besetzung durch weitere 6 Ensemble-Darsteller, die weitere Schüler spielen und bei einigen Chorstücken und beim Bühnenumbau unterstützend eingreifen.

Aufgezeichnet wurde für diese Netzpremiere die Generalprobe Ende letzten Jahres, die in überraschend guter Qualität daherkommt. Durch die kammerspielartige Inszenierung, meist innerhalb des Klassenraums, eignet sich das Stück durchaus für eine Übertragung als Stream. Die drehbare Bühnenkonstruktion, mit einigen Schiebewänden stammt dabei von Veronika Tupy. Das Kostümbild von Anett Jäger besteht passend aus der zu erwartenden Alltagskleidung der Schüler, gefallen kann hier vor allem die spätere Uniform der Bewegung, die bis in die Socken abgestimmt ist. Musikalisch erinnert „The Wave“ etwas an das Musical „Frühlingserwachen“, was allerdings auch durch ein ähnliches Setting beeinflusst sein kann. Allgemein untermalt die Musik von Or Matias eher die Handlung, anstatt mit großen Ohrwürmern aufzuwarten, was allerdings in dem Fall alles andere als schlimm ist. Unter der musikalischen Leitung von Juheon Han klingt die Band auch am heimischen Fernseher sehr gut. Zu sehen ist das Musical noch bis zum 17. April 2021 über die Netzbühne, Tickets können hierbei zu Preisen zwischen 0 Euro und 120 Euro erworben werden, den gewünschten Preis bestimmt man bei der Bestellung des Zugangscodes nach eigenen Wünschen. Das Video kann dann am gewählten Tag sowie am Folgetag angesehen werden. In einer Zeit, in der man als Theatergänger sehnlichst auf die Wiedereröffnung der Theatersäle wartet, ist diese Inszenierung auf jeden Fall eine gelungene Bereicherung des digitalen Angebots, welche insbesondere allen Freunden des Musicals wärmstens empfohlen werden kann.
Markus Lamers, 21.03.2021
Fotos: © Reinhard Winkler
CINDERELLA
Premiere am 29.2.2020

Sergej Sergejewitsch Prokofjew begann die Arbeit an seinem opus 87 im Sommer 1940, zusammen mit dem Librettisten Nikolai Wolkow, auf Basis der Pubertäts- und Emanzipationsgeschichte aus der Sammlung von Charles Perrault, im deutschen Sprachraum als „Aschenputtel“ von den Gebrüdern Grimm populär gemacht. Der russische Titel ist Золушка (Soluschka). Vorgesehen war eine Uraufführung am Leningrader Kirow-Theater, was aber durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion und die jahrelange Belagerung der Stadt an der Ostsee verhindert wurde. Schließlich ging das Ballett am 21. November 1945 am Moskauer Bolschoi-Theater erstmals über die Bühne; die Choreographie stammte von Rostislaw Sacharow, es dirigierte Juri Fajer. Im Gegensatz zu Prokofjews heute populäreren „Romeo und Julia“ gab es keine musikalisch-rhythmischen Differenzen mit der Ballettcompagnie und von Anfang an uneingeschränkten Erfolg. Zudem ließ sich die Cendrillon-Geschichte auch gut mit der Staatsideologie vereinbaren.

Kann modernes Tanztheater die Zielsetzung des Komponisten erfüllen? „Das, was ich vor allem in Musik setzen wollte, ist die romantische Liebe Aschenbrödels und des Prinzen in der Tradition des alten klassischen Balletts, mit Pas de deux, Gavotte, Walzern, Bourrée, Mazurka und Galopp.“ Nun, Mei Hong Lin hat mit ihrer Inszenierung und Choreografie zwar an der Geschichte einiges herumgeschraubt, aber nicht darauf vergessen, daß es sich auch um ein Märchen handelt (Dramaturgie: Thorsten Teubl). Nur ist dieses in die Welt des klassischen Balletts verlegt, Immerhin sehen wir so zum ersten Mal seit mindestens 20 Jahren Pause am Linzer Landestheater wieder Spitzentanz!!!

Aschenputtel ist hier die Tochter eines Tänzerehepaares, schon von klein auf vom Beruf ihrer Eltern fasziniert. Die Mutter stirbt plötzlich, eine Stiefmutter mit zwei fies-steampunkigen Töchtern tritt auf. Wobei diese weniger ihre neue Schwester piesacken als sich selbst, durch alle Jahreszeiten, in den Vordergrund spielen wollen (was freilich auch an Schuhen scheitert). Allerdings wird Aschenputtel auch von einer guten Fee, die ihrer verstorbenen Mutter ähnelt, und von zwei Schutzengeln geleitet und beschützt. Cinderellas Tanzbegeisterung wird überwältigend, als eine Ballettcompagnie in ihrer Heimatstadt zu Gast ist, die … Prokofjews „Soluschka“ aufführt! Nach der Vorstellung, als schon die Sterne funkeln, schleicht sich unsere Hauptfigur auf die Bühne und beginnt zu tanzen. Der „Startänzer“ der Compagnie kommt zurück auf die Bühne und wiederholt mit ihr – fast – genau den pas de deux, den er (vor der Pause) mit seiner Bühnenkollegin aufgeführt hat. Einige Jahre später kommt die Ballettruppe wieder in die Stadt, und Cinderella erneut auf die Bühne – jetzt aber, um zu bleiben, und den Tänzer zu heiraten. Zuletzt sehen wir beider Tochter, die, wie einst ihre Mutter, schon in der Jugend vom Tanz begeistert ist.

Dirk Hofacker hat dafür eine einfache schwarze Kastenbühne mit vielen – variablen – schlauen Details gebaut; z. B. gibt er der Stiefmutter einen großen Spiegel für einen pas de deux mit sich selbst, und Engel sowie die Fee tauchen aus dem Himmel auf. Zwischendurch ist auch ein Arkadengang auf der Straße zu sehen, markiert mit Bögen aus Licht; immer wieder vervollständigen auch sparsame, jedoch wirkungsvolle bunte LED-Akzente den Raumeindruck (Johann Hofbauer); aber es gibt auch einen prachtvollen Sternenhimmel! Natürlich nicht zu vergessen die Logentürme und der prächtige rote Vorhang, die das Theater im 2. Akt markieren.
Herr Hofacker hat auch eine Fülle von treffenden Kostümen entworfen, von einem grauen Kittel fürs Aschenputtel, aus dem eine Art Tütü-Bürzel ragt (die in keiner Lebenslage zu unterdrückenden Liebe zum Tanz), über die bunten Gestalten aus der Feenwelt bis zu fantastisch aufgedonnerten „Stiefdamen“, vielleicht an Cruella deVil in Disneys Dalmatinerfilm von 1961 orientiert.Als Cinderella (Kind und Teenager) berührt und begeistert Lara Bonnel Almonem mit wunderbar tanztheatralisch dargestellten Gefühlen.

Später, als junge Frau, kann Kayla May Corbin der Figur auch klassisches Ballettkönnen verleihen. Núria Giménez Villarroya wirbelt als Fee in verschiedenen Erscheinungsformen über die Bühne, immer auf ihr Kind bedacht, das sie als jung verstorbene Mutter alleine lassen mußte. Ihr Gatte ist Vincenzo Rosario Minervini in einer kleineren, nichtsdestotrotz engagiert getanzten Rolle.
Stiefmutter Mireia González Fernández ist eine köstlich schräge Schreckschraube mit Wudupüppchen im Haar, und ihre leiblichen Töchter (Rie Akiyama und Julie Endo) lassen keinen Zweifel daran, von wem sie abstammen.
(„Soluschka“-Prinz) Shang-Jen Yuan packt die klassische Ballettkunst aus, mit bezaubernden pas de deux, mit der klassischen Primaballerina Cristina Uta (die die Emotionalität des Spitzentanzes wunderbar demonstriert) wie mit Frau Corbin. Die beiden gelb-blau flatterhaften Schutzengel (Pavel Povrazník und Lorenzo Ruta) haben offensichtlich ebenso viel Spaß und Freude damit, Aschenputtel zu leiten wie das Publikum zu unterhalten.
Das weitere, präzise, akrobatische, expressive Ensemble: Melissa Panetta, Alessia Rizzi, Filip Löbl, Pedro Tayette, Safira Santana Sacramento, Evi van Wieren, Valerio Iurato, Nimrod Poles und Andrea Schuler; außerdem etliche der vorgenannten Solistinnen und Solisten in Zweitrollen.

Das Bruckner Orchester unter der souveränen Leitung von Marc Reibel erfüllt die bunte und fantasievolle Partitur Prokofjews mit blühendem Leben – von perkussiver Präzision bis zu schwelgerischer Pracht, von zarter Lyrik bis zu eleganten Walzern … und unter letzteren findet sich, als das „Theater im Theater“ aufgebaut wird, ein Stück Musik, das sehr an den weltberühmten Walzer Nr. 2 (Kubrick’s „Eyes Wide Shut“!) aus der „Suite für Varieté-Orchester“ von Dimitri Schostakowitsch erinnert – die wurde aber doch, wie neuerdings erhoben wurde, erst nach 1950 geschrieben?! Aufgrund der dramaturgischen Umgestaltung wurde auch einiges umgestellt bzw. gestrichen, etwa das Marsch-Zitat aus den „Drei Orangen“; das ändert aber nichts daran, daß der Abend auch musikalisch balanciert, aus einem Guß, gerät.
Schließlich: Uneingeschränkte Begeisterung für Bühnenpersonal, Musik und Produktionsteam. Ein Abend für alle, und nebenbei ein wunderbares Beispiel dafür, daß Musik des 20. Jahrhunderts überaus eingängig sein kann, ohne banal zu werden…
Foto (c) Sakher Almonem
Petra und Helmut Huber, 3.3.2020
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
SISTER ACT
Ein Hit für das breite Publikum
20. Dezember 2019 (Premiere 7. 9.19)
Den Filmhit gleichen Namens aus dem Jahr 1992, mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle, kennt vermutlich jeder. Die Musicalversion von Sister Act, die seit 10 Jahren um die Welt geht und bereits mehr als sieben Millionen Menschen begeistert hat, war schon 2011 im Ronacher in Wien zu sehen, allerdings, wie im internationalen Musicalbusiness üblich, in exakt umgesetzter Originalinszenierung. Den geschickten Verhandlern der Linzer Musicalsparte ist es wieder einmal gelungen, die Rechte für eine österreichische Non-Replica-Produktion zu erwerben: Wie machen die das nur?
Die Inszenierung von Andreas Gergen, mit der Choreographie von Kim Duddy und im Bühnenbild von Walter Vogelweider, ist daher tastsächlich sowohl einmalig wie auch einzigartig. Wer genau diesen Sister Act erleben will, muss also unbedingt nach Linz fahren. Das kann freilich nur wärmstens empfohlen werden.

Die Handlung ist bekannt und stimmt mit der filmischen Vorlage weitgehen überein. Es geht um eine junge Disco-Sängerin namens Deloris Van Cartier (Künstlername!), die im Zuge eines Zeugenschutzprogramms in einem Nonnenkloster Unterschlupf findet und dort bald als unkonventionellen Chorleiterin den klösterlichen Alltag ihrer Mitschwestern gehörig aufmischt, in dieser Umgebung aber auch erstmals echte Freundschaft und Gemeinschaft erfahren wird. Während man bei der Filmmusik auf bereits bekannte, nur etwas aufgefrischte Hits zurückgegriffen hatte, wurde für das Musical eigens Alan Menken engagiert, der Haus- und Hofkomponist des Walt Disney Konzerns, bekannt für Kompositionen u.a. für Traumfabrik-Musicals wie Arielle, die kleine Meerjungfrau, Die Schöne und das Biest, Der Glöckner von Notredame und Aladdin. Seine Songs sind, wie nicht anders zu erwarten, bestens geeignet für eine unangestrengte, kurzweilige und amüsante Unterhaltung für die ganze Familie. Richtige Ohrwürmer wird man vergeblich suchen, aber die Musik funktioniert perfekt und gibt den fabelhaften Solisten und dem exzellent gecasteten Chor genug Gelegenheiten für effektvoll choreographierte Auftritte.
Die afroamerikanisch geprägte Soul-Musik, aus Rhythm ’n‘ Blues und Gospel, in den späten 50-er und in den 60-er Jahren entstanden, bildet die Grundlage der meisten Nummern. Die Handlung spielt allerdings im Jahr 1977, als der Höhepunkt des Soul schon zu Ende und Disco-Music à la Donna Summer in ihrer besten Blüte war. Auch davon finde sich einige geschickt eingebunden Anklänge. Bei den Chören hätte man sich zuweilen etwas weniger Soul und etwas mehr Gospel gewünscht. Wer je erlebt hat, wie zündend und mitreißend Gospelmusik in einer Kirche in den Südstaaten der USA klingt, weiß, wovon hier die Rede ist. Aber auch so funktioniert diese Kirchen-Disco-Musik ziemlich gut.

Die aus Kapstadt gebürtige Tertia Botha ist eine sympathische, quicklebendige Sängerin Deloris Van Cartier, deren anfängliches Disco-Tussy-Image im Kloster eine grundlegende Veränderung erfährt. Auch Daniela Dett erlebt als auf Würde bedachte Schwester Oberin eine Umwandlung und wird, was die strikten Regeln in ihrem Haus betrifft, allmählich eine Spur toleranter und liberaler. Berührend ihre Anrufung Gottes, von dem sie erfahren will, warum sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden und für ihre spirituelle Bedürfnisse anderweitig eine Erfüllung suchen. Von derartigen Skrupeln weit entfernt ist ihr Vorgesetzter, Monsignore O’Hara, der gern bereit wäre, die anfangs kaum noch besuchte und baufällig gewordene Kirche samt Kloster an finanzkräftige russische Investoren zu verkaufen, dann aber mit Freude konstatiert, dass man mit der Kirche auch als Showbusiness Geld verdienen kann. William Mason zeichnet ein köstliches Porträt dieses kauzig-klapprigen, ältlichen Kirchenmannes, der schließlich begeistert mittanzt, mitsteppt und mitsingt. Kein Wunder, der Nonnenchor wird in den Medien gefeiert und erhält sogar eine Einladung in den Vatikan. Die Kirche ist inzwischen längst architektonisch aufgemotzt, inklusive Discokugel in der Höhe.
Feine Charakterstudie liefern Viktoria Schubert als bärbeißig-humorvolle Mary Lazarus die Vorgängerin von Deloris als Chorchefin, sowie Hanna Kastner als Schwester Mary Roberts, eine Postulantin, die als solche noch vor ihrer endgültigen Aufnahme in den Orden steht, zunehmend verunsichert wird und sich fragt, ob sie sich auf dem richtigen Weg befindet. Wie sie, die Schüchterne und Verlegene, den Mut für klare Worte aufbringt, geht ebenso unter die Haut wie die herrlich naive, ebenso unerschütterliche wie ansteckende Begeisterung für das gottfröhliche Nonnenleben, die Sanne Mieloo als Mary Patrick ausstrahlt.

Schließlich treten im Musical – neben dem Herrn Monsignore – natürlich auch noch so „richtige Männer“ in Erscheinung. Wenn Joey (David Arnsberger), TJ (Lukas Sandmann) und Pablo (Christian Fröhlich), Gefolgsleute des schmierigen Unterweltbosses Curtis Jackson (Karsten Kenzel), davon träumen, wie sie die Nonnen mit ihrer jeweiligen Masche umgarnen und so dazu bringen werden, ihnen den Aufenthaltsort von Deloris zu verraten, bleibt kein Auge trocken. Gernot Romic, als der um das Wohl von Deloris bemühte Polizist Eddie Fritzinger, entwickelt sich von einem etwas gehemmten jungen Mann – er hat Deloris schon in der Schulzeit heimlich bewundert, wurde von ihr aber nur stets als „Schwitze-Fritze“ bezeichnet – in einen Mann, der im rechten Augenblick, als Curtis Deloris erschießen will, seine Hemmung ablegt, die Dienstwaffe zieht und den Angreifer außer Gefecht setzt. Das Happy-end ist gesichert.
Standing Ovations und ryhthmisches Mitgeklatsche gibt es auch bei dieser Aufführung. Dem Linzer Musiktheater ist mit Sister Act – unter der musikalischen Leitung von Tom Bitterlich an der Spitze der im Programmheft als „Sixtinischen Kapelle“ bezeichneten Rockband mit Blechbläser-Erweiterung – offensichtlich ein echter Publikumshit gelungen. Nicht unbedingt etwas für puristische Musicalfans, aber immerhin ein brauchbares Familienmusical für das breite Publikum.
Bilder (c) Barbara Palffy
Manfred A. Schmid, 27.12.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Dritte Kritik:
LE PROPHÈTE
Vorstellung am 20. November 2019
Die Macht der Manipulation der Massen…
Giacomo Meyerbeer war der Doyen der Oper in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts und der prägende Komponist der Grand Opéra, die Richard Wagner so verachtete als oberflächliches Unterhaltungsprogramm. Dabei hatte ihm Meyerbeer durch eine persönliche Intervention beim Königlichen Hofopernintendanten in Dresden dort zur UA des „Rienzi“ 1842 verholfen. Es wurde Wagners erster großer Erfolg, auch weil der „Rienzi“ der damals beliebten Grand Opéra sehr nahe kam und dem Publikum somit gefiel.
 Wagner wollte aber etwas ganz Anderes. Das Ende kennen wir ja: „Tristan und Isolde“, „Ring des Nibelungen“, sowie „Parsifal“, alles Werke mit großen Herausforderungen an das Publikum, bis heute. Dass Meyerbeer mit seiner Grand Opéra durchaus nicht nur gefällig war und Wagner damit also nicht ganz Recht hatte, wird mit dem „Prophète“, den er 1849 nach einem Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte und der noch im selben Jahr an der Pariser Oper seine UA erlebte, sehr deutlich. Hier geht es um die Manipulation der Massen mit einer von Gott abgeleiteten Pseudo-Autorität, die im Rahmen der Geschichte der sozialrevolutionären Wiedertäufer im 16. Jahrhundert in Holland sowie in und um die Stadt Münster, genauer von 1533–1535 spielt. Die Wiedertäufer krönten Jan van der Leyden zum König und zogen damit den Widerstand des Establishments auf sich, bis zur Verfolgung und finalen Vernichtung. Was könnte - auch heute noch - aktueller sein als solch ein Stoff, wobei die Verführung bekanntlich über religiöse wie über politische Inhalte erfolgen kann. Das zeigten Regisseur Alexander von Pfeil und Bühnenbildner Piero Vinciguerra in Linz dramaturgisch spannend und optisch eindrucksvoll.
Wagner wollte aber etwas ganz Anderes. Das Ende kennen wir ja: „Tristan und Isolde“, „Ring des Nibelungen“, sowie „Parsifal“, alles Werke mit großen Herausforderungen an das Publikum, bis heute. Dass Meyerbeer mit seiner Grand Opéra durchaus nicht nur gefällig war und Wagner damit also nicht ganz Recht hatte, wird mit dem „Prophète“, den er 1849 nach einem Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte und der noch im selben Jahr an der Pariser Oper seine UA erlebte, sehr deutlich. Hier geht es um die Manipulation der Massen mit einer von Gott abgeleiteten Pseudo-Autorität, die im Rahmen der Geschichte der sozialrevolutionären Wiedertäufer im 16. Jahrhundert in Holland sowie in und um die Stadt Münster, genauer von 1533–1535 spielt. Die Wiedertäufer krönten Jan van der Leyden zum König und zogen damit den Widerstand des Establishments auf sich, bis zur Verfolgung und finalen Vernichtung. Was könnte - auch heute noch - aktueller sein als solch ein Stoff, wobei die Verführung bekanntlich über religiöse wie über politische Inhalte erfolgen kann. Das zeigten Regisseur Alexander von Pfeil und Bühnenbildner Piero Vinciguerra in Linz dramaturgisch spannend und optisch eindrucksvoll.

Was wir hier zu sehen bekommen, ist eine gnadenlose Darstellung der Skrupellosigkeit religiös abgeleiteter Macht. Vinciguerra hat erst dieser Tage mit einem ungewohnten Bühnenbild in der Felsenreitschule Salzburg mit der Bebilderung eines neuen „Lohengrin“ des Landestheaters Furore gemacht. Er stellte ein komplettes Flugzeugwrack mit 40 Metern Länge auf die dortige Riesenbühne. In Linz für den Propheten und die Machenschaften seiner Wiedertäufer baute er ähnlich gigantomanisch eine riesige gasometerartige Metallkonstruktion, in der sich das ganze Drama auf verschiedenen Ebenen abspielt. Die eher unauffälligen Kostüme von Katharina Gault sind optimal auf das einfache Volk in Verbindung mit dem jeweiligen Geschehen abgestimmt, womit ihr zum Krönungsgewand des Jean ein umso größerer optischer Exzess möglich ist. Mit weiß getünchter Maske sieht er in dem viel zu großen und schweren weißen Pelzmantel mit Krone darin aus wie ein schon zu Beginn zum Scheitern Verurteilter.
Anfangs geht es Jean nur um die Liebe zu seiner Verlobten Berthe, die hier von Brigitte Geller mit einem klangvollen, aber nicht allzu großen Sopran gesungen und mit viel Emotion verkörpert wird. Dann zeigt von Pfeil, wie durch die immer militanter und grausamer werdenden Aktionen der drei Wiedertäufer Zacharie (Dominik Nekel), Jonas (Matthäus Schmidlechner) und Mathisen (Adam Kim), die stimmlich wie darstellerisch viel aus ihren Rollen machen und eigentlich die treibende Kraft dafür sind, dass das Schicksal Jeans immer mehr in die Richtung des (vermeintlichen) Propheten treibt, unter Missachtung seiner privaten und vor allem familiären Wünsche.

In dieser Historienoper zeigt Meyerbeer, wie Dramaturg Christoph Blitt in einem Aufsatz im Programmheft formuliert, „wie der Mensch von Politik und Ideologie zum Bösen verführt werden kann, sodass das Individuum, das sich derartigen Suggestionen entgegenstellen möchte, keine Chance auf die Verwirklichung seines privaten Glücks hat.“ In der Folge vermengen sich Politik und Privates auch auf der Linzer Bühne in fataler Weise sichtbar immer mehr. Leider ist Jeffrey Hartman bei guter schauspielerischer Leistung stimmlich mit einem zu verquollenen und glanzlosen Tenor bei wenig Resonanz nicht in der Lage, der Figur auch vokal Nachdruck zu verleihen. Katherine Lerner, die schon als Klytämnestra in Linz großen Eindruck machte, kann als Fidès mit ihrem klangvollen Mezzo beeindrucken und macht den Dialog mit Berthe zu Beginn des 4. Akts zu einem Höhepunkt des Abends. Martin Achrainer ist ein stimmlich und darstellerisch präsenter Graf von Oberthal, erst als arroganter Großgrundbesitzer, später als von den Wiedertäufern zum Tode verurteilter Bittsteller. Daneben gibt es noch eine Reihe von kleinen Nebenrollen, deren Interpreten sich allesamt harmonisch in das Ganze einfügen. Der Chor, Extrachor und Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz, einstudiert von Elena Pierini, Martin Zeller und Ursula Wincor, setzt starke vokale Akzente und ist auch bestens choreographiert, wie überhaupt die Personenregie sinnvoll konzipiert ist. Wie man nicht nur an den Handies erkennt, spielt das Stück in der Gegenwart, ein weiterer Hinweis auf seine bedauerliche tagespolitische Relevanz.

Marc Reibel dirigiert das Bruckner Orchester Linz mit großem Engagement, wenn auch bisweilen etwas zu laut. Allerdings könnte man sagen, dass dies zu dem militanten Geschehen ebenso passt wie der oft spröde Duktus der Musik Meyerbeers.
Fotos: Klaus Billand, Barbara Palffy, Martin Winkler
Klaus Billand /10.12.2019
www.klaus-billand.com
Zum Zweiten
LE PROPHÈTE
12.10. (Premiere am 22.9.2019)
Ein musikalisches Juwel szenisch eher dürftig aufbereitet
Auf ein gemeinsames Libretto von Eugène Scribe und Émile Deschamps komponierte der deutschstämmige Komponist seine Grand opéra in fünf Akten, deren Uraufführung am 16. April 1849 in der Pariser Oper stattfand.
Erzählt wird die Entstehung und der Untergang des protestantischen Täuferreiches 1535 im westfälischen Münster. Der Gastwirt Jan van Leiden, Anführer dieser fundamentalistischen Bewegung, ließ sich im September 1534 zum „König Johannes I.“ krönen. Neben der Person des Propheten ist nur noch Jan Matthys (Mathisen) historisch nachweisbar, der unbewaffnet im April 1534 von Landsknechten zerhackt wurde. Die übrigen Personen der Oper hat Meyerbeer frei erfunden, ebenso das theatralisch effektvolle Ende der Oper mit dem Brand und Einsturz des Schlosses von Münster. Das Täuferreich endete vielmehr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1535 als kaiserliche Truppen Karls V. Münster einnahmen und die führenden Täufer am 22. Januar 1536 qualvoll hinrichten ließen… In der Behandlung des zentralen Themas dieser Oper, nämlich der Instrumentalisierung von Religion mit dem Ziel der Errichtung eines „Gottesstaates“ war Meyerbeer seiner Zeit weit voraus und geradezu visionär. Sein düsterer Ausblick sollte sich ja gerade in unserer spannungsgeladenen Zeit bewahrheiten… Die Aufführung in Linz verwendete die kritische Edition der Oper unter Einbeziehung aller gestrichenen Teile, wie sie auch der Aufführung an der Wiener Staatsoper 1998 zu Grunde gelegen war. Ein literarisches Detail am Rande: Heimito von Doderer benutze in seinem Roman „Die Merowinger oder Die totale Familie“ Meyerbeers Krönungsmarsch aus der Oper „Le prophète“ zur musikalischen Begleitung einer grotesken Wuttherapie des Psychiaters Dr. Horn durch Application von Paukenschlögeln. Eine dramatisierte Fassung dieses Romans kann man derzeit am Wiener Volkstheater in der Regie von Intendantin Anna Badera sehen.

Meyerbeer schuf mit seinen Opern totales Theater, indem er alle Aspekte des Musiktheaters, wie Komposition, Instrumentation, Text und Ausstattung der Darstellung eines übergeordneten Gesamtkonzeptes unterwarf, in „Le prophète“ eben der Instrumentalisierung von Religion und der Errichtung eines Terrorregimes. In Wien sang Plácido Domingo die herausfordernde Rolle des Jean de Leyde. In Linz wagte sich der aus Anderson / Indiana stammende US-amerikanische Tenor Jeffrey Hartman an diese gefürchtete Rolle, deren stimmlichen Herausforderungen er hörbar an vielen Stellen nicht gewachsen war. Resultat: er knödelte und stemmte, dafür aber war sein Rollenspiel umso überzeugender, womit er einiges an gesanglichen Schwächen ausgleichen konnte. Brigitte Geller gefiel als resolute Berthe. Katherine Lerner in der Rolle der Fidès, Mutter des Propheten, führte ihren Mezzosopran zu Höchstleistungen und bot ein ergreifendes Bild einer Mutter, die ihren Sohn verleugnen muss. Dominik Nekel als Zacharie mit gut geführten Bass, Matthäus Schmidlechner als Jonas mit tragfähigem Tenor und der in Seoul geborene Bariton Adam Kim als Mathisen wurden von der Regie sträflich vernachlässigt und konnten sich deshalb in stimmlicher Hinsicht auch nur bedingt behaupten.

Die Bassrolle des Comte d‘Oberthal war für Bassbariton Martin Achrainer vielleicht eine Spur zu tief angelegt, aber er hielt sich wacker und konnte sich dank seiner Routine neben seinen darstellerischen Qualitäten in dieser unsympathischen Rolle auch stimmlich behaupten. In kleineren Rollen wirkten noch Markus Schulz als ein Bauer, Csaba Grünfelder als ein Soldat, Marius Mocan als ein Bürger, Jonathan Whiteley und Markus Raab als erster und zweiter Wiedertäufer sowie Danuta Moskalik und Yoon Mi Kim-Ernst als zwei Bäuerinnen mit. Der Chor, Extrachor sowie der Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz wurden von Elena Pierini, Martin Zeller und Ursula Wincor bestens einstudiert. Das Bruckner Orchester brachte unter dem sensiblen Dirigat von Markus Poschner Meyerbeers stilistisch changierende Partitur in klanglicher Virtuosität zu ungeheurem Funkeln. Schade nur, dass während der Balletteinlage Les Patineurs und zwischen den einzelnen Bildern der Oper Bibelzitate und Aussprüche von Luther, von Meister Heinrich Gresbeck, dessen Name fälschlich mit „Grasbeck“ angeführt wird, sowie ein zeitgenössischer Text über die Vielweiberei der Wiedertäufer auf den eisernen Vorhang projiziert wurden, der szenisch dadurch umgesetzt wurde, dass das Lager plötzlich mit schwangeren und stillenden Müttern bevölkert war.

Comte d’Ottenthal beliefert diese noch incognito mit abgefüllter Muttermilch und trägt eine Jacke mit der Aufschrift „Au bon lait“ bevor er enttarnt und danach ermordet wird. Die Inszenierung des 1970 in Bremerhaven geborenen Alexander von Pfeil, mit vollem Namen Alexander Christian Ernst Walter Friedrich Carl Graf von Pfeil und Klein-Ellguth, eines Schülers von Götz Friedrich, versucht in einer Zeitreise jene historischen Ereignisse in die Gegenwart zu holen. Als äußere Merkmale dienen ihn dazu die Bücherverbrennung während der NS-Zeit und, äußerst aktuell aber völlig unnötig, der Einsatz von Mobiltelefonen. Das Einheitsbühnenbild von Piero Vinciguerra erschöpft sich in der düsteren Architektur einer halbrunden mehrstöckigen Halle aus dem Zeitalter der industriellen Revolution. In dieser verlassenen Wüste versammelt sich eine verlassene Gesellschaft auf der Suche nach Erlösung. Ihre Heilserwartung in der Gestalt des prophetischen „Erlösers“ Jean de Leyde löst eine Spirale der Gewalt aus, die in der alttestamentarischen Entscheidung Jeans zwischen seiner Mutter Fidès und seiner Freundin, der Waisen Berthe, gipfelt. Die historische Mutter von Jean de Leyde hieß jedoch Alit Bockel und starb bereits 1521.

Der Fanatismus der Täufer, fälschlicherweise als „Wiedertäufer“ etikettiert, kommt durch Waffen schwingende Schergen nur marginal zum Ausdruck, sie schleppten sich in den Allerweltskostümen von Katharina Gault ziemlich stereotyp und völlig uninspiriert über die Bühne und auch das handelnde Volk, eine weitere Stereotype der Grand Opéra, fungierte in dieser Inszenierung eher wie Statisten. Weshalb am Ende der Oper der Niedergang der Wiedertäuferbewegung durch Menschen in grünen Strahlenschutzanzügen beschleunigt wird, bleibt uns der Regisseur schuldig. Die von der Decke der Bühne baumelnden Körper spielen auf das historische Ende nach der Eroberung von Münster an, wo die Leichen der zu Tode gefolterten Anführer Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling in eisernen Körben am Turm der Lambertikirche zur Schau gestellt wurden. Am Ende der Oper spendete das Publikum wohlwollenden Applaus, von denen die beiden Damen am stärksten profitierten. Die nicht immer einwandfreien Leistungen des Sängers der Titelrolle, Jeffrey Hartman, wurden vom Publikum großzügig bedankt. Trotz der szenischen Tristesse würde ich den Besuch dieser Produktion unbedingt empfehlen, hat man sie doch hierzulande seit jener denkwürdigen Inszenierung an der Wiener Staatsoper nicht mehr erleben können. Also auf nach Linz. Bis März 2020 kann man sich der schwelgerischen Musik von Meyerbeers „Prophète“ noch genussvoll hingeben.
Harald Lacina, 13.10.2019
Copyright: Barbara Pálffy und Reinhard Winkler
LE PROPHÈTE
Musikalischer Effekt ohne szenische Wirkung!
27. 9. 2019 (2. Vorstellung nach der Premiere vom 22. 9. 2019)

Bei meiner Rundreise zu Eröffnungspremieren österreichischer Bundesländerbühnen gab es ein interessantes Zusammentreffen:
Auf den Tannhäuser in Klagenfurt folgte nun in Linz Giacomo Meyerbeers Grand opéra Le Prophète! Tannhäuser wurde 1845 uraufgeführt und Le Prophète 1849. Als Wagner in Paris von 1840 bis 1842 unter ärmlichen wirtschaftlichen Bedingungen lebte, erhielt er von Meyerbeer mehrmals finanzielle Hilfe. Der deutsche Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer schreibt dazu: „aber dieser hat es ihm nicht gedankt, sondern er hat Konkurrenzneid entwickelt. In einer Besprechung von Le Prophète feierte Wagner zwar zunächst den Komponisten als den Propheten der neuen Welt -Kommt das Genie und wirft uns in andere Bahnen, so folgt ein Begeisterter gern überall hin, selbst wenn er sich unfähig fühlt, in diesen Bahnen etwas leisten zu können. Kurz danach allerdings änderte Richard Wagner seine Meinung wegen der jüdischen Herkunft von Meyerbeer radikal und schrieb: Das Geheimnis der Meyerbeerschen Opernmusik ist – der Effekt und Wirkung ohne Ursache.
Dieses Wagner-Wort kann man abgewandelt durchaus auf die Linzer Produktion ummünzen: Es war wahrhaft Musikalischer Effekt ohne szenische Wirkung!
Vor allem durch das Bruckner Orchester Linz, den Chor und Extrachor des Landestheaters Linz (Leitung Elena Pierini) unter der Gesamtleitung des Opernchefs Markus Poschner sowie durch die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen Brigitte Geller als Berthe und Katherine Lerner als Fidès war es ein respektabler und hörenswerter Versuch, das Meyerbeer-Werk wieder auf die Bühne zu bringen.

Das Werk nach dem Textbuch von Eugène Scribe war bei seiner Pariser Uraufführung 1849 ein ungeheurer Erfolg und erlebte dort in 2 Spielzeiten 100 Aufführungen. Rasch breitete sich der Erfolg über ganz Europa aus. In Österreich wurde Le Prophète schon im Jahr danach im Wiener Kärntnerthor-Theater und in Graz mit großem Erfolg aufgeführt. Gustav Mahler setzte das Werk dann 1897 mit dem berühmten Tenor Hermann Winkelmann auf den Spielplan der Wiener Staatsoper. Dann dauerte es allerdings fast 100 Jahre, bis Le Prophète wieder in Wien aufgeführt wurde. Das war dann 1998/99 mit Agnes Baltsa als Fidès und mit Plácido Domingo als Jean. Und damit sind wir bereits bei einem entscheidenden Manko der Linzer Neuproduktion: der amerikanische Tenor Jeffrey Hartman hat leider weder stimmlich noch darstellerisch das nötige Format für die immens schwierige Titelpartie. Im Neuen Merker gibt es eine kluge Premierenkritik , der ich mich vor allem was die Inszenierung anlangt, durchaus anschließe. Gerne bescheinige ich Jeffrey Hartman, dass ihm in der von mir besuchten Aufführung die Kickser der Premiere nicht passierten und dass er in den letzten beiden Akten auch diesmal an stimmlicher Präsenz gewonnen hatte. Aber die Stimme sitzt einfach zu weit hinten, hat keinen Glanz und erreicht die Spitzentöne immer nur mit beträchtlicher, guttural-kehliger Anstrengung. Dazu kommt, dass er auch schauspielerisch als zentrale Figur des Stücks nicht überzeugen kann - wohl auch, weil er von der Regie recht allein gelassen wird und sich wiederholt mit rhythmisch-mitbewegenden Armgesten behelfen muss. Besser war es um die drei düsteren, sektiererischen Wiedertäufer-Figuren bestellt, die Jean begleiten und in die Propheten-Rolle drängen. Matthäus Schmidlechner mit seinem markanten und gut sitzenden Charaktertenor, Adam Kim mit seinem sicheren, wenn auch schmalem Bariton und vor allem Dominik Nekel mit in allen Lagen souveränem Bass machten ihr Sache stimmlich sehr gut. Die wichtige Figur des Grafen Oberthal war mit der Ensemblestütze Martin Achrainer darstellerisch prägnant besetzt. Allerdings ist sein Bariton nur bedingt für die Bassrolle geeignet. Aber mit seiner Routine konnte er das gut kaschieren.

Leider ist aus meiner Sicht die Regie bei der Umsetzung dieser Grand Opéra gescheitert. Im Programmheft finden sich kluge Gedanken des Dramaturgen Christoph Blitt zu Werk, Entstehungszeit und Katastrophenszenarien. Leider haben diese Gedanken im szenischen Konzept (Alexander von Pfeil - Regie, Piero Vinciguerra - Bühne und Katharina Gault - Kostüme) zu keiner effektvollen Bühnenwirkung geführt. Im Programmheft liest man: Meyerbeer war nur in zweiter Linie Komponist oder Tonsetzer; denn zunächst und vor allem war er ein „Homme du théâtre“. Meyerbeer wäre vom trostlosen Einheitsbühnenbild in der gründerzeitlichen Werkshalle samt Flüchtlingslager und stereotyp Maschinenpistolen schwingenden, schäbig gewandeten Menschen zutiefst enttäuscht gewesen. Das war kein Bühnenspektakel, sondern eine triste Allerweltszenerie ohne Bezug zum Stück. Für einen Homme du théâtre wäre es wohl auch ganz unvorstellbar gewesen, die Balletteinlage Les Patineurs im 3. Akt und den Einzug von Jean in den Dom zu den Klängen des Krönungsmarsches im 4.Akt nicht szenisch zu gestalten. Der Vorhang fiel und die Musik klang aus dem Orchestergraben - übrigens erfeulich temperamentvoll interpretiert.

Da musste ich wehmütig an die zwar umstrittene, aber mit echter Theaterpranke gestaltete Konwitschny-Inszenierung der französischen Grand Opéra-Fassung des Verdischen Don Carlos vor etwa 15 Jahren an der Wiener Staatsoper denken - Konwitschny hatte eine Fülle von Einfällen, wie man Balletteinlagen einer Grand Opéra heute effektvoll auf die Bühnen stellen kann! Dem Linzer Leading-Team ist leider gar nichts Bühnenwirksames eingefallen. Zwischen den einzelnen Bildern wurden Texte auf den eisernen Vorhang projiziert - da gab es Bibel-Texte, Worte von Martin Luther über die Wiedertäufer und z.B. vor dem 2. Bild des 3. Aktes einen zeitgenössischen Text zur Vielweiberei der Wiedertäufer. Dieser Text wurde dann szenisch aufgegriffen - plötzlich war das Lager mit schwangeren Frauen und Müttern mit Säuglingen bevölkert. Der Graf von Oberthal war in eine Jacke mit der Aufschrift Au bon Lait gehüllt und brachte offenbar eine Lieferung mit abgepumpter Muttermilch, bevor er als Graf entlarvt und gemordet wurde..…. Nicht nur hier wurde man den Eindruck nicht los, dass man eher eine Opernparodie als eine effektvolle Wiederbelebung einer Meyerbeer-Oper erlebte. Dazu passte letztlich auch die peinliche Kleinigkeit, dass sich in die Textprojektion ein Schreibfehler eingeschlichen hatte: der zitierte Münstersche Handwerksmeister des Jahres 1534 hieß Heinrich Gresbeck, wie hier nachzulesen ist, und nicht Heinrich Grasbeck …
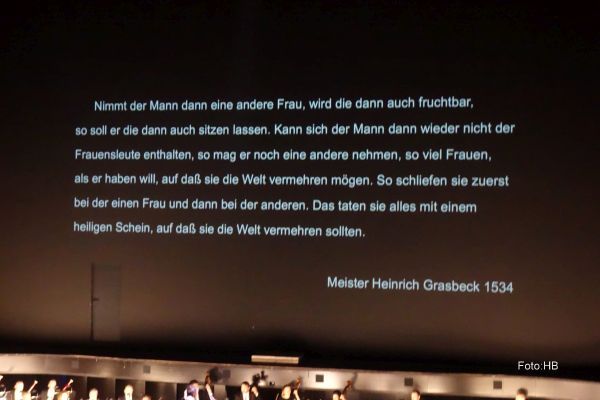
Leider: das war eine vertane Chance, in dem kaum 10 Jahre alten wunderbaren Linzer Musiktheater Meyerbeer zeitgemäß auf die Bühne zu bringen! Ich kann mich nur dem Schluss-Satz der eingangs zitierten Kritik anschließen: Die beiden „leading ladies“ sind, neben der orchestralen Seite, absolut den Besuch der Produktion wert, und ansonsten kann man bekanntlich ja die Augen zu machen.
Hermann Becke, 28.9.2019
Aufführungsfotos: Landestheater Linz, © Barbara Pálffy und Reinhard Winkler
Hinweise:
- Noch 10 weitere Vorstellungen bis März 2020
Othmar Schoeck
PENTHESILEA
18.5.19
Konwitschnys Meisterinszenierung aus Bonn endlich auch Linz
Der 1886 geborene Schweizer Komponist Othmar Schoeck gilt als einer der bedeutendsten Schweizer Liedkomponisten des 20. Jhd. und es war vor allem Dietrich Fischer-Dieskau, der sich zeitlebens für die Verbreitung seiner Lieder einsetzte. Sein insgesamt acht Werke umfassendes Opernschaffen ist heutzutage nahezu unbekannt. Neben Schoecks Venus, op. 32, erfreut sich seine Penthesiliea, op. 39, in den letzten Jahren einer steigenden Beliebtheit.

Die Opernhäuser wurden endlich wieder auf den völlig zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Opernkomponisten Schoeck aufmerksam. Gemeinhin wurde sein musikalischer Stil als der Spätromantik verpflichtet etikettiert, aber das trifft auf seine einaktige Oper „Penthesilea“ nicht zu. Für diese Oper verfasste der Komponist selbst das Libretto, das weitgehend auf dem Drama von Heinrich von Kleist beruht, kürzte es drastisch und legte den Fokus auf die Kernszenen zwischen Achilles und Penthesilea, deren tragische Liebesaffäre darin gipfelt, dass die Amazonenkönigin ihren Widersacher und Bezwinger Achilles, den sie gleichzeitig liebt, gemeinsam mit ihren Hunden zerfleischen lässt… Trotz Verwendung eines großen spätromantischen Orchesters verzichtete Schock ganz auf den Einsatz von tutti-Violinen zu Gunsten von vier Soloviolinen, zehn Klarinetten in verschiedenen Höhenlagen, zwei Klavieren und einem stark erweiterten Schlagwerk samt einer Peitsche, wobei er den Einfluss von Alban Berg und Igor Strawinsky, bei aller Eigenständigkeit, nicht gänzlich verleugnen kann. Man könnte anders formuliert auch behaupten, dass diese Musik, die zwischen zwei Weltkriegen entstanden ist, die Greuel des einen widerspiegelt und jene des anderen vorwegnimmt und die Unmöglichkeit einer Liebe zwischen verfeindeten Völkern an Hand des Griechen Achilles und der Amazone Penthesilea programmatisch vor Augen führt. Uraufgeführt wurde die Oper dann 1927 an der Staatsoper in Dresden unter dem Dirigenten Hermann Ludwig Kutzschbach (1875-1938).

Das Landestheater Linz brachte seine Penthesilea in Koproduktion mit der Oper Bonn heraus. Für seine Inszenierung wurde Peter Konwitschny bereits zum vierten Mal als bester Regisseur des Jahres ausgezeichnet. Das Orchester wurde für diese Produktion im Hintergrund der Bühne positioniert. Die von lediglich zwei Klavieren geschmückte und in den Zuschauerraum vorgezogene Bühne symbolisiert einen Boxring, der an den drei Seiten von einigen Solisten und Choristen bevölkert wird. Die vierte Seite bildet der Zuschauerraum, in dessen Reihen einige Protagonistinnen sitzen und in das Geschehen einbezogen werden, sodass der Eindruck einer antiken Arena entsteht. Den weißen Bühnenraum und die heutigen Kostüme ersann Johannes Leiacker. Auf ihm stehen zwei Konzertflügel, die von Andrea Szewieczek und Elias Gillesberger bespielt werden. Gleichzeitig sollen sie auch die Berge Ida und Ossa darstellen, auf denen die Protagonisten herumklettern, Achilles einige Klimmzüge darunter vollführt und die während der Kriegswirren auch als Schutzräume fungieren. Die Oberpriesterin Vaida Raginskyté beobachtet und kommentiert kritisch das Geschehen auf der Bühne von ihrer Loge aus.

Für die grausamsten Szenen seines Dramas griff Kleist ja bekanntlich zum antiken Kunstgriff des „Botenberichtes“, also wird das grässliche Zerfleischen von Achill durch die Meute von Hunden und Penthesilea nur erzählt. Bühnenmagier Konwitschny aber greift hier zum Stilmittel der totalen Abstraktion, indem die Amazonenkönigin Achilles erschießt und danach sich selbst. Beide erheben sich nach einer kurzen Pause und Penthesilea erscheint etwas später wieder mit hochgestecktem Haar als Konzertsängerin gestylt mit der Partitur in der Hand. Achilles stellt ihr noch einen Notenständer auf. Durch diesen Kunstgriff kann sich Penthesilea von ihrer abscheulichen blutrünstigen Tat distanzieren, sie nimmt sich gleichsam aus der Geschichte heraus und rechtfertigt ihre Tat durch die Idee einer grenzenlosen, schrankenlosen Freiheit mit den berühmten Kleist‘schen Worten: „Küsse, Bisse, das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das Eine für das Andre greifen.“

Mit der Titelpartie wurde die deutsche Mezzosopranistin und Preisträgerin des Österreichischen Musiktheaterpreises Dshamilja Kaiser besetzt, die diese Rolle auch schon bei der Premiere in Bonn 2017 gesungen hat. Von Beginn an beherrscht sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und enormen körperlichen Präsenz die Szene. Martin Achrainer tritt als blonder Widersacher Achilles zunächst in Siegerpose auf. Seinen äußeren Reizen ist die Amazonenkönigin nachvollziehbar verfallen. Mit seinem gut geführten Bariton bewältigt er sowohl die Mittellage als auch die herausfordernden Tiefen seines Parts mit Aplomb. Sein Liebesduett mit Penthesilea, das Schoeck erst später hinzugefügt hat, bildet den musikalischen Höhepunkt der knapp 90 minütigen Oper. Die übrige Besetzung sang und spielte mit Verve: Julia Borchert war eine berührende Amazonenfürstin Prothoe, ebenso Katherine Lerner als Meroe. Gotho Griesmeier gefiel als erste Priesterin. Unter den Solisten gibt es außer Achilles nur zwei weitere männliche Rollen: Matthäus Schmidlechner in der Rolle des Griechenkönigs Diomedes und Domen Fajfar als Hauptmann.

Das Bruckner Orchester Linz wurde von dem 1983 in Colombuthurai / Sri Lanka geborenen Dirigenten Leslie Suganandarajah, die meiste Zeit über mit dem Rücken zum Ensemble, dirigiert. Über mehrere Monitore erteilt er auf diese Weise seine präzisen Einsätze, was auch aus den vorderen Reihen des Zuschauerraumes sehr gut sichtbar war. Neben den gesprochenen bzw. stark rhythmisierten Passagen dominierten in Schoecks spannungsgeladener Musik auch zahlreiche Rezitative. In der ersten Reihe saß auch Souffleuse Ioana Calomfirescu, die für den textlich reibungslosen Ablauf dieses höchst erfreulichen Abends sorgte. Der Chor und der Extrachor des Landestheaters Linz waren von Elena Pierini und Martin Zeller bestens einstudiert. Obwohl das Landestheater nur zu etwa 2/3 besetzt war, fand die Vorstellung beim Publikum ihren uneingeschränkten Zuspruch. Alle Mitwirkenden wurden zu Recht mit begeistertem Beifall für ihre Leistungen bedankt. Ein Besuch dieser Opernrarität kann nur empfohlen werden!
Harald Lacina, 19.5.2019 Fotocopyright: Reinhard Winkler
Cherubini
MÉDÉE
4.5.2019 Premiere
Medea Alexis Colby wütet im Créon Tower
Als Koproduktion mit der Opéra de Nice und dem Theater Erfurt präsentierte das Landestheater Linz im Großen Saal seines Musiktheaters Cherubinis Médée in französischer Sprache mit Dialogen auf Deutsch nach der Neuedition aus dem Jahr 2008. Grundlage für Cherubinis Oper bildeten die antike Tragödie Medea von Euripides und Pierre Corneilles (1606-84) Drama Médée von 1635. Das Libretto verfasste François-Benoît Hoffman (1760-1828). Die Uraufführung der französischen Erstfassung mit gesprochenen Dialogen fand dann am 13.3.1797 im Théâtre Feydeau in Paris statt. Das Werk erlebte danach eine aufregende Aufführungsgeschichte. Für eine Produktion am Kärntnertortheater in Wien am 6.11.1802 erstellte Cherubini selbst eine gekürzte Zweitfassung, die in einer deutschsprachigen Übersetzung von Georg Friedrich Treitschke (1776-1842) gezeigt wurde. Der deutsche Komponist und Dirigent Franz Paul Lachner (1803-90) ersetzte schließlich 1854 die Dialoge durch Rezitative im Stil Richard Wagners, welche 1865 von dem italienischen Geiger und Komponisten Luigi Arditi (1822-1903) ins Italienische übersetzt wurden. Den endgültigen Siegeszug aber leitete erst Maria Callas 1953 ein, für die die „italienische“ Fassung der „Médée“ zur Paraderolle wurde.

Guy Montavon, Intendant des Theaters Erfurt, führte einige Striche in den Musiknummern und den langen Dialogen von François-Benoit Hoffman durch und verlegte die Handlung in die Zentrale eines Konzernes in einem Wolkenkratzer an der Wallstreet in New York. Während der Ouvertüre öffnet sich der Vorhang und wir erblicken ein von Annemarie Woods entworfenes Großraumbüro mit Computerarbeitsplätzen. Die Familienaufstellung erinnerte mich an die US-amerikanische Fernsehserie „Dynasty“ (1981-89), wobei die Rivalinnen Alexis Colby und Krystle Carrington sowie Blake Carrington bei Regisseur Montavon zu Médée, Dircé und Créon umgedeutet wurden. Médée und Jason haben sich zunächst als fremde Zuwanderer ein eigenes Imperium an der Wallstreet aufgebaut. Auf Grund einer Finanzkrise überschrieb der wendehalsige Karrierist Jason dieses aber an den Magnaten Créon und hofft, dass sich ihm an der Seite des Firmenchefs und seiner Tochter Dircé, die in ihrem hellen Outfit an Melania Trump erinnert, bessere Zukunftschancen eröffnen werden.

Im Businesslook von Annemarie Woods vergnügen sich die Angestellten dann auf der Hochzeit von Dircé und Jason in diesem Bürokomplex, der durch seine Transparenz keinerlei zwischenmenschliche Regungen aufkommen lässt. Jason verstößt Médée, verlangt von ihr aber, dass sie ihre beiden Söhne zurücklässt. Fulminant inszenierte Montavon schließlich das Ende der Oper, indem alle PCs im Créons-Tower abstürzen und Médée den Weltenbrand wie in Wagners Götterdämmerung entzündet, indem alle Beschäftigten und sie selber in den lodernden Flammen des Hochhauses zu Grunde gehen. Resümee: Eine interessante Adaption des Medea-Stoffes, der allerdings an einigen Stellen mit dem gesungenen Text nicht in Einklang steht.
Als Médée glänzte am Premierenabend die in der Schweiz geborene Berliner Kammersängerin Brigitte Geller. Sie bewies erstaunliches Durchhaltevermögen in den langen Gesangsphrasen und hielt das Publikum auch bei den deutschen Textpassagen mit ihrer stupenden Aussprache und Satzmodulation in Atem. Glaubwürdig zeigte sie die Zerrissenheit der liebenden Mutter und der hasserfüllten betrogenen Ehefrau auf, deren einzige Gedanken nur mehr auf Rache sinnen.

Sie erinnert Jason an ihre frühere Liebe und die Opfer, die sie ihm zuliebe gebracht hatte und fleht ihn in ihrer großen Arie „Vous voyez de vos fils la mère infortunée“ an, Mitleid mit ihr als verlassener Mutter zu empfinden. Ihr totales Scheitern in der fremden kalten Welt eines Finanzimperiums gipfelt schließlich im doppelten Kindsmord, nachdem sie zuvor Dircé einen roten Schal, den ihr Jason einst geschenkt hatte, und einen Revolver als Hochzeitsgeschenk übergibt. Dircé versteht diesen Wink Medeas und dass ihre Liebe zu Jason unter keinem guten Stern steht und sucht den Ausweg aus dieser Krise, indem sie sich erschießt. Allerdings wissen wir über Médée, dass sie auch eine Göttin und Zauberin war, sodass sie diesen roten Schal vergiftet haben könnte und sich Dircé, nachdem sie ihn mit den Händen berührt hatte, wie fremdgeleitet gezwungen sah, sich mit Médées Revolver zu töten. Jessica Eccleston war als Médées Begleiterin Néris die einzig wirklich sympathische Figur in dieser Oper. Die gebürtige Britin bewies mit ihrem Mezzosopran höchste Belcanto Qualitäten. Voller Mitgefühl verspricht sie ihrer Herrin in der berührenden Arie „Ah! nos peines seront communes“, begleitet von einem Solofagott, auf jeden Fall ihr Schicksal teilen zu wollen. Die gebürtige Salzburgerin Theresa Grabner ergänzte in der Rolle der Dircé dieses starke Damentrio. Ob sie bloß nach dem Willen ihres Vaters Créon einer kapitalsüchtigen Finanzpolitik geopfert wird, welche durch die Heirat mit Jason zu einer Fusion der beiden Imperien führen soll, bleibt offen.

Und diese Unsicherheit spielt sie überzeugend, indem sie die Feierstimmung für ihre bevorstehende Hochzeit mit Jason nicht in Freude versetzen kann. Bereits im ersten Bild plagt sie eine böse Vorahnung, die sie in ihrer Arie „Hymen! viens dissiper une vaine frayeur“, die von einer Soloflöte begleitet wird, furchtsam zum Ausdruck bringt. Der in Celje geborene slowenische Tenor Matjaž Stopinšek als Jason ließ seine Stimme heldenhaft wagnerisch erstrahlen, blieb aber in der Rollengestaltung hinter den drei Damen zurück. Was aber blieb ihm anderes übrig, denn die Rolle des Jason ist die eines schwachen Mannes, der zwischen zwei selbstbewussten Frauen steht. Im Duett mit Médée „Perfides ennemis, qui conspirez ma peine – O fatale toison! O conquête funeste!“ verwünschen beide das Goldene Vlies, das so viel Leid verursacht hat. Martin Achrainer als Créon, König von Korinth, wurde von der Maske gleich um einige Jahrzehnte künstlich gealtert. Er behandelt Médée abfällig und fordert sie mehrmals auf, das Land zu verlassen. Dann beweist er aber doch ein gewisses Maß an Diskussionskultur, indem er Médées letzten Wunsch, von ihren Kindern Abschied nehmen zu dürfen, gewährt. Sein stupender Bassbariton passte ideal zu dem eiskalten Firmenchef Créon, dem sich alle und alles unter zu ordnen haben. Die gebürtigen Koreanerinnen Margaret Jung Kim und Yoon Mi Kim-Ernst ergänzten als erste bzw. zweite Frau aus Dircés Gefolge mit ihren gut geführten Sopranen und szenischer Präsenz. In den stummen Rollen der beiden Söhne Medeas und Jasons wirkten am Premierenabend Matthias Körber und Raphael Naveau noch etwas schüchtern mit.

Unter der musikalischen Leitung von Bruno Weil bewies das Bruckner Orchester Linz wieder einmal mehr, dass es zu den führendsten Orchestern Österreichs zu zählen ist. Die ständigen Wechsel zwischen deklamatorischen, dramatischen und lyrischen Passagen wurden besonders plastisch heraus gebildet und auch die Gefühlslagen der handelnden Personen säuberlich modelliert. Bemerkenswert erklang auch das feine klagende Halbtonmotiv, welches in jedem Akt als ein Moment der Erinnerung wiederkehrt. Und besonders prächtig fiel auch das Gewitter zu Beginn des dritten Aktes aus, welches zugleich den inneren Konflikt Médées vor dem Mord an ihren beiden Söhnen vermitteln soll. Elena Pierini hatte den spielfreudigen Chor des Landestheaters Linz auf diesen höchst erfreulichen Premierenabend bestens vorbereitet. Das Premierenpublikum wurde von dem entfachten musikalischen wie szenischen „Weltenbrand“ förmlich mitgerissen und bejubelte die Produktion. Wie lange der Applaus gedauert hatte, entzieht sich dem zum Zug nach Wien eilenden Rezensenten! Ein Besuch dieser spannenden Produktion kann nur empfohlen werden!
Harald Lacina, 7.5.2019
Fotocopyright: Reinhard Winkler
George Gershwin
EIN AMERIKANER IN PARIS
22.03.2019
TRAILER
Der Film Ein Amerikaner in Paris, mit der fesselnden Musik von George Gershwin und der kongenialen Choreographie des Hauptdarstellers Gene Kelly, sorgte 1952 für Furore und wurde mit 8 Oscars, darunter bester Film und beste Filmmusik, ausgezeichnet. Es sollte 63 Jahre dauern, bis die Bühnenversion des Stoffes 2014 am Theatre de Chatelet in Paris seine Uraufführung erlebte. Die Originalnummern aus dem Film – Gershwins Songs „I Got Rhythm“, „‚S‘ Wonderful“, „Stairway to Paradise“, sowie Teile aus seinem Concerto in F und sein, wie er es nannte, „Rhapsodisches Ballett“ An American in Paris – wurden dafür durch weitere Nummern aus dem Schaffen des schon 1937 viel zu früh verstorbenen Komponisten ergänzt. Ein Jahr später war dann der Broadway an der Reihe, die europäische Musical-Hauptstadt London folgte 2018. Im selben Jahr – November des Vorjahres – feierte auch die erste deutschsprachige Version ihre Premiere: Nicht in Hamburg, wie man vielleicht vermutet hätte, sondern in Linz! Berichtet wird von der ausverkauften letzten öffentlichen Vorstellung. Die beiden im Mai folgenden Termine sind geschlossene Veranstaltungen.

Die Handlung der von Craig Lucas gebastelten Handlung ist recht banal und nicht ohne Kitsch à la Hollywood. Die einzigartige, Jazziges und Klassisches in einer unverwechselbaren Mixtur verbindende Musik George Gershwins jedoch punktet auf allem Linien und sorgt für elektrisierende Spannung bis zur letzten Minute. Die temporeiche und tanzintensive Show rund um Kunst, Freundschaft und Liebe – Regie und Choreographie von Nick Winston – bleibt so stets am Laufen, was besonders nach der Pause, wenn die Balletteinlagen – bis hin zu einem fulminanten Stepptanz – dominieren, besonders nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Als Hintergrund stets präsent sind die Straßen und Plätze der Seinemetropole. Die Ausstattung – Bühne von Charles Quiggin, Lichtdesign von Michael Grundner und Videodesign von Duncan McLean – sorgt dank perfekter Bühnentechnik im Nu für das jeweils passende Ambiente. Nicht ganz so zufriedenstellend und ziemlich uneinheitlich sind hingegen die Leistungen der Akteure.

Im Mittelpunkt stehen ambitionierte junge Künstler aus der Pariser Bohème sowie zwei Kollegen aus den Vereinigten Staaten, die es infolge des Zweiten Weltkriegs nach Paris verschlagen hat und dortgeblieben sind. Der junge amerikanische Kriegsveteran Jerry, ein ebenso talentierter wie ambitionierter Kunstmaler, verliebt sich Hals über Kopf in die Parfümerieverkäuferin und aufstrebende Tänzerin Lisa, für die sich auch ein amerikanischer Komponist namens Adam sowie Henri, ein Sprössling aus reichem Haus, mit vor seiner Mutter geheim gehaltener Berufung zum Chansonnier, interessieren. Eine liebeshungrige amerikanische Millionärin und Kunstmäzenin verkompliziert dieses ohnehin schon rechte komplizierten Beziehungsverhältnisse. Besonderen Reiz verströmt das Lied „S‘ Wonderful“, in dem jeder der drei Verehrer von seiner Liebe schwärmt und keiner ahnt, dass alle Beteuerungen derselben Frau, nämlich Lisa, gelten. Alle Songs werden im Übrigen mit den englischen Originalteten gesungen.

Gernot Romic, am Performing Arts Studio in Wien ausgebildet, hat sein Können in vielen Produktionen in Stockerau, Graz und Wien unter Beweis gestellt. Er ist als Jerry ein sicherer Sänger und exzellenter Tänzer, doch es fehlt ihm für diese Rolle etwas, nämlich Ausstrahlung, Charisma, Bühnenpräsenz. Diesmal hat er diese Eigenschaften, sollte er sie haben, jedenfalls nicht ausgepackt.
Sein ernstzunehmender Rivale um die Gunst Lisas ist Henri. Christian Fröhlich hat einen starken Erstauftritt mit dem großartigen Song „I Got Rhythm“, bleibt dann aber der stets schüchterne, gegenüber seiner Mutter und Lisa nie ganz offene junge Mann, der seine wahre Leidenschaft unterdrücken muss. Umso größer dann die Überraschung, als er schließlich im Cabaret Montmartre „Stairways To Paradiese“ zum Besten gibt, alle Gehemmtheit über Bord wirft und endlich wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser schwimmt.

Christof Messner als Komponist Adam Hochberg hat im Wettstreit um die Zuneigung von Lisa die schlechtesten Karten. Dass er der geniale Komponist der zu hörenden Songs ist, will man ihm nicht so recht abkaufen. Es soll freilich auch bescheidene, unauffällige Künstler geben. Sympathisch ist er allemal.
Für musikalischen – musicalhaften – Glanz sorgt glücklicherweise Myrthes Monteiro, die international bewährte Darstellerin der Lisa. Hier ist alles vereint, was einen Musicalstar von Format ausmacht, und Tanz, Gesang, Schauspiel bilden in ihrer Performance eine bezwingende Einheit.
Daniela Dett verleiht der Rolle der Kunstsponsorin Milo Davenport eine souveräne Note. Linsey Thurgar als Madame Baurel bereichert – mit eigenwilliger Erscheinung und karikierendem französischem Akzent – die Aufführung, indem sie für komische Momente sorgt.

Alles in allem: Das Landestheater Linz scheint auf dem besten Weg, sich als eine bemerkenswerte Bereicherung der österreichischen Musicalwelt zu etablieren. Auch die auf An American in Paris folgende Produktion des Musicals Ragtime war und ist ein Renner bei Presse und Publikum – der online Merker berichtete darüber. Das ist nicht zuletzt das Verdienst von Tom Bitterlich, seit der vergangenen Saison Musikalischer Leiter der Musicalsparte des Hauses, der dort auch schon Hairspray, Blue Eyes, Forever Young und Lazarus von David Bowie dirigiert hat. Auch diesmal hat er alles im Griff, und das Bruckner Orchester, das im Alltag gewiss andere musikalische Kost gewöhnt ist, swingt, dass es eine Freude ist.
Manfred A. Schmid 23.3.2019
Besonderen Dank an unseren Kooperatinspartner MERKER-online Wien
Bilder (c) Barbar Pálffy
OPERNFREUND FILMTIPP dazu

Da die DVD einzeln unverschämt teuer ist, empfehlen wir diese Variante für 13 Euro aktuell bei Amazon - mit gleich beiden großen Klassikern. P.B.
TRISTAN UND ISOLDE
Aufführung am 30.9.2018
(Premiere 15.9.2018)
Eine 25 jährige Kultinszenierung auf dem Prüfstand

Die Wiederaufnahme der inzwischen schon zum Kult gewordenen Inszenierung des ostdeutschen Schriftstellers Heiner Müller für die Bayreuther Festspiele 1993 erfolgte im Vorjahr in Lyon. Im Stile Brechts hatte Heiner Müller (1929-95) seinerzeit eine der größten Liebesgeschichten der Opernliteratur radikal und konsequent entschlackt und gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Erich Wonder in völlig abstrakt angeordnete Räume platziert. Der eng begrenzte Raum Isoldes in einem abgesenkten Viereck des Bühnenbodens mochte wohl seine Anklänge im stilisierten japanischen Theater gehabt haben. Im zweiten Akt stellte er dann eine Reihe von Brustharnischen auf die Bühne, schließlich sind wir ja bereits in Markes gut bewaffnetem Land, und beließ den dritten Akt in tristem Grau, wobei sich die einzige Auftrittsmöglichkeit für die Sänger in der hinteren Bühnenmitte befand. Die Farben der jeweiligen Akte braun und gelb für den ersten, blau in allen Schattierungen für den zweiten und schließlich grau für den dritten Akt, dürften dem abstrakten Expressionismus von Mark Rothko (1903-70) und dem Formalismus von Piet Mondrian (1872-1944) verpflichtet gewesen sein.

Allerdings dämmert bei Isoldes Schwanengesang am Ende doch ein hoffnungsvolles Gold an den Wänden und ihrem Kostüm auf. Das, was man nicht unbedingt sehen muss, ließ Heiner Müller, gemäß dem Credo von Wieland Wagner, einfach weg. Und so gibt es in seiner Inszenierung auch keine Flöte für den Hirten, keinen Wachtturm für Brangäne und auch keine Matrosen auf der Bühne. Der 1943 geborene japanische Modedesigner Yohji Yamamoto entwarf, dem Wunsche Heiner Müllers folgend, bewusst einfache dunkle Kostüme, die eine Distanz zu der ohnehin überhitzten Gefühlsebene der Oper aufbauen sollten. Besonders symbolträchtig waren die durchsichtigen Halskrausen, die wohl die Gefangenschaft der Protagonisten einerseits in ihrem feudalen Gefüge, andererseits aber in ihrer eigenen Vorstellungwelt versinnbildlichen sollten. Erst nachdem beide den vermeintlichen Todes-, in Wirklichkeit aber Liebestrank genossen haben, gelingt es ihnen, aus ihrer gesellschaftlichen Verankerung ausbrechen und so verschwinden diese Halsringe dann auch im zweiten Akt. Für Lyon bzw Linz hat Stephan Suschke, seinerzeit in Bayreuth der Regieassistent von Heiner Müller und derzeitiger Schauspielchef des Landestheaters Linz, die Inszenierung rekonstruiert.

Die Realisierung der von Erich Wonder entworfenen Bühnenbilder sowie des von Manfred Voss vorgesehenen Lichtdesigns erfolgte durch Kaspar Glarner und Ulrich Niepel. Gesungen und agiert wurde in Linz auf der den engeren Verhältnissen von Bayreuth bzw. Lyon angepassten Bühne. Das Geschehen entrollt sich dabei während der drei Akte hinter einem durchsichtigen Gazevorhang. Heiko Börner (Tristan) hielt sich im ersten Akt zurück, drehte dann im zweiten Akt zu voll auf und sang im dritten Akt für mein Empfingen etwas zu verquollen. Für die Rolle der Isolde musste kurzfristig Ruth Staffa einspringen, die ihre erste Isolde 2011 am Staatstheater Mainz gesungen hatte. Ihr satter Sopran entfaltete nach kurzen Anlaufschwierigkeiten zu vollendeter Größe im zweiten Akt, wo sich die Liebenden bei Heiner Müller auch erstmals etwas näher kommen dürfen. Ihren finalen Abgesang aber zierten einige unschöne Klangfarben. Für die Rolle der Brangäne hatte die junge amerikanische Mezzosopranistin Katherine Lerner noch eine vielleicht etwas zu lyrische Stimme, welche sich erst im zweiten und im dritten Akt zu eindrucksvollem strahlenden Schönklang formen wollte. Solide wie gewohnt Dominik Nekel mit seinem profunden Bass in der Rolle des bemitleidenswerten Hahnreis König Marke.

Die eindrucksvollste Leistung dieses Abends aber bot zweifellos in gesanglicher wie in darstellerischer Hinsicht Bassbariton Martin Achrainer. Obwohl er gleich zu Beginn weit hinten auf der Bühne singen musste, wirkte sich dieses Manko nicht hörbar auf seine stupende Wortdeutlichkeit und hohe Gesangskultur aus. Matthäus Schmidlechner unterlegte den Intriganten Melot mit seinem erstklassigen Tenor. Philipp Kranjc verlieh dem Steuermann seine Stimme und Matthias Frey sang noch die kleinen Rollen des jungen Seemanns und des Hirten, wo bei er als Hirte im dritten Akt gleich dem blinden antiken Seher Teiresias mit verdunkelter Brille auf einem schäbigen Endzeitsofa sitzt. Der in dieser Inszenierung nicht sichtbare Herrenchor des Landestheaters Linz wurde von Csaba Grünfelder bestens einstudiert. Markus Poschner sorgte am Pult des Bruckner Orchesters für eine ausgewogene Balance zwischen Bühne und Graben und kostete die narkotische Wirkung, die Wagners Musik gerade in dieser Oper verströmt und alle in den Bann zieht, formvollendet aus. Das Publikum dieser Derniere schenkte allen Mitwirkenden großzügig Applaus, dem sich der Rezensent gerne anschloss.
Harald Lacina, 1.10.2018
Fotocredits (c) Reinhard Winkler
TRISTAN UND ISOLDE
Premiere am 15. September 2018
Im Jahre 1993 erlebte die legendär gewordene Inszenierung von Heiner Müller, seine erste und damit auch letzte Opern-Inszenierung überhaupt, bei den Bayreuther Festspielen in den Bühnenbildern von Erich Wonder, den Kostümen von Yohji Yamamoto und im hier besonders bedeutsamen Lichtdesign von Manfred Voss unter der Stabführung von Daniel Barenboim ihre Premiere. Für mich war diese Produktion von Wagners „Tristan und Isolde“, die er selbst als „Eine Handlung in drei Aufzügen“ bezeichnete, das Beste was damals für längere Zeit in Bayreuth zu sehen war. Das ist nun 25 Jahre her, und der damalige Assistent von Müller, Stephan Suschke, seit einiger Zeit Schauspieldirektor am Musiktheater Linz, bekam vom Intendanten der Opéra de Lyon, Serge Dorny (der bald die Bayerische Staatsoper übernehmen wird), im Dezember 2015 einen Anruf. Dorny unterbreitete ihm seinen Plan einer Rekonstruktion dieser Produktion auf der Bühne in Lyon, die nun auch ihren Weg nach Linz ins Landestheater fand.
Natürlich ist die Ausgrabung einer Musiktheater-Produktion, zumal nach einem Vierteljahrhundert, wie gut sie auch immer gewesen sein mag, in mancher Hinsicht fragwürdig. Sofort stellen sich Gedanken ein wie Festhalten an Liebgewordenem (wie die „Ring“-Inszenierungen von Götz Friedrich in Berlin und Otto Schenk in New York), statisches oder gar museales Denken gegenüber der nicht zuletzt aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus notwendigen Weiterentwicklung des Musiktheaters, bisweilen gerade bei Wagner auch als gutes oder schlechtes „Regietheater“ wahrgenommen, oder das retrograde Frönen eines Kultes bis hin zur Kultur-Archäologie. Man denke nur an die diesbezüglichen Diskussionen um den Wiederaufbau des Berliner Schlosses vor einigen Jahren.
Nun gut. Stephan Suschke hat sich natürlich diese Gedanken gemacht, aber sie mit überzeugenden Argumenten - und die außerordentliche Qualität der Inszenierung von Heiner Müller machte das natürlich leichter - konterkariert. So sehen sich heute Menschen in Museen Bilder aus Zeiten an, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Und gute Filme der 1950er und 60er Jahre begeistern noch heute (und wohl auch in Zukunft) nicht nur Cineasten. So nahm er das Angebot von Dorny an und der Müller-„Tristan“ kam mit Erfolg auf die Bühne der Opéra de Lyon, ein Haus, welches ohnehin durch eine interessante Wagner-Pflege in den letzten Jahren nicht nur in Frankreich auffiel.
Und auch in Linz kam die Inszenierung bei Premierenpublikum gut an. Da ja das Regietem nicht mehr vor dem Vorhang erscheinen konnte, wurde dies nicht zuletzt auch an dem überschwänglichen Applaus für Erich Wonder deutlich, als er bei der sehr zahlreich besuchten Premierenfeier auf das Podium trat. Das war ein ganz großer Augenblick dieses Abends. Auch Stephan Suschke wurde neben den Sängern und dem Linzer GMD Markus Poschner mit großem Beifall bedacht. Man hatte die Aufführung bei glücklicherweise gutem Wetter sogar in den Park vor dem Musiktheater auf eine Leinwand übertragen, wo es für das zahlreich erschienene Publikum in den Pausen auch Interviews gab, eines mit Markus Poschner. So erlebten etwa 2.400 Menschen diese Premiere des „Tristan“, wie Intendant Hermann Schneider später sagte.
Für Heiner Müller ist die „Tristan“-Musik, wie er in einem kurzen Aufsatz im Programmheft mitteilt, „eine ungeheuer theatralische Musik, ihr Wesentliches liegt im Schauspielerischen.“ Und „die Musik übernimmt bei Wagner die Funktion der Maske in der griechischen Tragödie.“ Und diese war bei beim Bayreuther Meister ja bekanntlich die Grundlage seines Opernschaffens. Diese darstellerische Archetypik hat Müller mit einer eher statisch konzipierten Personenregie und -bewegung verdeutlicht, die zeitweise an jene von Robert Wilson erinnert, der farb- und lichtästhetisch ähnlich inszeniert. Die Figuren bewegen sich bei Müller deutungsschwer meist nebeneinander, gewissermaßen forciert emotionslos. Denn gerade im 2. Aufzug wird die höfische und damit durch strenge gesellschaftliche Konventionen bis hin zu militärischen Zwängen begrenzte Liebe Tristans und Isoldes durch etwa 250 in militärischer Reih‘ und Glied aufgestellte Brustpanzer nahezu völlig unterdrückt. Suschke sieht nach Müller in diesen Brustpanzern auch „eine im Erdreich versunkene Armee, die das ‚Lager‘ für Tristans und Isoldes Liebe bietet, aber auch einen Verweis auf die Beziehung zwischen Tristan und Marke.“ Das alles hat Erich Wonder mit seinen kubischen und meist auf der Form des Quadrates aufbauenden Bühnenbildern mit der dramaturgisch außerordentlich bedeutsamen Farbgebung von Wolfgang Voss in einen stets eindrucksvollen und assoziationsreichen Rahmen gestellt - im wahrsten Sinne des Wortes.
Im kalten Blau des 2. Aufzugs entwickelt sich die Liebe zwischen Tristan und Isolde in „gesellschafticher Kälte“. Starrheit und Unnahbarkeit der Figuren werden optisch noch durch die Kostüme Yamamotos gesteigert. Sie wirken wie gepanzert mit übergroßen Schultern, auf denen sich jede Berührung unterbindende Spangen befinden, die erst im 2. Aufzug bei den beiden Titelfiguren verschwinden. Hier ist ihnen eine kurze intime Annährung und somit der Sündenfall vor Marke und der Gesellschaft sowie der auch militärisch aufgeladenen Beziehung Tristans als Vasall Markes in einem Moment völliger Dunkelheit möglich. Dazu singt Brangäne passend ihren Weckruf. Ein unglaublich starker Moment, der umso intensiver mit der dann folgenden Offenbarung bei grellem Licht kontrastiert!
Im 1. Aufzug konnten noch goldene bis rötliche Töne in den Rechtecken von Manfred Voss die Entwicklung einer Liebe andeuten, wenngleich damit auch schon herbstliche Assoziationen anklangen - also schon vor Beginn ein Zuendegehen eines beglückenden Sommers, der aber nie stattgefunden haben wird. Das immer näher kommende Haupt Markes mit der Königskrone wirft am Schluss des 1. Aufzugs einen bedrückenden Schatten auf die völlig entrückten Tristan und Isolde. Die beiden Wasser andeutenden Lichtleisten links und rechts im Kubus standen in Linz im Unterschied zur Bayreuther Fassung leider still. Ich kann mich erinnern, dass die Assoziation mit den Meereswellen der Schifffahrt nach Irland damals auch deshalb so stark war, weil es ansonsten wenig Bewegung gab.
Im 3. Aufzug ist dann alles in einem tristen Trümmergrau mit ebensolchen auf der gesamten Bühne zerstört. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht wurde diese Trümmerästhetik mit dem Fall der Mauer (Wolfgang Wagner bot Müller den „Tristan“ kurz nach deren Fall an) und der im Sinne des in der damaligen DDR lebenden Schriftstellers nicht unbedingt positiv bewerteten „Wiedervereinigung" assoziiert. Nahe lag es aus damaliger Sicht schon, und das macht einmal mehr die Problematik des Wiederbelebens einer Opernproduktion deutlich, die zur Zeit ihrer Entstehung einen nachvollziehbaren und in diesem Falle auch sinnhaftenden Gegenwartbezug hatte.
Wen man den Müller-„Tristan“ in Bayreuth erlebt hat, hat sich natürlich auch das Tandem Siegfried Jerusalem und Waltraud Meier in das Gedächtnis eingebrannt, die beide damals wahrlich Erstklassiges leisteten, sowohl in darstellerischer wie in stimmlicher Hinsicht. Es gibt nicht viele, die diese fordernden Rollen heute singen (können). Dennoch ist dem Musiktheater Linz eine weitgehend gute Besetzung gelungen. Heiko Börner debutierte wie Annemarie Kremer mit der Rolle und hatte schon einige Erfahrung im Wagner-Fach mit Tannhäuser, Lohengrin, Erik, und Walther von Stolzing an mittleren Häusern. Börner ist jedoch nicht unbedingt ein Sympathieträger als Tristan. Seine Mimik gibt nicht die Intensität der Gefühle wieder, denen der Titelheld ausgesetzt ist, was sich insbesondere im 2. Aufzug zeigt. Bis zu einem gewissen Grad kann dies aber auch den Anweisungen des Regieteams geschuldet sein, wenngleich Isolde hier viel intensiver agierte. Börners Timbre ist stark baritonal gefärbt. Es fehlt der Stimme an tenoralem Glanz und auch etwas an Resonanz. In den dramatischeren Passagen muss er auch auf Kraft singen. Der Tristan ist sicher eine Grenzpartie für Heiko Börner.
Annemarie Kremer, seit langem im schweren Fach als Salome und Tosca bekannt und mit einer Elisabeth in Monte-Carlo auch etwas Wagner-erfahren, aber sicher keine Hochdramatische, lieferte ein beachtliches Debut als Isolde, obwohl auch diese Rolle für sie eher eine Grenzpartie ist. In der Mittellage mit schönem Timbre und leuchtendem Sopran erklingen Phrasen wie „Er sah mir in die Augen…“ und auch der Liebestod durchaus eindrucksvoll. Die Stimme hat aber relativ wenig Tiefe und auch in der Höhe, wie bei den beiden hohen Cs im 2. Aufzug, werden Mängel hörbar. Hinzu kommt eine wirklich verbesserungswürdige Diktion - man verstand meist fast gar nichts. Dafür gestaltet sie die Isolde mit großartiger Ausdruckskraft und Emphase und wurde im Laufe des Abends auch stimmlich besser.
Dshamilja Kaiser hingegen konnte auf allen Noten mit einem klangvollen und leuchtenden Mezzo sowie sauberer Intonation mehr als überzeugen. Ihre Stimme weist zudem guten Aplomb auf und ist sehr wortdeutlich. Zeitweise klang sie damit größer als jene von Kremer, zumal zu Beginn des 2. Aufzugs. Auch Martin Achrainer als Kurwenal kann mit einem bestens geführten Bariton bei guter Resonanz und Diktion beeindrucken. Dominik Nebel singt den König Marke mit einem eher baritonal klingenden Bass und guter Diktion, aber doch zu geringem Volumen und nicht allzu starker Höhe. Matthäus Schmidlechner ist ein guter Melot, und die Stimme von Mathias Frey als Steuermann und Hirte, in dieser Inszenierung zu völliger Untätigkeit verdammt, ist für diese Rollen etwas zu klein. Philipp Kranjc gibt den wie immer undankbaren jungen Seemann. Die Herren des Chores und Extrachores des Landestheaters Linz absolvieren ihren Part stimmstark und gut verständlich.
GMD Markus Poschner dirigierte das Wagner-erfahrene Bruckner Orchester Linz und begann das Vorspiel meines Erachtens zu sehr auf plastisch und prägnant. Da fehlte es noch etwas an Mystik und Emotionalität. Zum Ende des 1. Aufzugs unterstrich das Orchester jedoch mit hoher Dramatik das Geschehen auf der Bühne, und Poschner konnte auch die lyrischen Passagen im 2. Aufzug fein ausmusizieren. Damit gab es auch einen berechtigten Auftrittsapplaus für ihn und das Orchester zu Beginn des 3. Aufzugs. Immer wieder imponierte das starke, transparent und facettenreich spielende Streicherensemble. Ein musikalischer Höhepunkt war auch das Englischhorn-Solo von Martin Kleinecke im 3. Aufzug. Insgesamt ein lohnender Wagner-Abend in Linz! Die Aufführungen gehen noch bis 10. Februar 2019.
Fotos siehe Kritik oben !
Klaus Billand NACHTRAG 11.10.2018
Zum Zweiten
Death in Venice
6.7.2018 (Premiere am 19.5.2018)
Ein engagiertes szenisches Konzept
Als Koproduktion mit der Opéra Nice Côte d’Azur und dem Theater Bonn stellte das Landestheater Linz, die 1973 uraufgeführte letzte Oper des englischen Komponisten, basierend auf Thomas Manns Novelle aus dem Jahr 1913, in einer Inszenierung von Intendant Hermann Schneider , die dieser bereits 2016 für Nizza entwickelt hatte, auf die Bühne.
Zwischen seiner ersten Oper, „Peter Grimes“, und seiner letzten, „Death in Venice“, liegen 28 Jahre, in denen sich Brittens musikalischer Stil radikal änderte, indem er atonale Elemente, fernöstliche Harmonien und Gamelan-Klänge einbaute, aber im Wesentlichen dennoch der Tonalität verpflichtet blieb. Hans Schöpflin musste Brittens bisweilen ermüdende Accompagnato-Rezitative mit wenigen ariosen Einsprengseln, die er für den alternden Dichter Gustav von Aschenbach komponiert hatte, mit seinem gut geführten Tenor vortragen. Dieser etwas monoton wirkende, kontemplative Stil dient dazu, die Vereinsamung eines alternden, homosexuellen Schöngeistes zu versinnbildlichen, der sich seiner großen Lebenslüge bewusst ist.

Angesichts der dionysisch-sinnlichen Jugend, wie sie sich für ihn im polnischen Knaben Tadzio manifestiert, sehnt er auf selbstquälerische Weise seinen eigenen Tod herbei. Freilich ist die seelische Zerrissenheit Aschenbachs in der Musik Brittens nur ansatzweise vorgegeben. Kopflastig vollzieht sich seine seelische Aufspaltung in dionysische Zügellosigkeit und apollinische Zucht im gesungenen Text, der über lange Strecken eher philosophisch-esotär dahinplätschert. Darin liegt - meiner Meinung nach - auch die Schwäche des Werks, mag sich auch die musikalische Sprache Brittens in diesem seinem letzten Werk der Sprache Thomas Manns in ihrer vollkommenen Klarheit aufs Engste angenähert haben. Regisseur Hermann Schneider konzipierte das Stück als ein minutiöses Sterben des Dichters Aschenbach in der Maske von Thomas Mann. Als Ort der Handlung wählte Bühnenbildner Bernd Franke die Bibliothek des Dichters von Aschenbach mit einer Nachbildung jenes Schreibtisches, den Thomas Mann einst verwendet hatte.

Die zunächst kleine Bibliothek des Dichters wird aber im Verlauf des Abends aufgebrochen, Licht tritt herein und ein Spalt im Fußboden mag wohl einen Kanal in Venedig symbolisieren. In Aschenbachs Kopf ziehen die Erlebnisse in Venedig langsam vorüber und gemäß den von Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) entwickelten fünf Phasen des Sterbens durchläuft der gepeinigte Dichter all diese Stadien, beginnend mit der Isolierung des Dichters, seines Zornes darüber, nicht Teil des geselligen Treibens um ihn herum sein zu können, des Verhandelns, indem er sich vom Friseur „verjüngen“ lässt, und schließlich, als er die Ausweglosigkeit auch dieser Situation erkennt, seine tiefe Depression und sein Leid, das schließlich in die Zustimmung seines unausweichlichen Unterganges mündet. Die Kostüme von Irina Bartels sind der mondänen Eleganz des fin de siècle des frühen 20. Jahrhunderts verpflichtet.
Britten und seine Librettistin Myfanwy Piper (1911-97) sahen für ihre Oper 17 verschiedene Schauplätze vor, auf die in dieser Inszenierung aber großzügig verzichtet wurde. Dadurch gingen aber insbesondere die Traumsequenzen des Dichters, in denen das apollinische mit dem dionysischen Prinzip ringen, völlig unter. Diesem Manko halfen aber die Video-Projektionen von Paolo Correia, die Ansichten von Venedig zeigen, einigermaßen ab. Brittens Musik wirkt in seiner letzten Oper für den Zuhörer oft kammermusikalisch und manche Rezitative erklingen gar nur mit Klavierbegleitung. Im Unterschied zu früheren Opern gelangt in Brittens letztem Werk aber gleich eine ganze Batterie an Schlagwerk, die fünf Schlagzeuger und ein Pauker bedienen müssen, zum Einsatz: Vibraphon, Xylophon, Marimbaphon, Aeolophon, kleine und große Peitsche und Trommel, Crotales, Gong, Triangel, Glockenspiel, Becken, Tamtam, Tom-Tom, Tamburin, Glockenspiel und Glockenbaum, Windmaschine, Holzblock, O-Daiko und Pauken.

Takeshi Moriuchi, der kommende Saison an die Frankfurter Oper wechselt, führte das Bruckner Orchester behutsam durch die äußerst diffizil ausgestaltete Partitur Brittens und lässt Aschenbachs Tod unter der sanften Begleitung des Glockenspiels leise verklingen. Ivan Alboresis kreierte für Tadzio und seine Freunde eine lebendige Choreographie, die weit davon entfernt ist, pubertierende Knaben mit ihren ausgelassenen Spielen am Stand vorzuführen. Dem spanischen Tänzer Jonatan Salgado Romero war die stumme Rolle des Tadzio anvertraut. Er tanzt natürlich besonders ausdrucksstark und liefert spannende Momente durch sein stummes Mienenspiel mit Aschenbach. Aber ein Knabe ist der seit nunmehr bereits zehn Jahren in Linz engagierte Tänzer gewiss nicht mehr… Ebenso wenig wie Edward Nunes als sein bester Freund Jaschiu und die übrigen Freunde Filip Löbl, Urko Fernandez Marzana und Lorenzo Ruta. Csaba Grünfelder hatte den Chor des Landestheaters bestens auf seine mannigfachen Aufgaben vorbereitet.
Hans Schöpflin hat die Rolle des Gustav von Aschenbach, mit der Britten Gustav Mahler ein musikalisches Denkmal setzen wollte, 2008 bereits in Barcelona interpretiert und 2016 in Nizza. Er singt über weite Strecken äußerst textverständlich und liefert darstellerisch wie stimmlich eine ergreifende Charakterstudie dieses weltfremden Schöngeistes. Als Stimme des Apollo war der britische Countertenor James Laing ebenso bei der Premiere dieser Produktion in Nizza dabei. Als dramaturgisches Gegengewicht zu dem szenebeherrschenden, aber eher besinnlich agierenden Dichter, hatte Bariton Martin Achrainer gleich acht Rollen zu interpretieren, die in schauspielerischer Hinsicht seine ungeheure Wandelfähigkeit unter Beweis stellten.

Offenbar gelang ihm das an diesem Abend so hinreißend, dass die Souffleuse ihre erforderliche helfende Tätigkeit ganz vergaß… Zunächst tritt der als „Reisender“ auf, später als ältlicher Geck und alter Gondoliere, dann wieder als Hotelmanager und als umtriebiger Fremdenführer in Venedig, als schwatzhafter Coiffeur des Hauses, als Führer der Straßensänger und schließlich noch aus dem Off als Stimme des Dionysos. Alle diese Rollen verlangen nach einer unterschiedlichen Gestaltung, wobei es für einen Bariton natürlich eine besondere Kraftanstrengung darstellt, in der Rolle des ältlichen Geck auch im Falsett zu singen… Die übrigen Kleinstpartien wurden von Vaida Raginskytè als deutsche Mutter und Bettlerin, Domen Fajfar als Glasbläser und Straßensänger, Jochen Bohnen als deutscher Vater, Ulf Bunde als englischer Angestellter im Reisebüro, Joschko Donchev als Schiffssteward und Restaurantkellner, Theresa Grabner als Zeitungs- und Erdbeerverkäuferin sowie als Straßensängerin, Boris Daskalov als russischer Vater, Tomaz Kovacic als polnischer Vater, Priester in San Marco und Gondoliere, Ran Seo-Katanic als dänische Frau, Kateryna Lyashenko als russische Mutter, Gabriele Salzbacher als englische Frau, Kathleen Louisa Brandhofer als französisches Mädchen, Margaret Jung Kim als Spitzenverkäuferin, Isabelle Wernicke-Brincoveanu als französische Mutter, Joanna Müller als russisches Kindermädchen, Mathias Frey als Hotelportier, Ville Lignell als Bootsmann am Lido und Hotelkellner, Jin Hun Lee als Gondoliere, Bonifacio Galván als Amerikaner und Gondoliere, Jonathan Whiteley als weiterer Amerikaner.

Die stummen Rollen wurden von Anna Hinterreiter-Lyubavina als die polnische Mutter von Tadzio samt ihren beiden Töchtern, Paula Kernreiter und Paula Rosenauer, sowie der Erzieherin, Tatiana Pichler, allesamt Mitglieder der Statisterie des Landestheaters Linz, bekleidet. Die Derniere wurde vom Publikum mit stürmischem Applaus bedacht. Intendant und Regisseur Hermann Schneider ergriff die Gelegenheit, drei verdiente Chormitglieder anlässlich ihres Ruhestandes gebührend zu bedanken und dem Dirigenten Takeshi Moriuchi alles Gute für seine weitere berufliche Laufbahn an der Oper Frankfurt zu wünschen.
Harald Lacina, 7.6.2018 Fotocredits: Sakher Almonen
DEATH IN VENICE
22. 5. 2018 (2. Vorstellung nach der Premiere vom 19. 5. 2018)
Konsequent, aber zu einengend inszeniert

Linz hat keine große Erfahrung mit Benjamin Brittens musikdramatischen Werken. Da gab es bisher nur 1958 die Bettleroper und dann 2014 in der (nur 270 Plätze fassenden) Blackbox The Turn of the Screw. Seit der Spielzeit 2016/17 ist Hermann Schneider Intendant des prächtigen neuen Linzer Musiktheaters - und er hat erstmals Benjamin Brittens Death in Venice in Linz auf die große Bühne gebracht. Es ist dies eine Inszenierung, die Hermann Schneider selbst unmittelbar vor Beginn seines Linzer Wirkens im Jänner 2016 für Nizza entwickelt hatte. Diese Inszenierung wird weiter nach Bonn wandern und ist nun für acht Aufführungen in Linz zu sehen - aber nicht nur das szenische leading team ist gleich wie an der Opéra de Nice, auch der Dirigent und zwei Hauptdarsteller waren schon in Nizza dabei.
Leicht hat es Benjamin Britten (1913-1976) ja seinem Publikum nicht gemacht: “Tod in Venedig” nach der Novelle von Thomas Mann ist Brittens letztes Bühnenwerk und wird gerne als “sperrig und nicht leicht zugänglich” beschrieben. Wohl deshalb wird es auf europäischen Bühnen bis heute nur wenig gespielt: Operabase weist seit dem Jahre 2000 nur 38 Aufführungen in 5 Städten aus.
Hermann Schneider und sein Team haben ein konsequentes und im Programmheft schlüssig begründetes Konzept entwickelt: Das Stück spielt ausschließlich in der Arbeitsbibliothek des Schriftstellers Gustav Aschenbach, dessen Figur in der Maske deutlich Thomas Mann nachempfunden ist - und dessen Schreibtisch ein minutiöses Abbild des Schreibtisches von Thomas Mann ist. Das gesamte Stück ist als Sterbeprozess des Dichters angelegt, wobei sich die Dramaturgie auf das Phasenmodell des Sterbens beruft, das die weltberühmte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gerade zu jener Zeit entwickelt hatte, in der Benjamin Britten seine Oper schrieb.
Die Arbeitsbibliothek weitet sich im Laufe des Abends, es hebt sich die Decke des Raums, Licht strömt herein, es bildet sich im Boden ein Spalt, den man als Kanal deuten kann und die Wände werden brüchig. Die Venedig-Erlebnisse des Dichters spielen sich offenbar nur in seinem Kopf als Lebenserinnerungen oder Lebenswünsche ab, die im Sterbeprozess nochmals lebendig werden, bunte Gestalten kommen in das sich auflösende Arbeitszimmer. Aschenbach stirbt bereits zu Beginn - und dieser Tod wiederholt sich immer wieder von Szene zu Szene.

Wenn man dieses Konzept vor der Aufführung in der klugen Stückeinführung durch den Dramaturgen Christoph Blitt vermittelt bekommt und dann auch im Programmheft nachliest, dann überzeugt das zunächst durchaus. Aber wenn man es dann auf der Bühne sieht, dann muss man doch registrieren, dass es zwar eine geistvoll ausgedachte Idee ist, der aber in der praktischen Umsetzung die gerade bei diesem Stück unverzichtbare Mehrdeutigkeit und Doppelbödigkeit und vor allem die theatralische Kraft fehlt. Der große Bühnenraum des Linzer Musiktheaters wird durch eine Guckkastenbühne eingeengt, die Figuren haben gerade ausreichend Platz um aufzutreten, aber die Weite der traumhaften Illusion fehlt. Britten und seine Librettistin haben eigentlich 17 verschiedene Schauplätze vorgesehen - diese fallen in diesem Konzept völlig weg, dadurch leidet die Verständlichkeit des Handlungsfortganges. Ein konkretes Beispiel: die Auseinandersetzung zwischen den Göttern Dionysos und Apollo, die Aschenbach im Traum erlebt, ist optisch überhaupt nicht gelöst. Apollo tritt in der Maske Aschenbachs auf - man versteht, was gemeint ist: das Apollinische ist ebenso ein Teil des Dichters wie das Dionysische. Das ist gescheit ausgedacht, aber nicht bühnenwirksam und das Publikum ist zunächst verwirrt, weil man die Figuren ganz einfach nicht auseinanderhalten und die Verdoppelung der Traumsituation nicht erkennbar ist

Die zahlreichen Nebenfiguren wirken nie mysteriös-skurril, sondern treten immer eher bieder-gegenständlich auf und auch wieder ab - da entwickelt sich nie jene irreal-traumhafte Stimmung, die im Stück und in der Musik angelegt ist. Auch Aschenbach und sein diabolischer Gegenspieler, der sich vom Reisenden in vielfältige Figuren bis zum Dionysos wandelt, sind immer eher eindimensionale Gestalten und können szenisch das Doppelbödige des Stücks nicht glaubhaft vermitteln. Und noch ein Einwand: der polnische Junge Tadzio, auf den sich Aschenbachs Begehren richtet, sollte wohl im pubertären Alter sein - am Übergang zwischen Kind und jungem Mann. In dieser Produktion ist die Rolle mit einem - ohne Frage exzellenten - Tanzsolisten besetzt. Jonatan Salgado Romero ist seit 10 Jahren in Linz engagiert - er ist ein viriler junger Mann, aber eben kein Knabe. Das gilt übrigens auch für seine vier Freunde, alle so wie er Mitglieder des Tanzensembles des Landestheater - vielleicht wäre es rollendeckender gewesen, hätte man Knaben der Tanzakademie eingesetzt.
 Über die musikalische Seite der Aufführung ist hingegen nur Positives zu berichten:
Über die musikalische Seite der Aufführung ist hingegen nur Positives zu berichten:
Hans Schöpflin ist ein überaus erfahrener Interpret der zentralen Rolle des Aschenbach. Schon vor 10 Jahren war er in dieser Rolle in Barcelona erfolgreich. Seine klare Stimme ist für die Partie ideal geeignet - er gestaltet die Rolle musikalisch hervorragend. Schöpflin war ebenso wie der Interpret des Apollo bereits bei der Premiere in Nizza dabei. Apollo ist der englische Countertenor James Laing - auch er ist ein optimaler Vertreter seines Fachs. Britten und seine Librettistin Myfanwy Piper haben eine sehr wirkungsvolle Lösung entwickelt, um ein gewisses dramturgisches Gegengewicht zu der das ganze Stück beherrschenden Figur von Aschenbach zu schaffen: sie haben die vielen diabolisch-mehrdeutigen Gestalten, denen Aschenbach in Manns Erzählung begegnet, ein- und demselben Sänger anvertraut. Der beliebte Linzer Hausbariton Martin Achrainer - gerade erst als Eugen Onegin erfolgreich - sang seine Partie mit gebührender stimmlicher Charakterisierungskunst.
In den über zwanzig Kleinstpartien bewährten sich Ensemble- und Chormitglieder. Der Chor (Einstudierung: Csaba Grünfelder) macht seine Sache sehr gut und ambitioniert. Der international bewährte Dirigent Roland Böer kann durchaus als ein Spezialist für Benjamin Britten bezeichnet werden. Mit dem sehr gut disponierten Bruckner-Orchester-Linz sorgte er nicht nur für große Präzision, sondern vor allem für einen sehr schönen und warm-ausgewogenen Orchesterklang. Ich gestehe allerdings, ich hätte mir ein wenig mehr Schärfe und Kantigkeit bei der Wiedergabe der komplexen Britten-Partitur gewünscht.

Ich komme zum Beginn meines Berichtes zurück: Linz hatte bisher wenig Erfahrung mit dem musikdramatischen Werk von Benjamin Britten. Dies merkt man auch an den Publikumsreaktionen: wohl aufgrund der durchgehend positiven Kritiken über die Premiere war bei der zweiten Aufführung der Neuproduktion das Linzer Musiktheater sehr gut besucht - allerdings verließ ein großer Teil des Publikums in der Pause die Vorstellung - so wie dies übrigens laut Presseberichten bereits bei den Premieren in Linz und auch in Nizza geschehen war. Schade - denn der 2.Teil war insgesamt spannender in Szene gesetzt als der Anfang und die großartige musikalische Wiedergabe lohnt unbedingt den Besuch
Und noch eine persönliche Anmerkung:
Die Beurteilung von Opernaufführungen beruht zu einem wesentlichen Teil auf Vergleichen. Ich konnte nicht nur die österreichische Erstaufführung von Brittens Tod in Venedig im Jahre 1974 in Graz besuchen, sondern im Vorjahr auch über die Stuttgarter Neuinszenierung berichten (Wer Interesse hat, kann hier meinen Opernfreund-Bericht vom 7. 5. 2017 nachlesen). Aus diesen Erfahrungen und nach dem Besuch vieler Britten-Aufführungen in Wien und Graz komme ich diesmal speziell bei der szenischen Umsetzung zu einer anderen Einschätzung als die anderen Premieren-Berichte.
Aber wie auch immer: die Linzer Produktion sollte besucht werden - zu selten hat man die Chance, Brittens letzte Oper zu erleben!
Hermann Becke, 23.5.2018
Aufführungsfotos: Landestheater Linz, © Sakher Almonem
Hinweise:
- Noch 6 weitere Vorstellungen bis Anfang Juli
- Das ausführliche Radiointerview zu Stück und Produktion mit dem Linzer Musikdramaturgen Christoph Blitt ist allen Britten-Interessierten zu empfehlen
- Und noch eine Kuriosität: das Linzer Musiktheater bietet bisher keinen Trailer der Britten-Neuproduktion an. Dafür steht Venedig aber derzeit doppelt auf dem Linzer Spielplan - neben Brittens Tod in Venedig gibt es auch Eine Nacht in Venedig von Johann Strauss. Anfang Juni stehen beide Stücke sogar an aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm. Von der Operetten-Produktion gibt es einen Trailer - der beginnt mit den Worten: Setzt eine Maske auf und lasst euch verzaubern. Ob dies im Operetten-Venedig gelungen ist, kann ich nicht beurteilen - bei Britten vermisste ich jedenfalls szenischen Zauber.
EUGEN ONEGIN
14.4. (Premiere)
Psychologisch ausgefeilte Interpretation
Nach einem gemeinsamen Libretto des Komponisten und Konstantin Stepanovich Shilovsky (1849-93), das auf der Vorlage von Alexander Puschkins Versroman „Eugen Onegin“ beruht, komponierte Peter Iljitsch Tschaikowsky seine gleichnamige Oper mit dem Untertitel „Lyrische Szenen“. Die Uraufführung fand am 29. März 1879 im Moskauer Maly-Theater unter der Leitung von Nikolai Grigorjewitsch Rubinstein (1835-81) und wurde von Studenten des Moskauer Konservatoriums aufgeführt. Während im Roman Puschkins die kulturelle Situation im Russland um 1820 am Leben junger Adeliger in Moskau und St. Petersburg sowie auf deren Landgütern mit ihren alten Traditionen abgehandelt wird, verkürzte Tschaikowsky die Vorlage auf eine romantische Liebesgeschichte unter fast völliger Ausklammerung der gesellschaftlichen Vorgänge zur Zeit der beiden Zaren Alexander I. (1777-1825) und Nikolaus I. (1796-1855).

In Linz leitete der 1983 in Sri Lanka geborene Leslie Suganandarajah, der dem Landestheater Linz seit der Spielzeit 2017/18 als 1. Kapellmeister angehört, nun erstmalig das Bruckner Orchester Linz bei einer Premiere. Er setzte dabei auf eher moderate, bisweilen sogar etwas zu sehr gedehnte Tempi, fand aber schließlich nach der Pause zu einem aufwallenden und formvollendeten Finale. Der erste Teil des Abends endete übrigens mit der Aufforderung zum Duell, sohin mitten im zweiten Akt. Das Duell findet dann handlungsgemäß bei Schneefall nach der Pause statt und die anschließende Polonaise im Hause von Fürst Gremin dient teilweise dem szenischen Umbau. Der in Düsseldorf geborene deutsche Regisseur Gregor Horres, der bisherige Leiter des Oberösterreichischen Opernstudios am Landestheater Linz, gab mit dieser Inszenierung seinen Einstand auf der großen Bühne des Musiktheaters, wobei er großes Augenmerk auf die Personenführung legte, indem er die unterschiedlichsten Charaktere der handelnden Personen wie ein Chirurg mit dem Skalpell aus ihrer, den Konvention und der Etikette geschuldeten, vorgegebenen und verkrusteten Verhaltensweisen löste.

So wurde die Briefszene, der Onegin auf einem vom Bühnenplafond herabgelassenen Zwischenboden stumm beiwohnte, zu einem der Höhepunkte seiner Inszenierung. Bühne und Kostüme entwarf der in Freital in Sachsen geborene Jan Bammes, wobei er die ländlichen Kostüme auf dem Landsitz der Larins im zaristischen Russland um 1820 ansiedelte und die stilvollen Roben der Damen im dritten Akt, der in St. Petersburg spielt, dem Jugendstil anlehnte. So trägt beispielsweise Tatjana im Hause von Fürst Gremin auch selbstbewusst und selbstbestimmt einen Hosenanzug, was für eine Frau im 19. Jhd. noch gänzlich undenkbar gewesen wäre und sucht offensichtlich ihrer Bestimmung als erfolgreiche Schriftstellerin gerecht zu werden. Die auf einen Zwischenvorhang zu Beginn der Oper projizierten Eiszapfen, die am Ende wieder auftauchen als der Titelheld in eine noch unbekannte Zukunft flieht, dienen als poetische Klammer, um das eisige Innenleben Onegins wieder zu spiegeln. Auf der eher karg eingerichteten Zwischenbühne in Form eines Rechtecks stehen zahlreiche, fest angeschraubte Sessel umher. Diese Plattform kann angehoben und gekippt werden, sodass Triquet an den Stühlen empor steigen und seinen Lobpreis auf Tatjana aus luftiger Höhe darbieten kann. Und Onegin darf in der letzten Szene auch die über die Sessel gezogenen Schutzüberzüge – verlegen – entfernen. Bei Puschkin ist Eugen Onegin übrigens erst 20 Jahre alt und bei seiner neuerlichen Begegnung mit Tatjana in St. Petersburg gerade einmal 26!

Nicht ganz so jung sind freilich die durchgehend stimmlich hervorragend disponierten und mit äußerster Hingabe spielenden Sängerdarsteller in Linz. Als Titelheld brillierte wieder einmal mehr der aus Tirol stammende Wahllinzer und charismatische Bassbariton Martin Achrainer. Geradezu idealtypisch verkörperte er dabei den von Puschkin geschaffenen Typus des überflüssigen Menschen, der am Rande der Gesellschaft steht, finanziell unabhängig, belesen und gebildet ist und mit den Gefühlen seiner Mitmenschen spielt. Als echter Müßiggänger kann er auch keinerlei Verantwortung übernehmen und empfindet sein Leben nur als langweilig. Den Wandel dieses Dandy zum geläuterten und nunmehr Empathie fähigen jungen Mann konnte er durchaus glaubwürdig vorführen. Erlösung blieb ihm aber naturgemäß verwehrt. Immerhin kann er sich glücklich schätzen, dass Tatjana ihn noch immer liebt.
 Die polnische Sopranistin Izabela Matula war zu Beginn eine schwärmerisch ein Onegin verliebte und gleichzeitig naive Tatjana, die durch die Zurückweisung von Onegin mit einem Schlag von der Realität des Lebens eingeholt wird und durch diese erste und bittere Liebeserfahrung für ihr weiteres Leben gestählt wird. Mit ihrem warmen lyrischen Sopran stattete sie die Briefszene zu einer ergreifenden Studie über erwachende Liebe eines jungen Mädchens, das nach einem ihm geeignet erscheinenden Ausdrucksmittel sucht und erhielt dafür auch verdienten Szenenapplaus. Der in Lublin geborene polnische Tenor Rafał Bartmiński unterlegte die Rolle des romantischen Dichters Lenski mit seinem leuchtenden Heldentenor, der sehr gut zum erdigen Bariton von Onegin und dem Mezzosopran von der Britin Jessica Eccleston in der Rolle von Olga, seiner Verlobten und jüngeren Schwester von Tatjana, fröhlich uns völlig unbedacht mit Onegin flirtend, passte. Die Kinderfrau Filipjewna wurde von der aus Varna stammenden bulgarischen Mezzosopranistin Valentina Kutzarova mit wahrer Herzenswärme interpretiert. Katherine Lerner war eine intensive Gutsbesitzerswitwe Larina, mit mütterlich sanften Mezzosopran fürsorglich um ihre beiden Töchter bemüht. Fürst Gremin wurde von Bass Michael Wagner perfekt und nobel dargeboten. Noch länger als er hat – meiner Erinnerung nach – lediglich der unvergessliche József Gregor (1940-2006) den Schlusston ausgehalten. Matthäus Schmidlechner ließ seinen Tenor im kurzen Auftritt von Monsieur Triquet, modisch nach dem dernier cri gekleidet, aus der bereits erwähnten Anhöhe der gekippten Zwischenbühne ertönen. Die kleineren Rollen waren noch mit den beiden Bässen Marius Mocan als Hauptmann, sowie Tomaz Kovacic als Sekundant Saretzki, der südkoreanische Tenor Jin Hun Lee als Vorsänger und Florens Matscheko in der stummen Rolle von Onegins Kammerdiener Guillot besetzt. Erwähnt werden muss auch der von Martin Zeller hervorragend einstudierte Chor des Landestheaters Linz. Für die gelungene russische Sprachbetreuung gebührt allergrößter Dank Marianna Andreev. Den begeisterten Applaus für alle Mitwirkenden konnte der Rezensent noch auf dem Weg zum Zug nach Wien im Foyer des Musiktheater Linz wahrnehmen.
Die polnische Sopranistin Izabela Matula war zu Beginn eine schwärmerisch ein Onegin verliebte und gleichzeitig naive Tatjana, die durch die Zurückweisung von Onegin mit einem Schlag von der Realität des Lebens eingeholt wird und durch diese erste und bittere Liebeserfahrung für ihr weiteres Leben gestählt wird. Mit ihrem warmen lyrischen Sopran stattete sie die Briefszene zu einer ergreifenden Studie über erwachende Liebe eines jungen Mädchens, das nach einem ihm geeignet erscheinenden Ausdrucksmittel sucht und erhielt dafür auch verdienten Szenenapplaus. Der in Lublin geborene polnische Tenor Rafał Bartmiński unterlegte die Rolle des romantischen Dichters Lenski mit seinem leuchtenden Heldentenor, der sehr gut zum erdigen Bariton von Onegin und dem Mezzosopran von der Britin Jessica Eccleston in der Rolle von Olga, seiner Verlobten und jüngeren Schwester von Tatjana, fröhlich uns völlig unbedacht mit Onegin flirtend, passte. Die Kinderfrau Filipjewna wurde von der aus Varna stammenden bulgarischen Mezzosopranistin Valentina Kutzarova mit wahrer Herzenswärme interpretiert. Katherine Lerner war eine intensive Gutsbesitzerswitwe Larina, mit mütterlich sanften Mezzosopran fürsorglich um ihre beiden Töchter bemüht. Fürst Gremin wurde von Bass Michael Wagner perfekt und nobel dargeboten. Noch länger als er hat – meiner Erinnerung nach – lediglich der unvergessliche József Gregor (1940-2006) den Schlusston ausgehalten. Matthäus Schmidlechner ließ seinen Tenor im kurzen Auftritt von Monsieur Triquet, modisch nach dem dernier cri gekleidet, aus der bereits erwähnten Anhöhe der gekippten Zwischenbühne ertönen. Die kleineren Rollen waren noch mit den beiden Bässen Marius Mocan als Hauptmann, sowie Tomaz Kovacic als Sekundant Saretzki, der südkoreanische Tenor Jin Hun Lee als Vorsänger und Florens Matscheko in der stummen Rolle von Onegins Kammerdiener Guillot besetzt. Erwähnt werden muss auch der von Martin Zeller hervorragend einstudierte Chor des Landestheaters Linz. Für die gelungene russische Sprachbetreuung gebührt allergrößter Dank Marianna Andreev. Den begeisterten Applaus für alle Mitwirkenden konnte der Rezensent noch auf dem Weg zum Zug nach Wien im Foyer des Musiktheater Linz wahrnehmen.
Harald Lacina, 15.4.
Fotocredits: Reinhard Winkler
DAMNATION DE FAUST
Premiere: 3.2.
besuchte Vorstellung: 16.2.
Man sieht betroffen, den Vorhang zu und zu viele Fragen offen…
Berlioz sperriges opus 24 bezeichnete er selber als eine dramatische Legende in vier Teilen. Stilistisch gesehen ist es eine Mischung aus Nummernoper und Oratorium, die von Berlioz nie als szenische Aufführung gedacht war. Demgemäß fand die Uraufführung in der Pariser Opéra-Comique am 6. Dezember 1846 unter Berlioz‘ Leitung auch nur in konzertanter Form statt und endete, wie auch die Reprise am 12. Dezember, in einem künstlerischen wie finanziellen Desaster. Eine weitere Aufführung in Paris sollte der Komponist zu seinen Lebzeiten nicht mehr erleben. An eine szenische Aufführung in Österreich kann ich mich nur mehr an jene des katalanischen Regieteams La Fura dels Baus bei den Salzburger Festspielen 1999 erinnern. Der 1975 geborene ungarische Regisseur und studierte Pianist David Marton wurde bereits 2009 von der Fachzeitschrift „Deutsche Bühne“ für sein 75 minütiges Musiktheater nach Mozart, „Don Giovanni. Keine Pause“, aufgeführt in der Kulturfabrik Kampnagel, Hamburg-Winterhude, zum Opernregisseur des Jahres gewählt.

Das Landestheater zeigt nun Martons Deutung von „La damnation de Faust“ in einer Koproduktion mit der Opéra de Lyon, wo diese Inszenierung bereits 2015 Premiere hatte. Bei Marton spielt dieser Faust, anders als im Libretto, nicht in Ungarn und Deutschland, sondern im Südwesten der USA in den fünfziger Jahren. Christian Friedländer stellte dafür eine unfertige Autobahnbücke auf die Bühne und einen Pick-up truck an den rechten Bühnenrand. Als dann der berühmte Rákóczy-Marsch ertönt, übt der Kinderchor die feierliche Einweihung dieses Autobahnabschnittes. Die Kostüme von Pola Kardum setzen auf Uniformität der Massen, die in den Bann von Méphistophélès gezogen werden. Dass Faust Arzt ist, wird man sich in dieser Inszenierung erst dann bewusst als er am Ende des ersten Teiles vor seinen Studenten eine Leiche seziert. Und bevor er das Innere des Brustkorbes freilegt, schließt sich der Vorhang vor den gespannten Blicken des Publikums… Im zweiten Teil ist das gesamte Bühnenbild mit weißen Laken zu gehüllt. Der Männerchor ist mit schwarzen Mänteln und Melonen wie Méphistophélès gekleidet, sodass sich das Böse in Gestalt von Méphistophélès nicht mehr aus der Masse hervorhebt. Masse und Macht. Das Böse ist unter uns, steckt in jedem und jeder von uns und ist nur schwer zu erkennen und zu entlarven. Diese optische und auch gesungene Vervielfachung einer Bühnenfigur als Regiekunstgriff hat zuletzt auch Stefano Poda für seine Turandot-Inszenierung am Teatro Regio di Torino im Januar 2018 angewendet, wo er Turandot gleich gekleidet wie der übrige Teil des weiblichen Chores in der Masse unerkannt bleiben lässt.

Regisseur Marton aber übernimmt auch einige Szenen aus Goethes Faust I, deren Text er einmal vom Chor auf Deutsch, nicht immer textverständlich, sprechen lässt und dann bei der Gretchen-Frage zwischen den beiden englischsprachigen Sängern von Marguerite und Faust im Truck dann auf Englisch, was nicht ohne Reiz ist, aber zum besseren Verständnis von Berlioz‘ Werk entbehrlich wäre. Der in Arkansas geborene US-amerikanische Tenor Charles Workman verfügt für die Titelpartie über eine kräftige und höhensichere Stimme, die nur fallweise etwas angestrengt klang. Er hat sich vor allem auf Mozart, Händel und das französische Repertoire spezialisiert und war am Theater an der Wien bereits in drei Händel-Produktionen (Semele 2010, Il trionfo del tempo e del disinganno 2013, Messiah 2014) zu hören bzw zu sehen. Darstellerisch vermag er alle Lebensstationen dieses hin- und hergerissenen und getriebenen Faust glaubwürdig zu verkörpern. Zu Beginn sitzt er am Rande der Autobahnbrücke in höchster Verzweiflung, bereit, sich hinab zu stürzen. Aber sein sehnlichster Wunsch nach Verjüngung wird ihm in dieser Inszenierung leider nicht zu Teil. Und hätte denn nicht ein verjüngter Faust besser zu der Marguerite der britischen Mezzosopranistin Jessica Eccleston gepasst?

Diese verfügt über eine lyrisch schwelgerische sinnliche Stimme, was sie besonders gut im Chancon gothique „Le roi de Thulé“ unter Beweis stellen konnte. Seit der Spielzeit 2017/18 ist sie festes Ensemblemitglied am Landestheater Linz. Michael Wagner glänzte mit seiner eindringlichen Bassstimme als wahrhaft dämonischer Méphistophélès. Während des Höllenritts sitzt er hinter dem Lenkrad des Pick-ups, während Faust dahinter auf der Ladefläche steht und der Zuschauer auf einer Leinwand die Wüstenlandschaften des Mittleren Westens der USA vorbeiziehen sieht. Dann dreht er das Autoradio auf und stimmt diabolisch lächelnd in den himmlischen Chor ein und liefert Faust in der Hölle ab, die sich unseren Augen als Leichenhalle eröffnet. Sein Leichnam wird mit einem Nummernschild am großen Zeh aufgebahrt und schließlich in einen lebenden Leichnam, ein seelenloses Wesen, transformiert. Er erhält einen schwarzen Mantel mit Melone als Referenz an René Magritte und ist nun optisch bestens ausgerüstet, um das Böse auf elegante Weise in der Welt zu verbreiten… Méphistophélès aber verlässt die Szene, denn hier gilt es ja nicht mehr, Faust zu verführen…

Dominik Nekel ergänzte mit seinem gut geführten Bass rollengerecht als Student Brander und gab vor der betrunkenen Studentenhorde sein Chancon „Certain rat, dans une cuisine etabli, comme un vrai frater…“ Martin Zeller hat den Chor und Extrachor des Landestheaters Linz gesanglich gut einstudiert. Was das Rezitieren von Goethe Versen betrifft, hätte man noch einige Proben einlegen müssen, um zu einem textlich verständlichen Ergebnis gelangen zu können. Der Chor wurde von Berlioz im Übrigen als gleichgewichtiger Protagonist konzipiert. Im Finale wurde der Chor dann noch vom aufgeweckt singenden Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz stimmstark ergänzt. Auch hier gilt wieder: Mehr Proben für das Rezitieren des Goethe Textes wäre ein Gewinn gewesen. Allerdings nur für das Konzept des Regisseurs. Wirklich gebracht haben diese Ausflüge in die Prosa von Goethes Faust, ob in Deutsch oder in Englisch vorgetragen, dramaturgisch gesehen nichts. Martin Braun hatte das Bruckner Orchester Linz gut im Griff und beeindruckte besonders in den sinfonischen Passagen mit seiner äußerst sensiblen Umsetzung der Partitur. Immer wieder gelangen ihm Momente höchster musikalischer Anspannung und gewaltiger geradezu ekstatischer Spannungsbögen. Henning Streck sorgte noch für das passende Lichtdesign der einzelnen Szenen.

Fausts Verdammnis zu inszenieren ist zweifelsohne kein leichtes Unterfangen. Als ich diese Rezension verfasste, sah ich mir nebenbei noch die Produktion von Salzburg 1999 auf DVD an, um einen Vergleich zu haben, der zu Gunsten des Katalanischen Regieteams in diesem Falle ausfiel. Zu viele Fragen blieben in dieser intellektuell überfrachteten Inszenierung offen, zu vieles Beiwerk in Form der eingeflochtenen Prosatexte störte den natürlichen Handlungsablauf und zog das Werk daher unnötig in die Länge. Trotzdem: wenn man dieses Werk – wie der Verfasser dieser Zeilen – nicht so gut kennt, dann zahlt sich eine Begegnung in Linz auf jeden Fall aus!
Harald Lacina, 17.2.
Fotocredits: Reinhard Winkler
DIE FRAU OHNE SCHATTEN
8.10. (Premiere am 30. 09.2017)
Atemberaubende Realisierung! Drei OF Sterne!
Es gab Zeiten, da haftete dieser Oper das Etikett an „spröde zu sein“. Spätestens aber mit der unvergesslichen Leonie Rysanek als Kaiserin, die sich für diese Oper zeitlebens besonders stark eingesetzt hatte, gehört der „Frosch“ zum Repertoire jeden größeren Opernhauses und stellt für dieses eine ungeheure Kraftprobe dar. Alleine an die 100 Musiker sitzen im Graben und die Glasharfe sowie ein Teil der Stimmen müssen über die elektronische Anlage in den Besucherraum eingespielt werden. Ein ungeheurer logistischer Aufwand, den das Ergebnis, das sei vorweggenommen, allemal gerechtfertigt hat. Der gut gemischte Cocktail an Quellen, Hofmannsthal bemühte u.a. Goethe, Hauff, Freud und Jung, ergab eine äußerst komplexe und komplizierte Märchenoper mit dem einen Hauptthema des Segens der Liebe durch Geburt von Kindern. Und der „Schatten“ in dieser Oper steht als Symbol für die Fähigkeit zur Mutterschaft, welche die Kaiserin nicht besitzt, da das Licht durch sie wie durch Glas durchdringt. Traditionell bedeutet das Fehlen eines Schattens aber auch, dass jene Person mit bösen Mächten, in der Oper in Gestalt der Amme, im Spiel ist. Diese zweite Deutung schwingt auch bei der „Frau ohne Schatten“ im Hintergrund mit.

Intendant Hermann Schneider zeigt gleich zu Beginn der Oper die Transformation der Kaiserin, der Tochter des Geisterkönigs Keikobad, die den Kopf einer Gazelle langsam abnimmt. In einer bewaldeten Umgebung, die entfernt an das „Nocturne“ von Max Ernst aus dem Jahr 1949 erinnert (Ausstattung: Falko Herold), hat sie der Kaiser der südöstlichen Inseln erlegt. Da sie aber keine Kinder gebären kann, gehört sie nicht vollständig zu den Menschen. Der an der linken Bühnenseite über eine sehr hohe Leiter herabkletternde Geisterbote verkündet der Amme, die alles Menschliche verabscheut, dass in drei Tagen die Frist um sei und der Kaiser zu Stein wird, wenn die Kaiserin bis dahin keinen Schatten werfe, sprich schwanger werde. Die Kaiserin in Kenntnis dieser Umstände macht sich zu den Menschen auf, um einen Schatten zu gewinnen, während sich der Kaiser für drei Tage nichtsahnend fröhlich auf die Jagd begibt. Die an sich vertikale Geschichte dieser Oper wurde nun in dieser Inszenierung dergestalt aufgebrochen, dass mittels der Drehbühne die Geister- und Menschenwelt als Parallelwelten vorgeführt werden, und so äußerst spannende Übergänge kreieren. Die Welt des Färbers Barak und seiner Gattin wird wiederum naturgemäß in die Arbeitswelt verlegt, wo der Färber Barak mit seinen drei körperlich behinderten Brüdern und seiner Gattin um ihre Existenz ringen.

Mit einem Gabelstapler bringt er eine Palette beladen mit weißer Wäsche heran und führt dann eindrucksvoll vor, wie diese mittels eines kleinen Kranes in die Bühnenversenkung getaucht wird, um nach einigen Minuten goldgelb wieder in die Höhe gezogen zu werden. Diese Szenerie mit ihren Waschmaschinen im Hintergrund zitiert das Ambiente der Färber in der Inszenierung von Jonathan Kent und der Ausstattung von Paul Brown für das Mariinsky Theater St. Petersburg 2011 (vgl. http://www.dailymotion.com/video/x52yjna_strauss-die-frau-ohne-schatten-saint-petersburg-2011_music). Die Szene, in der dann die Färbersfrau von der Amme mit Reichtum betört wird, erinnert in ihrer klanggewaltigen Illustration entfernt an Klingsors Zaubergarten. Man hört demgemäß, dass es gar nicht so leicht ist den gewaltigen Fels Wagner in der Brandung ohne hörbare Blessuren zu umschiffen… Aber auch Schönbergs „Lied der Waldtaube“ aus den „Gurre-Liedern“ fand ihren Niederschlag im Gesang des Falken. Während die Färbersfrau dann kocht, hört sie die Stimmen der ungeborenen Kinder, die in dieser Inszenierung mit übergroßen Köpfen erscheinen. Edgar Allan Poe lässt grüßen.

Der von der Amme herbeigezauberte Jüngling könnte rein optisch als Double von Max Raabe durchgehen. Und während der von der Jagd heimgekehrte Kaiser, erfreut seinen verloren geglaubten Falken wieder gefunden zu haben, sich betrogen wähnt, weil er die Kaiserin nicht antrifft und sie daher töten möchte, empfindet diese erstmals Mitgefühl mit dem gepeinigten Barak, das ihrer Menschwerdung als unabdingliche Voraussetzung dienen wird. Der versteinerte Kaiser erscheint auf einem hohen Sockel sitzend effektgeladen wie eine Horrorfigur aus einem Gothic Thriller. Das Lebenswasser verweigernd, beschließt die letzte Prüfung der Kaiserin vor ihrer endgültigen Menschenwerdung. Sie hat die Amme inzwischen verstoßen und betritt nun den Tempel ihres Vaters. Die glückliche Wiedervereinigung der Paare ist stets eine Herausforderung an jede Regie. Auch diesmal ist sie leider etwas kitschig geraten, denn Kaiser und Kaiserin schieben einen Kinderwagen über die Bühne. Das allerletzte Bild jedoch verlöscht diesen Eindruck sofort, denn es zeigt die schlafende Färberin, die die Ereignisse möglicher Weise nur geträumt hat und eine mädchenhafte Kaiserin, die sich wieder in die Gazelle transformiert. Ausstatter Falko Herold hat durch ein Video, welches Soldaten im ersten Weltkrieg zeigt, geschickt auf die Entstehungszeit des Werkes hingewiesen und auch erschütternd das „Versinken“ der Färberswelt am Ende des zweiten Aktes ausgestaltet, indem die Wand des Färberhauses, wie man sie in einem beliebigen Baumarkt vorfinden kann, geräuschvoll einstürzt. Weniger beeindruckend wirkte aber jene transparente Kabine, in der der weinende Falke erscheint.

Markus Poschner am Pult des Bruckner Orchesters Linz präsentierte einen derart spannungsgeladenen farbigen Strauss wie man ihn nur sehr selten erleben kann. Die drei Damen waren exzellent in stimmlicher wie darstellerischer Hinsicht. Allen voran Miina-Liisa Värelä als Färberin, die mühelos alle Höhen dieser mörderischen Partie scheinbar mühelos und ohne Einbrüche meisterte. Brigitte Geller als Kaiserin stand ihr aber in nichts nach. Zerbrechlich und doch menschliche Stärke beweisend, führte sie ein ergreifendes Bild des vom Kaiser erlegten Geisterwesens auf der Suche nach einem menschlichen Schicksal vor. Die an der Lyric Opera Chicago ausgebildete dramatische Mezzosopranistin Katherine Lerner bewies durch ihre stimmlich abgedunkelte dämonische Amme, dass sie ein Gewinn für das Ensemble des Landestheaters Linz ist. Man kann gespannt auf ihre nächsten Debüts warten: Marguerite in „La Damnation du Faust“ und Brangäne. Enttäuschend war der Kaiser von Heiko Börner, dessen Tenor wenig erstrahlte. Die Regie ließ ihn leider auch in Unterwäsche aus dem Bett der Kaiserin ersteigen und umständlich bekleiden, was nicht gerade vorteilhaft mitanzusehen war. Der in Seoul geborene Bariton Adam Kim war als Geisterbote anzusehen, dass er nicht gänzlich schwindelfrei ist, um von so einer hohen Leiter, wenn auch gesichert, herab zu steigen.

Gesanglich gefiel er. Bassbariton Michael Wagner war ein bemitleidenswerter Färber Barak, der wunderschön auf Linie sang und dessen Stimme schließlich zu einem fulminanten Höhepunkt im Schlussquartett fand. Die Färbersbrüder reüssierten sowohl gesanglich als auch darstellerisch. Matthäus Schmidlechner verlieh seinen satten Tenor dem Buckligen, während Dominik Nekel den Einarmigen mit seinem erdigen Bass unterlegte. Martin Achrainer stellte als Einäugiger auf einem Möbelgleiter kniend hin- und her rollend neben seinem profunden Bariton auch wieder einmal sein enormes schauspielerisches Talent unter Beweis. Der in München geborene junge Tenor Mathias Frey gefiel als charmante Erscheinung des Jünglings, auf den die Färberin ihre begehrlichen Blicke nachvollziehbar schon einmal werfen durfte. Die drei Dienerinnen an diesem Abend Margaret Jung Kim, Gabriele Salzbacher und Vaida Raginskytė ergänzten das übrige Ensemble vortrefflich, ebenso Ulf Bunde, Tomaz Kovacic, Marius Bocan, Jochen Bohnen, Joschko Donchev und Markus Schult, die ihre Stimmen den Wächtern der Stadt verliehen. Svenja Isabella Kallweit in der Doppelrolle als Hüter der Schwelle des Tempels und Stimme des Falken gefiel mit ihrem eindringlichen Sopran ebenso wie Jessica Eccleston mit ihrer Altstimme von oben. Erwähnt werden müssen noch der von Martin Zeller und Ursula Wincor gut geführten Chor bzw. Kinderchor des Landestheaters Linz. Ein Abend der in seiner musikalischen wie szenischen Intensität keinerlei Wünsche offenließ und nur empfohlen werden kann!
Harald Lacina, 11.10.17
Fotocredits: Reinhard Winkler und Norbert Artner
Michael Obst
DIE ANDERE SEITE
24.6. (österreichische Erstaufführung daselbst am 20.5.2017)

Alfred Kubin in einer surrealen Irrenanstalt
Es ist dies bereits die dritte Oper des 1955 in Frankfurt am Main geborenen deutschen Pianisten und Komponisten Michael Obst. Nach seiner Kammeroper „Solaris“ (1996) nach dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem aus dem Jahr 1961, seiner abendfüllenden Oper „Caroline“ (1999), die das Verhältnis von Caroline Schelling (1763-1809), geb. Michaelis, verwitwete Böhmer, geschiedene Schlegel, verheiratete Schelling zu August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) und zu dem um 12 Jahre jüngeren Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) thematisiert, und schließlich „Die andere Seite“, nach dem gleichnamigen und einzigem Roman von Alfred Kubin (1877-1959), die am 25. September 2010 am Mainfranken Theater in Würzburg uraufgeführt wurde.

Bei der Aufführung in Linz handelt es sich erst um die zweite Inszenierung dieser Oper und – was besonders erstaunlich ist – um die zweite Oper von Michael Obst, die in ein- und derselben Saison im Musiktheater am Volksgarten, nach „Solaris“(17.9.2016), gezeigt wurde. Freilich kommt bei Alfred Kubin noch ein Nahebezug zu Linz und Schärding zum Tragen, da Kubin bis zu seinem Tod auf Schloss Zwickledt in Wernstein am Inn, politischer Bezirk Schärding, gewohnt hatte. Der fantastische Roman von Alfred Kubin entstand nun 1908 während einer Schaffenskrise, wurde 1909 mit 52 Illustrationen Kubins veröffentlicht und 1973 unter dem Titel „Traumstadt“ von Johannes Schaaf verfilmt.

Hermann Schreiber, der Intendant des Theaters in Würzburg, hat aus dem Roman ein Libretto in 18 Szenen mit Prolog und Epilog angefertigt, das nicht unbedingt viel zum Verständnis des Romans mit seiner psychologisch überfrachteten Handlung, die nachgerade aus verschiedenen Blickwinkeln heraus interpretiert werden kann. Während im Roman der Zeichner (Kubin) in die Hauptstadt „Perle“ des von Multimillionär Claus Patera im fernen Asien geschaffenen Traumreichs reist, spielt die Handlung in Linz in der Inszenierung von John Dew in einer psychiatrischen Irrenanstalt zur Zeit der Entstehung des Romans. Neben dem üblichen Personal eines Krankenhauses begegnen wir auch einem gewaltigen Chor an inhaftierten Insassen hinter Gitterstäben und Horrorgeschöpfen in den unheimlichen Masken von Uwe Wagner. Der Zeichner von Martin Achrainer ist in dieser Inszenierung von Anbeginn äußerst nervös, überspannt und neurotisch zerfahren porträtiert.

Sein tonloser qualvoller Schrei zu Beginn der Oper ist eine cineastische Referenz an Al Pacino auf den Stufen des Teatro Massimo in Palermo in Francis Ford Coppollas Film „The Godfather Part III“. Und er demonstriert auch seine körperliche Beherrschung, wenn er den „liegenden Helden“ (Supta- Virasana), eine Yoga Position, ausführt. Die „Anstalt“ dient dem Zeichner zunächst noch als Inspirationsquelle, doch nach dem Tod seiner Frau keimen in ihm ungeheure Horrorvisionen auf, auf deren Höhepunkt das Traumreich einer Irrenanstalt langsam wieder untergeht. Seine Gattin (Gotho Griesmeier) erscheint und holt den „geheilten“ Zeichner wieder ab. Auf Grund einer Entzündung konnte sie die Rolle an diesem Abend nur ausdrucksstark spielen, gesungen hat sie vom Rand der Bühne aus den bereitgestellten Notenblättern besonders ausdrucksstark Jennifer Davison. Bravo! Countertenor Denis Lakey hat die Rolle des Patera bereits bei der Uraufführung gesungen. Er verlieh der Figur einen skurril dämonischen Ausdruck und erinnerte etwas an Dr. Miracle aus Offenbachs Les Contes d’Hoffmann. Nikolai Galkin gefiel in der Doppelrolle eines Verkäufers und eines Wirtes. Rollengerecht ergänzten spielfreudig Csaba Grünfelder als Kleiner Herr und Amtsperson, Michael Wagner als Friseur und Arzt, Matthäus Schmidlechner als Gast und Zoologe, John F. Kutil in der Sprechrolle von Pateras Gegenspieler Herkules Bell, Martha Hirschmann als laszive Krankenschwester Melitta mit gut geführtem Sopran und Jochen Bohnen sowie Tomaz Kovacic als zwei Schachspieler.

Michael Obst bezog häufig elektroakustische Musik in seine Komposition, deren melodische Grundstrukturen ihre Wurzeln in armenischer Musik finden. Daneben setzt er auch eine Sprechstimme (Christian Manuel Oliveira) und am Ende der Oper einen gespenstisch wirkenden A-capella Chor (Leitung: Georg Leopold) zu der auf einer Volksweise aus dem 18. Jhd. stammenden Melodie und Textes zum Abendlied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, genannt Wilhelm von Waldbrühl (1803-69), ein. Dazwischen zauberte Marc Reibel am Pult des Bruckner Orchesters Linz flirrende Klangwolken in freier Tonalität gepaart mit meditativen Passagen, die entfernt der Gregorianik verpflichtet zu sein schienen. Die Ausstattung von Dirk Hofacker unterwarf sich dem Regiekonzept und verortete die Kostüme ins frühe 20. Jhd. Die Bühne wiederum entsprach jenen Anstalten, die man heute noch in Resten im Sanatorium Baumgartner Höhe in Wien findet. Und da darf natürlich auch die berühmte Couch aus Sigmund Freuds Berggasse 19 nicht fehlen.

Das Musiktheater war leider recht schlecht besucht und zwei Personen in der ersten Reihe verließen noch während der Aufführung das Haus. Schade! Mag man auch darüber streiten, ob sich dieser Roman als Opernstoff überhaupt eignet, musikalisch war er jedenfalls durchaus interessant, aber mehr auch nicht. Nach 100 Minuten war der Spuk vorbei und höflicher Applaus bedanke alle Mitwirkenden! Bravorufe gab es natürlich für die Linzer Publikumslieblinge Martha Hirschmann und Martin Achrainer.
Harald Lacina, 26.6.
Fotocredits: Sakher Almonem und Tom Mesic
Hindemith
DIE HARMONIE DER WELT
besuchte Vorstellung 24.4.

Grandiose Choroper in gelungener Präsentation
Auf den ersten Eindruck wirkt Hindemiths vorletzte Oper vielleicht etwas sperrig, aber ein Besuch wird jedem Opernliebhaber nur empfohlen. Paul Hindemith hatte die Uraufführung am 11. August 1957 am Pult des Prinzregententheaters in München an Stelle des erkrankten Ferenc Fricsay dirigiert. Die Reaktionen bei der Uraufführung kann man in der Ausgabe Der Spiegel 34/1957 nachlesen http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41758349.html.
Bereits 1951 hatte Paul Hindemith eine Sinfonie gleichen Namens verfasst, die die musikalische Quintessenz seiner späteren Oper enthält. Die Oper wiederum ist die vorletzte Hindemiths. Ihr sollte 1961 noch die einaktige Oper „Das lange Weihnachtsmahl“ auf einen Text von Thornton Wilder, den Hindemith ins Deutsche übersetzt hatte, folgen.

Der Inhalt der fünfaktigen Oper durchläuft ein Zeitfenster von 22 Jahren zwischen 1608 und 1630. Die Schauplätze wechseln simultan und wollen damit dramaturgisch gesehen die Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren widerlegen. Sie führen von Prag nach Güglingen in Württemberg, Linz, Sagan in Schlesien nach Regensburg und schließlich in einer großangelegten Passacaglia barocken Ausmaßes in strahlendem E-Dur in sphärische Gefilde. Kepler entdeckte durch seine musiktheoretischen Überlegungen die drei Gesetze der Planetenbewegungen, die bis heute ihre Gültigkeit bewahrten. Für ihn war Musik ein kosmisches Phänomen, eine Weltenmusik, bei der die Himmelsbewegungen eine fortwährende polyphone Musik, die durch das Ohr nicht hörbar ist, erzeugten. In seinen Betrachtungen sieht er sich einerseits der hohen Realpolitik in Gestalt der beiden Kaiser Rudolf II. und Ferdinand II. sowie Wallenstein und anderen Aristokraten ausgesetzt, andererseits dem Unverständnis der eigenen Familie. Am Ende muss sich Kepler resignierend eingestehen „Die große Harmonie, das ist der Tod… Im Leben hat sie keine Stätte“. Über die Disharmonie seiner Gegenwart findet der sterbende Kepler nur durch seinen unerschütterlichen Glauben an eine letzte Harmonie der Welt Trost.

In Linz wurde Hindemiths Oper „Die Harmonie der Welt“ bereits 1967, also zehn Jahre nach ihrer Uraufführung gezeigt. Während Hindemiths Oper „Cardillac“ ihren festen Platz im Repertoire der Wiener Staatsoper hat und auch seine Oper „Mathis der Maler“ 2012 mit überwältigendem Erfolg am Theater an der Wien gezeigt wurde, blieb eine szenische Aufführung der „Harmonie der Welt“, wohl auch auf Grund ihres Nahebezuges von Johannes Kepler, der ja von 1612 bis 1626 in Linz gelebt hatte, bisher nur der oberösterreichischen Donaumetropole vorbehalten. Und diese zeigt nun das Opus Magnum Hindemiths in der ungekürzten Fassung (!) nun dankenswerter Weise bereits zum zweiten Mal, wenn auch in einem zeitlichen Abstand von einem halben Jahrhundert. Wer bei der österreichischen Erstaufführung – so wie ich – noch nicht geboren war, musste die Gelegenheit nützen, um nach Linz zu reisen, denn einer weiteren Aufführungsserie nach vielleicht wieder 50 Jahren würde der Rezensent wohl nicht mehr beiwohnen können. Kaum zu glauben, aber seit der Uraufführung in München 1957 ist dies erst die sechste Neuinszenierung dieser Oper. Für Linz bedeutete sie einen gewaltigen logistischen Kraftaufwand. Zunächst erkrankte Regisseur Dietrich Hilsdorf, sodass Intendant Hermann Schneider die Inszenierung auf Grund dessen Konzeptes (Dramaturgie: Christoph Blitt) fertig stellte. Gerrit Priessnitz erzeugte am Pult des Bruckner Orchesters Linz einen gewaltigen Klangteppich, der A- und Polytonalität kongenial verband und das Publikum suggestiv in seinen Bann zog. Der gewaltige, mitunter an beiden Rändern des Zuschauerraumes positionierte Chor und Extrachor des Landestheaters Linz war auf diese ungeheuren Aufgaben durch Georg Leopold und Martin Zeller besonders gut vorbereitet worden. Dieter Richter stellte eine Art Observatorium in Form eines Kuppelbaus in die Mitte der Bühne, dazwischen wird immer wieder ein Straßenprospekt eingezogen, Symbol der Bewegung, denn Kepler muss ja seinen Aufenthaltsort in Abhängigkeit von den jeweiligen Brotherren häufig wechseln. Die geöffnete und immer wieder gedrehte Sternwarte eröffnete den Blick in Keplers Wohnung und in Wallensteins Prunksaal. Ein ständig rotierendes Pendel in der Mitte des Raumes rief Erinnerungen an Richard Peduzzis Bühnenbild für den 2. Akt der Walküre im Bayreuther Jahrhundertring von Patrice Chereau hervor. Renate Schmitzer verzichtete größtenteils auf historisierende Kostüme, lediglich der Klerus und die beiden Kaiser waren „standesgemäß“ gekleidet. Die übrigen Protagonisten und Protagonisten gefielen sich in Kostümen, die dem ersten Drittel des 20. Jhd. verpflichtet waren.

Seho Chang war ein von den politischen Kräften seiner Zeit aufgeriebener Astronom auf der Suche nach der Weltenharmonie, der bis zu seinem Ende nie den Glauben an eine göttliche Weltordnung verlor. Sein kräftiger Bariton changierte dabei gekonnt zwischen lyrischer Verinnerlichung und gewaltiger Expressivität im forte. Am Ende war er noch als Himmelskörper Erde zu hören. Sandra Trattnigg war eine bis zuletzt treu ergebene Gattin Susanna, die mit ihrem gewaltigen Sopran bis in höchste Höhen schon einmal der Obrigkeit Paroli zu bieten vermochte und in der Schlussapotheose Venus. Besonders eindringlich gestaltete die in Kaunas in Litauen geborenen Mezzosopranistin Vaida Raginskytė Keplers Mutter Katharina, die von Aberglauben geleitet und als Hexe verleumdet beinahe auf dem Scheiterhaufen endet, dank der Fürsprache ihres Sohnes aber im letzten Augenblick gerettet werden kann sowie Luna. Keplers Gehilfe, später Gegenspieler Ulrich Grüßer war in der Kehle des isländischen Tenors Sven Hjörleifsson bestens aufgehoben, der am Ende auch den Mars sang. Ein Erlebnis, sowohl in gesanglicher wie auch darstellerischer Hinsicht bot der in Südafrika geborene Tenor Jacques le Roux als Wallenstein, ein machtgieriger Despot, durch seinen unbeugsamen Glauben an Horoskope aber verwundbaren Menschen. Im Finale war ihm natürlich die Rolle von Jupiter vorbehalten. Die beiden Kaiser Rudolf II. und Ferdinand II. sowie Sol unterlegte Dominik Nekel mit dem Anlass entsprechenden majestätischen Bass. Matthias Helm gefiel als Studienabbrecher Tansur aus Wittenberg, der Flugblätter mir Berichten über Katastrophen, die von Kometen ausgelöst werden, mit erdigem Bariton lautstark verkauft. Im Finale verkörperte er noch Saturn.

Dem in Odessa geborenen Bass Nikolai Galkin war der Klerus in Gestalt des evangelischen Linzer Pfarrers Daniel Hizler, der Kepler vom Abendmahl ausschließt, als auch dessen Regensburger katholischen Kollegen vorbehalten. In der Schlussapotheose noch Merkur. Dem smarten Bassbariton Ulf Bunde waren die Rolle von Susannes Vormund Baron Starhemberg sowie eines Vogtes (Rechtsbeistand) vorbehalten, einen weiteren Anwalt verkörperte Bassbariton Tomaž Kovačič, während Tenor Csaba Grünfelder als Keplers Bruder Christoph rollengerecht agierte. Die kleine Susanna, Keplers Tochter, wurde von Theresa Grabner verkörpert. Vier Weiber (Danuta Moskalik, Sarolta Kovacs-Führlinger, Karin Behne und Mitsuyo Okamoto) beobachten heimlich, wie Katharina den Leichnam ihres Vaters auf dem Friedhof ausgräbt und beschließen sie daraufhin als Hexe anzuzeigen. Den drei Mördern Jang-Ik Byun, Tomaž Kovačič und Ville Lignell war es bestimmt, Wallenstein zu töten. Seinen gebührenden Auftritt absolvierte auch ein Schäferhund mit tierischer Präzision.
Dem Publikum des für einen Montagabend gut ausgelasteten Musiktheaters Linz gefiel die Produktion und es spendete allen Mitwirkenden warmherzigen Applaus.
Harald Lacina, 25.4. Copyright: Thilo Beu
DON GIOVANNI
Aufführung am 10.4.2017
Prager Fassung mit fulminantem Helden!
Ob es tatsächlich die „Opern aller Opern“ ist, wie Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, der mit seinen eigenen Opernwerken ziemlich erfolglos blieb, behauptete, mag dem Urteil der Nachgeborenen vorbehalten sein. Es sollte meiner Meinung nach nicht wie ein „ewig gültiges Urteil“ behandelt werden, zu verschieden sind die musikalischen Vorlieben heutiger Zuhörer und selbst verständlich auch Zuhörerinnen.

Unbestritten ist jedoch, dass Mozart Don Giovanni, in welcher Fassung auch immer, ein Meisterwerk darstellt.
Mit den Klängen der Höllenfahrt beginnt und endet der Linzer Don Giovanni in der Inszenierung von François de Carpentries. Die Ouvertüre wird, einer inzwischen Usus gewordenen Sitte im Musiktheater, bebildert. Don Giovanni wird zu Grabe getragen, winkt jedoch mit einer Hand aus dem Sarg heraus. Das Ende seiner Höllenfahrt ist gekommen. Durch Christi Kreuzestod hat dieser die Sünden der Menschheit (auch für die Zukunft) bereits vorweg auf sich genommen und so wird - in der Lesart des Regisseurs - auch Don Giovanni Erlösung gewährt. Er entsteigt dem Grab und beginnt wieder von neuem. Zunächst tänzerisch galant, begnügt er sich offenbar mit dem Versuche, seine Opfer zu verführen, der jedoch zumeist scheitert, denn die während der Oper vorgeführten Damen entkommen oft im letzten Moment seinen Nachstellungen. Für Don Giovanni aber heißt das: Die Jagdsaison in Sevilla ist wieder eröffnet. Hüte sich jeder Rock vor diesem Erotomanen und Libertin! Dabei scheint dieser spanische Lebemann nicht so vergnügt, sondern eher getrieben, das von ihm entworfene Bild eines Wüstlings perfekt zu erfüllen.

In leisen, fast wehmütigen Rezitativen, die Martin Achrainer in der Titelrolle so ergreifend gestaltet, wird einem die Ambivalenz dieser tragischen Figur in ihrer charakterlichen Nähe zu ihrem Epigonen Giacomo Girolamo Casanova erst so richtig bewusst. Martin Achrainer hat diese Partie bereits 2008 gesungen und ist mit ihr und an ihr gewachsen. Neben ihm konnten sich gesanglich wie darstellerisch vor allem das Bauernpaar Masetto und Zerlina behaupten. Till von Orlowsky, der im Herbst 2016 an der Mailänder Scala als Papageno in Mozarts Zauberflöte zu erleben war, stattete auch den Masetto mit gut geführtem, weichen Bariton aus. Ideal mit dem wunderbaren Sopran von Fenja Lukas als Zerlina. Nikolai Galkin sang einen textverständlichen Komtur mit resolutem Bass. Einem Edelmann geziemend versucht er den Verführer seiner Tochter im Duell mit dem Degen zu töten. Don Giovanni in die Enge getrieben findet aber in höchster Not nur mehr Gelegenheit, sein Pistoletto zu ziehen und den über ihn gebeugten Komtur auf diese Weise schnell und schmerzlos ins Jenseits zu befördern. Von Don Giovanni später zum Diner geladen, wird sein steinernes Abbild auf eine drei Zinnen aufweisende Mauer furchteinflößend projiziert. Beim Diner erscheint er dann in Begleitung von 12 dunklen Gestalten aus dem Jenseits, die an die Studien des britischen Malers Francis Bacon nach Velázquez‘ Porträt von Papst Innozenz X. erinnert, hier in einer Paraphrase auf das Letzte Abendmahl. Margareta Klobučar war eine imposante Donna Anna in weit ausladendem schwarzem Reifrock. Leider hörte sich ihr Sopran manchmal recht schrill an und wurde meiner Meinung nach auch etwas unausgewogen geführt. Gesanglich etwas enttäuschend für mich hörte sich Gotho Griesmeier als Donna Elvira an diesem Abend an.

Ich vermute eine Erkältung, die sich besonders in den Spitzentönen unangenehm bemerkbar machte. Der moldawische Tenor Iurie Ciobanu, der 2006 den ersten Platz beim Internationalen Hans Gabor Belvedere Gesangswettbewerb belegte, sang den tollpatschigen Don Ottavio mit idealer Mozart-Stimme, die er freilich in der Prager Fassung nur in seiner einzigen Arie „Il mio tesoro intanto“ formvollendet zur Wirkung bringen durfte. Michael Wagner war als Diener Leporello ein berührender tragisch-komischer Gegenspieler seines Herrn mit ausgezeichnet geführtem, erdigem Bass.
Regisseur François De Carpentries wusste in seiner Inszenierung die körperlichen Fähigkeiten seines durchwegs jungen Ensembles nahezu perfekt einzusetzen. Einen wichtigen Bestandteil seiner Inszenierung lieferte aber auch die Choreographie von Christina Comtesse. Gleich zu Beginn der Oper wird der dem Grab frisch entstiegene Don Giovanni von vier Furien der Hölle, die noch „zahm“ als Mond- und Sonnenmädchen erscheinen, umworben. Später erscheinen sie aber schon als schwarze schaurige Todesbotinnen. Vor dem Finale 1 erscheinen noch die drei Mascherette, Donna Elvira, Donna Anna und Don Ottavio. Alle drei in schwarzen Reifröcken mit aufgemaltem, weißem Skelett. Don Giovanni nähert sich gleich verführerisch einer von ihnen. Sein Opfer ist aber ausgerechnet Don Ottavio, der sich nicht zu wehren wagt… Weiters dient ein Grammophon in dieser Inszenierung noch dazu, um scheinbar alte Aufnahmen auf Schellacks abzuspielen, deren Originalklang das unsichtbare Bühnenorchester liefert. Wir hören also musikalische Zitate aus Vicente Martín y Solers „Una cosa rara“, Giuseppe Sartis „Fra i due litiganti il terzo gode“ und aus Mozarts vorangegangener Erfolgsoper „Le nozze di Figaro“. Bei dem moralisierenden Schlusssextett lässt der Regisseur dann Don Giovanni wieder aus der Hölle auferstehen und beim Schlussakkord mit einem teuflischen Gelächter abtreten. Zurück bleiben die erstarrten Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen des Libertins.

Die Belgierin Karine Van Hercke ersann die Bühnenausstattung und die Kostüme. Der Raum wird von ihr abstrakt gehalten. Eine riesige Kirchenrosette wird im Verlauf des ersten Aktes dann mit düsteren Videoanimationen von Aurélie Remy belebt. Der von Georg Leopold bestens einstudierte Chor des Landestheaters Linz trug maßgeblichen Anteil am Erfolg dieses Abends.
Gespielt wurde die Prager Fassung in bewusstem Verzicht auf zwei Arien von Donna Elvira und Don Ottavio der späteren Wiener Fassung. Das Bruckner Orchester wurde dieses Mal von dem 1979 in Tokio geborenen Takeshi Moriuchi geleitet, der einen eleganten, flotten Mozart ohne Stillstand präsentierte. Den Schlussapplaus konnte der Rezensent nur mehr aus dem Foyer lautstark vernehmen, da er zum letzten Zug nach Wien eilen musste! Es war jedenfalls ein höchstvergnüglicher, kurzweiliger Abend!
Harald Lacina, 11.4.2017
Fotocredits: Thomas M. Jauk
McTEAGUE
Oper von William Bolcom
Premiere des Landestheaters Linz im Musiktheater am 6. Februar 2016
Wer hat vom Genre des Opernthrillers schon gehört? Zumindest „Tosca“ könnte einem dazu rasch einfallen, und als „Western-Oper“ die „Fanciulla“ – nicht zufällig zwei Klassiker des Verismo. Doch bei der Gruppe der „Zahnarzt-Opern“ wird wohl auch der erfahrenste Opernliebhaber, die weitest herumgekommene Raritätenexpertin aufgeben müssen. Zu allen diesen dreien gleichzeitig aber zählt die Programmzeitung unseres Landestheaters die amerikanische Oper, die uns heute als Premiere und europäische Erstaufführung ins Haus an der Blumau stand.

William Bolcom, geboren 1939 in Seattle, hat u. a. bei Milhaud und Messiaen studiert; seine Werkliste umfaßt 10 Symphonien, dazu Oratorien („Songs of Innocence and Experience“), Kammermusik, Konzerte – und, neben anderen Stücken für Musiktheater, drei Opern: „A View from the Bridge“ (1999), „A Wedding“ (2004) und „McTeague“, die erste der drei, uraufgeführt am 31. Oktober 1992. Alle wurden erstmals in der Lyric Opera of Chicago gegeben (die sie auch beauftragt hatte), und alle wurden dabei jeweils von Dennis Russell Davies dirigiert. Der seit der böse-realistischen Kriegssatire „MASH“ berühmte, immer zu Experimenten aufgelegte, vielfältig musikaffine Regisseur Robert Altman inszenierte und arbeitete auch am Text mit (nur nicht bei „Bridge“, das ein Theaterstück von Arthur Miller ist). Arnold Weinstein war Hauptlibrettist bei allen drei Opern.
McTeague war ursprünglich ein Roman (in der deutschen Ausgabe als „Gier nach Gold“ betitelt), erschienen 1899; erstmals wurde dieser Stoff 1924 von Erich von Stroheim verarbeitet: sein Film „Greed“ ist eine Hollywood-Legende an künstlerischem Anspruch wie Maßlosigkeit, Ausschweifung und Frustration – 85 Stunden Material wurden gedreht, 8 Stunden wollte Stroheim ins Kino bringen, und MGM-Produktionschef Irving Thalberg machte 2½ Stunden daraus. Filmarchäologen mühen sich seit den 1950ern, Stroheims „director’s cut“ wiederherzustellen…

Wie Stroheims Filmtitel erahnen läßt, geht es im Roman und schließlich auch in der Oper (die freilich auch in erwähnter „Thalberg-Länge“ bleibt) um ein Thema, aus dem ein anderer, ebenfalls legendär maßloser Künstler vier zusammenhängende Opern mit einer Gesamtlänge von etwa 15 Stunden gemacht hat: Gier, Neid und die daraus resultierenden Verwerfungen. McTeague spielt im Jahr 1900 in San Francisco und im Death Valley; der kalifornische Goldrausch ist freilich schon lange Geschichte – das Gold, um das es in der Oper geht, sind Golddollars aus einem Lotteriegewinn: Titelfigur ist ein lediglich „angelernter“ Dentist, der seine Schwierigkeiten mit Frauen hat, bis er die Cousine und Freundin seines Kumpels Marcus Shouler, Trina Sieppe, kennenlernt. Als die sich von McTeague heiraten läßt, bekommt McTeagues Freundschaft zu Shouler einen Riß, welcher sich drastisch vertieft, als Trina 5.000 Dollar in Gold gewinnt, das „ja eigentlich Shouler zustünde“. Aus Rache läßt Shouler McTeagues fehlende Qualifikation auffliegen, und so verliert McTeague seine Lebensgrundlage – derweil Trina auf dem gewonnen Vermögen sitzt, dass der Adler quietscht und die ihren Lebensunterhalt durch das Verscherbeln ihm ans Herz gewachsener Dinge bestreitet. Der Hass, jeder gegen jeden, wächst, und kann nur zu mörderischen Konsequenzen führen. Als tragikomischer Kommentar zu diesem Geschehen tritt immer wieder die etwas verrückte, kleptomanisch veranlagte, und in wohl irrealen „Erinnerungen“ gefangene Maria Miranda Macapa auf.
Bolcoms Kompositionsstil fußt auf serieller Technik; er hat sich jedoch auch ausführlich mit dem US-Musikerbe beschäftigt (war u. a. am Ragtime-revival in den 70ern wesentlich beteiligt), und das kommt auch in der McTeague-Partitur zum Ausdruck: als der Titelheld und Shouler noch gut miteinander befreundet sind, singen sie fröhlich gesetzte Duette in der Art des Barbershop-Gesanges (aus dem u. a. auch die Comedian Harmonists schöpften) – und beim Finale unter der sengenden Sonne des Death Valley, das durchaus in einen Tarantino-Film passen würde, erklingt dieser an sich fröhliche Stil, jetzt stark eingedunkelt, noch einmal. Die Straßen von San Francisco werden in Ragtime-Rhythmen charakterisiert. Und natürlich sind auch die einzelnen Rollen musikalisch klar definiert.

Inszeniert hat der Linzer Musicalchef Matthias Davids, Bühne Mathias Fischer-Dieskau, Kostüme Susanne Hubrich. Die Szenerie ist nicht nur epochegetreu in Kostümen und Requisiten (mit Unterstützung des OÖ. Zahnmedizinmuseums!), sondern nimmt auch mit liebevollen Details wie „Dreckrändern“ an Hosen, Röcken und Mänteln auf die Orte der Handlung bezug. Was aber geradezu als genial gelten kann, ist die Lösung, die Fischer-Dieskau mit den Linzer Technikern für die zahlreichen Szenewechsel gefunden hat, die durch filmschnittartige, nicht-lineare Erzählweise bedingt sind: man verwendet die Drehbühne, wobei einander aber nicht in klassischer Weise zwei oder drei vorbereitete Szenarien einander abwechseln, sondern stets der gesamte Bühnenraum in ganzer Größe zur Verfügung steht – die Häuser, Arztpraxisinnenraum etc. sind durch ein offensichtlich hochkomplexes Faltsystem u.a. mit Seilzügen umzulegen und ebenso schnell wieder aufzustellen, sodass alle Szenenwechsel von der Stadt zur Wüste im Handumdrehen in wenigen Sekunden offen erfolgen können. Und dieses System funktionierte auch noch absolut perfekt! Stets präsent ist eine riesige Scheibe, die als Sonne, Mond – oder als Projektionsfläche für Traumbilder dient. Dieser eindrucksvolle und eindrucksreiche Rahmen wurde mit einer sehr sorgfältigen und ebenfalls bis aufs kleinste Detail perfekt durchdachten und umgesetzten Personenregie gefüllt und belebt: es bewegten sich richtige Menschen auf der Bühne.

Während der Vorbereitungen im vergangenen Herbst gab es leider einen Rückschlag, als sich der höchst prominente Gast, der als Sänger der Titelrolle ausersehen war, Stephen Gould, aus gesundheitlichen Gründen von (nicht nur) dieser Rolle zurückziehen mußte; ein junger, mutiger Landsmann von ihm, der derzeit an der Oper am Rhein in Düsseldorf engagiert ist, war reichlich kurzfristig bereit, sich diese umfangreiche Rolle für Linz anzueignen. Auch in letzter Minute mussten noch Einspringer (allerdings als offizielle zweite Besetzung voll geprobt) aushelfen.
Dieser Darsteller des McTeague ist Corby Welch, der nicht nur körperlich die im Roman festgelegten Eigenschaften dieses Charakters erfüllt, sondern mit beweglichem, kraftvollen und schön timbrierten Tenor in dieser riesigen Rolle ohne hörbare Ermüdung von der ersten bis zur letzten Minute präsent ist. Und „präsent“ heißt, daß er auch schauspielerisch überzeugen konnte – einfach eine hervorragende Leistung!
Seine Ehefrau, Trina Sieppe, um die sich der Konflikt der Handlung dreht, wird von Çiğdem Soyarslan mit leuchtendem dramatischen Sopran verkörpert, auch sie nicht nur stimmlich, sondern auch als Bühnencharakter restlos überzeugend.

An sich war als Marcus Schouler Seho Chang für die Premiere eingeteilt; dieser mußte jedoch wegen Erkrankung w. o. geben, worauf Michael Wagner diese Aufgabe übernahm – auch er nicht völlig gesund (er ließ sich ansagen), jedoch konnte sein Bariton mit den anderen zwei Hauptpersonen absolut mithalten. Schauspielerisch ließ er natürlich ebenso keine Wünsche offen.
Die Maria Miranda Macapa von Karen Robertson ist ebenso brillant – eine Charakterkomikerin par excellence in Spiel und Stimmeinsatz.
Papa Sieppe wird liebevoll verschroben charakterisiert vom Landestheater-Veteranen William Mason, als seine Gattin mußte Kathryn Handsaker in letzter Minute für Cheryl Lichter einspringen. Sheriff Jacques le Roux und Lottery Agent & Health Inspector Nikolai Galkin boten ebenfalls sehr feine Leistungen. Ulf Bunde als New Dentist und der junge Lorenz Kothbauer als Owgooste, kleiner Bruder von Trina, ergänzten das Ensemble mit sehr guten Leistungen.
Der Chor des Landestheaters Linz, einstudiert von Georg Leopold, lieferte den Solisten in Spiel und Gesang die perfekte und zuverlässige Stütze. Auch das Bruckner Orchester spielte in Höchstform, was nicht zuletzt an den auf die Hundertstelsekunde präzisen Schlägen – schon der allererste Ton dieser Oper ist eine gewaltige Eruption der groß besetzten Schlagwerker – zu hören war.

Dennis Russell Davies dirigierte sein erstes von Michael Bolcom komponiertes Stück 1967 und konnte den Komponisten hier in Linz daher als alten Freund begrüßen. Man kann davon ausgehen, daß Bolcom auch mit dieser Interpretation seiner nicht immer einfach zu erfassenden Musik sehr zufrieden war: absolute Synchronisation zwischen Bühne und Graben, vorzüglich abgestimmte Dynamik (bei diesen hervorragenden Sängern ohne Kompromisse möglich), immer wieder fein gewebte Farbstimmungen, zwischendurch elegant swingende „Amerikanismen“.
Begeisterter Applaus für Darsteller und Musiker wie Produktionsteam, der erst durch das Saallicht beendet wurde.
Bilder (c) Patrick Pfeiffer
H & P Huber 8.2.16
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-Online (Wien)
SINGIN‘ IN THE RAIN
von Comden, Green, Brown und Freed
Vorstellung: 28. 12. 2015

Das Linzer Musiktheater feierte wieder einen großen Musical-Erfolg. Diesmal mit dem 1983 im Londoner Palladium uraufgeführten Stück „Singin’ in the Rain“, dessen Songs von Nacio Herb Brown und Arthur Freed stammen (Libretto und Bühnenadaption: Betty Comden und Adolph Green). Das Musical basiert auf den klassischen Metro-Goldwyn-Mayer-Film Singin’ in the rain mit Gene Kelly in der Hauptrolle.

Die Handlung des Musicals spielt in der Zeit des Umbruchs vom Stumm- zum Tonfilm, die für die Filmindustrie reichlich turbulent ausfiel. In zwei Akten werden auf humorvolle Art und Weise die Schwierigkeiten gezeigt, die das Stummfilm-Traumpaar Don Lockwood und Lina Lamont bei den Dreharbeiten zum Tonfilm Der tanzende Kavalier erleben. Für Lina stellte der Tonfilm wegen ihrer schlampigen Aussprache und schrillen Stimme eine unüberwindbare Hürde dar, die auch durch einen Sprechlehrer nicht zu meistern ist. Die Voraufführung des Films mit der sprechenden Lina Lamont gerät zum Debakel. Die Produzenten entschließen sich, Lina durch die Sängerin Kathy Selden zu synchronisieren. Der Film wird ein voller Erfolg, doch als das begeisterte Publikum von Lina Lamont eine Live-Darbietung hören möchte, fliegt der Schwindel auf.

Melissa King inszenierte und choreographierte das Werk auf typisch amerikanische Musical-Art, wobei sie den Schwerpunkt auf Humor und Tanz legte. Es gelang ihr, auf der Bühne eine Broadway-Atmosphäre zu schaffen, die das Publikum begeisterte und immer wieder zu Szenenbeifall animierte. Bestechend die einfallsreich choreographierten Stepptanz-Szenen, die nicht nur vom Ballett, sondern auch von den Darstellern exzellent dargeboten wurden. Für Humor sorgten sogar vier Bühnenarbeiter, die – von der Decke baumelnd – den Regen zum Titelsong mit Gießkannen besorgten. Ein gelungener Gag, dies dem Publikum sichtbar werden zu lassen.
Für die im amerikanischen Stil gehaltene Bühnengestaltung sorgte Knut Hetzer, die hübschen farbenfrohen Kostüme entwarf Judith Peter. Für das kreative Lichtdesign zeichnete Michael Grundner verantwortlich, für Film und Animation Boris Brinkmann.

Als gefeierter Stummfilmstar Don Lockwood überzeugte der elegant wirkende Konstantin Zander stimmlich, tänzerisch und schauspielerisch. Ihm ebenbürtig war die Sopranistin Anaïs Lueken, die ihre Rolle als Synchronsprecherin und –sängerin Kathy Selden mit Charme ausstattete und stimmlich zu begeistern wusste. Hervorragend der quirlige Philippe Ducloux als Cosimo Brown, der mit artistisch anmutenden Einlagen verblüffte und die Tanzszenen zu den Höhepunkten des Abends werden ließ.
In der Rolle der Lina Lamont bot die zierliche Daniela Dett eine bemerkenswerte Leistung. Wie sie immer wieder mit hoher Fistelstimme die Texte sprach und sogar zu singen versuchte, war beeindruckend! Dass sie auch in ihren Bewegungen komisch wirkte, war noch eine Zugabe. In weiteren Rollen konnten Rob Pelzer als Produzent R. F. Simpson, Alen Hodzovic als Regisseur Roscoe Dexter und Riccardo Greco als Sprechlehrer Dinsmore ihre komische Begabung ausspielen.

Das stets erstklassig aufspielende Bruckner-Orchester wurde von Marc Reibel sehr ambitioniert geleitet und brachte die vielen Ohrwürmer des Musicals – wie Good morning, good morning…, Make ’Em Laugh!‚ You are my lucky star und mehrmals Singin’ in the Rain – wunderbar zur Geltung.
Das Publikum im ausverkauften Musiktheater belohnte am Schluss alle Mitwirkenden mit minutenlang anhaltendem Applaus, wobei die Phonstärke bei Philippe Decloux und Daniela Dett jedes Mal hörbar zunahm.
Bilder (c) Reinhard Winkler / Landestheater
Udo Pacolt 4.1.16
Besonderer Dank an MERKER-online (Wien)
Natürlich ist der Original-Film ein MUST HAVE
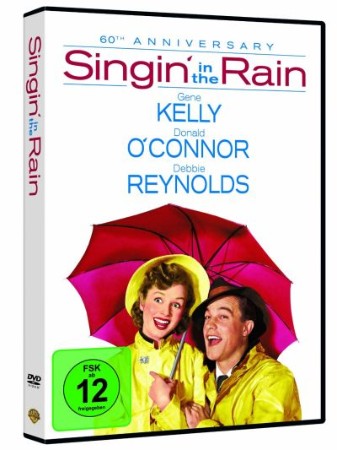
aktuell beim Großversender nur 4,97 Euro
LÁMOUR DE LOIN

6.6. (Premiere 28.3.2015)
Ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk
Die Oper der finnischen Komponistin Kaija Saariaho (1952*) erlebte ihre Uraufführung bei den Salzburger Festspielen am 15. August 2000. Die Komponistin, die seit 1982 in Paris lebte, stieß dort auf die Lebensgeschichte des im 12. Jhd. lebenden Troubadours Jaufré Rudel, von dem lediglich acht Gedichte, davon vier mit Noten, in altokzitanischer Sprache erhalten geblieben sind. Huegues de Saint-Cyr verfasste um 1225 sog. vidas, also Lebensbeschreibungen, mehrerer provenzalischer Dichter. In ihnen wird von Jaufrés unstillbarer Sehnsucht nach der Gräfin von Tripoli, seiner „amor de lonh“ erzählt, die ihn bewog, sich einem Kreuzzug anzuschließen. Während der Schiffsreise erkrankt er aber und stirbt in den Armen der Gräfin, die, von dieser Fernliebe derart beeindruckt, in ein Kloster eintrat.

Noch bevor die Komponisten die Arbeit an der Oper in Angriff nahm, vertonte sie seine Gedichte 1996 unter dem Titel „Lonh“ für Sopran und Elektronische Instrumente.
Der gleichfalls in Paris lebende Journalist libanesischer Herkunft Amin Maalouf (1949*) schrieb das fünfaktige Libretto zu dieser Oper. Die impressionistische Musik von Saariaho ist sicherlich etwas von Debussy und Messiaen beeinflusst und der meditativen Litanei verpflichtet.
Der Regisseurin Daniela Kurz, die auch die Choreographie, das Bühnenbild und die Kostüme in Personalunion kreierte, gelang ein atemberaubendes Gesamtkunstwerk. Die Farben Weiß, Schwarz und Rot dominieren in den Kostümen. Zu Beginn ist Jaufré noch weiß gekleidet, und erlebt in dieser heilen Welt eine Schaffenskrise, von der ihn erst der Bericht des Pilgers von jener schönen Gräfin im Libanon befreit. Clémentine, die angebetete Gräfin von Tripoli, ist aber zunächst schwarz gekleidet. Sie kam als fünfjährige ins Heilige Land und sehnt sich nach ihrer alten Heimat zurück. Am Ende ist sie ebenfalls rot gekleidet, Zeichen ihrer Liebe zu Jaufré und später zu Gott. Der Pilger, eine Hosenrolle, trägt aber die ganze Zeit rot als Symbol der (Gottes)liebe und des Blutes. Am Ende der Oper, dem Höhepunkt, wo Jaufré und Clémentine für den kurzen Augenblick vereint sind, sind dann alle handelnden Personen rot gekleidet.

Von den drei Sängern wurde das Liebespaar von der Regisseurin geschickt gedoppelt. Bonnie Paskas und Samuel Delvaux setzen damit die verhaltenen Gefühlsregungen des Paares in ausdrucksstarke Bewegungen um. Während der Ouvertüre erscheint ein vertikaler roter Streifen in der Bühnenmitte auf dem ein Mensch, offenbar der Pilger, seine Reise antritt. Die Sicht auf ihn ist gleichsam von oben, sodass er demgemäß an Seilen befestigt, waagrecht zur Bühne langsam hinunterschreitet. Die meist dunkle Bühne wird von schiefen Ebenen eingenommen. Besonders imposant gestaltete sie das musikalische Intermezzo nach der Pause, das die stürmische See mit ihren heftigen Wogen in Gestalt von zwei schwarzen, sich auf- und ab bewegenden Flächen darstellt.

Das Bruckner Orchester Linz breitete unter der versierten Leitung von Kaspar de Roo die meditativen Klangflächen der Partitur in schillernden Farben aus. Eine Vielzahl an Schlagwerk mit fünf Pauken Xylophon, japanischem Taiko, Vibraphon, Marimba und Glockenspiel gelangte da zum Einsatz und einmal hatte ich den Eindruck, dass Saariahoo beim Glockengeläute kurz die entsprechende Musik aus Boris Godunow zitierte.
Martin Achrainer als Troubadour Jaufré ließ darstellerische wie gesanglich mit seinem warm dahinströmenden Bariton und seiner hingebungsvollen Darstellung, die dem sympathischen Sänger einiges an sportlichem Einsatz abverlangte, keinerlei Wünsche offen. Aber auch Gotho Griesmeier als Gräfin Clémence bewies, dass ihr die enormen gesanglichen Herausforderungen ihrer Partie keinerlei Schwierigkeiten bereiteten. Ergreifend war dann auch die Schlussszene, wo sie den sterbenden Jaufré in den rmen hält, um endlich, nach seinem Tod, mit Gott zu hadern. Darin wird sie aber schlussendlich vom Chor mahnend eingebremst. Ihr bleibt nunmehr als neue Liebe aus der Ferne jene zu Gott. Martha Hirschmann in der Rolle des Pilgers trat darstellerisch naturgemäß etwas in den Hintergrund, gesanglich aber bestach auch sie mit einschmeichelnder Stimmführung ihres Mezzos.

Der von Georg Leopold geleitete Chor des Landestheaters trug aus dem Orchestergraben „unsichtbar“ singend zum großen Erfolg dieses Abend bei. Zu erwähnen auch das stimmige 13-köpfige Bewegungsensemble, welches die Kreuzfahrer und die Pilger auf ihrer Fahrt ins Heilige Land symbolisierte, wodurch die eher knappe Handlung der Oper an Bewegung und Intensität gesteigert wurde.
Die Vorstellung war – wohl auf Grund des Schönwetters – nicht restlos ausverkauft. Dem erschienenen Publikum sagte das Dargebotenen offensichtlich sehr zu, denn alle Künstler wurden mit viel Applaus bedankt, dem sich der Rezensent gerne länger angeschlossen hätte, wenn er nicht seinen Zug nach Wien zurück erreichen wollte. Harald Lacina, 7.6.15
Fotocredits: Ursula Kaufmann
DAS RHEINGOLD
8.5. (Premiere: 26.10.2013)
Orient trifft auf klassische Antike

Dem Programmheft war zu entnehmen, dass das Landestheater Linz als weltweit erstes Theater Das Rheingold mit dem neu edierten Orchestermaterial des Schott-Verlags nach der Richard Wagner-Gesamtausgabe herausbringt. In erwartungsvoller Spannung ließ sich der Rezensent daher auf seinen Sitz nieder. Am Pult des Bruckner-Orchesters Linz stand Dennis Russell Davies. Es ist seine letzte Saison in Linz. Und unendlich getragen hebt das Orchester im berühmten Es-Dur Dreiklang zum sich steigernden Rauschen des Rheins an, der zunächst als Videoprojektion von Falk Sternberg in einem schmalen Band in der Bühnenmitte horizontal verläuft. Ein überdimensionales Auge (Bühnenbild: Gisbert Jäkel) lässt dann den Blick auf die Rheintöchter frei, die in silbernen Trikots (Kostüme: Antje Sternberg) über den felsigen Boden des Rheins umhertollen, was einer gewissen unfreiwilligen Komik nicht entbehrte. Mari Moriya als Woglinde, Gotho Griesmeier als Wellgunde sowie Valentina Kutzarova als Flosshilde bildeten dabei ein gesanglich ausgewogenes stimmiges Terzett, das mit dem armen Nachtalben Alberich ihr böses Spiel trieb. Genau genommen verflucht ja Alberich erst dann die Liebe, die er auf Grund seines Äußeren von den schönen Rheintöchtern nicht erlangen kann, nachdem sie ihn, was im Grunde genommen auch besonders sadistisch ist, verspotten und quälen. Dem Lieblosen bleibt daher nur ein Ausweg: das Gold zu rauben, um sich damit Liebe zu erzwingen. Und als Gold dient den Rheintöchtern auf dem Bühnenboden befindliche Plättchen, die sie in die Luft wirbeln und dann umher fliegen lassen, was ebenfalls unfreiwillig komisch wirkte…

In der Rolle von Alberich glänzte mit hervorragender Diktion und ausdrucksstarkem Spiel Oskar Hillebrandt, der im vierten Bild dann in einem Käfig vorgeführt wird, ähnlich jenem des Zwergs in der Inszenierung von Zemlinskys Der Geburtstag der Infantin von Adolf Dresen an der Staatsoper Hamburg 1983. Und wenn ihm dann Wotan gleich den Finger mit seinem Speer abtrennt, um den Ring zu raffen, dann weckt das Erinnerungen an die ähnlich, aber ungleich brutaler, gestaltete Szene bei Kasper Bech Holten im Kopenhagener Ring von 2006 wach, wo Wotan Alberich gleich den ganzen Unterarm abtrennt, um den „Armreif“ an sich zu reißen. Matthäus Schmidlechner war stimmlich ein sehr guter Mime, der mit seiner Brille die Attitüde eines neuzeitlichen Forschers ausstrahlte.
Die Götterszenerie stellt ein orientalisches Zelt dar, in welchem Kisten verstreut umher stehen, welche die Ménage der Götter enthalten und am Ende der Oper von livrierten Dienern in das Innere der Götterburg Walhall verschafft werden. Karen Robertson als Fricka weckte gleich zu Beginn mit alles durchdringendem Ruf ihren Göttergatten Wotan aus seinem eher unwissenden Schlaf auf. Dieser noch junge Wotan wurde von Gerd Grochowski mit angenehmer bassbaritonaler Eleganz äußerst solide, aber unspektakulär, präsentiert. Er tritt in typisch orientalischer Gewandung mit einem Fes auf dem Kopf auf. Auffallend war die überlaut aus dem Souffleurkasten agierende Souffleuse, die scheinbar des Guten oft zu viel tat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sänger und Sängerinnen derartige Textunkenntnisse hatten.

Bei Dominik Nekel als Fasolt hatte ich allerdings auf Grund der oft verspäteten Einsätze schon den Eindruck, dass er zwar nicht mit der Melodei, doch aber mit dem Text ziemlich frei umging. Nikolai Galkin hat als Fafner viel weniger zu singen, das tat er aber dafür mit Prägnanz.
Seho Chang stattete den Donner mit sonoren Bassqualitäten aus und Pedro Velázquez Díaz bereitete den Göttern als Froh einen würdevollen Einzug in ein hellenistisch gestaltetes Walhall.
Positiv angemerkt muss auch die Freia von Sonja Gornik werden. Als Göttin der Fruchtbarkeit, des Frühling, der Liebe und als Lehrerin des Zaubers, tritt sie gleich mit einigen Kindern, Symbol ewiger Jugend und des immerwährend Neuen, auf. Beim Einzug nach Walhall streuen die Kleinen dann noch Blüten, womit der häufig gesehene Madama Butterfly Kitsch schon Einzug in Wagners hehre Götterwelt hält. Ungeschickt von Regisseur Uwe Eric Laufenberg gelöst ist auch die Verhüllung Freias mit dem Rheingold. Sie wird dabei wie an einen indianischen Marterpfahl mit den Armen über dem Haupt gebunden und genau diese beiden Arme werden vom Gold dann auch nicht verdeckt. Man fragt sich also unwillkürlich, ob denn der liebestrunkene Fasolt lediglich Freias holdes Auge sehrend erblickt und in seinem letztlich todbringenden Liebesrausch die nackten Arme völlig übersieht?

Michael Bedjai war als Loge leider stimmlich indisponiert, was eine völlig verquollene Höhe zur Folge hatte. Diesen Fehler machte er aber durch seine überragende schauspielerische Gestaltung der Rolle dieses ungestümen wie listigen Halbgottes einigermaßen wett.
Bernadett Fodor musste sich als Erda auch wenig spektakulär aus dem Bühnenhintergrund zwischen die Götterschar mischen, bewies aber mit ihrem gewaltigen Mezzo wahre mahnende Walaqualitäten, die keinen Widerspruch dulden!
Eine optische Herausforderung jeder Rheingoldinszenierung ist die zweimalige Verwandlung Alberichs im dritten Bild. Bei der Wandlung zum wilden Wurm, wird uns zunächst einmal eine Koloskopie vorgeführt, die sich schließlich zum Auge eines Reptils und im zweiten Verwandlungsdurchgang endlich in die klitzekleine Kröte umformt.

Dennis Russel Davies war am Pult des Linzer Bruckner-Orchesters ein unterstützender Begleiter der Stimmen, was natürlich auf Kosten der dramatischen Struktur der Partitur ging. Er vermied ausladende sinfonische Bögen und setzte vielmehr auf einen zurückhaltenden Wagner-Sound, der ihm auch am Ende der Vorstellung einen Buhruf aus dem Auditorium eintrug.
Mit den Sängern und Sängerinnen gab sich das Publikum am Ende der Vorstellung zufrieden, Beatrix Fodor erhielt sogar Blumen auf offener Bühne und sie war ja auch, neben Oskar Hillebrandt, der gesangliche Höhepunkt an diesem Abend.
Harald Lacina, 10.5. Fotocredits: Karl Forster
GÖTTERDÄMMERUNG
7.2. Premiere, besuchte Vorstellung am25.4.
Szenisch nicht stringent, musikalisch unausgewogen
Der Abschluss der Tetralogie in der umstrittenen Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg hatte bereits am 7.2. seine Premiere im Neuen Opernhaus in Linz gefeiert. Eine zeitliche Distanz zur Premiere kann gewinnbringend sein, denn die Mitwirkenden haben dann bereits einen Großteil der Nervosität abgelegt. Dafür schleichen sich andere Mängel ein, so vor allem die Beherrschung des Textes. Das war an diesem Abend bei Elena Nebera als Brünnhilde zu bemerken, die, um den Gesangsfluss nicht zu bremsen, einfach passende Lautschöpfungen kreierte. Aber auch bei den Rheintöchtern fehlte plötzlich eine ganze Zeile!

Dieser Gefahr ging Lars Cleveman als Siegfried gleich von vornherein aus dem Weg, indem er sich bei Bedarf in der Nähe des Soufleurkastens – lauschenden Ohres - aufhielt. Das ist eben der Vor- aber auch der Nachteil einer Übertitelung. Man liest zwangsläufig mit und entdeckt dann manchmal überraschende textliche Abweichungen vom Gelesenen, obwohl die Übertitel wiederum auch nicht immer den genauen Text des Librettos wiedergeben. Ich wünschte für mich, es nur einmal bei Wagner zu schaffen, nicht mitzulesen. Aber dafür eignet sich wohl nur Bayreuth und Erl.
 Die drei Nornen agieren zu Beginn rund um einen gläsernen Kubus im Bauhausstil, dem Heim des trauten Paares Brünnhilde und Siegfried. Von den drei wesensgemäß schwarz mit grau gesteiftem Oberteil gekleideten Nornen (Kostüme: Antje Sternberg) empfahl sich die Ungarin Bernadett Fodor, die später noch als Waltraute auftrat, mit ihrem einprägsamen, voluminösen Mezzosopran als erste Norn. Karen Robertson und Brit-Tone Müllertz als zweite und dritte Norn traten ihr gegenüber gesanglich etwas in den Hintergrund. Und als stummer Zeuge, teils als bloßer Schatten, teils realiter, erscheint Gerd Grochowski als Göttervater Wotan, wodurch die Szene zwar göttlich, aber doch entbehrlich, aufgepeppt wurde.
Die drei Nornen agieren zu Beginn rund um einen gläsernen Kubus im Bauhausstil, dem Heim des trauten Paares Brünnhilde und Siegfried. Von den drei wesensgemäß schwarz mit grau gesteiftem Oberteil gekleideten Nornen (Kostüme: Antje Sternberg) empfahl sich die Ungarin Bernadett Fodor, die später noch als Waltraute auftrat, mit ihrem einprägsamen, voluminösen Mezzosopran als erste Norn. Karen Robertson und Brit-Tone Müllertz als zweite und dritte Norn traten ihr gegenüber gesanglich etwas in den Hintergrund. Und als stummer Zeuge, teils als bloßer Schatten, teils realiter, erscheint Gerd Grochowski als Göttervater Wotan, wodurch die Szene zwar göttlich, aber doch entbehrlich, aufgepeppt wurde.
In der gleichfalls von Bauhausstilelementen durchwachsenen Gibichungenhalle mit langer Tafel und bequemen Chefsesseln (Bühnenbild: Gisbert Jäkel) reicht ein alle Mitwirkenden an stimmlicher wie körperlicher Größe haushoch überragender Albert Pesendorfer als Hagen den bar jeglicher guter Umgangsformen ungestüm auftretenden Siegfried den Trank des Vergessens, um diesen Rowdy willfährig für die eigenen Pläne zu formen. Aber dieser Longinus ist nicht der Größte auf der Bühne. Grane erscheint und Hagen reicht ihm trotz stattlicher Figur gerade einmal bis zum Knie! Das inzestuöse Verhältnis von Siegmund und Sieglinde scheint sich übrigens hier zwischen Gunther und Gutrune scheinbar zu wiederholen, derart innig sind sie einander zugetan.

Während Hagen auf einem Stuhl auf der geräumigen Tafel der Halle Wacht hält, erscheinen Alberich und Hagens Mutter Grimhild als Obdachlose gekleidet und bewachen seinen Schlaf. Björn Waag als Alberich hat gleich eine Videokamera mitgebracht um sein vergrößertes Konterfei vom Hintergrundprospekt aus drohend über dem Sohn wachend auszubreiten und ihn für seinen Machtanspruch als Herr des Ringes zu missbrauchen. Aber Söhne widersetzen sich ja bekanntlich zumeist den Zukunftsplänen ihrer Väter…
Siegfried wiederum lässt an den Designer-Walkürenfelsen zurückgekehrt keinen Zweifel mehr über seine wahre Natur aufkommen. Der Inzestspross will nach dem kurzen Intermezzo mit seiner Tante Brünnhilde nur mehr eines: ohne Rücksicht Karriere machen und so schreckt er auch nicht davor zurück, die ohnmächtige Brünnhilde am Ende des ersten Aufzugs in eigener Gestalt (und nicht der von Gunther) zu missbrauchen.
 Der zweite Akt spielte wieder in der bekannten Gibichungenhalle und der sichtlich leicht angeheiterte Hagen lässt sich von seinen Mannen zunächst willfährig auf einem Drehsessel hin- und herschieben. Die im Vorspiel und im ersten Akt noch in Designerkleidung aufgetretene Brünnhilde erscheint nun in einem züchtigen altmodischen weißen Hochzeitskleid. Nach Siegfrieds und Brünnhildens Eid auf die Spitze des Speeres und dem vom Triumvirat Hagen, Gunther und Brünnhilde vereinbarten Todesurteil über Siegfried ging der szenisch wenig spektakuläre zweite Aufzug zu Ende.
Der zweite Akt spielte wieder in der bekannten Gibichungenhalle und der sichtlich leicht angeheiterte Hagen lässt sich von seinen Mannen zunächst willfährig auf einem Drehsessel hin- und herschieben. Die im Vorspiel und im ersten Akt noch in Designerkleidung aufgetretene Brünnhilde erscheint nun in einem züchtigen altmodischen weißen Hochzeitskleid. Nach Siegfrieds und Brünnhildens Eid auf die Spitze des Speeres und dem vom Triumvirat Hagen, Gunther und Brünnhilde vereinbarten Todesurteil über Siegfried ging der szenisch wenig spektakuläre zweite Aufzug zu Ende.
Im dritten Aufzug erscheinen die drei Rheintöchter als lockere Animierdamen in der Bar „Zum Rheingold“. Danach gibt dann Siegfried den Mannen einige Jugendschwänke über Fafner, den Waldvogel und schließlich Brünnhilde zum Besten. Auffallend dabei war, dass er diese Stellen nicht mit Kopfstimme vortrug! Bravo!
Zurück in die Gibichungenhalle gekehrt, präsentiert Hagen Gutrune ihren auf der Jagd getöteten Gatten Siegfried. Als Gunther dessen Ring für sich beansprucht, schneidet ihm sein Halbbruder Hagen in IS-Manier die Kehle durch. Brünnhilde schreitet zu ihrem letzten Gang ins Feuer, das den Weltenbrand entzündet und stimmt ihren bewegenden, einige Worte übergehenden Schwanengesang an.
Eine Videoprojektion von Falko Sternberg zeigt den Untergang der Zivilisation durch Naturkatastrophen und atomare Zerstörungen. Gutrune erscheint als einzige Überlebende mit einem Fernrohr auf der Bühne und sucht den Horizont nach einer besseren Welt ab…

Von der gesanglichen Seite waren der Hagen von Alfred Pesendorfer mit gewaltigem Bass und die Waltraute / erste Norn von Beatrix Fodor die stimmlichen Höhepunkte an diesem Abend, dicht gefolgt von Seho Chang als Gunther und Björn Waag als Alberich. Elena Nebera als Brünnhilde verfügt zwar über eine strahlende Höhe, in der mittleren, vor allem aber in der tiefen Lage schwächelte sie hörbar. Eine gute gesangliche Leistung bot Brit-Tone Müllertz als Gutrune, die sich auch als dritte Norne stimmlich wacker hielt.
Die drei Rheintöchter waren mit Claudia Braun-Tietje als Woglinde, Gotho Griesmeier als Wellgunde und Valentina Kutzarová als Flosshilde, abgesehen von textlichen Unsicherheiten, gesanglich ausgewogen besetzt.
Ingo Ingensand sorgte am Pult des Bruckner Orchesters Linz dafür, dass der Abend ohne größere Intonationsprobleme verlief. Man hat freilich schon bessere Götterdämmerungen gehört, allerdings auch viele weitaus schlechtere! Und auch der Chor und Extrachor des Landestheaters Linz unter seinem Leiter Georg Leopold war für den vom Applaus des Publikums als Erfolg eingestuften Abend mitverantwortlich. Ein zaghaftes Buh für Elena Nebera ging im starken Applaus unter.
Harald Lacina, 26.4. Fotocredits: Karl Forster
SIEGFRIED
7.12. (Premiere am 1.11.)
Musikalisch gelungen, szenisch gezwungen

Es ist unter Wagner-Kennern bereits ein Allgemeinplatz, dass der „Ring“ derart universal und komplex ist, dass er sich auf tausendfache Weise inszenieren ließe. Der „Siegfried“ ist da sicherlich das schwierigste Stück der gesamten Tetralogie, denn er steht stellvertretend für das Satyrspiel der antiken Tetralogie. Und es ist nur allzu verständlich, dass sich das moderne Regietheater dabei äußerst schwer tut, eine „Komödie“, ohne in aufgesetzte Plattitüden zu verfallen, stringent auf die Bühne zu stellen. Hinzukommt noch besonders im Siegfried, dass die Naturebene mit der Handlungseben nicht nahtlos einhergeht.
Siegfried ist der Revoluzzer, bereit zum Ziehvatermord, um sich zu emanzipieren. Er zieht aus, um das Fürchten zu lernen und erweckt schließlich sein „Schneewittchen“ Brünnhilde durch einen Kuss aus dem komatösen Schlaf. Diese ist übrigens seine Tante! Darüber hinaus ist dieser „Antiheld“ ein infantiler, naiver Rüpel, der leicht zu manipulieren ist. Und hätte er nicht seine Lippen mit Fafners Blut getränkt, wodurch er nicht nur die Sprachen der Tiere versteht, sondern auch die eigentliche Absicht der Menschen durchschaut, wäre er ein allzu leichtes Opferlamm für die Machenschaften des ihn gängelnden Mime geworden.

Wo also ansetzen bei einer Inszenierung des „Siegfried“? Ich darf dabei als bekannt voraussetzen (wie ich aus eigenen Gesprächen mit Regisseuren bestätigt gefunden habe), dass sich ein Regisseur vor einer Inszenierung alle für ihn zugänglichen Aufnahmen ansieht und für ihn verwertbare interessante Details dann in abgewandelter Form für seine eigene Inszenierung verwendet. Und so gelangen dann Reminiszenzen an andere „Ring-Inszenierungen“, wie sie Klaus Billand minutiös in seiner Besprechung der Premiere aufgelistet hat, auch in diese aus manchen entlehnten Puzzleteilen anderer Inszenierungen zusammengewürfelte eigene postmoderne Sichtweise des Siegfried.
Mimes Schmiede verkommt da im Bühnenbild von Gisbert Jäkel zu einem willkürlich zusammengestellten Stilmix aus Reifendeponie (Mad Max, 1980) mit Küche aus den prüden fünfziger Jahren (in den Filme mit Doris Day), Flachbildschirm und Tablett Computer aus dem 21. Jhd., Esse und Amboss aus der Zeit der Uraufführung. Und über allem schwebt die Projektion einer Favela aus Rio de Janeiro…

Während der Wissenswette werden dann die einzelnen Fragen durch eingeblendete Videosequenzen von Falko Sternberg zu den allgemeinen Themen von Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht, in einem dramaturgisch nicht unbedingt schlüssigen Zusammenhang, untermalt, wobei Andreas Frank für den raschen Lichtwechsel zwischen den Szenen sorgte.
Der Humor, so dachte sich Regisseur Uwe Eric Laufenberg offensichtlich, darf in einem „Satyrspiel“ nicht fehlen und so „spällt“ Siegfried mit seinem frisch gegossenen Schwert Nothung zu Ende des ersten Aktes anstelle des Ambosses eine Wassermelone, spielt mit Teddybären und Legomodellen. Und hetzt statt des obligaten, in einem Bärenkostüm steckenden Statisten, einen „bärigen“ Punkrocker auf Mime (wo er den wohl im menschenleeren Wald aufgetrieben hat?).
Aber so „menschenleer“ ist dieser Wald denn doch nicht, das erfahren wir spätestens im zweiten Akt im Inneren der Neidhöhle. Diese ist ein von dorischen Säulen zu beiden Seiten der Bühne flankierter Geldbunker mit Gittertor, in dem Fafner seinen Hort hütet. Alberich und Mime können sich nur durch eine Sprechanlage am Eingang mit dem „Wurm“ verständigen. Nach dem Kampf Siegfrieds mit dem Drachen, mit den üblichen Schablonen von Urweltungeheuren à la Tyrannosaurus rex aus Jurassic Parc, wird dann das Innere dieses Bunkers sichtbar. Bankier Fafner hat in seinem Imperium Neidhöhle offensichtlich eine ganze Armada beschäftigt. Natürlich sind zwei sonnenbebrillte Bodyguards in schwarzen Anzügen dabei und Bankangestellte in dezenter grauer Businesskleidung (Kostüme: Antje Sternberg). Den lästigen Paparazzi müssen sich Siegfried, der nun einen Anzug und die typische Richard-Wagner-Kappe trägt, und der Waldvogel einem Interview unterziehen. Nachdem Siegfried Mime getötet hat, erfolgt eine spannende Generalpause, in der das Publikum durch eine Einblendung erfährt, das der Komponist an dieser Stelle die Vertonung des Siegfried für zwölf Jahre unterbrochen hat, um sich der Komposition der „Meistersinger von Nürnberg“ und „Tristan und Isolde“ zu widmen. Danach stürmt Jung Siegfried, geleitet vom Waldvogel, dem Walküren Felsen entgegen…

Im dritten Akt befinden wir uns wieder in der aus der Walküre bekannten verdreckten Reithalle. Der Walküren Felsen in der Mitte gleicht wiederum dem Denkmal der barbusigen französischen Marianne Im Inneren wartet geduldig Brünnhilde auf jenen furchtlosen „Helden“, der sie dereinst wachküssen werde. Und nachdem das geschehen ist, irren beide, von der Regie scheinbar gänzlich im Stich gelassen, planlos über die Bühne umher. Aber zum Happy End dürfen die beiden einander wenigstens leidenschaftlich küssen und umarmen… Vorhang!
Am Pult des bestens einstudierten Bruckner-Orchesters stand an diesem Abend Takeshi Moriuchi, mit Argusaugen dabei war auch Dennis Russel Davies, der scheidende GMD, der die Aufführung aus dem Zuschauerraum mitverfolgte. Moriuchi konnte das Bruckner-Orchester zu wahren Höchstleistungen anspornen, die dem internationalen Vergleich durchaus standhalten können. Die hervorragende Akustik des Musiktheaters Volksgarten brachte die ausgezeichneten Streicher, die hervorragende Celli und Viola da braccio zu vollendeter Entfaltung. Ein vereinzelter Bläserpatzer unterläuft auch den Philharmonikern in Wien. Bravo!
 Lars Clevemann hat den Siegfried erstmals 2006 in Stockholm gesungen, später folgte dann die Metropolitan Opera. Ihm gelangen vor allem die Spitzentöne beim Schwertschmieden besonders gut. Dazwischen musste er sich aber immer wieder von dieser Gewaltanstrengung hörbar erholen, was auf wohl einen Rückschluss auf eine mangelhafte Technik zulässt. Darstellerisch ist er freilich trotz Langhaarfrisur kein juveniler 17jähriger Siegfried mehr. Dennoch vermag er durch eine intensive Rollengestaltung in der Interaktion zu punkten.
Lars Clevemann hat den Siegfried erstmals 2006 in Stockholm gesungen, später folgte dann die Metropolitan Opera. Ihm gelangen vor allem die Spitzentöne beim Schwertschmieden besonders gut. Dazwischen musste er sich aber immer wieder von dieser Gewaltanstrengung hörbar erholen, was auf wohl einen Rückschluss auf eine mangelhafte Technik zulässt. Darstellerisch ist er freilich trotz Langhaarfrisur kein juveniler 17jähriger Siegfried mehr. Dennoch vermag er durch eine intensive Rollengestaltung in der Interaktion zu punkten.
Elena Nebera gefiel mir als „Siegfried“-Brünnhilde besser als zuvor in der Walküre. Sie sang dieses Mal auch äußerst textverständlich und vermittelte durch ihre leidenschaftliche Interpre-tation einer Dea Virgo Immaculata berührende Momente. Alle Spitzentöne einschließlich des Finaltones gelangen ihr hervorragend. Ein stellenweise auftauchendes Tremolo in der Mittellage vermochte den sehr guten Gesamteindruck an diesem Abend keinesfalls zu schmälern.
Gerd Grochowski drohte als Wanderer im dritten Akt, so hatte ich den Eindruck, stimmlich einzubrechen, zu stark hatte er sich in den beiden Akten zuvor verausgabt. Aber auch er hatte einige wirklich hervorragende und berührende Momente aufzuweisen, etwa in der Wissenswette und in der Auseinandersetzung mit Alberich. Der Mime von Matthäus Schmidlechner empfahl sich mit seinem baritonal gefärbten strahlendem Charaktertenor und intensiver Rollengestaltung den großen Bühnen Donau ab- und aufwärts.
Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend war der hämisch verschlagene Alberich von Bjørn Waag mit mächtiger, furchteinflößender Röhre.

Nikolai Galkin sang einen zufriedenstellenden Fafner, der nach seinem Tod von zwei Sicherheitswachebeamten auf einem sich im Inneren der „Neidhöhle“ befindlichen goldenen Quader aufgebahrt wird.
Die ungarische Altistin Bernadett Fodor agierte rollengerecht als Erda in schäbigem Kostüm. Gotho Griesmeier zwitscherte einen beherzten Waldvogel mit glockenhellem Sopran und bewies, dass sie auch Blockflöte spielen kann.
Das aus Nahem und Fern angereiste Publikum (zahlreiche nach der Vorstellung wartende Busse belegten das große Einzugsgebiet des Linzer Opernhauses) gefiel, nach dem starken Schlussapplaus schließend, das Gesehene und auch der Rezensent war mit dieser Produktion, trotz der ausgezeigten Mängel, zufrieden. Man hat in Bayreuth vor kurzem „Schlimmeres“ erlebt. Und die musikalische Leistung des Bruckner-Orchesters unter seinem verdienten Dirigenten sowie aller mitwirkenden Solisten an diesem Abend lohnen allemal einen Besuch des Linzer Musiktheaters.
Harald Lacina, 08.12.2014 Fotos: Karl Forster
Walter Braunfels
ULENSPIEGEL
besuchte Vorstellung am 14.9.14 in der Tabakfabrik Linz (Prem. am 10.09.14)
Erschütternde Kriegsoper am Vorabend des 1. Weltkriegs

In den zwanziger Jahren des vorigen Jhd. zählte Walter Braunfels (1882-1954), neben Richard Strauss und Franz Schreker, zu den meistgespielten deutschen Opernkomponisten. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde es still um den als Sohn eines zum Protestantismus konvertierten Juden geborenen Komponisten. Nach dem zweiten Weltkrieg galt Braunfels‘ Stil bei den Vertretern der Avantgarde als veraltet. Erst seit den neunziger Jahren des vorigen Jhd. nimmt das Interesse an Braunfels‘ musikdramatischen Werken wieder zu. Von seinen acht vollendeten Opern erreichten zunächst „Die Vögel“ bei ihrer Wiederaufführung u.a. in Wien 2004, Cagliari 2007 und Los Angeles 2009 eine größere internationale Beachtung.
Nun ist die Zeit reif geworden für den „Ulenspiegel“, einer Oper in drei Aufzügen, op. 23, die vierte Oper von Walter Braunfels, uraufgeführt am 4. November 1913 am Königlichen Hoftheater Stuttgart unter Max von Schillings. Der Komponist selbst verfasste das Libretto nach dem französischen Roman „La légende et les aventures héroiques joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays des Flandres et ailleurs“ (1867), in Deutsch „Die Mär von Eulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen, ergötzlichen und rühmlichen Abenteuern in Flandern und anderen Ländern“ (übersetzt von Georg C. Lehmann) des belgischen Schriftstellers Charles Théodore Henri De Coster (1827-1879).

Obwohl dem Ulenspiegel bei seiner Uraufführung in Stuttgart 1913 ein Achtungserfolg beschieden war, wollte sich der nach dem ersten Weltkrieg zum Katholizismus konvertierte Komponist mit dem betont antikatholischen Stoff des Ulenspiegels nicht mehr auseinander setzen. Und so blieb es bei dieser einzigen Aufführung der Oper in Stuttgart. Auf Betreiben der Enkelin des Komponisten, Susanne Bruse, wurde das Notenmaterial des „Ulenspiegels“ dem Dämmerschlaf im Archiv der Stuttgarter Oper entrissen und das Werk 2011 mit großem Erfolg in Gera wieder szenisch aufgeführt.
Zum Inhalt: Der exzentrische protestantische Narr Till Ulenspiegel ist ein Außenseiter, der sich über die Ablasspriester lustig macht und ihnen unerschrocken entgegen tritt und erst als er die Nachricht vom Tod seines Vaters erhält, mit einem Male aus seinem Traumleben erwacht und nun zum erbitterten Anführer der Geusen in Vlissingen gegen die katholischen Peiniger wird. Nele, seine Geliebte, wird getötet, als sie sich schützend vor ihn stellt. Doch Ulenspiegel ist bereits derart traumatisiert von den Ereignissen, dass er sein Leben nur mehr der Rache und dem Kampf gegen die Spanier weiht.
Der Verein EntArteOpera führte nun den „Ulenspiegel“ in Zusammenarbeit mit dem internationalen Brucknerfest in einer Bearbeitung von Werner Steinmetz für großes Kammerorchester in der ehemaligen Tabakfabrik Linz, einem historisch geschichtsträchtigen Ort, zum ersten Mal szenisch in Österreich auf. Martin Sieghart leitete das Israel Chamber Orchestra mit Verve und Braunfels ausdrucksstarke Musiksprache mit ihren ekstatischen Ausbrüchen an der Grenze zur Atonalität entfaltete ungeheure Klangcluster in der riesigen Halle des Veranstaltungsortes. Unterstützt wurde er dabei noch von Franz Jochum, der den Chor EntArteOpera zu Höchstleistungen anspornte. Seine musikalischen Wurzeln sah Braunfels übrigens in Hector Berlioz, Richard Wagner, Anton Bruckner und Hans Pfitzner.
Regisseur Roland Schwab möchte mit seiner beklemmenden Interpretation des Ulenspiegels aufzeigen, dass Krieg jeden Menschen verändert und zu einem Zerrbild seiner Selbst werden lässt. Seine stringente Personenführung arbeitet auch jede Figur des Chores individuell heraus, sodass dieser nicht als Gesamtheit, sondern als Summe von Einzeldarstellern in der Aufführung in Erscheinung trat. Susanne Thomasberger verortete das Geschehen in einer fiktiven Gegenwart mit zahlreichen Reverenzen (Autowracks, Reifen, etc) an den australischen Film „Mad Max“ von 1980. Die spanischen Unterdrücker tragen schwarze Lederkleidung, die ihre Gewaltbereitschaft und Grausamkeit noch optisch unterstreicht, während die Niederländer zum überwiegenden Teil mehr volkstümlich gekleidet auftreten.
Marc Horus lieferte einen darstellerisch grandiosen Titelhelden Till Ulenspiegel, der überzeugend den Wandel vom gewitzten Narren zur ausdrucksleeren Kampfmarionette vollzog und dabei seinen markigen Tenor schön zur Entfaltung brachte, wenngleich er in der Höhe manchmal doch Probleme hören ließ. Aber wen wundert das, bei einer so mörderischen Partie mit Tristan Ausmaßen?
Hans Peter Scheidegger gefiel als besorgter und später gefolterter alter Kohlenbrenner und Vater Klas mit markigem Bass. Als Findelkind Nele beeindruckte Christa Ratzenböck mit ihrem gewaltigen Sopran, mit dem sie immer wieder gesangliche Akzente setzte. Als Profoss des Herzog Alba agierte Joachim Goltz so richtig abgrundtief böse, wozu sein Bassbariton ein Übriges beitrug. Andreas Jankowitsch ergänzte noch rollengerecht als Schuster und als alter Holländer Jost mit polterndem Bass.
Die übrigen Mitwirkenden hatten gleich mehrere Rollen zu gestalten. Zu sehen und hören waren Tomas Kovacic, Martin Summer, Saeyoung Park, Dimitrij Leonov, Neven Crnic, Mario Lerchenberger und László Kiss als Ablasspriester, Bäcker, Fischer, Schneider, Schreiber, Schreiner, Schuster Seifensieder, Soldat, Zimmermann, als Schmied von Damme, Bürgermeister von Vlissingen und spanischer Arkebusier.
Das Programmheft zählt noch die solistisch aufgetretenen Mitglieder des Chores und die mitwirkenden sieben Statisten namentlich auf.
Der enorme Applaus am Ende der rund 2,5 stündigen Oper drückte wohl den tief empfundenen Dank des Publikums aus, ein wichtiges Werk des 20. Jhd, in einer äußerst gelungenen szenischen Aufführung miterlebt zu haben. Ich könnte mir eine Übernahme dieser Produktion an ein Haus wie die Wiener Volksoper durchaus vorstellen, die damit an die Erfolge der Vögel, König Kandaules und Irrelohe anknüpfen könnte.
Harald Lacina, 15.9.2014 Fotos: Julia Fuchs