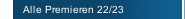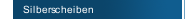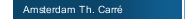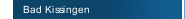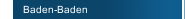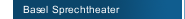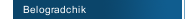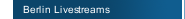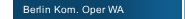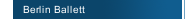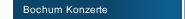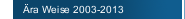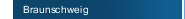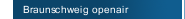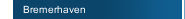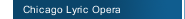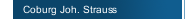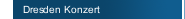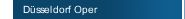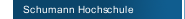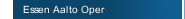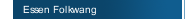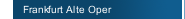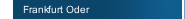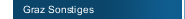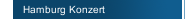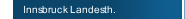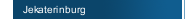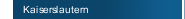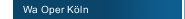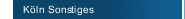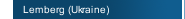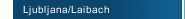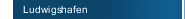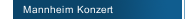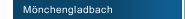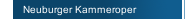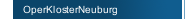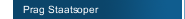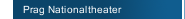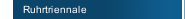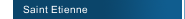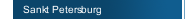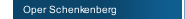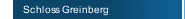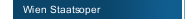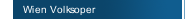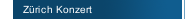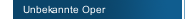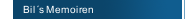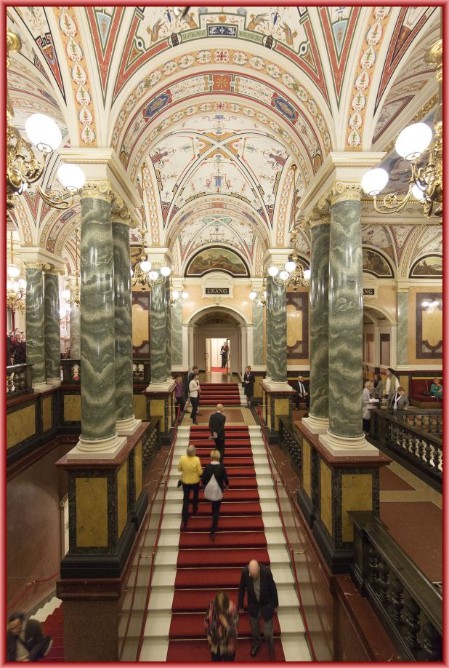www.semperoper.de/

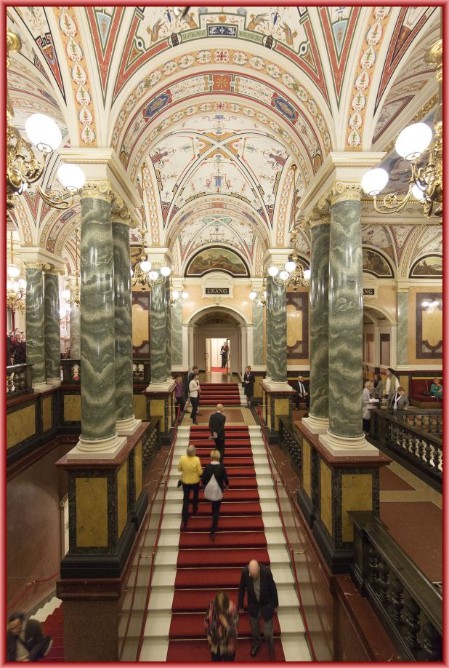
9. Oktober 2022 Semperoper Dresden
Ton Koopmann mit Mozart, Weber und Haydn
Der Bach- und Buxtehude-Spezialist im zweiten Symphoniekonzert 2022
Der weltweit gefragte und renommierte Spezialist für die sogenannte „Alte Musik“ und vor allem als Bach- und Buxtehude-Kenner anerkannte Ton Koopman war bereits im April des Jahres mit dem neunten Symphoniekonzert der vorherigen Saison zu Gast im Semperbau gewesen und hatte vor allem mit Händels „Feuerwerksmusik“ brilliert.
Im zweiten Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle in der laufenden Saison stellte Koopman seine Interpretationen von Kompositionen Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Carl Maria von Weber (1786-1826) und Joseph Haydn (1732-1809) vor.

Von einer Konzertreise mit seiner Mutter schrieb der 22-jährige Wolfgang Amadeus Mozart an seinen Vater „....ach, wenn wir doch clarinetti hätten- sie glauben nicht was eine sinfonie mit fleuten, oboen und clarinetten einen herrlichen Effekt macht“. Die Entwicklung des Instruments war zwar seit dem Ende des 17. Jahrhunderts fortgeschritten, hatte sich aber erst zögerlich im Konzertbetrieb etabliert.
Nachdem ab 1770 die Bassettklarinette mit ihrem, dank des längeren Unterstücks, den Tonumfang in der Tiefe ausweitete, wurde die Klarinette zunehmend Mozarts Lieblingsinstrument. Um 1785 skizzierte er einen Allegro-Satz für Bassetthorn, einer Tenorspielart der Klarinette, und Orchester in G-Dur.
Die Freundschaft und gemeinsames Musizieren mit dem aus Prag nach Wien gekommenen Instrumentalisten Anton Stadler (1753-1812) war Veranlassung, bereits 1789 dieses in der Musiksystematik als KV 584b erfasste Material nahezu unverändert für die tiefere Bassettklarinette in A-Dur zu transponieren und damit den Kopfsatz des „Konzertes für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622“ zu gestalten.
Das Ohrwurm-Adagio haben Mozart und Stadler offenbar beim gemeinsamen Musizieren derart Solo-lastig kreiert, dass auf eine Kadenz verzichtet wurde.
Die Wandlungsfähigkeit der Klarinette und der, dank des Verzichtes Mozarts auf Ausdruckskontraste, erlaubten über alle drei Sätze des Konzertes den einheitlichen Musikeindruck.

Ton Koopman gelang es auf das Vollkommenste, eine Synthese aus den liedhaften Orchestepassagen und Robert Oberaigners „sprechender Solostimme“ zu schaffen. Der Dialog des Solisten, wenn er seine Themen subtil in den Streicherklang einfügte, gestaltete eine gelassen-heitere Stimmung und innige Wärme der Empfindungen.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) steht nicht auf der Liste der Meister des Concerto grosso. Und doch hat er sich mit der„Serenata notturna“, seiner „Serenade Nr. 6 D-Dur KV 239“, in dieser im Barock entstandenen Konzertform versucht, bei der eine kleine solistisch behandelte Gruppe einer größeren Musikerformation gegenüber steht.
Bei Mozart sind zwei Soloviolinen, eine Bratsche und ein Kontrabass mit der Streicher-Formation sowie der Pauke kombiniert.
Die „Serenade“, abgeleitet von „sereno=wolkenloser Himmel“, gleichsam der Begriff für eine aus kurzen Sätzen bestehende, oft zur Unterhaltung im Freien gedachte Komposition. Notturno weist auf die Verwendung zum abendlichen Vergnügen. So wie das Stück untypisch für Mozart daherkommt, bleibt zweifelhaft, ob das im Januar 1776 geschrieben Stück für eine open air –Gelegenheit gedacht war. Es ist denkbar, dass Mozart das KV 239 zu seinem 20. Geburtstag schrieb oder das Stück dem Kälte-resistenten Teil des Salzburger Karnevals zu eignete.

Nach der militärisch anmutenden Einleitung des Paukers brachen Matthias Wollong, Holger Grohs, Florian Richter und Andreas Ehelebe mit einem zarten Cantabile die martialischen Attitüden. Ein ständig stärker ironisierender Klangwechsel zwischen den zarten Soli und dem kräftigen Tutti markierte den „Marcia-Satz“. Das Menuetto kam tatsächlich wie ein Karnevalstanz daher, während das galante Trio den Solo-Streichen vorbehalten blieb.
Die von Mozart im Finalsatz verorteten Überraschungen, etwa dem raschen Wechsel zwischen gestrichenen und gezupften Saiten heiterten die Hörenden zusätzlich auf.
Der Leistung des Paukers Christian Langer wurde von Koopman besonders gewürdigt.
Der „Mozart-Block“ des Konzertes war von Kompositionen Carl Maria von Webers (1786-1826) und Joseph Haydns (1732-1809) umschlossen.
Webers Freischütz-Ouvertüre hat nicht nur das Potential, Hörende auf die Stimmung der Oper ein zustimmen. Seine musikdramatische Doppelbödigkeit ermöglichte Ton Koopman einen beschwingten und klangkulinarisch gehaltvollen Konzertauftakt zu gestalten. Harmonisch-liebliche Beschaulichkeit war offenbar nicht sein Anliegen. Nach den furiosen Eingangspassagen setzte er kontrastreich-zart die Holzbläser-Solisten entgegen.
Webers Fülle von Motiven, eigentlich ein Vorgriff auf Wagners „Leitmotiv-Technik“, die Steigerung zu einem strahlenden C-Dur-Akkord gaben Koopman die Voraussetzungen, den Konzertstart zu einem Kabinettstück seines Dirigats zu gestalten.

Den Konzertabschluss bestritt Joseph Haydns vorgebliche „Militärsymphonie“ Nr. 100 G-Dur aus der späten Londoner Zeit des Komponisten.
In Koopmans Deutung des Werkes ging es aber offenbar nicht um „Leben und Tod“, sondern allenthalben um fröhliches militärisches Leben. Selbst wenn Becken, Triangel und große Trommel mit Drastik Einbrüche martialische Gewalt im Allegretto in die friedliche Idylle befürchten ließen, hatte der dritte Satz „Menuet“ kaum etwas Kriegerisches zu bieten. Denn auch das eher volksmusikalisch geprägte Finale ließ den drohenden Gewaltausbruch rechtzeitig in friedlichere Bereiche abbiegen, so dass das Publikum friedlich gestimmt, nachdem heftig-freundlicher Beifall gespendet war, den Semperbau verlassen konnte.
Die Matinee war ausverkauft. Die Finger einer Hand reichten für das Auszählen der unbesetzten Plätze aus. Für die Abendkonzerte des gleichen Programms sind allerdings noch ausreichend Tickets zu erwerben.
Bilder © Oliver Killig
Thomas Thielemann, 16.10.22
10. Juli 2022 Semperoper Dresden
Der designierte Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle stellt sich vor
Daniele Gatti dirigiert Gustav Mahlers 9 Symphonie im letzten Saison-Konzert
Als Gastdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden hatte Daniele Gatti ein sensibles Gespür für den besonderen Klang des Orchesters erkennen lassen und Verständnis bei seinen Dirigaten für die Musiker gezeigt. Mit der Matinee am 10. Juli 2022 konnte er sich als „Designierter Chefdirigent“ mit Gustav Mahlers (1860-1911) neunten Symphonien den Dresdner Musikfreunden vorstellen.
Nach dem Tod der vierjährigen Tochter Maria Anna und einem Zusammenbruch Almas suchte das Ehepaar Mahler am 14. Juli 1907 den Arzt Carl Viktor Blumenthal (1868-1947) auf. Aus einer Laune heraus ließ sich im Anschluss der Behandlung Alma Mahlers (1879-1964) auch Gustav Mahler untersuchen, bei der der Mediziner eine Herzklappenerkrankung feststellte. Der Wiener Spezialist Dr. Friedrich Kovac (1861-1931) bestätigte Tage später eine rheumatische Verengung von Herzklappen, eine Mitralstenose und verbot Gustav Mahler das Schwimmen, Radfahren und Bergaufgehen.
Möglicherweise war die Erkrankung eine vom der Mutter Maria Mahler (1837-1889) ererbte Anlage, die zeitlebens „herzleidend“ gewesen und an Herzversagen verstorben war. Das Verhältnis Mahlers zu seiner Mutter sei sehr komplex gewesen und seine Erinnerungen seien für Gustav gleichzeitig mit Leben und Tod verbunden gewesen.

Gustav Mahler begann nach der Diagnose in sich hineinzuhorchen und hielt die ärztlichen Empfehlungen sklavisch ein. Er benutzte einen Schrittzähler und fühlte ständig seinen Puls. Erst als Dr. Franz Hamperl (1866-1920) die Diagnosen, die Bedeutung der Herzrhythmusstörungen sowie die Maßregelungen seiner Kollegen relativierte und empfahl, das Angebot der „Metropolitan Opera“ vom Mai 1907 anzunehmen, „normalisierte“ sich sein Lebensstil. Geblieben waren aber seine Todesahnungen.
Nach seinem Abschiedskonzert an der Hofoper am 15. Oktober 1907 verließ die Familie im Dezember Wien in Richtung New York.
Die Verhältnisse an der Metropolitan waren für Mahler unbefriedigend, obwohl er mit Stars wie Enrico Caruso (1873-1921) und, allerdings seltener, mit Fjodor Schaljapin (1873-1938) arbeiten konnte, so dass er nach zwei Spielzeiten den Vertrag kündigte. Vor allem Sponsorinnen beschafften die finanziellen Mittel, dass die angeschlagen dahin dümpelnden „New York Philharmonics“ verjüngt und materiell ausgestattet auf Mahlers Ansprüche ausgerichtet werden konnten. Mit dem Orchester bestritt er 1909 und 1910 reine Konzertjahre.
Am gesellschaftlichen Leben der Stadt nahm er, anders als in Wien, häufiger Teil, vor allem um sein Verhältnis zu seiner Frau Alma zu verbessern. Die Sommer verlebte die Familie im Tiroler Toblach.
Die ersten Skizzen der 9. Symphonie waren bereits im Jahre 1908 geschrieben worden. Im „sakral-jenseitsverlockendem“ Komponier-Häusl von Toblach verfällt Mahler im Sommer 1909 in einen Schaffensrausch, komplettierte den Entwurf und fertigte noch im gleichen Jahr eine Reinschrift der Partitur.

Entstanden war ein emotionales Lebewohl, das die Milde des Todes, das Versprechen einer Versöhnung, aber auch das Aufbäumen gegen die Unaufhaltsamkeit des Endlichen umfasst. Mit dem Aufbau der Symphonie waren die Formtraditionen der Gattung auf den Kopf gestellt, indem die langsamen Passagen die Ecksätze bilden: der Kopfsatz eröffnet mit einem Seufzer-Motiv und das Finale endet in einem langsamen Ersterben. Diese musikalische Form der Komposition gibt damit das Gerüst für eine Auseinandersetzung mit der Lebenszeit: Geburt, Kindheit, Jugend, Reife, Alter und Tod.
Mahlers Musik wurde zum Abgesang auf das Zeitalter der Romantik und steht am Beginn der Moderne, sie verkörpert Abschied und Aufbruch gleichermaßen. In wie weit Todesängste Mahler getrieben haben, mit seiner Abschiedsmusik die Tür zu neuen Welten aufzustoßen, kann nur Spekulation bleiben.
Der Umstand, dass zu dieser Zeit bereits Skizzen zu seiner 10. Symphonie entstanden sind, könnte nur bedeuten, dass Mahler auch in der Hoffnung lebte, den „Fluch der neunten Symphonie“ überwunden zu haben.

Mit seinem Dirigat des Kopfsatzes führte Daniele Gatti seine Hörer unter einem großen Bogen und stockenden Passagen fast mühevoll zu Mahlers intensiver Musik. Erst intensive Dialoge von Cello und Harfe sowie Horn und Violine führten Gatti zum Hauptmotiv der gewaltigen kontrastreichen Ausbrüche, bevor er das Orchester den intensiv fordernden Satz mit innigen Ausdrucksmomenten seltsam entrückt leise verklingen ließ.
Mit Ironie, Sarkasmus und hemmungsloser Virtuosität, so gar nicht im gemächlichen Ländler-Tempo, dirigierte Gatti das Scherzo. Fast desolat und desillusioniert ließ er die ihm freudig folgenden Musiker der Sächsischen Staatskapelle die verzerrten Disharmonien spielen, bevor der Spuk ausklang.
Im Rondo-burlesk bewegte sich das Gatti-Dirigat eine knappe Viertelstunde in einer fast missgünstigen Eleganz mit schadenfrohem Spaß am Banalen. Gleichsam betonte er die choralartige Rückkehr zum Hauptthema des ersten Satzes und die Vorgriffe Mahlers auf das zentrale Thema des Finalsatzes, gestaltet den Satz zum retardierenden Moment seiner Interpretation.
Damit kam Daniele Gatti im Finalsatz ohne emotionale Erschütterungen und Sentimentalitäten aus. Das Wesentliche war dargeboten, so dass mit Ruhe, sowie Gelassenheit Abschied genommen werden konnte. Mit dem Zitat aus den „Kindertotenliedern Nr. 4 Takt 64 bis 69“ bewies das Orchester im abschließend verklingendem Adagissimo mit einem extremen Pianissimo noch einmal seine absoluten Qualitäten.
Das erschöpfte Publikum applaudierte mit kraftvollen stehenden Ovationen Daniele Gatti und einem außergewöhnlich lange auf dem Podium ausharrendem Orchester für diese im Semperbau wohl noch nicht gehörte Form einer Mahler-Interpretation.
Leider waren die im Corona-Vorverkauf entstandenen Lücken in den Besucherreihen nicht vollständig gefüllt worden, so dass Plätze ungenutzt geblieben waren.
Thomas Thielemann, 12.7.22
Autor der Bilder: Matthias Creutziger
2. Juli 2022 Semperoper Dresden
Der zweite Geniestreich des Dmitri Schostakowitsch
Peter Konwitschny inszeniert „Die Nase“
Derzeit gaben die Auswüchse der parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaates, des Datenschutzes sowie des Genderwahnsinns ausreichende Voraussetzungen zu bösen Aktualisierungen des Sujets.
Für Petr Popelka war der Premierenabend seine erste Musikalische Leitung im Semperbau. Mit den Musikern der Sächsischen Staatskapelle gelang ihm eine konsequent-lockere Umsetzung der bissig-komplexen Partitur Dmitri Schostakowitschs. Hatte doch dieser mit jugendlicher Unbekümmertheit durcheinander gewirbelt, was ihm so eingefallen war: schräge Märsche, Tanzmusik, geistliche Gesänge und sarkastische Folklorismen. Das war alles mit ständigen Taktwechseln, waghalsigen Instrumentationen, beherzten Lautmalereien sowie atonalen Reibereien verbunden. Lustvoll wurden die musikalischen Grenzüberschreitungen ausgelebt.

Der Bariton Bo Skovhus sang und spielte den Kollegienassessoren Platon Kusmitsch Kowaljow mit unerbittlicher Ironie, dass dem Zuschauer das Lachen im Halse stecken blieb. Sein kaltes Entsetzen, seine existenzielle Verlorenheit und zugleich seine Unterwürfigkeit im Bemühen, seine Nase wieder zu bekommen, waren von Skovhus brillant auf die Bühne gebracht.
Der Chor von Singenden des Sächsischen Staatsopernchores, des Sinfoniechores Dresden und des Extrachores der Semperoper sowie die weiteren fünfzehn Solisten überwiegend aus dem Hausensemble agierten auf hohem Niveau.
Die Rollen verlangten überwiegend verfremdete Tongebungen bis hin zum Sprechgesang.
Neben der grandiosen Katerina von Bennigsen wären Jukka Rasilainen als Barbier Iwan Jakowlewitsch, Timothy Oliver als Diener Kowaljows, Aaron Pegram als „der liebe Gott“, Martin-Jan Nijhof als Doktor Jesus und als Mutter-Tochter Podtotschina Sabine Brohm mit Alice Rossi genannt.
Aber das ist schon wieder ungerecht, den Ungenannten gegenüber.
Das Libretto der Oper hatte der Komponist auf der Grundlage der gleichnamigen Novelle des Nikolai Wassiljewitsch Gogol(1809-1852) aus dem Jahre 1836 mit drei befreundeten Literaten erarbeitet: Jewgeni Samjatin (1884-1937), Arkadi Preis und Georgi Ionin. Der als Schriftsteller profilierteste des Quartetts ist zweifelsfrei Samjatin gewesen. Als Berufsrevolutionär war er 1905 an der Organisation der Matrosen-Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin beteiligt gewesen und war bis 1917 in britischer Emigration gewesen. Sein Hauptwerk über eine fiktive Gesellschaft, in der jede Individualität unterdrückt ist, der Gesellschaftsroman „Wir“ ist das erste Buch, welches in der UdSSR verboten worden war. Mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in der Sowjetunion der 1930-er Jahre konnte sich der Kommunist Samjatin letztlich aber nicht arrangieren, so dass er 1931 auf Anregung Maxim Gorkis (1868-1937) das Land verlassen konnte. In Paris ist er wenige Jahre später an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

Ein weiterer des Autoren-Quartetts, Arkadi Preiss hat über das „Nasen-Libretto“ hinaus weiter mit Schostakowitsch gearbeitet und unter anderem das Libretto der Oper „Lady Macbeth von Mzenck“ verfasst.
Während in Gogols literarischer Vorlage die Kritik am zaristischen Überwachungsstaat den Kontext bestimmte, brachte das Opernlibretto vor allem das bürokratische System und das opportunistische Verhalten von Teilen der sowjetischen Gesellschaft um 1930 auf die Bühne.
Genauso wie Schostakowitschs Jugend-Streich „Die Nase“ im Divergenz-Bereich der avantgardistischen Musik- und Theaterexperimente der 1930-er Jahre und der sich formierenden Kulturpolitik Stalinscher Prägung entstanden war, haben Verwerfungen unseres gesellschaftlichen Umfelds in die spritzigen Inszenierung gefunden.

Die handwerklich hervorragende Inszenierung mit ihren subtilen Personenführungen begann im ersten Teil fast klassisch, lebte zunächst von einigen eindringlich-beklemmenden Bildern und der wechselvollen Bühnenbauten Helmut Brades. Dazu gehörte ein mehrere Minuten dauerndes Intermezzo von neun Schlag-Instrumenten, zur Verdeutlichung der Verhörszene des Barbiers, ein absolutes Novum im Operngeschehen. Auch die von Katerina von Bennigsen und Bo Skovhus grandios umgesetzte Sturmbahn-Szene, ein Hinweis auf die neue Wehrhaftigkeit unserer Gesellschaft, gehörte dazu.

Was im ersten Teil schlaglichtartig aufkommt, entwickelte sich im zweiten Teil der Inszenierung zum Feuerwerk der Ideen. Ganze Teile des Geschehens einfach in den Himmel zu verorten oder gleich dem Teufel zu überlassen, war schon genialisch. Eine Wasserkanone, viel Grünes rundeten die aktuellen Bezüge und ließen den zweiten Teil zum Hochgeschwindigkeitstheater auflaufen.
Das Premieren-Publikum bedankte sich bei den Agierenden der Vorstellung und bei Peter Konwitschny sowie Helmut Brade mit frenetischem Jubel für den brillanten Opernabend.
© Ludwig Olah
Thomas Thielemann, 5.7.33
29. Juni 2022 - Semperoper Dresden
Vorabendkonzert der Gohrischer Schostakowitsch-Tage 2022
Omer Meir Wellber und Vadim Gluzman mit Gubaidulina und Schostakowitsch
Vom 30. Juni 2022 bis zum 3. Juli 2022 finden in Gohrisch die „13. Internationalen Schostakowitsch-Tage“ statt. Traditionell fand am 29. Juni 2022 zur Einstimmung der über Dresden anreisenden Gäste in der Semperoper ein Gohrisch-Vorabend-Konzert der Sächsischen Staatskapelle mit dem Dirigenten Omer Meir Wellber statt.
Als Dmitri Boleslawitsch Schostakowitsch (1875-1922) verstorben war, musste dessen zweiter Sohn Dmitri, der am Retrograden Konservatorium ein Studium der Kompositionslehre absolvierte, einen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie leisten.
Trotz einer Lungen- und Lymphdrüsentuberkulose begleitete er nach den Lehrveranstaltungen in den Petrograder Kinos die Stummfilm-Vorführungen mit Klavierimprovisationen. Dabei sind ihm unzählige musikalische Einfälle untergekommen, die er zu einer Komposition verdichtete und als seine Abschluss-Arbeit des Kompositionsstudiums einreichte.
Für diese Komposition mit einer Fülle von Parodien, die tiefe Gefühle nicht scheut, aber jeder Art von Kitsch abschwört, sind die mittleren zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein günstiger Zeitrahmen. Der Russische Bürgerkrieg ist beendet, die junge Sowjetmacht hatte die wesentlichsten vom Zarismus hinterlassenen gesellschaftlichen Probleme und die mit der „Neuen Ökonomischen Politik“ selbstgeschaffenen Verwerfungen im Griff, so dass man sich um die Entwicklung antibürgerlicher Künste sowie einer proletarischen Kultur kümmern konnte. Mithin wird die Uraufführung der Abschlussarbeit des jungen Genies als seine 1. Symphonie ein großer Erfolg.

Bei einem 1926 in Polen ausgeschriebenen Pianisten-Wettbewerb stellte Schostakowitsch sein Werk außerhalb Russlands vor. Der Juror Bruno Walter war begeistert, bat um die Partitur und führte die Symphonie bereits 1927 in Berlin auf.
Zum Glück der Musikwelt war der Pianist Dmitri Schostakowitsch im Wettbewerb weniger erfolgreich. Damit löste sich der Zwiespalt des Musikers, ob er eine Pianistlaufbahn ergreifen oder als Komponist weitere Erfolge anstreben sollte, wie bekannt auf.
Dass „Mitja“ sich durchaus auf dünnem Eis bewegte, erlebte er bei einem zum Studienabschluss gehörenden Examen in „Marxistischer Methodik“. Aufgefallen war Schostakowitsch mit einem Lachanfall über die Ausführungen eines Mit-Prüflings zu „ Unterschieden der Werke von Chopin und Liszt in soziologischer und ökonomischer Hinsicht“. Als sich der Prüfling Schostakowitsch zum Thema „ Fragen zum soziologischen Prinzip des Bach´schen Stimmungssystems und der Skrjabin´schen Klangaggregate“ auch noch als absolut unvorbereitet erwies, war er durchgefallen. Nur eine Intervention des Direktors des Konservatoriums Alexander Glasunow (1865-1936) ermöglichte eine erfolgreiche Nachprüfung.
Omer Meir Wellber dirigierte am Beginn des Konzertes Schostakowitschs „1. Symphonie“ beherzt, zuweilen frech, mal nachdenklich und gelegentlich auch abgründig, ohne sich in diese Abgründe zu verlieren. Immer gelang immer der Sprung über den tiefen Fall.
Wellbers Interpretation verband auf das Vortrefflichste den klassischen Aufbau der Symphonie mit den Slapstick-Anklängen von „Mitjas“ Eindrücken aus der Zeit des Stummfilm-Begleiters.
Die Musiker der Staatskapelle unterstützten dieses Konzept hervorragend mit ihren respektlos aufspielenden Trompeten, den abstrus blökenden Hörnern sowie den plärrenden Holzbläsern, so dass das Hören nur so eine Freude war.

Als zentrales Werk des Konzertes spielte der Geiger Vadim Gluzman mit der Sächsischen Staatskapelle das 1. Violinkonzert „Offertorium“ von Sofia Gubaidulina.
Gluzman, 1973 in der Ukraine als Sohn eines Dirigenten-Musikwissenschaftler-Ehepaares geboren, wuchs in Riga auf und ist seit 1990 in Israel beheimatet.
Für seine Interpretation des „Offertoriums“ hatte Gluzman die berühmte Stradivari „-Leopold Auer“, gefertigt 1690, mitgebracht. Der Vorbesitzer des Instruments Leopold von Auer (1845-1930) war als Geiger, Violinpädagoge und Dirigent mehrfach in Russland tätig und hat mit der Stradivari im Jahre 1905 das Violinkonzert op. 82 von Alexander Glasunow (1865-1936) uraufgeführt. Das Instrument sollte auch für die Uraufführung des Violinkonzertes von Peter Tschaikowski eingesetzt werden, denn der Komponist hatte das Werk ursprünglich von Auer gewidmet. Die von Auer gewünschten Änderungen waren aber für die erste Drucklegung der Partitur zu spät abgesprochen worden, so dass Auer Widmung und Uraufführung der gedruckten Partitur Fassung ablehnte.
Auer hat übrigens mehrfach im Haus Malerstraße 10 in Dresden-Loschwitz gewohnt und ist auch dort verstorben.
Das Violinkonzert „Offertorium“ hatte Sofia Gubadulina vom Sommer 1979 bis zum März 1980 auf eine Anregung von Gidon Kremer geschrieben und diesem auch gewidmet. Die bis zu dieser Zeit außerhalb der Sowjetunion nahezu unbekannte tatarisch-russische Komponistin wurde mit diesem Werk auch in Westeuropa anerkannt.
Das Offertorium begleitet als Gesang in einigen Choraltraditionen die Vorbereitung des liturgischen Opferritus, die Zurechtlegung des Brotes sowie des Weines für die Verabreichung des Abendmahls, und war üblicherweise ein Wechselgesang.

Vadim Gluzman spielte den komplizierten Solopart extrem differenziert und ausdrucksvoll bis in die letzten Verzweigungen mit großer Leidenschaft. Perfekt ausbalanciert antwortete das Orchester mit fließend ineinander übergehendenden Passagen auf seine Vorgaben. Faszinierend, wie sich sein Instrument selbst in den extremsten Piano-Passagen noch kraftvoll behauptete. Besonders beeindruckte der abschließende Streicherchoral.
Die 9. Symphonie gehört mit Sicherheit zu jenen Arbeiten Dmitri Schostakowitschs, die am intensivsten einem Zuordnungsversuch in das Gesellschaftliche Umfeld und der persönliche Situationen des Menschen Schostakowitsch unterzogen worden sind. Die Interpretation Omer Meir Wellbers ließ nach meinem Empfinden letztlich nur einen erfrischenden Blick auf das Nachkriegswerk zu. Denn nirgends habe ich authentische Hinweise gefunden, dass Schostakowitsch mit dieser Symphonie das Sowjetsystem oder gar Stalin bewusst provozieren wollte. Letztlich findet man in der 9. Symphonie vor allem die Freude über den Sieg und die Erleichterung des Komponisten, dass die Kriegsgreuel beendet sind. Dass Schostakowitsch schon charakterlich in der Lage gewesen wäre, eine Siegeshymne in die Welt zu plärren und er zum Sänger von Stalins Triumph werde, hatte ohnehin kaum jemand erwartet.

Deshalb ließ Omer Meir Wellber den erste Satz allegro eher nachdenklich spielen und beschleunigte sein Dirigat erst mit dem Scherzo, ohne dabei auch in den Folgesätzen zusätzliche expressive Komponenten zusetzen.
Wellber ließ die Musiker der Staatskapelle unbeschwert und fröhlich spielen, betonte dabei das begeisternde Fagott-Solo.
Die Besucher dankten mit stehenden Ovationen für diese in unserem nicht einfachen gesellschaftlichen Umfeld wohltuend belebende Konzertabrundung.
© Matthias Creutziger
Thomas Thielemann, 30.6.2022
19. Juni 2022
Zum 140. Geburtstag Igor Strawinskys
Der 8. Kammerabend der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit Werken von Debussy und Strawinsky
Der 140. Geburtstag Igor Strawinskys am 17. Juni 2022 war für Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden Anlass, am 19. Juni 2022 im Rahmen eines Kammerabends zu einem schillernden Kaleidoskop des französischen Impressionismus in den Semper-Bau einzuladen.
Igor Strawinsky (1882-1971) gehört zweifelsfrei zu den letzten großen Komponisten, die noch mit einem konventionellen Verständnis alle Gattungen der Musik bedient haben. Dabei bewies er eine faszinierende Wandlungsfähigkeit, wechselte von der spätromantischen Tradition des „Feuervogels“ zum Modernistischen „des Petruschka, des Sacre“. Dem folgte das Neoklassizistische mit „Concerto in D; Symphonie in C“, um in seinem Spätwerk zwölftönig zu werden.
Das Septett für Klarinette, Horn, Fagott, Violine, Viola, Violoncello und Klavier dürfte das Schlüsselwerk in Strawinskys Schaffen gewesen sein, als er unter dem Einfluss Robert Crafts (1923-2015) vom Neoklassizismus sich der Zwölfton-Technik annäherte. Arnold Schönberg (1874-1951) war verstorben, die ideologisch aufgeheizte Auseinandersetzung der beiden Titanen konnten nicht weitergeführt werden, so dass Strawinsky seine besondere Kompostionsweise, das Beste aus der Musikhistorie geschickt zu kombinieren, ausleben konnte. Bewegte er sich im ersten Satz des Septetts noch im Neoklassizismus, setzte sich in der Folge mit ständigen Wiederholungen eine konsequente kompositorische Ökonomie durch.
Jan Seifert (Klarinette), Marie-Luise Kahle (Horn), Thomas Eberhardt (Fagott), Lukas Stepp (Violine), Uhjin Choi (Viola) sowie Norbert Anger (Violincello), aber allen voran der Pianist Johannes Wulff-Woesten, konnten Strawinskys Vorlage beeindruckend umsetzen.
Dem Spätwerk Strawinskys aus den Jahren 1952/1953 folgten zwei spätere Kompositionen Debussys, als er erschüttert vom ersten Weltkrieg und von Krankheit gezeichnet sich den kleineren Formen widmete. Mit der Sonate für Flöte, Viola und Harfe, dieser ungewöhnlichen Kombination eines Holzblasinstruments mit einem Streich- und einem Zupfinstruments, versuchte Debussy einen Bezug zurverlorenen Welt des Barocks herzustellen.

Johanna Schellenberger © Bonifaz Weiss
Hervorragend ausbalanciert, sich abtastend, sich aneinander abarbeitetend, gelang es Rozálie Szabó, Wen Xiao Zheng und Johanna Schellenberger die F-Dur-Musik Debussys fast unwirklich in der Schwebe zu halten. Die drei Instrumente umgarnten sich und gaben die Stimmen weiter, so dass man kaum ausmachen konnte, woher die Klänge kamen.
Die d-Moll-Sonate aus der gleichen 1915-er Schaffensperiode Debussys, von ihm für Violoncello und Klavier konzipiert, wurde im Konzert von Anke Heyn und Johanna Schellenberger in einer Fassung für Cello und Harfe geboten.

Anke Heyn
Die beiden Vollblut-Musikerinnen boten ein bestrickendes Klangbild voller Pathos und Theatralik. Mit geradliniger Modellierung antwortete im Kopfsatz das Cello auf die kadenzartigen Vorgaben der Harfe. Besonders in den beiden Mittelsätzen schillerte schwerelose Ironie durch. Im Finale verbeugten sich die Interpreten mit selten gehörten Harfenklängen vor der Barockmusik und führten ihre Darbietung mit reicher Inspiration auf die Spannungen der Entstehungszeit des Werkes zurück.
Der zweite Teil des Konzertes führte uns zum Strawinsky der 1920-er Jahre:
Kaum verwunderlich, dass das Pariser Publikum der Uraufführung des „Bläser-Oktetts“, das einen wilden ungestümen Russen erwartet hatte, den milden, nüchternen Neo-Klassizisten des Jahres 1923 nach der Uraufführung mit eisigem Schweigen bediente.
Dabei hatte der Komponist die Besetzung des Oktetts seinem Anliegen entsprechend , eine Abkehr von romantischer Ausdrucksseligkeit zu Gunsten einer objektiven Musik geändert, so dass uns Sabine Kittel (Flöte), Marie-Luise Kahle (Horn), Thomas Eberhardt und Hannes Schirlitz (beide Fagott), Anton Winterle und Christoph Reiche (beide Trompete) sowie Jonathan Nuß und Christoph Auerbach (beide Posaune) das Oktett „trocken, kühl , klar und spritzig wie Sekt“, servieren konnten.
Die vom Solo-Korrepititor des Hauses Alexander Bülow dirigierte Interpretation gefiel mit ihrer Leichtigkeit und Burschikosität. Weiche warme Klangfarben mit durchsichtigen Mitteltönen wechselten mit satirisch gefärbten Schärfen.
Das Paris des 19. Jahrhunderts war auch ein Zentrum des Musikinstrumentenbaus. Der Wettbewerb tobte insbesondere zwischen den Klavier- und Harfenbauern Érard und Pleyel. Die Firma des Klavier- und Harfenbauers Sébastian Érard (1752-1831) hatte sich bereits 1810 ein Doppelpedal für seine Harfen patentieren lassen und bot ein mit sieben zweistufig verstellbaren Pedalen ausgerüstetes Instrument mit verbesserten Klangmöglichkeiten an.
Der Chef des von Ignaz Pleyel (1757-1831) gegründeten Unternehmens Gustave Lyon (1857-1937) wollte mit einer einfacher aufgebauten Harfe mit überkreuzliegenden Saiten vergleichbare „chromatische Klangmöglichkeiten“ erreichen und damit die aufwendigen Harfen-Angebote Érards vom Markt fegen.
Die Auseinandersetzung wurde in den Medien und in den Konzertsälen geführt. So wurde Claude Debussy (1862-1918) im Jahre 1904 vom Königlichen Konservatorium Brüssel beauftragt, die „Danses pour harpe chromatique avec accompagnement d´orchestre d´instruments à cordes“ zu komponieren, um die Harfe der Firma Pleyel zu protegieren.
Im Folgejahr konnte die Firma „Klavier- und Harfenbau Érard Paris“ Maurice Ravel (1875-1937) gewinnen, seine „Introduktion et Allegro for Harp, Flute, Clarinet ans String Quartet“ mit einer Doppelpedal-Harfe im Konzertsaal vorzustellen.
Letztlich entschieden die Musiker und setzten die zwar mechanisch aufwendigere, aber präziser spielbare Doppelpedal-Variante als noch derzeit übliche Konzert-Harfe durch.
Deshalb hörten wir im 8. Kammerkonzert Debussys „Zwei Tänze für Harfe und Streicherbegleitung“ von der Solo-Harfenistin der Sächsischen Staatskapelle Johanna Schellenberger mit der Doppelpedal-Harfe sowie einem Streicher-Quintett des Orchesters dargeboten. Dem Auftrag entsprechend hatte Debussy mit der Komposition die klanglichen Möglichkeiten des Instruments voll ausgereizt und dem Solo einen besonders breiten Raum eingeräumt. Johanna Schellenberger beschritt den Weg der eingängig-melodischen Gestaltung konsequent, als sie den „Danse sacrée“ weich sowie ausdrucksvoll spielte und den „Danse profane“ recht beschwingt, mit mehr Dynamik und Klangdifferenzierung interpretierte. Die Streicher Lukas Stepp, Michael Schmid (Violine), Uhjin Choi (Viola), Michael Bosch (Violincello) und Viktor Osokin (Kontrabass) mischten sich in das musikalische Geschehen zurückhaltend ein und blieben angenehm im Hintergrund.

Yazmin Verhage

Gustavo Chalub
Die holländische Tänzerin Yasmin Verhage und der aus Argentinien stammende Tänzer Gustavo Chalub, Beide im Cops de ballet engagiert, illustrierten die Kontraste der beiden Teile mit interessanten Tanzbildern.
Für Teile des Publikums war das zwar der emotionale Höhepunkt des Konzertes, letztlich lenkten aber die Tänzer von der Konzentration auf Debussys Musik ab.
Thomas Thielemann, 21.6.22
Bildrechte (c) Sächsische Staatskapelle
Nachtragskonzert mit Sol Gabetta
im 11. Symphoniekonzert der Dresdner Staatskapelle
Robert Schumann und Peter Tschaikowski mit Myung-Whun Chung
Als Robert Schumann (1810-1856) im September 1850 mit seiner Frau Clara geborene Wieck (1819-1896) und den vier Kindern in Düsseldorf eintraf, um die Nachfolge Ferdinand Hillers als Städtischer Musikdirektoranzutreten, hatte er in seinem „Projektenbuch“ die Skizze eines „Konzertstücks für Cello“ im Gepäck.
In Dresden hatte er zwar die schaffensintensivste Zeit seines Lebens gehabt, rund ein Drittel seines Gesamtwerkes war in den sechs Jahren seines Aufenthaltes in der Landeshauptstadt entstanden, aber es hatte sich keine Möglichkeit einer Festanstellung für den Komponisten als Hofkapellmeister ergeben. Auch in Leipzig hatte sich eine Nachfolge Felix Mendelssohn Bartholdys als Gewandhauskapellmeister nicht realisieren lassen.
Folglich ergriff der Sachse Schumann die Chance ins Rheinland zu gehen.
Dort erlebte er zunächst einen regelrechten Schaffensrausch. Innerhalb von vierzehn Tagen schrieb Schumann mit dem a-Moll-Cellokonzert ein Werk mit neuer ungewohnter Verwebung von Solisten und Orchester. Er brach mit den Gepflogenheiten der zeitgenössigen Virtuosen-Konzerte, die hauptsächlich die Präsentation der brillant, bravourös aufspielenden Solisten beinhalteten, um andere musikimmanente Ansprüche zu erfüllen.

Nicht unproblematisch für Schumanns Behandlung der Solo-Stimme erwies sich, dass er kein Cello spielte und sich weder mit der Spieltechnik noch mit dem Klang des Instrumentes gut auskannte. Deshalb stehen in der Solopartitur Passagen von bezaubernder Poesie in scharfem Kontrast zu technisch extrem schwierigen Stellen, die eigentlich für das Cellospiel völlig ungeeignet sind. Auch hatte Schumann in der Orchesterpartitur die tiefe Tonlage des Cellos nicht unbedingt berücksichtigt, so dass der Dirigent einige Mühe aufwenden muss, wenn das Orchester den Solisten nicht überdecken soll.
Für die Uraufführung seines Cellokonzertes hatte Robert Schumann den befreundeten in Frankfurt tätigen Cellisten Robert Emil Bockmühl (1812-1881) vorgesehen. Der Virtuose war auch an der Mitwirkung interessiert, drängte aber Schumann in mindestens 26 Briefen zu Änderungen. Die lediglich sechs Antwort-Briefe Schumanns sind zwar nicht erhalten geblieben, dürften aber seine Beharrung auf die Begrenzung der Virtuosität der Solostimme zu Gunsten der intensiveren musikalischen Aussage des Werkes beinhaltet haben. Auch lassen Bockmühls weitere Vorstöße vermuten, dass Schumann auf einer thematischen Einbindung der Solostimme in das Klangbild als Ersatz der überbordeten Virtuosität einforderte.
Der als menschlich schwierig geltende Bockmühl hielt sich in den Jahren von 1852 bis 1854 sogar in Düsseldorf auf und half bei der Vorbereitung der Drucklegung des Opus 129, verweigerte aber seine Mitwirkung bei einer Konzertaufführung. Ein internes Anspielen des Konzertes durch den Düsseldorfer Cellisten Christian Reimers im März 1851 in Anwesenheit des Komponisten ist nicht verbürgt. Andere Cellisten zierten sich, so dass Schumann „zur Sicherung seiner musikalischen Einfälle“ sogar eine Fassung für Violine vorbereitete.
Im Konzert hat Robert Schumann sein Cello-Konzert nie hören können.

Im Pandemie-Kartenstapel der ungenutzten Tickets findet sich bei uns für das 10. Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle am 30. April 2020 das Schumann-Cellokonzert mit der Solistin Sol Gabetta und dem Dirigenten Christian Thielemann. Frau Gabetta war in der Saison 2019/2020 als „Capell-Virtuosin“ des Orchesters nominiert, konnte aber lediglich im September 2019 mit dem Violoncello Konzert Nummer 1 von Camille Saint-Saëns brillieren. Die gesamte restliche Planung ihrer Residenz-Wirkung waren Opfer der Pandemie geworden.
Unser Konzert von Schumanns Opus 129 der Staatskapelle mit dem Violoncello-Solo der Sol Gabetta und dem Dirigat von Myung-Whun Chung war letztlich eine Nachlieferung aus den Pandemieopferungen.
Mit ihrer Interpretation des a-Moll-Konzertes bewies die Solistin nicht nur, dass sie über außergewöhnliche cellistische und musikalische Fähigkeiten verfügt, sondern auch Schumanns emotionalen Zustand der Entstehungszeit des Werkes spüren lässt.
Sie spielte die großzügige Romantik des langsamen Mittelsatzes nahtlos mit einer langen lyrisch getragenen Melodie, ließ diese Poesie auch in die Ecksätze hineinfließen. Deren scharfe Konturen rundete sie mit stimmlicher Sensibilität und vermittelte ihr Gefühl für die ausgeglichene Dynamik der Musik Robert Schumanns.
Nicht unwesentlich am Klanggeschehen war der Beitrag des in der Venezianischen Werkstatt Matteo Gaffriller (1659-1742) gebauten Instrumentes. Als Matheus Goffriller bei Brixen geboren, hatte den Instrumentenbau in Bozen erlernt, war wahrscheinlich 1685 nach Venedig gegangen und hatte die Werkstatt seines Schwiegervaters zur führenden „Cello-Schmiede“ entwickelt. Das von Sol Gabetta gespielte Instrument stammt aus der Spätphase des Schaffens Goffrillos wahrscheinlich um 1730. Das ausdrucksstarke, aber nicht aggressive Instrument konnte die Solistin sowohl auf die Spitze getrieben voller Energie spielen, erlaubte ihr dabei auch, den Klang mit faszinierender Zartheit zu gestalten.
Der Erste Gastdirigent der Staatskapelle Myung-Whun Chung steuerte die Struktur mit meisterhaftem Können, indem er Solistin und Orchester als gleichberechtigte Partner austarierte. Die große Streicherbesetzung des Orchesters konnte die Bläser hervorragend einhegen und so einen runden Klang sichern.
Als Zugabe zupfte Sol Gabetta das „Capriccio Nr. 5“ von Fernand Dall´Abaco.

Als Pjotr Tschaikowski (1840-1893) im Herbst des Jahres 1892 Teile eines Symphonieentwurfs vernichtet hatte, weil er im Notenmaterial wenig Erfreuliches, nur leeres Spiel der Klänge und wenig Inspiration eingebracht zu haben meinte, reifte bei ihm der Wunsch, ein programmatisches, wahrhaftiges Werk zu schaffen.
Tschaikowski arbeite an dieser, seiner 6. Symphonie vom Beginn des Jahres bis zum August 1893. Am Beginn sei die Arbeit sehr rasch vorangegangen. Zunehmend kam er aber von der Idee einer Programm-Symphonie mit den Sätzen „Tod“-„die Liebe“-„Enttäuschung“ und „Ersterben“ ab.
Bei der Deutung, ob bei der Arbeit am vierten Satz der Symphonie bereits Todesahnungen beim Komponisten eine Rolle gespielt haben, müssten wir uns nur an den vielgestaltigen Spekulationen um Tschaikowskis Ende beteiligen? Ob es schon Anzeichen auf das Drängen auf einen Suizid oder eine Vorahnung gegeben haben mag?
Der zwar nicht vom Komponisten stammende, von ihm aber akzeptierte Titel „Pathétique“ (etwa Leidenschaftlich) passt bei nüchterner Betrachtung letztlich nur zum vierten Satz und kaum zum Gesamtwerk.
Der mit dem Orchester bestens vertraute Erste Gast-Dirigent der Sächsischen Staatskapelle Mung-Whun Chung bot uns eine ausgereifte und geschärfte Version der im Laufe der Jahre oft gehörten Komposition. In jedem Satz gab es Passagen zu bewundern, die sowohl im Detail, als auch mit emotionaler Intensität beeindruckten.
Mit dem Adagio-Kopfsatz vermied Chung ein Abgleiten in eine depressive Stimmung, schuf mit eindrucksvollen Klangfarben ein reizvolles Wechselbad der Gefühle und scheute sich nicht, auch einen regelrechten Hexensabbat zu entwickeln.
Entspannter interpretierte er den an Walzerklänge erinnernden zweiten Satz, bevor er nach dem leise huschenden Scherzo den dritten Satz mit überbordendem Temperament und Begeisterung fast wie einen Marsch spielen ließ.
So fiel dann der stille Übergang zum herzzerreißendem langsamen Finalsatz nicht unproblematisch aus. Aber das Wunder der Transformation zu den vermeintlichen Wünschen, Ängsten, Qualen und Träumen Tschaikowskis gelang.
Die Struktur der Klangbewegung löste sich zunehmend auf, drohte zu verreißen bis die letzten Takte zur vermeintlichen Lösung führten.
Leuchtkräftige Orchesterfarben, warm sonorer Streicherklang, dunkel goldener Ton der Blechbläser und poliertes Kolorit der Holzbläser hatten eine feierliche Atmosphäre geschaffen. Mit der vorherrschenden Zartheit und Transparenz öffnete das Orchester im Einklang mit dem Dirigenten uns den Zugang zu Tschaikowskis Seelenklang seiner letzten Lebenszeit.
Thomas Thielemann, 13.6.22
© Matthias Creutziger
Dvoráks Märchen an der Semperoper
Rusalka geht ins Licht
Das Ärgernis von Stefan Herheims Inszenierung der Rusalka von 2010 im Rotlicht-Milieu ist noch in wacher Erinnerung – nun bietet das Haus eine neue Deutung von Christof Loy, die aus Madrid kommt und in Koproduktion mit den Opernhäusern in Bologna, Barcelona und Valencia entstand. Auch der deutsche Regisseur erzählt bei seinem Debüt an der Semperoper eine andere Geschichte. Bei ihm spielt sie in einem maroden Theater, das der Wassermann als Direktor leitet, in dem die Hexe Jezibaba im Kassenhäuschen sitzt und die Eintrittskarten verkauft und die drei Nymphen als Ballerinen in Tutus Figuren des klassischen Balletts zelebrieren. Dass Einheitsbühnenbild von Johannes Leiacker zeigt das Foyer eines Rokoko-Theaters in monochrom müdem Grau, wo nur der Kristalllüster noch vom einstigen Glanz kündet. In den Raum ist mittlerweile die Natur in Form von zu Stein gewordenen Wassermassen eingedrungen. Ursula Renzenbrinks vielfältige Kostüme reichen von schlichter Alltagskleidung bis zu attraktiven Kreationen.
Wegen einer Fußverletzung bewegt sich Rusalka anfangs mühsam an Krücken vorwärts, sie möchte tanzen können wie ihre Schwestern. Aber sie sehnt sich auch nach dem Leben mit einem geliebten Mann. Die Hexe bereitet ihr in der Kaffeetasse einen Trank, verflucht sie aber dafür, wie auch ihr Vater, der Wassermann, sie verstößt. Rusalka kann nun tanzen wie ihre Schwestern, wird zum Weißen Schwan auf Spitze. Sie begegnet dem Prinzen, der sie in seinen Armen davon trägt wie Albrecht seine Giselle.
Im 2. Akt, wo die Hochzeit des Prinzen mit Rusalka stattfinden soll, zeigt der Regisseur mit seinem Choreografen Klevis Elmazaj zur Polonaise eine wüste erotische Orgie mit halb entkleideten Gästen, die sich in aggressiver Triebhaftigkeit auf dem Boden wälzen und kopulieren. In raffinierter schwarzer Seidenrobe nutzt die Fremde Fürstin die Zweifel des Prinzen an Rusalkas Liebesfähigkeit zu ihren Gunsten aus und verführt ihn wie eine Domina. Der Wassermann wird Zeuge dieses beschämenden Vorgangs. Im 3. Akt scheinen die Gefühle der Figuren wie eingefroren. Die Nymphen tragen Winterkleidung, bäumen sich mit letzten Kräften gegen die Ereignisse auf. Danach bringt die finale Begegnung Rusalkas mit dem Prinzen die berührendste Szene der Aufführung. Nach ihrem Kuss stirbt er erlöst, sie verlässt den Raum und geht ins Licht.
Olesya Golovneva in der Titelrolle ist ein Glücksfall für die Aufführung – auch wenn ihr jugendlich-dramatischer Sopran schon in Lisa-Nähe ist und ihrer Stimme vielleicht ein Quäntchen lyrischer Liebreiz für die Partie fehlt. Aber die mühelose Durchschlagskraft in der Höhe, die souveräne Bewältigung der dramatischen Passsagen und nicht zuletzt die zu Herzen gehende Darstellung machen ihre Interpretation singulär. Das berühmte „Lied an den Mond“ ist erfüllt von zarter Wehmut, die dramatische Szene mit dem Wassermann im 2. Akt von phänomenaler Spannung. Wenn sie im 3. Akt singt „Ich habe meine Jugend verloren“ und sich dabei an „magische Sommernächte über zarten Seerosen“ erinnert, kann man sich der Rührung kaum entziehen. Überwältigend dass Schlussduett mit dem Prinzen in seiner berührenden Tragik, aber auch der geradezu mirakulösen Bewältigung der Extremnoten. An ihrer Seite ist Pavel Cernoch ein stattlicher Prinz von attraktiver Erscheinung und Jugendlichkeit mit in der Mittellage männlich timbriertem Tenor und strahlkräftigen Spitzentönen. In seiner Arie „Wundersames Traumbild“ im 1. Akt kann er auch mit lyrischen Valeurs aufwarten, im Schlussduett die heikle Tessitura bewundernswert meistern.
Kurzfristig sprang für die erkrankte Christa Mayer Jolana Fogasová als Hexe ein, die nach verhaltenem Beginn ihrem dramatischen Mezzo interessante Farben und Zwischentöne abgewinnt. Elena Guseva als Fremde Fürstin wartet mit strenger Stimme und schrillem Klang in der Höhe auf, was dieser Rolle immanent ist. Großartig der Wassermann von Alexandros Stavrakis mit profundem, weichem Bass und reicher Ausdruckspalette. Wunderbar homogen im Klang sind die drei Nymphen bei ihren Gesängen (Ofeliya Pogosyan/Sandra Maxheimer/Constance Heller), wobei Erstere bei ihrem Solo im 3. Akt („Golden ist mein Haar“) durch den innigen Vortrag besonders auffällt. Die Besetzung ergänzen Sebastian Wartig als Wildhüter, Nicole Jäger als Küchenjunge und Simeon Esper als Jäger mit soliden Leistungen. Der Sächsische Staatsopernchor Dresden (Einstudierung: Jonathan Becker) singt klangvoll aus dem Off.
In der 5. Aufführung am 4. 6. 2022 steht am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden Christoph Gedschold, der eine romantische Klangwelt erstehen lässt, in der Polonaise festlichen Bläserglanz entfacht und mit schwelgerischen Lyrismen aufwartet. Die Zuschauer (im leider nicht ausverkauften Saal) feierten die Mitwirkenden enthusiastisch.
Bernd Hoppe, 10.6.22
Premiere beim Semperoper Ballett
Peer baut ein IKEA-Haus
Der schwedische Choreograf Johan Inger ist in Dresden kein Unbekannter – jetzt kam sein 2017 in Basel uraufgeführtes Ballett Peer Gynt als Deutsche Erstaufführung in der Semperoper heraus und wurde vom Premierenpublikum am 5. 6. 2022 frenetisch akklamiert. Das erstaunt, erzählt Inger doch weniger die Geschichte nach Ibsens Drama mit dem Titelhelden als Abenteurer, der die Welt durchstreift, sich schuldig macht und am Ende geläutert zu seinen Wurzeln zurückkehrt, sondern eine sehr eigene und eigenwillige Version. Diese behandelt mehr seine Biografie als Tänzer und Choreograf mit wichtigen künstlerischen Stationen wie dem Nederlands Dans Theater oder dem Cullberg Ballet Schweden. Seine erste und entscheidende Begegnung mit Mats Ek geschah bei dessen Stück Gamla Barn, was seine Abkehr vom klassisch-akademischen Ballett markiert. Inger zitiert es in einer Szene und lässt den Choreografen sogar als Figur auftreten (Francesco Pio Ricci).
Ähnlich vielfältig wie die Choreografie ist die musikalische Folie, die neben der Schauspielmusik von Edvard Grieg auch Ausschnitte aus Tschaikowskys Nussknacker und Bizets Carmen enthält. Die Sächsische Staatskapelle Dresden unter Thomas Herzog, der Sinfoniechor Dresden und der Extrachor der Semperoper (Einstudierung: Jonathan Becker) liefern eine gediegene Interpretation der Musik, zu der auch Stefanie Knorr beiträgt, die Solveigs Gesänge mit klarem Sopran und lyrischer Zartheit vorträgt.
Das Estudio de Dos (Curt Allen Wilmer/Leticia Gañán) hat die Bühne links und rechts mit schwarzen Blöcken eingefasst, aus denen Bildtafeln gezogen werden, welche die einzelnen Schauplätze in naiver Manier illustrieren – Häuser, Interieurs, Landschaften. Die Kostüme von Catherine Voeffray dienen der Charakterisierung der Personen, sind rustikal und derb ländlich.
Das Geschehen beginnt mit der Konfrontation Peers mit seiner Mutter Aase, die von Casey Ouzounis en travestie wie eine Wilde Grete dargestellt wird, was die unerbittliche Strenge der Figur plastisch umreißt. Christian Bauch ist ein schlaksiger Peer, der seine Szenen mit expressivem Nachdruck ausfüllt, leider oft auch unverständlich grölen muss und den Abstieg des Helden zum verkommenen Alkoholiker bezwingend darstellt. Die Serie von Peers Untaten beginnt bei einer Hochzeit, wo er die Braut Ingrid (Svetlana Gileva sehr einprägsam) entführt und der Bräutigam (Václav Lamparter) allein und verzweifelt zurückbleibt. In der Welt der seltsamen Trolle, denen Inger einen bäuerlich-drastischen Bewegungsduktus verordnet hat, lernt Peer Die Grüne (Zarina Stahnke) kennen, die ihn mit erotisch lasziver Aura verführt. Später wird sie ihn mit dem gemeinsamen Baby im Kinderwagen konfrontieren, was zu einer erregten Auseinandersetzung zwischen beiden führt. Dann will Peer zu seiner Jugendliebe Solveig zurückkehren und für sie ein Haus bauen, wofür IKEA Pakete mit den erforderlichen Bauteilen liefert. Zuvor aber drängt es ihn, seine sterbende Mutter aufzusuchen – schüttelnde, wackelnde, zuckende und hopsende Bewegungen bieten hier ein gebührend skurriles Spektrum.
Der 2. Akt beginnt mit einem sportiv eleganten Männertanz, dessen Ästhetik man sich an diesem Abend noch öfter gewünscht hätte. Danach gibt es ein Kabinettstück mit Drei Tänzerinnen beim Vortanzen – herrlich komisch Jenny Laudadio, wild-exzessiv Nastazia Philippou und sinnlich lockend Ayaha Tsunaki. Letztere, Anitra, gewinnt den Wettbewerb und Peer, der sich inzwischen wie ein Kaiser fühlt und eine Krone trägt, folgt ihr in die spanische Heimat, wo sie zum Entr’acte aus Carmen Flamenco tanzt, ihn aber dann verlässt. Unaufhaltsam vollzieht sich Peers Abstieg, lässt ihn gar zum Mörder werden – eine brutal-naturalistische, ausufernde Szene. Die Schatten der Vergangenheit holen Peer ein – Die Grüne mit dem Kinderwagen, Anitra, der Krumme (stark: Jón Vallejo), der wie ein Doppelgänger auftritt, und schließlich Solveig. In ihrem Schoß kann er schließlich ruhen – für immer.
Bernd Hoppe, 9.6.2022
7. Juni 2022 Semperoper Dresden
Kammerabend des Dresdner Oktetts
Werke von Johann Nepomuk Hummel, Egon Wellesz und Felix Mendelssohn Bartholdy in faszinierenden Interpretationen
Das Dresdner Oktett mit Matthias Wollong und Jörg Faßmann (Violine), Sebastian Herberg (Viola), Norbert Anger (Violincello), Andreas Wylezol (Kontrabass), Wolfram Große (Klarinette), Joachim Hans (Fagott), Robert Langbein (Horn) mit ihren Gästen Anya Dambeck (Viola) sowie Andrei Banciu (Klavier) hatten am 7. Juni 2022 zum 7. Kammerabend in die Semperoper zu einem intessanten Programm eingeladen.
Im Alter von 24 Jahren schrieb der Virtuose und Komponist Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) in Wien sein Klavierquintett Es-Dur. Der Umstand, dass Hummel die zweite Violine durch einen Kontrabass ersetzte und der virtuose Klavierpart führen zur Vermutung, dass es sich bei seinem Opus 87 um ein Auftragswerk handelte. Auch der Umstand, dass eine Drucklegung des Werkes erst 1822 erfolgte, stützt diese Vermutung.
Hummel, ein Schüler und von 1788 bis 1793 Hausgenosse Mozarts (1756-1791), galt in Wien sogar als ernsthafter Konkurrent Beethovens (1770-1728) und war durch seine frühromantischen Kompositionen in virtuoser Gestaltung bekannt. Das war lange bevor er sich nach Ende seiner reichen Karriere als Hofkapellmeister des Fürsten Esterhazy, in Stuttgart und Weimar dem Vorwurf ausgesetzt sah, sein Klavierspiel sei inzwischen altmodisch.
Musikhistorisch interessant ist, dass Hummels außergewöhnliche Besetzung des Klavierquintetts wahrscheinlich Anlass war, dass der Großbürger von Steyr und ausgezeichnete Cellist Silvester Paumgartner (1764-1841) im Jahre 1819 seinen häufigen Gast Franz Schubert (1797-1828) beauftragte, sein später bekanntes „Forellenquintett“ zu komponieren.
Fast irrwitzig, dass Schubert als Grundlage des launigen Variationssatzes, so wie auch für sein Lied „die Forelle“, ein Gedicht Christian Friedrich Daniel Schubarts (1739-1791) nutzte. Schubart hatte das Gedicht 1787 während seiner zehnjährigen „Umerziehungshaft“ auf der Bergfeste Asperg in tiefer Verzweiflung, aber mit doch etwas Selbstironie, über die Umstände seiner Verhaftung geschrieben. Denn „die Forelle“ am Angelhaken war Schubart gewesen, als er sich von Agenten des Herzogs Carl Eugen hat nach Württemberg locken lassen.
Die fünf Musiker meisterten die musikalischen Herausforderungen des Hummel es-Moll- Klavierquintetts bravourös. Vom Dresdner Oktetts spielten Jörg Faßmann (Violine), Sebastian Herberg (Viola), Norbert Anger (Violoncello) und Andreas Wylezol (Kontrabass) mit ausdruckstarker Intensität, Brillanz undSpielfreude, während der Gast Andrei Banciu den Klavierpart ausdrucksvoll modellierte.
Der Österreichische Komponist, Musik- und Byzanzwissenschaftler Egon Wellesz (1885-1974) schrieb das Oktett op. 67 im Jahre 1948 auf Bitten einer Reihe Musiker der Wiener Philharmoniker, weil diese ein Werk suchten, das sich mit Franz Schuberts Oktett in F-Dur kombiniert aufführen ließe.
Als Sohn ungarischer Juden in Wien geboren, blieb Egon Wellesz der Stadt bis zu seiner Emigration verbunden, obwohl er die massiv zunehmende faschistische Bewegung mit ihrem breiten Antisemitismus im Lande spürte. 1938 gelangte er über Holland nach Großbritannien, lebte und arbeitete in Oxford bis zu seinem Tode. Alle Angebote aus Wien, zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen konnten ihn nicht wieder nach Österreich locken.
Diese Ambivalenz ist möglicherweise verantwortlich, dass seine Musik, vor allem sein faszinierendes Oktett, so selten gespielt werden und ich in der Konzertvorbereitung nicht eine komplette Einspielung finden konnte.
Das heitere fünfsätzige Oktett mit der originellen Satzreihung Andante-Allegretto; Adagio, Presto-Trio, Andante-con moto; Allegro-Presto wurde vom Dresdner Oktett mit seinen ausdrucksvollen Dialogen mit erkennbarer Freude und Spiellaune geboten. Von einem aufgeschlossenen Publikum wurde das hin- und herfliegen der Themen begeistert aufgenommen und das präzise Musizieren begeistert gewürdigt. Dabei überdehnte das Klangbild kammermusikalische Gewohnheiten deutlich und hatte eher orchestrale Fülle.
Nicht zuletzt machte das Klarinetten-Solo im dritten Satz von Wolfram Große die Wellesz-Komposition zum emotionalen Höhepunkt des Abends.
Den Abschluss des Kammerkonzertes bildete das Sextett in D-Dur für Violine, zwei Bratschen, Violoncello, Kontrabass und Klavier op. 110 von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) aus dem Jahre 1824. Die Interpretation der Komposition des fünfzehnjährigen Genies nahm fast orchestralen Charakter an. Das kommunikative Miteinander der Musiker und insbesondere die ungewöhnliche Kombination einer Violine mit zwei Bratschen belebten das interessante Klangbild.
Leider war das von „concerti“ in seiner Konzertankündigung versprochene „Oktett für Bläser mit Kontrabass ad libitum“ von Isang Yun (1917-1995) aus dem Jahre 1978 nicht mehr im Programm enthalten geblieben. Ich empfand das als Schade, denn Yun verband mit seinem Oktett Techniken der traditionellen koreanischen Musik mit Elementen der westlichen Avantgarde, so dass eine Folge faszinierender Klangbilder seltener Reinheit von den Musikern des Dresdner Oktetts hätte zu Gehör gebracht werden können.
Isang Yun stammte aus Korea, lebte aber seit 1956 in Frankreich und Westdeutschland. Er war uns in Erinnerung geblieben, weil er am 17. Juni 1967 vom Südkoreanischen Geheimdienst aus West-Berlin entführt und wegen angeblicher Spionage für Nord-Korea verurteilt worden war; eine Aktion, die sowohl im Ost-Berlin, als auch im West-Berlin gewaltigen Staub aufgewirbelt hatte. Nach einer weltweiten Protestaktion von über 200 führenden Musikern kam er 1969 frei und lebte bis zu seinem Tode in Berlin. Seine Bemühungen galten dem Frieden und der Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel. So unterstützte Yun die Demokratisierungsbewegung im Süden seines Heimatlandes und besuchte auch mehrfach Nordkorea. Der Spionagevorwurfwurde aber erst 2006 zu einer Erfindung des Geheimdienstes erklärt.
Thomas Thielemann, 6.6.22
21. Mai 2022 Semperoper Dresden
Zemlinskys Lyrische Symphonie im Semperbau
Das Opus 18 des Unentschlossenen:-Christian Thielemann dirigiert die Staatskapelle Dresden
Alexander Zemlinsky (1871-1942) wurde als Sohn des Schriftsteller-Journalisten Adolf von Zemlinzky (1845-1900) in Wien geboren. Seine Mutter Clara (1848-1912) geborene Semo stammte aus einer sephardischen Familie Sarajevos. Der aus der katholisch-getauften Familie nach Wien gekommene Vater verließ 1870 seiner künftigen Ehefrau zuliebe die katholische Kirche und wurde in die sephardische Gemeinde Wien aufgenommen.
Die Sepharden bilden eine Gruppe der Nachkommen der 1513 von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden, die ihre kulturellen Besonderheiten bis in die Neuzeit pflegen. Das Adelsprädikat hatte Adolf für vermeintliche Verdienste eines Vorfahren dem Namen zugefügt und das „z“ aus der Namensschreibung liquidiert.
Alexander trat mit 13 Jahren in das Wiener Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde ein. Als seine Kompositions-Dissertation lieferte er 1890 einen Walzerzyklus für Klavier ab, der bei Breitkopf & Härtel als sein Opus 1 verlegt wurde. Die weitere Abschlussarbeit, eine Symphonie in d-Moll (Nr. 2) wurde 1892 im Konservatorium mit positiven Kritiken aufgeführt.
Zemlinsky begann seine Laufbahn als Operettendirigent am Wiener Carl-Theater und Leiter des Laienorchesters „Polyhymnia“ und wechselte später an die Volksoper. Weitere Stationen waren „Musikdirektor des Neuen Deutschen Theaters“ in Prag und ab 1927 die „Kroll-Oper“ in Berlin.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ging Zemlinsky wieder nach Wien. Nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 emigrierte er nach den Vereinigten Staaten, wo er vier Jahre später an den Folgen eines Schlaganfalls starb.

Neben acht vollendeten Opern komponierte er eine Sinfonietta, Kammermusik, vor allem Lieder und als sein eventuell wichtigstes Werk, die Lyrische Symphonie op. 18.
Von den weit mehr als einhundert abgeschlossenen oder begonnenen Kompositionsarbeiten Zemlinskys sind nur 27 einer Opus Zahl zugeordnet. Das lässt schon tief blicken.
Für einige seiner Orchesterwerke und Opern erhielt Zemlinsky, auch von seinem Schwager Arnold Schönberg (1874-1951), mit dem ihm seit seiner Jugend eine innige Freundschaft und Fachpartnerschaft verband, große Anerkennung. Aber Zemlinsky konnte den Übergang von der Tonalität zur Atonalität nicht beschreiten, blieb trotz der Abkehr von der traditionellen Harmonik in den Grenzenzwischen Spätromantik und Moderne verhaftet. Eine Beschäftigung mit der Zwölftontechnik schloss er konsequent aus.
Ab Mitte der 1930-er Jahre wurden seine Arbeiten nahezu vergessen und erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts erinnerte man sich seiner.
In der in den Jahren 1922 und 1923 entstandenen „Lyrischen Symphonie“ ist Zemlinskys Suche nach Individualität noch spürbar. Mit der Vertonung der Gedichte von Rabindranath Tagore (1861-1941) vereinte er nicht nur unterschiedliche Stränge der Spätromantik, sondern öffnet auch den Raum für die Moderne, schuf auch Gegenstücke zu Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ und Schönbergs „Gurre-Liedern“. Für diesen Komplex von großer Symphonie und Orchesterlied setzte Zelensky gleichfalls zur Entwicklung eines breiten emotionsgeladenen Erzählstroms den großen spätromantischen Orchesterapparat ein.
Das Dirigat Christian Thielemanns entwickelte bei den Musikern der Sächsischen Staatskapelle ein enormes kraftvolles Spannungsfeld. Da war mit interpretatorischer Routine oder eleganter Abgeklärtheit ohnehin nichts zu machen. Es musste eine Portion wissender Neugier und solide fundierter Naivität aktiviert werden, um die innere Zusammengehörigkeit der sieben Gesänge mit ihren Vor- und Zwischenspiele zur Geltung zu bringen. Mit dem Dialog des Baritons Adrian Eröd mit der Sopranstimme von Julia Kleiter entwickelte sich eine faszinierende Geschichte von Sehnsucht, erfüllter Lieben und Abschied, dem alten romantischen Dualismus von Tag und Nacht, von Raum und Zeit, von Pflicht und Leidenschaft.
Den breit ausgeführten ersten Gesang „Ich bin friedlos“ eröffnete der Bariton Adrian Eröd mit sängerischer Souveränität und fügt sich hervorragend in die weitgespannten Passagen des Orchesters ein, hatte allerdings einige Mühe, sich gegen die Wucht des Orchesters zu behaupten.

Gnädiger hatte der Komponist bei der Orchesterbegleitung des zweiten Liedes “Mutter, der junge Prinz muss an unserer Tür vorbeikommen“ die kraftvoll auftrumpfende Julia Kleiter behandelt. Beeindruckend verstand die fein nuancierende Sopranistin, den Wechsel der Empfindungen der Frau zwischen Traum und Realität fast scherzo-artig darzubieten. Ruhiger, leidenschaftlicher kam der Bariton mit der raffinierten Harmonik und der besonderen Instrumentation des dritten Satzes „Du bist die Abendwolke“ zurecht und schuf für mich den emotionalen Höhepunkt des Zelensky-Opus 18.
Die Gesänge „Sprich zu mir Geliebter“, „Befrei mich von den Banden deiner Süße, Lieb“ „Vollende denn das letzte Lied“ stellen vermutlich ein autobiografisches Intermezzo dar, mit dem der Komponist eine unerfüllte Liebe zur Frau eines Prager Industriellen zu verarbeiten suchte.
Da beide Interpreten am Drama mit dieser Frau, die trotz erwiderter Zuneigung ihr Leben mit Ehemann und zwei Kindern nicht verlassen wollte, emotional nicht beteiligt sind, gelang die Darbietung der Gesänge freier und gelöster.
Den siebten Gesang „Friede, mein Herz“ gestaltete Adrian Eröd mit seinem höhensicheren Bariton und sängerischer Souveränität zum faszinierenden Abgesang.
Wunderbar fließend begleite die Staatskapelle und bildete hervorragend die orchestralen Segmente der Zemlensky´schen Eingebungen.
Christian Thielemann erwies sich als der selbstsichere und dennoch stets neugierige Beherrscher der schwer auslotbaren Partitur.

Es gab reichlich herzlichen Beifall, aber wir waren nur wenige, die stehend applaudierten. Auch sah ich in meiner Umgebung einige mürrische Gesichter.
Am Anfang des Konzertes bot Christian Thielemann mit der Staatskapelle die „Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 (Schottische)“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Bereits hier war der große gewaltige gestalterische Atem des Dirigenten zu spüren.
Die „Schottische“ wird vielfach als Mendelssohns bedeutendstes symphonisches Werk angesehen. Bei der Uraufführung im Gewandhaus zu Leipzig hatte der Komponist die „stimmungsmordenten Pausen zwischen den Sätzen“ durch nahtlose Übergänge ersetzt. Obwohl im Ursprung zur Vermeidung von Applaus gedacht, dient diese Praxis der Geschlossenheit der Interpretation, zumal die Kompaktheit der motivischen Ebene ihre Entsprechung findet.
Schon der Einsatz des Themas im ersten Satz ließ uns die Ohren auf konzentriertes Hören schalten. Der satte Klang der Streicher und das Potential der Blechbläser, verschmolzen mit atemberaubend musizierenden Holzbläsern, entwickelten den so geliebten Dresdner Klang. Dazu spielte Robert Oberaigner ein traumhaftes Klarinetten-Solo. Die differenzierte Dynamik der Tempi mit den variabel gestalteten Übergängen und der bis in das tiefste Pianissimo tragfähige Klang des Orchesters bildeten die sichere Grundlage für das fesselnde Hörerlebnis.
Für „Mendelssohn“ gab es ungeteilt frenetischen Beifall.
Thomas Thgielemann, 23.5.22
© Matthias Creutziger
Rusalka-ein modernes Märchen
Überirdisch schöne Musik zu einer tragischen Geschichte.
Nachdem sich der Theaterreferent der Prager Jung-Tschechen-Zeitung „Národni Listi“ Jaroslav Kvapil (1868-1950) im Hinterbühnen Bereich des Prager Nationaltheaters im Januar 1890 in Hana Kubešová ( 1860-1907) verliebt und diese 1894 geehelicht hatte, konzentrierte er sich unter dem Einfluss der klugen und erfolgreichen Schauspielerin zunehmend auf die Theaterarbeit.
Er übersetzte bzw. adaptierte Theaterstücke, schrieb selbst Schauspiele, führte Regie bei anerkannten Inszenierungen und bemühte sich um eine Modernisierung des tschechischen Theaterwesens, was ihm den Beinamen „Böhmischer Reinhardt“ eintrug.
Auf Anregung des Komponisten Josef Jiránek (1855-1940) beschäftigte sich Kvapil 1899 mit einem Stoff, der neoromantischen Symbolismus mit nationaler Märchenlyrik verbinden sollte. Freimütig nutzte er Anregungen unter anderem von Hans Christian Andersen (1805-1875), E. T. A. Hoffmann (1776-1822), Jaques Offenbach (1819-1880), Friedrich de La Motte Fouqué (1777-1843), Theodor Fontane (1819-1898), sezierte oder zertrümmerte diese und schuf aus den Bruchstücken einen hochmodernen Text.

Unglaublich viele Facetten der Rusalka, vom Verlassen gewohnter Pfade, notwendigem Überschreiten von Grenzen, vom Nichthineinpassen in die Welt der Ordnung, des Nutzens dazu vom Scheitern wurden mit äußerster Intensität und Wirksamkeit zu einer Parabel der Seelentragödie einer großen Liebenden verdichtet.
Da Jiránek keine Opern komponierte bot Jaroslav Kvapil seinen Text vergeblich den Komponisten Oskar Nedbal (1874-1930), Josef Bohuslaw Foerster (1859-1951), Karel Kovarovic (1862-1920)und Josef Suk (1874-1935) zur Vertonung an. Erst als er im Prager Nationaltheater erfuhr, dass Antonin Dvořák ein Libretto für eine neue Oper suche, wagte er, dem um vieles älteren und berühmteren Komponisten sein Libretto vorzustellen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Beiden sei reibungslos gewesen. Oft kam Dvořák am frühen Morgen in die Wohnung der Kvapils, um über jenen Libretto-Abschnitt zu beraten, der am Vortag vertont geworden war.
Nicht reibungslos verlief die für Anfang 1901 als Auftakt eines Opernzyklus zum 60. Geburtstag des Komponisten geplante Uraufführung der „Rusalka“. Banale Konflikte im Orchester des Nationaltheaters, die das Ausmaß des Erträglichen überschritten, machten das Engagement eines anderen Klangkörpers erforderlich. Als noch ein Hauptdarsteller wegen vorgeblicher Indisposition absagte, wurde die Uraufführung auf den 31. März 1901 verlegt, gestaltete sich aber dann zu einem großen Erfolg.

Für sein Debüt an der Semperoper nahm Christof Loy die Vorgaben des Librettisten Jaroslav Kvapils auf und komprimierte seine Inszenierung auf die Titelfigur, indem er sie aus dem Wasser holte und in ein modernes Umfeld brachte.
Sein Bühnenbildner Johannes Leiacker hatte das Foyer eines heruntergekommenen Theaters, in das symbolisch ein erstarrter Lavastrom hineinreichte, als Handlungsraum geschaffen. Der Lavastrom, Sinnbild für die Kraft der Natur, im zweiten Akt negiert, überbordete im abschließenden Akt doch größere Bereiche der Szene.
Die Begrenzungen der Wasserwelt waren durch die Metapher der extrem regulierten Welt des Balletts ersetzt, um die Schwierigkeiten der Kommunikation unterschiedlicher Welten sichtbar zu machen.
Aus dem Zusammenprall der Unschuld Rusalkas mit der durchtriebenen Welt des Prinzen gestaltete Loy eine komplexe Erzählung mit durchaus poetischen Momenten. Unbeirrt auf das Wesentliche konzentriert, gestaltete er seine feinsinnige, ideenreiche Personenführung ohne die Musik Antonin Dvořáks auch nur in einem Moment in Frage zu stellen. Loy offeriert sich uns als „Der Theatermann“ und auf der Bühne ist immer etwas los. Da gab es Slapsticks-Einlagen, wenn es Dvořáks Musik zuließ und es gab die von Klevis Elmazaj choreografierten hocherotisierten Tanzszenen, die ihrerseits den Handlungsfortschritt beschleunigten.Ein Erlebnis der Sonderklasse waren die Kostüme der Hausdebütantin Ursula Rezenbrik.

Am Beginn der Aufführung liegt die Titelheldin mit verletztem Fuß auf einem Bett, möchte aber unbedingt tanzen, aber auch leben und lieben. Der Ballettmeister erkennt die Gefährlichkeit ihrer Situation und versucht, sie zur Besinnung zu bringen. Sie ist verliebt: der Pakt mit der Jezibaba bringt sie wieder auf die Beine, raubt ihr aber Stimme und sexuelle Bindungsfähigkeit. So hat die intrigante Fürstin leichtes Spiel, die Katastrophe in Gang zu setzen. Die Aufführung gestaltete sich zu einer großartigen Lektion der Zerbrechlichkeit jedes Lebensentwurfs.
Denn die Berührung mit einer anderen Welt endet für den Prinzen tödlich und die entmutigte Rusalka geht in ihr früheres Leben zurück.
Musiziert wurde ohne Ausnahme auf einem hohen Niveau:
Die russische Sängerin Olesya Golovneva ist ein Glücksfall für die Titelrolle. Sie gestaltete die Rusalka mit jugendlich-strahlendem Sopran, natürlicher Ausdruckskraft in ihrer gesamten Zerrissenheit. Mit ihrer Rollenauffassung ist sie die behütete Tochter, die sich von der Familie emanzipieren möchte. Olesya Golovneva ist nicht nur eine hervorragende Sängerin mit prachtvoller Durchschlagskraft, sondern auch eine begrenzte Spitzentänzerin und begnadete Schauspielerin, die ohne Einsatz der Stimme im zweiten Akt Präsentation vermitteln konnte.
Mit seiner slawisch gefärbten disziplinierten Stimme bot der Prinz von Pavel Černoch einen soliden heldischen Tenor mit lyrischen Qualitäten, der auch darstellerisch ein breites Gefühlsspektrum zu bieten vermag. Seine Zuneigung zur Titelfigur war von erotischer Leidenschaft geprägt, welche der Realität nicht standzuhalten vermag.
Mit beträchtlichen stimmlichen und darstellerischen Mitteln hatte die Sopranistin Elena Guseva ihre aufdringlich fremde Fürstin ausgestattet und dabei weder mit scheinbarer Wärme und Erotik gegeizt.
Mit der Kraft ihrer großen dunklen Stimme gestaltete Christa Mayer die finster-dämonische und entschlossene Ježibaba als sie den Preis der Verwandlung Rusalkas festsetzte und damit Voraussetzungen für die tragische Entwicklung schuf.
In der Rolle des Ballettmeister-Wassermanns konnte Alexandros Stavrakakis mit seiner weich timbrierten Stimme in Momenten der Zuneigung die Wärme der Figur überzeugend darbieten, gleichsam auch heftig sein Entsetzen über die dekadenten Ausschweifungen in der Ballszene ausdrucksstark äußern.

Die weiteren Rollen, von der Regie keinesfalls vernachlässigt, waren durchaus hochkarätig besetzt und lieferten zum Teil subtile Charakterstudien: so der Wildhüter Sebastian Wartigs, der Jäger Simon Espers, der Küchenjunge Nicole Chirkas und , auf keinen Fall zu vergessen, die Nymphen Ofelia Pogosyans, Stepanka Pucalkovas sowie Constance Hellers.
Der Chor, von Jonathan Becker einstudiert, präsentierte sich mit seinen wenigen Hinter-der Bühne –Auftritten solide.
Für Joanna Mallwitz war der Abend sowohl Haus- als auch Orchesterdebüt in Dresden. Berührungsprobleme zu den Musikern der Sächsischen Staatskapelle waren nicht zu spüren, wenn Frau Mallwitz die Möglichkeiten des Orchesters für die Vermittlung der symphonischen Welt Antonin Dvořáks auszuloten versuchte und den Farbenreichtum der Orchesterinstrumente mit ihrem Dirigat betonte. Die harmonische Vielfalt der Partitur wurde durch eine beeindruckende Balance zwischen den Instrumentengruppen im Graben und den Singenden auf der Bühne nahezu vollkommen zur Geltung gebracht.
Für die Musizierenden und das Inszenierungsteam gab es lang anhaltende und stehende Ovationen.
Dabei soll auch nicht unterschlagen werden, dass eine Reihe der Premierengäste die Inszenierung am Ende auch ratlos zurück gelassen hat und mancher sich das „Lied an den Mond“ in romantischer Umgebung gewünscht hätte.
Thomas Thielemann, 9.5.22
Bildrechte: Semperoper Dresden © Ludwig Olah
26. April 2022
Die Staatskapelle versucht sich mit Barockmusik.
Ton Koopman dirigierte das 9. Saison-Symphoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden.
Georg Friedrich Händel (1685-1759), in Halle an der Saale geboren und über Hamburg, Italien sowie Hannover 1711, eigentlich zu einem verlängerten Urlaub, nach London gekommen, würde nach heutiger Definition als ein Popstar seiner Zeit benannt werden.
Er betätigt sich in London über 40 Jahre als Unternehmer, schmeichelt den Adeligen und begeistert die Bürger mit überwiegend leidenschaftlich-schwülstigen, unwahrscheinlichen Stoffen in Opern, Kantaten und Oratorien, war aber letztlich in allen gängigen Musikgenres zu Hause.
Als 1748 die Österreichischen Erbfolgekriege mit dem „Aachener Frieden“ abgeschlossen worden waren, sollte der Erfolg der Verbündeten Maria Theresias und Georg II.mit „dem größten Feuerwerk“ auch in London gefeiert werden. König Georg II. (1683-1760) beauftragte Händel, für die Begleitung des Spektakels eine Orchestersuite zu komponieren. Der militäraffine König forderte, dass die Musik ausschließlich von Bläsern und Paukern dargebracht werden sollte, also keine „fiddles“ zum Einsatz kommen dürften. Erst nach heftigen Auseinandersetzungen beugte sich Händel und verfasste die Erstfassung für „martial instruments“.

Da aber die Detail-Vereinbarungen der Vertragsverhandlungen noch fast ein Jahr beanspruchten, konnte die geplante Feier in London erst am 27. April 1749 stattfinden. Die Probleme um die „Feuerwerksmusik“ gingen schon mit deren Generalprobe am 21. April 1749 weiter, als 12 000 zahlende Besucher im Vergnügungspark „Vauxhall Gardens“ den ersten Verkehrsstau Londons auslösten. Stundenlang mussten die wohlhabenden Londoner in ihren Kutschen ausharren.
Auch zur Friedensfeier gingen die Pannen weiter: da es regnete, gingen die 101 Auftakt-Salutschüsse nicht los und Händel ließ die Ouvertüre gleich zweimal vor dem Feuerwerk spielen. Auch das Feuerwerk wurde zum Debakel, als Raketen-Irrläufer die prachtvollen Illuminations-Aufbauten in Brand setzten, Besucher unter schützende Bäume flüchten mussten, und der italienische Architekt der Kulissen auf den englischen Feuerwerker mit dem Degen losging.
Der König hatte sich, obwohl er der Veranstalter, wegen des Regens längst in seine Bibliothek zurückgezogen und erlebte das Fiasko aus der Ferne.
Händel hat dann vier Wochen später die Feuerwerksmusik in einem Saal in der von ihm gewünschten Fassung mit Streichern aufgeführt. Da ihn das Klangbild nicht überzeugte, dampfte er die ursprüngliche Bläserbesetzung von 24 Oboen, zwölf Fagotten, einem Kontrafagott, neun Hörnern, neun Trompeten und ein paar Pauken ein, beließ aber die volle Streicherbesetzung.
Der ausgewiesene Barockmusiker Ton Koopman ließ im Konzert diese Fassung spielen, wobei es die reduzierten Bläser bei der Übermacht der opulenten Streicher-Besetzung der Staatskapelle doch schwer hatten, sich zu behaupten.
Vor dem „Highlight Feuerwerksmusik“ hatten die Programmmacher Ton Koopman weitere interessante Beispiele der Barockmusik des 18. Jahrhunderts ins Programm geschrieben, wohl auch um Spitzenmusikern der Staatskapelle die Gelegenheit zum Spiel dieser nicht zur Kernkompetenz des Orchesters gehörenden Musik zu geben.
Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nr. 4 BWV 1069, nach neuesten Forschungen bereits 1715/16 in Weimar entstanden, erklang am Konzertbeginn in einer, nach meinem Empfinden, den heutigen Hörgewohnheiten abträglichen Fassung. Mit Joseph Haydns „Sinfonia concertante B-Dur Hob.I:105“ gab das weiter Programm die Besonderheit Spitzensolisten der Staatskapelle ihre Barock-Auffassungen darzulegen. Matthias Wollong Violine), Norbert Anger (Violoncello), Céline Moinet (Oboe) und Thomas Eberhardt (Fagott) spielten eine himmlische Quartett-Kadenz.
Haydn (1732-1809) hatte die Sinfonia concertante 1792 in London in der damals beliebten Form geschrieben, um eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Geigern dem Publikum zur Entscheidung vorzulegen, ob Musik mit Niveau oder gefällige Darbietungen die Konzertsäle füllen sollten. Eigentlich noch immer ein aktuelles Problem.

Mit Koopmans Dirigat wurde am Konzertabend das Problem nicht gelöst, hatte mich aber doch tief beeindruckt.
Komplettiert war der Abend mit Antonio Vivaldis Concerto g-Moll RV 577 „Per l´Orchestra di Dresda“, entstanden 1720 oder 1721. Die Musik Vivaldis wurde offenbar von der Kurfürstlichen Hofkapelle häufig gespielt und der Venezianer wusste von der Leistungsfähigkeit des Orchesters, ist aber nie in Dresden gewesen. Aber sein Schüler und Freund Johann Georg Pisendel (1687-1755) war seit 1712 zunächst Geiger und später Konzertmeister der Kapelle und wird ihm berichtet haben.
Zumindest hat Vivaldi (1678-1741)dem Geiger ein hochvirtuoses Solo geschrieben, dass Matthias Wollong im Konzert hervorragend, unterstützt vom Oboisten Rafael Sousa zur Geltung brachten.
Zu einem emotionalen Höhepunkt des Konzertes gestaltete sich, als zum Abschluss der Solohornist und Kammervirtuose Erich Markwart nach 32 Dienstjahren in der Sächsischen Staatskapelle vom Orchestervorstand Friedwart Christian Dittmann in den Orchestermusiker-Ruhestand verabschiedete und Ton Koopman den verdienten Virtuosen mit Händels „La Réjouissance“ besonders ehrte.
Autor der Bilder: Matthias Creutziger
Thomas Thielemann, 28.4.22
MADAMA BUTTERFLY
Premiere: 2.4. 2022. Besuchte Vorstellung: 8.4. 2022
Sie ist – stimmlich und gestisch – eine reife Cio-Cio-San: Kristine Opolais. Allein die Tatsache, dass sie, im Mittelpunkt einer Oper stehend, in der sie ab ihrem ersten Auftritt fast pausenlos auf der Bühne zu stehen hat, den Raum zu füllen vermag, den ihr die Regie großzügig und souverän einräumt, macht die neue Butterfly der Sächsischen Staatsoper zu einem tränenseligen Vergnügen - den Rezensenten möchte ich sehen, der trotz permanten Reflektierens über die Mach-Art und die Protagonisten dieses Abends kühl bleibt.
Nun könnte, ja müsste ein politisch korrekter Zuschauer im Deutschland des Jahres 2022 zunächst einmal fragen, wie er es mit dem sog. Gehalt des Werks hält, dessen „schöne“ Melodien und dessen zügige Dramaturgie eventuell nicht darüber hinwegzutäuschen vermögen, dass Madama Butterfly den Kolonialismus mit Hilfe von genialen und tief ergreifenden Melodien mit einer trügerischen Sauce überkleckert. Versuche, dem Werk die Brutalität wiederzugeben, die noch in der Erstfassung stärker enthalten war, gab und gibt es genug – doch welchen Sinn sollte es haben, die Wiederherstellung der ursprünglichen Intentionen der Schöpfer des Werks zugunsten einer ganz anderen, ja gegenteiligen Lesart zu suspendieren? Joachim Herz hat einst eine Spielfassung der Urversion der Butterfly auf die Bühne gebracht, um zu belegen, dass sich Puccini irrte, als er die Oper in einer zweiten, ideologisch gleichsam abgemilderten Werkgestalt in Brescia zur erfolgreichen Uraufführung brachte. In Dresden wählt man einen gänzlich anderen – und probaten Weg: die Koproduktion, u.a. mit Tokyo, wurde von einem japanischen Regisseur inszeniert, der den kolonialen Blick auf die Figuren und die Oper genauer unter die Lupe nimmt. Amon Miyamoto hat, zusammen mit seinem Kostümgestalter, dem mittlerweile verstorbenen Kenzo Takada, dem Bühnenbildner Boris Kudlicka und dem Videographen Bartek Macias, nicht zuletzt dem Lichtgestalter Fabio Antoci, eine Bühnenästhetik realisieren lassen, die Japan deutlich und liebevoll zitiert, das eine oder andere Klischee (das keines ist) in den zahlreichen Bildprojektionen präsentiert und es doch schafft, mit Hilfe einer in jedem Sinne luftigen Bühnentechnik eher eine Parabel als, trotz überdeutlicher Kirchenfenstereinblendung, eine Hollywood-Produktion auf die Bühne zu bringen; nebenbei fällt einem wieder auf, dass die klassische Filmmusik nicht allein Wagner und Strauss, auch Puccinis Tonsprache zumal der weltberühmten Madama Butterfly einiges verdankt.

Ob einem die Bühnenästhetik mit ihren zahlreichen Illustrationen im Stil eines konkreten Symbolismus (Kirschblüten, Himmel, Sterne und ein gigantischer Planet) und szenischen Verdoppelungen (die verarmte, singende und tanzende Butterfly auf der Strasse) gefällt oder nicht gefällt, ob sie einem „zuviel“ ist oder im Rahmen zitierter Japanbilder gerade richtig anmutet, ist eine Sache des persönlichen Geschmacks, nichts sonst. Soffiten bewegen sich oft von links nach rechts, akzentuieren neue Räume, wenn sich der zentrale Holzkubus mit seinen verschiedenartigen Seiten und Öffnungen in eine neue Position dreht, um den agierenden Personen einen neuen Rahmen zu geben. Japan ist in den Kostümen unverstellt gegenwärtig; es hat schon seinen Sinn, wo Miyamoto die Handlung in direkten Bezug zur anglo-japanischen Allianz von 1902 und zum russisch-japanischen Krieg von 1904 setzt. Wenn Pinkerton im 3. Akt kurz nach Nagasaki zurückkehrt, ist er ein vom Krieg buchstäblich Versehrter, der, obwohl er eine „standesgemäße“ amerikanische Frau geheiratet hat, vor allem deshalb leidet, weil er Butterfly immer innig geliebt hat – so wie, das ist das Grundkonzept der psychologisch motivierten Inszenierung, Cio-Cio-San im Gleichklang mit dem Amerikaner verbunden war und blieb. Der japanische Regisseur behauptet also nicht, dass der Mann aus den USA ein verlogener und selbstmitleidiger wie inkonsequenter Kolonialist, sondern wie seine Geliebte ein Opfer der politisch-gesellschaftlichen Zustände und des Krieges ist. Das Schöne und Entscheidende an dieser Lesart ist die Tatsache, dass ihm Puccinis Musik – eine Musik der tiefsten Zuneigung zu den Figuren – niemals widerspricht. Miyamoto widerholt also mit seiner Deutung die Liebe, die Puccini einst seinen leidenden Figuren, insbesondere der Cio-Cio-San, der Suzuki und dem Kind, aber auch den Männern geschenkt hat. Er will nicht klüger sein als der Komponist und seine Librettisten, aber er geht über das zumindest bei uns übliche Bild der „problematischen“ Oper empathisch hinaus.

Sieht man auch das, was im Programmheft und von der Dramaturgie (Johann Casimir Eule) an Psycho- und Soziologischem behauptet wird? Sagen wir so: Wenn wir es wissen, sehen wir es – wir sehen ja auch, jeweils zu Beginn der drei Bilder, wie Pinkerton nach dreissig Jahren stirbt und zuletzt seinem Sohn, der zunächst nichts von seiner japanischen Vergangenheit weiss, nun endlich alles mitteilt. Alexander Ritter spielt den erwachsenen Sohn, der fast die gesamte Spielzeit über zum Zeugen der Ereignisse und zum Imaginator der von ihm nicht erlebten Szenen wird; das kleine Kind, Typus: Süßer Fratz,ist Georg Sund, der die gute alte Theaterweisheit „Keine Tiere, keine Kinder“ ins Recht setzt – und doch so wichtig für die Entwicklung der fatalen Geschichte ist. Beide Akteure, der große und der kleinere, machen ihre Sache ausgesprochen gut und diskret genug. Eine Konsequenz der von Miyamoto interpretierten Handlung ist die Tatsache, dass sich Cio-Cio-San nicht aus dem Gefühl der persönliochen Enttäuschung heraus umbringt, sondern mit echt japanischen Ethos den letzten freien Entschluss ihres Lebens in die Tat umsetzt: Wer nicht in Ehren leben kann, kann in Ehren sterben, um, das ist der Sinn dieses Suizids, dem Sohn eine sozial gesicherte Existenz im fremden Land zu verschaffen.

Dass der Regisseur mit tiefer Zuneigung zu den sich begegnenden Liebesleuten und nicht mit dem scharfen Blick des Ideologiekritikers auf Madama Butterfly schaut, belegt auch der Umstand, dass die winzige, aber so wichtige Rolle der Kathe (musikalisch eine Wurzen), mit Aufmerksamkeit bedacht wird. Die Frau, die an Cio-Cio-San schuldlos schuldig wird, behält ihre Ehre, wird im Übrigen von der jungen Nicole Chirka, einem Mitglied des Jungen Ensembles Semperoper Dresden, sehr schön gesungen. Wichtiger sind freilich die anderen kleineren und großen Rollen: Kristina Opolais glänzt durch eine stimmliche Stärke, wenn auch in der Höhe nicht völlig durch letzte vokale Freiheit, und durch eine dunkle Sopranfärbung, die aus dieser Cio-Cio-San von Anfang an eine selbstbewusste Frau macht, die sich schon sehr schnell von ihren Wurzeln emanzipiert, weil sie sich in Beziehung zu Pinkerton zurecht als gleichberechtigt sieht – eine Lesart, die im Widerspiel des Texts von Illica und Giacosa fast völlig funktioniert, wäre da nicht Pinkertons früher Hinweis auf die andere Frau: ein Widerspruch, den auch diese Inszenierung nicht völlig ausräumen kann, aber es verschlägt im Grunde nichts. Freddie de Tommaso singt einen stimmsicheren, lyrisch wie heldisch begabten Pinkerton wie aus dem Bilderbuch der italienischen Oper; kein Wunder, dass Cio-Cio-San über drei Jahre auf ihn wartet. Schön auch, dass der Sharpless des Gabriele Viviani gleichermaßen über die nötige vokale Pracht wie über die Intelligenz verfügt, diese wichtige Rolle mit artikulatorischer Prägnanz zu erfüllen – seine letzte Begegnung mit Suzuki und Cio-Cio-San gehört zu den dramatischen Höhepunkten des Abends. Die Suzuki der Christa Mayer lässt keine Wünsche offen, ebenso wenig der Fürst Yamadori des Sebastian Wartig (und wieder fragt sich wohl mache Zuschauerin, wieso Cio-Cio-San nicht dem stimmlichen Charme des gutaussehenden Mannes / Sängers erliegt). Aaron Pegram spielt den Goro wie de Tommaso den Pinkerton: rollendeckend, also ein wenig „schmierig“ und stimmlich deutlich wie spielerisch überzeugend. Bleibt die Edelwurzen des Onkel Bonzo: Nicolai Karnolsky (eine alte Bekanntschaft aus dem Nürnberger Ensemble) wütet (s)ein(e) paar hübsche Minuten über die Bühne: in grellroter, quasi heidńischer Maske.
Und die Basis? Vergessen wir nicht den wie stets wunderbaren Chor der Sächsischen Staatsoper unter André Kellinghaus und die Sächsische Staatskapelle. Sie spielt an diesem Abend einen so bezwingenden wie zauberhaften Puccini heraus. Omer Meir Welber „kann“ nicht allein Mozart, er ist auch um 1900 zuhaus – die Staatskapelle spielt unter seiner Leitung eine gefederte wie gespannte, dramatisch mitreissende und tieflyrische, dabei mit ihrer raffinierten Motivik, ihrem Melos und ihrem brillanten Orchester glasklar organisierte Madama Butterfly. Schon musikalisch ist diese Produktion ein großes Vergnügen – szenisch ist sie delikat, um menschenfreundliche Aufklärung bemüht, ästhetisch geschmackvoll und stets interessant. Die Zustimmung des Publikums war jedfenfalls ziemlich eindeutig. Und am Ende dürfen sich Cio-Cio-San in irgendeinem Jenseits sogar wieder glücklich begegnen – Herz, was willst du mehr?
Frank Piontek, 11.4. 2022
Fotos: Ludwig Olah
6. April 2022
Madama Butterfly mit fernöstlicher Deutung.
Amon Miyamoto inszenierte- Omer Meir Wellber dirigierte.
Das Schicksal des Teehaus-Mädchens Cho-san im japanischen Nagasaki der 1890-er Jahre hatte die Missionarin Sarah Jane Correll (1835-1932) sehr berührt, so dass sie die Geschichte ihrem Bruder, dem US-amerikanischen Schriftsteller John Luther Long (1861-1927) erst in einem Brief, dann persönlich davon berichtete. Aus seiner Niederschrift der Begebenheit gestaltete er mit dem Dramatiker und Theaterunternehmer David Bellasco (1853-1931) für dessen Theater die einaktige Tragödie „Madam Butterfly“. Giacomo Puccini (1858-1924) lernte das Stück im Juni 1900 im Londoner „Duke of York´s Theatre“ kennen und war von dem Aufeinanderprallen der fernöstlichen und amerikanischen Lebensauffassungen fasziniert. Die Rechte des Stoffes wurden gekauft und Luigi Illica mit der Abfassung eines Librettos beauftragt. Guiseppe Giacosa wurde für die Abfassung der Verse verpflichtet.

Um eine „glaubhafte japanische Färbung seiner Komposition“ zu erreichen, nutzte Puccini als Inspirationsquellen alles was japanische oder chinesische Klangfarben aufweisen konnte. Mit diesen Inspirationen schuf ereine von herrlichen Momenten erfüllte, hemmungslos romantische Musik, die in der Oper mit ihrer Schönheit auf die Brutalität der Handlung trifft. Eine aus heutiger Sicht ist das eine erstaunliche Kombination.Deshalb sei die Frage erlaubt, ob man in der #MeToo-Ära diese Oper dem Publikum noch zumuten darf.
Man darf, wenn die Regie sich ihrer Verantwortung der unangenehmen Gegensätze, so wie der japanische Gast Amon Miyamoto, Jahrgang 1958, gewachsen zeigt.
Miyamoto belässt die Handlung im Jahre 1894, als der US-amerikanische Offizier Pinkerton, damals 25-jährig, nach Nagasaki kam, um als Beobachter den japanisch-chinesischen Krieg zu begleiten. Zu Beginn der Opernhandlung kennen sich Cio-Cio-San und Pinkerton bereits; möglicherweise von ihrer Arbeit im Teehaus. Die Emotionalität des Liebesduetts zum Schluss des ersten Aktes weist zumindest auf eine außergewöhnliche Leidenschaft, eine schicksalhafte Begegnung voller transzendenter Kraft der Beiden.

Pinkerton hatte eine solche Frau noch nie getroffen, so dass nur noch der Moment zählt. Er musste diese Frau heiraten, egal was passiert, auch wenn in Amerika die Verlobte wartet. Im Kriegseinsatz schwer verletzt, heiratet Pinkerton in den Staaten die Verlobte Kate und beide holen den Sohn aus der japanisch-amerikanischen Beziehung samt der Kinderfrau Suzuki nach Amerika. Den Suizid der Butterfly motivierte bei Miyamoto nicht ihre Verzweiflung, sondern ist Folge der Erkenntnis der jungen Japanerin, dass ihre Situation nie wieder besser werden könne. Deshalb blieb das Endziel ihres Lebens, ihrem Sohn die Chance zu erhalten, Amerikaner zu werden. Ihm drückte sie zum Abschied symbolisch ein US-Fähnchen in die Hand und ging hinter den Wandschirm und man hört den Fall des Dolches…
Doch der Pinkerton-Sohn, inzwischen erwachsen, wird in Amerika nicht glücklich. Er tut sich schwer mit seiner Identität und leidet unter der Fremdenfeindlichkeit, bis er in den 1920-er Jahren einen Abschiedsbrief seines Vaters erhält, der ihm die Geschichte der Beziehung zwischen seinen leiblichen Eltern eröffnet.
Diesen Aspekt, der über die Sichtweise der Puccini-Oper hinaus führte, stellte Amon Miyamoto in einer Rahmenhandlung zur Oper und erzählte uns seine Interpretation des Puccini-Werkes mit dem Inhalt des Briefes eines ob seiner Gewissensnot schwer depressiven Menschen. Der erwachsene Sohn Cio-Cio-Sans und Pinkertons begleitete das Operngeschehen als Betrachtender und durch Körpersprache Kommentierender.
Das Schlussbild war für mich problematisch, als die suizidierte Butterfly und der ob der Aufregungen des dritten Aktes offenbar verstorbene Anti-Held Hand in Hand „ins Licht „ gehen, so als ob die eigentlich Unmöglichkeit der Geschichte eine Verklärung ermögliche. Das mag allenthalben für den Gemütszustand des nach Hause entlassenen Besuchers tunlich sein, aber entspricht nicht unseren gesellschaftlichen Moralansprüchen.

Die eindrucksvolle Bühne war von Boris Kudlička so gestaltet worden, wie man sich die Wohnverhältnisse in Nagasaki um 1900 vorstellen könnte. Das Spiel mit gewaltigen Vorhängen prägte über weite Strecken das Geschehen auf der Bühne. Phantastische Lichteffekte, einfallsreiche Videoeffekte mit überraschenden Allegorien und fast unbemerkte kleine symbolische Randhandlungen zeigten das Können der Gestalter.
Die fantasievollen Kostüme stammten noch vom im Oktober 2020 verstorbenem Altmeister Kenzo Takada und entsprechen gleichsam unseren Vorstellungen japanischer Kleidung der Handlungszeiten.
Garanten für einen glänzenden musikalischen Abend waren die Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden, die mit dem „noch –Ersten Gastdirigenten“ Omer Meir Wellber Puccinis Partitur mit zauberhaften Farben beleuchteten und den Singenden eine stabile Stütze sichern. Wellber nutzte seine Fähigkeit, melodische Linien zu entwickeln sowie mühelos zwischen Poesie und Spannung zu wechseln. Da war auch nicht eine Spur der Gefahr einer Verkitschung des Klangbildes zu erkennen.

Die Cio-Cio-San von Kristine Opolais war keine zerbrechliche Fünfzehnjährige, sondern eine wissende, starke Frau, die sich die Liebe zu Pinkerton als Schicksal erwählt hat. Sie erahnte vom Beginn, dass der Traum vom amerikanischen Eheglück fragil ist, so dass ihr Suizid die Entscheidung bleibt, ihrem Sohn die Chance auf ein Leben in Amerika zu erhalten. Mit angenehm rund geführtem Sopran entfaltete sie Kraft in der Höhe, einen unbändigen Gestaltungswillen und durchaus demonstrative Gesten.
Der warme Mezzosopran Christa Mayers, als die besorgte Suzuki, harmonierte auf das Wunderbarste mit dem Sopran der Titelheldin. Mit ihrer Zerrissenheit zwischen Treue zur Untergehenden, sowie die Erkenntnis der Ausweglosigkeit der Situation der Cio-Cio-San, trug sie wesentlich zur Verdeutlichung der Gemüts- und Stimmungslage ihrer Herrin bei. Neu, die sanfte Frau Mayer kann auch aggressiv werden!
Den B.F. Pinkerton musste und konnte Freddie De Tomaso bei Miyamotos Ausdeutung seiner Beziehung zur Cio-Cio-San sensibler darbieten, als ihm in anderen Inszenierungen möglich gewesen wäre. Ihm kam zu pass, dass seine Tenorstimme doch in den mittleren Lagen hörbar wohler und weicher aufwarten kann, als in der Höhe, so dass er sympathischer wirkte.
In der väterlich angelegten Partie des amerikanische Konsuls Sharpless war der Bariton Gabriele Viviani mit seiner Sorge um die jungen Leute und mit seinem Unbehagen stimmlich und darstellerisch hervorragend aufgehoben.
Der Heiratsvermittler Goro von Aaron Pegram war mit seinem weltmännischen Auftreten, obwohl doch letztlich nur ein Zuhälter, eine gute Besetzung.
Die übrigen Rollen waren ordentlich besetzt, blieben allerdings weitgehend unauffällig.
Den Chor, von Jonathan Becker einfallsreich, präzise vorbereitet, ließ Wellber recht ungezwungen frei singen und erreichte so gute Wirkungen.
Reichliche Ovationen für alle Beteiligten einer Inszenierung , die mit hoher Sicherheit ihren Weg im „Touristen-Repertoire“ der Semperoper finden wird.
© Ludwig Olah
Thomas Thielemann, 7.3.22
Premiere 11. März 2022 - Semper zwei-Studiobühne

Udo Zimmermann
Die weiße Rose
Zwei junge Menschen im Wissen, dass in kurzer Zeit ihr Leben enden wird und ihre Persönlichkeit ausgelöscht werde, befanden sich in der extremsten Situation, die man sich als Nichtbetroffener kaum zu denken wagt.
Sophie und Hans Scholl erleiden ihre letzte Lebenszeit in getrennten Haftzellen, waren sich aber über ihre Lebensauffassungen, ihrem Glauben und ihrer Geschwisterliebe aus innigste verbunden, so dass auf der Spielfläche der Studiobühne „Semper zwei“ der Sächsischen Staatstheater die getrennten Räume von Lichtkegeln symbolisiert werden konnten. Ansonsten befanden sich neben zwei Stühlen nur ein angedeuteter Hügel, ein Mauerabschluss im Hintergrund und etwas symbolische Erde auf der kahlen Spielfläche.

Als Ouvertüre erklingt das metallische Knallen des Fallbeils bei der Hinrichtung des dritten Verurteilten, ihres Freundes Christoph Probst, erzeugt mit der besonderen Tonkälte des Nachbaus eines Stahl-Kontrabasses.
Noch das Gekeife des Richters des „Volksgerichtshofs“ Roland Freisler im Ohr, Original-Tondokumente wurden in der Aufführung eingespielt, sangen und spielten die Sopranistin Elisabeth Dopheide und der Bariton Franz Xaver Schlecht in einem beklemmenden Auf und Ab von Emotionen, Texte, die sie vor ihrer Verhaftung gemeinsam gelesen und besprochen haben könnten. Die wechselvollen Gefühle, Poesie, Halbtraum, Utopie, sowie die fließenden Grenzen zwischen Realität und Irrealität wurden dramatisch, fern von jeder Opernkonvention, in einem Schwebezustand zwischen Realismus und Abstraktion, bestechend glaubhaft, bis zur Grenze des Erträglichen dargestellt.
Am Anfang agierten die Geschwister scheinbar noch aneinander vorbei, boten eigene Sichtweisen. Je beängstigter sich die Musik entwickelte, finden Beide den anderen zunehmend als Teil der eigenen Geschichte.
Die junge Sopranistin Elisabeth Dopheide (*1996), die mit dem überwiegend extrem hoch gesetztem Gesang ihrer radikal dramatischen Rolle stimmlich besonders gefordert war, meisterte die Sophie auch darstellerisch überwältigend. Eine ausgereifte Leistung, die sie in ihren doch jungen Jahren über den Abend brachte.
Ihre Panik bei der vermeintlichen Abholung zur Hinrichtung und ihr verzweifeltes „nur einmal noch….“ waren grandios.
Franz Xaver Schlecht vom Ensemble der Oper Leipzig singt und spielt den Hans Scholl mit einem dunklen, kraftvoll-fokussiertem Bariton und ungebrochenem Stimmfluss. Mit seiner Darstellung versuchte er sich zunächst, natürlich vergeblich, aus der Situation herauszudenken, wird dann zunehmend verzweifelter.
Letztlich waren sämtliche der sechszehn Szenen eindringlich, ausdrucksstark und beschwörend, aber nie opernhaft.
Um das Publikum zur Konzentration auf die besondere Dramatik der Situation regelrecht in Haft zu nehmen, war das Orchester hinter der Besucher-Tribüne angeordnet. Der musikalische Leiter der Aufführung Johannes Wulff-Woesten hatte mit seiner Bearbeitung die Zahl der Instrumentalisten der Guiseppe-Sinopoli-Akademie, Corona-bedingt, mit neun begrenzt. Ein faszinierend, wandlungsfähiges Ensemble ließ Holzbläser über wütendem Blech schrillen, Oboen und Geigen weinten. Dazu mischten sich Klavier- und Schlagzeug-Deklamationen sowie bestechende Gitarren und Bassgitarrenklänge; alles mit präziser Intonation geboten.
Die Lichtgestaltung Marco Dietzels war imponierend und die Kostümgestaltung von Véronique Seymat passte.
Für den Regisseur und Bühnenbildner Stephan Grögler war dieses gelungene Dresdner Hausdebüt seine siebte Inszenierung des Opernstoffes Udo Zimmermanns.

Hans und Sophie Scholl waren als Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ am 18. Februar 1943 bei einer Flugblattaktion in der Münchner Universität von einem Hausmeister entdeckt und der GESTAPO übergeben worden. In einem Prozess am 22. Februar 1943 werden sie mit ihrem Kommilitonen Christoph Probst zum Tode verurteilt und die Vollstreckung für den gleichen Tag angeordnet.
Als der ostdeutschen Nachkriegsgeneration war in unserem Bewusstsein das Schicksal der Geschwister Scholl besonders verankert, eigentlich ständig präsent. Dabei war regelrecht ausgeblendet, dass es sich bei den Widerstandskämpfern der „Weißen Rose“ nicht um in der Wolle gefärbte, gar kommunistisch orientierte Antifaschisten gehandelt hatte. Uns war nicht bewusst, dass der heranwachsende Hans begeistertes Mitglied der Hitlerjugend mit Führungspositionen im „Deutschen Jungvolk“ und Sophie eine straffe Scharführerin des Bundes Deutscher Mädel gewesen waren. Und dass sich erst dank der Kontakte mit Universitätskreisen, die regimekritische und christlich-ethische Positionen besetzten, sowie des Kriegseinsatzes des Hans ihre weltanschauliche Haltung in den 1940-er Jahren entwickelt hatte, war nie thematisiert worden.
Dass die Flugblattaktion im Lichthof der Universität, die letztlich zur Verhaftung der „Weißen Rose“ führte, ein übermütiger Leichtsinn junger, unkonventionell-lebensfroher Menschen gewesen war, bei dem auch Opiate eine Rolle gespielt haben sollen, war und ist weitgehend unbekannt.

Der Dresdner Komponist Udo Zimmermann (1943-2021) ist vermutlich mit einem vergleichbaren „Geschwister-Scholl-Bild“ aufgewachsen. Während unserer Loschwitzer Zeit haben wir nur reichlich einhundert Meter von Zimmermanns Neubau gewohnt und ihn gelegentlich im Fitness-Studio getroffen. Leider hatte es dabei kaum Kommunikationen gegeben.
Udo Zimmermann begann im Alter von 22 Jahren, sich mit dem Schicksal der Geschwister Scholl musikalisch zu beschäftigen. Mit einem Libretto seines Bruders Ingo Zimmermann (*1940) schuf Udo „ein Stück für Musiktheater in acht Bildern“ für eine Studentenproduktion des Opernstudios der Hochschule für Musik Dresden, die 1967 im kleinen Haus der Staatstheater zur Aufführung kam.
In eine Rahmenhandlung der Geschwister, mit der Erwartung ihrer Hinrichtungen, waren sechs Zwischenspiele mit Reflexionen, wie die Protagonisten zur Widerstandsbewegung gefunden hätten, eingebunden.
Zimmermanns Opern-Erstling erforderte ein mittelgroßes Orchester und etwa 80 Mitwirkende auf der Bühne. Trotz mehrfacher Überarbeitungen blieben auch die Neufassungen flach, konstruiert sowie belehrend, waren von den Gesetzen der Oper nicht zu erfassen und ähnelten eher einer Kantate. Nach neun Inszenierungen und einer Rundfunkfassung im Jahre 1972 verschwand das Werk aus dem Repertoire.
Der Versuch, in den Jahren 1984 und 1985 die Oper noch einmal zu überarbeiten, führte zur Erkenntnis, besser auf die dokumentarisch-erzählende Handlung zur Geschichte der Widerstandsgruppe völlig zu verzichten und die Komposition auf die Grenzsituation der letzten Lebensstunde von Hans und Sophie zu konzentrieren.
Der Dramaturg Wolfgang Willaschek stellte 1986 aus Briefen, Tagebuchaufzeichnungen der Geschwister, sowie Texten von Dietrich Bonhoeffer, Franz Fühmann, Reinhold Schneider, Tadeusz Różewicz und Psalmworte des Alten Testaments das Libretto der Kammeroper „Szenen für zwei Sänger und 15 Instrumentalisten“ zusammen.

Auf der Dresdner Studio-Bühne erlebten wir mit der faszinierend geradlinigen Inszenierung Stephan Gröglers einen beklemmend hochemotionalen Abend.
Ich hatte mit den, für manche Besucher eventuell erlösenden Ovationen, einige Probleme. Bevorzugt wäre ich nach den deklamatorischen Schlussworten still nach Hause gegangen.
Für mich hat sich ob der eigentlich nicht zu überbietenden Situation der Protagonisten jeder Versuch eines aktuellen Bezuges des Lebens und Sterbens der Geschwister Scholl schwierig gestaltet, zumal es gefährliche Nutzungen des Sinnbildes der „Weißen Rose“ für Querdenker, Impfgegner und Rechtspopulisten gibt. Und wenn Björn Höcke 2018 in Chemnitz vor allen Augen mit einer weißen Rose einen „Trauermarsch der Neonazis“ anführte, dann ist doch jedes Maß überzogen.
Bilder © Ludwig Olah
Thomas Thielemann, 12.3.22
Premiere 5. März 2022
Aida-Neuinszenierung von Katharina Thalbach
Die Semperoper erhält eine publikumswirksame Erweiterung des Repertoires.
Zu den Bestrebungen des Vizekönigs der osmanischen Provinz Ägypten Ismail Pascha (1830-1895) gehörte eine Vereinigung der Kunst und Kultur Europas mit dem Land der Pharaonen. Deshalb ließ er zu Beginn seiner Regentschaft noch als Gouverneur das Khedival-Opernhaus als erstes Opernhaus auf afrikanischen Boden bauen. Eröffnet werden sollte der Musentempel am 1. November 1869, also sechzehn Tage vor der Inbetriebnahme des Suez-Kanals. Der Vizekönig wollte dazu eine Repräsentations- und Prunkoper, die Macht und Bedeutung Ägyptens verherrlichte, aufführen lassen. Guiseppe Verdi (1813-1901) sollte die Oper nach einem Szenario des Ägyptologen Auguste Mariette (1821-1881) komponieren. Verdi wollte allerdings keine Gelegenheitskompositionen schaffen, erlag dann trotzdem 1870 der Überzeugungskraft des in Frankreich ausgebildeten „Khedive“ Ismail Pascha und akzeptierte den Vertrag. Allerdings erst, als angedeutet wurde, dass die Aufgabe ansonsten an Herrn Wagner oder Herrn Gounod gehen könnte und als ihm das Honorar in der zu dieser Zeit schwindelerregenden Höhe von 150.000 Goldfranken zugesichert worden war. Da waren der Kanal und das Opernhaus längst eingeweiht.

Im Spannungsfeld der Wünsche des Auftraggebers und Verdis Befindlichkeiten begann er im Juli 1870 mit der Arbeit.
Nach Verdis Anforderungen schrieb Antonio Ghislanzoni (1824-1893) das Libretto. Für den Triumph-Marsch baute Adolphe Sax (1814-1894) spezielle Fanfarentrompeten. Auch fertigten für die Kairoer Uraufführung die Werkstätten der Pariser Oper die Kulissen und Kostüme.
Unterdessen hatte Frankreich Preußen den Krieg erklärt. Die siegreichen Preußen beschlagnahmten in Paris die Ausstattung, so dass die Oper erst am 24. Dezember 1871 in Kairo zum ersten Mal auf die Bühne kommen konnte.
In seiner Oper ließ Verdi im extremen Kontrast monströse Prunkszenen auf intime Innerlichkeit aufschlagen, die den Inszenierungen die Voraussetzungen schaffen, mit einer einfach zu erfassenden Handlung, je nach Gemütslage, ein filmreifes Spektakel oder eine Studie menschlicher Gefühle unter gesellschaftlichen Zwängen zu bieten.
Die großartigen Bühnenbauten und die Kostüme Ezio Toffoluttis der Dresdner Inszenierung von 2022 deuten zunächst auf eine pompöse Variante. Hohe gold-bronzierte Wände bildeten beeindruckende Klangräume. Aber eine überlebensgroße Katharina am rechten Bühnenrand im dritten Akt deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger, worum es gehen wird.
Mit ihrer Inszenierung erteilte Katharina Thalbach dem Verherrlichungs-Anliegen des Ismael Pascha eine Abfuhr, versuchte dabei die Autokraten unserer Zeit zu treffen. Und so gestaltete sich die Aufführung der Nationalhymne der Ukraine, nicht nur als Solidaritätsbekundung, zu einer Einheit mit Katharina Thalbachs Verdi-Deutung.
Statt Triumphmarsch–Pomp wurde die Grand Opera zum Kammerspiel eingedampft Die Dreiecksgeschichte erzählte Katharina Thalbach schlicht und geradlinig. Die individuellen Dramen stehen im Mittelpunkt ihrer Inszenierung. Die Figuren und Situationen waren konsequent und sinnlich aus dem Geist der Musik heraus gestaltet.
Aida als Schwächste im Trio erweist sich als die Stärkste des Bühnengeschehens. Trotzdem gehört das besondere Mitgefühl der Regie der verschmähten Amneris.
Die Massenszenen hatte die erfahrene Schauspielregisseurin so gestaltet, wie sie zum Fortgang der Handlung notwendig waren. Erfreulich gut eingebunden erwiesen sich die Choreografien von Christopher Tölle, der die Tänzerinnen und Tänzern fast etwas ironisch agieren ließ.

Die Mitglieder des Sinfoniechores Dresden, des Extrachores der Semperoper und des Sächsischen Staatsopernchores Dresden erfreuten mit eindrucksvoller Intensität, bemerkenswerter Klangwucht und Profilschärfe in den dramatischen Phasen. Mit diesem hervorragend klug von André Kellinghaus koordinierten Klang-Raum-Erlebnis kam damit auch die Monumentalität in der Thalbach-Arbeit nicht zu kurz.
Mit seinem Dirigat orientierte sich Christian Thielemann am Inszenierungskonzept, zeigte den Schulterschluss des musikdramatischen Anliegens, immer spannungsgeladen, mit der unter die Haut gehenden Intensität der Inszenierung. Mit feinstem orchestralem Gewebe betonte er die intimen Momente und die kammermusikalische Struktur.
Mit den Erkennungsmotiven, die sich wie ein roter Faden durch den Orchesterpart der Sächsischen Staatskapelle ziehen, verband der Dirigent das Ganze geschickt zu einer großen musikalischen Einheit. Damit verhinderte er, dass die Oper zur Aneinanderreihung von beliebigen Gesangs- und Instrumentalstücken ohne erkennbaren Zusammenhang verfällt, auch wenn Zwischenbeifall den musikalischen Fluss gelegentlich gefährdete.
Die Sächsische Staatskapelle erwies sich an diesem Abend für Verdis Orchestrierung, als die höchste Errungenschaft der italienischen Oper, wie gemacht. Die Instrumente wurden zu musikalischen Seelenpartnern für die Liebenden, Eifersüchtigen oder Schmerzgeplagten.
Immer wieder begeisternd, wie Christian Thielemann die Koordinierung zwischen dem Orchester, den Solisten und dem Chor sicherte, vor allem auch Sänger-freundlich agierte und den Solisten viel Raum gab.
Als Aida beeindruckte Krassimira Stoyanova nicht nur mit ihrem wohlklingenden, bezaubernden Sopran, mit dem sie mühelos die vokalen Feinheiten meisterte. Auch die differenzierte Darstellung der rechtlosen Sklavin einerseits und der selbstbewussten liebenden Frau andererseits gelang ihr überzeugend. Beeindruckend, wie Frau Stoyanova die Achterbahn der Gefühle in den Auseinandersetzungen mit ihrem Vater Amonasro und ihrer Konkurrentin Amneris bewältigte.

Stimmliche Ausdruckskräfte mit berührenden Pianissimo bestimmten die Darstellung der Emotionen ihrer Aida. Ihre Gestik, ihre Körpersprache waren immer Spiegel ihrer Interpretation, selbst wenn sie nichts zu singen hatte.
Die Amneris von Oksana Volkova brillierte mit Kraft in den unteren Registern und edler Schönheit in den Höhen ihres technisch einwandfrei geführten, wohltuend kontrollierten Mezzosoprans. Differenziert bot sie mit grandioser Mezzowucht die giftige von Eifersucht geprägte Haltung der rachsüchtigen Frau und die verschmähte Liebende mit dramatischer Ausdruckskraft als voluminöser Mezzosopran.
Dazu spielte sie auch die Dramaturgie ihrer ägyptischen Prinzessin ordentlich aus.
Neben den beiden starken Frauen hatten es die Männer etwas schwerer:
Einen beeindruckenden Radamès kreierte Francesco Meli mit leicht eingedunkelten Tenor. Sehr präsent in der Mittellage, trifft er mit hervorragender Stimmkultur und mit darstellerischen Mitteln die Ausweglosigkeit der Situation des Radamès. Fast unverschuldet gerät er in den bitterernsten „Zickenkrieg“. Mit seinem widersprüchlichen Charakter geht er im Hoffen auf Treue und sinnhafte Bindung, als schmerzlich hoffnungsloser Romantiker, von Ängsten gepeinigt, als verträumter Idealist mit wehenden Fahnen unter. Da nützten ihm weder kriegerischen Erfolge, noch seine Glaubwürdigkeit und Menschlichkeit.
Einen starken König von Äthiopien Amonasro, der trotz Gefangenschaft stolzer Anführer bleibt, konnte der Bariton Quinn Kelsey darbieten. Die Höhepunkte seiner Darstellung fand er im Duett mit Aida und seinem emotionalen Ausbruch im dritten Akt.

Der Priester Ramfis , mit schwarz-markanter Kraft von
Georg Zeppenfeld raumfüllend gesungen und dargestellt, repräsentierte eindrucksvoll die Macht der ägyptischen Priesterschaft.
Wenige Möglichkeiten seinen etwas spröden sonoren Bass zu präsentieren, blieben für Andreas Bauer Kanabas mit der Rolle des Königs von Ägypten. Simon Esper hatte als Bote einen frischen Auftritt.
Als Tempelsängerin bestach Ofeliya Pogesyan vom Jungen Ensemble mit ihrer Aufweitung der Weihe des Radamès zum Feldherrn. Überhaupt gehörte diese Präsentation einer Nebenfigur zu den Glanzpunkten der vielen Regieeinfälle der Inszenierung.
Mit stehenden rhythmischen Ovationen dankte das Premierenpublikum für die brillanten Leistungen und diese populär-schlüssige Deutung der Verdi-Oper, die bereits im Juli 2022 ihren Weg in das Repertoire der Semperoper nehmen wird.
Bilder © Ludwig Olah
Thomw Thuilemann, 6.3.22.
Der Capell-Compositeur stellte sich vor
3. Februar 2022
Semperoper Dresden
Matthias Pintscher dirigiert bei der Staatskapelle Anton Webern; Mattias Pintscher und Sergej Rachmaninow.
Der Capell-Compositeur der Sächsischen Staatskapelle Dresden der Saison 2021/22 Matthias Pintscher, geboren im Jahre 1971, war im Semperbau bereits vor dieser Verpflichtung kein Unbekannter. Seinen nach dem Drama Hans Henny Jahnns gestalteten hochemotionalen Opern-Erstling „Thomas Chatterton“ hatte er als 27-Jähriger 1998 im Hause mit großem Erfolg zur Uraufführung gebracht.
Bedingt durch die Pandemie-Umstände bedurfte es der Zeit bis zum Februar 2022, dass sich der inzwischen Einundfünfzigjährige in einem Sonderkonzert als Komponist und Dirigent dem Dresdner Publikum vorstellen konnte.

Für seinen Dresdner Neuanfang brachte Matthias Pintscher sein neuestes Orchesterwerk „
Neharot“ für die Deutsche Erstaufführung zur Staatskapelle mit. Neharot, steht im Hebräischen für Flüsse, aber auch für Tränen.
Das Orchesterwerk ist im Frühjahr des Jahres 2020 in New York unter dem Eindruck der ersten Welle der Corona-Pandemie als „ musikalische Reflexion der Verwüstung und Angst, aber auch der Hoffnung auf Licht, die diese Zeit unseres Lebens so emotional geprägt hat“ entstanden.
Unter dem Eindruck des Eingesperrtseins im März 2020 und als Hommage an die Opfer des Covid war ein Totengebet, ein „Kaddisch“, mit weichen Fragmentierungen musikalischer Elemente entstanden.
Der unmittelbare Anlass für die Komposition führte folgerichtig auch zu einem für Matthias Pintscher nicht unbedingt typischen Werk.
Die Musik entwickelte sich fast zögerlich in auf- und abschwellenden Wellen der Blechbläser und Perkussionen, in die fast vorsichtig die Streicher, vor allem die tieferen Instrumente Celli und Kontrabass, eingreifen. Bis sich dann mit einem Hornruf explosionsartig eine wütende Energie des Orchesterklangs entwickelte, um nach einem Trompetensolo mit den Bassinstrumenten auszuklingen.
Faszinierend, wie sich da Klangwellen regelrecht durch das Orchester bewegten, interessante neue Tonstrukturen entstanden und beeindruckende Halleffekte zu hören waren.
Das Dirigat des eigenen Werkes für ein Publikum, das die Zeit der ersten Pandemie-Welle in Sachsen noch relativ entspannt erlebte, dann aber von der Pandemie massiv belastet war, von einem gleichsam gebeutelten Orchester dargeboten, brachte die deutsche Uraufführung der Totenklage für alle Beteiligten schon eine emotionale Herausforderung.

Eingerahmt war das zentrale Werk des Capell-Compositeurs mit Kompositionen von Anton Webern (1883-1945) und
Sergej Rachmaninow (1873-1943).
Anton Webern, in Wien als Anton Friedrich Wilhelm von Webern geboren, ist von den Großen der so genannten Zweiten Wiener Schule derjenige, der ab der 1920-Jahre aus der Zwölftontechnik seines Lehrers Arnold Schönberg mit seiner äußersten Komprimierung der musikalischen Strukturen die radikalsten Konsequenzen gezogen hatte.
Die Idylle für großes Orchester „Im Sommerwind“ war aber bereits 1904 nach der gleichnamigen Dichtung von Bruno Wille (1860-1928) entstanden. Wille hatte das Gedicht einem Band seines „Offenbarung eines Wacholderbaums-Roman eines Allsehers“ vorangestellt, in dem Kontraste des Lebens in der Natur thematisiert waren.
Der junge Komponist sparte nicht mit musikalischen Einfällen und Gestaltungsreichtum. Aber es gibt lange Generalpausen und exzessiv ausgedehnte Einzeltöne, die die Spannung der späteren Werke des Komponisten vermissen lassen.
Matthias Pintscher ließ die Musik regelrecht aus dem Nichts entstehen, bevor er den brillanten Streichern im Wechsel mit den hervorragenden Bläsern des Orchesters breiten Raum für das zwölf-Minuten-Werk gab, so dass die ungestümen Taktwechsel ordentlich zur Wirkung kamen.

Nach dem publikumswirksamen, unfertigen Frühwerk Weberns und der emotionalen anlassbezogenen Komposition Mattias Pintschers schloss das Konzert mit einem reifen Spätwerk Rachmaninows „Symphonische Tänze“ op. 45.
Sergej Rachmaninow, auf einem Landgut im Gouvernement Nowgorod geboren und in Russland ausgebildet, war eigentlich weltläufig unterwegs gewesen. Mit seiner Familie wohnte er 1906 längere Zeit in Dresden, erfreute sich an den barocken Schönheiten und nahm am vielfältigen gesellschaftlich-kulturellen Leben der Stadt, aber auch Leipzigs, teil. Für den Komponisten war das Pflaster der Stadt fruchtbar, denn hier entstanden unter anderem seine zweite Symphonie, eine Klaviersonate d-mol und die symphonische Dichtung „Die Toteninsel“.
Ein Kuriosum: der Hausbesitz eines „Eigentümers Sergej Rachmaninow mit Wohnsitz New York“ wurde erst 1990 aus dem Grundbuch der Stadt getilgt.
Im Dezember 1917 brach er von Moskau aus zu einer Konzertreise nach Schweden auf, kehrte aber nie in sein Heimatland zurück.

Als Rachmaninow 1940 in den Vereinigten Staaten auf Long Island lebte, war er bereits krank und schöpferisch ausgelaugt. Trotzdem hoffte er die frühere Partnerschaft mit dem Ballettmeister Michael Fokin (1880-1942) weiterführen zu können. Deshalb griff er auf eigenes Material, eine 1915 unvollendete Ballettmusik „Die Skythen„ zurück, um mit den Erfahrungen von 25 Jahren Kompositions-Handwerk aus den Entwürfen als sein letztes vollendetes Werk eine Bilanz seines Lebens zu schaffen.
Rachmaninows Erwartung, seine „Symphonischen Tänze“ auf der Ballettbühne erleben zu können, erfüllten sich wegen Fokins Versterben nicht.
Die Partitur des Opus 45 sieht eine außergewöhnlich große Orchesterbesetzung und als Besonderheit ein Altsaxophon vor. Dabei war weder eine Ballettmusik noch eine Symphonie entstanden. Die drei Sätze hatten ursprünglich die Bezeichnungen „Mittag“, „Abenddämmerung“ und „Mitternacht“.
Es wird berichtet, dass der Komponist selbst während der Proben zu einer Aufführung des Minneapolis Symphony Orchestra die Satzbezeichnung des „Non Allegro“ als Druckfehler definiert habe und das „Non“ ausstreichen ließ. Deshalb findet sich in den Konzertprogrammen die Satzbezeichnung häufig mit „(Non) Allegro“.
Matthias Pintscher ließ das Orchester das Werk keinesfalls tänzerisch spielen. Der erste Satz wies eher Anklänge an eine Marschmusik auf, während sich beim Hören des Andante con moto, des 2. Satzes, Bilder aufdrängten.
Im dritten Satz orientiert sich die Komposition fast ausschließlich auf den Gregorianischen Hymnus „Dies irae“, dem Tag des Zorns, gestaltet das „Lento assai“ wenn nicht das gesamte Werk zur Totenklage.
Matthias Pintscher baute mit der Sächsischen Staatskapelle eine faszinierende Spannung zwischen einer wilden Orgie, Bildern russischer Weiten und niederdrückender Todessehnsucht auf.

Irritierend am Konzert war das mäßige Interesse der Dresdner Musikfreunde an der Vorstellung des Capell Compositeurs der Sächsischen Staatskapelle. War das Konzert mit Werken unterschiedlicher Stilrichtungen doch eine Demonstration der Fülle der Möglichkeiten des Orchesters, seinen prachtvollen Klang und die exzellenten Leistungen seiner Solisten im Zusammenwirken mit dem Gastdirigenten Mattias Pintscher zu erleben.
Autor der Bilder: Sächsische Staatskapelle © Oliver Killig
Thomas Thielemann, 4.2.2022
DIE ANDERE FRAU
Uraufführung am 22. Januar2022
Die Semperoper bringt die Uraufführung der Kammeroper „Die andere Frau“ von Torsten Rasch und Helmut Krausser
Die Pandemie hat uns Opernbesuchern bereits manche Flexibilität abgefordert. Deshalb waren wir auch nicht sonderlich verwundert, als wir zur Erstaufführung der Kammeroper „Die andere Frau“ von Torsten Rasch gebeten wurden, auf die Bühne der Semperoper zu klettern.
Auf der Hinterbühne war eine Tribüne mit etwas über 300 Sitzplätzen errichtet, auf der gemäß der in Sachsen gültigen Pandemieregeln 85 Besucher mit der Blickrichtung zum leeren Zuschauerraum Platz nahmen.
Zwischen uns und dem im Graben warteten Orchester hatte der Bühnenbildner Arne Walter als Szene einen mit unzähligen verlorenen Fußbekleidungen bedeckten Fluchtweg, irgendwo zwischen Ägypten und dem „Gelobten Land“ Kanaan aufgebaut.
Das Parkett im Zuschauerraum war unbeleuchtet, während die Ränge mit von László Zsolt Bordes gestalteten Lichteffekten, die auf das Hervorragendste mit den Tücken der dreidimensionalen Flächenausleuchtung zurechtkamen, angeleuchtet waren.
Das Auftragswerk des Hauses hatte Torsten Rasch (*1965 in Dresden) gemeinsam mit dem Schriftsteller und Komponisten Helmut Krausser (*1964) aus der biblischen Dreiecksgeschichte von Abram, seiner Frau Sarai und der Sklavin-Leihmutter Hagar, einer Geschichte von Flucht, Vertreibung, Liebe und Hass, entwickelt:
Abram, mit dem vermeintlich-göttlichen Auftrag eine Dynastie zu begründen, war mit Sarai ins „gelobte Land“ Kanaan geflohen. Aber Sarai, nach dem Missbrauch durch ägyptische Männer sowie ob ihres fortgeschrittenen Alters unfruchtbar, konnte Abram den zur Dynastie-Gründung erforderlichen männlichen Nachkommen nicht schenken. Deshalb schlug sie Abram vor, mit der jungen Sklavin Hagar einen Nachkommen zu zeugen. Abram, stolz, ein Ausgewählter Gottes zu sein, zwang die Sklavin, sich ihm hinzugeben und seinen Nachkommen auszutragen. Hagars Schwangerschaft führte aber bei Sarai zu einer Eifersucht, die Hagar um ihr Leben fürchten lässt. Sie flieht in die Wüste, wird jedoch von einem Engel zur Rückkehr bewegt.
Sarai, in ihrer Stellung als Ehefrau bedroht, plant, die Nebenfrau Hagar, sobald ihre Aufgabe als Leihmutter und Amme von Abrams Erstgeborenen „Ismael“ erfüllt sei, weg zu jagen.

Drei Engel, als zufällige Gäste in Abrams Haus, verheißen Sarai eine baldige Schwangerschaft. In diesem Zusammenhang erfolgt erstmals die Erhöhung Abrams zum Abraham= Vater der Vielen [Völker]. Als Saras Schwangerschaft tatsächlich eintritt, fordert sie von Abraham, Hagar umzubringen.
Abram, nicht in der Lage, den Konflikt zwischen den beiden Frauen zu lösen, schenkt der Sklavin die Freiheit und schickt sie mit Ismael regelrecht in das Ungewisse. Hagar erkennt Abrahams feige Entscheidung und geht mit ihrem Sohn in die Wüste.
Von Abraham aber forderte Gott, dass er ihm den von Sarai geborenen Sohn Isaak opfern solle. Als Abraham dem Befehl folgen wollte, beendete Gott das grausame Spiel und machte beide Söhne Abrahams zu Gründungsfiguren zweier Weltreligionen: über die Nachfahren Isaaks definiert das Judentum Abraham zum Stammvater ihres Glaubens. Das Christentum reklamiert seinen Anteil an der biblischen Überlieferung, indem es im Neuen Testament den Stammbaum Jesu von Nazareth über Isaak auf Abraham zurückführt. Im Koran gilt der Sohn Hagars Ismael als der Gesandte Gottes, als Religionsstifter der Araber. Ein Stiefbruder-Verhältnis, das bis in unsere Zeit nachwirkt. Die Konkurrenz der beiden Frauen symbolisiert über ihre Söhne die Differenzen der Weltreligionen, obwohl alle drei Religionen in Abraham ihren gemeinsamen Ursprung sehen.

Das Libretto Helmut Kraussers legt für uns die menschlichen Verwerfungen hinter der biblischen Geschichte frei, indem er die Agierenden wie heutige Menschen denken lässt. Damit machen Torsten Rasch und Helmut Krausser das Unmenschliche der Geschichte erfahrbar, ohne ihren Sinn infrage zu stellen.
In der Musik Torsten Raschs begleiten Motive bestimmte Ereignisse und werden die Charaktere der Hauptfiguren betont. So wurden Abram und Sarai ständig wechselnde Taktarten, die dem Sprach-rhythmus folgen, zugeordnet. Sarais Wechsel zwischen Wut und Reue wird durch die Instrumentierung zum Ausdruck gebracht. Hagars Musik ist lyrischer, fließender, Streicher-betont und bestimmte so deren Gefühlswelt.

Die Musiker der Sächsischen Staatskapelle bewältigen mit der Musikalischen Leitung des Chefdirigenten der Oper Halle Michael Wendeberg die anspruchsvolle Partitur mit der gewohnten Präzision und Klangfülle.
Johannes Wulff-Woesten hatte sich am Rande des Bühnenaufbaus aufgebaut und sicherte von dort dank einer optischen Verbindung zum Graben die Einsätze auf der Szene.
Der Rhythmus, der Wechsel der Farben der Rang-Anstrahlungen war der Musik zugeordnet und ergänzten das akustische Erleben durch zusätzliche optische Eindrücke.
Die Inszenierung hatte Immo Karaman gemeinsam mit Teresa Reiber spannend, abwechslungsreich und minimalistisch gestaltet. Beklemmend schleppten sich mehrfach wechselnde Flüchtlingsgruppen über die Bühne. Die wenigen Requisiten wurden von den Vertriebenen mit auf den Schauplatz gebracht, abgelegt und, wenn nicht mehr benötigt, auch von einer folgenden Gruppe aufgenommen. So konnten sich die Agierenden auf ihr Singen und ihre Körpersprache konzentrieren.

Die durchaus zwielichtige Rolle des Abram (später: Abraham= Vater der Vielen [Völker]) hatte Marko Marquardt übernommen. Er repräsentierte zwar den Stammvater der Dynastie, hatte aber seine junge Frau ägyptischen Männern preisgegeben, um sein Leben zu retten. Auch zeugte sein Verhalten im Konflikt zwischen den Müttern seiner Söhne nicht unbedingt von Souveränität.
Von der Last einer religiösen Bedeutung befreit, war schon beklemmend, wie Abram mit der archaischen Sprache der Bibel über Sarais Kinderlosigkeit spricht und wie er Hagar mit der Brutalität der biblischen Zeit als Objekt behandelte. Dabei versteckt er sich bei Bedarf immer wieder, wenn auch etwas unsicher, hinter seinem vorgeblichen „göttlichen Auftrag“. Mit welcher Nonchalance er seine Nebenfrau Hagar und seinen Erstgeborenen mit „Alles ist gut. Alles ist gut“ in die Wüste entsorgte, dem Verderben preisgab, war schon bemerkenswert.
Markus Marquardt (*1960), seit der Saison 2000 dem Ensemble der Semperoper verbunden, setzte in der Inszenierung seinen reifen Bassbariton und seine darstellerischen Fähigkeiten für diese fordernde Charakterstudie auf das Erstaunlichste ein.
Für die Sarai (später: Sara= Erzmutter) war, nachdem bereits seit dem Frühjahr 2020 an der Inszenierung gearbeitet wurde, die polnisch-österreichische Sopranistin Magdalena Anna Hofmann erst recht spät nach Dresden gekommen. Mit perfektem Gesang und intensivem Spiel verstand sie es, die differente Gefühlswelt, die aufkommende Eifersucht und die emotionalen Mängel ihrer Bühnenfigur glaubhaft zu machen. Als die Nachricht von der Zerstörung von Sodom und Gomorra mit den Nöten der Neffen-Familie Lots ins Geschehen einfloss, unterdrückte sie jede Reaktion der Betroffenheit.
Auch die Mezzosopranistin Stephanie Atanasov (*1983 in Wien) ist erst spät in die Vorbereitungen der Uraufführung einbezogen worden. Stimmlich hervorragend, gestaltete sie eindrucksvoll die Entwicklung der Hagar von der unterwürfigen Sklavin zur Leihmutter und Abrams Geliebten. Ihre Darstellung der Wandlung Hagars nach der aufgrund einer Intervention eines Engels abgebrochenen Flucht zur selbstbewussten Beschützerin ihres Sohnes Ismael und Verteidigerin der eigenen Person, war schon bewegend.
Der Einsatz des Countertenors Philipp Mathmann, des aus Tirol stammenden Tenors Philipp Meraner und des aus Russland ins Junge Semperoper-Ensembles gekommenen Ilya Silchuk als die Gäste des Hause Abrams kann nur als Luxusbesetzungen dieser kleinen Szenen bezeichnet werden. Ob der mit ihrem grandiosen Gesang ausgesprochenen Verheißung einer baldigen Mutterschaft Saras, erschien aber die Körpersprache der auftretenden Engel etwas befremdlich.
Zu einer Besonderheit der Inszenierung wurden die aufwühlenden Auftritte der „Augenzeugin“ Sussan Deyhim. Die 1958 in Teheran geborene Sängerin, Komponistin und Performancekünstlerin sang aus der Mitte des leeren Parketts Texte der über viertausend Jahre alten sumerischen „Klagen über die Zerstörung der Stadt Ur“ in der Originalsprache und erreichte mit ihrer dunklen Stimme sowie einer Chor- und Hallunterstützung frappierende Wirkungen.

Die Statisterie und die von André Kellinghaus überragend sorgfältig vorbereiteten Chöre von Laiensängern des Sinfoniechores Dresden und des Extrachores der Semperoper, waren wesentlich am Gesamteindruck der Aufführung beteiligt.
Der recht klägliche Schluss-Applaus der fünfundachtzig Besucher im nahezu schalltoten Raum der Hinterbühne war nach der Dramatik des Erlebten eigentlich deplatziert. Die Bravo-Rufe waren von den Masken ohnehin verschluckt und zum „stehenden Applaus“ konnte sich gerade die Hälfte der Begeisterten aufraffen.
Auch wenn ich mich wiederhole: in der Entwicklungsrichtung dieser erlebten Aufführung sehe ich eine Zukunft für das von uns so geliebte Opernleben.
Thomas Thielemann / 22.01.22
© Bilder: Ludwig Olah
16. Januar 2022 Semperoper Dresden
Britten, Walton und Elgar im fünften Symphoniekonzert
Daniel Harding und Antoine Tamestit musizieren mit der Staatskapelle Dresden nach Beendigung der Corona-Schließung.
Nach dem Ableben von Henry Purcell (1659-1695) hatte England keine bemerkenswerte Komposition hervorgebracht, bis am 19. Juni 1899 Hans Richter (843-1916), damals Leiter des Hallé-Orchesters Manchester, in einem Konzert in der Londoner St. James´s Hall Edward Elgars „Variationen über ein eigenes Thema für Orchester op. 36“, denen man später den Beinamen „Enigma= Rätsel“ beifügte, uraufführte.

Der Musiker Edward Elgar (1857-1934) hatte als Autodidakt-Komponist neben seinem Tanzmusik-Broterwerb mit Kantaten und Oratorien zwar Achtungserfolge erzielt. Aber sein 1898 komponierte „Land of Hope and Glory“, inzwischen die heimliche Nationalhymne der Briten, war unbeachtet geblieben. Mit dem Erfolg „Enigma“ erreichte er nicht nur einen Erfolg, sondern letztlich seinen Durchbruch zum viktorianischen Nationalkomponisten.
Zur Entstehung der Komposition wurde berichtet, dass Elgar im Oktober 1898, heimgekehrt nach einem langen und ermüdenden Unterrichtstag, unterstützt von einer Zigarre, am Klavier ein Thema improvisierte, was ihm auf dem Heimweg eingefallen sei. Anerkennend fragte die spätere Lady Caroline Alice Elgar (1848—1920), „was das sei“. „Nichts“, kam als Antwort, „aber es könne etwas daraus werden“.

Elgar spielte einige weitere Variationen des Themas und fragte, „wer ist das?“ Worauf die Lady meinte, „so ungefähr verlasse WMB, (der Schwager und Gastwirt William Meath Baker), einen Raum.“
In der Folge entstanden Variationen des Thema-Zufalls, die Persönlichkeitsmerkmale einer eher ungleichen Gruppe enger oder zufälliger Bekannter erfassten.
Elgars Ehefrau, die Schriftstellerin, Sekretärin und Managerin ihres Gatten Caroline Alice „CAE“ erkannte die Bedeutung der Spielerei. Sie ermunterte Elgar, „das er etwas schaffe, was zuvor noch nie getan worden sei“. Was da so humorvoll begonnen war, wurde in der Folge mit tiefem Ernst zu einem geschlossenen Werk entwickelt.
Was sich eher dem Stile der Portraitierten, als deren Charakterisierung entsprach, wurde entsorgt. So wurden die Variationen zu den Komponisten Arthur Sullivan (1842-1900) und Charles Parry (1848-1918) nicht aufgenommen.
So blieben vierzehn Variationen des Themas, denen irgendwann die Initialen der Portraitierten vorangestellt worden sind. Für dreizehn der Charakterisierten gelten die Zuordnungen zu Personen als gesichert. Lediglich für die Variante XIII „Romanza“ hatte Elgar zwar die wohlhabende Aristokratin und Sponsorin Lady Mary Lygon ins Gespräch gebracht. Es wird aber vermutet, dass die Bezugsperson der Variation die Jugendliebe Elgars Helen Weaver sei, mit der er verlobt gewesen war. 1884 hatte sie ihn verlassen und bei Elgar eine bleibende Verletzung verursacht.
Offenbar wollte sich Elgar mit Johann Sebastian Bach messen, als er seine Enigma mit vierzehn Variationen, wie Bach die Kunst der Fuge mit vierzehn Fugen und die Goldberg-Variationen mit vierzehn Kanons, begrenzt ließ.
Die Lösung des eigentlichen Rätsels der „Enigma-Variationen“ hat der in Chiffren und Kryptogrammen verliebte Elgar mit ins Grab genommen: es „gehe durch und über die gesamte Komposition ein anderes und größeres Thema, das aber nicht gespielt werde“, so Elgar. Das Hauptthema erscheine nie, „der wichtigste Charakter trete nie auf“.

An dieser teuflischen Äußerung Elgars arbeiteten und arbeiten sich noch immer Musikwissenschaftler ab, liefern unzählige Deutungsversuche, ohne eine gültig-schlüssige Lösung zu bieten. Auch wenn findige Experten in der Sprachmelodie des Namens des Komponisten die Lösung gefunden glauben.
Diese Unklarheit hielt aber die Staatskapelle nicht ab, sich Elgars Variationen mit Freude zu widmen.
Daniel Harding leitete das Orchester als leidenschaftlicher Verfechter der Musik seines Heimatlandes mit Spontanität und ohne philosophische Grübeleien. Vom Beginn an präsentierte er das Thema mit exquisit geformten Streicherklängen, um dann in der Variation III-RBT mit den Bläsern voran zu stürmen. Mit subtilen Tempovariationen und gekonnten Balancen führte er die Musiker von einer Variation zur anderen. Dabei betonte Harding die Soli in den Variationen VI-Ysobel (Andantino) für eine Bratscherin sowie XII-BGN (Andante) für einen Cellisten und entwickelte leichtere, schöne, fast schüchterne Akzente in den Allegretto-Variationen VIII-WN-und X-Intermezzo-Dorabella. Dazwischen war der Adagio-Ohrwurm der Komposition (IX-Nimrod), einer Hommage Elgars an seinen engsten Freund August Johannes Jaeger, eingeordnet. Bei dieser mehrfach auch als Filmmusik eingesetzten Variation entging Harding dank eigener fantasievoller, prägnanter Akzente der Gefahr eines Verkitschens.
Nach den etwas hektischen Stimmungswechseln zwischen den dreizehn kurzen Variationen brachte das etwas längere Elgar-Selbstportrait (XIV-Finale: EDU) etwas Ruhe in die Darbietung, aber auch etwas Verhaltung in den Konzertschluss.

Begonnen hatte das Konzert mit Benjamin Brittens düsteren vier Meeresbildern „four Sea Interludes“, einer Suite der Bearbeitungen der Zwischenspiele der Oper „Peter Grimes“ von 1944. Dabei bilden die vier Sätze der Suite nicht nur die harte, raue Lebenswelt der Küste und des Meeres ab. Sie übernehmen auch das Grundthema der Oper: das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, die Akzeptanz abweichender Lebensweisen in der Gesellschaft.
Daniel Harding war bei seiner Auslegung der Britten-Komposition bemüht, die Stimmung der Konzertbesucher eher etwas aufzuhellen und griff jedes der Zwischenspiele mit besonderer Lebendigkeit an. Mit schönen Streicherpassagen zeichnete er regelrechte Postkartenmotive der britischen Küsten. Dabei vernachlässigte er keineswegs die vom Komponisten angestrebte Dramatik, als im „Sturm“ die beunruhigten Gedanken des Peter Grimes am Rande des Abgrunds abzugleiten drohen und ein packendes Finale bildeten.
Aber im Zentrum des Konzertes stand die Darbietung des Violakonzertes von William Walton (1902-1983) mit dem Solisten Antoine Tamestit.
Für viele Musikfreunde ist die Viola im Orchester für die Übergangsbereiche zwischen Violinen und Celli eingesetzt und hat vor allem in der Kammermusik ihre Bedeutung.
Wir sind deshalb regelrecht begeistert, dass uns Antoine Tamestit mit seiner wunderbaren Mahler Stradivari als Capell-Virtuos der Saison die Möglichkeiten und Schönheiten seines Instruments in einem breiteren Umfang vermitteln kann. Die 1672 in Cremona von der Werkstatt Antonio Stradivaris (um 1644-1737) gebaute Viola,, gehört zu den klangschönsten Instrumenten seiner Gattung und wurde 2008 von der Stiftung Habisreutingen dem Solisten zur Verfügung gestellt.
In dem vom Dezember 1928 bis zum Frühjahr 1929 entstandenen „Violakonzert“ sind bereits die neoromantischen Einflüsse in der modernen Tonsprache Waltons zu spüren. Im Jahre 1961 verdünnte der Komponist die Bläserbesetzung des Orchesterparts und fügte eine Harfe hinzu.
Antoine Tamestit spielte das Konzert in einer sympathischen Mischung aus Lyrischem, Kontrastierten und Dissonantem mit einer nahezu unwirklichen Fülle unterschiedlicher Stimmen. Es hatte den Anschein, als schwebe der Solist und sein Instrument über dem Orchester.
Neben dem vertrauten rauchigen Sound der Viola überraschte das Soloinstrument mit tonalen Höhenflügen und fast jazzigen Aspekten. Diese grandiosen Darbietungen unterstützte das Dirigat Daniel Hardings mit ungewöhnlichen Orchesterkombinationen, ohne dabei das Soloinstrument zuzudecken.
Der zweite Satz wirkte dabei dank des stärkeren Blechbläsereinsatzes besonders lebendig, während der Finalsatz eher nachdenklich zu einer in sich gekehrten Schluss-Stimmung geführt war.
Als faszinierende Zugabe spielte Antoine Tamestid mit der Harfenistin der Staatskapelle Johanna Schellenberger ein Stück nach einem Lied von John Dowland (1563-1626).
Mit diesem Programm hat die Sächsische Staatskapelle für den 21. Januar 2022 ein Gastkonzert in Wien geplant.
Der Mitschnitt des Konzertes wird am 18. Januar 2022 ab 20 Uhr 05 von MDR-Klassik und MDR-Kultur ausgestrahlt.
Thomas Thielemann, 17.^.22
© Markenfotografie
NORMA
Die Priesterin verlässt das Büro
Aufführung 23.10.21
Mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen will Norma ihre Schuld sühnen. Als Priesterin hat sie ihr Keuschheitsgelübde gebrochen und aus der illegalen Verbindung mit dem Römer Pollione zwei Kinder geboren. In Peter Konwitschnys Neuinszenierung von Bellinis Melodramma an der Semperoper ist sie in der Finalszene die Direktorin eines Konzerns im grauen Hosenanzug, ordnet ihren Schreibtisch und packt Akten, persönliche Dinge und einen Blumentopf in einen Pappkarton vom NORMA-Großmarkt, mit dem sie, Adalgisa an der Hand, die gläserne Halle verlässt. Einmal mehr sieht man hier eine Inszenierung, welche die Handlung in lächerlicher Manier profaniert. Das beginnt schon in der Eingangsszene im Hain der Druiden, wo zwischen mächtigen kahlen Baumstämmen gelbbezopfte Männer mit Stöcken gegeneinander kämpfen und dabei als eine tölpelhaft beschränkte Meute verzeichnet sind (Ausstattung: Johannes Leiacker). Ihr Oberhaupt Oroveso, den Liang Li mit körnigem, voluminösem Bass singt, ist gleichfalls zur lächerlichen Karikatur verkommen. Ein groteskes Erscheinungsbild gibt auch Norma ab, die mit ihren blonden Zöpfen wie aus Hänsel und Gretel ausgeborgt scheint. Für ihre Auftrittskavatine wird sie in einem Korb von oben herabgelassen – bei erleuchtetem Saal (ein sattsam strapaziertes Stilmittel des Regisseurs) lässt Yolanda Auyanet in ihrem für die Partie zu hellen Sopran Charakter und Gewicht vermissen. Die spanische Sopranistin verstört zudem mit einer schmerzend grellen Höhe und zeigt sich überfordert bei der Cabaletta mit deren Tessitura und virtuosem Anspruch. In den lyrischen Teilen der Titelfigur, ihren wehmütigen Erinnerungen an das Glück mit Pollione, ist der stimmliche Eindruck günstiger. Die Duette mit Adalgisa zählen zu den gelungenen Momenten der Aufführung am 23. 10. 2021, denn Stepanka Pucalkova ist eine Idealbesetzung mit ihrem kultivierten, jugendlichen Mezzo, der sich perfekt mit dem Sopran der Titelheldin verblendet. Normas Behausung fährt als niedriger Raum mit Sofa und Wickeltisch aus der Unterbühne herauf. Das erste Duett der beiden Frauen, „Ah! si, fa core“, wird szenisch illustriert vom Windeln der Babys, das zweite, „„Mira o Norma“, ist in der gläsernen Halle des Konzerns eine alberne Orgie, wenn die beiden Frauen sich betrinken und herum torkeln, im Überschwang der Gefühle auf dem Boden wälzen und den Kinderwagen hin und her rollen lassen.
Da auch Adalgisa blonde, im 2. Akt überraschend rote Zöpfe trägt, nimmt sich Pollione mit natürlichem Haar erstaunlich normal aus. Marcelo Puente bleibt ihm allerdings darstellerisch ein markantes Profil schuldig. Der argentinische Tenor imponiert mit metallisch glänzenden Spitzentönen. In der Mittellage klingt die Stimme mehrfach belegt und gequält. Mit Adalgisa muss er sich ein lächerliches Versteckspiel hinter Baumstämmen liefern, mit Norma die entscheidende Auseinandersetzung („In mia man“) als lapidare Konversation am Büroschreibtisch abhandeln. Auyanet bleibt in dieser zentralen Szene stimmlich harmlos, ihr Ton entbehrt der Bedrohlichkeit. Der Sächsische Staatsopernchor Dresden (Einstudierung: André Kellinghaus) kann dagegen als geklonte Masse mit gelben Haaren im „Guerra, guerra!“-Chor an der Rampe fulminant auftrumpfen. Die Besetzung komplettieren zuverlässig Roxana Incontrera als Clotilde und Jürgen Müller als Flavio. Gaetano d’Espinosa sorgt mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden für einen farbenreichen Orchesterklang. In der Sinfonia setzt er auf einen dramatisch-stürmischen Impetus, der gelegentlich sogar verhetzt wirkt, aber er legt auch Wert auf die langen elegischen Bögen, auf Bellinis „melodie lunghe“.
Bernd Hoppe, 27.10.21
Bilder weiter unten Premierenbesprechung
22. Oktober 2021
Don Carlo im dritten Anlauf
Vera Nemirova bringt ihre 2020 verhinderte Osterfestspiel-Inszenierung nach Dresden
Sieben Versionen hat Guiseppe Verdi von seinem „Don Carlo“ geschrieben. Zum Teil belanglose Änderungen begleiteten den die historischen Gegebenheiten sehr freie folgenden Roman von César Vichard de Saint-Réal seit 1673 und die daraus entstandene TextvorlageFriedrich Schillers von 1787, das dramatische Gedicht „Dom Karlos, Infant von Spanien“, bis zur in Dresden vorgestellten italienischen Fassung von 1884 mit einem Vorspiel von Manfred Trojan.
Wechselvoll ist aber auch die Geschichte der Inszenierung von Vera Nemirova: bereits im April 2019 erfolgten Bühnenproben der Entwürfe von Heike Scheele im Großen Festspielhaus in Salzburg, da die Inszenierung als Kernstück der Osterfestspiele 2020 unter der Musikalischen Leitung von Christian Thielemann vorgesehen war. Wurden die Festspiele ein Opfer der Corona-Pandemie, so sollte an der geplanten Übernahme der Inszenierung, allerdings mit dem Rollendebüt von Anna Netrebko als Elisabeth de Valois und der Musikalischen Leitung Thielemanns an der Semperoper festgehalten werden.

Folglich begannen im Frühjahr 2020 auch die Proben mit Anna. Als auch Corona-bedingt die Premiere am 23. Mai 2020 nicht stattfinden konnte, stellte der Komponist und Solorepetitor des Hauses Johannes Wulff-Woesten eine kammermusikalische Fassung von Höhepunkten der Oper zusammen und brachte diese im Juni 2020 mit Anna Netrebko, Elena Maximova, Yusif Eyvazov sowie Mitgliedern des Hausensembles mit großem Erfolg zur Aufführung.
In der Zeit des Probenbeginns des dritten Anlaufs war dann noch die Mutter und künstlerische Beraterin der Regisseurin, die Opernsängerin und Gesangspädagogin Sonja Nemirova (1942-2021), verstorben.
Da bereits de Saint-Réal und Schiller recht frei mit den historischen Gegebenheiten der Zeit um 1560 umgegangen sind, sei es der gebürtigen Bulgarin Nemirova nachgesehen, dass ihre Inszenierung mit dem Sujet von Joseph Méry und Camille du Locle nicht zimperlich verfährt, um ihr Anliegen den Dresdner Besuchern zu vermitteln.

In der aufgeführten Fassung der Oper fehlen bekanntlich die Szenen im Wald von Fontainebleau mit der ersten Inkognito-Begegnung des Don Carlo mit Elisabeth. An dessen Stelle erlebten wir die Uraufführung eines orchestralen Prologs von Manfred Trojan (*1949), der moderne Musik im Verdischen Sinne komponierte. In einem stilisierten „Wald von Fontainebleau“ treffen die Beiden als die 14-jährigen in einer Tanzszene aufeinander, verlieben sich und werden auseinandergerissen. Das bietet einen eigenständigen aber durchaus schlüssigen Auftakt des Abends.
Für die folgenden Abläufe hat Heike Scheele eine gewaltige und prachtvolle Bibliothek des Klosters von San Yuste, jenes Rückzugsorts des amtsmüden Karl V., gemäß der Zeit um 1560 entstehen lassen.
Der ob der Unregierbarkeit der Welt verzweifelte Kaiser war zwar 1558 verstorben, die Bibliothek blieb aber mit ihren 5200 Büchern als Zentrum der Hortung vom Wissen der Zeit ein Machtzentrum.
Die Handlung führte uns in die revolutionäre Zeit des Übergangs von den ausschließlichen Abschriften der Mönche zum im Vielfachen verfügbaren Gedruckten. Denn damit war nicht nur Wissen breiter verfügbar, sondern auch unerwünschtes, verbotenes Gedankengut zunehmend zugänglich.

Den Umgang der Mächtigen mit verbotenem und staatlich legitimiertem Wissen bis in unsere Tage machte Vera Nemirova zum Kernpunkt ihrer Inszenierung. Die Bibliothek blieb deshalb auch omnipräsent. Selbst als die Prinzessin Eboli die Hofdamen bespaßte, schaute die Bücherwand bedrohlich über die Abtrennung. Der zweite Akt war in die leergeräumte Bibliothek, allerdings vor den Bücherwänden, verortet.
Selbst der gefangene Carlo empfängt Posa vor allerdings leergeräumten Bücherregalen, aus denen heraus dann der Marquis Posa folgerichtig erschossen wird.
Zuvor ist aber noch das große Autodafé zu absolvieren: hier kippt die Inszenierung wieder in die Unsitte des Regietheaters, indem uns politisch Mitdenkenden begreiflich gemacht werden muss, dass bestimmte Entwicklungen nicht nur im 16. Jahrhundert, sondern auch in Zeitnähe ablaufen. Die Bühne verschiebt uns in die Zeit der dreißiger des letzten Jahrhunderts und wir erleben die Machtergreifung einer totalitären Bewegung, die in eine optisch sehenswerte Bücherverbrennung mündete. Prachtvoll inszeniert, aber wer benötigt diesen Nachhilfeunterricht.

Als Verbindung zum Folgenden war als Zwischenspiel eine zweite Komposition Manfred Trojans, „ Mendelssohns Möwen- ein Lied ohne Worte für Violoncello solo“, von Norbert Anger berührend gespielt und von den Tänzern Malwina Stepien sowie Briab Scalini angedeutet, dass da noch nichts entschieden ist.
In der Folge zerfasert die so kompakt begonnene Inszenierung und verliert Struktur.
Die Einbeziehung der Beziehungsgeschichte von Don Carlo und Elisabeth in die Handlung beschränkte sich folglich auf die Duette der Liebenden, die Intrigen bzw. die Läuterung der Prinzessin Eboli und die Auseinandersetzungen mit dem Großinquisitor. Die Umstände der gestohlenen Schmuck-Schatulle machen deutlich, dass nur noch die Geschichte einer zerrütteten Ehe erzählt wird, die im Finale für Elisabeth und Carlo in ein Happy End führt.
Zumindest deutet das der dritte Auftritt der beiden Tanzenden
Das rebellierende Volk überschwemmt nur kurz die Szene und verschwindet wieder. Sollte das eine Persiflage an die Wendedemonstrationen des Jahres 1989 sein?
Alles zeichnet sich durch eine hervorragende Personenführung aus, lebt aber letztlich vom Gesang.
Die Musiker der Staatskapelle sicherten mit dem Dirigenten Ivan Repušic die hohe musikalische Qualität des Abends. Der aus Kroatien stammende Musikalische Leiter hält eine phantastische Balance zwischen Kammerspiel und großer Oper. Von leidenschaftlichen Ausbrüchen bis zu leisen Passagen mit sprunghaftem Stimmungswechsel war alles dabei. Der weiche geschmeidige Klang des Orchesters beeindruckte im Besonderen in den Massenszenen des von André Kellinghaus blendend vorbebereiteten Chors, unterstützte aber ebenso einfühlsam die Gesangssolisten.
Für den Abend stand eine opulente Riege der Singenden und Spielenden zur Verfügung.
Die aserbaidschanische Sopranistin Dinara Alieva war für die Partie der Elisabetta di Valois nach Dresden gekommen, um mit souveränem Gesang und schauspielerischer Eleganz die Emotionen der zwischenmenschlichen Beziehungen beeindruckend darzustellen. Ihr tief getönter, voluminöser Sopran bot sowohl Durchschlagskraft in den Duetten als auch samtige Weichheit; alles im rechten Maß.
Eine grandiose Besetzung der Prinzessin Eboli war der Einsatz der Moskauerin Anna Smirnova. Ein ungewöhnlich heller und brillant timbrierter Mezzosopran, leichtgängig oder fähig zu frontaler Attacke, eisig kalkulierend aber auch ungepanzerte Wärme offenbarend, war zu bewundern.
Mit dem italienischem Tenor Riccardo Massi stand ein Darsteller mit einer relativ dunkel gefärbten in allen Lagen souverän geführten Stimme, der Gefühle ebenso wie Präsenz zeigen konnte.
Die Sängerdarsteller der beiden Männer, König Philipp und Marquis Posa, sorgten für echte Glanzpunkte der Aufführung: Vitalij Kowaljow ließ seine sonore Bassstimme mit fabelhaft zwingender Autorität und Durchsetzungsfähigkeit strömen, akzeptierte zugleich die Verletzlichkeit des Königs mit dem “Ella giammai m´amò“auf feinfühlige Weise. Als das Geschehen mit diplomatischem Geschick vorantreibender Marquis de Posa verfügte Andrei Bondarenko über den eleganten, kraftvollen Ton mit klaren Akzentuierungen und über die notwendige Würde. Sein Duett mit Riccardo Massi wird in Erinnerung bleiben.
Als weiterer Vertreter der politischen Klasse agierte Alexandros Stavrakakis in der Rolle des Großinquisitors. Mit seinem Bass schenkte er der massiven Figur mit schönem Legato und schwarzen Farben die notwendige Dämonisierung.
Mit der leider kleinen Partie des Pagen Tebaldo erfreuten wir uns an der aufstrebenden Haus-Sopranistin Mariya Taniguchi.
Fast Luxusbesetzungen waren auch der Graf von Lerma, dessen kleiner Part Joseph Dennis kaum Gelegenheit zur Präsentation seiner Möglichkeiten gab, der Mönch vom immer zuverlässigen Tilmann Rönnebeck und der Herold von Simon Esper.
Ebenso kam makellos die berückend schöne warnende Stimme der Ophelya Pogosyan „von oben“.
Beeindruckend auch der berührend und sauber intonierte Gesang der flandrischen Deputierten: Sebastian Wartig, Padraic Rowan, Mateusz Hoedt, Lawson Anderson, Rupert Grössinger und Martin-Jan Nijhof,
Als die junge Elisabetha gefielen die Tänzerin Malwina Stepien und als der junge Don Carlo der Tänzer Brian Scaldini.
Wir erlebten einen musikalisch opulenten Opernabend, der modern und schlüssig auch Probleme unserer Zeit auf die Opernbühne brachte, die gesungenen Texte nicht sonderlich achtete, aber ohne der Partitur Gewalt anzutun.
Bildrechte © Semperoper /Ludwig Olah
Thomas Thielemann 24.10.21
Norma in der Konzernzentrale
Peter Konwitschny inszenierte in Dresden
2. Oktober 2021
Im April 1831 wird am Pariser Odéon-Theater das Drama „Norma“ von Alexandre Soumet (1786-1845) mit großem Erfolg uraufgeführt. Vincenzo Bellini (1801-1835), der, ob seines Opernerfolgs am Teatro La Fenice in Venedig „I Capuleti e Montecchi“ den Auftragvon je einer Oper für die Mailänder Scalasowie das Venediger La Fenice für die Saison 1831/32erhalten und angenommen hatte, war bei der Stoffsuche auf die Tragödie aufmerksam geworden. Im Juli beauftragte er seinen Freund und den mit Rossini- und Donizetti-Opernlibretti bereits erfolgreichen Felice Romani (1788-1865) mit der Textbearbeitung für eine „tragedia lirica“.

Bereits Anfang Dezember begannen die Proben für die Erstaufführung sowie eine Anpassung der Partie der Titelheldin an die stimmlichen Möglichkeiten der Sängerin der Uraufführung Giuditta Pasta (1797-1865).Neun Varianten der Auftrittsarie soll Bellini der Pasta angeboten haben.Am 26. Dezember 1831 eröffnet die Scala die Saison mit Bellinis „Norma“.
Für uns heute schwer nachzuvollziehen, dass der „Workaholic" Bellini wenige Jahre später mit nur 34 Jahren an einer schweren Dysenterie versterben musste.
Romanis Libretto verortet uns in das römisch besetzte Gallien des ersten Jahrhunderts vor Christus. Die Oberpriesterin Norma, Tochter desobersten Druiden, unterhält seit Jahren eine verbrecherische Beziehung zum römischen Prokonsul Pollione, aus der bereits zwei Kinder entstanden sind, dieversteckt gehalten werden müssen. Als sich Pollione in die junge Novizin Adalgisa verliebte und mit ihr nach Rom gehen möchte, beschließt Norma, den Treuebruch zu rächen. Die Kinder vermag sie nicht zu töten und, obwohl die Jüngere sich zu einem Verzicht bereitfindet, erkennt sie, dass ihre Liebe beendet ist. Norma entscheidet sich zum gemeinsamen Feuertod mit Pollione.

Bellinis berauschende Musik verschafft der „Norma“ trotz des recht verquirlten Handlungsfadensimmer wieder einen respektablen Platz im zeitgemäßen Opernrepertoire. Der Regietheater-kritische Besucher wird deshalb den Erlebniswert des Opernabends an der Qualität des Musikalischen messen.
Das Musikalische des Premierenabends unter der Leitung des Komponisten und Dirigenten Gaetano d´Espinosa ließ kaum Wünsche offen. Der in Sizilien geborene war bereits seit seinem 21. Lebensjahr von 2001 bis 2008 mit der Sächsischen Staatskapelle u.a. als stellvertretender Konzertmeister der ersten Violinen verbunden. Im Winter 2019 dirigierte er erstmalig als Einspringer einen Opernabend in Dresden.
Mit den Musikern der Staatskapelle sorgte d´Espinisafür makellosen Bellini-Klang. Mit großen elegischen Bögen, farbenreich und transparent folgte er dem gefühlsdichten Drängen des Belcanto-Gesangs. Obwohl Bellinis Komposition vor allem den Sängern gehört, behielt d´Espinosa das Bühnengeschehen mit den Musikern der Sächsischen Staatskapelle fest im Blick.

Die Runde der Sänger-Darsteller eröffnete der Bassist des Hausensembles Alexandros Stavrakakis als Oroveso.Mit kräftiger, hervorragend timbrierter Stimme vermittelte der oberste Druide und Vater der Norma mit der Würde des Amtes die Verantwortung und leitete mit dem Chor die Bühnenhandlung ein.
Mit ihrem Hausdebüt konnte Yolanda Auyanet in der Partie der Norma mit Kraft und Intensität ihres Gesangs aufwarten, was der Darstellung der angesichts der Beleidigung und des Verrats des Vaters ihrer illegitimen Kinder tief getroffenen Frau beeindruckend diente. Beginnend mit dem langen Rezitativ vor der Einflug-Kavatine, des empfindsam gesungenen „Casta Diva“ über die wunderbaren Zwiesprachen mit Adalgisa bis zum beeindruckenden Terzett am Ende des ersten Aktes.
Die Ensemble-Mezzosopranistin Stepanka Pucalkova stand ihr in der Partie der Adalgisa mit dunkel timbrierter Stimme,zwischen erotischer Anziehung und selbstanklägerischen Gewissensbissenverzweifelt agierend, nicht nach. Auch das Duett im zweiten Akt gestalteten die beiden Sängerinnen mit beeindruckender Kraft und Intensität, ohne dabei den Schöngesang auszublenden.
Dem Pollione des ukrainischen Tenors Dmytro Popov nahm man in seinem Hausdebüt den Beziehungsfrustgegenüber Norma und die neue Leidenschaft zur Adalgisa unbedingt ab. Sehr vokalaffin, klar in den Höhen und mit leicht metallischem Klang überzeugt er mit feinen Nuancen. Im szenischen blieb er etwas steif, wenn er dem Macho und seiner Gewaltbereitschaft Ausdruck verleihen sollte. Letztlich schimmerte am Schluss eine gewisse Verletzlichkeit durch.
Mit ihrem klaren Sopran sang und spielte Roxana Incontrera eine starke, wache Clotilde, die sich als Vertraute Normas der illegitimen Kinder angenommen hatte. Die kleine Rolle des Pollione-Freundes Flavio ließ Jürgen Müller wenig Spielraumseine passable Stimme zu repräsentieren. Die Chor-Altistin Leonie Nowak hatte als Tempelwächterin= Bürohilfe einen schönen Auftritt.
Einem wesentlichen Anteil am musikalischen Erfolg des Abends sind den breiten von André Kellinghaus vorbereiteten Chorszenen mit ihrem ausdrucksstarken schönstimmigen Gesang zu verdanken.

Schwieriger war es, zumindest für mich, sich mit Peter Konwitschnys Inszenierung zu identifizieren.
Für den ersten Akt hatte er von Johannes Leiacker ein Bühnenbild im Stil der 1830-er Jahre mit den passenden Kostümen, oder so wie wir uns das heute vorstellen, gestalten lassen und führte uns in das keltische Druidentum des Galliens der vorchristlichen Zeit. Mit Konwitschnys Präzision wurden die parallel verlaufenden Handlungsfäden der politischen Auseinandersetzung zwischen den gallischen Stämmen mit den römischen Legionen und der tragischen Entwicklung Normas Liebe zum römischen Prokonsul Pollione seziert. Das war schon gekonnt, wie der Altmeister die Gegensätze von Kulturen vermittelte und dabei in keinem Moment Langeweile hat aufkommen lassen.
Mit dieser Schlüssigkeit wurde aber der erste Akt zum ersten Teil von Konwitschnys beabsichtigter Provokation.
Mit dem zweiten Aktverfiel die Inszenierung in das Prinzip des Regietheaters, dasuns Opernbesuchern nicht erlaubt, „für uns“ herauszufinden, was das als zeitlos propagierte Werk heute bedeuten könnte. Es ist fast beleidigend, dass uns Peter Konwitschny eigentlich nicht zutraut, gesellschaftliche Umbrüche, die wir selbst erlebt haben und noch erleben, mit Bellinis Musik in Einklang, oder eben nicht in Einklang, bringen zu können und deshalb einer Aktualisierung im Rahmen eines Besserwissens bedarf.
Das Großraum-Büro einer Konzernzentrale für den Chor und eine Verkehrsfläche mit einem Schreibtisch dienten, uns begreiflich zu machen, dass wir in der Gegenwart angekommen seien. Die Agierenden behalten zwar ihre Perücken aus dem ersten Akt. Sprich: Intellekt und Fühlen der Menschen habe sich auch in 2070Jahren eigentlich nicht entwickelt, aber ansonsten ist die Welt komplett verändert.
Was in der Konzernzentrale passiert hat folglich mit den eingeblendeten ohnehin absurden Texten des Librettisten Romanikaum Zusammenhang und ist letztlich nur wegen der gesangsfreundlichen italienischen Sprache zu akzeptieren.
Die Sängerdarsteller zeigten ihr phantastisches Singenmit unpassenden Bewegungen in einer dazu unpassenden Umgebung.
Beklemmend auch, wie Peter Konwitschny seine Mitmenschen, die nicht in einem Rampenlicht agieren, sieht, wenn er die Chormitglieder uniformiert und agitpropmäßig ihre wundervollen Gesangsszenen abliefern lässt.
Während im ersten Akt die Frauen, ob ihres Sehertums das Tempo der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung bestimmten, ist doch offenbar im Konzern lediglich eine Sauerei im Gange, von der die Frauen des mittleren Managements Kenntnishaben. Sei es eine Finanzmanipulation, eine Korruption oder die Anpassung von Abgasprüfvorschriften. In der Auseinandersetzung opfern die früheren Kontrahentinnen den Macho, sind aber letztlich gescheitert und verlassen resignierend die Szene.
Es wird kolportiert, dass Peter Konwitschny auch andere Schluss-Szenen geprobt habe, wobei Büroeinrichtungen einschließlich des Kinderwagens komplett geblieben seien und Norma mit Adalgisa triumphierend die Szene verlassen.
Die Inszenierung war zwar handwerklich hervorragend gemacht, blieb aber zumindest für mich unbefriedigend, da jene Mitbürger, die eine solche Vorstellung besuchen, dieser Art der Nachhilfe nicht mehr bedürfen.
Mit einem Buh, aber reichlichen, zum Teil stehenden Ovationen wurden die Schaffenden des Abends bedacht.
Seit wir 2019 im Rahmen der MÜPA in Budapest mit der halbszenisch benannten Aufführung von Richard Wagners Ring des Nibelungen eine intensive Aufführungsreihe erleben durften, die uns trotz unserer im Laufe der Jahrzehnte doch stattlichen Ring-Karriereneue Sichten auf das Werk brachte. Die Konzentration auf die Singenden und Musizierenden ermöglichtenein neues und tieferes Eindringen in Wagners Anliegen. Das hat bei uns die Vermutung entwickelt, dass für die Repertoire-Oper die konzertante bzw.halbszenische Form als akzeptable Alternative zum Regietheater anzubieten wäre und die Bühne zeitgemäßen Schöpfungen überlassen bleiben sollte. Erfolgreiche weitere Ansätze gibt es bereits.
Autor der Bilder: Ludwig Olah
Thomas Thielemann, 3.10.2021
4. Und 5. September 2021 Semperoper Dresden
Abschluss eines bemerkenswerten Beethoven-Zykluses
Die Sächsische Staatskapelle rundet ihren Zyklus der Beethoven-Symphonien im ersten Saisonkonzert 2021/22.
Die ersten Konzerterlebnisse mit dem Gewandhausorchester während meines ersten Studiums in Leipzig führten mich bereits mit den Beethoven-Symphonien, damals mit Franz Konwitschny (1901-1962) zusammen. Diese bis heute prägenden Erinnerungen werden auch von den Einspielungen der Beethoven-Kompositionen des Gewandhausorchesters mit Franz Konwitschny von 1959-1961 gestützt. Die Aufnahmen wurden in der als Studio genutzten Bethanien Kirche in Leipzig-Schleußig gemacht. Neben dem Rundfunkchor Leipzig sangen Ingeborg Wenglor, Ursula Zollenkopf, Theo Adam und Hans-Joachim Rotzsch.
Vergleiche ich die Hörerlebnisse von Beethovens „kleiner F-Dur-Symphonie Nr. 8 op. 93 der Franz-Konwitschny-Einspielung vom 23. August 1961 des Gewandhausorchesters mit dem Konzerterlebnis des Saisoneröffnungskonzertes 2021/22 der Sächsischen Staatskapelle mit dem Dirigat von Christin Thielemann so fällt natürlich die unterschiedliche Klangfärbung beider Orchester auf.

Das Gewandhausorchester, damals noch vom gelegentlichen Strassenbahngeräusch in der Ersatzspielstätte Kongresshalle gestählt, klang auf der Einspielung bestimmter, dunkler und kompakter als die Staatskapelle im Semperbau. Bei der Staatskapelle begeistern immer wieder der dunkelglänzende Klang des satten Streichersounds, die warmen Holzbläsertöne, der volle Blechbläserdunst und die tollen Pauken, eben der „Dresdner Klang“. Erstaunlich gleichen sich die guten Übereinstimmungen der Tempi der Dirigate von Franz Konwitschny und Christian Thielemann. Das ist umso wohltuender, weil doch in den vergangenen fünfzig Jahren jeder Beethoven-Interpret seinen Individualismus gerade an den Tempi ausleben musste, seit nachgewiesen scheint, dass die Metronom-Angaben des Komponisten auf einem Irrtum beruhen. Eine weitere Gemeinsamkeit war, dass mit peinlicher Gewissenhaftigkeit sämtliche Wiederholungen ausgeführt waren und man Orchesterstimmen zu hören bekam, die ansonsten im gesamten Klangbild untergehen.
Christian Thielemanns Annäherung an Beethoven war auch im letzten Konzert des Zyklus im besten Sinne die eines Dirigenten der alten Schule. Bei aller Spontanität begrenzte er Temporückungen auf Bereiche, wo diese auch angebracht waren. Bereits mit dem temperamentvollen ersten Satz wurde betont, dass es sich bei der Beethoven Achten durchaus nicht um die „kleine C-Dur-Symphonie“ handelt. Den zweiten Satz, allegro scherzando, dirigierte er betont langsam, vermied jede Härte und Schroffheit, so als ob er zum Tanz gesetzter Personen aufspiele.

Wunderbar weich und zart der Übergang zum dritten Satz, dem Menuett, so dass man das Fehlen eines langsamen Satzes in der Symphonie nicht vermissen musste. Mit dem vierten Satz führte Christian Thielemann das Orchester zu einem prunkvollen philharmonischen Finale. Prachtvoll wurden die harmonischen Anschlüsse und die Versetzung der Tonarten herausgearbeitet.
Beethovens neunte Symphonie ist eigentlich das Werk des musikalischen Kosmos, welches die Werte des Humanismus, der Freiheit und Brüderlichkeit prägnant verinnerlicht. Andererseits sind nur wenige Kompositionen für allerlei Zwecke missbraucht worden: von der Motivation japanischer Kamikazeflieger, der Europa-Hymne, der Begleitung fragwürdiger Veranstaltungen bis zur Manifestation einer bürgerlichen Kultur und Selbstbeweihräucherung Mächtiger oder sogenannter Kreativer.
Als Richard Wagner im März 1849, wenige Wochen vor Ausbruch der Barrikadenkämpfe in Dresden die Symphonie einstudierte, befand sich der russische Anarchist Michael Bakunin unter den Zuhörern der Generalprobe. Begeistert von der Interpretation trat er zum Schluss an das Podium und forderte, wenn beim nahen Weltenbrand alle Musik verloren gänge, solle jeder für den Erhalt dieser Musik sein Leben wagen.
Haben Franz Konwitschny bei der Einspielung seines Zyklus noch 73 Stimmen des Rundfunkchores für den Schlusschor gereicht, so sind im Laufe der Jahre für die Events der Jahreswechselkonzerte des Gewandhauses zuletzt 150 Sänger aufgeboten gewesen. Der Verein Sinfonietta Mainz e.V. hatte für eine Aufführung der Symphonie in der dortigen Christuskirche im Dezember 2019 sogar 200 Chorsänger herangezogen.
Christian Thielemann führte das Orchester mit dem unerbittlichen, etwas ruppigen Kopfsatz zunächst von den freudvolleren, angenehmeren Tönen weg. Die Streicher ließ er aggressiver, fahler daherkommen, während die Bläser streng im Zeitmaß gehalten wurden. Das war Abkehr von jedem Wohlklang und Hinweis, dass der Finalsatz der Symphonie erarbeitet, verdient werden möchte. Folglich bietet der konsequent disponierte erste Satz mit seinen geheimnisvollen Depressionen und Explosionen kaum einen Anklang des euphorischen Schlusssatzes sondern deutet eher den Beginn eines längeren Weges.
Mit den vielen rasanten Stimmen des Scherzos ließ der Chefdirigent sein Orchester, keck und nicht ohne Raffinessen, Anklänge einer wohlklingenden und temperamentvollen Entwicklung des Symphoniegeschehens, herausarbeiten. Mit dem dritten langsamen Satz schlug Christian Thielemann, nach einer ordentlichen Anlaufzeit, einen schier unendlich langen mit zahlreichen Details und Facetten sowie einigen Neuentdeckungen ausgestatteten Brückenbogen zum leuchtenden Finalsatz, den er, nach Art eines klassischen Kapellmeisters, mit einer ordentlichen Anlaufzeit eher bescheidener einleitete.

Das Solistenquartett dürfte in der gegenwärtigen Zeit seinesgleichen suchen. Hanna-Elisabeth Müller mit leuchtendem Sopran und phantastischem Durchsetzungsvermögen traf auf die ihr ebenbürtige Elisabeth Kulman. Diese Begegnung war uns eine besondere Freude, da Frau Kulman für das Jahresende auch den Abschluss ihrer Laufbahn angekündigt hat. Der Einsatz von Piotr Beczala war der pure Luxus und Georg Zeppenfeld war, wie eigentlich immer, einfach großartig.
Die von Andé Kellinghaus hervorragend vorbereiteten zweiundsiebzig Sängerinnen und Sänger des Sächsischen Staatsopernchores profitierten vom differenziert geführten Orchesterspiel.
Letztlich wurde ein beeindruckender, sich steigernder, aber nie überbordender Schluss-Satz der neunten Symphonie geboten, der Lebensphilosophie des Menschen Beethoven entsprochen haben dürfte.
Es war nahezu verwunderlich, zu welch frenetisch stehenden Ovationen das ausgedünnte Auditorium fähig war. Fast ging die Verabschiedung des langjährigen Solo-Bratschers der Kapelle Michael Neuhaus dabei unter.
Mit diesen Konzerten der Sächsischen Staatskapelle wurde ein Beethovenzyklus von seltener Geschlossenheit beendet, der in Erinnerung bleiben wird.
Thomas Thielemann 7.9.21
(c) Matthias Creutziger
Der erste Meisterkurs des Honorar-Professors Christian Thielemann
Studenten dirigieren die Sächsische Staatskapelle Dresden
Das Fehlen von Opern- und Konzertveranstaltungen sowie ein ausgedünnter Probenbetrieb ermöglichten dem kürzlich ernannten Honorarprofessor Christian Thielemann, zehn Studierende der Bachelor- oder Masterstudiengänge „Orchesterdirigierens“ der Dresdner Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in das größte der Musikzimmer der Semperopern-Bühne zu einem Meisterkurs einzuladen.

An der Hochschule werden die Eingeladenen von den Professoren Ekkehard Klemm, Steffen Leißner beziehungsweise Georg Christoph Sandmann umfassend auf ihren künftigen Beruf vorbereitet. Für den Meisterkurs hatten sich die Teilnehmer jeweils auf zwei Kompositionen der romantischen Konzertliteratur vorbereitet. Zur Auswahl standen neben der „Freischütz-Ouvertüre“ des Carl Maria von Weber sowie zwei Sätze der Zweiten Symphonie Robert Schumanns zur Auswahl.
In zwei Probendurchläufen konnten fünf der ausgewählten Studierenden ihre Fähigkeiten im Umgang mit der großbesetzten Sächsischen Staatskapelle unter Anleitung des Chefdirigenten schulen und vervollkommnen.
Christian Thielemann und Ekkehard Klemm verfolgten die intensive Arbeit der jungen Musiker zunächst vom Parkett aus, bis dann der Chefdirigent seine Kritik ausführlich vor Ort begründete: nicht mit beiden Händen die gleiche Bewegung machen; die linke für das Herauslocken besonderer Akzente nutzen.-Die besondere Verteilung der Bläser im hinteren Teil des größten Musikzimmers beachten, damit diese nicht zu spät kommen.- Und die Rolle der Stimmführer im Blick behalten.

Die Musiker folgten tatsächlich den Anweisungen der Nachwachs-Dirigenten, auch wenn es schwer fiel, mal nicht perfekt zu spielen. Von Musikern und vom Konzertmeister Matthias Wollong gab es Rückmeldungen: mal zu langsam, zu mulmig,- schauen Sie in die Partitur.- Da müssen Sie mehr rauskitzeln.
Aber es gab auch Lob, wenn eine schöne Synthese von Präzision und Stimmung im 3. Satz der Schumann-Symphonie gelang.
Begeisterung und Zufriedenheit mit dem Geleisteten bei allen Teilnehmern:
Die Offenheit, das Talent und die Ernsthaftigkeit der Dresdner Dirigierstudenten haben mich nachhaltig beeindruckt, so der Chefdirigent. Er freue sich sehr auf die weiter Zusammenarbeit.

Christian Thielemann sei super auf uns eingegangen, hat sofort helfende Hinweise gegeben. Seine Begeisterung und Energie sind ansteckend, meint Tim Fluch. Seine Komilitonin Katharina Dickopf fand den Meisterkurs sehr inspirierend. Sie habe gelernt, wie man durch kleinste Bewegungen einen intensiven Kontakt zu den Musikern herstellen und dadurch freier gestalten kann.
Für die Musiker der Staatskapelle war der Meisterkurs wieder einmal Gelegenheit, gemeinsam zu spielen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Autor der Bilder: Matthias Creutziger
Mozarts „Zauberflöte“ aus kindlicher Perspektive
Josef E. Köpplinger inszenierte unter gelockerten Bedingungen- erlebte aber eingeschränkte Premierenbedingungen
Premiere am 1.11.2020

Mit einer Presse-Aussendung hatte die Semperoper am 30. September 2020 mitgeteilt, dass in Anbetracht des begrenzten Corona-Infektionsgeschehens im Bundesland Sachsen ab dem November die in adaptierten Fassungen angebotenen Opern- und Ballettvorstellungen zwar unter Berücksichtigung geltender Hygiene-Maßnahmen, aber in nahezu voller Länge zur Aufführung kommen werden. Dazu sollten ein erweitertes Sitzplatzangebot, Pausen sowie die Öffnung des Garderobenservices und der gastronomischen Einrichtungen einen weiteren Schritt in Richtung einer Normalität erbringen. Den Auftakt dieser lang erwarteter Entwicklung könnte am 1. November die Premiere der Inszenierung Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ von Josef Ernst Köpplinger in der vollen Länge bieten. Nun hatte sich seit der ersten Oktober-Dekade das Infektionsgeschehen auch im Freistaat derart rasant entwickelt, dass inzwischen auch in Sachsen der „Wellenbrecher-Lock Down“ zu praktizieren ist. Damit wurde für die Premiere die Besucherzahl wieder mit 331 Personen begrenzt und die Aufführungsdauer von 180 auf 125 Minuten eingedampft. Auch erfolgte die Aufführung ohne Pause sowie ohne die sonstigen angekündigten Verbesserungen.

Es blieb zum Glück die Verortung der etwas mehr als dreißig Orchestermusiker der Staatskapelle mit dem musikalischen Leiter Omer Meir Wellber im Graben, so dass ein „normaler Klangeindruck“ gesichert blieb.
Wolfgang Amadeus Mozarts bekannteste Oper „Die Zauberflöte“ wird oft als eine Mischung von Opera Seria, Opera Buffa und Singspiel abqualifiziert. Tatsächlich hat der Librettist und Theaterpraktiker Emanuel Schikaneder (1751-1812) dem Komponisten mehr als eine grobe Mischung aus Zaubermärchen, Maschinentheater sowie volkstümlicher Komödie, die er mit den Mysterien der Freimaurer anreicherte, vorgegeben. Natürlich bat der Theaterdirektor Schikaneder das befreundete Musikgenie Mozart vor allem um die Komposition eines erfolgversprechenden Beitrags für die finanzielle Sanierung seines „Vorstadttheater auf der Wieden“. Da das Theater mit dem Singspiel „Oberon“ von Paul Wranitzki (1756-1808) bereits im Jahre 1790 großen Erfolg gehabt hatte, schlug Schikaneder dem Freund vor, den vergleichbaren Quellen, den Märchen der Sammlung des Christoph Martin Wieland (1733-1813) „Dschinnistan“ zu folgen. Ausgewählt wurde das Werk „Lulu oder Die Zauberflöte“ des Wieland-Schwiegersohns August Jacob Liebeskind (1758-1793). Verwoben wurde diese Vorlage mit Motiven der gleichfalls in der Sammlung enthaltenen Märchen von Friedrich Hildebrand von Einsiedel (1750-1828) „Das Labyrinth“ und „Die klugen Knaben“ sowie mit weiteren zeitgenössischen Werken unter anderem von Matthias Claudius (1740-1815).
Die Sammlungen sind vor allem in den 1780er Jahren in Weimar im Umfeld von Goethe und Herder, als Wieland von der Herzogin Anna Amalia als Erzieher ihrer Söhne nach Weimar berufen worden war, entstanden. Mit den literarischen Vorlagen waren der „Zauberflöte“ bereits sozialethische Grundsätze von Schönheit, Weisheit und Stärke vorgegeben. Als „Freimaurer“ kombinierten die Schöpfer des Werkes deren Gedanken der Einheit von Humanität, Liebe, Bildung und Pathos. Des Weiteren sind Anklänge der Bewegung des fiktiven Christian Rosencreutzer, der mit einer kontinuierlichen Reformierung von Wissenschaft, Ethik und Glaube der Entfremdung zwischen Wissenschaft und Christlicher Kultur vorbeugen wollte, in das Libretto eingeflossen. In den Text sind leider auch Aspekte von Frauenfeindlichkeit und Rassismus eingegangen.

In seiner Inszenierung übertrug Josef E. Köpplinger den Kindern, diese massiven Vorgaben mit ihrer Sicht auf die Entwicklung der Hauptfiguren zu reflektieren. Das sorgfältig vorbereitete Konzept konnte in der gekürzten Fassung nach meinem Empfinden vollständig umgesetzt werden. Der jugendliche Tamino gerät in die „Wildnis des Lebens, verstrickt sich, gerät in die Gefahren einer Schlange, der drei Damen der Königin der Nacht und wehrt sich.
Das Folgende geschieht in seiner Fantasie: auf der Bühne ist immer etwas los. Köpplinger gelingt dank seine Einfälle und der glänzenden Personenführung ein abwechslungsreiches Spektakel. Es wechseln Anleihen bei den Symbolisten mit mystischen Aspekten. Nicht alles ist neu, wäre auch bei der Fülle von Inszenierungen der Oper verwunderlich, ist aber immer gekonnt, unterhaltsam und logisch in das Bühnengeschehen eingebaut. Die schlüssige Entwicklung der Tamina vom aufmüpfigen Teenager zur Tamino-Gefährtin und des Tamino vom naiven, von der Königin manipulierten, Knaben zum Kandidaten der Sarastro-Nachfolge war schlüssig eingebunden. Logisch dass sich am Schluss das Paar nicht in die frauenfeindliche starre Männergesellschaft einbinden lässt und fröhlich in eine selbstgestaltete Zukunft abgeht. Ohne erhobenen Zeigefinger postuliert Köpplinger unsere modernen Auffassungen zum Verhältnis der menschlichen Gesellschaft zur Natur, schon weil diese Gedanken der Rosenkreuzer-Bewegung im Libretto Schikaneders angelegt sind.
Musiziert und gesungen wurde auf hohem und höchstem Niveau. Mit seiner musikalischen Leitung gelang es Omer Meir Wellber der Mozart-Komposition eine besondere Intensität abzugewinnen. Sein faszinierender Ansatz war kraftvoll und dynamisch, die Tempi ausgewogen, ohne in sterilen Perfektionismus zu verfallen. Sein hervorragend gutes Verhältnis zu der hervorragenden Musiker-Besetzung der Staatskapelle blieb deutlich spürbar. Auch standen Wellber überwiegend großartige Sängerinnen und Sänger zur Verfügung, die er auf das Vollkommenste einzubinden verstand. Allen voran, der in seiner Heimatstadt lange vermisste René Pape, der als der Sarastro unserer Tage gilt. Dem Sarastro, den er seit 1988 im Repertoire hat, gab er Kraft seiner wundervollen Bassstimme Prägnanz und milde Autorität, aber eben auch Statik.

Dieser über dreißigjähriger Rollenpraxis stand das Rollendebüt von Nikola Hillebrand in der dem Sarastro ambivalenten Rolle der Königin der Nacht. Die Gastsängerin vom Mannheimer Nationaltheater brillierte mit einem hell strahlenden Sopran und sicherer differenzierter Gestaltung der Partie, während das Paar Pamina und Tamino mit jugendlicher Frische aufwartete. Die 2015 aus Finnland ins Hausensemble gekommene Tuuli Takala kam, nach ihrem Berliner Ausflug als Königin der Nacht, mit der Pamina sowohl im Gesang, als auch der Darstellung mit ihrer Natürlichkeit als rebellierender Teenager und andererseits mit ergreifender menschlichen Tiefe hervorragend zurecht.
Dem Tamino hatte die Regie den größten Spannungsbogen der Entwicklung vom Knaben zum würdigen Beinah-Nachfolger des Sarasto zugeordnet. Der amerikanische im Hausensemble Tenor Joseph Dennis aus dem Hausensemble, eigentlich erst in der Zweitbesetzung als Tamino vorgesehen, überzeugte mit positiver rustikaler Ausstrahlung.
Das Buffo-Paar Papagena und Papageno war den Ensemblemitgliedern Katerina von Bennigsen und Sebastian Wartig anvertraut worden. Dem komödiantischen Talent der Sopranistin blieben nur die Szenen mit dem „alten Weib“ und das Pa-Pa-pa-Duett, während Sebastian Wartig seinem „Affen ordentlich Zucker“ geben konnte. Auch mit seinem Gesang wusste er zu begeistern.
Als besonders widerwärtiges Trio der Damen der Königin, aber mit hervorragender Gesangskultur, boten die Sopranistinnen des Ensembles Roxana Incontrera und Stepanka Pucalkova sowie die Mezzosopranistin Christa Mayer ihre Auftritte. Archaisch hingegen die Beiträge der Geharnischten von Jürgen Müller und Matthias Henneberg. Statisch wie von der Regie angelegt, kamen die Priester Mateusz Hoedt und Gerald Hupach mit beeindruckenden Stimmen über die Bühne. Dazu wirkte auch prachtvoll der auf vierundzwanzig Sänger ausgedünnte Chor. Von Simon Espers Monostatus-Texten waren nur Teile den Streichungen entgangen. Vollständig hingegen konnten die drei routinierten Knabensoprane vom Tölzer Knabenchor in die Handlung eingreifen.
Mit der begeistert aufgenommenen Inszenierung von Josef E Köpplinger erhält das nicht gering an den Erfordernissen der Besucher der Stadt orientiertem Repertoire der Semperoper eine prachtvolle Ergänzung. Dabei wäre zu überlegen, ob nicht auch, wenn die Corona-Einschränkungen abgeklungen sein sollten, die gestraffte Fassung des Premierenabends den Erfordernissen des geringer opern-affinen Teiles des Publikums besser entgegenkommt.
Bilder (c) Ludwig Olah
Thomas Thielemann 4.11.2020
Christian Thielemann dirigierte Beethovens sechste und siebte Symphonie
18. Und 19. Oktober 2020 Semperoper Dresden
Die Sächsische Staatskapelle setzt mit außergewöhnlichen Interpretationen den Beethoven-Zyklus fort
Mit dem 3. Symphoniekonzert setzte die Staatskapelle den Beethoven-Symphoniezyklus mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann planmäßig fort. Der Unterschied zum ursprünglich im Saison-Heft ausgedruckten Programm war, dass vor aufgelockertem Publikum die 6. und die 7. Symphonie ohne Pause gespielt wurden. Die Streicher saßen wieder paarweise vor gemeinsamen Pulten, wenn auch etwas auf Abstand. Dass die Bläser mit größerer Distanz angeordnet und mit Glastrennwänden abgeteilt waren, hatte kaum Einfluss auf das wieder kompakte Klangbild.

Ludwig van Beethoven gesellte die idyllische F-Dur-Symphonie im Juni des gleichen Jahres 1808 zur dramatischen Kampfsymphonie c-Moll, der Fünften. Während er an dieser Schicksals-Komposition seit 1804, offenbar mehrfach unterbrochen und ständig nach Neuem suchend, gearbeitet hatte, gilt die innerhalb eines reichlichen Jahres entstandene „Sechste“ als zügig entstandene Arbeit.
Es wird vermutet, dass sich Beethoven bereits 1803 von einem „Tongemälde der Natur“ des Biberacher Organisten Justin Heinrich Knecht (1752-1817) hat anregen lassen, eine „Sinfonia pastorella“ zu schreiben. Das Projekt aber erst 1807 in Angriff nahm.
Beethoven hat den fünf Sätzen, den Inhalt kennzeichnende Satzüberschriften in deutscher Sprache zugeordnet und mit dem Titel „Sinfonia pastorale“, Hirtensinfonie, versehen. Zugleich warnte er vor pedantischer Ausdeutung: „Man überlasse dem Zuhörer, die Situationen auszufinden. Sinfonia caracteristica oder eine Erinnerung an das Landleben.“ Und weiter:“ Auch ohne Beschreibung wird man das Ganze, eher als Empfindung und weniger als Tongemälde, erkennen“.

Beethovens F-Dur-Symphonie op. 68 gehört zu den Kompositionen, bei deren Aufführung zur Deutung der Interpretation eigentlich eine Stopp-Uhr gehört. Liegen doch die Längen der bekannten Aufzeichnungen nach meinem Überblick zwischen Karajans 37 Minuten und Christian Thielemanns 50 Minuten. Herbert von Karajan interpretierte die Beethoven-Komposition als eine vom Anfang bis zum Ende recht forsche Wanderung in einer grandiosen Landschaft. Die Aufführungen der Staatskapelle Dresden erinnerten mich eher an den genussvollen Besuch einer Galerie mit prachtvollen großflächigen Landschaftsgemälden. Da sind keine naturalistischen oder folkloristischen Abbildungen der freien Natur auszumachen. Der Dirigent nutzte das Orchester, um über die Tonmalerei zum Ausdruck der Empfindungen zu kommen. Da war im zweiten Satz kein Murmeln oder Rauschen eines Baches zu hören. Selbst „Gewitter und Sturm“ des vierten Satzes finden außerhalb statt und man vermutet, dass man lediglich vergessen hat, vor dem Unwetter die Fenster zu schließen. Christian Thielemann bot das im Laufe der Jahrzehnte oft gehörte Werk völlig unangestrengt als eine filigrane Palette tiefster Musikalität. Präzise, in freier Einfachheit schwebten die Töne mit selten gehörter Intensität. Fast melancholisch erzählen die Soloklarinette von Wolfram Große, die Solo-Oboe von Céline Moinet, des Fagotts von Thomas Eberhartd und vor allem Sabine Kittels Flöte von der Schönheit der Landschaftsbilder.

Dazu die wunderbaren Hörner der Staatskapelle, deren Wirkung die Hörer angriffen. Sehr emotional, bemüht Christian Thielemann kaum den strukturell denkenden Analytiker, sondern erweist sich als Meister raffiniert angelegter Steigerungen. Mit besonders breit ausgespielten Passagen und theatralisch gesetzten Pausen wich er vom Gewohnten ab. Da roch nichts nach freier Natur, sondern eher nach dem Bericht eines Wanderers in froher Runde beim Wein über das Erlebte.
Auf das Titelblatt des Autographs der siebten Symphonie hatte Beethoven „Sinfonia 1812, 13ten May“ geschrieben. Das vermerkte zwar das Datum der Partiturniederschrift, war aber im tieferen Sinne mehr. Ist doch die Symphonie der künstlerische Beitrag des Patrioten Beethoven zur nationalen Volkserhebung der Befreiungskriege sowie der Niederlagen Napoleons, die 1812 mit dem Brand von Moskau ihren Anfang nahmen. Mit seiner Siebten hat Beethoven den Sieg der unterdrückten Völker über Napoleon regelrecht voraus gesehen.

Mehr noch: er sah den Sieg alles dessen, um das die Völker zum Erlangen ihres Glücks und Wohlstandes kämpfen, in einer verallgemeinerten, zeitüberhöhenden und künstlerischen Gestalt mit der A-Dur-Symphonie als kühne Vision.
Die thematische Anlage der siebten Symphonie Beethovens hat eine deutlich geringere emotionale Interpretation Christian Thielemann zur Folge, indem er den Eröffnungssatz brachial-leidenschaftlich vom ersten bis zum letzten Takt hochspannend dirigierte, um das Allegretto umso inniger anzuschließen. Mit klanglicher Opulenz, epischer Breite und technischer Brillanz wurde der Satz zu einem Nachweis der Qualität des Orchesters. Mit dem kontrastierend-rasend gespielten „Presto“ gelang es, an die Ereignisse der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. Bis zum 19. Oktober 1813, also vor exakt 207 Jahren, anzuknüpfen. Folglich war auch nichts vom oft zitierten „Tänzerischen“ auszumachen.
Der Schluss-Satz gestaltete sich noch einmal zum Kraftakt für den Dirigenten und eine Reihe der Musiker, allen voran „unseren Pauker“ Thomas Käppler, so dass man in diese Orgie der Rhythmen und der Lebensfreude zwangsläufig hineingezogen wurde.

Die Ovationen waren für das ausgedünnte Publikum in beiden Konzerten heftig und herzlich, aber nicht überschäumend. Nur eine begrenzte Besucherzahl gab stehenden Beifall. Eventuell waren die konzentriert Hörenden aber doch etwas erschöpft.
Autor der Bilder: Matthias Creutziger
26. September 2020 Semperoper Dresden
Butterfly-Essenz-Premiere in der Semperoper
Die Plätze im Mittelbereich der siebten Reihe der Semperoper in einer „Butterfly-Premiere“ sind eigentlich ein Traum. Kaum Direktschall des Orchesterklangs aus dem Graben, dafür die volle Reflexdröhnung von der Decke, gemischt mit den feinzilesierten Brechungen von den Rängen, geben eine vollkommene Basis für den horizontal einströmenden Gesang von der Bühne.
Die Corona-Umstände verweigerten uns allerdings das Bühnenbild des Japaner Keno Tamara und des Polen Boris Kullick, sowie die Inszenierung des japanischen Regisseurs Amen Miyamoto mit dem angekündigten ost-westlichen Blick auf die tragische Liebesgeschichte zwischen der Japanerin Cio-Cio-San und dem Amerikaner Pinkerton.

Für die konzertante Aufführung der musikalischen Höhepunkte des Puccini-Werkes hatte die volle Graben-Musikerbesetzung auf der Bühne Platz genommen und versorgte das Parkett-Publikum mit der vollen Intensität einer hervorragend musizierenden Staatskapelle. Der musikalische Leiter des Abends Giampaolo Bisanti dirigierte mit Körpereinsatz und Leidenschaft, die man von einem italienischen Puccini-Spezialisten erwartete. Puccinis farbenreiche Komposition erklang mit Klarheit und phantastischer Prägnanz.
Für die Gesangs-Solisten war es schwierig, sich im Rampenbereich gegen den oft recht heftigen Orchesterklang zu behaupten. Die Armenierin Hrachuhi Bassénz als Cio-Cio-San, die Moskauerin Anna Kundriashova als Kate Pinkerton, der Grieche Alexandros Stavrakakis als Onkel Bonzo und der Amerikaner Aaron Pegram als Goro hatten, wegen der im April ausgefallenen Premiere, ihre Rollen-Debüts erst im September am besuchten Abend.
Musikalisch war an diesem Abend Belcanto vom Feinsten zu erleben. Hrachuhi Basénz begeisterte als Butterfly mit großen dramatischen Bögen, exzellenter Pianokultur und souveränem Forte. Ihr immer sauber geführter, gut gestützter Sopran kippte auch bei den dramatischen Erkenntnissen des Scheiterns nicht ins Schrille. Eher hatte man den Eindruck, dass ihrer Figur vom Beginn an bewusst war, dass das Geschehen nicht gut gehen kann. Am Schluss erhält sie mehr Bewunderung als Anteilnahme.

Der warme Mezzo der erfahrenen Christa Mayers als die besorgte Suzuki harmonierte auf das Wunderbarste mit der Stimme der Titelheldin. Mit der gewohnten Souveränität erfüllte sie ihre Aufgabe ohne Fehl und Tadel.
Der einzige Gastsänger des Abends war Jonathan Tetelmann. Er ist in Chile geboren, in den USA aufgewachsen und ausgebildet. Mit seinem bemerkenswert glasklaren Tenor sang er mit mühelosen Höhen den nicht unbedingt sympathischen Pinkerton.
Alexandro Stavrakakis sang aus der Proszeniumsloge heraus den Onkel Bonze. Mit seinem kraftvollen Bass verfluchte er Cio-Cio-San wegen ihres Konfessionswechsels auf das eindrucksvollste. Gut gefielen der quirlige Goro von Aaron Pegram und der amerikanische Konsul von Christoph Pohl mit Stimme und Auftreten. Etwas blass hingegen erwies sich Anna Kudriashova-Stepanets vom jungen Ensemble des Hauses. War es ihre Nervosität oder war ihre Aufgabe so angelegt, dass sie unmotiviert von der Bühne verschwand und dann so zurückhaltend agierte, dass man ihr nicht abnahm, wie sie einer Mutter den Sohn entziehen konnte.
Die als Butterfly-Freundinnen agierenden sechs Damen des Staatsopernchores behaupteten sich mit ihrem wunderbaren Gesang gegenüber dem mächtigen Orchestersturm.

Nun kann ich bezüglich des unausgewogenen Klangbildes nur für den von mir bevorzugten vorderen und mittleren Parkettbereich sprechen. Aber bei der zurückhaltender eingerichteten Don-Carlo-Einrichtung von Johannes Wulff-Woesten war auch für diesen Bereich voller Operngenuss möglich gewesen. Wie sich die Orchester-Sänger-Konstellation in den höheren Rängen anhörte, kann ich leider nicht beurteilen. Aber dort habe ich bei früheren Opernaufführungen im Semperbau den Klangbrei beklagen müssen.
Bilder (c) Klaus Gigga
Thomas Thielemann, 27.9.2020
Sir András Schiff bietet beeindruckendes Rezital
Der Capell-Virtuos der Saison stellt sich dem Publikum der Staatskapelle Dresden vor
Der Capell-Virtuos der Sächsischen Staatskapelle der Saison 2020/21 Sir András Schiff ist nicht nur einer der herausragenden Pianisten unserer Zeit, sondern auch ein streitbarer Mann. Nicht nur, dass der 1953 in Budapest geborene und inzwischen vorwiegend in Italien lebende Künstler, im Jahre 2000 seine Teilnahme an der Feldkircher Schubertiade wegen der Beteiligung der FPÖ an der öster-reichischen Bundesregierung absagte und in Ungarn wegen der Politik Viktor Orbáns nicht mehr kon-zertiert. András Schiff formuliert seine Meinung deutlich und pointiert, sowohl im politischen als auch im künstlerischen Kontext. Er kann darüber hinaus durchaus Konzertbesucher-Gruppen „die Beurteilungskompetenz“ absprechen, sich mit Musikerkollegen anlegen, das Regietheater verteufeln und die besondere Eignung der doch allgemein anerkannten Flügel des Marktführers „Steinway & Sons“ für eine Wiedergabe der Musik Franz Schuberts in Frage stellen. Nach Schiffs Auffassung, rep-räsentieren die Flügel des Wiener Instrumentenbauers Bösendorfer des weicheren melancholische-ren Tonbildes wegen, die zentraleuropäischen Musiktraditionen am deutlichsten.

Aus diesem Grunde musiziert Schiff trotz des logistischen Aufwandes auf seinen Konzertreisen mit seinem „Bösendorfer Konzertflügel Modell 280VC Vienna Concert“.
András Schiff ist ein begeisterter Kammermusiker, obwohl er auch als Dirigent und Konzertsolist wirkt. Er selbst bezeichnete sich als „Stänker der Gründlichkeit“.
Sein Rezital eröffnete András Schiff mit einer kurzen Erinnerung an seinen langjährigen Freund Peter Schreier und ehrte den im vergangenen Jahr Verstorbenen mit Johann Sebastian Bachs „Capriccio über die Abreise des sehr geschätzten Bruders“ B-Dur (BWV 992).
Das ausgeschriebene Programm begann mit der g-Moll-Klaviersonate Hoboken-Verzeichnis XVI:44 von Joseph Haydn (1732-1809). Diese Sonate entstand vermutlich zwischen 1768 und 1773, als Haydn Erster Kapellmeister der ungarischen Magnaten Familie Esterhazy war. Die Musikkenner-Fürsten Paul Anton und später vor allem Nikolaus I. gaben dem Mittdreißiger Raum für seine künstle-rische Entwicklung unter anderem durch ständigen Zugang zum eigenen kleinen Orchester, sowie ausführliche Gespräche über die Hauskonzerte. Die zweisätzige Sonate gehört zu den ersten Klavier-werken, die Haydn nicht mehr als etwas anspruchslose „Divertimenti“ einordnete.
Bereits mit dem Moderato-Kopfsatz beeindruckte Schiff durch die zurückhaltende Trauer, die Melan-cholie und die feinen melodischen Linien seines Spiels. Im Allegretto bestätigt er die Haydnische Vor-liebe für harmonische Überraschungen und nutzt die Vorgaben des Komponisten, diese mit Humor zu intonieren.
Im Mittelteil seines Dresdner Rezitals stellte der Capell-Virtuos den Werken des Lehrers Haydn eine Komposition seines Schülers Ludwig van Beethovens (1770-1827), die Klaviersonate Nr. 21 C-Dur op. 53 -Waldstein-, gegenüber.

Mit der Entwicklung neuer Techniken hatte Beethoven mit seiner 1804 dem Grafen Waldstein gewidmeten Sonate eine Wende in der Entwicklung der Klaviermusik eingelei-tet und ein neues Verständnis geschaffen, was Klavierspiel letztlich leisten kann. Entstanden ist die heute gültige Fassung der Sonate nicht in einem einzigen Zug. Beethoven nahm mehrfach Änderun-gen vor. So hat er den ursprünglichen Mittelsatz, der vermutlich von Josephine Brunswick inspiriert gewesen war, als selbstständiges „Andante favori“ ausgegliedert und durch das recht kurze „Introdu-zione, Adagio molto“ ersetzt.
Begeisternd meistert der Pianist die schwierigen Orchestereffekte mit seiner unwahrscheinlichen Virtuosität. András Schiff beeindruckte mit seinem glasklaren, an Varianten reichem Anschlag und nahm sich genau die Zeit, um den Akkorden die Möglichkeit zur Nachwirkung zu geben. Da wurden Nebenstimmen und Schattierungen hörbar, die ansonsten, insbesondere in den Ecksätzen, oft unter-gehen. Jede Note schien deutlich markiert und die Relationen der Ecksätze zum Mittelsatz stimmten an jeder Stelle.
Mit Franz Schuberts Klaviersonate G-Dur, D 894 konnte der Capell-Virtuos die Besonderheiten seines Bösendorfer Konzertflügels im letzten Teil des Rezitals nachdrücklich zur Geltung bringen.

Obwohl die musikwissenschaftliche Forschung im Lied-Schaffen Schuberts bedeutsamsten Beitrag zur europäischen Musikgeschichte sieht, hat er doch in seinem kurzen Leben Außerordentliches in allen musikalischen Gattungen seiner Zeit komponiert. Die Sonate in G-Dur, die oft als „Fantasie“ benannt wird, hat Franz Schubert (1797-1828) im Jahre 1826 im Alter von 29 Jahren als sein perfektestes Kla-vierwerk fertig gestellt, auch wenn sie im Kammermusik-Betrieb oft im Schatten seiner letzten drei Klaviersonaten D958 bis 960 steht.
Mit seiner Klarheit und Transparenz des Spiels, dem kaum spürbaren Wechsel der Stimmungen bot uns Schiff ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Mit dem Schubert-adäquaten warmen Klang des Bö-sendorfers konnte Schiff eine erstaunliche Klangfarbenvielfalt und fast unwirkliche Differenzierungen im oberen Pianissimo-Bereich der Komposition Schuberts schaffen.
Mit stehenden Ovationen wurde der Sir András Schiff vom etwas ausgedünnten Publikum begeistert gefeiert. Der Pianist bedankte sich bei den Besuchern mit zwei Zugaben.
Thomas Thielemann 15.9.2020
Bilder (c) Matthias Creutziger
Das Mahler- Jugendorchester fordert sein Publikum mit Othmar Schoeck und Franz Schubert
Ungeachtet der erheblichen Einschränkungen des Kulturlebens, wurde die Dresdner Gepflogenheit, die Saison im Semper-Bau mit dem Gustav Mahler Jugendorchester zu eröffnen, auch für 2020/21 beibehalten. Begreiflicherweise waren erhebliche Programm- und Besetzungsänderungen erforderlich, um trotzdem ein niveauvolles Konzert zu bieten. In erster Linie waren die Kooperationsbeziehungen zur sächsischen Staatskapelle mit dem Einsatz von 26 Kapellmitgliedern und Akademisten zu konkretisierten. Auch gelang es, für die Begleitung der Darbietung von Othmar Schoecks Liederfolge „Elegie“, den durch frühere Zusammenarbeit dem Jugendorchester den verbundenen Bariton Christian Gerhaher zu gewinnen.
Der Schweizer Komponist und Dirigent Othmar Schoeck (1886-1857) ist unter anderem bei Max Reger in Leipzig ausgebildet worden. In Dresden brachte er seine wichtigsten Bühnenwerke „Penthesilea“ 1927 und „Massimilla Doni“ 1937 zur Uraufführung.

Schoeck wird vor allem als einer der bedeutendsten Liedkomponisten des 20. Jahrhunderts geschätzt. Sein 1923 geschaffenes Opus 36 „Elegie“ entstand in einer Zeit seines tiefen Liebeskummers zunächst mit Texten von Nikolaus Lenau (1802-1850). Den düsteren Lenau-Liedern fügte er später Kompositionen nach Gedichten von Joseph von Eichendorf (1788-1857) zu, um den Zyklus etwas „aufzuhellen“. Mit der Naturverbundenheit und Melancholie fühlte sich der Komponist auf das innigste verbunden. Mit der durchdachten Instrumentierung und dem Einsatz der Stimme erzeugt Schoeck beim Publikum bewegende Stimmungen, vorausgesetzt die Zuhörer lassen sich auf das Fehlen spektakulärer Momente ein. Schoeck zwingt den Sänger geradezu zur Bescheidenheit und fordert vom Auditorium einen gewissen intellektuellen Einsatz, so dass sich die „Elegie“ den meisten Konzertbesuchern bei der ersten Begegnung wohl kaum erschlossen hat. Deshalb fand ich die Wahl des fast einstündigen Werkes für ein Jugendorchester-Konzertes etwas gewagt.
So einfühlsam, fantasieintensiv und zugleich energievoll wie von Christian Gerhaher, hört man die Lieder selten. Mit betont heller Stimmführung vermied er das Deklamierende und sang nuancenreich und fantasievoll.

Die begrenzte Orchesterbegleitung, Flöte, Englischhorn, zwei Klarinetten, Horn, Schlagzeug, Klavier und Streicher, erlaubte ihm, die Melancholie der Komposition voll zur Geltung zu bringen. Das Verträumte, die Innenschau und ruhige Trauer liegt Gerhaher, wobei er durchaus auch dramatisch mit strahlender Stimme auffahren kann. Obwohl die Gedichte von Lenau und Eichendorf nicht unmittelbar zusammenhängen, gelang es dem Dirigenten Duncan Ward mit dem Kammerensemble, eine wirklich konkrete Abfolge der psychischen Zustände des Erzählenden zu schaffen.
Sanft, mit Eichendorfs „Wehmut“ eröffnet, folgt Nikolaus Lenaus deprimierender „Liebesfrühling“. Mit „Stille Sicherheit“ und „Frage nicht“ taucht mehrfach auf, warum die Liebe zerbrochen sei. Dazu treten mit „Warnung und Wunsch“ Gedanken auf ein mögliches Handeln zum Retten der Beziehung auf, flackern mit Lenaus „Waldgang“ und „An den Wind“ Hoffnungen. Ein ständiger Wechsel zwischen Rückbesinnungen, Niedergeschlagenheiten, angedachten Aktivitäten und Hoffnungen bis sich der Protagonist sich im „Der Einsame“ (nach Eichendorfs „Der Einsiedler) in sein Schicksal fügt.

Der britische Dirigent Duncan Ward (geboren 1989) wollte ursprünglich sein Debüt bei der Staatskapelle im März diesen Jahres geben. Nun konnte er den Dresdnern zeigen, wie exponiert und brillant er mit einem reduzierten Orchester prachtvolle Wirkungen erreichen kann.
Auch mit Schuberts 5. Symphonie bot Ward im zweiten Konzert-Teil feine Nuancen und Transparenz. Franz Schubert (1797-1828) komponierte die D-Dur-Symphonie im Herbst des Jahres 1816, nach dem etwas missglückten Versuch, sich mit einer c-Moll-Symphonie Beethoven zu nähern. Der 19-jährige Schubert begriff offenbar selbst, dass er mit seiner Vierten statt einer tragischen, eine pathetische Komposition geschaffen hatte. Mit seiner Fünften schuf er mit einem ganz eigenen Tonfall und ihrer unbeschwerten Melodik sein bekanntestes kleines Orchesterwerk. Jugendliche Unbekümmertheit kombiniert mit künstlerischer Reife lassen das Werk gleichberechtigt zwischen Mozart, Haydn und Mendelssohn stehen. Duncan Ward gewinnt mit der sparsamen Orchesterbesetzung einen beeindruckenden Klangreichtum, bewegliche Transparenz sowie feine Nuancen und gibt damit dieser Musik ihre Jugendlichkeit zurück. Besonders gefiel, wie Ward mit seinem körperbetonten Dirigat das Menuetto zur Geltung bringen konnte.

Ich hätte für den Programmgestalter keinen Vorschlag, welche Musik er der hochemotionalen Elegie-Interpretation Christian Gerherhars ohne Pause hätte folgen lassen können, ohne deren Wirkung zu beeinträchtigen. Für mich war der Wechsel von der Nachwirkung der „Elegie“ ohne Pause zu Schuberts fröhlicher Musik äußerst problematisch und ich habe den Hauptanteil des Schubertschen Allegro noch bei Schoeck zugebracht.
Autor der Bilder: Oliver Killig
Thomas Thielemann, 30.8.2020
Ein Klassik-Wochenende in Dresden mit Corona
3. Juli 2020 Konzertplatz WeißerHirsch
4. und 5. Juli 2020 Semperoper
Das vergangene Wochenende haben wir genutzt, um konzentriert zu erleben, was unter den derzeitigen Corona-Einschränkungen in der Dresdner Klassikszene möglich ist.

Das Wochenende begann am Abend des Freitags mit der Traditionsveranstaltung der Musiker der Sächsischen Staatskapelle „Ohne Frack auf Tour“. Seit 2016 wechselten einmal im Jahr kleine Ensembles von ihrem Stammhaus in Kneipen, Bars und Restaurants in die Innere Neustadt, um dort im Halbstunden-Rhythmus 20 Minuten abseits vom Konzertrepertoire zu spielen, was ihnen so am Herzen liegt. Jedes Jahr waren wir von Lokal zu Lokal gezogen, haben vier bis sechs der Musikergruppen besucht und viel Freude am Gebotenen sowie am Interesse der sonst nicht im Konzertsaal Anzutreffenden gehabt. Selbst am Rande der Osterfestspiele hatten wir die Gelegenheit, „unsere“ Musiker in den Salzburger Kneipen zu begleiten.
An eine Einhaltung der Corona-Einschränkungen war in den Kneipen der Neustadt natürlich nicht zu denken. Weder die Abstände noch die Voraussetzungen für die Nachverfolgung eventueller Infektionsketten, eine Bedingung für die Dresdner Veranstaltungen, wären zu sichern gewesen. Deshalb spielten die zehn Ensembles auf dem Konzertplatz „Weißer Hirsch“ in Oberloschwitz und nicht parallel sondern hintereinander. Und zwar am Freitag und am Samstag. Die Online-Buchung der Tickets und eine Registrierung an der Abendkasse ermöglichten, dass der Teilnehmerkreis bekannt war.

Ein Catering sorgte für eine begrenzte Biergarten-Atmosphäre und die Musiker für die Stimmung.
In der besuchten Freitagsveranstaltung spielten zunächst die Flöten-Gruppe der Staatskapelle um Rozália Szabó Musik von Haydn, Mendelssohn Bartholdy und dem nach Dänemark verschleppten Österreicher Friedrich Daniel Kuhlau (1736-1832) unter dem Motto „Schneller, höher, schöner-die Flöten“.
Zu einer Reise „In den Rausch der Tiefe „verführten sieben Kontrabässe unter Viktor Osokin mit Musik aus Südamerika, England, Österreich und Italien bis zum Australier Colin Brunby (1933-2018).
Etwas Ruhe brachte Anett Baumann sowie Ami Yumoto (Violine), Juliane Preiß (Viola) und Titus Maak (Violoncello), dem „mal anderen Streichquartett“, mit einem Satz aus Verdis Streichquartett in das Geschehen. Zu unserer Freude brachten die vier unter anderem eine Komposition des langjährigen Dresdner Konzertmeisters Franҫois Schubert (1808-1878), der eigentlich Franz Anton getauft, aber nicht mit dem Wiener Franz Schubert verwechselt werden wollte. Als Schmankerl schloss das Quartett mit einer launischen Katzenmusik.

Als Gast der Staatskapelle hatte die hervorragende Saxophonistin Sabina Egea Sobral den Konzertmeister Robert Lis (Violine), Florian Richter (Viola), Matthias Wilde Cello) sowie Andreas Ehelebe (Kontrabass) um sich geschart, um den Zuhörern „Die Quintessenz des Tangos“ zu servieren.
Das Dresdner Hornquartett konnte aus den Werken des Dresdner Kantors Gottfried August Homilius (1714-1785), einer Szene aus dem Rosenkavalier, dem Mascagnti-Intermezzo entspannte Stimmung auf den Konzertplatz tragen. Besonders bezaubernd war das „Souvenir du Rigi op. 38“ des aus Lemberg stammendem Romantikers Albert Ferenc Doppler (1821-1883). Die Flötistin Rozália Szábo vermittelte den Gesang eines Waldvogels eingebettet in das Spiel der vier Hornisten.

Für den Abend des Samstag gab es natürlich die Möglichkeit, den zweiten Teil „Ohne Frack auf Tour“ zu besuchen. Andererseits bot auch im Kulturpalast die Dresdner Philharmonie am Samstag und Sonntag den Dirigier-Einstand von Vasily Petrenko. Die Haydn- Sinfonia concertante, Prokofjews Klassische Sinfonie und Faurés Suite Pelléas und Mélisande waren für jeweils fast 500 Besucher zu hören. Ob der „Allgemeinen Verwirrung“ lenkte die online-Buchung aber zu den viel versprechenden Mottos der Aufklang! Lieder -Abende mit Mitgliedern des Semperopern-Ensembles.
Wer sich diese reißerischen Titel ausgedacht hat, kannte hoffentlich die Abendprogramme nicht. Denn , was der depressive Monolog des König Philipp, die tragischen Schicksale der Linda di Chamounix oder des Mathias in Wilhelm Kienzls „Evangelimann“ an Leidenschaft vermittelten, bleibt dessen Geheimnis. Aber Peter Theiler hat es in seinem kurzen Talk herausgelassen, dass er das Haus wieder mit Leben erfüllen wollte.
Letztlich boten die spartanisch ausgestatteten Abende einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit eines leider nur kleineren Teils des Hausensembles. Die Sänger wurden von den Korrepetitoren beziehungsweise musikalischen Assistenten Alexander Bülow, Hans Sotin, Clemens Posselt und Sebastian Ludwig am Klavier begleitet, also Personen, die sie aus der Zusammenarbeit beim Rollenstudium kennen und nicht von zufälligen Dirigenten abhängig.

Daneben hatten auch die ansonsten im Verborgenen arbeitenden Musikdramaturginnen Bianca Heitzer und Juliane Schunke Gelegenheit, sich als Moderatorinnen vor Publikum zu zeigen.
Der Technische Direktor des Hauses Jan Seeger erläuterte in einen Talk, welche Hürden zu überwinden waren, die Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen organisieren zu können.
Die große Freude war aber vor allem, die vertrauten und lange vermissten Stimmen von Christa Mayer, Ute Selbig, Roxana Incontrera, Markus Marquardt, Tilmann Rönnebeck sowie anderen langjährigen Ensemblemitgliedern zu hören. Auch sind wir begeistert, dass mit Katerina von Bennigsen, Michal Doron und Alexandros Stavrakis inzwischen neue Stimmen ins Haus gekommen sind. Besonders freut uns, dass mit dem Amerikaner Joseph Dennis wieder ein entwicklungsfähiger Tenor dem Ensemble angehört.
Zu den Besonderheiten beider Abende gehören zweifelsfrei die Arie der Linda di Chamounix der Katarina von Bennigsen, der kraftvollere Philipp von Tilmann Rönnebeck, das Mahler-Lied „Ging heut morgen übers Feld“ von Michal Doron, die Barcarolle aus Hoffmanns Erzählungen mit Christa Mayer und der Gastsängerin Elena Gorshunova, die kraftvollen Tschaikowski-Lieder von Alexandros Stavrakis und vor allem die beeindruckend von Markus Marquardt dargebotene Carl-Löwe-Ballade „Archibald Douglas“.

Inzwischen liegen auch die Corona-Austausch-Programme der Staatskapelle und der Semperoper für den Zeitraum August bis Oktober 2020 mit einer Reihe Höhepunkte vor. Die Staatskapelle wird ihre Konzerte mit eingegrenzter Besetzung durchführen müssen. Die Semperoper bietet ein fast vollständiges Programm der Repertoire-Opern, allerdings halbszenisch und auf die musikalischen Höhepunkte begrenzt. Das Ganze unter dem Motto „Essenz“.
Bildrechte:
Konzertplatz Weißer Hirsch
©<Markenfotografie/Staatskapelle Dresden
©Semperoper Dresden/Fotos: Daniel Koch
Thomas Thielemann 6.7.2020
DON CARLO
Aufklang: Semperoper eröffnet Zwischensaison mit Anna Netrebko und Elena Maximova - kammermusikalisch
20.Juni 2020
Endlich wieder ein Besuch in der Semperoper. Kein elektronisches Notfallprogramm mit dem heimischen TV und der HiFi-Anlage, sondern ein Live-Konzert mit den Höhepunkten aus Guiseppe Verdis „Don Carlo“; und das mit einer hochrangigen Besetzung.
Natürlich waren die äußeren Umstände des Abends etwas verstörend. Die Garderobe konnte nicht abgegeben werden, das Flanieren im Haus und Catering fehlten und es bestand Maskenpflicht bis zur Einweisung zum Sitzplatz durch das Hauspersonal.
Wegen des Aerosolschutzes blieben die ersten fünf Parkettreihen frei. Auch jede zweite Reihe blieb gesperrt. Innerhalb der Reihen waren mit dem Zwischenraum zweier Plätze jeweils zwei Sitze nutzbar. Damit konnten etwas über 300 Besucher das Konzert hören.

Das Engagement Anna Netrebkos und Yusif Eyvazovs verdankten wir dem Umstand, dass die Star-Sängerin eigentlich am 23. Mai 2020 ihr Rollendebüt als Elisabetta di Valois (in der Übernahme der Don-Carlo-Inszenierung von Vera Nemirova von den Osterfestspielen) geben wollte und gemeinsam mit Yusif Eyvazov die Partien einstudiert hatte. Trotz der Premierenverschiebung kam die Operndiva mit ihrem Ehemann nun doch in dieser Spielzeit zu einer, allerdings Corona-bedingten kammermusikalischen Fassung der Verdi-Oper, nach Dresden. Mit ihnen belebten die mit Gastauftritten als Carmen im Haus bereits bekannte Elena Maximova und Ensemblemitglieder die Bühne der Semperoper. Dies wurde prächtig durch drei stimmstarke Damen und vier kraftvoll singende Herren des Sächsischen Staatsopernchores, von Jan Hoffman glänzend vorbereitet, unterstützt.
Der dem Hause verbundene Komponist und Dirigent Johannes Wulff-Woesten schuf eine kammermusikalische Fassung der Verdi-Oper und begleitete als Musikalischer Leiter des Abends vom KLavier die Musiker der Staatskapelle. Bei den Bestzungen der Instrumentalisten kamen, wegen der Abstandsregelungen, jeweils nur ein Flötist (Andreas Kißling), ein Oboist (Sebastian Römisch), ein Englischhorn (Volker Hanemann), eine Violine (Robert Lis), ein Violoncello (Simon Kalbhenn) sowie ein Kontrabass (Andreas Wylezol) zum Einsatz. Das Klavier und vor allem das Harmonium, von Jobst Schneiderat meisterhaft eingesetzt, ließen weitere Blasinstrumente und die Orgel nicht vermissen. Das klang für diese karge Instrumentierung aber dank dem längeren Nachhall und der guten Raumakustik erstaunlich voll.

Für mich störend, wurde der von Wulff-Wuesten schwer erarbeitete Handlungsfluss häufig durch Zwischen-Beifall unterbrochen. Aber im Konzertverlauf verzichtete der Musikalische Leiter dann zunehmend auf straffe Übergänge und gab Raum für stürmische Zwischen-Ovationen.
Anna Netrebko beeindruckte mit ihrer vor Kraft strotzenden, leicht eingedunkelten Stimme. Bereits mit dem Duett „Io vengoo domandar“ und der Szene „Non pianger, mia compagna“ forderte sie fast schwerelos ein, wer dem Abend den Glanz verleihen werde.
Mit Elena Maximova war ein weiterer Weltstar und häufige Partnerin der Anna Netrebko nach Dresden gekommen. Mit ihrem wunderbaren Mezzosopran bot sie mit aufregendem Gesang die Prinzessin Eboli.
Die Titelrolle verkörperte der aserbaidschanische Tenor und Ehemann der Primadonna Yusif Eyvazov mit seiner kräftigen Stimme. Mir hat sein Gesang in makellosem Italienisch recht gut gefallen. War es der Erfolg seiner Arbeit mit einem persönlichen Stimm-Coach, oder der Umstand, dass er nicht nur Anna Netrebko und Elena Maximova ansingen musste, sondern auch die zu Unrecht unterschätzten Ensemble-Mitglieder des Hauses zu Partnern hatte.

Der im Magdeburg geborene Bassist Tilmann Rönnebeck ist seit 2010 eine feste Größe im Repertoire-Betrieb der Semperoper. Mit seiner Interpretation des Königs Philippe verzichtete er auf expressive Gegengewichte und bot seine Aufgaben vorwiegend mit einem ausgeglichenen samtigen Timbre. Insbesondere den Monolog „Ella giammal m´amò“, unterstützt von Simon Kalbhenn, gestaltete er betont lyrisch.
Der Dresdner Sänger Sebastian Wartig, seit 2013 Ensemblemitglied, ergänzte mit der stimmlich-darstellerischen Autorität seines warmen Baritons als Marquis de Posa, so wie ihn das heimische Publikum kennt, die Sängerriege. Auch im Freundschaftsduett „È lui!...desso!“ ließ er sich nicht von Kraftmeierei des Tenors aus der Reserve locken.
Aus Athen ist 2018 Alexandros Stavrakakis zum Hausensemble gekommen. Mit respektforderndem Organ gab er der Autorität des Mönchs seine prachtvolle Stimme.
Besonders gefreut hatte mich der Tebaldo von der aus Japan stammenden Sopranistin des jungen Ensembles Mariya Taniguchi. Mich hatte sie in der abgebrochenen Saison in Eötvös „Goldener Drache“ als tragischer Chinese mit ihrer Darstellung und ihrem Schlussgesang begeistert. Im „Nei giardin del bello“ mit der Eboli war sie, von drei stimmstarken Choristinnen unterstützt, eine präsente Partnerin der Frau Maximova.

In der Schluss-Szene verkörperte Holger Steinert den Großinquisitor.
Gemessen an der geringen Zahl der Zuschauer erklang ein lauter, dankbarer und freudiger Schlussbeifall. Am Ende stand das gesamte Publikum und wollte eigentlich das Haus nicht verlassen
Inzwischen hat das Haus, etwas verhalten informiert, dass Peter Theiler am Projekt der „Don Carlo-Inszenierung“ von Vera Nemirova, allerdings mit der Musikalischen Leitung von Paolo Arrivabeni festhält. Als Solisten der Kernrollen werden neben Elena Maximova als Eboli, René Pape als Philippo, Hibla Gerzmava als Elisabetta und Tomislav Mužek als Don Carlo benannt.
Autor der Bilder:Daniel Koch
Thomas Thielemann 21.6.2020
GURRELIEDER
Zum Zweiten
Einen langer Entstehungsprozess von zehn Jahren wendete Arnold Schönberg auf, um sein spätromantisches Monumentalwerk GURRE-LIEDER zu komponieren. Spannend ist dabei, dass der erste Teil in den Jahren 1900 – 1903 entstand und der zweite Teil, der eine wesentlich modernere Klangsprache fand, erst 1910 folgte. Die Uraufführung fand schließlich im Februar 1913 in Wien statt.
Der Schriftsteller Jens Peter Jacobsen verfasste zu diesem Werk die Textdichtung. Auf dem dänischen Schloss Gurre ereignet sich die mittelalterliche Liebestragödie zwischen König Waldemar und seiner Geliebten Tove. Diese wird ermordet, veranlasst durch Waldemars Frau, Königin Helvig.
Rache, Eifersucht und Leichenzug, erlebt und besungen aus der Perspektive der Waldtaube. Bis zum Mord ist der erste Teil ein einziges Wechselspiel einer sinnlich beschworenen großen Liebe zwischen Tove und Waldemar.
Im zweiten Teil steht der dem Wahnsinn nahe Waldemar, der den Tod seiner Geliebten beklagt und dabei die Auferstehung der Toten erfleht. Die „wilde Jagd“ beginnt mit rasselnden Ketten und furios beinahe gröhlendem gewaltigen Männerchorgesang.
Klaus-Narr reflektiert das Geschehen in grotesker Weise. Dann beschreibt ein Sprecher das wunderbare Erwachen der Natur, gipfelnd in dem gewaltigsten Sonnenaufgang, den es in der Musik überhaupt gibt. Schönberg öffnet hier alle dynamischen Schleusen, führt den achtstimmigen Riesenchor nun erstmals mit den Frauenstimmen zusammen und das gewaltige Orchester errichtet mit den Gesangsstimmen eine orgiastisch anmutende riesige Klangkathedrale, die den Zuhörer in ein akustisches Paradies führt. Was für ein unüberbietbarer musikalischer Abgesang auf die Spätromantik!
Arnold Schönberg fordert von seinen Gesangssolisten außerordentliche Leistungsfähigkeit.
Camilla Nylund gab eine stimmlich starke Tove, die mit sinnlichem Timbre und herrlich aufblühender Höhe sehr für sich einnahm. Die Stimme floß ruhig auf dem Atem und wurde von ihr mit großer Souveränität geführt.
Der erfahrene Stephen Gould agierte als Waldemar kraftstrotzend mit sicherer Höhe. Wissend gestaltete er den Text und konnte vor allem auch in den Pianofärbungen bei „Du wunderliche Tove“ begeistern. Überzeugend konnte er die emotionale Entwicklung vom Liebenden zum Leidenden vermitteln.
Bewegend und tiefgründig wurde das Lied der Waldtaube von Mezzosopranistin Christa Mayer vorgetragen. Warmstimmig, raumgreifend im Klang und sicher in der Höhe war ihre Stimme zu vernehmen.
Mit messerscharfer Diktion gefiel Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Klaus-Narr, ebenso wie der kurzfristig eingesprungene Markus Marquardt als Bauer.
Ein besonderer Höhepunkt war freilich die Szene des Sprechers, die durch den großartigen Franz Grundheber so besonders eindrücklich geriet. Jede Silbe erhielt von ihm eine Bedeutung, eine Aura, die dem abschließenden Chorfinale eine perfekte Vorlage bot. Beim finalen „Erwacht, ihr Blumen zur Wonne“ wechselte er in den gesungenen Tonfall und demonstrierte, wie zeitlos, wie stark und in Takt sein herrlicher Bariton auch in seinem hohen Alter noch ist.
Die beide Chöre (MDR Rundfunkchor und der Sächsische Staatsopernchor Dresden) lieferten ebenfalls eine besondere Leistung ab. Wunderbar geschmeidig im Zusammenklang und bestens wortverständlich.
Am Pult der Staatskapelle Dresden, ergänzt durch Musiker des Gustav Mahler Jugendorchesters, stand Christian Thielemann.
Es gelang ihm eine packende Aufführung dieses anspruchsvollen Werks. Vorzüglich wahrte er die dynamische Balance, bestechend umgesetzt durch Transparenz und fein differenzierte Klanglichkeit. Da schillerte es fortwährend und die Musik erzählte in endlos vielen Farbverläufen. Die Klangqualität war in allen Gruppen des riesenhaften Orchesters ausgezeichnet. Thielemann ließ die Musik atmen, war immer um das Wohl seiner Sängerinnen und Sänger bemüht, und ließ es zuweilen im Orchester beherzt aufrauschen. Thielemann musizierte ganz im Geiste der Spätromantik, was diesem herrlichen Werk zu größter Wirkung verhalf.
Es war eine überwältigende Hörerfahrung dieses so außergewöhnlichen Konzertes. Das Publikum war begeistert und applaudierte frenetisch.
Dirk Schauß, 12.3.2020
Grandiose Gurrelieder-Aufführung
9. März 2020
Arnold Schönbergs spätromantisches Oratorium in der Semperoper
Nahezu jede zu Herzen gehende Dichtung handelt von einer unglücklichen Beziehung zweier Menschen. So auch die Legende von der Liebe des dänischen Königs Waldemar des Großen (1131-1182) zu dem Mädchen Tove (im Altnorwegischen: Tofa, die Taube). Aber so recht war die Liebe Waldemars zu dem Bauernmädchen nicht unerfüllt geblieben, denn Tove lebte offenbar als Mätresse am Hofe des auch Volmer genannten künftigen Königs und hatte ihm 1150 einen unehelichen Sohn Christoffer geboren.
Eifersucht wird es kaum gewesen sein, dass die Gattin des Königs Helwig ihren Bettgenossen Folkward anstiftete, während einer Abwesenheit des Königs seine Geliebte im Badehaus einzusperren, so dass Tove vom Heißdampf verbrüht wurde. Denn sie hatte sich mit Falkward anderweitig versorgt. Da wären doch andere Mordmotive zu vermuten.

Offenbar war die Rache des Volmer so fürchterlich, dass er auch die Existenz des Mörderpaar aus den Geschichtsbüchern regelrecht tilgen ließ. Deshalb gilt die Heirat des Königs 1157 mit Sophia von Minsk (etwa 1141-1198) rechtlich als seine einzige Ehe.
Als sich Waldemar nach blutigen Auseinandersetzungen 1157als alleiniger König von Dänemark durchsetzen konnte, wurde Toves Sohn Christoffer sogar zum Herzog von Jütland.
Die Beziehung von Waldemar I. und Tove aber wurde zur Legende und eine ehemalige Burg in Nord-Seeland zum Schloss „Gurre“-nach dem Ruf der Tauben.
In der Überlieferung im Volke wurde die wilde Ehe des Volmers mit der Mätresse Tove zur unglücklich-reinen Liebe des späteren Königs Waldemar IV. Atterdag (1321-1375) zu einem Bauernmädchen verklärt. Möglicherweise auch, weil er auf Schloss Gurre lebte und dort auch verstorben war.
Der dänische Schriftsteller und Naturforscher Jens Peter Jacobson(1847-1865) hat, damals 21-jährig, diese Legende der Liebe von Waldemar und Tove irgendwann in das Mittelalter Dänemark verortet, die Bestrafung des Folkwards auf das grausamste ausgeschmückt und Waldemar wegen eins Gottesfluches samt seinen Mannen zu rastlos reitenden unerlösten Toten gemacht. Zur heiteren Entspannung des Geschehens hat der Dichter die Figuren des abergläubigen Bauern sowie des Klaus-Narr eingeführt und aus dieser Gemengelage eine Novelle geschaffen, die um 1870 seinem Prosa-Poesie-Zyklus „En cactus springer du“-Ein Kaktus ist erblüht- zugefügt worden war. Der Österreicher Literaturhistoriker Robert Franz Arnold (1872-1938) übersetzte die Jacobson-Texte.

Arnold Schönberg (1874-1951) war von Jacobsens Lyrik stark beeindruckt. Als er sich an einem Komponistenwettbewerb des Wiener Tonkünstlervereins für einen „Liederzyklus mit Klavierbegleitung“ beteiligen wollte, entnahm er der deutschen Übertragung Arnolds von 1899 Verse und komponierte einige schöne und vor allem neuartige Lieder. Sein Freund und Lehrer Alexander von (1871-1942) Zemlinski riet von der Einreichung ab, weil die Lieder wegen ihrer Neuartigkeit beim Wettbewerb keine Chance hätten und die Kompositionen in dieser Form ohnehin zu schade wären. Folglich verzichtete Schönberg auf die Teilnahme am Wettbewerb und entschloss sich zu einer Umarbeitung seiner Arbeit für Gesang und Orchester.
Zwischen März 1900 und März 1901 setzte er sich, unterbrochen von teils längeren Pausen, intensiv mit dem Vorhaben auseinander. Entstanden war ein Werk für einen gewaltigen Klangapparat: fünf Gesangssolisten, einen Sprecher, vier unterschiedliche Chöre und ein riesiges Orchester. Mit großen Abständen schloss er 1911 die Instrumentierung des Oratoriums ab. Für Schönberg war seine Periode der Spätromantik längst abgeschlossen und er war mit seinen ersten Streichkonzerten und der 1. Kammersinfonie von 1906/1907 zur musikalischen Moderne mit der freien Tonalität weitergezogen. Möglicherweise bereitete er bereits seinen Übergang zur Atonalität vor.
Trotzdem verblüffte Schönberg am 23. Februar 1913 sein Wiener Publikum, als er ein publikumsfreundliches, im Schönklang der Spätromantik schwelgendes Opus mit opulenter Besetzung vorstellte.

Auf der Bühne der Semperoper hatte eine gewaltige Orchesterbesetzung von 149 Musikern Platz genommen und zieht die Zuhörer vom Beginn des Vorspiels an, in ihren Bann. Faszinierend machtvoll lässt Christian Thielemann aus diesem gewaltigen Klangfluss die überreichen Melodien aufblühen. Zurückhaltend vom Orchester begleitet, interpretieren Camilla Nylund und Stephen Gould im Wechsel und nie gemeinsam die Klagen des Bauernmädchens Tove sowie des Königs Waldemar über den dramatischen Verlauf ihrer Liebe. Wunderbar sinnlich singt Frau Nylund mit ihrer klaren hellen Stimme gut verständliche Verse. Stephen Goulds Waldemar ist nur im ersten Teil der junge Held. Stimmlich beweist er aber beeindruckend, dass er das Träumen noch nicht verlernt und gibt seiner Partie über den gesamten Abend eine besondere Note. Zum letzten Abschnitt des ersten Teils kommt noch die Waldtaube der Mezzosopranistin Christa Mayer hinzu, wenn sie mit einer zwölf-Minuten-Wahnsinns-Partie den Tod und die Grablegung der geliebten Tove zu beklagen hat. Alle drei Solisten mit ihren perfekt aufeinander abgestimmten Stimmen bieten eine brillante Klangkultur und souveräne Sprache.
Im zweiten, nur kurzen Teil, hadert Waldemar mit seinem Schöpfer, bezichtet ihn, nicht wie ein gütiger Gott gehandelt zu haben und wendet sich wieder zum Glauben der Urahnen.
Was dann Christian Thielemann und das Orchester im dritten Teil leisteten, war in seiner Wirkung überirdisch. Alles erschien leicht und gelang wie selbstverständlich. Mit der wilden Jagd der Verfluchten verquicken sich die von Schönberg verwandten Gattungselemente: Schauerromantik, Chöre, Ironie und Wiedererweckungsjubel durchsetzt, mit wunderlich-nordischer Atmosphäre. Eingeordnet kommen die zur Auflockerung der Stimmung hinzu gefügten Figuren: des von Markus Marquardt artikuliert vorgetragenen abergläubigen Bauern, des von Wolfgang Ablinger-Sperrhacke mit schöner Tenorstimme gesungenen skurrilen Klaus-Narr, sowie die etwas distanziert angelegte Rolle von Franz Grundheber, als mit seinem Sprechgesang über die zweideutige Lebenskraft der Natur uns ordentlich Angst eingeflößt werden sollte.

Aber dem dritten Teil spürt man ohnehin an, dass Schönberg während seiner Arbeit schon gedanklich im Aufbruch war. Und ohne Grund hatte er die „Gurrelieder“ nicht noch zwei Jahre bis zur ersten Aufführung warten lassen.
Zu den musikalischen Höhepunkten der Aufführung gehörten aber vor allem die von Jörn Hinnerk Andresen beziehungsweise Jan Hoffmann hervorragend einstudierten Darbietungen des MDR-Rundfunkchores und des Sächsischen Staatsopernchores, die dem Abend dann mit dem Schlusschor noch eine gehörige Portion Optimismus verleihen konnten.
So steht unter dem Strich ein in jeder Hinsicht stimmig und musikalisch packendes Konzerterlebnis..
Thomas Thielemann, 10.3.2020
Bilder (c) Matthias Creutziger
Gerolstein ist überall
29. Februar 2020 (Premeire)
Jaques Offenbach erobert die Semperoper
Der Kantor, Komponist und Dichter Isaac Juda Eberst (um 1780-1850) aus Offenbach war ein energischer Mann. Als sein 1819 in Köln geborener Sohn Jakob musikalisches Talent zeigte, reiste er 1833 mit ihm nach Paris und blieb hartnäckig, bis der junge Mann am 30. November 1833 in der Cello-Klasse des Conservatoire national de musique et de déclamation aufgenommen worden war. Aber offenbar befriedigte Jakob der Unterricht bei Olive-Charlier Vaslin (1794-1889) nicht. Er verließ ohne Abschluss das Konservatorium, nannte sich fortan Jaques und nahm Kompositionsunterricht bei Jacques Fromental Halévy (1799-1862). Etwas Geld verdiente er von 1835 bis 1837 als Orchestermusiker der Pariser Opéra-Comique und spielte dabei massenhaft Rossini-Opern. Dabei hörte der Cellist Rossini ab, was beim Publikum ankommt. So hat er eigentlich im Orchestergraben von Rossini regelrecht das Komponieren erlernt. Daneben mischte er mit seinen Instrument die Pariser Salons auf, und galt bald als der „Paganini des Cellos“.
Daneben komponierte er zunächst Romanzen, Walzer, Salonstücke und erste kleinere Bühnenwerke.

Parallel zur Pariser Weltausstellung 1855 mietete er ein eigenes „Théȃtre des Bouffes-Parisiens“, in dem er mit großem Erfolg „Die beiden Blinden“ aufführte, denen kurzfristig sieben weitere Uraufführungen folgten. Neben konzertanten Werken, Balletten und Opern hat Offenbach im Laufe der Jahre 102 Operetten komponiert.
Anlässlich der Pariser Weltausstellung 1867 platzierte er an drei Pariser Theatern je eine neue Kompositionen. Darunter im Théȃtre des Variétés sein Erfolgsstück „La Grande-Duchesse de Gérolstein“.
Obwohl sich Offenbach politisch offenbar nie betätigte, sowie sich auch kaum über die Politik von Napoleon III. öffentlich geäußert hat, fielen ihm doch die militärischen Ambitionen seines Gastlandes auf. So nutzte er auch seinen Beitrag zur Weltausstellung zur Verspottung alles Militärischen. Würzte das mit einer Satire auf das Günstlingswesen, ergänzte es mit etwas Herz-Schmerz und packte eine gewaltige Menge Frivolität auf die „Großherzogin von Gerolstein“. Mit ihrem Schwung und ihrem Witz der Dialoge von Henri Meilhac(1831-1897) sowie Ludovic Halévy(1834-1908) hat die freche Komödie als Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse selbst in unserer Zeit ihre Aktualität nicht verloren.

Die Semperoper gewann für eine Inszenierung der Operette auf der Opernbühne einen Spezialisten für unterhaltsames Musiktheater Josef E Köpplinger vom Münchner Gärtnerplatztheater.
Köpplinger hatte wenig Skrupel, in den Texten aktualisierte Momente ein zu bauen und die Handlung mit neuen Personen und ergänzenden Handlungsfäden anzureichern. Er entfacht dabei ein abwechslungsreiches Spektakel und gibt die großen Ideale zwischen Liebe, Treue, und Staatsraison der Lächerlichkeit preis.
Die musikalische Leitung übertrug die Intendanz dem seit seiner Iphigenien-Arbeit im vergangenen Jahr im Hause bestens eingeführten britischen Dirigenten Jonathan Darlington.
Den Musikern der Staatskapelle machte die Wiedergabe der prägnanten schmissigen Musik Offenbachs offenbar gewaltige Freude, so dass durchaus auch mal eine Abweichung vom weichen Dresdner Klang riskiert wurde. Darlington hatte die Kapelle im Graben etwas höher gesetzt, so dass deutlich mehr Direktschall in den Zuschauerraum drang. Schon damit war der gewohnte Klangrausch des Hauses „zerstört“ und es hörte sich doch etwas „operettisch“ an.
Das Bühnenbild des Johannes Leiacker beschränkte sich fast ausschließlich auf beeindruckende Rundhorizont-Malereien. Nur wenige Requisiten störten Spieler und Tänzer bei ihren quirligen Aktionen.

Die Wirtschaft im Großherzogtum Gerolstein befindet sich in einer tiefen Krise und wird eigentlich nur von einem fragilen Fremdenverkehr am Leben gehalten. Deshalb begann auch die Vorstellung mit einem Touristen-Werbefilm. Der Touristenbetreuer, gespielt von Josef Ellers, sichert das Bruttosozialprodukt des Landes. Deshalb lockerte er an den zum Teil „unpassendsten Stellen“ mit seinen Gästeführungen das Bühnengeschehen auf.
Die Koalitionäre des Großherzogtums, der Baron Grog, die Haushofmeisterin Erusine von Nepumukka und der General Bumm, haben die Sorge, ihre unverheiratete Großherzogin könnte sich aus langer Weile in das politische Geschehen einmischen und ihre Machenschaften einschränken.
Die Titelrolle wurde von der großartigen Anne Schwanewilms verkörpert. Für die Gesangspartien setzte sie ihren weichen, leichtverhangenen Sopran ein, so wie wir sie kennen. Mit viel Selbstironie meistert sie die Gratwanderung zwischen Würde und Peinlichkeiten mit einer tollen Bühnenpräsenz. Aber es blieb der Eindruck, dass Frau Schwilms bisher mehr Wagner, Strauss und wenig Offenbach verkörpert hatte. Trotzdem: Unsere volle Anerkennung.

Die „Herrscherin“ zu verheiraten, erweist sich auch nicht so problemlos, da sich der ins Land geholte Heiratskandidat als nicht so recht geeignet erweist. Denn der von den Höflingen für die Großfürstin vorgesehenen Bräutigam-Prinz Paul ist der mit reichlichen Profilneurosen ausgerüstete Tenor Daniel Prohaska.
Ein noch immer erfolgreiches Rezept bleibt deshalb, dass innenpolitische Probleme mit militärischen Mitteln gelöst werden. Der bewährte Charakterbariton Martin Winkler bewies als General Bumm seine Wandlungsfähigkeit. Mit großer Stimme lässt er auch mit seiner maulheldenhafter Art seiner Lust freien Lauf.
Bei der Truppenparade verguckt sich allerdings die Befehlshaberin spontan in den Soldaten Fritz und überträgt ihm, zum Leidwesen der Koalition, das Kommando für einen Waffengang mit einem Nachbarländchen. In seinem Semperopern-Debüt gibt Maximilian Mayer vom Gärtnerplatz-Theater den schmucken, etwas begriffsstutzigen Soldaten Fritz, präzise, ausdrucksstark mit einem klaren schmiegsamen Tenor.
Dank einer List ist das „Krieglein“ für Gerolstein erfolgreich und Fritz könnte Großherzog werden. Aber da meldet des Fritzen Verlobte Wanda ihre älteren Ansprüche an und obsiegt nach einigen Verwicklungen. Mit einer hübschen, leichten Sopranstimme agiert energisch als seine Verlobte Wanda Katarina von Bennigsen vom Hausensemble.

Den Möchtegernstaatsmann Baron Grog spielte Martin-Jan Nijhof mit instinktiver Sicherheit. Ihm zur Seite der Baron Puck von Jürgen Müller.
Als Haushofmeisterin der Großherzogin und Hauptintrigantin Erusine von Nepomukka erwies sich die die Österreicher Kabarettistin Sigrid Hauser als ein Schwergewicht der Inszenierung.
Mit der tragenden Rolle des Fremdenführers hielt Josef Ellers das Bühnengeschehen zusammen, indem er an den unpassendsten Stellen seine Schützlinge in die Szene führte.
Der souveräne Chor, sowie vor allem das Ballett mit tollen Can Can-Einlagen und vor allem dem Siegestanz der Soldaten halfen die Vorstellung zu einem temporeichen Abend zu gestalten.
Nicht alle Besucher des üblichen Semperoper-Premierenpublikums teilten meine Begeisterung. Es bleibt aber zu hoffen, dass die Inszenierung über längere Zeit das „DD-Touristen-Repertoire“ nicht nur bereichert, sondern zu einem Zugpferd wird.
Thomas Thielemann, 1.3.2020
Bilder (c) Ludwig Olah