THEATER BREMEN

www.theaterbremen.de/
DON CARLO
Premiere am 18.09.2022
Bücher sind gefährlich
Für Verdi-Freunde in Bremen und Umgebung gab es in jüngster Zeit viel Futter. Das Musikfest präsentierte konzertant einen kompletten „Rigoletto“, Bremerhaven eröffnete seine Spielzeit mit „Macbeth“ und am Bremer Theater wurde als erste Opernpremiere Don Carlo gezeigt. Und das war mit fast vier Stunden Spieldauer richtig zum Sattwerden, denn gespielt wurde die fünfaktige Fassung mit dem Fontainebleau-Akt.

Der in Bremen geborene Regisseur Frank Hilbrich ist hier kein Unbekannter und hat am Bremer Theater bereits „Der Vetter aus Dingsda“, „The Turn of the Screw“ und den „Rosenkavalier“ inszeniert. Nun ist er in Bremen leitender Regisseur des Musiktheaters geworden. Bei seiner Sicht auf „Don Carlo“ mag eine Inspiration der Tatsache geschuldet sein, dass der spanische König Philipp II. die größte Bibliothek seiner Zeit besaß. Jedenfalls zeigt das Bühnenbild von Katrin Connan riesige, grau in grau getauchte Bücherwände. Mit ihrem stufenartigen Aufbau erinnern sie gleichzeitig an den Turmbau zu Babel. Für Hilbrich beginnt eigentlich erst mit Büchern die Zivilisation. Auf den Stufen dieser Bibliothek sieht man überall lesende Menschen. Aber Bücher sind für die Institutionen der Macht, egal ob kirchlich oder weltlich, auch eine Gefahr. Sie können deshalb brennen. „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“, hat Heinrich Heine gesagt. Hilbrich zeigt beides in der grandios und überwältigend arrangierten Autodafé-Szene, bei der eben Bücher verbrannt und Menschen so sehr von wolfsartigen, lauernden Wesen auf das Grausamste gefoltert werden, dass auch für die Zuschauer fast eine Schmerzgrenze erreicht wird. Nach dem Autodafé sind die Bücherwände dann leer.

Hilbrichs Inszenierung zeichnet sich insgesamt durch eine sehr intensive und klug durchdachte Personenführung aus. Die Wechselwirkung zwischen Politischem und Privatem wird deutlich herausgearbeitet. Bei der Freundschaftsbekundung zwischen Posa und Don Carlo (und auch später noch) spielt die knallgelbe Flagge Flanderns eine große Rolle. Die Szene wirkt wie ein Eid auf die Fahne. Bei der nächtlichen Begegnung zwischen Eboli und Don Carlo lodert bei ihr soviel Leidenschaft wie bei Carmen und Don José. Eindrucksvoll gerät auch die Auseinandersetzung zwischen König Philipp und dem Großinquisitor. Letzter sitzt dabei unbeugsam auf dem Thron - da bleibt kein Zweifel darüber, wer die eigentliche Macht im Staat hat. Keinen Zweifel gibt es auch daran, dass das Streben von Posa und Don Carlo nach Freiheit zum Scheitern verurteilt ist. „O Freiheit! Du bist ein böser Traum!“ kann man zu Beginn und am Ende in großer Schrift lesen. Trotz aller Meriten von Hilbrichs Inszenierung gibt es doch kleine Einschränkungen. Dass Eboli und die Hofdamen dem Pagen Tebaldo bis zur Vergewaltigung an die Wäsche gehen, ist überflüssig. Und beim Fontainebleau-Akt hört man lange nur die Stimmen hinter dem schwarzen Zwischenvorhang, bevor man schemenhaft etwas erkennt.

Dann wird (wieder einmal) darauf ein Live-Video projiziert, das zudem völlig unsynchron ist. Marko Lentonja und die Bremer Philharmoniker musizieren diesen Don Carlo durchgängig mit energievoller Spannung, mit großem Atem und viel Sinn für Feinheiten und dynamische Abstufungen. Allein der Orchesterausbruch nach Posas Auseinandersetzung mit Philipp geht tief unter die Haut. Auch die düstere Welt des Großinquisitors spiegelt sich eindrucksvoll im Orchester wider. Der Chor (Alice Meregaglia) zeigt sich ebenfalls von der besten Seite. In der Titelpartie hat Luis Olivares Sandoval viele schöne Momente und kann die Vorzüge seines Tenors gut zur Geltung bringen. Im späteren Verlauf muss man aber angesichts der Länge der Partie kleine Abstriche machen. Ob das eher helle Timbre von Michal Partyka unbedingt für den Posa geeignet ist, bleibt Geschmackssache. Er ist nicht unbedingt ein typischer Verdi-Bariton, verfügt aber über eine sichere Höhe und gestaltet die Partie mit viel Leidenschaft.

Sarah-Jane Brandon ist ebenfalls neu im Ensemble und begeistert als Elisabetta mit ihrem lyrischen Sopran, silbrigem Stimmklang und wunderbaren Piani. Patrick Zielke besticht als Philipp mit seiner Bühnenpräsenz und ausgefeilter Gestaltung. Die Tragik und auch die Brutalität der Figur werden sehr deutlich. Nathalie Mittelbach kann als Eboli nicht nur mit ihrem vehementen Ausbruch bei „O don fatale“ überzeugen. Der ukrainische Bassist Taras Shtonda gibt den Großinquisitor mit machtvoller Urgewalt. In kleineren Partien sind Stephen Clark als Mönch, Elisa Birkenheier als Tebaldo, Nerita Pokvytyte als Stimme vom Himmel und Christian-Andreas Engelhardt als Lerma und Herald zu hören.
Wolfgang Denker, 19.09.2022
Fotos von Jörg Landsberg
JENUFA
Premiere am 09.04.2022 besuchte Aufführung am 26.06.2022
Vernichtender Ehrenkodex

Da ist dem Regisseur Armin Petras und dem Dirigenten Yoel Gamzou zusammen mit einem hervorragenden Sängerensemble eine spannende und tief bewegende Produktion gelungen. Jenůfa von Leoš Janáček spielt eigentlich in Mähren im 19. Jahrhundert. Petras verlegt die Handlung in Zeiten des Umbruchs im letzten Jahrhundert: Im 1. Akt erinnern lässliche, aber nicht störende Videos (von Rebecca Riedel) an den Prager Frühling und den Zusammenbruch der Sowjetunion. Der menschenvernichtende Ehrenkodex und die alten Begriffe von Schande sind in dem Dorf, in dem Jenůfa lebt, aber noch präsent. Jenůfa erwartet von dem Hallodri Števa ein uneheliches Kind. Der ist aber nicht gewillt, seinen Pflichten nachzukommen. Da beschließt die Küsterin, Jenůfas Ziehmutter, das Baby umzubringen, um Jenůfa (und vor allem sich) die „Schande“ zu ersparen. Während der Hochzeit Jenůfas mit ihrem Stiefbruder Laca kommt alles ans Tageslicht. Die Küsterin bekennt sich schuldig und Jenůfa verlässt mit Laca das Dorf für eine glückliche Zukunft.

Bühnenbildner Julian Marbach hat für die Mühle, die Wohnräume und den Dorfplatz eine zweistöckige Konstruktion geschaffen, die mittels Drehbühne immer wieder eindrucksvoll variiert wurde. Petras gelingt eine intensive Charakterisierung aller Personen. Nadine Lehner zeigt beklemmend die Entwicklung Jenůfas vom schwärmerischen jungen Mädchen zum traumatisierten Opfer in tiefster Verzweiflung bis zur gereiften Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Ihre stimmlichen und darstellerischen Facetten sind dabei von atemberaubender Vielfalt. Nicht weniger intensiv agiert Ulrike Schneider als Küsterin. In ihrer großen Szene im 2. Akt zeigt sie, dass diese Küsterin nicht nur die eiskalt kalkulierende Despotin ist, sondern auch mit Verzweiflung und Gewissensqualen kämpft. In diesem Akt haben die Videos eine sehr sinnvolle Funktion, weil sie die Gefühle der Küsterin und das Elend von Jenůfa in Nahaufnahmen noch verdeutlichen und verstärken. Hier zeigt sich die Inszenierung von ihrer stärksten Seite. Überflüssig hingegen ist das hinzugefügte Telefongespräch von Števas neuer Verlobter (Marie Smolka) vor dem 3. Akt.

Die beiden Tenorrollen werden von Luis Olivares Sandoval (Laca) und Christian-Andreas Engelhardt (Števa) sehr ansprechend gestaltet, wobei Kostümbildnerin Patricia Talacko den Števa mit seiner scheußlichen Perücke zur Karikatur degradiert. Die weiteren Partien sind mit Nathalie Mittelbach (alte Buryia), Stephen Clark (Altgesell), Christoph Heinrich (Richter) und Ulrike Mayer (Frau des Richters) bestens besetzt. Der Chor des Bremer Theaters (Einstudierung Alice Meregaglia) beweist einmal mehr seine hervorragende Qualität.
Das gilt auch für die Bremer Philharmoniker, die unter der Leitung von Yoel Gamzou die gesamt Pracht von Janáčeks Musik in allen Farben und Schattierungen zum Klingen bringen. Die mächtigen Ausbrüche, die folkloristischen Anklänge und die zarteren Momente - alles wird in den richtigen Proportionen zueinander gesetzt. Ein großer Abend auch für die Bremer Philharmoniker!
Wolfgang Denker, 27.06.2022
Fotos von Jörg Landsberg
DER BAJAZZO
Premiere am 30.10.2021
Ein Zwilling allein
Im Jahr 1883 schrieb der Mailänder Verleger Edoardo Sonzogno erstmalig einen mehrfach wiederholten Wettbewerb für Komponisten aus. Zugelassen waren einaktige Opern. Diesen Wettbewerb gewann Pietro Mascagni 1889 mit seiner Oper „Cavalleria rusticana“. Auch Ruggero Leoncavallo beteiligte sich später an diesem Wettbewerb mit der Oper „I Pagliacci“.

Die wurde allerdings aus formalen Gründen abgelehnt, weil sie ein zweiaktiges Werk ist. Gleichwohl - „Cavalleria rusticana“ und „I Pagliacci“ sind die „Flaggschiffe“ des Verismo. Meistens werden beide Opern zusammen aufgeführt, weshalb sie auch als veristische Zwillinge bezeichnet werden. Andere Kopplungen sind eher die Ausnahme, aber Bremen hat „I Pagliacci“ sogar schon einmal (1964) zusammen mit Strawinskys „Die Nachtigall“ aufgeführt. In der neuen Opern-Premiere von Leoncavallos I Pagliacci (Der Bajazzo) kommt nun einer der „Zwillinge“ allein - wahrscheinlich weil kurze Opernabende ohne Pause in Corona-Zeiten noch als angemessen angesehen werden. Es gibt an diesem Abend drei Debüts und einen Abschied. Die aus Tschechien stammende Sopranistin Marie Smolka wechselte vom Landestheater Coburg fest ins Bremer Ensemble. Sie singt die Nedda. Der aus Korea stammende lyrische Bariton Elias Gyungseok Han debütiert als Silvio und Ulrike Schwab führt erstmals Regie am Bremer Theater. Der junge Dirigent Killian Farrell wird Ende des Jahres nach Stuttgart wechseln.

Wo ist die Grenze zwischen Künstler und Mensch? Wo die zwischen Bühne und Publikum? Gibt es sie überhaupt? Was fordert die Kunst? Und wie viel ist man bereit, dafür zu opfern? Das sind die Fragen, die Ulrike Schwab zum Ausgangspunkt ihrer Inszenierung gemacht hat. Und sie sucht am Beispiel des Künstlerehepaars Canio und Nedda darauf eine Antwort zu finden. Die Gauklertruppe um diese beiden ist eine Welt aus Schein, aus Eifersucht, aus Begehren und Verletzungen, aus unerfüllten Sehnsüchten. Nedda sehnt sich nach einem besseren Leben an der Seite ihres Liebhabers Silvio. Tonios Triebe münden in Bösartigkeit und Canio ahnt, dass er Neddas Liebe längt verloren hat und bringt sie am Ende um. Bei Schwab erschießt sie sich allerdings mit einem Gewehr und wird in ihrem blutverschmierten weißen Gewand wie eine Christus-Figur in die Höhe gezogen.

Für Bühne und Kostüme zeichnet Rebekka Dornhege Reyes verantwortlich. Ein richtiges Bühnenbild gibt es aber eigentlich nicht. Hier wird vor allem mit der Schwebebühne gearbeitet, bei der die Fläche mit ihren vielen Luken mal gekippt, mal in schwindelnde Höhen gefahren wird. Bei den Kostümen sind die Rollen zwischen den Gauklern und dem dörflichen Publikum getauscht. Canios Truppe ist fast normal gekleidet, während die Dorfbewohner in ihren knallbunten Kostümen eher in einem Zirkus angesiedelt sind. Ulrike Schwab hat viel im Performance-Bereich gearbeitet. Körperlichkeit und Bewegung sind ein zentrales Element ihrer Inszenierung. Gleich zu Beginn sieht man eine gläserne Vitrine, in der Nedda liegt. Ihr Körper wird quasi ausgestellt. Der Harlekin jongliert bei seiner Serenade und das rein orchestrale Intermezzo untermalen alle mit marionettenhaften, pantomimischen Bewegungen. Das Vogellied singt Nedda in einer Art Vogelkäfig in luftiger Höhe - ein etwas plattes Symbol, wenn auch schön anzusehen.

Überhaupt - längst nicht alles ist nachvollziehbar, was in Schwabs Regie auf der Bühne passiert. Warum wickelt sich Nedda in eine Plastikfolie? Warum verfolgt Canio seinen Nebenbuhler (eine lächerliche Szene!) unter einer Plane? Und warum stehen alle beim eigentlich dramatischen, aktionsreichen Finale in Glaskäfigen? Hier wurde mitunter überzogen. Nicht zwingend war auch das eingeschobene Lied In der Nacht von Robert Schumann, nur um auf ein anderes Künstlerehepaar (Robert und Clara Schumann) hinzuweisen. Dass Killian Farrell Bremen verlässt, kann man nur bedauern. Seine opulente Wiedergabe mit punktgenauen dramatischen Zuspitzungen, mit süffigem Wohlklang und Sinn für Proportionen war eine Klasse für sich. Das kann man auch von Marie Smolka sagen, die als Nedda ohne Einschränkungen überzeugte. Mit ihrem silbrigen und kraftvollen Sopran, mit ihrer feinen Pianokultur und ihrer attraktiven Bühnenerscheinung ist sie ein großer Gewinn für das Bremer Theater.

Dass Claudio Otelli ein Sängerdarsteller von Format ist, hat er wiederholt bewiesen. Auch als Tonio überzeugte er mit Präsenz und sehr höhensicherem Bariton. Luis Olivares Sandoval sang den Canio durchweg ansprechend, auch mit viel Leidenschaft, blieb aber etwas hinter seinen Möglichkeiten zurück Einen guten Eindruck hinterließen auch Elias Gyungseok Han als Silvio und Diego Silva als Harlekin. Ein Sonderlob gebührt dem prachtvoll auftrumpfenden Chor in der Einstudierung von Alice Meregaglia.
Wolfgang Denker, 31.10.2021
Fotos von Jörg Landsberg
DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN
Premiere am 24.09.2021
Marko Letonja zaubert Poesie herbei

Diese Premiere wurde deutlich von einem Gefühl beherrscht - dem Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit des Publikums, endlich wieder live eine Oper im Theater erleben zu können, und Dankbarkeit der Künstler, wieder auftreten zu können und Beifall zu erhalten.
Da spielte es auch keine Rolle, dass keine der ganz populären Opern gegeben wurde. Aber Das schlaue Füchslein von Leoš Janáček ist ein liebenswertes Werk, das die Natur, den Wald, die Tier- und die Menschenwelt märchenhaft charakterisiert, das den ewigen Kreislauf des Lebens und die Harmonie der Natur schildert. Janáček gelang mit diesem Werk eine Art tschechischer „Sommernachtstraum“.
Für Bremens GMD Marko Letonja war es eine besondere Premiere, denn er dirigierte wegen Corona erst jetzt erstmals im Theater am Goetheplatz. Und es war auch seine erste Begegnung mit diesem Werk.

Das schlaue Füchslein hat ungewöhnlich viele rein orchestrale Anteile - die Oper wird fast mehr vom Orchester als von den Sängern getragen. Die Bremer Philharmoniker spielen in reduzierter Besetzung die gut durchhörbare, mitunter kammermusikalisch feine Fassung von Jonathan Dove. Aber man vermisst nichts. Marko Letonja musiziert den vielfarbigen Orchestersatz mit strömendem Wohlklang und, setzt die dem Tonfall der Sprache abgelauschte Rhythmik präzise und delikat um. Den zahlreichen Zwischenspielen sichert er reiche Ausdruckskraft. Stets erklingt die Musik natürlich und absolut organisch. Letonja ist es, der die Poesie herbeizaubert und den Kreislauf der Natur in der Musik verdeutlicht.

Und das ist gut so, denn Regisseurin Tatjana Gürbaca schließt Natur und Wald völlig aus. Als Spielfläche dient eine schiefe Ebene (Bühne von Henrik Abt), die wie eine kleine Zirkusarena aussieht. Auf der Rückseite ist ein vollgestopftes Wohnzimmer als Dachs- bzw. Fuchsbau zu sehen. Die nicht unbedingt schönen Kostüme von Silke Willrett machen zwischen Mensch und Tier kaum Unterschiede. Für das Füchslein reicht ein rot-braunes Kleid. Die Hühner mutieren zu einer Art Zirkuskapelle. Eigentlich bilden Tier- und Menschenwelt einen großen Kontrast, aber Gürbaca hat die Grenzen beider Welten (ganz im Sinne Janáčeks) aufgehoben. Sie verschmelzen sogar, wenn der Förster und das Füchslein sich einen innigen Kuss geben. Hübsch wird das Liebeswerben des Fuchses um die Füchsin ausformuliert. Man hätte sich die Personenführung noch prägnanter, vielleicht auch humorvoller vorstellen können. Aber es gelingt Gürbaca szenischen Kreis zu schließen. Am Beginn und am Ende turnt eine Akrobatin an Tuchbahnen und die Äpfel kullern aus der Tasche des Försters. Der stirbt allerdings nicht im Einklang mit der Natur, so ist der Eindruck, sondern in einsamer Endzeitstimmung.

Die Sängerleistungen bewegen sich durchweg auf hervorragendem Niveau. Marysol Schalit als selbstbewusstes Füchslein, Christoph Heinrich als kantiger Förster und Nadine Lehner als eleganter Fuchs prägen die Aufführung nachhaltig. In weiteren Partien bewähren sich u. a. Stephen Clark als Landstreicher, Christian-Andreas Engelhardt als Schulmeister, Daniel Eggert als Dachs und Pfarrer sowie Ulrike Mayer als Försterin.
Wolfgang Denker, 26.09.2021
Fotos von Jörg Landsberg
L’ ITALIANA IN ALGERI
Premiere am 12.06.2021
Gute Laune in der Abenddämmerung

Eigentlich sollte die zweiaktige Oper L’ Italiana in Algeri („Die Italienerin in Algier“) von Gioachino Rossini schon als Silvester-Premiere im Theater am Goetheplatz für gute Laune sorgen. Die Aufführung im Theater hat Corona bekanntlich verhindert, nicht aber die gute Laune, die die verspätete Premiere - jetzt im Theatergarten - bescherte. Der Theatergarten ist der Ort, an dem sich früher das Stadttheater befand, bevor es 1944 ausgebombt wurde.
Der Regisseur Josef Zschornack und die musikalische Leiterin Alice Meragaglia haben dazu eine eigene Fassung erarbeitet. Die eigentlich über zweistündige Oper wurde auf pausenlose 90 Minuten verkürzt, indem u. a. sämtliche Rezitative gestrichen wurden. Zudem wurden einige Retuschen im italienischen Text vorgenommen, weil man Begriffe wie „Muselman“ nicht stehen lassen wollte…
Überhaupt ist der Bezug zu Algerien hier völlig eliminiert.

Der Ort der Handlung wird beliebig und nicht mehr festgelegt. Mustafa ist hier kein Sultan sondern der Besitzer von einem Kiosk, der die Leute mit Getränken und Snacks versorgt. Hier geht es nicht mehr um ein orientalisches Märchen, sondern um die wechselseitigen Beziehungen der Charaktere, die ort- und zeitlos sind. Das ist Regisseur Josef Zschornack ganz gut gelungen. Und er setzt auch eigene Akzente: Elvira ist nicht die verstoßene Ehefrau, die am Ende zu ihrem Mann zurückkehrt und sich in ihr Schicksal fügt. Vielmehr gelingt es ihr, Mustafa den Kiosk abzuluchsen, dessen Besitzerin sie dann wird. Mustafa hat im wörtlichen Sinne die Pappnase auf.
Den Kiosk hat Bühnenbildnerin Carla Maria Ringleb farbenfroh und liebevoll ausgestattet, ebenso gefallen die Kostüme von Kristin Herrmann. Nur am Anfang treten die Solisten mit Masken auf, damit wir Corona nicht ganz vergessen.

Musikalisch war die Beschränkung der Bremer Philharmoniker auf ein nur elfköpfiges Ensemble schon ein kleiner Wermutstropfen. Da hätte man sich oft mehr Streicher und einen üppigeren Klang gewünscht. Aber Alice Meragaglia hat aus den Gegebenheiten das Beste gemacht. Wie sie die Musik mit rhythmisch sicherem Zugriff und mit ausgefeilten Akzenten umsetzte, verdient Bewunderung. Selbst das irrwitzige Finale des 1. Aktes wackelte an keiner Stelle.
Gesanglich standen vor allem Hyojong Kim als Lindoro und Nathalie Mittelbach als Isabella für das hohe Niveau der Aufführung. Mittelbach hatte gleich bei ihrem effektvollen Auftritt mit „Cruda sorte“ einen fulminanten Einstand. Sie ließ ihren beweglichen, ausdrucksvollen Mezzo in allen Lagen funkeln und spielte gekonnt mit den dunklen Farben des Brustregisters. Kim setzte mit seinem lyrischen Tenor von ausgesprochen schönem Timbre die Liebessehnsucht des Lindoro in strömenden Klang um. Nicht nur sein tragfähiges Piano sorgte für bezaubernde Momente.

Auch Stephen Clark erfüllte mit Bühnenpräsenz und viel Spielfreude die Partie des Mustafa sehr ansprechend. Sein schlanker Bass zeichnet sich durch Agilität und markanten Klang aus. Mustafas Ehefrau Elvira fand in María Martín Gonzáles eine persönlichkeitsstarke Interpretin mit leuchtenden Spitzentönen. Mariam Murgulia als Zulma, Diego Savini als Matteo und Alberto Gallo als Haly rundeten die Ensembleleistung ab.
Wolfgang Denker, 13.06.2021
Fotos von Jörg Landsberg
PRESSEKONFERENZ ZUR SPIELZEIT 2020/21
am 19.06.2020
Behutsame Planung
Die Pressekonferenz am 19.06.2020 zur Spielzeit 2020/21 vermittelte schon mal eine Vorstellung davon, wie es im Bremer Theater demnächst aussehen könnte. Jede zweite Stuhlreihe war entfernt und zwischen den einzelnen Zuhörern mussten mindestens zwei Sitze frei bleiben. Die Kapazität wird durch diese Maßnahme von über 800 auf nur noch 103 Plätze reduziert. Intendant Michael Börgerding erläuterte seine Pläne für das Musiktheater, das Schauspiel, die Tanz-Sparte und das Jugendtheater auch erst bis zum 31. Dezember. Danach ist noch alles offen - davor aber eigentlich auch. Aus diesem Grund gibt es auch noch kein gedrucktes Jahresheft für die gesamte Spielzeit. Das Motto für die neue Saison stand aber schon lange vor Corona fest: „Neue Realitäten“ - passender könnte es nicht sein.
Eröffnet wird mit einer Gala Mit Abstand das Schönste (13.9.), bei der das Ensemble Arien, Duette und Terzette serviert - alles mit Klavierbegleitung. Es folgt am 1. 10. von Francis Poulenc La voix humaine (Die menschliche Stimme) mit Nadine Lehner, am Klavier begleitet von Killian Farell (1.10.).

Imagine (17.10.) ist ein Lieblingsprojekt von GMD Yoel Gamzou. Dabei handelt es sich um einen von Tom Ryser szenisch eingerichteten John-Lennon-Liederabend. Michael Talke wird Papageno erfindet die Zauberflöte (7.11.) inszenieren. Bei dieser „kleinen Fassung einer großen Oper“ führt Schauspieler Simon Zigah als Papageno durch das Geschehen.
Mit einer halbszenischen Produktion von Rossinis L’ Italiana in Algeri (11.12.), die musikalisch von Alice Meregaglia geleitet und szenisch von Martin G. Berger betreut wird, endet die behutsame Planung. Was und in welcher Form in der zweiten Spielzeithälfte möglich sein wird, hängt sicher auch von den dann gemachten Erfahrungen ab.
Wolfgang Denker, 20.06.2020
Foto von Jörg Landsberg
Wolfgang Rihm
JAKOB LENZ
Premiere am 30.01.2020
Sezierung einer Seele
Dieser Opernabend mit Jakob Lenz von Wolfgang Rihm wirkt lange nach und dürfte sich bei den meistern Zuschauern tief ins Gedächtnis gebrannt haben. Und das aus mehreren Gründen: Zum einen ist da die singuläre Leistung von Claudio Otelli in der Titelpartie, zum anderen sind es die Inszenierung von Marco Štorman und die Bühnengestaltung von Jil Bertermann, die für beklemmende, intensive Hochspannung von der ersten bis zur letzten Sekunde sorgen. Und es ist natürlich die Begegnung mit dem ungewöhnlichen Werk von Wolfgang Rihm, das die Bezeichnung Kammeroper trägt, aber die Anforderungen und Qualitäten eines Schauspiels mit denen einer Oper verbindet.

Jakob Lenz (1751-1792) war ein Sturm-und-Drang-Dichter. Sein Vater war Pfarrer und auch Lenz studierte zunächst Theologie, brach das Studium aber ab, was zu einem Bruch mit dem Vater führte. Lenz machte die Bekanntschaft von Goethe und gewann zeitweilig dessen Freundschaft. Der psychische Zustand von Lenz verschlechterte sich. Deshalb besuchte er den Pfarrer Oberlin, um sich dort zu erholen. Oberlins Aufzeichnungen waren die Grundlage von Georg Büchners Erzählung „Lenz“, diese wiederum für Rihms 1979 in Hamburg uraufgeführte und aus dreizehn Szenen bestehende Oper.
Jil Bertermann hat auf der eigentlichen Bühne ein „anatomisches Theater“ gebaut. Dieses besteht aus steil ansteigenden Rängen in kreisrunder Anordnung und orientiert sich an dem heute noch zu besichtigenden anatomischen Theater, das 1594 in Padua gebaut wurde.

Damals wurden dort Leichen öffentlich obduziert. Bei „Jakob Lenz“ ist es die Seele der Titelfigur, die „seziert“ wird. Lenz befindet sich in einer lebensbedrohenden Krise. Die Loslösung vom Vater, der Zweifel an seinem eigenen Schaffen, die Konflikte mit der Religion und nicht zuletzt die Suche nach seiner Stellung in der Gesellschaft, von der er sich unverstanden fühlt, sind gebündelte Faktoren, die ihn dem Wahnsinn näher rücken. Und dann ist da noch seine unerwiderte Liebe zu Friedrike Brion, die er tot wähnt. Diese Friederike wird von Sibylle Bülau verkörpert und erinnert in ihrem Aussehen etwas an Hildegard Hamm-Brücher. Sie sitzt stumm im eigentlichen Zuschauerraum, ihre Erscheinung wird mittels Kamera auf eine Leinwand übertragen. Am Ende kommen Jakobs Freund Kaufmann und der Pfarrer Oberlin zu dem Schluss, dass Lenz nicht mehr zu helfen sei.
Die Bariton-Partie des Lenz ist eine Mammutaufgabe. Sie ist stilistisch ein wenig mit der des Wozzeck vergleichbar. Sie wechselt zwischen Gesang, Sprechgesang und gesprochenem Wort - mit häufigen Ausflügen in die Kopfstimme.

Claudio Otelli bewältigt diese Partie in geradezu sensationeller Weise. Sein Porträt einer zerfallenden Seele ist von atemberaubender Intensität. Da wird jede Nuance in Spiel und Stimme zum Ereignis. Seine expressive Gestaltung und seine physische Präsenz sind über die gesamte Spieldauer von 75 Minuten gefordert. Toll! Die vergleichsweise kleineren Partien von Oberlin und Kaufmann werden von dem Bassisten Christoph Heinrich und dem Tenor Christian-Andreas Engelhardt ebenfalls mit Bravour und reichem Ausdruck gestaltet.
Regisseur Marco Štorman ist das Kunststück gelungen, das an äußerer Handlung eigentlich arme Stück trotzdem zu einem Theaterabend voll berstender Spannung zu formen. Die kreisrunde Spielfläche wirkt wie eine Zirkusarena, die zwischendurch auch mit Wasser gefüllt wird. Die inneren Stimmen, von denen Lenz quälend heimgesucht wird, werden von sechs Sängerinnen und Sängern des Chors ausgefüllt. Mal erscheinen sie auf den Tribünen, mal hinter dem Orchester. Auch der Kinderchor, deren Mitglieder wie Doubles von Lenz wirken, hat symbolträchtige Aufgaben.

Rihm hat bei seiner Musik mit vielen Zitaten gearbeitet. Der Rhythmus einer Sarabande tönt auf, ebenso ein Ländler. Es gibt Anklänge an Choräle und Motetten. Sogar das Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ wird zitiert.
Das von Killian Farrell geleitete Orchester besteht aus elf Musikern der Bremer Philharmoniker: Drei Celli, zwei Oboen, Kontrafagott, Fagott, Trompete, Posaune, Schlagwerk und Cembalo. Die vielschichtige Musik von Rihm wird hier optimal zum Klingen gebracht, insbesondere in den verschieden Zwischenspielen. Ein nachhaltiger und das Publikum fordernder Opernabend, den man sich nicht entgehen lassen sollte!
Wolfgang Denker, 02.02.2020
Fotos von Jörg Landsberg
ALCINA
Premiere am 10.11.2019
Der Machtverlust einer Zauberin
Die Oper Alcina (1735) von Georg Friedrich Händel ist lang. Auch in Bremen dauert sie trotz einiger Kürzungen (die Figur des nach seinem Vater suchenden Oberto taucht z. B. gar nicht auf) noch immer fast dreieinhalb Stunden. Und bei der Bauart des Werkes, bei dem es praktisch keine Ensembleszenen gibt und sich „nur“ eine Arie an die andere reiht, sind Längen vorprogrammiert. Dabei gibt die Handlung eigentlich viele Gelegenheiten für „barocken Zauber“: Sie basiert auf einer Episode aus Ludovico Ariosts „Orlando furioso“, einem Abenteuerroman des 16. Jahrhunderts, und spielt auf einer von der Zauberin Alcina beherrschten Insel.

Alcina verführt ihre Liebhaber scharenweise und verwandelt sie, wenn sie ihrer überdrüssig wird, in Tiere, Steine oder Blumen. Auch Ruggiero verfällt ihr und verlässt für sie seine Verlobte Bradamante. Bradamante und ihrem Vertrauten Melisso gelingt es aber mittels eines Gegenzaubers, Ruggiero aus Alcinas Reich zu befreien und für ein glückliches Ende zu sorgen. Auch Alcinas Schwester Morgana und ihr Geliebter Oronte finden nach diversen Eifersüchteleien dauerhaft zusammen. Alcina ist die Verliererin, die Macht, Glück und Jugend einbüßt.
Regisseur Michael Talke betont in seiner Inszenierung nicht in erster Linie den Aspekt der „Zauberoper“, sondern sieht das Werk vor allem als philosophisches Psychogramm. Denn das Handlungsgerüst ist aus seiner Sicht eigentlich nur die Klammer für die vielen Affekte, die in Händels Arien ihren Ausdruck finden: Liebe, Verlustangst, Eifersucht, Kränkung, Wut, Enttäuschung, Macht, Ohnmacht und vieles mehr. Trotzdem bleibt die Imagination einer Zauberwelt erhalten. Dafür stehen auch die Bühnenbilder von Thilo Reuther.

Er hat sich bei seiner Konzeption von dem niederländischen Maler Otto Marseus van Schrieck inspirieren lassen, der für seine Stilleben bekannt geworden ist. Oft zeigen seine Bilder üppige Blüten einerseits, Zerfall und Morast andererseits. Dieser Naturwelt stellt Reuther mit dem Gerüst eines Einfamilienhauses eine bürgerliche Welt (die von Ruggiero und Bradamante) gegenüber. Auch ein Schiff, mit dem man die Insel erreicht (und wichtiger: auch wieder verlässt) ist zu sehen. Und immer wieder laufen Menschen mit Tierköpfen durch die Szene - die dunkle Kehrseite von Alcinas Zauberwelt.
Talkes Personenführung ist stets lebendig und besonders bei Morgana von viel tänzerischer Bewegung geprägt. Anschaulich werden Alcinas Verführungsmechanismen gezeigt, wenn sie Ruggiero eine Blume zuwirft (wie Carmen dem Don José) und der ihr fasziniert in ihr Reich folgt. Den Untergang von Alcinas Reich verdeutlicht Talke sehr eindringlich.

Auf der Bühne sind alle farbenfrohen Blüten verschwunden, dafür hängt ein riesiges, bedrohliches Insekt vom Schnürboden herab. Und auch die vorher bonbonfarbenen Kostüme (von Regine Standfuss) haben allen Glanz verloren. Alcina sieht fast wie ein gerupftes Huhn aus. Und wenn ihr auch noch die Perücke heruntergerissen wird und sie kahlköpfig dasteht, ist sie nur noch ein Bild des Jammers. Hier wird deutlich: Alcina ist eine tragische Figur. Sie wird sich durch den Verlust des Geliebten ihres Alterns bewusst. Was bleibt, ist ein alternder, einsamer Mensch. Einen kleinen Schlussgag gönnt sich Talke auch. Nachdem Alcina im Wasser entsorgt wurde, taucht sie wieder auf, streut Blumen und lockt jetzt Bradamante in ihr neues Reich. Siegt nun die Vernunft (Ruggiero) oder das Gefühl (Alcina)?
Musikalisch glänzt die Sängerschar mit einem Feuerwerk der Koloraturen. Marysol Schalit kann als Alcina alle Facetten der Figur in virtuosen Gesang umsetzen. Auch Ulrike Mayer ist mit ihrem schönen Mezzo ein sehr präsenter, technisch versierter Ruggiero. Einen guten Eindruck hinterlässt auch die Gastsängerin Candida Guida als Bramante, auch wenn ihr die Koloraturen nicht ganz so leichtfüßig gelingen.

Einfach bezaubernd ist Nerita Pokvytyté als Morgana. Ihr Charme und ihre stimmliche Brillanz rücken die Rolle ganz in den Vordergrund. Und die Kabbeleien mit ihrem Liebhaber Oronte machen einfach Vergnügen. Diesen Oronte singt Luis Olivares Sandoval. Eigentlich ist Barockmusik nicht unbedingt seine Domäne, aber er findet sich mit seinem ausdrucksvollen Tenor gut in die Musik Händels ein. Den Melisso gestaltet der Bassist Stephen Clark mit schlanker Tongebung und durchweg überzeugend.
Am Pult der Bremer Philharmoniker kann Marco Comin mit kluger Disposition und einem gut austarierten Händel-Klang gefallen.
Wolfgang Denker, 11.11.2019
Fotos von Jörg Landsberg
JUAN DIEGO FLÓREZ
Konzert am 05.11.2019
Neue Farben in der Stimme

Einen weiteren Glanzpunkt (nach Elina Garanča) bescherte Juan Diego Flórez in der diesjährigen Reihe „Glocke Vokal“. Flórez, der schon bei seinem Bremen-Debüt vor fünf Jahren im Rahmen des Musikfestes mit einem Liederabend begeisterte, kam diesmal in großer Besetzung mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und mit etwas anderem Repertoire. Rossini, Bellini oder Donizetti tauchten nicht im Programm auf. Im Mittelpunkt standen statt dessen Werke von Giuseppe Verdi - klugerweise die leichteren Partien wie der Duca im „Rigoletto“, der Alfredo in „La Traviata“ oder der Oronte in „I Lombardi“. Das sind Partien, die zu seiner stimmlichen Entwicklung, nämlich zu einer substanzreicheren Mittellage, perfekt passen. Die Leichtigkeit seiner Höhe und die geschmeidige Agilität seines Tenors hat Flórez sich bewahrt.
Gleich die Ballade des Herzogs „Questa o quella“ singt Flórez mit siegesgewissem Charme und großer Eleganz. „Ella mi fu rapita…Parmi veder le lagrime“ (auch aus „Rigoletto“) verlangt emotionale Tiefe und viel Legato. Beides erfüllt Flórez glanzvoll. Die Schlussphrase versieht er sogar mit einem Triller. In Duktus und Aufbau ähnlich ist die Arie „Lunge da lei“ aus „La Traviata“. Auch hier überzeugt Flórez mit feinster Phrasierung und der Wärme seines Tenors. Bei der Cabaletta lässt er es mit fulminanten Spitzentönen virtuos „krachen“. Mit Ausschnitten aus „Attila“, „I Lombardi“ und „I due Foscari“ kommt auch der frühe und mittlere Verdi zu Wort. Die schmerzvolle Romanze des Foresto (aus „Attila“) gestaltet Flórez mit effektvollen, lang ausgehaltenen Spitzentönen. Bei der Arie „Brezza del suol natio“ und der anschließenden Cabaletta aus „I due Foscari“ zeigt er expressive Dramatik.
Das von Jader Bignamini kompetent und spannungsvoll geleitete Orchester steuert in diesem ersten Teil neben der Ouvertüre zu „Nabucco“ und dem Vorspiel zu „La Traviata“ als Rarität die noch an Donizetti erinnernde Ouvertüre zu „Un giorno di regno“ bei - ein schwungvolles, hier sehr spritzig musiziertes Stück.. Im zweiten Teil gibt es dann noch den Ungarischen Marsch aus „La damnation de Faust“ und das Intermezzo aus „Cavalleria rusticana“.

Dieser zweite Teil wird mit den bekanntesten Lehár-Schlagern eröffnet: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Gern hab’ ich die Frau’n geküsst“ und „Freunde, das Leben ist lebenswert“. Aber hier ist Flórez nicht wirklich zu Hause. Er zieht sich zwar achtbar aus der Affäre, aber die Kraft in der Mittellage reicht nicht ganz. Dafür ist er bei „Pourquoi me réveiller“ aus „Werther“ wieder ganz in seinem Element, da stimmt einfach alles. Auch die „Blumenarie“ aus „Carmen“ serviert Flórez mit viel Gefühl, mit viel Ausdruck und einem wunderschönen Piano am Schluss. Glanzstück ist aber „Che gelida manina“ aus „La Boheme“, das so leicht und schwärmerisch erklingt, wie man es selten hört.
Ohne Zugaben lässt das Publikum Flórez natürlich nicht gehen. Insgesamt sechs Zugaben werden es! Und die sind überraschend und sorgen für eine ganz intime Stimmung. Flórez setzt sich nämlich auf einen Stuhl und begleitet sich selbst auf der Gitarre. Der Tango „El dia que me quieras“ (von Carlos Gardel) ist ebenso dabei wie „Cielito lindo“ (von Cortés) oder „Cucurrucucú paloma“ (von Tomás Mendéz). Das sind wahrhaft beglückende und bezaubernde Momente. Zum Ende (dann wieder mit Orchester) zwei Nummern, die wohl jeder gern singt: „Granada“ (von Agustin Lara) und „Nessun dorma“ (aus „Turandot“). Tenor bleibt eben Tenor.
Wolfgang Denker, 06.11.2019
Fotos von Kay Michalak
DON GIOVANNI
Premiere am 20.10.2019
Das Ende einer Drogenkarriere
Don Giovanni ist krank, sehr krank. Er hustet Blut und ist auch noch drogensüchtig. Am Beginn ist das noch gar nicht so klar - da kommen Don Giovanni und Leporello eher wie halbstarke Rotzlöffel daher, die ihre Pubertät noch nicht überwunden haben. Aber wenn die Hustenattacken immer stärker werden und das Blut auf Don Giovannis Hemd nicht mehr zu übersehen ist, wird es deutlich: Hier geht ein armer Teufel jämmerlich zu Grunde.

Regisseurin Tatjana Gürbaca hat in ihrer Bremer Inszenierung eine ganz eigene Sicht auf Mozarts Don Giovanni entwickelt. Vom „Mythos Don Giovanni“ bleibt dabei nicht viel übrig. Auch Zeit und Ort bleiben offen. Klaus Grünberg schuf einen Bühnenraum, der auch für Samuel Becketts „Warten auf Godot“ passend gewesen wäre: Eine einsame Straße durch ein Feld mit Kohlköpfen, die aus dem Nichts kommt und ins Nichts führt. An einer Biegung unter einer Straßenlaterne spielt der gesamte „Don Giovanni“. Eine nächtliche Endzeitstimmung mit viel Regen wird hier beschworen. Eine Grube für den Komtur und Don Giovannis Höllenfahrt ist auch schon ausgehoben. Aber eine richtige Höllenfahrt wird es am Ende nicht, eher eine ordentliche Beerdigung mit Trauergästen.

Den Gedanken, Don Giovanni als Außenseiter der Gesellschaft zu sehen, der den Tod vor Augen hat und sich in jeden ausschweifenden Exzess stürzt, zieht Gürbaca konsequent durch. Ob er seine erotischen Obsessionen wirklich erlebt oder ob sie nur in seinem Drogenrausch existieren, bleibt offen. Der Ansatz ist durchaus interessant, aber über die Details kann man streiten. Müssen Don Giovanni und Leporello ständig die Hosen fallen lassen? Feinripp-Paraden hat man in den letzen Jahren wirklich zur Genüge gesehen. Manche Dinge sind einfach übertrieben und nervig, etwa Leporellos ständiges Gezappel, wodurch die Wirkung der Champagner-Arie sogar beschädigt wird. Und wenn Leporello Zerlinas skurrile Hochzeitsgesellschaft wie ein Sandmännchen mit seinem Rauschgiftpulver bestreut, mündet das sofort in eine Massenorgie.

Hinter Donna Annas Fassade schlummert ein erotischer Vulkan. Mit verbundenen Augen wird sie von Don Giovanni herbeigeführt und lässt sich bereitwillig die Strumpfhose ausziehen. Der biedere Don Ottavio genügt ihr offenbar nicht. Später greift auch sie zum Joint. Dass Donna Elvira ihren Don Giovanni unbedingt zurück haben will, ist verständlich - immerhin ist sie von ihm schwanger. Leporello und Don Giovanni gebärden sich durchweg lärmend und wie völlig durchgeknallte Typen, wobei letzterer auch schon mal wie in einem Horror-Film mit der Axt durch die Gegend rennt. Das berühmte Ständchen singt Don Giovanni allerdings nicht für eine Frau, sondern für den Komtur. Ihn bittet er, sein Fenster (zum Tod) zu öffnen.
Birger Radde als Don Giovanni und Christoph Heinrich als Leporello machen ihre Sache gut. Radde singt mit virilem Bariton und spielt mit ausufernder Präsenz. Heinrich ist für dieses Konzept genau der richtige Partner. Mima Millo ist neu im Bremer Ensemble und gibt mit kraftvollem Sopran einen guten Einstand als Donna Anna. Patricia Andress ist die Donna Elvira und hinterlässt besonders mit ihrer Arie „Mi tradi quell’ alma ingrata“ einen nachhaltigen Eindruck.

Hyojong Kim beschert als Don Ottovio mit seiner Arie „Dalla sua pace“ reinsten Wohllaut. Schade, dass seine zweite Arie gestrichen war. Aufhorchen lässt KaEun Kim als Zerlina. Mit Anmut und silbrigem Sopranglanz rückt sie die Partie in den Vordergrund. Als Masetto löst Stephen Clark mit geschmeidigem Bass die Rolle aus dem Verlierer-Image. Obwohl bereits in den Ruhestand verabschiedet, kann man dem verdienstvollen Loren Lang hier noch einmal als Komtur begegnen. Der Chor (Alice Meregaglia) singt in bewährter Qualität.
Am Pult der Bremer Philharmoniker steht der vielseitige Hartmut Keil, der die Musik versiert aufblättert und die Sänger umsichtig begleitet. Die Balance zwischen „dramma“ und „giocosa“ wird gewahrt. Die wirklich wuchtige Dramatik spart er sich für das Finale auf.
Wolfgang Denker, 21.10.2019
Fotos von Jörg Landsberg
DER ROSENKAVALIER
Premiere am 20.09.2019
Mehr Triebe und Angst als Gefühle
Nachdem Richard Strauss die musikalische Welt mit „Salome“ und „Elektra“ in Erstaunen versetzt hatte, wurde ihm nach der Uraufführung des Rosenkavaliers 1911 von einigen Kritikern Anachronismus vorgeworfen.

Denn diese „Komödie für Musik“, geschaffen aus dem Geiste Mozarts, galt manchen als „Gipfel des Konservatismus“. Gleichwohl - Richard Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal haben hier ein zeitloses Meisterwerk geschaffen, eine Komödie, deren Akteure mit warmer, tief berührender Menschlichkeit gezeichnet sind. „Der Rosenkavalier“ ist bis heute die populärste Oper von Richard Strauss.
Konservatismus ist etwas, was man der Inszenierung von Frank Hilbrich gewiss nicht vorwerfen kann. Das betrifft die Regie und auch die Bremer Fassung des Rosenkavaliers. Denn von den über zwanzig Partien sind hier gerade mal acht übrig geblieben. Die Leitmetzerin, Annina, Valzacchi, der Haushofmeister, der Wirt, der Tierhändler und viele andere - sie treten hier nicht in Erscheinung. Auf die Spieldauer wirken sich diese Striche mit vielleicht insgesamt einer halben Stunde gar nicht mal so gravierend aus. Die Striche sind so geschickt gemacht, dass Zuschauer, die den Rosenkavalier noch nie gesehen haben, die „Amputationen“ wahrscheinlich nicht bemerken. Aber Hilbrich hat dadurch viel Beiwerk ausgemerzt, um sich ganz auf die Hauptpersonen zu konzentrieren. Und die zeichnet er anders, als man sie normalerweise erlebt.

Auch Zeit und Raum sind in seiner Inszenierung aufgehoben. Da gibt es kein Rokoko und kein höfisches Zeremoniell. Zentrales Thema ist das Bewusstsein der Endlichkeit des irdischen Daseins. Sebastian Hannak hat dazu einen abstrakten, zeitlosen Spielraum geschaffen, der wie ein Irrgarten anmutet, der mit mehreren, verschachtelten Ebenen arbeitet und einen ästhetisch sehr gelungen Rahmen bildet.
Zum Vorspiel, das die Liebesnacht zwischen der Marschallin und Octavian plastisch schildert, sieht man aus einer Art Schlüssellochperspektive, wie die beiden immer wieder übereinander herfallen. Überhaupt die Triebe: Octavian versucht gleich bei der ersten Begegnung mit Sophie, ihr an die Wäsche zu gehen. Hier keimt keine zarte Liebe auf, sondern man geht gleich zur Sache. Das tut auch der Baron Ochs auf Lerchenau, der alles andere als ein nur etwas derber Landedelmann ist. Hier tobt ein „tierischer“ Wüstling, der auch vor einer Vergewaltigung nicht zurückschreckt.

Sophie ist eigentlich nur Opfer, einerseits als Beute von Ochs, andererseits durch die Machenschaften ihres Vaters Faninal, der seine Tochter skrupellos verschachert. Die Marschallin ist keineswegs die souveräne Frau, die wehmütig und philosophisch abgeklärt auf den Lauf der Zeit blickt. Bei ihr ist es die nackte Angst vor dem Alter und vor dem Tod, die ihr Handeln und Denken bestimmt. Den Tod hat Regisseur Hilbrich als allegorische Figur eingefügt. Der heißt hier Hippolyte wie die stumme Rolle des Friseurs im Original. Er ist ständig gegenwärtig, belauert die Personen und wartet, bis seine Zeit gekommen ist. Und das ist dann am Ende auch so, wenn Octavian und Sophie zusammensinken und er in triumphales Gelächter ausbricht. Luis Olivares Sandoval verkörpert diese Figur, der neben einigen Stichworten vor allem auch die Arie des Sängers anvertraut ist und die gut bewältigt wird.
Nadine Lehner singt die Marschallin mit zunächst noch etwas harter Tongebung, die eher einer Elektra angemessen wäre. Aber das gibt sich schnell. Die Lebensangst der Marschallin verdeutlicht sie mit emotionalem Hochdruck, als ginge es stets um Leben oder Tod.

Tut es ja auch. Nathalie Mittelbach ist ein schönstimmiger und temperamentvoller Octavian, der seine Lebens- und Liebesgier kaum zu zügeln weiß. Nerita Pokvytyté bezaubert als Sophie mit ihrer Strahlenden Höhe. Das Terzett im 3. Akt gelingt den drei Sängerinnen so traumhaft schön, dass man Zeit und Raum vergisst. Patrick Zielke ist in jeder Rolle bühnenbeherrschend. Das gilt auch für seinen Ochs, den er als widerwärtigen Zeitgenossen anlegt, dem er aber stimmliche Wucht und Größe verleiht. Über sein unvorteilhaftes Kostüm (von Gabriele Rupprecht) muss man hinwegsehen. Christian-Andres Engelhardt gibt den Faninal mit gewohnter Prägnanz, Daniel Ratchev ist der Polizeikommissar und Jakob von Borries der Leopold.
Wie Yoel Gamzou und die Bremer Philharmoniker die teils rauschhafte, teils filigrane Musik von Richard Strass spielen, lässt keine Wünsche offen. Man spürt, mit welchem Herzblut er sich gerade diese Oper zueigen gemacht hat. Das Orchester nahm den begeisterten Beifall auf der Bühne entgegen.

Insgesamt überzeugt dieser im doppelten Sinne neue „Rosenkavalier“, auch wenn der Wiener Schmäh zugunsten eines gnadenlosen Blicks auf Existenzängste weichen musste. Aber das war vielleicht der Grund für die wenigen Buhrufe für die Regie.
Wolfgang Denker, 21.09.2019
Fotos von Jörg Landsberg
ELINA GARANČA
Konzert am 17.5.2019
Auf ungewöhnlichen Pfaden
Die Reihe „Glocke Vokal“ sorgt immer für besondere Leckerbissen. Dafür garantierte diesmal der Name Elina Garanča. Die lettische Mezzosopranistin gehört seit Jahren zu den absoluten Stars der Opernszene. Zu Beginn ihrer Karriere standen Mozart und das Belcanto-Fach im Mittelpunkt. Inzwischen ist ihre Stimme schwerer und dramatischer geworden - mit folgerichtiger Repertoireerweiterung. So ist die Titelpartie in „Carmen“ eine ihrer wichtigsten Rollen geworden. Aber sie widmet sich auch zunehmend den Partien von Verdi und denen des Verismo.
Die standen auch im ersten Teil des Konzerts in der Bremer Glocke auf dem Programm. Gleich mit der Arie der Eboli „Nel giardin del bello“ aus Verdis „Don Carlo“ zeigt sie mit einer kraftvollen, satten Mittellage alle Tugenden ihrer derzeitigen stimmlichen Verfassung. Ihr warmer, schöner Klang in allen Lagen begeistert ebenso wie ihre Fähigkeit, die Stimme nach wie vor beweglich führen und ein makelloses Piano formen zu können. Die Arie „Io son l’umile ancella“ aus „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea ist eigentlich für einen Sopran geschrieben. Aber Garanča bleibt ihr an strahlendem Höhenglanz nichts schuldig. Sie lässt die Stimme auf den Bögen der Melodie balsamisch strömen. Und das Crescendo am Ende ist atemberaubend. „O don fatale“, wieder aus „Don Carlo“, ist erwartungsgemäß ein „Knaller:“ Was sie hier an glutvoller Kraft und an ungebremsten Emotionen geradezu herausschleudert, dürfte nur wenigen Sängerinnen so packend gelingen. Und bei den großen Ausbrüchen wird die Stimme immer kontrolliert geführt. Da gibt es nicht die geringsten Schärfen im Klang.

Die NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Karel Mark Chichon begleitet hervorragend, setzt aber auch eigene Akzente. Neben der Ouvertüre zu „Luisa Miller“ und dem Intermezzo aus Puccinis „Manon Lescaut“, das Chichon sehr klangmächtig und schwelgerisch nimmt, ist auch die Ouvertüre zu „La Forza del Destino“ zuhören. Die taucht bei derartigen Anlässen fast immer im Programm auf, aber wenn sie wie hier so frei von Routine und so spannungsgeladen musiziert wird, ist man doch dankbar.
Nach der Pause hat Elina Garanča ihr grünes Kleid gegen ein feuerrotes getauscht. Nicht ohne Grund, denn die Musikstücke führen jetzt auf ungewöhnlichen Pfaden in südliche Gefilde. Sie finden sich auch auf ihrem aktuellen Album „Sol y Vida“, auf dem sie populäre Lieder vor allem aus Italien und Spanien singt. Einen roten Faden für das Programm gib es nicht, der Reiz liegt in der Abwechslung. Da stehen furios musizierte und einfach gute Laune verbreitende Orchesterstücke aus spanischen Zarzuelas neben der Canzone „Musica Proibita“, dem Lied „Ich liebe Dich“ von Edvard Grieg (hier immerhin in katalanischer Sprache) oder der schmissigen Ouvertüre „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé. Aber der Gesang von Elina Garanča adelt jedes Stück. Da wird bei „Lela“ aus „Os vellos non deben namorarse“ von Rosendo Mato Hermida die Tristesse um eine verlorene Liebe ebenso getroffen wie die träumerische Sehnsucht in „El dia que me quieras“ von Carlos Gardel. Beide Stücke sind so süffig orchestriert, dass man sich in einen Hollywood-Film versetzt fühlt. Bei der dramatischen und effektvollen Arie „No puede ser!“ aus der Zarzuela „La tabernera del Puerto“ von Pablo Sorozábal „wildert“ Garanča im Tenor-Repertoire, ebenso bei „Granada“, das sie als eine der Zugaben serviert. Frenetischer Jubel für eine große Sängerin und ein tolles Orchester.
Wolfgang Denker, 20.05.2019
Foto von Holger Hage / DG
DIE TOTE STADT
Premiere am 12.5.2019
Die Seele geht an Krücken
Korngold schrieb sein 1920 uraufgeführtes Meisterwerk Die tote Stadt im Alter von erst 23 Jahren. Stilistisch steht das Werk zwischen dem Verismo und Richard Strauss: Das üppig besetzte Orchester schwelgt in Klangfarben, die Nähe zu Puccini ist unverkennbar. Die Oper ist insgesamt äußerst melodisch; zwei Nummern sind richtige „Schlager“ geworden: Das gefühlvolle Lied des Pierrot „Mein Sehnen, mein Wähnen“ und Mariettas Lied „Glück, das mir verblieb“.

Die Handlung spielt in Brügge Ende des 19. Jahrhunderts und beschwört die Stimmung einer sterbenden, verödenden Stadt. Das korrespondiert mit den Seelenzuständen der Hauptfigur Paul, der den Tod seiner Frau nicht verarbeiten kann und für sie eine Kultstätte, die „Kirche des Gewesenen“, eingerichtet hat. Eigentlich ist er zu keiner neuen Beziehung fähig. Aber in der Tänzerin Marietta glaubt er, seine tote Frau wiedergefunden zu haben. In einem fieberhaften Traum erwürgt er Marietta; als er erwacht, ist er (bei Korngold) von seinem Trauma geheilt und für einen Neuanfang bereit.
Bei Armin Petras sind Pauls Aussichten eher trübe. Vielleicht ist er von seinem Trauma auch geheilt, weil er die Krücken ablegt, mit denen er sich bisher abstützte und bis zum Mord fast bewegungslos auf einem Podest verharrte. Aber sein Freund Frank entpuppt sich als Polizist, der Handschellen und Revolver bei sich trägt und ihn am Ende, nach dem realen Mord an Marietta, abführt. Am Ende tritt Marie wieder in Erscheinung, obwohl es bei Korngold eigentlich Marietta ist. Aber die wurde ja ermordet.

Armin Petras bezeichnet seine Inszenierung als „Installation“ und sieht sie als szenisches Oratorium. Entsprechend ist auch die Bühne gestaltet. Anklänge an den Schauplatz Brügge gibt es nicht. Das Orchester ist im hinteren Teil der Bühne postiert, der abgedeckte Orchestergraben dient mit als Spielfläche. Rundbögen bilden eine Art Kuppel, eine Kathedrale, in der sich vier lebensgroße Skulpturen der toten Marie befinden. Die Bühnengestaltung von Martin Werthmann ist eindrucksvoll gelungen. Die Farbmuster auf den Wänden sollen Abstraktionen vom zerbombten Aleppo sein. Das kann man allerdings nur dem Programmheft entnehmen, von selbst erschließt es sich nicht.

Das gilt auch für viele Einfälle dieser Inszenierung, die insgesamt etwas verrätselt und überfrachtet scheint, vom Auftritt des Kinderchores bis hin zum Einsatz der Tänzerinnen und Tänzer, die den Blumenschmuck plündern und sich in wilden Aktionen ergehen. Der optische Eindruck ist dabei aber stets von erlesener Ästhetik und übt große Faszination aus, auch wenn nicht jedes Detail der Regie unmittelbar verständlich ist. Immerhin liefern aber die allzu vielen, pausenlos laufenden Videos (von Rebecca Riedel) die Vorgeschichte und die Erklärung für Pauls Trauma: Marie kam bei einem Autounfall ums Leben, an dem Paul nicht ganz schuldlos beteiligt war.
Im Gegenzug ist einiges gekürzt worden, etwa die komödiantischen Szenen. Franks Lied „Mein Sehnen, mein Wähnen“ steht isoliert und ohne Zusammenhang da, aber das konnte man ja schlecht weglassen. Wäre auch schade gewesen, denn Birger Radde singt es mit viel Ausdruck und virilem Bariton. Als Paul ist Karl Schineis, der viele Jahre im Bayreuther Festspielchor gesungen hat, über weite Strecken überfordert. Seinem Tenor fehlt es an Schmelz und an der Kraft, über das zugegeben massive Orchester zu kommen.

Ein anderes Kaliber ist Nadine Lehner, die als Marietta die Lyrik ihres Liedes im 1. Akt mit fast hochdramatischer Expressivität im weiteren Verlauf verbindet. Man könnte sie sich gut als Salome vorstellen, denn auch tänzerisch glänzt sie mit totalem Einsatz. Nerita Pokvytyté als Erscheinung Maries und Nathalie Mittelbach als Pauls Haushälterin Brigitta machen ihre Sache ausgezeichnet.
Yoel Gamzou kostet am Pult die Kraft der Korngoldschen Musik rauschhaft und in vollen Zügen aus. Da knallen die Pauken, schmettern die Bläser und flirren die Geigen, dass es eine wahre Lust ist. Eine mit viel Beifall bedachte Leistung. Nur für die Regie gab es auch einige Buhrufe.
Wolfgang Denker, 13.5.2019
Fotos von Jörg Landsberg
DAS HOROSKOP DES KÖNIGS - L’ ÉTOILE
Premiere am 30.3.2019
Eine Oper im Geiste Offenbachs

Der Name des französischen Komponisten Emmanuel Chabrier (1841-1894) wird den meisten nur durch seine schmissigen Orchesterstücke wie etwa die Rhapsodie „Espaňa“ bekannt sein. Er schrieb aber auch mehrere Opern, darunter L’ Étoile („Der Stern“), die als
Das Horoskop des Königs - L’ Étoile Premiere hatte.
L’ Étoile wurde 1877 in Paris im Théâtre des Bouffes-Parisiens uraufgeführt. Das Publikum wusste über den Komponisten nur, dass er ein Anhänger Richard Wagners war. Das stufte seine Musik im Vorfeld als „unzugänglich und langweilig“ ein. Aber es gab wohlwollende Kritiken und auch das Publikum hatte seinen Spaß. Obwohl es in jüngerer Zeit auch Aufführungen in Berlin, Frankfurt, Augsburg und Amsterdam gab, ist L’ Étoile noch immer eine Rarität.

Hauptfigur ist König Ouf, der eine Diktatur errichtet hat, in der das Leben grau und trist ist, und der zur Volksbelustigung alljährlich eine Hinrichtung inszeniert. Diesmal soll es den Hausierer Lazuli treffen. Der deutsche Titel Das Horoskop des Königs ist da etwas aussagekräftiger, denn dieses Horoskop hat es in sich: Der Astrologe Siroco prophezeit dem König nämlich, dass er einen Tag nach dem Tod Lazulis ebenfalls sterben müsse. Und so wird Lazuli wie ein Staatsschatz behütet. Dazu gibt es auch ein paar Liebesgeschichten: Lazuli verliebt sich in die Prinzessin Laoula, die (mit einem Hubschrauber) in Begleitung des Fürsten Hérisson, dessen Ehefrau Aloès und des Sekretärs Tapioca in Oufs Königreich gekommen ist. Sie soll Ouf aus diplomatischen Gründen heiraten, was natürlich nicht klappt, weil sie mit Lazuli durchbrennt. Und Tapioca und Aloès kommen sich auch näher. Ouf und Hérisson müssen am Ende gute Miene zum bösen Spiel machen.

Für Bremen „entdeckt“ hat Yoel Gamzou das Werk. Er sah es in Amsterdam und hat sich spontan dafür begeistert. Ihm und dem Regisseur Tom Ryser ist eine unglaublich leichtfüßige, beschwingte Umsetzung dieser sehr an Offenbach erinnernden musikalischen Komödie gelungen. Das Bühnenportal ziert ein riesiger, goldener Bilderrahmen und signalisiert, dass wir uns in einem Märchen befinden - ein Märchen allerdings, das von Ironie, Spott und schwarzem Humor von Anfang bis Ende durchzogen ist. Ausstatter Stefan Rieckhoff schuf dazu ein Bühnenbild, das auf zwei Ebenen angelegt ist, die mit einem (oft benutzten) Fahrstuhl verbunden sind. Wir befinden uns in einem Hotel, mal aber auch auf der Strasse davor. Der Erzähler Martin Baum, der spielend und erläuternd perfekt durch die Handlung führt, trägt die Livree eines Hoteldieners. Die (stark eingekürzten) Dialoge werden deutsch gesprochen, bei den Musiknummern blieb man beim französischen Original.

Rysers Regie hat sich ganz auf die geradezu süffige Musik eingestellt. Da wird jede Bewegung, jede tänzerische Nuance mit dieser in Einklang gebracht. Und er denunziert die Figuren nicht zu Knallchargen, sondern sichert sogar dem eigentlich „bösen Despoten“ Ouf durchaus Sympathien.
Dass diese Produktion so begeisternd ausgefallen ist, hat man auch Yoel Gamzou und den Bremer Philharmonikern zu danken. Denn Gamzou gelingt es, die Qualitäten, die Feinheiten und den Witz von Chabriers Musik mit jedem Takt zu verdeutlichen. Raffinierte Rubati, überschäumendes Temperament und ironische Akzente, etwa bei dem Can Can, bei dem Kitzel-Terzett oder dem mit viel Nieserei angereicherten Couplet von Lazuli. Ganz bezaubernd ist das Kuss-Quartett, bei dem die beiden Paare sich ihre Liebe gestehen.

Getragen wird die Aufführung von einer hervorragenden Ensemble-Leistung. Louis Olivares Sandoval gibt dem König Ouf mit rundem Tenor schöne Klangfarben und überzeugt mit jovialer, aber nur vordergründiger Freundlichkeit auch komödiantisch. Ulrike Mayer kann mit samtenem Mezzo und bemerkenswertem körperlichen Einsatz als Lazuli begeistern. Auch Nerita Pokvytyté als Laoula und Iryna Dziashko als Aloès erweisen sich mit viel Sopranglanz als erstrangige Besetzung. Joel Scott als stimmfrischer Tapioca, Christoph Heinrich als skurriler Astrologe und Christian-Andreas Engelhardt als umtriebiger Fürst Hérisson tragen entscheidend zum Vergnügen bei. Bestens disponiert präsentiert sich der von Alice Meregaglia einstudierte Chor.
Wolfgang Denker, 31.3.2019
Fotos von Jörg Landsberg
LULU
Premiere am 27.1.2019
Im Irrgarten der Obsessionen

Alban Bergs unvollendet gebliebene Oper Lulu, zwei Jahre nach Bergs Tod 1937 in Zürich uraufgeführt, zählt zu den absoluten Meisterwerken des 20. Jahrhunderts und stellt große Anforderungen - an die Ausführenden und auch (immer noch) an das Publikum.
Den 3. Akt konnte Berg nicht mehr vollenden, er liegt nur als Particell vor. 1979 schuf Friedrich Cerha eine komplette Instrumentierung des 3. Aktes. Und in Bremen sorgte nun Detlef Heusinger für eine neue Fassung. Dazu führt er als zusätzliche Instrumente ein Theremin (elektronisches und berührungslos gespieltes Instrument), E-Gitarre, Synthesizer und Hammondorgel ein. Da klingt „bedrohlich“, aber diese Zutaten fügen sich überraschend gut in den jetzt reduzierten Orchesterklang ein, wenn man von den etwas geisterhaft wimmernden und surrealen Tönen des Theremins einmal absieht. Heusinger ist jedenfalls insgesamt eine klanglich und strukturell überzeugende Version gelungen, die Bestand haben dürfte.

Die Inszenierung von Marco Štorman zeichnet sich durch eine äußerst ästhetische, dabei abstrakte Sichtweise aus. Alle realistischen Zutaten bleiben ausgespart. Auch der Selbstmord des Malers und die tödlichen Schüsse auf Dr. Schön werden nur angedeutet, hier mit rotem Konfetti für das spritzende Blut. Das Bühnenbild von Frauke Löffel zeigt einen in ruhigem Tempo rotierenden Irrgarten mit beweglichen, teils durchsichtigen und teils spiegelnden Wänden. Es ist ein Irrgarten der Obsessionen, in dem sich Lulus Verehrer verlieren. Dieser Irrgarten wird im Verlauf des Abends immer durchlässiger bis nur noch das nackte Gestänge übrig bleibt. Die Männer sehen mit ihren schwarzen Anzügen (Kostüme von Sara Schwartz) alle gleich aus (auch die Gräfin Geschwitz) - wie Variationen von Dr. Schön, der in Lulus Leben die zentrale Rolle spielt. Schigolch ist in Štormans Inszenierung eine Art Spielmacher, dem auch die einleitenden Worte „Hereinspaziert in die Menagerie“ übertragen werden, die eigentlich der Tierbändiger zu sagen hat.

Mit Aujust (verkörpert von dem Tänzer Sami Similä) wird ihm ein Gehilfe an die Seite gestellt, der einen skurrilen Tanz in diesem Labyrinth vollführt. Lulu selbst ist in ihrem langen, hoch geschlossenen und geradezu züchtigen Kleid alles andere als aufreizend. Es sind die Phantasien der Männer, die sie zum begehrten Lustobjekt machen. Lulu zählt zu den rätselhaften, mystischen Operngestalten, wie etwa auch Carmen und Kundry, deren Charakter viele Deutungen zulassen. Bei Štorman ist Lulu weniger die gefühllose Täterin, vielmehr das Opfer, an dem die Männer allerdings bis hin zum Wahnsinn zerbrechen. Ihre Träume zerplatzen so wie die hier auch gezeigten Seifenblasen.
Štormans Konzept überzeugt zunächst durch die Konsequenz und Kühle der Bilder, durch Kunsthandwerk im besten Sinne. Allerdings trägt es nicht unbedingt drei Akte lang und wirkt gegen Ende etwas ermüdend, zumal die eigentliche Handlung nur schwer nachvollziehbar wird. Störend sind die immer wieder ins Publikum blendenden Scheinwerfer.

Die musikalische Seite ist atemberaubend gut gelungen. Allen voran begeistert Marysol Schalit in der Titelpartie. Ihre differenzierte Ausgestaltung fesselt mit glasklarer Stimme, die keine technischen Grenzen zu kennen scheint. Claudio Otelli verleiht mit seinem markanten Bariton den Dr. Schön außergewöhnlich starkes Profil. Aber auch Chris Lysack beeindruckt, wie er seinen Tenor mit berstender Expressivität führt. Beste Leistungen gibt es aber auch im restlichen Ensemble, darunter Loren Lang (Schigolch), Nathalie Mittelbach (Gräfin Geschwitz), Hyojong Kim (Maler/Prinz von Uahubee), Birger Radde (Tierbändiger/Athlet), Christian-Andreas Engelhardt (Prinz/Kammerdiener/Marquis) und Ulrike Mayer (Gardobiere/Gymnasiast).
Am Ende zeigt sich auch das Orchester auf der Bühne: Völlig zu Recht, denn was Hartmut Keil und die Bremer Philharmoniker an Spannung, Wucht und Klangraffinesse zu bieten haben, ist von überwältigendem Format. Es ist auch und besonders diese Leistung, die den Abend prägt.
Wolfgang Denker, 28.1.2019
Fotos von Jörg Landsberg
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
Premiere am 1.12.2018
Doppelt hält besser stimmt nicht immer
Zugegeben - eine Inszenierung von Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail birgt die Gefahr, das Werk auf die Klischees der Türkenoper, auf einen Konflikt verschiedener Kulturen und die Angst vor dem Fremden zu reduzieren. Das wollte Regisseur Alexander Riemenschneider offensichtlich vermeiden und bettet das Werk in eine Rahmenhandlung ein. Während der Ouvertüre führt die erste Szene bei ihm auf eine ausgelassene Party im Haus von Konstanze und Belmonte Lostados, auf der sich deren Freunde Blonde, Pedrillo, Osmin und Bassa Selim versammelt haben.

Wie in einem großen Setzkasten sieht man sie trinken, tanzen und scherzen (Bühne von Jan Štèpánek). Allmählich beginnen sie, sich mit ihren verschütteten oder unbewussten Gefühlen auseinanderzusetzen, ebenso mit ihren erotischen Phantasien. Mozarts „Entführung“ dient dabei nur als Katalysator. Riemenschneider hat den beiden Paaren dazu mit Stephanie Schadeweg, Ferdinand Lehmann, Anna-Lena Doll und Parbet Chugh Alter Egos aus dem Schauspielensemble an die Seite gestellt. Es sind keine simplen Doubles - sie haben durchaus unterschiedliche Kostüme (von Emir Medić), die aber nur geringfügig und so geschickt variieren, dass sie bestens korrespondieren. Dass die Sänger und Schauspieler ihre Kostüme wiederholt tauschen, trägt aber eher zur Verwirrung bei. Diese Verdoppelung gibt zwar Gelegenheit für immer neue Konstellationen und für die Verdeutlichung widersprüchlicher Gefühle, ist aber auf Dauer ermüdend. „Doppelt hält besser“ stimmt eben nicht immer.

„Das Fremde ist das versäumte Eigene“, lautet ein Satz von Adolf Muschg, den Riemenschneider wohl als Grundsatz seiner Inszenierung genommen hat. Das ist eigentlich kein schlechter Ansatz, aber der angestrebte Tiefgang bleibt leider doch auf der Strecke. Dazu gibt es zu viele Albernheiten wie das ständige Gezappel, wenn die Musik auch nur ein wenig rhythmisch wird. Die angedeuteten Sadomaso-Szenen gehören ebenso dazu wie die Spießbürger-Idylle mit einem bügelnden Pedrillo oder die Engelsflügel, die alle zwischenzeitlich anlegen. Ein Fremdkörper von ätzender Länge ist Albertines Traumerzählung aus der „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler. Auch das dort vorkommende Kind (Jenna Blume) wird bei Riemenschneider bemüht, allerdings nur, damit Pedrillo ihm sein Ständchen „In Mohrenland gefangen war“ als Gute-Nacht-Lied singen kann. Am Ende befinden sich alle wieder in dem Setzkasten - Gefühlslage unklar.

Hartmut Keil am Pult der Bremer Philharmoniker sichert Mozarts „Entführung“ den Stellenwert, der bei der Inszenierung etwas verloren geht. Seine Wiedergabe hat Kraft und Elastizität, das Orchester folgt ihm mit bester Spielkultur. Auch die Solisten erfüllen ihre Aufgaben durchweg gut, allen voran Hyojong Kim als Belmonte, der seinen schönen Tenor empfindsam durch die Partie führt und mit exemplarischer Textdeutlichkeit glänzt. Auch wenn der geschmeidige Sopran von Nerita Pokvytytè anfangs noch etwas spitz klingt, findet sie in „Traurigkeit“ und vor allem der Marternarie zu großer Form. Martina Nawrath gestaltet die Blonde in bester Soubretten-Manier. Bei ihrer Arie „Welche Wonne, welche Lust“ hängt sie an der Flasche: Es ist purer Galgenhumor, weil sie das Serail eigentlich nicht verlassen will, auch wenn sie mit Joel Scott als Pedrillo einen attraktiven Partner hat.

Christoph Heinrich macht als Osmin eine gute Figur, auch wenn man sich bei ihm in der tiefen Lage mehr Substanz wünschen würde. Der Bassa Selim ist mit Alexander Swoboda für die „Entführung“ nicht typgerecht besetzt, als Teilnehmer beim Seelen-Striptease aber durchaus. Den Chor hat man eingespart. Die kleinen Aufgaben, die er gehabt hätte, werden vom Ensemble übernommen.
Wolfgang Denker, 02.12.2018
Fotos von Jörg Landsberg
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere am 21.10.2018
Masken und einstürzende Fassaden
Wie bei kaum einer anderen Oper hatte Verdi bei seinem „Un ballo in maschera“ („Ein Maskenball“) Probleme mit der Zensur, die einen Mord am schwedischen König Gustav III. auf der Bühne verbot. Deshalb verlegte er die Handlung nach Boston und machte aus dem König den Gouverneur Riccardo. Heutige Inszenierungen verlegen die Handlung meistens wieder nach Schweden. Das tut auch Regisseur Michael Talke bei seiner Bremer Produktion. Er schafft mit der Bühnenausstattung von Barbara Steiner und den Kostümen von Regine Standfuss ein entsprechend stilisiertes Ambiente.

Gustav ist ein leichtherziger Monarch, der die Frau seines Freundes und Untergebenen liebt und der alle Warnungen vor einem geplanten Attentat in den Wind schlägt, obwohl die Verschwörer in ihren schwarzen Gewändern von Anbeginn bereits über die Bühne schleichen. Talke hat den Kontrast zwischen dieser Bedrohung und der mit einem Feuerwerk aus Papierschlangen und dem operettenhaft tänzelnden Chor angedeuteten Party-Stimmung der Hofgesellschaft vor dem Besuch bei der Wahrsagerin Ulrica gut herausgearbeitet.
Das Bühnenbild von Barbara Steiner zeigt opulente Fassaden des Königspalastes, die allerdings beim Besuch von Ulrica einstürzen. Denn dies ist die Stunde der Wahrheit: Ulrica erkennt die Liebesverstrickung Gustavs und die politische Gefahr ganz genau.
Amelias schlechtes Gewissen ist vor dem Treffen mit Gustav am Galgenberg fast greifbar: sie erblickt in einer Vision sich und ihre Familie in gespenstisch grünem Licht an einem Tisch sitzend. Dazu werden Totenköpfe projiziert.

Talkes Personenführung ist zunächst etwas statisch, da hätte es etwas mehr spielerische Akzente geben können. Allein für Oscar findet er eine neckische Körpersprache, die ihn mehr als frechen Hofnarren denn als Pagen charakterisiert. Aber im zweiten Teil mit dem handfesten Ehekrach zwischen Renato und Amelia und dem beeindruckenden Racheschwur der Verschwörer nimmt die Inszenierung kräftig an Fahrt auf. Amelia wird mit körperlicher Gewalt dazu gezwungen, das Los für den Mörder zu ziehen. Renato streift sich einen schwarzen Mantel über, den auch die Verschwörer tragen. Dazu werden bedrohlich und fanatisch schwarze Fahnen geschwenkt. Auch das letzte Bild mit der maskierten Hofgesellschaft, unter denen die Zahl der Verschwörer ständig wächst, gerät sehr eindrucksvoll. Talke ist jedenfalls eine werkgetreue und in jedem Moment nachvollziehbare Inszenierung gelungen, die für Spannung und Emotionen sorgt.

Dazu kommt eine durchweg hervorragende sängerische Besetzung, allen voran Birger Radde als Renato. Sein markiger Bariton entwickelt beachtliche Klangfülle, die Gestaltung der Arie „Eri tu“ geht unter die Haut. Luis Olivares Sandoval punktet als Gustav einmal mehr mit seinem runden Tenor und seinem ausgesprochen schönen Timbre. Besonders den letzten Akt gestaltet er mit Schmelz, Legato und differenziertem Ton. Patricia Andress ist eine Amelia, die vor allem das Wechselspiel ihrer Gefühle verdeutlichen kann. Als Ulrica beeindruckt Romina Boscolo vor allem mit einer fulminanten Tiefe, während die Registerübergänge aber Wünsche offen lassen. Iryna Dziashko ist ein munterer Oscar mit blitzsauberen Koloraturen. Mit Stephen Clark (Graf Ribbing) und Daniel Ratchev (Graf Horn) sind die Verschwörer sehr überzeugend besetzt. Im kleineren Rollen sind Dongfang Xie (Cristiano) und Sungkuk Chang (Richter) zu erleben.
In ganz großer Form präsentiert sich der von Alice Meregaglia einstudierte Chor vor allem im Finale.

Das Bremer Debüt des Dirigenten Marco Comin hätte besser kaum ausfallen können. Vielleicht hätte das Liebesduett noch etwas mehr Feuer vertragen, aber ansonsten gelingt ihm eine spannende, effektvolle Wiedergabe, bei der er ganz auf die zugespitzten Emotionen setzt.
Wolfgang Denker, 22.10.2018
Fotos von Jörg Landsberg
FIDELIO
Premiere am 16.09.2018
Zeitreise durch die Welt- und Theatergeschichte
Das ist wirklich mal ein originelles Konzept, mit dem sich Regisseur Paul-Georg Dittrich Beethovens einziger Oper „Fidelio“ genähert hat. Er nimmt den Zuschauer im 1. Akt mit auf eine Zeitreise durch die Welt- und Theatergeschichte und macht diese an früheren, historischen Inszenierungen dieser Oper fest. Dabei verknüpft er das Weltgeschehen mit dem Ge- und Missbrauch, und mit der Instrumentalisierung der auch gern zu Repräsentationszwecken aufgeführten Oper. Das klingt zunächst auch nach einer Instrumentalisierung, aber Dittrich tastet den Gehalt und die Handlung des „Fidelio“ in keiner Sekunde an. Es bleibt Beethovens „Fidelio“. Einen ähnlichen Ansatz hatte Stefan Herheim in seinem Bayreuther „Parsifal“ verfolgt, der von der Wagner-Zeit bis zum Deutschen Bundestag führte.

Die Stationen bei Dittrich sind das Kärntner-Theater in Wien (1814), das Theatre-Lyrique Paris (1860), das Werktätigen-Theater Leningrad (1928), das Stadttheater Aachen (1938), das Deutsche Opernhaus Berlin (1945), das Stadttheater Kassel (1968), die Semperoper Dresden (1989) und schließlich das Bremer Theater (1997).
Leonore steht von Anbeginn auf der Bühne. Mit ihren Stiefeln, der superkurzen Rockhose einer teilweise schulterfreien Jacke passt sie in kein Klischee. Eine Verkleidung als Mann findet nicht statt. Sie befindet sich bei der Suche nach ihrem Florestan in permanenter Hochspannung und fungiert auch als eine Art Spielmacherin, wenn sie die Haltung von zwei leblosen Figuren arrangiert, die sich dann als Marzelline und Jaquino entpuppen. Oder wenn sie ungeduldig das Bühnenbild verschieben will, um zum nächsten Schauplatz zu gelangen.

Diese Schauplätze werden in den Bühnenbildern von Lena Schmid eindrucksvoll stilisiert. Da blitzt die Biedermeier-Zeit (1814) auf, das Theatre-Lyrique wirkt mit ihren postkartenartigen Standbildern wie ein Gruß aus vergangenen Zeiten, bei Leningrad wird die Szene mit dem die Treppen von Odessa herunterrollenden Kinderwagen aus dem Film „Panzerkreuzer Potemkin“ zitiert. Aachen führt in die NS-Zeit. Auf der Bühne sind Bänder mit der Aufschrift „Zum Geburtstag“ zu sehen. Gemeint ist die von Karajan geleitete „Fidelio“-Aufführung am 20.4.1938 zu Hitlers Geburtstag. Kassel erinnert an die APO-Zeit mit einem Hörsaal und Studenten. Und schließlich wird die Bremer Kresnik-Inszenierung mit Aldi-Tüten und den Helmen der Arbeiter von der damals pleitegegangen Vulkan-Werft zitiert.
Den Bezug zur Zeitgeschichte stellt Dittrich über diverse Videos her. Lenin, Stalin, Hitler, Trümmerfrauen, Studentenunruhen und der Mauerfall - all das flimmert in guter Dosierung über die Leinwand. Die Dialoge werden durch gleich mehrfach wiederholte Satzfetzen, ersetzt die aus diversen Platteneinspielungen zusammengeschnipselt wurden. So weit, so überzeugend.

Der 2. Akt kann diese Spannung nicht halten. Ein Teil der Zuschauer sitzt wie beim Abendmahl an einem Tisch, auf dem sich Florestan befindet - ein Gefängnis der besonderen Art. Mitunter sind die Solisten akustisch unbefriedigend im Hintergrund postiert. Nach der Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 lässt Dittrich Mikrofone ins Publikum halten und Szenenbeschreibungen sowie die Worte des Ministers ablesen. Eine überflüssige Aktion. Für Leonores Melodram schwebt ein Klavier vom Bühnenhimmel. Sie wird daran von Florestan begleitet, während das Orchester schweigt. Zum Finale sind alle Akteure, also Chor und Solisten, im zweiten Rang versammelt. Auf der Bühne passiert dann nichts mehr.
Im Zentrum steht Nadine Lehner als Leonore, die ihre Partie mit stählerner Härte und einer unglaublichen Intensität singt. Eine tolle Leistung! Der Tenor von Christian-Andreas Engelhardt wird immer kraftvoller und substanzreicher. Er bewältigt den Florestan sehr achtbar, stößt aber mitunter auch an seine Grenzen. Claudio Otelli gibt den Don Pizarro als furchterregenden und brutalen Machtmenschen mit erzener Stimmgewalt.

Christoph Heinrich zeigt mit schlankem Bass vor allem die freundlichen Seiten des Rocco. Als Marzelline und Jaquino können Marysol Schalit (mit kleinen Schärfen) und Joel Scott mit jugendfrischem Tenor ihre Partien gut erfüllen. Daniel Ratchev ist als Minister nicht auf der Bühne sondern nur vom Rang zu erleben. Der von Alice Meregaglia einstudierte Chor leistet Großartiges, wenn auch das Jubelfinale etwas zuviel an Klangwogen beschert.
Für eine durchweg bewegende Wiedergabe sorgt Yoel Gamzou am Pult der ausgezeichnet spielenden Bremer Philharmoniker. Seine Dynamik und seine Tempi sind schwindelerregend. Die Leonoren-Ouvertüre ist bei ihm „große Sinfonie“. Der Spannungsbogen wird durchgängig gehalten.
Wolfgang Denker, 17.09.2018
Fotos von Jörg Landsberg
LAZARUS
Premiere am 09.06.2018
Jeder Song ein Volltreffer

In dem Film „The Man Who Fell to Earth“ (1976) spielte David Bowie die Hauptrolle. Der Film handelt von dem Außerirdischen Thomas Newton, der eigentlich Wasser für seinen Heimatplaneten suchen will, sich dann aber in das Mädchen Mary-Lou verliebt, den Verlockungen des „American Way of Life“ erliegt und geschäftliche Karriere macht. Am Ende ist er aber desillusioniert und gescheitert.
Hier setzt das Musical ein, das 2015 kurz vor dem Tod von David Bowie in New York uraufgeführt wurde. Enda Walsh hat die Geschichte des Films weiterentwickelt. Newton verbringt seine Tage nur noch damit, Gin zu trinken und den Fernseher laufen zu lassen. Er wartet auf seinen Tod, da er nicht zu seinem Heimatplaneten zurückkehren kann. Die Handlung des Musicals und die auftretenden Personen finden eigentlich nur im Kopf von Thomas Newton statt.

Da gibt es Elly, eine Mischung aus Krankenschwester und Haushälterin, die sich äußerlich auch schon mal in seine verlorene Liebe Mary-Lou verwandelt, daneben gibt es die schillernde, zwielichtige Figur des Valentine, eine Art Mephisto, der mit seinem Messer wie Jack the Ripper herumfuchtelt und auch davon Gebrauch macht. Und es gibt „das Mädchen“ als Symbol für die Hoffnung. Sie will mit Newton eine Rakete für die Heimreise konstruieren und erweist sich als eine verständnisvolle Partnerin, die tiefe Einblicke in die Seele von Newton hat. Zwar löscht Valentine die an eine Tafel gekritzelten Raketenpläne wieder aus und ersticht das Mädchen - aber man weiß ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Ende senkt sich eine riesige Leiter auf die Bühne herab, auf der Newton den Heimweg antritt.
Die Regie von Tom Ryser versucht nicht, die Bestandteile der etwas abstrusen Handlung in einen logischen Ablauf zu bringen. Da helfen auch die deutsch gesprochenen Dialoge nicht viel. Aber er verbindet die siebzehn Songs von David Bowie zu einem abwechslungsreichen und bewegungsintensiven Pastiche.

Unterstützt wird er von der Choreographin Lillian Stillwell und von dem Ausstatter Stefan Rieckhoff. Newtons Bett steht im Zentrum, hinter einem Vorhang sind wiederholt bedrohliche Schattenspiele zu sehen. Ansonsten zeigt das Bühnenbild verschieden hohe Podeste, die mit Treppenstufen verbunden sind - wie ein Labyrinth durch eine verwirrte Seele.
Herzstück der Produktion sind die hinreißenden Songs von David Bowie, die in einer breiten Palette vertreten sind. Da gibt es traumhaft schöne Balladen, fetzige Rock-Songs und tanzbare Up-Tempo-Nummern. Sie stammen aus verschiedenen Alben, darunter aus „The Next Day“ („Love is Lost“, „Where Are We Now?“, „Dirty Boys“ und „Valentine’ Day“) und aus „Hunky Dory“ („Changes“ und „Life on Mars?“). Jeder Song ein Volltreffer! Das Quartett „Absolute Beginners“ ist dabei ein besonderer Höhepunkt. Die siebenköpfige Band (Keyboard und Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxophon und Cello) leistet unter der Leitung von Yoel Gamzou Hervorragendes. Die Musiker sorgen für einen mal prallen, mal intimen Klang, der keine Wünsche offen lässt.

Das gilt auch für die gesanglichen Leistungen. Wie sich Martin Baum als Thomas Newton die Songs von David Bowie zueigen gemacht hat, ist schlicht bewundernswert. Einfach toll - Hut ab! Nerita Pokvytyté als „das Mädchen“ begeistert nicht nur mit der schönsten Stimme des Abends, sondern auch damit, wie sie ihren ausdrucksvollen Sopran an den Stil der Songs anschmiegen kann sowie mit einer geradezu akrobatischen Körperbeherrschung. Eindrucksvoll gestaltet Claudia Renner ihren Part der Elly. Insgesamt gut schlagen sich auch Alexander Angeletta (Valentine), Justus Ritter (Ben), Bastian Hagen (Zach), Siegfried W. Maschek (Michael) sowie Lotte Rudhart, Lucca Züchner und KaEun Kim (Teenage Girls).
Wolfgang Denker, 10.06.2018
Fotos von Jörg Landsberg
THE RAKE’S PROGRESS
Premiere am 27.05.2018
Das Glück bleibt Illusion

Mit seinem Ballett „Le Sacre du Printemps“ hob Igor Strawinsky 1913 die musikalische Welt aus den Angeln. Bei seiner 1949/50 entstandenen Oper „The Rake’s Progress“ schlug er ganz andere, neo-klassizistische Töne an. Strawinsky spielt in diesem Werk, das im Stil einer klassischen Nummernoper aufgebaut ist, mit Anklängen von Monteverdi bis zum Jazz. Die Gesangspartien huldigen dem Belcanto. Vor allem aber schwebt der Geist Mozarts über der Partitur: Ein moderner „Don Giovanni“ mit einem Helden, dem eigentlich alles misslingt und einem Epilog, der die „Moral“ von der Geschichte bilanziert.

Zu Beginn ist ein grauer Saal zu sehen (Bühne von Barbara Steiner). „I wish I were happy“ steht in großen Lettern an der Wand. Menschen sitzen auf Stühlen, darunter auch Tom Rakewell. Ist es ein Wartesaal zum Glück? Bevor der erste Ton der Musik einsetzt, fällt Rakewell tot vom Stuhl. Die Handlung wird somit in der Inszenierung von Michael Talke als Rückblick entwickelt. Wie sich erst am Schluss der Oper erweist, befinden wir uns hier bereits in dem Irrenhaus, in dem das Werk endet. Es ist eine surreale Welt, die hier aufgeblättert wird. Die skurrilen Kostüme von bieder bis bizarr, von mausgrau bis zu barocker Farben- und Formenpracht machen dadurch durchaus Sinn. Anne Truelove trägt ein rotes, herzförmiges Kleid und signalisiert schon rein optisch die Wahrhaftigkeit ihrer Gefühle. Die Jahrmarktsattraktion Baba, die von Tom geheiratet wird, entpuppt sich als Affenmensch. Und Nick Shadow ist nicht nur im übertragenen Sinne eine Gestalt der Finsternis: Schwarzes Gesicht, schwarze Hände und ein pechschwarzes Gewand - eindrucksvoller kann man den Teufel nicht charakterisieren. Regine Standfuss hat viel Phantasie in ihre Kostüme investiert.

Und Talke verdeutlicht die Stationen von Toms Abstieg mit ebenfalls viel Phantasie, ob er nun unter dem riesigen Reifrock der Puffmutter Mother Goose verschwindet, seine nervige Ehefrau Baba erschlägt (die aber wieder aufwacht) oder in der Anstalt vor sich hin dämmert. Der Gehalt der Szenen, Toms Scheitern bei der Jagd nach Geld und Anerkennung, wird in immer neuen Konstellationen verdeutlicht. Spannend gerät das Kartenspiel zwischen Tom und Nick, eindrucksvoll dessen Höllenfahrt in dichten Nebelschwaden.
Hyojong Kim setzt als Tom Rakewell seinen Tenor mit viel Kraft und strahlendem Glanz ein, Marysol Schalit bezaubert als Anne Truelove mit reinstem Belcanto und Christoph Heinrich setzt stimmlich und darstellerisch als Nick Shadow besondere Glanzlichter. Dazu kommen die hervorragenden Leistungen von Nathalie Mittelbach als umwerfende Baba, Ulrike Mayer als verruchte Mother Goose, Christian-Andreas Engelhardt als quirliger Auktionator, Loren Lang als Annes besorgter Vater und vom bestens disponierten Chor (Alice Meregaglia).

Die fragile und feinsinnige Musik Strawinskys liegt bei Hartmut Keil und den Bremer Philharmonikern in besten Händen. Tom Rakewell ist zwar nicht glücklich geworden, dafür aber das Publikum mit dieser sehenswerten Inszenierung.
Wolfgang Denker, 29.05.2018
Fotos von Jörg Landsberg
DIE FLEDERMAUS
Premiere am 31.03.2018
Nahe am Offenbarungseid

„Die Fledermaus“ ist das erklärte Lieblingswerk des Bremer Musikdirektors Yoel Gamzou. Und das merkt man seiner Wiedergabe am Pult der Bremer Philharmoniker in fast jedem Takt an. Schon die mit vielen Generalpausen sehr individuell gestaltete Ouvertüre überzeugt, auch im eigenwilligen, aber gekonnten Spiel mit Tempowechseln. Gamzou gelingt eine durchgehend schmissige und mitreißende Interpretation, geprägt von feinem Sinn für Details und nie versiegender Intensität, wenn man vom etwas matten Terzett im 3. Akt einmal absieht. Als Einlage gibt es die furios gespielte Polka „Unter Donner und Blitz“.
Rein musikalisch überzeugt die Produktion auch mit einem homogen besetzten Sängerensemble, allen voran Patricia Andress mit ihrem temperamentvollen Csardas als Rosalinde. Aber auch Birger Radde als viriler Eisenstein, Ulrike Mayer als Orlofsky, Marysol Schalit als freche Adele und Marian Müller als Dr. Falke machen ihre Sache gut. Hyojong Kim bleibt als Alfred etwas unter seiner gewohnten Form.

Die „Inszenierung“ von Felix Rothenhäusler kommt einem Offenbarungseid gleich. Die Solisten stehen aufgereiht an der Rampe und singen frontal ins Publikum. Blickkontakte gibt es kaum. Ein wie auch immer geartetes Spiel findet nicht statt. Auch ein Bühnenbild gibt es nicht, dafür senken und heben sich mehrere lilafarbene und geraffte Vorhänge im Zehn-Sekunden-Takt. Auf- und Abtritte kommen ebenfalls nicht vor. Immer, wenn ein Solist verschwindet oder hinzukommt, findet das hinter dem Vorhang statt. Selbst bei Positionswechseln werden die Vorhänge bemüht. Das ist schlicht nervtötend und ätzend.
Die Dialoge wurden von Tobias Haberkorn bearbeitet. Orlofsky sagt bei jeder Gelegenheit nur immer „Na, bravo“, Eisenstein erzählt die Geschichte von Falkes Fledermauskostüm, was vom Chor unisono mit einem albernen, staccatohaften „Ha, ha, ha, ha“ kommentiert wird. Die Szenen mit dem Gefängnisdiener Frosch sind zur Unkenntlichkeit verstümmelt und eine einzige Katastrophe - völlig frei von Witz und Geist.

Alle Solisten und Choristen, also auch die Herren, treten in Frauenkleidern auf, warum auch immer. Zu der eingeschobenen Polka dreht sich der Frosch ständig im Kreis - rein körperlich imponierend von Hauke Heumann durchgeführt. Aber mit Persiflage und „Entstaubung“ hat all das nichts zu tun. Die Frage muss gestattet sein, welches Bild der Regisseur und die Theaterleitung eigentlich von ihrem Publikum haben. Veräppeln kann man sich auch alleine.
Wolfgang Denker, 01.04.2018
Fotos von Jörg Landsberg
WAHLVERWANDTSCHAFTEN
Premiere am 24.02.2018 besuchte Aufführung: 04.03.2018
Abstruser geht es kaum
Schon einmal hat Armin Petras für das Bremer Theater ein gewichtiges Werk der Weltliteratur zu einem Stück für die Bühne bearbeitet. 2014 war es „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi, diesmal ist es der Roman „Die Wahlverwandtschaften“ von Johann Wolfgang von Goethe. Damals wie heute lieferten die Komponisten Thomas Kürstner und Sebastian Vogel die Musik dazu. Was bei „Anna Karenina“ wenigstens in Ansätzen gelungen war, erwies sich bei den „Wahlverwandtschaften“ allerdings als langweiliges Fiasko. Das liegt weniger an der Musik, die zwar alle möglichen Stilrichtungen plündert, die aber ihre begleitende und kommentierende Funktion erfüllt und mit apart konstruierten Klängen punktet, die von machtvollen Clustern und Klangfetzen bis zu kammermusikalischer Feinheit reichen. Eingestreut sind Anlehnungen an „Pop-Songs“, ein tieftrauriges Lamento und am Ende eine intensiv berührende Arie. Clemens Heil am Pult der in Freizeitkleidung und kleiner Besetzung spielenden Bremer Philharmoniker setzt diese Musik mit offensichtlicher Spielfreude um und sichert der zweistündigen Aufführung ihre Erträglichkeit.

Denn von Goethes „Wahlverwandtschaften“ ist außer der Grundkonstellation von zwei Paaren, die an ihrer Beziehung zweifeln und sich „über Kreuz“ orientieren, nicht viel geblieben. Auch die Namen Eduard, Charlotte und Otto der handelnden Personen wurden übernommen (wobei aus Ottilie hier der unreife Teenager Tilly wird), während ihre Stellung in der Gesellschaft völlig geändert wurde. Armin Petras hat das Stück „überschrieben“ und das Ergebnis ist eine unsägliche Ansammlung von Banalitäten. Hier Goethe als Autor Goethe zu bemühen, grenzt an Etikettenschwindel. Textpassagen wie „Lasse ich mir meine Brüste machen oder vielleicht den Hintern“, „Ich lasse mich scheiden - Geht nicht, wir sind nicht verheiratet - Scheiße, hab ich vergessen“ oder die Diskussion über den Preis von Badehosen sind nur kleine Bespiele für den „Tiefsinn“ dieser Textfassung. Zudem wird ständig und unmotiviert zwischen deutscher und englischer Sprache gewechselt. Eine überflüssige Zumutung für den Zuschauer. Der Ansatz, die Brüchigkeit von Beziehungen, den Sinn des Lebens und speziell die individuelle Bedeutung von Glück zu hinterfragen, ist zeitlos und hätte durchaus spannend sein können. Aber wenn es so platt herüberkommt wie hier, dann ist praktisch alles verschenkt. Fast unerträglich die Auslassungen der hinzuerfundenen Figuren Wolfgang und Christina: Er hält mit aufgesetztem Pathos einen Monolog über Ehe und die Lust auf andere Partner, sie über das Glück und die Langweile eines ewigen Paradieses.

Die Regie von Stephan Kimmig verstärkt obendrein die Defizite des Abends. Er hat die Handlung wie ein Experiment angelegt. Schauplatz ist ein Partyzelt, auf dessen Wänden laufend Videos von Menschen im Wasser und unter Wasser zu sehen sind (Bühne von Katja Haß). Die Figuren können kaum Profil entwickeln, und ergehen sich oft in zuckenden und zappelnden Bewegungen. Charlotte und Otto trommeln wie besessen mit Bestecken auf dem Küchentisch oder präsentieren immer neue Bademoden. Tilly (unten herum nackig) lässt Eduard in seinem albernen Kleidchen Zirkuskunststücke vorführen, klettert an den Zeltstangen herum oder begleitet sich selbst bei einigen Songs am Klavier. Abstruser geht es kaum, seelische Sinnfragen werden mit vordergründiger Pseudo-Philosophie und einer merkwürdigen Vorstellung von groteskem Humor erschlagen.

Gleichwohl sind besonders die Leistungen von Nadine Lehner als Charlotte und Patrick Zielke als Eduard aus der Opernsparte hervorzuheben. Lehner setzt ihren wandlungsfähigen Sopran punktgenau ein und beeindruckt besonders in ihrem Schlussgesang. Ihre Bühnenpräsenz ist auch in diesem Kontext bezwingend. Ähnliches gilt auch für den wie immer spielfreudigen Patrick Zielke, dessen satter Bass bestens zur Geltung kommt. Die anderen (Sprech-)Rollen sind in diesem spartenübergreifenden Projekt mit Schauspielern besetzt: Robin Sondermann als Otto, Markus John als Wolfgang, Annemaaike Bakker als Christina und nicht zuletzt Hanna Plaß als Tilly, die ihre eingestreuten Chansons gekonnt servierte. Wie schrieb eine Kollegin nach der Premiere? „Der glücklichste Moment dieser Aufführung ist der, wenn das Licht im Zuschauerraum wieder angeht.“ Recht hat sie!
Wolfgang Denker, 05.03.2018
Fotos von Jörg Landsberg
LUCIA DI LAMMERMOOR
Premiere am 28.01.2018
Szenische Überfrachtung
Donizettis Belcanto-Oper „Lucia die Lammermoor“ lief zuletzt 1989 in Bremen. Da ist eine Neuinszenierung natürlich doppelt willkommen, besonders wenn ausnahmslos alle Partien so hervorragend aus dem eigenen Ensemble besetzt werden können. Die musikalische Seite der neuen Produktion sorgte denn auch bei der Premiere für uneingeschränkte Begeisterung.

Die Partie der Lucia ist, ähnlich wie die der Norma, eine der anspruchvollsten Aufgaben im Belcanto-Bereich. Nerita Pokvytyté bewältigt sie bravourös - technisch und gestalterisch. Ihren silbrigen Sopran führt sie perfekt und virtuos durch alle Lagen. Die große Wahnsinnsarie wird in ihrer äußerst differenzierten Interpretation zum Höhepunkt der Aufführung. Hier kommt auch statt der Flöte die von Donizetti ursprünglich vorgesehene Glasharmonika (subtil von Philipp Alexander Marguerre gespielt) zum Einsatz. Gleichmaßen begeisternd ist die Leistung von Hyojong Kim als Edgardo. Sein Tenor verfügt über ein ausgesprochen schönes und farbenreiches Timbre. Er gibt der Partie Glanz und Wärme. Die kalte, herrische Attitüde seines Gegenspielers Enrico wird von Birger Radde mit martialisch auftrumpfendem Bariton punktgenau getroffen. Arturo, mit dem Lucia verheiratet wird, bekommt bei Luis Olivares Sandoval stimmliches Gewicht. Auch er wäre sicher ein guter Edgardo. Bei Christoph Heinrich erhält Raimondo, der Erzieher Lucias, dunkle und skurril-bedrohliche Züge.

Er ist ein unheimlicher Strippenzieher, eine Art Guru. Die kleine Partie des Normanno wird von Christian-Andreas Engelhardt besonders aufgewertet. Der Chor (Alice Meregaglia) und die Bremer Philharmoniker hinterlassen unter Olof Boman in Bezug auf Klang und Stringenz, auf Dramatik und Feinabstimmung einen vorzüglichen Eindruck. Unverständlich ist nur, warum Boman sich von der Regie wiederholt willkürliche Generalpausen, die den Fluss der Musik stoppen, hat aufzwingen lassen.
Diese Regie von Paul-Georg Dittrich musste massive Buhrufe hinnehmen. Er verdreifacht Lucia und Edgardo, indem er ihnen jeweils ein junges (Alisa Hrudnik und Max Geburek) und ein altes (Sibylle Bülau und Ernst-August Hartmann) Alter Ego an die Seite stellt. Das Wechselspiel dieser Figuren ist verwirrend und befremdend. Lucia tritt in einem Theaterkarren auf, nachdem sie zu Beginn als Kind mit einer Miniaturausgabe des Karrens gespielt hat.

Für den Regisseur steht die Welt des Theaters als Symbol für einen Zufluchtsort der Träume. Für den Chor werden Tribünen hereingerollt (Bühne von Pia Dederichs und Lena Schmid). Zuckende Chormitglieder mit toten Geiermasken, Videoprojektionen (von Jana Findeklee) mit Gesichtern, Symbolen, Mustern und Farben sind fast ständig zu sehen und überfrachten die Inszenierung unnötig und manchmal sogar störend. Den Zauber der Wahnsinnsarie beschädigen sie sogar. Die eigentliche großartige Wirkung des zweiten Aktfinales verpufft, weil Edgardo bei geöffnetem Vorhang auf der Bühne liegen bleibt und jämmerliche nach Lucia ruft, während das Publikum in die Pause geht. Auch die Personenführung hat oft wenig mit der Handlung zu tun. Edgardo scheint die „junge“ Lucia zu ermorden und schleift die Leiche hinter sich her, obwohl er eigentlich erst in der letzten Szene von ihrem Tod erfährt. Enrico gefällt sich in skurrilem Spiel mit einer riesigen Krone, fast wie ein wahnsinniger Nero. Und wenn Arturo in seinem goldenen Gewand vom Bühnenhimmel schwebt, ist das eher unfreiwillig komisch.

Zwar beweist Dittrich eine gerüttelt Maß an Phantasie, verliert dabei aber mitunter den Bezug zu „Lucia di Lammermoor“. Schade.
Wolfgang Denker, 30.01.2018
Fotos von Jörg Landsberg
LEONARD BERNSTEIN 100 - EINE GEBURTSTAGSGALA
Premiere am 31.12.2017
Gelungene Hommage an ein Multitalent
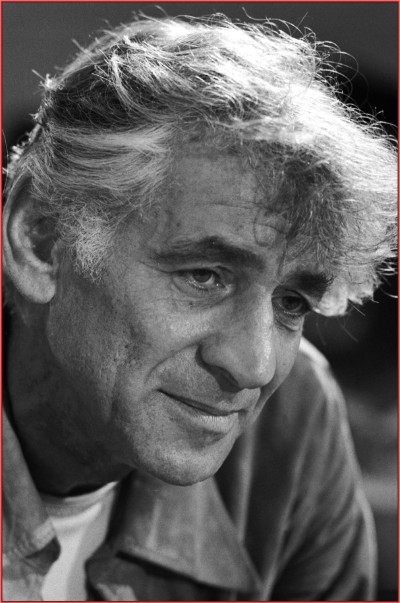
Yoel Gamzou, der neue Musikdirektor des Bremer Theaters, liebt Leonard Bernstein. Und er liebt auch alles, was Bernstein liebte. „Er ist eins meiner größten Vorbilder, für mich ist er eine einzigartige Erscheinung in der Musikgeschichte“, sagt Yoel Gamzon. Bernsteins 100. Geburtstag wäre zwar erst am 25. August 2018 gewesen, aber das ist kein Grund, nicht schon jetzt das „Bernstein-Jahr“ einzuleiten.
Bei der von Gamzou konzipierten, moderierten und dirigierten Silvestergala sollten nicht nur Höhepunkte aus Bernsteins Schaffen erklingen, sondern auch Werke von Freunden, Weggefährten oder Komponisten, die für Bernstein eine zentrale Rolle gespielt haben. Folgerichtig versuchte die Geburtstagsgala mit einem sehr breiten Programm den vielen verschieden Talenten und Facetten von Leonard Bernstein nachzuspüren. Das ist auf begeisternde Weise gelungen.

Jeder andere Dirigent wäre wahrscheinlich schon nach der am Beginn stehenden Ouvertüre zu „Candide“ erschöpft zusammengebrochen, wenn er sie mit einem solch körperlichen Einsatz dirigiert hätte, wie es Yoel Gamzou tat. Aber seine Energie übertrug sich derart ungebrochen auf die Bremer Philharmoniker, dass das effektvolle Stück wie im Rausch abschnurrte. Von Aaron Copland, einem engen Freund Bernsteins, gab es „5 Old American Songs“, die Loren Lang, ganz stilgerecht im roten Hemd und mit Cowboy-Hut, authentisch gestaltete, wobei ihm das lustige „I bought me a cat“ besonders gut gelang. Der Chor des Bremer Theaters glänzte mit dem Autodafé aus „Candide“, das durch die farbenfrohen Kostüme der Sänger wie ein fröhliches Volksfest wirkte. „A little bit in love“ aus „Wonderful Town“ wurde von Patricia Andress wie ein intimes Chanson gesungen, wobei sie von Israel Gursky am Klavier begleitet wurde. „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehars „Das Land des Lächelns“ fiel in diesem Programm zwar etwas aus dem Rahmen, aber dafür brillierte Christian-Andres Engelhardt bei diesem Operetten-Evergreen mit Glanz, Kraft und einer Rose in der Hand. Mit „Glitter and be Gay“ aus „Candide“ waren wir wieder bei Bernstein. Nerita Pokvytyté kam von einer Wendeltreppe auf die Bühne und bewältigte diese Bravour-Arie mit begeisternder Virtuosität.
Die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin ist ein Stück, dem Bernstein sich sehr verbunden fühlte und bei dem er oft den Klavierpart selbst spielte.

Für die Überraschung des Abends sorgte nun der Tenor Chris Lysack, den das Bremer Publikum aus vielen Partien kennt. Hier präsentierte er sich aber nicht als Sänger, sondern als Pianist (!). Es dürfte den meisten nicht bekannt gewesen sein, dass er vor seiner Sängerkarriere auch als Pianist ausgebildet wurde. Wie er mit kraftvollem Anschlag, mit einer Spielkultur zwischen verspielten Läufen und furiosen Akkorden das Stück meisterte, konnte nur Staunen machen.
In seiner sympathischen und kenntnisreichen Moderation, die stets von herzlicher Bewunderung für Bernstein geprägt war, stellte Gamzou die Frage, ob Gustav Mahler durch Bernstein, oder Bernstein durch Gustav Mahler berühmt geworden sei. Denn Bernstein hatte wesentlichen Anteil an der „Wiederentdeckung“ Mahlers in den sechziger Jahren. Mit dem „Adagietto“ aus seiner 5. Symphonie und dem „Urlicht“ aus seiner 2. Symphonie unterstrichen die Bremer Philharmoniker ihre oft bewiesene Kompetenz in Sachen Mahler. Dem „Urlicht“ schloss sich pausen- und bruchlos der Liebestod aus Wagners „Tristan und Isolde“ an, bei dem Nadine Lehner die immer mehr gewachsene Strahl- und Ausdruckskraft ihrer Stimme eindrucksvoll demonstrierte.
Am Schluss stand dann das Werk, für das der Name Bernstein ewig stehen wird: „West Side Story“. In einer langen Melodienfolge, die von „Maria“ und „Tonight“ bis zu „America“ und vor allem den Symphonischen Tänzen reichte, die von Gamzou und den Bremer Philharmonkern aufregend musiziert wurden, glänzten Chris Lysack (nun wieder als Tenor), Nerita Pokvytyté, Nathalie Mittelbach, Patricia Andress und Nadine Lehner sowie der Chor des Bremer Theaters (Alice Meregaglia), der einen ergreifenden Schlusspunkt setze. Wenn das Jahr 2018 so weitergeht, wie das alte Jahr ausgeklungen ist, kann man nur zuversichtlich sein.
Wolfgang Denker, 01.01.2018
Fotos (c) Wikipedia / Jörg Landsberg
Lady Macbeth von Mzensk
Besuchte Vorstellung am 9. Dezember 2017
TRAILER
Neben Alban Bergs „Wozzeck“ gehört die „Lady Macbeth von Mzensk“ des damals 26jährigen Dimitri Schostakowitsch zu den Schlüsselwerken der Moderne, die sich im Repertoire der Opernhäuser behaupten können. Die Handlung beider Werke geht jeweils auf einen authentischen Gerichtsfall zurück. Nikolai Leskow war in Orjol auf den Fall der Kaufmannsfrau Katerina Ismailowa gestoßen. Seine 1856 veröffentlichte Novelle regte Schostakowitsch zu seiner zweiten Oper an. Es heißt, dass ohne Wozzeck die Lady Macbeth nicht denkbar gewesen wäre. Trotz des ähnlichen Sujets unterscheidet sich die musikalische Sprache. In ihrer Dramatik und Expressivität, aber ebenso in ihren lyrischen Passagen zielt die Musik der Lady Macbeth auf Emotionen. Über weite Strecken wird das Parodistische, Groteske betont, um im letzten Bild der Erschütterung über das Schicksal der Menschen in einem brutalen System unmittelbar Raum zu geben. Der bewegende Chor der Zwangsarbeiter kommt stilistisch den großen Volksszenen der Mussorgski-Opern nahe. Die Fallhöhe vom Satirischen zum Dramatischen verleiht dem Werk eine Tiefe, wie sie nach meinem Empfinden weder der „Wozzeck“ noch Schostakowitschs Opernerstling „Die Nase“ aufweisen.

Leskow soll mit der Novelle den Auftakt für eine Art Charakterstudie russischer Frauen beabsichtigt haben. Auch Schostakowitsch erklärte, dass sein Werk den Auftakt einer Trilogie bilden sollte, die „der Lage der Frau in den verschiedenen Epochen Russlands“ gewidmet sein sollte. Ob er dies wirklich beabsichtigte, darf bezweifelt werden. Mit Ankündigungen an politisch erwünschten Themen zu arbeiten, gewann er vielmehr Freiräume für sein Schaffen und unterlief die an ihn gerichteten politischen Erwartungen.
Es war kein Zufall, dass die 1934 erfolgreich uraufgeführte „Lady Macbeth von Mzensk“ den willkommenen Vorwand für das politische Exempel des parteioffiziellen Verrisses von 1936 bot. Mit dem berüchtigten Prawda-Artikel „Chaos statt Musik“ wurde der Siegeszug der Oper abrupt beendet und die sowjetische Musik auf einen streng reglementierten „sozialistischen Realismus“ in Abgrenzung vom bürgerlichen „Formalismus“ eingeschworen. Das Proletariat kommt in dem Werk tatsächlich schlecht weg. Schostakowitsch brach mit der Regel der russischen Oper, wonach im „Volksliedton sich äußernde Menschen entweder aus dem Volk stammen, zumindest aber ‚gute Menschen‘ seien.“ (Siegrid Neef 1987).

Die Sympathie des Komponisten galt hörbar seiner Protagonistin, einer gelangweilten und unbefriedigten Kaufmannsfrau, die drei Menschen und sich selbst ums Leben bringt (in der literarischen Vorlage waren es noch vier). Lediglich der Älteste der Zwangsarbeiter zeigt Mitgefühl. Er spricht das bittere Fazit aus „Wird denn für ein solches Leben der Mensch geboren?“ Alle anderen Figuren sind einander die Hölle. Die Köchin Aksinja wird von den Angestellten der Ismailows unter Führung des neuen Arbeiters Sergej vergewaltigt. (In der von derartigen „Vulgarismen“ bereinigten Fassung von 1964 treiben die Arbeiter mit der Köchin „rohe Späße“, indem sie versuchen, sie „in ein Fass zu stecken“). Den Tod des Patriarchen nehmen die Angestellten und auch der schließlich herbeigerufene Pope eher achselzuckend zur Kenntnis und auch das Auffinden der Leiche von Katerinas Ehemann bietet der unter dem Ausbleiben von Bestechungsgeldern leidenden Polizei den hochwillkommenen Anlass, sich zur Hochzeitsfeier der Ismailows einzuladen. Auf dem Weg in die Verbannung kennen die Zwangsarbeiter keine Solidarität – auch hier herrschen Heimtücke und das Recht des Stärkeren. Eine positive Identifikationsfigur ist in keiner der in dieser Oper vorgestellten Gesellschaftsschichten zu finden.
Dass ein solches Sujet mit der starken Betonung der Sexualität als Erlösung aus einem lieblosen Alltag und dessen musikalische Umsetzung, die sich aus unterschiedlichsten musikalischen Stilmitteln – einschließlich, Marsch, Galopp und Polka – bediente, den stalinistischen Kulturfunktionären nicht gefallen konnte, liegt nahe.

Regisseur Armin Petras verzichtet glücklicherweise auf jeglichen Sowjetkitsch, mit dem das Werk gern auf die Bühne gebracht wird – zumal es in der der Entstehungszeit der Oper kaum eine gelangweilte Kaufmannsfrau gegeben hat. Er verlegt die Handlung aus dem Russland des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart und aus dem rund 300 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Mzensk in den Norden Sibiriens, nach Norilsk, einem der kältesten Orte der Welt. Die Unwirtlichkeit dieses Ortes, der 1935 von Zwangsarbeitern des stalinschen Gulag errichtet worden ist, korrespondiert mit der seelischen Kälte der Protagonisten. Katerina wird als Schwiegertochter eines russischen Oligarchen vorgestellt, der sie wie eine Leibeigene hält. Sie langweilt sich vor dem Fernseher. Materieller Wohlstand geht mit seelischer und körperlicher Grausamkeit einher.
Die zeitliche und geographische Verortung funktioniert und vermittelt eine Allgemeingültigkeit. Den Bezug zur Gegenwart Russlands oder auch allgemein zu autoritär und männlich dominierten Gesellschaften sollen die Zitate von Nadja Tolokonnikowa von Pussy Riot herstellen. Eines davon ist als Motto der Aufführung vorangestellt: „Macht haben nicht diejenigen, die über Gefangenentransporte verfügen, sondern diejenigen, die ihre Angst überwinden. Es ist ganz einfach: Hab keine Angst.“ Die Botschaften werden als Projektionen eingeblendet. Sie stören nicht, tragen aber aus meiner Sicht nichts Wesentliches zum Verständnis des Geschehens auf der Bühne bei.

Die Szene war gewissermaßen dreigeteilt. An den privaten Raum der Ismailows schließt sich nach Drehung der Bühne ein gekachelter Raum mit einer Dusche an. Oberhalb dieser Räume werden Videos – u.a. Schneetreiben, aber auch Aktionen der Protagonisten, projiziert. Daneben befindet sich eine freie Fläche, auf der ein Kinderpaar tanzt, sich Arbeiter zusammenfinden und wo sich die Erscheinung des ermordeten Boris mit seinem Sohn Sinowi trifft. Mitunter fällt es schwer, den Überblick über die gleichzeitig ablaufenden Aktionen zu behalten.
Nadine Lehner verkörpert eine beeindruckend glaubhafte Katerina Ismailowa. Sie singt und spielt die anspruchsvolle Rolle mit unglaublicher Bühnenpräsenz. Sicher beherrscht sie die verhaltenen lyrischen Passagen wie auch die dramatischen Ausbrüche. Ihr wird eine durch die Regie deutlich aufgewertete Aksinja zur Seite gestellt. Aus der Nebenrolle entwickelt die Bremer Interpretation eine Vertreterin der niederen Gesellschaftsschicht, die mit der altrussischen Tradition der Heilkraft in Berührung steht. Gestisch kommentiert sie die Handlungen der Katerina und verkörpert die einzige wirklich empathische Rolle. Der alte Zwangsarbeiter, in dessen Gestalt sich Schostakowitsch am Ende der Oper mit seinem Kommentar an das Publikum wendet, wirkte auf mich in Bremen hingegen eher distanziert.

Chris Lysack als Sergej und Patrick Zielke als Boris und auch Alexey Salyapin als schwächlicher Sinowi überzeugen ebenfalls stimmlich und darstellerisch. Die Spielfreude aller Darsteller wirkt ansteckend und vermittelt sich dem Publikum. Yoel Gamzou beherrscht das gewaltige Orchester. Ihm gelingen mitreißende Zwischenspiele und Steigerungen des Orchesters bis an die Schmerzgrenze, wobei er jedoch die Sänger nicht zudeckt. Mitunter malt er freilich mit einem etwas breiten Pinsel. Einige Details gehen im kompakten Orchesterklang unter.
Armin Petras traut der Komposition und verzichtet darauf, was die Musik detailfreudig illustriert, auf der Bühne vorzuführen. Dies empfand ich als erfreulich, da durch die optische Zurückhaltung Peinlichkeiten oder gar unfreiwillige Komik vermieden werden. Ihm gelingen eindrucksvolle Szenen. Ausgesprochen ärgerlich sind allerdings die eigenwilligen und geradezu brutalen Eingriffe in die Struktur des Werkes. Bei Barockopern können Kürzungen sinnvoll sein – bei musikdramatischen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts verfälschen sie das Werk.
Warum man sich in Bremen entschloss, wichtige, für das Verständnis der Handlung erforderliche Szenen zu streichen und zum Teil durch gesprochene Dialoge zu ersetzen, vermag ich nicht nachzuvollziehen. Konnte man die Rollen des Popen, der Aksinja und des Polizeichefs sängerisch nicht adäquat besetzen?

Schlüsselszenen gingen dabei eher beiläufig unter, z.B. der "Ringkampf" zwischen Katerina und Sergej. Hier deutet sich bereits an, dass Katerina dem "Rudelführer" bei der Vergewaltigung der Aksinja verfallen ist, was dem Schwiegervater nicht entgeht. Die Musik, die diese Ambivalenz zwischen der Zurechtweisung Sergejs und der Faszination für ihn hörbar macht, fehlt jedoch. Gestrichen wurden u.a. die Auffindung des vergifteten Boris, die "Totenklage" der Katerina, in der Schostakowitsch das angeordnete Flehen des Volkes um einen neuen Zaren aus Boris Godunow parodiert sowie die essentiellen Chorszenen des Dritten Aktes. Eigenwillig ist die Platzierung der Pause unmittelbar nach der Passacaglia mit ihrer gewaltigen Orchesterklimax, die eigentlich vom Tod des Schwiegervaters zur Liebeszene mit dem aus dem Gewahrsam befreiten Sergej überleitet.
Diskutabel und interessant finde ich, dass Armin Petras bei der Exkulpierung der Katerina Ismailowa selbst über die spürbare und in Musik gekleidete Zuneigung des Komponisten hinausgeht. Eigentlich begeht Katerina keinen Mord – zumindest habe ich keinen gesehen. Wer das Gift unter die Pilze gemischt hat, war nicht recht zu erkennen. Wenn ich es richtig wahrgenommen habe, hätte es auch Aksinja gewesen sein können.
Katarinas Ehemann Sinowi wird wie in der Partitur als unbeholfener Schwächling gezeichnet, hier ist er überdies auf ein Beatmungsgerät angewiesen (was er offenkundig während seiner Abwesenheit bei der Inspektion der weit entfernt liegenden Mühle nicht benötigt). Dieses Handicap enthebt Katerina der nun unausweichlichen Mordtat. Als Sinowi bei der Auseinandersetzung nach seiner unverhofften Heimkehr einen Asthmaanfall erleidet, enthalten ihm die Liebenden den Griff zum rettenden Sauerstoffschlauch vor. Hier treibt es der Regisseur mit der „Rehabilitierung“ der Katerina freilich etwas weit.

Nach der unterlassenen Hilfeleistung entsorgen die Beiden den Leichnam in der Biotonne. Ausgerechnet dort vermutet dann der Schäbige einen guten Tropfen, um seiner Alkoholsucht zu frönen. In der sehr anspruchsvollen – durchaus auch dankbaren – Passage, in der der „Schäbige“ seine Liebe zum Alkohol und die verkorksten Familienverhältnisse besingt, gelingt es Luis Olivares Sandoval nicht ganz, die Textfülle in der Originalsprache über das Orchester zu bringen.
Wer sich nun auf die köstliche Szene freut, in der die sich langweilenden Polizisten den Dienst und ihre schlechte Bezahlung beklagen sowie darüber nachdenken, welchen Vorwand sie finden könnten, um auch ohne Einladung von der Hochzeitsfeier bei den Ismailows zu profitieren, wird bitter enttäuscht. Ohne Umschweife platzt der Schäbige in die Diskussion mit dem Nihilisten über die Seele der Frösche, die anderenorts gern übersprungen wird. Es ist schwer zu verstehen, dass ausgerechnet die Satire auf den Obrigkeitsstaat und die allgegenwärtige Korruption, die zu den musikalischen und textlichen Highlights der Oper gehört, einfach gestrichen wird. In dem folgenden Zwischenspiel eilen die mit sichtlicher Freude agierenden Polizisten zu der in hektischen Videosequenzen gezeigten Hochzeit. Zu spät! Bei ihrer Ankunft ist die Hochzeitsgesellschaft bereits zum Standbild erstarrt, lediglich das Hochzeitspaar erwacht angesichts der bevorstehenden Verhaftung aus der Starre. Auch die gewaltige Chorszene mit dem besoffenen Popen fiel der unerklärlichen Streichwut zum Opfer. Es fühlt sich an, als hätte man beim „Ring des Nibelungen“ den „Walkürenritt“ gestrichen.
Aksinja, die in der Inszenierung als proletarisches Alter ego von Katerina fungiert und die in dieser Deutung als einzige zu Empathie fähig ist, tritt mit einem Akkordeon vor die Bühne und stimmt ein mir unbekanntes Lied an, das dann durch den Chor aufgenommen wird. Dieser stilistische Bruch bildet die Überleitung zum Vierten Akt. Die vom Chor der Verbannten aufgenommene Klage des alten Zwangsarbeiters über die unmenschlichen Verhältnisse wird ergreifend gestaltet und sorgt für Gänsehaut. Auch szenisch gelingen eindringliche Momente. Der große Ausbruch des Orchesters, der die Verzweiflung Katerinas ausdrückt und ihren Schlussmonolog eröffnet, wird durch eine Banda auf der Bühne in seiner Wirkung gesteigert. Die Handlung endet, bevor Katerina sich gemeinsam mit Sonjetka umbringen kann. Ihr Monolog geht unmittelbar in den das Werk beschließenden Chor der Zwangsarbeiter über.
Erfreulich war, wie das Bremer Publikum im ausverkauften Haus dem Geschehen auf der Bühne – weitestgehend hustenfrei – folgte und auch eine angemessene Pause zu den stehenden Ovationen zuließ. Alle Sänger des Abends, besonders aber der Dirigent Yoel Gamzou und die Bremer Philharmoniker wurden begeistert gefeiert. Beim Publikum lassen die ausgewogene Altersstruktur und das Interesse auf Neues für die Institution Musiktheater hoffen. Wie den Pausengesprächen zu entnehmen war, dürfte es für die meisten Zuschauer die erste Begegnung mit dem Werk gewesen sein. Deshalb empfand ich den sehr eigenwilligen Umgang mit der musikalischen Struktur des Werkes als bedauerlich und irreführend.
Michael Rudloff 30.12.2017
Bilder (c) Theater Bremen
RUSALKA
Premiere am 11.11.2017
Die Natur versteckt sich auf dem Dachboden
Antonín Dvořáks romantische Märchenoper „Rusalka“ mit ihrer schwelgerischen Musik wird im norddeutschen Raum eigentlich viel zu selten gespielt - weltweit ist das anders. Auch in der Reihe der Übertragungen von der Metropolitan Opera wurde sie schon zweimal berücksichtigt. Da kann man dankbar sein, dass das Bremer Theater das herrliche Werk jetzt auf den Spielplan gesetzt hat.

Von den zehn Opern Dvořáks ist „Rusalka“ seine bekannteste und erfolgreichste. Zwar gilt „Die verkaufte Braut“ von Smetana als tschechische Nationaloper, aber diesen Rang könnte „Rusalka“ auch für sich beanspruchen. Die Oper entstand im Jahr 1900, danach folgte nur noch „Armida“. Die märchenhafte Handlung um eine Nixe macht „Rusalka“ zu einer tschechischen Schwester von Lortzings 1845 uraufgeführter „Undine“.
Die Geschichte handelt von der Nixe Rusalka, die unbedingt ein Mensch werden will, weil sie sich in einen Prinzen verliebt hat. Die Hexe Ježibaba erfüllt ihr den Wunsch, allerdings um den Preis, dass sie stumm bleiben muss. Der Prinz wendet sich von ihr ab und Rusalka kehrt als Irrlicht in das Reich des Wassermanns zurück. Von ihrem Fluch kann sie nur durch den Tod des Prinzen befreit werden. Sie bringt das nicht übers Herz, aber der Prinz, inzwischen von Sehnsucht nach Rusalka erfüllt, folgt ihr freiwillig in den Tod.

Regisseurin Anna-Sophie Mahler hat in ihrem Konzept das Märchenhafte vollkommen ausgespart. Es gibt im Bühnenbild von Duri Bischoff keinen See und keine Naturstimmung. Man sieht nur einen schäbigen Dachboden mit Wasserflecken an der Decke und Tapeten, die sich von den Wänden lösen. Für das Schloss des Prinzen kommen ein Sofa und eine Stehlampe auf die jetzt in etwas freundliches Licht getauchte Bühne. Aber letztlich bleibt es doch der unwirtliche Dachboden. Mahler hat die Beziehung zwischen dem Wassermann und Rusalka als Konflikt zwischen Vater und Tochter umgedeutet. Rusalka will sich von ihrer Kindheit (für die steht symbolisch dieser Dachboden) lösen und den Entwicklungsschritt zur jungen Frau vollziehen, wobei der Vater sie aber nicht gehen lassen will.
Die grünen Kleider von Rusalka und den anderen Nixen (Kostüme von Geraldine Arnold) geben nur einen sanften Hinweis auf das Wasserreich. Allerdings erinnern die Szenen vom Wassermann und seinen „Töchtern“ mit ihrer latenten Erotik an Alberich und die Rheintöchter.

Rusalka kommt natürlich nicht in der Welt des Prinzen zurecht. Beide sitzen beziehungslos auf besagtem Sofa. Vor seinen Annäherungen schreckt sie zurück. Wenn der Prinz sich mit der signalrot gekleideten Fürstin vergnügt und die Hofgesellschaft das Hochzeitskleid für Rusalka präsentiert, wirkt das fast zynisch. Zur aufwühlenden Orchestermusik stößt sie einen stummen Schrei aus - eine der gelungensten Szenen dieser Inszenierung. Das Hochzeitskleid presst sie bei ihrer Rückkehr als Relikt ihres verlorenen Glücks fest an sich.
Rusalkas Sprachlosigkeit deutet Mahler als ein Trauma; die fremde Fürstin, die den Prinzen verführt, ist hier die personifizierte Angst Rusalkas. Die Hexe kann als böse Stiefmutter gedeutet werden. Der Schluss sieht bei Mahler anders aus als im Original: Den Todeskuss gibt Rusalka nicht dem Prinzen sondern dem Wassermann. Das bedeutet ihre endgültige Befreiung. Dvořáks verklärende Musik kündet vom Glück in einer anderen Welt.

Bei dieser Inszenierung steht eher Sigmund Freud Pate und weniger Hans Christian Andersen. Mahler setzt ihr Konzept aber mit so ausgefeilter Personenführung und schlüssiger Aktion um, dass diese Umdeutung durchaus funktioniert. Zudem kann man sich über durchweg ausgezeichnete Sängerleistungen freuen: Patricia Andress gibt dem „Lied an den Mond“ zwar einen sehnsuchtsvollen Klang, findet aber erst danach mit leuchtenden Tönen zu großer Form. Die seelischen Nöte verdeutlicht sie mit sehr nuanciertem Spiel. Nadine Lehner ist als Fürstin eine elegante Verführerin der Sonderklasse - stimmlich und auch Kraft ihrer Bühnenpräsenz. Romina Boscola ist eine ebenso herzlose wie dämonische Hexe, mit imponierendem Mezzo und einer Ausdrucksintensität, die an eine Ortrud denken lässt. An Ausdruck und Intensität mangelt es auch Claudio Otelli nicht, der dem Wassermann nachhaltiges Profil gibt. Hinter seiner Maske des Biedermanns lauern Abgründe. Luis Olivares Sandoval begeistert als Prinz mit warmer, ergiebiger Tenorstimme. Für die Nymphen tritt mit Iryna Dziashko, Nathalie Mittelbach, und Anna-Maria Torkel ein stimmschönes Trio an. Der Jäger ist bei Loren Lang gut aufgehoben. Nicht zu vergessen ist die gute Leistung des von Alice Meregaglia einstudierten Chores.

Hartmut Keil, der neue 1. Kapellmeister, überzeugt am Pult der Bremer Philharmoniker ohne Einschränkung. Er bringt Dvořáks herrliche Musik glanzvoll zum Klingen, er lässt sie funkeln und aufblühen. Der romantische Duktus - hier wird er aufs Glücklichste getroffen.
Wolfgang Denker, 14.11.2017
Fotos von Jörg Landsberg
CANDIDE
Premiere am 14.10.2017
In zwei Stunden um die Welt und darüber hinaus

In seinem satirischen Schelmenroman „Candide“ rechnet der französische Philosoph Voltaire u.a. mit der Gedankenwelt des Optimismus von Gottfried Leibniz und mit der katholischen Kirche ab. Er wendet sich gegen Absolutismus, Dogmatismus und Dummheit. Dabei ist ein Werk entstanden, in dem „jede Seite in einem anderen Land spielt und jeder Absatz ein neues Abenteuer bringt“, wie der Satiriker John Wells es ausdrückte. Gleichwohl sah Leonard Bernstein in dieser Vorlage eine reizvolle Möglichkeit, dem selbstzufriedenen Amerika der Ära Eisenhower mit seinen politischen Verhältnissen (McCarthy) eins auszuwischen. Aber auch sein Musical ist, trotz mehrfacher Überarbeitung, von verwirrender Handlungsfülle, was Loriot zu dem Bonmot veranlasste, es sei das einzige Stück seiner Art, „dessen Inhaltsangabe, rasch vorgetragen, ebenso lange dauert, wie das Musical selbst“. Schon bei der Uraufführung (Boston 1956) merkte die Kritik an, das Musical müsse drastisch gekürzt werden, vor allem im zweiten Akt.

In Bremen wurde eine 1999 entstandene Fassung von John Caird gespielt, die insbesondere den philosophischen Gehalt wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Hier dauert Candides abenteuerliche Reise um die „beste aller möglichen Welten“, bei der er mit Naturkatastrophen, Krieg, Inquisition, Fanatismus und allen denkbaren Schlechtigkeiten der realen Welt konfrontiert wird, noch gut zweieinhalb Stunden. Und Bernsteins feinsinnige, oft zündende Kompositionen mit ihren rhythmischen Finessen, die er für diese Musiksatire in bester Tradition eines Arthur Sullivan ersann, entzückten ohne Einschränkung. Das beginnt bereits mit der hinreißenden Ouvertüre, die im Kern schon fast die gesamte Musik enthält, und setzt sich über die kniffligen Ensembles bis zum anrührenden, hoffnungsvollen Finale fort. Bernstein nannte die Musik zu „Candide“ eine Liebeserklärung an die europäische Musik, was sich in vielen Tanzformen wie Mazurka, Polka, Walzer und Gavotte niederschlägt.
Jeder Regisseur, der „Candide“ inszenieren will, steht vor immensen Schwierigkeiten. Marco Štorman hat einen eigenen, sehr originellen Weg gefunden. Er verzichtet darauf, die im gefühlten Sekundentakt wechselnden Schauplätze auch nur ansatzweise zu bebildern. Das Herzstück der von Jil Bertermann gestalteten Bühne ist eine riesige Spiegelwand im Hintergrund, mit der die Inszenierung geradezu zaubert. Diese Spiegel werden laufend verändert: Sie scheinen zu zerspringen, formen räumliche Gebilde oder setzen sich wieder zusammen.

So entstehen, auch dank perfekter Lichtregie (Christian Kammermüller), immer wieder neue Ansichten und Eindrücke. In dieser Inszenierung macht Candide sogar einen Ausflug ins Weltall. Mit den Spiegeln wird das Schweben der Astronauten perfekt vorgegaukelt. Štorman hat seine Inszenierung (zusammen mit Alexandra Morales) perfekt durchchoreographiert. Der Ritt zu Pferde, die Fahrt über stürmisches Meer, ein Stierkampf in Spanien oder das Erdbeben - alles wird von den Solisten und vom Chor nur durch Bewegungen und Körpersprache verdeutlicht. Die Naturgewalten werden zusätzlich durch akustische Effekte imaginiert. Das verheißungsvolle Lan El Dorado wird durch ein Tor in leuchtenden Regenbogenfarben symbolisiert. Der Garten, in den sich Candide und Cunegonde zurückziehen wollen, ist allerdings ein Stacheldrahtverhau - nicht gerade ein Zeichen von Optimismus.
Besonders beeindruckend sind die mit viel Phantasie und Symbolkraft entworfenen Kostüme von Bettina Werner, ob es nun um die historischen Soldatengewänder, den Prozessionszug eines mexikanischen Totenkults, die Vertreter der Kirche mit ihren überdimensionalen Köpfen, der Goldrausch bei dem wie ein fröhliches Volksfest gestalteten Autodafe, die Astronautenanzüge oder die „Old Woman“ handelt, die hier eher ein heißer Feger in knalligem Rot ist - dem Auge wird viel geboten. Es ist eine Inszenierung, bei der man gut unterhalten wird und der Tiefgang der Gedanken trotzdem zu seinem Recht kommt.
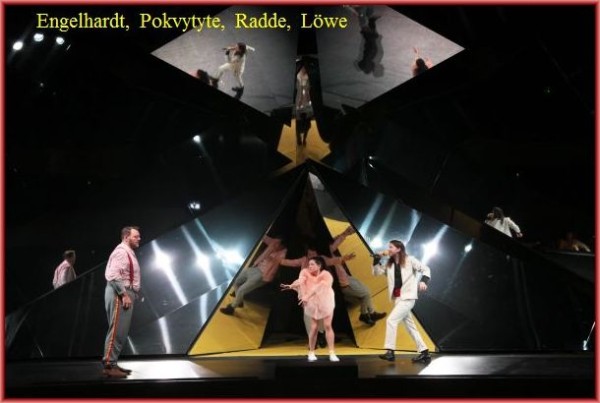
Aber: Die vielen gesprochenen Texte, die man auf der Textanlage gar nicht so schnell verfolgen kann, in englischer Sprache zu bringen, grenzt schon an Arroganz. Die Absicht, den philosophischen Gehalt mehr in den Vordergrund zu rücken, wird dadurch völlig konterkariert. Man musste sich entscheiden: Bühne oder Textanlage - entweder oder. Dies ist ein entscheidendes Manko der Produktion. Dadurch wird einiges an Wirkung verschenkt.
Musikalisch ist alles bestens. Wenn man von der Ouvertüre absieht, die man schon pfiffiger und eleganter gehört hat, können die Bremer Philharmoniker unter Christopher Ward durchgängig überzeugen. Uneingeschränkt vergnüglich gelingt die Quirligkeit bei dem Song „What’s the Use“, den Bernstein erst später in die Partitur einfügte und der eine der besten Nummern ist.
Die Titelpartie, diesen amerikanisch-französischen Simplicissimus, singt Christian-Andreas Engelhardt, dem hier eine seiner besten Leistungen gelingt. Sein Tenor entwickelt Schmelz und Kraft, die Gefühle Candides finden in seinem Gesang und seiner Darstellung oft berührenden Ausdruck. Der bekannteste „Schlager“ der Partitur ist Cunegondes Bravour-Arie „Glitter and Be Gay“, eine Art Parodie auf Gounods „Juwelenarie“, die von Nerita Pokvytyteté mit leichtfüßiger Souveränität und einem Augenzwinkern serviert wird. Aber auch Natalie Mittelbach als „alte Dame“ beeindruckt mit sinnlichen, frivolen Mezzotönen. Die zentrale Rolle des Dr. Pangloss, dem für Leibniz stehen Hauslehrer Candides, wird von dem Schauspieler Holger Bülow gestaltet, der der Rolle Züge eines dämonischen Mephisto verleiht und zudem respektable gesangliche Fähigkeiten entwickelt. Sein Gegenspieler Voltaire, der als Erzähler und Spielmacher wirkt und auch in die Handlung eingreift, findet in Moritz Löwe einen suggestiven Interpreten. Unter den vielen weiteren Partien seien die bestens agierenden Irina Dziashko als Paquette und Birger Radde als Maximilian erwähnt. Der Chor zeigt sich in der Einstudierung von Alice Meregaglia in bester Form und darf gegen Ende auch vom zweiten Rang und in den Gängen im Parkett singen.
Wolfgang Denker, 15.10.2017
Fotos von Jörg Landsberg
OPERNFREUND CD TIPP
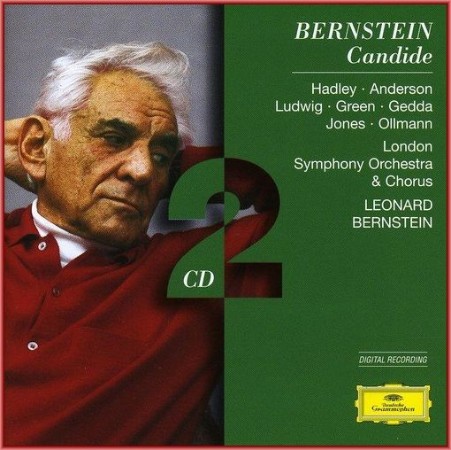
LADY MACBETH VON MZENSK
Premiere am 10.09.2017
Sex and Crime in Sibirien

Zur Saisoneröffnung in Bremen hat Armin Petras die Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ von Dmitri Schostakowitsch inszeniert. Die musikalische Leitung hatte der neue Bremer Musikdirektor Yoel Gamzou. Gesungen wurde in russischer Sprache.
Schostakowitsch plante seine „Lady Macbeth von Mzensk“ als tragisch-satirische Oper; sie sollte der erste Teil einer Trilogie über „die Lage der Frauen in verschiedenen Epochen der russischen Geschichte“ sein. Das Werk hatte zunächst großen Erfolg, bis Stalin es faktisch verbieten ließ und der berüchtigte Artikel „Chaos statt Musik“ 1936 in der Prawda erschien, der den Beginn einer beispiellosen Kampagne gegen den Komponisten einleitete. Nach Stalins Tod kam die Oper auch wieder auf die Spielpläne, wobei sich seit 1979 die ursprüngliche Fassung, die auch in Bremen gespielt wurde, gegenüber der Überarbeitung „Katerina Ismailowa“ von 1963 zu Recht durchgesetzt hat.

Armin Petras arbeitet in seiner insgesamt dem Werk angemessenen Regie in zwei Ebenen: Das Bühnenportal ist in gleichgroße Hälften geteilt. In der oberen werden auf eine Leinwand Videos, Fotos und Texte (von Nadja Tolokonnikowa, der Begründerin der Band Pussy Riot) projiziert, in der unteren sind mittels Drehbühne die verschiedenen Spielräume zu sehen. Die Fotos zeigen Ansichten der Industriestadt Norilsk, einem der kältesten Orte der Welt, wo die Regie die Handlung verortet hat. Die Videos von Rebecca Riedel verdoppeln das Geschehen oft in Großaufnahme oder zeigen Dinge, die auf der eigentlichen Bühne nicht zu sehen sind. Gleichwohl - es ist oft zu viel des Guten und lenkt von der durchweg spannenden Personenführung ab. Die Bühnenbilder von Susanne Schuboth sind sehr unterschiedlich und wechseln sehr häufig. Da gibt es die spießig, überladene Wohnstube, in der später auch die Hochzeitsfeier stattfindet.

Daneben gibt es die schäbigen Umkleideräume der Arbeiter, in denen die brutale Vergewaltigung der Köchin (Hanna Plaß, die auch ein tieftrauriges Solo mit Akkordeon beisteuert) stattfindet, sowie den kalt-weiß gekachelten Waschraum, in dem Katerina und Sergej es treiben, einschließlich der „Zigarette danach“. Eine Außenansicht zeigt Schneeflocken, eine Feuerstelle, ein allegorisches Kinder-Tanzpaar (Adelina Mazakow und Michael Nuss) und eine gelbe Mülltonne, in der der ermordete Sinowi entsorgt wird. Am Schluss im Gefangenenlager verschwindet die Leinwand und gibt den Blick auf einen Turm frei, von welchem sich Katerina in den Tod stürzt und Sergejs neue Geliebte Sonjetka (Ulrike Mayer) mitreißt.
Petras gelingt die Charakterisierung der Personen eindringlich: Katerina, die sich langweilt und nach körperlicher Liebe sehnt, ihren Schwiegervater Boris als aufgeblasenen und rücksichtslosen Machtmenschen, den Arbeiter Sergej als schwanzgesteuerten Egomanen. Die skurrilen Momente der Oper werden durch den Polizeichef (Loren Lang), den Popen (Christoph Heinrich) und den Schäbigen (Luis Olivares Sandoval), der die Leiche in der Mülltonne entdeckt, verdeutlicht. Bei den drastischen Szenen wie der Vergewaltigung oder der Auspeitschung von Sergej geht die Regie schonungslos zur Sache, findet im Schlussakt aber auch zu stillen, berührenden Bildern.

Zur Sache geht auch Yoel Gamzou mit den Bremer Philharmonikern, der die Expressivität der Musik fast nur mit Fortissimo-Gewalt, dabei aber temporeich und rhythmisch umsetzt. Zumindest im ersten Teil wird jedenfalls alles ins Extreme getrieben. Im zweiten Teil findet Gamzou dann zu einer differenzierteren Lesart, bei der es auch mal zu ruhigerer Gangart mit Piano-Kultur kommt. Eine ausgezeichnete Leistung erbringt der Chor (Alice Meregaglia).

Die Titelpartie wird von Nadine Lehner gestaltet, die schon allein mit ihrer ausgeprägten Persönlichkeit überzeugt. Ihren ausdrucksvollen Sopran führt sie, ganz im Sinne der Rolle, bis an schrille Grenzen, kann aber im letzten Akt auch innige und warme Töne liefern. Chris Lysack singt den Sergej mit eher robustem Tenor. Geschmeidiger klingt da Alexey Sayapin als verschmähter Ehemann Sinowi. Die beeindruckendste Leistung liefert Patrick Zielke als Boris. In seinem Anzug mit Krawatte wirkt er wie ein schmieriger Mafia-Boss - ein Vollblut-Darsteller, der Komik und Verschlagenheit perfekt verbindet. Sein runder, dunkler Bass sorgt für Gänsehautmomente.
Wolfgang Denker, 11.09.2017
Fotos von Jörg Landsberg
THE FAIRY QUEEN
Premiere am 21.05.2017
Vor allem musikalisch lohnend

Das auf Shakespeares „Sommernachtstraum“ basierende, 1692 uraufgeführte Werk „The Fairy Queen“ von Henry Purcell, dem wohl bedeutendsten englischen Barockkomponisten, gehört zur eigentümlichen Gattung der Semi-Oper, die eine Mischung aus Oper, Schauspiel und Tanzabend darstellt. Unvergessen sind im norddeutschen Raum die Produktionen in Oldenburg (2004) und Bremerhaven (2001), bei denen fulminantes Totaltheater geboten wurde.
Ähnlich geglückt ist in Bremen leider nur die musikalische Seite. Und das ist in erster Linie Olof Boman und den Bremer Philharmonikern zu danken, die aus dem halb hochgefahrenen Orchestergraben musizieren. Die reiche Erfahrung, die Boman mit Barockmusik hat, ist in jedem Takt spürbar. Boman sichert der Musik Purcells Farbenreichtum und Individualität. Die kleine, mit Barockinstrumenten angereicherte Besetzung der Philharmoniker erweist sich dabei als bestens aufgestellt und an allen Pulten sehr kompetent. Allein die schmetternden Trompeten sind für sich schon ein Ereignis.

Das kann man über die Inszenierung von Robert Lehniger leider nicht sagen. Die Bühne ist eine sterile Raumlandschaft und soll eine Art Schlaflabor darstellen. Im Zuschauerraum verteilte Chorsänger werden von den Elfen, die in ihren weißen Anzügen an Klinikpersonal erinnern, auf die Bühne geholt, um in dem experimentellen Institut „The Forest“ ihre geheimen Wünsche ausleben zu können. Titania (Irene Kleinschmidt) und Oberon (Helge Tramsen), Lysander (Christoph Vetter) und Hermia (Meret Mundwiler), Demetrius (Julian Anatol Schneider) und Helena (Lina Hoppe) sowie Puck (Parbet Chugh) und Zettel (Justus Ritter) - sie alle werden von Schauspielern dargestellt, denen viel Action bis hin zur handfesten Prügelei abverlangt wird. Die Gesangspartien sind den Elfen zugeordnet. Iryna Dziashko und Nerita Pokvytyté (Sopran), Hyojong Kim (Tenor), Birger Radde (Bariton), Christoph Heinrich (Bass) sowie John Lattimore (Countertenor) erweisen sich dabei als stilsicheres und weitgehend schlagkräftiges Ensemble. Und der von Alicia Meregaglia einstudierte Chor überzeugt mit einer hervorragenden Leistung.

Regisseur Lehniger arbeitet wieder einmal mit Videos und Live-Kameras - eine Spezialität von ihm. Zudem begeht er die „Todsünde“, an vielen Stellen in die Musik reinquatschen zu lassen. Die textliche Bearbeitung mit Klauern wie „Kein Triangel hat je geangelt“ von Durs Grünbein ist dabei oft grenzwertig. Für Zuschauer, die den „Sommernachtstraum“ nicht kennen, dürfte die eigentliche Handlung nur schwer nachzuvollziehen sein. Und die Posse um Pyramus und Thisbe, die eigentlich von den Handwerkern aufgeführt wird, gerät hier zu einer reichlich albernen Einlage, bei der der Schwanz eines Löwen zur tödlichen Waffe wird. Charme, Erotik, Phantasie und zauberische Stimmung sind Zutaten, die dieser Inszenierung völlig fehlen. Da hilft auch die manchmal aparte Lichtregie von Christian Kemmetmüller nicht mehr viel. Selbst die Choreographie von Emmanuel Obeya beschränkt sich auf unmotivierte, zuckende Bewegungen. Am Ende ist das Kind, um das sich Titania und Oberon streiten, erwachsen. Die „Eltern“ sind alt und gebrechlich geworden, Oberon sitzt sogar im Rollstuhl. Beider Traum scheint es zu sein, sterblich zu werden. „One charming night gives more delight than a hundred lucky days“ ist auf einer Projektion zu lesen. Diese Inszenierung macht die Aussage nicht nachvollziehbar.
Wolfgang Denker, 22.05.2017
Fotos von Jörg Landsberg
IL TABARRO & GIANNI SCHICCHI
Premiere am 16.04.2017
Hauptsache anders
Giacomo Puccinis „Il Trittico“ besteht aus drei kurzen, sehr unterschiedlichen Opern. Wenn man eine davon weglässt, in diesem Fall die „Suor Angelica“, bleiben immer noch zwei im Charakter gegensätzliche Werke. Regisseur Martin G. Berger hat nun den Versuch unternommen, „Il Tabarro“ und „Gianni Schicchi“ zu einer Einheit zu verschmelzen. Zwingend ist das nicht - Hauptsache anders. Dabei ist der Trick eigentlich gut ausgedacht: Die Personen des „Gianni Schicchi“ sind hier Filmleute, die in einer alten Villa den gesellschaftskritischen Film „Il Tabarro“ drehen. Es ist ein Film im Stil des Film Noir mit deutlichen Anspielungen an „Der Swimmingpool“ (mit Romy Schneider und Alain Delon). Bei den Dreharbeiten stirbt der Geldgeber Buoso Donati, der im „Tabarro“ den Luigi gespielt hat. Damit ist die Brücke zum „Gianni Schicchi“ geschlagen, denn Buono Donati ist der Tote, dessen Testament im „Gianni Schicchi“ gefälscht wird. Dieser Übergang zwischen den ohne Pause gespielten Opern ist glänzend gelungen. Aber um welchen Preis!

Während des gesamten „Tabarro“ ist das Geschehen auf der Bühne nur schemenhaft durch einen Gaze-Vorhang zu sehen. Auf der Bühne (Sarah-Katherina Karl) befindet sich besagter Swimmingpool (den die Sänger wiederholt in voller Montur besteigen). Puccini hat in seiner Musik aber das fließende Wasser der Seine so deutlich komponiert - da ist der Pool keine wirkliche Alternative. Zwei Live-Kameras übertragen vorwiegend die Gesichter der Sänger auf eine Leinwand. Blicke und Gesten haben natürlich große Bedeutung, aber eine ganze Oper nur als Projektion ist ermüdend. Ton und Bild sind dabei immer um Sekundenbruchteile auseinander, was auf Dauer störend ist. Auch die Textanlage versagte anfangs für längere Zeit. Immer wieder wird die Musik unterbrochen, wenn jemand aus dem Film-Team „Cut!“ und „Action!“ ruft. Dass am Ende doch ein wenig Spannung aufkommt, ist vor allem den guten Leistungen von Loren Lang als Michele, Patricia Andress als Giorgetta und Luis Olivares Sandoval als Luigi zu danken, aber nicht dem Regiekonzept.

Lang ist für den alternden Michele eine gute Besetzung, er gestaltet die Partie sehr differenziert und glaubwürdig. Sein Monolog „Nulla! Silenzio!“ besticht durch Intensität. Luis Olivares Sandoval singt den Luigi mit lodernder Leidenschaft und kraftvollem Tenor. Wenn sich seine Stimme mit der von Patricia Andress im Liebesduett vereint, bleiben kaum Wünsche offen. Wohl aber an die musikalische Leitung von Hartmut Keil, denn Puccinis feine, raffinierte Stimmungsmalerei geht in seiner Einheitslautstärke ziemlich unter. Erst im dramatischen Schluss kann Keil überzeugen. Aber vielleicht ist der zwiespältige Eindruck auch ein wenig der Regie anzulasten, denn die Sänger sind oft so ungünstig postiert, dass es zu Lasten der Balance zwischen Stimmen und Orchester geht.

Auch beim „Gianni Schicchi“ führen die Vorstellungen des Regisseurs zu wiederholten Unterbrechungen der Musik. Zwar wird auf Videotechnik hier weitgehend verzichtet und die Handlung spielt sich „normal“ auf der Bühne ab. Aber bei Berger hat Donati seinen Tod nur vorgetäuscht, um die Reaktion seiner Verwandten (hier des Filmteams) zu testen. Der Schauspieler Mateng Pollkläsener tritt als quicklebendiger Donati immer wieder erläuternd auf, auch um Sätze wie „Darf man Zigeunerschnitzel sagen?“ anzubringen. Gleichwohl spielt sich die Komödie turbulent und mit viel Aktion ab, auch wenn man den feineren Witz vermisst. Dafür gibt es Einfälle wie den Arzt Spinelloccio (Wolfgang von Borries) nur über Skype auftreten zu lassen. Und die Schlussworte des Gianni Schicchi werden diesmal Buoso Donati überlassen, allerdings hier recht belanglose ohne den Bezug zu Dante.

Vom Klang und der Dynamik liegt Keil hier besser als beim „Tabarro“. Seine Wiedergabe hat Tempo und Drive. Mit Patrick Zielke steht ein Vollblutkomödiant als Gianni Schicchi auf der Bühne. Seine lässige und spitzbübische Lesart der Partie kann darstellerisch und stimmlich überzeugen. Nerita Pokvytytè singt als Lauretta die Wunschkonzertarie „O mio babbino caro“ mit der ansprechenden Leichtigkeit, die Luis Olivares Sandoval in der Partie des Rinuccio vielleicht etwas fehlt. Loren Lang ist hier der ehrwürdige Simone. Das insgesamt spielfreudige Ensemble ist in beiden Opern eingesetzt, was ja dem Regiekonzept auch entspricht. Hervorzuheben sind Christian-Andreas Engelhardt (Il Tinca und Gherardo), Nathalie Mittelbach (La Frugola und Ciesca) und Birger Radde (Marco). Begeisterter Beifall für die Sänger, für die Regie gab es auch ein paar Buhrufe.
Wolfgang Denker, 17.04.2017
Fotos von Jörg Landsberg
LA DAMNATION DE FAUST
Premiere am 18.03.2017 besuchte Aufführung: 29.03.2017
Jekyll und Hyde in der Klinik

Hector Berlioz hat sein Werk „La Damnation de Faust“ („Fausts Verdammnis“) nicht für szenische Aufführungen konzipiert. Es ist eine Mischung aus Oratorium, Oper und Sinfonie mit Chor und Solisten. Berlioz hat die Szenen und Motive aus Goethes Drama, die ihn besonders ansprachen und inspirierten, zu einer Art Collage zusammengefügt, ohne dabei auf die Dramaturgie einer durchgehenden Handlung zu achten, wie es etwa Gounod in seiner „Faust“-Oper getan hat. Und er ging mit dem Stoff sehr frei um. Die erste Szene spielt in Ungarn - und das nur, um den effektvollen Ungarischen Marsch einfügen zu können. Auch das Ende wird zu Gunsten einer opulenten Höllenfahrt verändert: Méphistophélès führt Faust nach dem Pakt direkt in die Verdammnis.

Die Brüche in den locker aneinandergereihten Szenen dieser „Dramatischen Legende“, wie Berlioz sein Werk bezeichnet hat, nahm Regisseur Paul-Georg Dittrich zum Anlass für eine Art assoziatives Theater. Wer einen logischen Handlungsfaden für diese Inszenierung sucht, wird scheitern. Es sind die Bilder, die in Kombination mit der Musik ihre besondere Wirkung entfalten. Ein Steg führt vom Bühnenrand bis weit in den Zuschauerraum. Dort befindet sich Faust, der rastlos hin und her trippelt, gefangen in tiefster Depression. Dabei wird er von zwei Handkameras gefilmt und die Bilder werden auf eine Leinwand auf der Bühne projiziert. Eine ähnliche Anordnung hatte Benedikt von Peter bei „Mahler III“ entworfen. Auf der Leinwand sind auch Bilder von einem Flug über den Wolken, ein EKG oder bruchstückhafte Goethe-Zitate zu sehen.

Faust hängt am Sauerstoff-Tropf: Er trägt einen Behälter mit einem Bonsai-Bäumchen auf dem Rücken und wird so mit Sauerstoff versorgt. Nach seinem Selbstmordversuch wird er in einer Klinik behandelt. Das kommt hier einer rituellen Waschung gleich. Das Personal hält Schilder mit Aussagen wie „Die ganze Welt ist mir vergällt“ oder „Einzig mein Herz bleibt kalt“ in die Höhe. Überhaupt Klinik - in dieser Irrenanstalt scheint sich zunächst alles nur in Fausts Kopf abzuspielen. Méphistophélès ist dabei das Alter Ego von Faust, die dunkle Seite in seiner Psyche. Beide sind rothaarig und ganz in Weiß gekleidet. Es ist so wie bei Jekyll und Hyde. Auerbachs Keller gibt es nicht. Die Figur des Brander (kraftvoll Christoph Heinrich) mutiert hier zu einer knallbunten, skurrilen Putzfrau in der Klinik.
Die Bühne ist überwiegend mit weißen Laken verhängt und wird von kaltem Neonlicht geflutet. Die Ausstattung von Pia Dederichs und Lena Schmid verstärkt den Eindruck eines rituellen Mysterienspiels. Dazu gehört auch die Chorführung von Dittrich, der die Sängerinnen und Sänger mitunter auf den Seitengängen oder auf besagtem Steg auftreten lässt. Das erzeugt oft ein berückendes Klangerlebnis. Der Kinderchor tritt hier als koboldartige, dunkel gekleidete Schar von Zwergen auf, die der Welt des Méphistophélès angehören.

Marguerite im silbernen Latexanzug bewegt sich zunächst wie eine Schwester Olympias als roboterhafte Puppe, die an Blüten abzählend zupft. Ihre Liebe zu Faust und seine zu ihr ist nur imaginär. Beide kommen nicht zusammen, sondern projizieren ihre Gefühle nur auf das Bild des anderen. Eindrucksvoll sind die gelungenen Schattenspiele mit Requisiten wie etwa einem Spinnrad. Aber Dittrich arbeitet auch viel mit Videos und Projektionen, bei denen die Gefahr der Verselbstständigung nicht von der Hand zu weisen ist. Vieles ist arg verrätselt und vielleicht etwas überzogen. Aber immer finden die Brüche in der Musik ihre Entsprechung in der szenischen Umsetzung.
Musikalisch ist die Aufführung in jeder Phase beeindruckend gelungen. Markus Poschner hätte den Bremern vor seinem Wechsel nach Linz kein schöneres Abschiedsgeschenk machen können. Poschner lässt die Musik von Berlioz quasi von innen leuchten. Was er hier mit den Bremer Philharmonikern an Klangfarben, an Durchsichtigkeit und an ausgewogener Dynamik realisiert, ist der reinste Glücksfall. Die Schönheit und Größe dieses Werks - hier kann man sie erleben. Das gilt auch für die von Alice Meregaglia einstudierten Chöre, die bei ihrer umfangreichen und zentralen Aufgabe über sich selbst hinauswachsen.

Chris Lysack überzeugt als Faust mit rundem, klangschönem Tenor. Auch wenn im späteren Verlauf der Aufführung ein paar Töne etwas steif angesetzt werden, ist dies eine seiner besten Leistungen in Bremen. Claudio Otelli schöpft alle Möglichkeiten der Partie des Méphistophélès mit seinem markanten Bassbariton voll aus und überzeugt durch sein hintergründiges Spiel. Mit ihrer ausdruckvollen Stimme, die sich zu großer Leuchtkraft aufschwingt, ist Theresa Kronthaler eine ideale Marguerite.
Wolfgang Denker, 30.03.2017
Fotos von Jörg Landsberg
HOFFMANN - EIN OFFENBACH-PROJEKT
Premiere am 08.02.2017
Kleine Zwischenmahlzeit
Als kleine Zwischenmahlzeit wurde „Hoffmann - Ein Offenbach-Projekt“ zusätzlich in den Musiktheater-Spielplan aufgenommen. Der im Schauspielhaus mit siebzig Minuten Spieldauer realisierte Abend hinterließ allerdings zwiespältige Eindrücke. Das von Levin Handschuh (Regie) und Riccardo Castagnola (musikalische Bearbeitung) konzipierte Projekt ist keine richtige Oper, aber auch kein richtiges Schauspiel. Wer Offenbachs „Les contes d’ Hoffmann“ nicht kennt, dürfte nur schwer Zugang gefunden haben, auch wenn sich die Hauptfiguren der Oper in diesem experimentellen Stück wiederfinden. Hoffmann und Niklausse befinden sich hier auf einer Silvesterparty, von der es drei Variationen gibt. Als Zeitpunkt der Handlung wird jedes Mal „Silvester, 23:43 Uhr“ angegeben. Bevor es losgeht, wird das Wort „Ende“ projiziert, so als hätte es schon zuvor eine Episode gegeben.

Castagnola arbeitet mit elektronischen Klängen, die unter der Leitung von Tommaso Lepore live gespielt werden. Hämmernde Rhythmen oder Orgelklang, Geräusche und Melodiefetzen wechseln sich ab. Offenbachs Musik wird dabei als Steinbruch benutzt. Aber es sind doch einige von Offenbachs Arien, die den musikalischen Fortgang bestimmen, wenn auch in verfremdeter Art. „Habe Brillen“ von Coppelius, die Arie der Olympia oder Hoffmanns Trinklied sind ebenso enthalten wie Antonias Arie. Die Barcarole erklingt teilweise als Vocalise und wird mit der Spiegelarie gekoppelt. Die gesanglichen Leistungen von Christian-Andreas Engelhardt (Hoffmann), Pauline Jacob (Nicklausse), Iryna Dziashko (Olympia, Antonia, Giulietta) und Christoph Heinrich (Coppelius, Mirakel, Dapertutto) sind unterschiedlich, wobei Dziashko und Heinrich ihre Aufgaben noch am besten bewältigen.

Alle drei Szenen markieren Party-Ende. Ein langer Tisch bestimmt das Bühnenbild von Nanako Oizumi. Hoffmann scheint im Alkohol- oder Drogenrausch zu sein. Seine Erinnerungen an die tatsächlichen Ereignisse der Silvesternacht sind verschwommen. Aber immer bleibt seine Annäherung an die drei Frauen ohne Erfüllung. Zuletzt verlässt ihn auch Nicklausse, um sich mit Dapertutto zu vergnügen. Regisseur Handschuh hat die unwirkliche Atmosphäre der Szenen gut eingefangen. Dennoch - ein Abend, an dem vorwiegend Insider ihre Freude haben dürften.
Wolfgang Denker, 09.02.2017
Fotos von Jörg Landsberg
SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS
Premiere am 28.01.2017
Plädoyer für Humanismus
Der Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus“ von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen ist ein Wälzer mit über sechshundert Seiten, die Oper „Simplicius Simplicissimus“ von Karl Amadeus Hartmann ist ein Werk von knapp anderthalb Stunden Spieldauer. Der Untertitel der Oper lautet „Drei Szenen aus seiner Jugend“ und erklärt, wie das zusammenpasst. Die Oper entstand 1934/35, nachdem der Dirigent Hermann Scherchen den Komponisten Hartmann bei einer nächtlichen Autofahrt auf den Stoff aufmerksam gemacht und auch gleich ein Szenario entworfen hatte. Das Werk wurde erst 1949 uraufgeführt. In Bremen wird die reduzierte Fassung von 1957 gespielt. Leider fehlt auch die lange, sehr reizvolle Ouvertüre.

Die erste Szene beschreibt das Leben im Dorf und die hereinbrechenden Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Dann trifft Simplicius auf einen Einsiedler, der ihn väterlich erzieht. Im dritten Teil kommt Simplicius an den Hof des Gouverneurs, der ihn zum Hofnarren ernennt. Als Narr kann er ungestraft die Wahrheit sprechen und sein Gleichnis vom Lebensbaum entwickeln, bei dem die Schwachen die ganze Last tragen. Gouverneur, Hauptmann und Landsknecht, die Symbolfiguren der Unterdrückung, werden am Schluss von den Bauern umgebracht. Nur Simplicius wird verschont.

Regisseurin Tatjana Gürbaca hat dieses Antikriegsstück in sehr eindrucksvoller Weise umgesetzt. Das Orchester sitzt in Parketthöhe, die Bühne von Klaus Grünberg besteht aus einer Holzwand mit einem kreisrunden Loch, in dem die Aktionen stattfinden. Darunter ist ein breiter Spalt, durch den man zunächst Wolkenkratzer und später Totenköpfe sieht. Im zweiten Teil erblickt man dann eine friedliche, hügelige Landschaft als Symbol für die Welt des Einsiedlers, am Ende schließlich die drei Leichen. Dieses einfache wie wirkungsvolle Bühnenbild ist sehr passend für das Werk, das ohnehin an das Brechtsche Theater anknüpft.

Bei der Umsetzung im ersten und dritten Teil bedient Gürbaca sich des Mittels der Groteske. Die Charaktere werden holzschnittartig gezeichnet, fast wie die Figuren eines Kaspertheaters. Nur Simplicius ist davon ausgenommen, er ist stets ein Mensch, wenn auch noch ein unwissend staunender. Ein Totentanz von skurrilen Gestalten steht für den Spuk des Krieges. Beim Bankett des Gouverneurs gibt es eine drastische Szene, bei der sich die Machthaber vor einer lasziven Tänzerin (Nora Ronge) zum Affen machen. Die ruhige Szene mit dem Einsiedler wirkt dazwischen wie eine Oase des Friedens, in der sich auch der Tod, nämlich der des Einsiedlers, im Einklang mit der Welt vollzieht.

Die Musik von Hartmann ist vielschichtig und spielt mit verschiedenen Anlehnungen, vor allem an Bach, Prokofieff oder Strawinsky. Beim Tod des Einsiedlers wird ein jüdisches Lied zitiert. Clemens Heil und die mit fünfzehn Musikern besetzten Bremer Philharmoniker setzen die stilistische Vielfalt der Partitur mit kammermusikalischer Delikatesse um. Besonders eindringlich gelingen die Zwischenspiele. Die teilweise im Publikum platzierten Choristen verstärken dabei mit ihren gesummten Passagen den Ausdruck tiefster Trauer. Ein musikalischer Moment, der unter die Haut geht, bei dem auch das auf die Wand projizierte Sonett „Tränen des Vaterlandes“ von Andreas Gryphius tiefe Wirkung erzielt.

Marysol Schalit ist ein Simplicius mit klarer, leuchtender Stimme und sehr guter Diktion. Ihre Darstellung macht die Entwicklung vom naiven Knaben zum klar sehenden Humanisten deutlich - ein moderner Parsifal, wenn man so will. Luis Olivares Sandoval vermittelt mit ebenmäßigem Tenor die Abgeklärtheit des Einsiedlers. Loren Lang gibt den Bauern stimmlich eher robust, Christian-Andreas Engelhardt (Gouverneur), Patrick Zielke (Hauptmann) und Birger Radde (Landsknecht) überzeugen mit praller Aktion. Engelhardt liegen die zwielichtigen Charaktere ohnehin besonders, und Zielke erweist sich einmal mehr als „Bühnentier“. Die Sprechrolle wird von einem Jungen (Max Geburek) eindringlich gestaltet. Das ist famos gelungen. Insgesamt ist diese hochkarätige Produktion sehr zu empfehlen, nicht zuletzt auch, weil sie ein überzeugendes Plädoyer für Humanismus und eine bessere, menschlichere Welt ist
Wolfgang Denker, 30.01.2017
Fotos von Jörg Landsberg
HÄNSEL UND GRETEL
Premiere am 25.11.2016
Ein Wald aus Pilzen
Es gibt kaum eine Oper, die so regelmäßig zur Weihnachtszeit auf deutschen Bühnen auftaucht, wie „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. In Bremen wurde das Stück zuletzt 2007 von Christian Schuller in einer Bearbeitung von Elke Heidenreich gezeigt. Jetzt hat der Schauspielregisseur Alexander Riemenschneider die populäre Märchenoper inszeniert. Es ist seine erste Arbeit für das Musiktheater. Herausgekommen ist eine Umsetzung mit vielen Stärken und kleinen Schwächen.

In den geschlossenen Vorhang ist eine Mini-Guckkastenbühne integriert. Dort sieht man gleich zu Beginn die Hexe, die „Ist jemand da?“ ruft. Ein geheimnisvolles Echo antwortet. Die Frage kann auch so verstanden werden, ob es einen Gott gibt. Während der Ouvertüre sind eine mit Wunderkerzen garnierte Torte zu sehen und Hänsel, der sie gierig verschlingt. Es kommt leider immer häufiger vor, dass Regisseure schon die Ouvertüre bebildern und der alleinigen Wirkung der Musik misstrauen. Aber hier hält es sich in Grenzen.
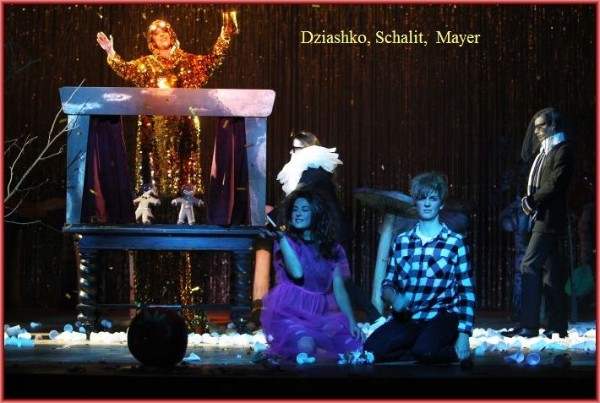
Der erste Akt spielt auf weitgehend kahler Bühne. Hänsel und Gretel necken sich ziemlich handgreiflich. Bei der Szene zwischen Vater und Mutter spürt man den Schauspielregisseur: Ein Ehestreit mit unterschwelliger Erotik - Strindberg lässt grüßen. Sehr gelungen ist die märchenhafte Phantasiewelt des 2. Aktes. Jan Štěpánek hat ein anregendes Bild mit riesigen Pilzen und einem glitzernden Lamettavorhang im Hintergrund entworfen. Schattenriss-Effekte und malerische Farben entführen in eine Traumwelt. Dort tauchen allerdings nicht die berühmten vierzehn Engel auf, sondern eine bunter Schar skurriler Figuren, die von einer Art Feenkönig angeführt werden. Eindrucksvoll ist auch der Auftritt von Sandmännchen und Taumännchen im goldenen, dann silbernen Glitzeranzug. Etwas Kitsch gibt es trotzdem. Im Schlussbild schweben, wie schon am Anfang, eine Leuchtschrift mit den Worten „Wenn die Not auf’s Höchste steigt“ und ein knallrotes Herz herunter.

Die Hexe ist bei Riemenschneider kein „gruseliges Weib“, sondern eher eine verführerische Schönheit, eine elegante Dame der Halbwelt im schwarzen Hosenanzug. So richtig zum Fürchten ist sie nicht, aber eine unheimliche Aura strahlt sie dennoch aus. Nach dem sie unspektakulär in den Backofen gestoßen wurde (diese Szene verpuffte wirkungslos) und dieser schließlich explodiert, taucht sie wieder beim Dirigenten auf und dirigiert die letzte Szene. Das Böse ist eben nicht auszurotten. Insgesamt ist Riemenschneider trotz kleiner Einwände im Detail eine durchweg unterhaltsame und kurzweilige Inszenierung gelungen, an der große und kleine Zuschauer ihre Freude haben können.

Die musikalische Leitung lag in den Händen von Daniel Mayr, der mit den Bremer Philharmonikern ein durchweg flottes Tempo anschlug, was der Musik sehr gut anstand. Seine Wiedergabe wird von klanglicher Opulenz und gleichzeitig feiner Differenzierung geprägt. Mit Ulrike Mayer als Hänsel und Marysol Schalit als Gretel stehen zwei Sängerinnen zu Verfügung, die ihre Partien stimmlich und optisch überzeugend verkörpern. Ihr freches und lockeres Spiel macht die Figuren glaubhaft. Beim Abendsegen zeigt sich, wie gut die Stimmen harmonieren. Patricia Andress zeichnet die Mutter Gertrud als verhärmte, gefühlskalte Frau. Loren Lang als Vater Peter glaubt man die Sorge um seine Kinder. Stimmlich hat er vor allem im letzten Akt allerdings etwas zu kämpfen. Nathalie Mittelbach als Knusperhexe setzt sehr auf ebenmäßigen Gesang und vermeidet jegliche Übertreibung. Iryna Dziashko (sie ist auch alternativ als Gretel besetzt) ist trotz verbesserungswürdiger Diktion ein attraktives Sand- und Taumännchen mit Jubelton in der Stimme.
Wolfgang Denker, 27.11.2016
Fotos von Jörg Landsberg
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Premiere am 22.10.2016
Marionettenhafter Klamauk
Man muss schon ganz viel falsch machen, damit ein „Barbiere di Siviglia“ langweilig wird. Zwar hat Regisseur Michael Talke vieles „falsch“ gemacht, aber den Unterhaltungswert von Rossinis Meisterwerk hat er weitgehend bewahrt. Er schlug in seiner Inszenierung eher konventionellere Pfade ein, versah die Oper aber auch mit entbehrlichen Zutaten. So tritt denn ein Herr (Guido Gallmann) mit den Worten auf: „Sie kennen mich nicht. Ich bin ein Regieeinfall“. Kein besonders guter, muss man hinzufügen, denn der Fluss der Handlung und der Musik wird dadurch oft unterbrochen. Wenn diese Einlagen wenigstens etwas vom feinsinnigem Humor eines Loriot gehabt hätten! Bei der Gewittermusik muss dieser Moderator, der auch als Ambrogio und Notar fungiert, einen Kampf mit seinem Regenschirm bestehen. Diese wie andere Szenen hatten einen Hauch von Stummfilm-Ästhetik.

Insgesamt setzt Talke in seiner Inszenierung mehr auf Klamauk, denn auf wirklich gewitzten Humor. Dafür gibt es viele Beispiele, etwa beim Ständchen des Grafen, bei dem die von ihm angeheuerten Musiker immer wieder polternd etwas fallen lassen. Auch die Gesangsstunde mit dem falschen Basilio gerät reichlich albern. Wenn Doktor Bartolo über die Bühne stampft, werden am Klavier Akkorde angeschlagen, als wolle man das Nahen eines Dinosauriers untermalen.
Chor und Solisten bewegen sich oft im Rhythmus der Musik wie Marionetten oder Aufziehpuppen. Man muss bewundern, wie exakt diese schwierigen Bewegungsabläufe ausgeführt werden, aber sie tragen keinen ganzen Opernabend. Auch die Bühnenausstattung von Barbara Steiner ist ständig in Bewegung. Schon bei der Ouvertüre schweben kronleuchterartige Ornamente immer wieder hoch und runter, werden Vorhänge auf- und zugezogen und ein Sofa hereingerollt. Das war einfach zuviel des Guten. Die Kostüme von Regine Standfuß beweisen teilweise Mut zur Hässlichkeit, passen in ihrer skurrilen Überzeichnung aber zum Stil der Inszenierung.

Immerhin gelingen Talke auch ein paar komödiantische Einfälle, sodass dieser „Barbiere“ letztendlich doch unterhaltsam ausfällt. Das ist natürlich auch dem komischen Talent der Sänger zu danken. Patrick Zielke etwa gibt den Doktor Bartolo in seinem zeltartigen Kostüm als trotteliges „Urviech“ mit ausgeprägter vis comica, Christoph Heinrich ist als Basilio sein Bruder im Geiste. Gesanglich können beide weitgehend überzeugen, auch wenn „La calunnia“ noch suggestiver hätte ausfallen können. Gute Figur machen auch Hyojong Kim als Graf Almaviva und Birger Radde als Figaro. Kim beeindruckt vor allem in der Arie „Cessa di piu resistere“, die ursprünglich aus Rossinis Oper „Le siège de Corinthe“ stammt, mit geschmeidiger Stimmführung und höhensicherem Tenor. Eine wunschlos überzeugende Leistung! Radde, der als Figaro oft wie ein zaubernder Magier daherkommt, gestaltet seine Partie sympathisch und mit markantem Bariton. Als Rosina wächst Nerita Pokvytyté im Laufe des Abends immer mehr in ihre Partie hinein und gibt der Figur kapriziöse Züge. Auch gesanglich kann sie sich im zweiten Akt steigern. Nathalie Mittelbach macht als Berta nicht nur durch ihr „raumfüllendes“ Kostüm nachdrücklich auf sich aufmerksam. Zoltán Melcovics und Daniel Ratchev sind Fiorello und ein Offizier.

Mit kleinen Extempores begleitet Andreas Lakeberg mit der Gitarre den Grafen bei seinem Ständchen. Der teilweise mit abenteuerlichen Perücken als Frauen verkleidete Herrenchor wurde von Alice Meregaglia gut einstudiert.
Olof Boman erweist sich am Pult der Bremer Philharmoniker als umsichtiger Garant für die musikalische Qualität. Seine Wiedergabe hat Schwung und Witz. Nicht nur das irrwitzige Tempo im Finale des ersten Aktes wird hervorragend umgesetzt. Wie sagte der Moderator? „Sie können auch die Augen zumachen!“. Nein, das wäre denn doch schade gewesen.
Wolfgang Denker, 23.10.2016
Fotos von Jörg Landsberg
PARSIFAL
Premiere am 11.09.2016
Häufiger Stellungswechsel des Orchesters

Ein Bühnenbild gibt es nicht. Dafür sitzt das Orchester auf der Bühne, Gurnemanz in Person von Patrick Zielke auf einem Stuhl davor. Dann kommen Loren Lang (Titurel), Nadine Lehner (Kundry), Christian-Andreas Engelhardt (Klingsor) und Claudio Otelli (Amfortas) hinzu. Eigentlich sind sie in ihren Partien noch nicht dran, aber sie übernehmen auch die Rollen der Knappen und Gralsritter. Es sieht nach konzertanter Aufführung aus. Ganz allmählich verdichtet sich aber die Szene. Fast unmerklich verschiebt und überschreitet Regisseur Marco Štorman die Grenze zwischen konzertanter Aufführung und szenischer Darstellung. Das ist ein faszinierender und auch schlüssiger Ansatz, zumal ein großer Teil des 1. Aktes mit den langen Erzählungen des Gurnemanz ohnehin der Vermittlung der Vorgeschichte dient. Bevor Parsifal auftritt, wird ein Schwanenboot auf die Bühne gerollt, mit Kundry als verwundetem Schwan darin.

Ein böses Vorzeichen, wie sich zeigen wird. Parsifal selbst schwebt in kurzen Hosen vom Bühnenhimmel, einen roten, herzförmigen Luftballon und ein Getränk in der Hand. Hier hat Štorman überzogen, auch in der Charakterisierung Parsifals. Er ist zwar ein Tor, aber hier wirkt er, als ob er einer geschlossenen Anstalt entwichen ist. Aber immerhin versucht er zu verstehen, was er gerade sieht, indem er die Bewegungen der anderen nachahmt und sogar mit dem Chor die Lippen bewegt. Überhaupt der Chor (Einstudierung Barbara Kler): Die Herren marschieren gemessenen Schrittes von den Seiten ein, der Damenchor singt aus den Gängen des Foyers und der Knabenchor (Einstudierung Alice Meregaglia) vom Rang. Ein überwältigendes Klangerlebnis ist die Folge. Auch das Orchester ist inzwischen näher an den Zuschauerraum gerückt. Während der Abendmahlszeremonie wird der Zuschauerraum mittels Leuchtbändern komplett erhellt. Wir sind Teil des Ganzen.

Totaler Stellungswechsel im 2. Akt: Das Orchester sitzt im Graben, auf der Bühne ist eine Art Lagerhalle zu sehen, in der Klingsor sein Zauberreich eingerichtet hat. Er selbst wirkt in seinem weißen Showanzug und mit seinem Stöckchen wie ein abgetakelter Unterhaltungskünstler; ähnlich sind die Soloblumen gezeichnet. Parsifal kommt mit Brustpanzer und Lorbeerkranz daher und wirkt bei den Annäherungen von Klingsors Zaubermädchen eher verlegen. Erst der Kuss Kundrys bringt ihm die Erkenntnis über den Sündenfall von Amfortas. Seine Schlussfolgerung ist allerdings tödlich. Damit es zukünftig keine Versuchung mehr gibt, auch für ihn, ersticht er Kundry und damit das mögliche Objekt seiner Begierde. Zwar hat Kundry im 3. Akt noch ganze zwei Worte („Dienen, dienen“) zu sagen, aber eine Gang von vier Jugendlichen erledigt das, was Parsifal nicht ganz vollendet hat. Ihre Matrosenanzüge erinnern an die Hitlerjugend.
Im 3. Akt wieder ein Stellungswechsel: Das Orchester sitzt erneut auf der Bühne, diesmal aber zunächst sehr weit hinten. Das hat deutliche Einbußen im Klang zur Folge, zumal auch die Solisten weit hinten stehen und der Chor „unsichtbar“ hinter dem Orchester singt. Für den Schluss hingegen rollt es wieder ganz nah nach vorne. Parsifal, jetzt im „seriösen“ Abendanzug, steht regungslos mit erhobenem Schwert an der Rampe. Mehr passiert nicht, wir sind wieder im konzertanten Teil angelangt.

Markus Poschner und die Bremer Philharmoniker, die durch Wagner und Bruckner große Erfahrung mit Repertoire dieses Kalibers haben, bescheren ein Klangfest erster Güte. Poschner schlägt mit gut dreieinhalb Stunden Spielzeit ein flottes Tempo an und liegt damit in etwa bei den Zeiten eines Pierre Boulez (Toscanini hat fast fünf Stunden benötigt). Das Vorspiel, die Verwandlungsmusiken, die großen Chorszenen und die Farbigkeit des Kundry-Aktes - Poschner zaubert, trotz der sich immer verändernden Positionen des Orchesters, einen begeisternden „Parsifal“, der in seinen Temporelationen und seiner Dynamik absolut stimmig ist.

Alle Rollen können aus dem hauseigenen Ensemble besetzt werden. Das ist schon bemerkenswert. Patrick Zielke hat für den Gurnemanz die besten Voraussetzungen. Wenn er voll „aufdreht“ und die Stimme strömen lässt, ist alles bestens. Aber wenn er in die Mezzavoce geht und sich fast bis zum Sprechgesang reduziert, werden manche Phrasen doch etwas brüchig. Nadine Lehner hat für die Kundry nicht unbedingt die ideale Stimme, dafür fehlt es etwas an verführerischer Wärme und Rundung. Aber mit ihrem schlanken, oft dramatisch und ausdrucksvoll geführten Sopran gibt sie der Partie eine ganz eigene und im höchsten Maße faszinierende Prägung. Sie ist trotz ihres Ballettkleidchens weit weniger als üblich nur ein „Werkzeug“ Klingsors, sondern auch ihm eine willensstarke, zynische Gegenspielerin. Mit Christian-Andreas Engelhardt ist der Klingsor hier mit einem Tenor besetzt. Dank seiner subtilen Gestaltungskunst glückt dieses Experiment bestens. Claudio Otelli gibt den Qualen und Schmerzen des Amfortas mit wuchtigem Bariton berührenden Ausdruck. Großartig brechen seine „Erbarmen“-Rufe in den Raum. Loren Lang gibt den Titurel nach besten Möglichkeiten. In der Titelpartie bleibt Chris Lysack zunächst über weite Strecken blass, vor allem neben der Kundry von Nadine Lehner. Erst bei „Nur eine Waffe taugt“ findet Lysack zu guter Form und ringt seinem Tenor schönen Glanz ab.
Wolfgang Denker, 12.09.2016
Fotos von Jörg Landsberg
WERTHER
Premiere am 20.05.2016
Aggressive Liebe

Das Bühnenbild besteht nur aus einer rechteckigen Plattform über dem Orchestergraben, einem Boxring nicht unähnlich. Die Bremer Philharmoniker haben ihren Platz im hinteren Teil der Bühne. Werther steht, grimmig dreinblickend, in seinem roten Kapuzenshirt auf diesem „Kampfplatz“. Was zunächst gar nicht als eine richtige Inszenierung wahrgenommen wird, sondern eher wie eine konzertante Aufführung daherkommt, gewinnt im Laufe des Abends aber immer mehr an Spannung. Regisseur Felix Rothenhäusler, der mit diesem „Werther“ nach einer gewöhnungsbedürftigen „Nozze die Figaro“ seine zweite Arbeit im Musiktheater vorlegt, ist mit seiner Fokussierung auf Charlotte und Werther ein psychologisch ausgefeiltes, gleichwohl hochdramatisches Kammerspiel gelungen. Dieses Konzept konnte aber nur aufgehen, weil mit Nadine Lehner als Charlotte und Luis Olivares Sandoval als Werther zwei gesanglich und darstellerisch außergewöhnlich starke Persönlichkeiten zur Verfügung stehen.

Rothenhäüsler bezeichnet den Werther als Gefühlsterroristen - bei ihm gibt es auch keine romantische Liebesgeschichte, sondern einen existentiellen Kampf auf Leben und Tod. Werthers Liebe ist alles andere als schwärmerisch, sie ist im höchsten Grade aggressiv. Werther verhält sich fast wie ein Stalker. Einmal fällt er enthemmt über Charlotte her, ein andermal prügelt er sich mit Albert. Und Charlotte wird von ihrem Konflikt zwischen Pflicht und Neigung seelisch zerrissen. Sie und Werther umkreisen einander oft wie Raubtiere. Wenn sie von Werthers Selbstmordabsichten erfährt, läuft sie wie von Furien gehetzt minutenlang zu Werthers Haus. Dass Nadine Lehner danach noch ohne geringste Erschöpfung singen kann, ist phänomenal! Bei der langen Sterbeszene Werthers wird der Zuschauerraum erleuchtet und das Publikum dadurch symbolisch mit einbezogen.

Die phänomenale Leistung von Nadine Lehner und Luis Olivares Sandoval trägt den gesamten Abend und heizt ihn mit ungeheurer Spannung auf. Beide könnten in dieser Form an den größten Opernhäusern reüssieren. Lehner hat mit ihrem ausdrucksvollen Sopran auch die dunkleren Farben für die Rolle (die eigentlich eine Mezzo-Partie ist) zur Verfügung. Ihre Gestaltung ist durchgehend von solcher Intensität, dass ihre grandiose Arie „Va! Laisse couler mes larmes“, die vom Altsaxophon begleitet wird (was Massenets Zeitgenossen als „beschwörendes Exotikum eines Übergangs in eine andere Welt“ empfunden haben), organisch in die Gesamtleistung eingebunden ist. Das gilt auch für Sandoval, der die Titelpartie von Anfang bis Ende mit tenoralem Glanz, mit emotionaler Wucht in den großen Ausbrüchen und mit feinsinniger Phrasierung versieht. Die expressive Arie „Pourquoi me reveiller“ ist ein Glanzpunkt seiner Leistung, aber nur einer unter vielen.

Die Partie des Albert gewinnt in der Interpretation des hervorragenden Baritons Peter Schöne hier viel an Gewicht und Ausstrahlung. Schöne singt ausgesprochen kultiviert und verfügt über eine sehr ansprechende, gut sitzende Stimme. Und Marysol Schalit kann als Sophie zu den dramatischen Ereignissen ein heiteres Gegengewicht setzen. Zudem trennt sie die prügelnden Rivalen und bringt (das einzige Requisit der Inszenierung) einen kitschigen Weihnachtsbaum auf die Bühne. Die kleineren Rollen wurden von Loren Lang (Bailli), Christian-Andreas Engelhardt (Schmidt) und Johannes Scheffler (Johann), die letzteren leutselig mit Bierkrügen hantierend, zuverlässig gestaltet. Der Kinderchor (in der Einstudierung von Alice Meregaglia) absolvierte seine Aufgabe mit Feuereifer.
Daniel Mayr ist eigentlich Chordirektor in Bremen, fungiert seit einiger Zeit aber auch als 2. Kapellmeister. Er bleibt am Pult der Bremer Philharmoniker der Sinnlichkeit und der Dramatik der Musik nichts schuldig.
Wolfgang Denker, 21.05.2016
Fotos von Jörg Landsberg
MARIA STUARDA
Premiere am 02.04.2016
Meisterhaft umgesetzter Psychothriller
Wenn man vom „Ring“ spricht, ist immer der von Wagner gemeint. Aber als Donizettis drei historische England-Opern „Anna Bolena“ (1830), „Maria Stuarda“ (1834/35) und „Roberto Devereux“ (1837), die den Zeitraum von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts der englischen Geschichte behandeln, in einer zyklischen Aufführung in New York gespielt wurden, hat ein amerikanisches Magazin sie spontan als „Tudor-Ring“ bezeichnet. „Roberto Devereux“ wird am 16. 4. von der Metropolitan Opera im Kino übertragen; „Maria Stuarda“, der zweite Teil dieses „Rings“, hatte in Bremen Premiere. Die Inszenierung ist von Anna-Sophie Mahler, die musikalische Leitung hat Olof Boman.

In „Maria Stuarda“ geht es nur äußerlich um die historischen Ereignisse - die Oper ist in erster Linie ein Eifersuchtsdrama. Königin Elisabeth I. von England liebt den Grafen Leicester, der sich aber seinerseits zu der auf Schloss Fotheringhay gefangen gehaltenen schottischen Königin Maria Stuart hingezogen fühlt. Maria bittet brieflich um ein Treffen mit Elisabeth, um ihre Begnadigung zu erwirken. Das Zusammentreffen wird ein Fiasko. Elisabeth, eifersüchtig auf die Jugend und Schönheit Marias, verhöhnt diese, worauf Maria sie als Bastard und Schande Englands beschimpft. Die Folge ist ein Todesurteil. Elisabeth verfügt sogar noch, dass Leicester der Hinrichtung beiwohnen solle. Maria verzeiht ihren Feinden und geht gefasst zum Richtblock.

Anna-Sophie Mahler macht aus der Donizetti-Oper nach Schillers „Maria Stuart“ einen Psychothriller, indem sie sich ganz auf das „Duell“ zwischen Maria und Elisabetta konzentriert. Das Bühnenbild von Duri Bischoff verzichtet komplett auf historisches Kolorit, es ist eine Art Verhörraum mit durchlässigen Lamellen-Fenstern. Für Maria ist es ein reales Gefängnis, für Elisabetta eines ihrer von Ängsten und Zweifeln bedrängten Seele. Die Kostüme von Geraldine Arnold sind fast zeitlos schlicht gehalten, aber die Halskrause als Insigne der Macht deutet auf das historische Zeitalter.
Bevor der erste Ton erklingt sagt Elisabetta: „In meinem Ende liegt mein Anbeginn.“ Sie trägt dabei die Augenbinde, die sie später Maria bei ihrer Hinrichtung anlegen wird. In Mahlers Sicht geht es mehr um die Psyche als um einen Machtkampf, der bei Donizetti eher ein Kampf um einen Mann ist, nämlich um den Grafen Leicester, den beide lieben. Leicesters Entscheidung für Maria gibt letztlich den Ausschlag, dass Elisabetta ihre Rivalin zum Tode verurteilt. Die szenische Reduktion intensiviert die psychologisch sehr geschickt aufgebaute Spannung ungemein.

Im Eingangsbild wirbt der französische König um Elisabetta, allerdings sehr aufdringlich: Seine Gesandten führen das Hochzeitskleid schon im Gepäck. Kein Wunder, dass Elisabettas Ablehnung sehr schroff ausfällt.
Bei der Begegnung der beiden Frauen kreisen sie wie zwei Raubtiere umeinander bzw. um Leicester herum. Dieser Moment wird szenisch und musikalisch mit berstender Spannung aufgeladen. Sie sind vom Charakter zwar sehr verschieden - Elisabetta setzt auf die Ratio, Maria auf das Gefühl - aber Mahler sieht darin zwei Seiten einer Medaille. Das verdeutlicht sie mit einer ausgefeilten Personenführung, bei der jede Geste, jeder Ausbruch passgenau erarbeitet ist. Der Bühnenraum verwandelt sich unmerklich in ein raffiniertes Spiegelkabinett, mit dem Annäherung und Trennung der beiden Frauen visualisiert werden. Maria nimmt ihr Schicksal ruhig und gelassen an, während Elisabetta seelische Qualen leidet, an denen sie und ihre gespiegelten Doubles fast körperlich zugrunde gehen. Die parallel ausgeführten, gleichen Bewegungen der beiden zeigen, wie ähnlich sie sich im Grunde sind. Marias Tod bedeutet keinen Frieden für Elisabetta, auch ihre Existenz ist dadurch vernichtet.

Theresa Kronthaler war in Gesang und Ausdruck eine ungewöhnlich starke Elisabetta und stellte ein expressives, bezwingendes Porträt auf die Bühne. Was sie an gesanglichen und darstellerischen Facetten zur Verfügung hatte, war sensationell. Mit Gebärden der Macht, aber auch mit großer innerer Verunsicherung formte Kronthaler einen Charakter voller Widersprüche. Aber Patricia Andress konnte mit eher verhaltenem, weichem Sopran daneben durchaus überzeugen. Neben ihrer mit feiner Differenzierung gesungenen großen Arie „O nube! Che lieve per l’aria“ war es vor allem die lange Abschiedsszene vor der Hinrichtung, ihre Lebensbeichte, in der Andress so intensiv gestaltete, dass man fast Gänsehaut bekam. Hyojong Kim gab mit kräftigem Tenorstrahl der Verzweiflung Leicesters lebendigen Ausdruck. Neben kraftvollen, aber stets ungefährdeten Tönen konnte Kim auch mit zarteren, differenzierteren Momenten für sich einnehmen. Christoph Heinrich gab mit sattem Bass den Grafen Talbot, Loren Lang den intriganten Cecil. Marias Vertraute Anna wurde von Nathalie Mittelbach gesungen.

Der Chor, der am Ende sehr eindrucksvoll im 1. Rang postiert war, wurde von Daniel Mayr und Alice Meregaglia ganz hervorragend einstudiert.
Olof Boman ließ die Bremer Philharmoniker teilweise auf historischen Instrumenten spielen und erzeugte ein geschärftes Klangbild. Die dramatischen Zuspitzungen musizierte er geradezu atemberaubend aus. Die prallen Jagdhörner, das fulminante erste Finale und die elegische Stimmung des Schlussbildes - alles entwickelte er stimmig und wie aus einem Guss. Ein großer Abend!
Wolfgang Denker, 03.04.2016
Fotos von Jörg Landsberg
WOZZECK
Besuchte Aufführung: 20.3.2016
Premiere: 13.2.2016
Ewiger Kreislauf ohne Hoffnung
Die letzte Inszenierung von Bergs Oper „Wozzeck“ am Theater Bremen erfolgte bereits vor 45 Jahren. Es war mithin höchste Zeit für eine Neuproduktion. Und diese ist, um es vorwegzunehmen, in hohem Maße gelungen. Was an diesem Abend über die Bühne des Bremer Theaters ging, war imposantes, hoch spannendes Musiktheater, das einen gänzlich in seinen Bann zog.

Claudio Otelli (Wozzeck)
Die Regie lag in den bewährten Händen von Paul-Georg Dittrich, das Bühnenbild und die Kostüme besorgten Pia Dederichs und Lena Schmid. Das durchweg dunkel ausgeleuchtete Bühnenbild wird von einer aus mehreren Stockwerken bestehenden Stahlkonstruktion eingenommen, die sich mit Hilfe der Drehbühne ständig um sich selbst dreht. Es ist eine sehr modellhafte Welt, die hier vorgeführt wird, aus der es kein Entkommen gibt. Die Handlungsträger sind vom Anfang bis zum Ende in das Innere dieses von einer kalten Sonne beschienenen Labyrinths eingeschlossen. Auf Leinwänden erfährt das dramatische Geschehen durch Jana Findeklees Videoprojektionen eine nicht immer appetitliche, oftmals blutige Kommentierung. Hier haben wir es mit einem geschlossenen System zu tun, in dem die Emotionen leicht überkochen und in eine Katastrophe münden können. Das Fehlen jeglicher Art von Privatsphäre hat daran regen Anteil. Nirgendwo sind die handelnden Personen für sich allein. Alle Raumsegmente bestehen aus transparentem Plexiglas oder Plastikfolie. Jeder ist für jeden jederzeit sichtbar. Sämtliche Figuren sind von Anfang an auf der Szene und harren der Dinge, die da kommen werden.

Claudio Otelli (Wozzeck), Nadine Lehner (Marie)
Dabei findet seitens der Regie keine eindeutige zeitliche Einordnung statt. Dittrich geht es vielmehr darum, die zeitenübergreifende Essenz, ja sogar das Zeitlose der dargestellten Konflikte herauszustellen und dabei die Wozzeck ausgrenzende und missbrauchende Gesellschaft gnadenlos zu hinterfragen. Die Handlung spielt sich auf mehreren Zeitebenen ab. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit ihrem jeweiligen Zeitgeist reichen sich die Hände und leisten damit verschiedenen Ästhetiken Vorschub. Der von seiner Umwelt ziemlich gebeutelte Wozzeck und die als Flittchen im Minirock vorgeführte Marie sind Gestalten der Gegenwart. Der reichlich clowneske Hauptmann, der im roten Morgenmantel auftretende Doktor und der Tambourmajor sind eher der Vergangenheit entsprungen und werden vom Regisseur obendrein reichlich skurril gezeichnet. In die Zukunft weisen dagegen die beiden Handwerksburschen in klinisch weißem Gewand samt riesigen Schlüsseln auf dem Rücken.

Es ist schon eine äußerst eigenwillige Mischung verschiedenster Charaktere und Figuren, die hier zusammenkommt und die Dittrich mit Hilfe einer ausgelassenen, und doch stringenten Personenregie trefflich zu führen vermag. Ihm ist wirklich nicht das Geringste anzulasten, er versteht sein Handwerk ausgezeichnet. Immer wieder gelingen ihm starke Bilder von großer Eindringlichkeit. So wenn der die Gesellschaft symbolisierende Chor auf einmal rote Hände hat und damit vom Regisseur eine Mitschuld an den tragischen Ereignissen zugesprochen bekommt. Oder wenn Marie nach ihrem Beischlaf mit dem Tambourmajor unter der Dusche krampfhaft versucht, die Sünde von sich abzuwaschen, angesichts der ihr von dem Liebhaber geschenkten Ohrringe aber unvermittelt wieder in Entzücken gerät. Die Liebe ist hier keine reine, sondern eine der Lust und materiellem Gewinn durchaus zugängliche Größe. Der einzige wahrhaft Liebende ist Wozzeck, obwohl er den Gegenstand seiner aufrichtigen Liebe, Marie, zu guter Letzt aus Eifersucht tötet. Er ist gleichzeitig Täter und Opfer und wird schließlich vom Volk gemeuchelt. Es ist eines der eindrucksvollsten Bilder der Produktion, wenn er gleichsam von den Chormassen verschluckt wird, in ihnen sozusagen „ertrinkt“.

Besondere Bedeutung kommt in Dittrichs Interpretation den Kindern zu, denen hier auch die Worte des Narren anvertraut sind. Sie erscheinen durchaus nicht als Träger einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sondern unterscheiden sich in Nichts von ihren rohen, grausamen Eltern. Die Erziehung erfolgt per Bildschirm, vor dem die Kleinen immer wieder Platz nehmen. Zu Präzision und Reinlichkeit werden sie auf diese Weise angehalten. Artig und sauber sein heißt die Devise. Oberstes Gebot ist der Gehorsam. Ungehorsam zieht Strafe nach sich. Eine andere Art der Erziehung ist den Kindern fremd. Bereitwillig saugen sie die auf sie eindringenden Parameter in sich auf und suchen sich in Wozzecks und Maries Sohn auch gleich ihrerseits ein passendes Opfer aus. Er wird von ihnen zum neuen Wozzeck erhoben und in gleicher Weise misshandelt wie zuvor sein Vater von ihren Eltern drangsaliert wurde. Während des letzten Zwischenspiels gehen die Handlungsträger allesamt auf die Plätze des Anfangs zurück. Nun steht die Drehbühne endlich einmal still. Das Spiel kann von neuem beginnen. Es ist ein ewig währender Kreislauf, der hier geschildert wird und den keiner anhalten kann und das auch nicht will. Eine der abschließenden Repliken von Doktor und Hauptmann wird hier vom Tambourmajor übernommen. Ihn trifft dieselbe Schuld an Wozzecks Tod wie sie. Die durch den am Ende aufscheinenden bunten Regenbogen angedeutete Zuversicht trügt. Das Ganze endet in Hoffnungslosigkeit - ein sehr pessimistischer Schluss.

Wie bereits einen Tag zuvor beim Rigoletto bewies Claudio Otelli auch an diesem Abend, dass ihm die gebrochenen, geschundenen Charaktere vorzüglich liegen. Sein Wozzeck war ein durch und durch gebrochener, verzweifelter Mensch, missbraucht und gedemütigt. Alle diese Aspekte hat er mit intensivem Spiel ausgezeichnet vermittelt. Auch gesanglich vermochte er mit seinem kraftvollen, prägnant und wortdeutlich eingesetzten Bariton gut zu gefallen. Eine Glanzleistung erbrachte Nadine Lehner als Marie, für die sie schon rein äußerlich ideal besetzt war. Bereits ihre expressive Darstellung vermochte nachhaltig zu beeindrucken. Aber auch stimmlich ging sie mit ihrem über satte tiefe und gut fundierte hohe Töne verfügenden, hervorragend italienisch geschulten Sopran, den sie sehr nuanciert und farbenreich einzusetzen wusste, voll in ihrer Rolle auf. Bestens fokussiertes, klangvolles Tenormaterial brachte Hyojong Kim für den Andres mit. Martin Nyvall sang den Hauptmann sehr charaktervoll in die Maske. In der Mittellage solide, im oberen Stimmbereich dünn gab Christoph Heinrich den Doktor. Überzeugend war der markant und gut gestützt intonierende Tambourmajor von Christian-Andreas Engelhardt. Eine tadellose Margret stand in Anna-Maria Torkel zur Verfügung Vokal ansprechend bewährte sich Daniel Ratchev als Erster Handwerkbursche. Beim Zweiten Handwerkburschen hatte an diesem Abend der Krankheitsteufel zugeschlagen. Eine Lösung war indes schnell gefunden: Während Jörg Sändig die Partie spielte, sang Wolfgang von Borries den Part von der Seite aus ein, dies aber etwas flach. Als Mariens Knabe gefiel der kleine Max Geburek. Ganz vorzüglich machte der von Daniel Mayr einstudierte Chor und Kinderchor des Theaters Bremen seine Sache. Vor allem den Kindern ist für ihre exzellente Leistung ein großes Lob auszusprechen.
Am Pult zeigte sich Markus Poschner voll in seinem Element. Zusammen mit den versiert aufspielenden Bremer Philharmonikern lotete er Bergs Musik in allen ihren Feinheiten sehr expressiv, differenziert und farbenreich aus. Dabei versteifte er sich nicht auf einen spitzen, unterkühlten Klang, wie man ihn bei diesem Werk oft erlebt, sondern legt dem Ganzen eine mehr gefühlvolle Tongebung zugrunde.
Fazit: Das war hoch anspruchsvolles, anspruchsvolles Musiktheater, das die Fahrt nach Bremen einmal mehr voll gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 22.3.2016
Die Bilder stammen von Jörg Landsberg
RIGOLETTO
Besuchte Aufführung: 19.3.2016
Premiere: 24.10.2015
Auf dem Jahrmarkt des Grauens
Elf Jahre ist es her, dass Verdis „Rigoletto“ zum letzten Mal am Theater Bremen zu erleben war. Nun hat Regisseur Michael Talke, an dessen vorzügliche Produktion von Donizettis „L’elisir d’amore“ man sich noch gerne erinnert, in Zusammenarbeit mit Barbara Steiner (Bühnenbild) und Regine Standfuss (Kostüme) dem Bremer Publikum eine sehr eigenwillige, spektakuläre und in hohem Maße sehenswerte Neuinszenierung des Werkes beschert.

Marysol Schalit (Gilda), Herrenchor des Theaters Bremen
Insbesondere dem Auge wird recht viel geboten. Der Regisseur siedelt Verdis Oper im 19. Jahrhundert an, wobei ihn Realismus wenig interessiert. Das Seelenleben der Protagonisten spielt bei ihm eine große Rolle, weswegen er das Ganze auch in einem „Psychologischen Raum“ (vgl. Programmheft) spielen lässt. Seine Sichtweise der einzelnen Charaktere ist nicht mehr neu, wird aber stringent vermittelt. Einfühlsam zeichnet er das Bild einer von Männern dominierten Gesellschaft, die Frauen zum bloßen Objekt degradiert und sich darin gefällt, Außenseiter zu quälen. Der fast affenartige Rigoletto wird von ihnen ständig gehänselt und unterdrückt. Den Buckel, den der Hofnarr trägt, deutet Talke als äußeres Erscheinungsbild einer psychischen Deformation. Sparafucile wird als Ebenbild Rigolettos vorgeführt und erscheint als dessen Alter Ego. Der noch tierhafter gezeichnete Mörder ist als abgespaltener Teil der Titelfigur aufzufassen, als Fleisch gewordene Projektion von deren rachedurstigen Gedanken. Dieses Verständnis vorausgesetzt ist es strenggenommen Rigoletto selbst, der am Ende Gilda ermordet - ein sehr interessanter Ansatzpunkt. Im ersten Akt hat das sich gefangen fühlende Mädchen während „Pari siamo“, wo Komponist und Textdichter ihr eigentlich gar keinen Auftritt gönnen - hier wird in trefflicher Art und Weise vom Regisseur ein Tschechow’sches Element ins Spiel gebracht -, mehrmals vergeblich versucht, dem väterlichen Kerker zu entrinnen.

Claudio Otelli (Rigoletto), Marysol Schalit (Gilda), Herrenchor des Theaters Bremen
Mit ihren langen braunen Haaren und dem rosafarbenen Kleid fügt sie sich fest in das Beuteschema des nicht gerade ansehnlichen, glatzköpfigen und einen blauen Rock tragenden Duca ein. Wie Gilda sind alle Opfer des adligen Lebemannes gekleidet. Es ist gleichsam eine Vielzahl von Gildas, die hier auftritt. Wie Rigoletto und Sparafucile hier in Wahrheit nur eine Person darstellen, sind auch die sexuellen Opfer des Duca immer diesselben. Gilda wird praktisch zum Prinzip erhoben und gilt ihm nicht mehr als seine anderen Geliebten. Interessant ist: Die Puppe, mit der sie im ersten Akt spielt, ist dem Duca nachempfunden. Die Doppelung einzelner Figuren resultiert aus einer klar ersichtlichen Art der Zuordnung der Charaktere, die von Talke nachhaltig betont wird. Diese Wesensgleichheit macht einen Großteil der inneren Spannung der Inszenierung aus. Kein Fehler war, dass Talke am Ende auf den herkömmlichen Sack verzichtet und Gilda seitlich auf einem Stuhl sitzend das Schlussduett mit ihrem verzweifelten Vater singen lässt, während Sparafucile im Vordergrund an der Rampe kauert.

Diese Aspekte wurden allesamt von der Regie bestens herausgearbeitet. Dass man diese Aufführung aber nicht so schnell wieder vergisst, verdankt sich in erster Linie dem visuellen Element. Talke verortet die Handlung in einem gruseligen Jahrmarktsmilieu und macht aus dem Ganzen gekonnt ein Kabinett des Grauens. Oft fühlt man sich in einen Horrorfilm versetzt. Darüber hinaus wird der Einfluss des im Jahre 1897 in Paris gegründeten Théatre du Grand Guignol, das Mord und Vergewaltigung sehr realistisch zeigte, offenkundig. Das ist indes nichts Neues mehr. Das hat Lorenzo Fioroni jüngst bei seiner Mainzer Inszenierung des „Rigoletto - wir berichteten - ebenso gemacht. Ein Sonderlob gebührt hier der Sparte Maskenbildnerei und Kostüm für die Art und Weise, wie sie den Hofstaat des Duca in eine Schar regelrechter Zombies verwandelt hat. An der äußeren Aufmachung der Höflinge kann man sich nicht satt sehen, so phantastisch ist sie gelungen. Besondere Aufmerksamkeit beansprucht eine Nosferatu nachempfundene weibliche Gestalt mit langen, spitzen Krallen, der auch die Worte des Gerichtsdieners anvertraut sind. Auch der wie der Leibhaftige inmitten von Rauch aus dem Boden auffahrende Monterone hat etwas nosferatuhaftes an sich. Essentielle Bedeutung kommt in Talkes Interpretation den Bildern des Malers Gabriel von Max zu, die immer wieder zitiert werden. Das Bild der toten Frau nimmt Gildas Tod voraus. Der zähnefletschende Löwe steht für Rigoletto, der eifersüchtig seine Tochter bewacht. Das Bild der Affen macht deutlich, dass der Regisseur das Verhältnis zwischen Rigoletto und Gilda mit einer Affenliebe identifiziert. Diese Eindrücke fügen sich fabelhaft in den aufgezeigten psychologischen Kontext ein. Das war alles sehr überzeugend und wurde mit Hilfe einer stringenten Personenregie auch spannend vermittelt.

Claudio Otelli (Rigoletto)
Auf hohem Niveau bewegten sich auch die gesanglichen Leistungen. An erster Stelle ist hier die wunderbare Marysol Schalit zu nennen, die mit der Gilda einen bedeutenden Schritt in Richtung lyrisches Fach getan hat. Ihre bestens durchgebildete Stimme weist bereits deutlich in diese Richtung. Sie verfügt über einen absolut makellosen, bestens fokussierten, großen Glanz aufweisenden, mit sicherer Höhe und einer glänzenden Pianokultur gesegneten Sopran, mit dem sie alle Facetten ihrer Partie prachtvoll zog. Ihre herrliche E-Dur-Arie „Caro nome“ war der Höhepunkt des Abends. Auch darstellerisch war sie überzeugend. Zu Recht durfte sie sich beim Schlussapplaus über viele Bravo-Rufe des begeisterten Publikums freuen. Dieser außergewöhnlichen Sängerin steht eine große Karriere bevor! Neben ihr ging Claudio Otelli voll und ganz in der Rolle des Rigoletto auf. Schon darstellerisch war er mit seinem imposanten Spiel eine Wucht. Verachtung und Wut auf die Höflinge einerseits, die große Liebe zu Gilda und Verzweiflung andererseits, alles wurde von ihm einfühlsam vermittelt. Auch gesanglich vermochte er mit geradlinigem, robustem und vorbildlich verankertem Bariton für sich einzunehmen. Ebenfalls hervorragend schnitt Hyojong Kim als Duca ab. Er hatte sich die nicht gerade sympathische Anlage der Figur durch die Regie gut zu eigen gemacht und sie schauspielerisch trefflich vermittelt. Gesanglich überzeugte er mit vorbildlich italienisch geschultem, frischem und sonor klingendem Tenor, dem er eine Vielzahl von Farben entlockte. Markant und frisch klang das „La donna è mobile“, sehr gefühlvoll das „Parmi veder le lagrime“. Ein solider Sparafucile war Christoph Heinrich. Loren Lang verfügte in der Partie des Monterone immer noch über ansprechendes Stimmmaterial. Gleich in drei Rollen wurde die einen gut sitzenden, tiefgründig klingenden Mezzosopran aufweisende Nathalie Mittelbach eingesetzt: als Giovanna, Maddalena und Gerichtsdiener. Anständig sang Jörg Sändig den Marullo, vokal wenig auffallend war Wolfgang von Borries’ Borsa. Tadellos gab Daniel Ratchev den Grafen Ceprano. Gerne mehr gehört hätte man von Pauline Jacob, die mit vollem, rundem Sopran die kleinen Rollen der Gräfin Ceprano und des Pagen aufwertete.

Hyojong Kim (Duca), Marysol Schalit (Gilda)
Am Pult stand Daniel Mayr und animierte die konzentriert und klangschön aufspielenden Bremer Philharmoniker zu einem von vielen Zwischentönen geprägten, flüssigen Spiel, das eine gute Italianita aufwies und sich zudem durch viele Zwischentöne auszeichnete.
Fazit: Ein regelrecht preisverdächtiger Opernabend, mit dem das Theater Bremen sein hohes Niveau wieder einmal unter Beweis gestellt hat!
Ludwig Steinbach, 21.3.2016
Die Bilder stammen von Jörg Landsberg