Musiktheater des Landestheaters
DIE SPINNEN, DIE RÖMER
(A Funny Thing Happened on the Way to the Forum)
 Toll trieben es die alten Römer – die Linzer Musicalexperten können das aber auch. Foto: Reinhard Winkler / Linzer Landestheater
Toll trieben es die alten Römer – die Linzer Musicalexperten können das aber auch. Foto: Reinhard Winkler / Linzer Landestheater
Premiere am Musiktheater des Landestheaters, Großer Saal, 01. 02.
Buch Burt Shevelove und Larry Gelbart, Musik und Gesangstexte von Stephen Sondheim, Original-Produktion am Broadway von Harold S. Prince; Deutsch von Roman Hinze (auch bekannt als Arne Beeker) In deutscher Sprache mit Übertiteln (etiam in ligua latina)
„Vaudeville“, ein Begriff unklarer Herkunft, war die Bezeichnung für sowas wie einen Schlager im Frankreich des 16. Jahrhunderts, später für populäre Bühnenunterhaltung. In dieser Bedeutung übersiedelte er in die USA, wo Vaudeville-Theater dann um 1900 extrem verbreitet waren. Bespielt wurden sie vor allem von Darstellern osteuropäisch-jüdischer und italienischer Herkunft. Eine schöne filmische Rekonstruktion solch einer show findet sich in Francis Ford Coppolas „Pate II“, mit Vito Corleone und Genco Abbandando im Publikum.
Die feineren Seiten der menschlichen Natur sprach diese Art von Theater wenig an; metoo-ProtagonistInnen und Apostel der political correctness würden aus so einer Vorstellung kreischend, shitstormend, mit gesträubten Haaren fliehen – aber die USA der großen Einwanderungszeit waren auch nicht gerade ein Land für Zartbesaitete. Der aufkommende Film unterminierte diese rauhe Kultur, nicht zuletzt durch Kaperung deren Stars für die – grundsätzlich „zahmere“ – Leinwand; Symbol des Todesstoßes für das Vaudeville ist, daß dessen größter Star, Al Jolson (geboren als Asa Yoelson im heutigen Litauen) die Hauptrolle im ersten kommerziellen Tonfilm („The Jazz Singer“) spielte, sang und sprach. Weiter glattgebügelt wurde die Szenerie durch den „production code“ (nichts anderes als Zensur) des „Hays office“ in Hollywood ab 1934. Zwar blieb das Theater freier, aber nach 2. Weltkrieg und McCarthy-Zeit konstatierte man auch am Broadway ein „Vulgaritätsvakuum“.
Dieses aufzufüllen machten sich die Autoren dieses respektlosen und turbulenten Spaßes, im Prinzip die altrömische, Plautus-gestützte Version eines Feydau’schen Türenknallers, Anfang der 1960er zur Aufgabe. Bezug zur Vaudeville-Tradition zeigt schon der Titel, der eine viel strapazierte Conference-Einleitung („a funny thing happened on the way to the theater“) zitiert. Die Uraufführung am 8. Mai 1962 war ein gewaltiger Erfolg (964 Vorstellungen en suite) und ein Befreiungsschlag gegen den Fünfziger-Mief. Wesentlichen Anteil daran hatte der Darsteller des Pseudolus, Zero Mostel – ein anarchischer Komiker, 1943 von der Mutter aller Illustrierten, „LIFE“, „the funniest American now living“ genannt, der später noch als verkommener Fürst Potemkin neben Jeanne Moreaus Zarin Katharina, Max Bialystok in den „Producers“ und erster „Milchmann Tevje“ glänzen sollte.
Eine Verfilmung, Regie Richard Lester, Kamera Nicolas Roeg, folgte 1966. Auch in dieser spielte Zero Mostel die Hauptrolle; Buster Keaton war als Erronius letztmalig auf der Leinwand zu sehen und sprach dabei sogar, lachte aber natürlich nicht.

Hans Kudlich, Arne Beeker. Foto: Petra und Helmut Huber
Die originale Bühnenszenerie (die im Film freilich oft verlassen wird) sieht drei nebeneinander stehende Häuser vor – und in diesen bzw. auf der Straße davor spielt sich die Handlung ab. Hans Kudlich hat ein fast – kleine Abweichungen sind gewollt und dienen der Satire – stilechtes altrömisches Wohnviertel auf die Bühne gestellt, vielleicht mit ein bisserl Palladios Teatro Olimpico von Vicenza im Hinterkopf. Die Spielfläche reicht bis weit über den diesmal abgedeckten Orchestergraben, damit zu dessen großem Vergnügen bis ins Publikum. Zu Feydeau gehören natürlich Schwingtüren (durch die Personen regelmäßig zur Unzeit auf- und abtauchen), und auch auf diese hat Kudlich nicht vergessen; eine delikate Sache für die Technik, wie er beim dieser Produktion gewidmeten Sonntagsfoyer der „Musiktheaterfreunde“, sagte: „Man glaubt nicht, was mit Bühnentüren alles schief gehen kann“. Es geht heute nix schief, also wurde in den Werkstätten sauber gearbeitet, und das teils höllische Tempo der Szenenwechsel kann unbehindert wüten.
Die Musik, ca. 40 Damen und Herren des Bruckner Orchesters, sitzt wie bei der Penthesilea/Schoeck-Produktion 2019 weit hinten oben – auf den „Hausdächern“, vor einem „romanoiden“ Prospekt. Unter der Leitung von Juheon Han wird stilsicher und swingend präzisest musiziert – bei einem Tempostück entscheidend für gute Wirkung.
Die Inszenierung durch den Musical-Spartenchef Matthias Davids erfüllt alles, was es braucht, um so ein Stück ohne viel Tiefgang und nüchterner Plausibilität überzeugend und fesselnd ans Publikum zu bringen: Frechheit, Schrillheit, atemberaubendes Tempo, vergnügt hemmungsloses Outrieren, eine slapstickhafte Choreografie (Simon Eichenberger). Bunte, wahnwitzig übertriebene Kostüme (Susanne Hubrich) mit köstlichen Details (als Senex aus dem Bad kommt, trägt er einen Frotteemantel, bestickt mir den Worten „non olet“) passen dazu. Das alles wird serviert mit der wie selbstverständlich wirkenden, also gut geprobten Präzision, ohne die viele gags gar nicht funktionieren würden. Für die südliche Sonne sorgt Michael Grundner.
Dramaturgie samt einer, gemessen am Text der Verfilmung, präzisen Neuübersetzung: Arne Beeker; er schafft es vor allem auch, den originalen Witz (und die originalen Witze) über die Sprachgrenze zu transportieren! Schon vor Beginn läßt er uns raten, Mobilphone eingeschaltet zu lassen und gute Manieren zu vergessen – schließlich ist das hier nicht die Oper!

Gernot Romic. Foto: Reinhard Winkler /Linzer Landestheater
David Arnsperger als Pseudolus braucht sich vor Rollenkreator Zero Mostel nicht zu verstecken: ein verschlagener Meister der Chuzpe, Jongleur mit Schwertern wie Menschen, flehend, bittend, tobend, herrisch, kriecherisch – alles im Handumdrehen abrufbar, kombiniert mit großer Körperbeherrschung und einer operngeschulten Singstimme. Heftige mimische Konkurrenz erfährt er freilich durch Gernot Romic in der Rolle des Hysterium, sein Sklavenkollege im selben Haushalt, der durch die genialen Pläne des Pseudolus oftmals in fürchterlichste Bredouillen gerät und sich vergeblich bemüht, einen Rest von Selbstwert und Ansehen zu wahren. Da hilft ihm oft nicht einmal sein engels- oder Merkur-gleiches Schweben durch die Szenerie, mit rollenbewehrten Schuhsohlen bewerkstelligt. Ein zwerchfellerschütterndes Duo!
Der Senex von Klaus Brantzen hat zwar weniger Zeit auf der Szene als die Vorgenannten, aber die, die er hat, nutzt er ebenso bestens für die köstliche Charakterisierung des (nicht grundlos) unterdrückten Ehemannes von Domina. Diese verkörpert mit Lust und Vergnügen am bösen Lied und verrückten Spiel Sanne Mieloo, auch sie ein wahres Erlebnis. Der nach Maßstäben dieses Stückes peinlich normale Hero, beider Sohn, wird von Lukas Sandmann mit entzückender Naivität dargestellt. Seine Sehnsucht gilt Philia, einer jungfräulichen Kurtisane (öhm…) mit Bildungsmängeln; Hanna Kastner haucht ihr liebreizendes Leben, auch nicht ohne doppelten Boden, ein.
Letztere ist aber schon an Miles Gloriosus, einem SEHR großen Hauptmann (20 cm Kothurnen!) verkauft; Christian Fröhlich leiht ihm in allen Aspekten Trittsicherheit und seine gute Stimme.
Kurtisanenhändler Marcus Lycus (Karsten Kenzel) irrlichtert ebenso höchstvergnüglich durchs Bild wie der alte, verzweifelte Erronius (William Mason), mit dem man fast echtes Mitleid haben könnte – aber bevors womöglich kitschig wird, steht er im Zentrum eines natürlich auch reichlich witzig-absurden happy end.

Daniela Dett. Foto: Reinhard Winkler/ Landestheater
Im Film wimmelt es vor Komparserie. Auf der Bühne, schon bei der Ur-Produktion 1962, waren das nur „drei Proteanerinnen“ – Piraten, Sklaven, Bürger, Eunuchen, Soldaten. Mit unermüdlicher Schwurbeligkeit, genau kalkuliertem Chaos, an Zahl und Tempo wahnwitzigen Umzügen schaffen das die Meisterinnen der Komik Daniela Dett, Celina dos Santos und Lynsey Thurgar; hinter der Bühne herrscht wohl ziemliche Hetze für die Kostümabteilung, einmal hängt der fat suit für einen Eunuchen etwas – eines unter hundert Malen passiert, oder Absicht, um zu zeigen, was für Aufwand da nötig ist?
Kabinettstückchen liefern die Handelsobjekte von Lycus: als exotisch tanzende Tintinabula Timo Radünz, als Panacea Hannah Moana Paul; die Geminae sind Yuri Yoshimura und Beate Chui, die wilde Schönheit Vibrata Brittany Young. Das Bewegungswunder Gymnasia wird von der Kontortionistin Maria Gschwandtner atemberaubend und wirbelsäulenverstörend verkörpert; sie kann aber genauso gut singen und tanzen.
Jubel und Begeisterung für eine erstklassig präsentierte, grandios verrückte und respektlose Bühnenshow. Aber es bleibt die bange Frage, ob so etwas heute überhaupt noch geschrieben werden dürfte? Oder haben nicht längst junge, natürlich nur das Beste im Sinn führende Frauen die üble Rolle des weißen alten engstirnigen Mannes Will H. Hays übernommen?
Petra und Helmut Huber, 16.2.2020
Besonderer Dank an unseren kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Premierenfeier. Foto: Petra und Helmut Huber
LINZ / Black Box des Musiktheaters
MARY UND MAX
Gelungene deutsche und europäische Erstaufführung
14. Dezember 2019 (Premiere 8. November 2019)
Im internationalen Sport gibt es Scouts, die stets auf der Suche nach jungen, weitgehend unbekannten und daher in der Regel meist noch recht erschwinglichen Talenten sind. Derartige Scouts (Späher) sind natürlich immer schon auch in der Kunstszene aktiv. Die Musicalabteilung des Linzer Musiktheaters muss einen besonderen Draht zu solchen Vermittlern haben: Da ist erst im Oktober des Vorjahres – im in Musicalkreisen nicht gerade tonangebenden Theatre Calgary (Kanada) – ein Musical mit dem Titel Mary and Max zur Uraufführung gekommen. Als Vorlage dient der gleichnamige Animationsfilm des australischen Filmemacher Adam Elliot, der für seinen Vorgängerfilm Harvie Krumpet – einer ebenfalls auf Knetmassefiguren à la Wallace und Gromit basierenden Produktion – immerhin mit dem Oscar ausgezeichnet worden war. Weltweite Schlagzeilen konnte das Musical zwar nicht einheimsen, immerhin aber wurde es mit dem Medienpreis beim MUT-Wettbewerb für neue Musicals in München ausgezeichnet. Es gehört gewiss eine gehörige Portion Mut dazu, dieses Musical, kaum ein Jahr später, nicht nur zur europäischen (und deutschsprachigen) Erstaufführung zu bringen, sondern es handelt sich hier überhaupt erst um das erste Mal weltweit, dass Mary und Max auf einer anderen Bühne nachgespielt wird!

Die Verantwortlichen in Linz bewiesen mit dieser Entscheidung jedoch nicht nur Mut, sondern auch einen guten Riecher: Das Musical ist seit seiner Premiere am 8. November beim Publikum ein wahrer Renner und genießt inzwischen schon Kultstatus. Das liegt zum einen an der darin abgehandelten Thematik, die weitab vom Gewohnten in der Musicalwelt steht und gerade deshalb neue Maßstäbe setzt. Wie im Stück Next To Normal, über eine an einer bipolaren Störung leidenden Mutter und ihre Familie, das in Linz schon zu sehen war und erst in der vergangenen Saison im Vienna´s English Theatre auf dem Spielplan stand, zielt auch Mary und Max auf Außenseiter und psychische Grenzfälle ab.
Im Mittelpunkt steht die Brieffreundschaft, die die von ihren Eltern vernachlässigte, junge Mary in einer Kleinstadt in Australien mit dem im fernen New York beheimateten Max führt. Mit dem um viele Jahre älteren Max, der wie Mary von seinen Eltern wenig Liebe erfahren hat und sich, wie sie, einsam und von der Umwelt unverstanden fühlt, pflegt sie – von einer monatelangen Beziehungskrise abgesehen – gut eineinhalb Jahrzehnte hindurch einen regen schriftlichen Austausch. Mary leidet zunächst an ihrem braunen Muttermal im Gesicht, das sie sich von ihrem ersparten Geld, das für eine Reise nach New York vorgesehen war, operativ entfernen lässt, ohne deshalb glücklicher zu werden. An Max, der jede Veränderung als Störung empfindet und geregelte Abläufe schätzt, wird von seiner Therapeutin das Asperger-Syndrom, einer abgemilderten Form von Autismus, diagnostiziert. Er leidet aber, wie er ausdrücklich sagt, nicht darunter, sondern findet das ganz okay. Nur wenn ihm Mary von ihren emotionalen Berg- und Talfahrten, u.a. von ihrer schwer geprüften Zuneigung zum stotternden, schüchternen Damian berichtet und um Rat fragt, wird er von Unruhe erfasst und weiß nicht weiter, sondern tröstet sich mit seiner Fresslust an Schokoburgern, oder zieht sich in sein Schweigen zurück. Erst nachdem Marys alkoholkranke, kleptomanisch veranlagte Mutter und ihr versponnener Vater verstorben sind, sie ihr Universitätsstudium erfolgreich abgeschlossen hat und die Ehe mit ihrer komplizierten Jugendliebe Damian gescheitert ist, macht sie sich endlich doch auf dem Weg nach New York. Dort erst werden ihr Bedeutung und Sinn ihrer Beziehung zu Max klar: Er war ihr einziger wahrer Freund.
 Was rührselig klingt, wird von Regisseur Andy Hallwax und Choreograph Jerome Knols mit einem Gespür für rasante Abläufe und berührende, aber nie in Kitsch abgleitende Momente auf die praktikable und atmosphärisch verknappte Bühne von Kaja Dymnicki gebracht. Bei der Ausstattung der handelnden Personen zeichnet sich Julia Klugs Kostümierung vor allem durch die Haartracht aus, die einen originellen Bezug auf die Plastilin-Welt der cineastischen Vorlage herstellt. Das zehnköpfige Ensemble, viele davon in Mehrfachrollen, ist angesichts rascher Umkleidungsmanöver sehr gefordert, macht seine Sache aber ausgezeichnet.
Was rührselig klingt, wird von Regisseur Andy Hallwax und Choreograph Jerome Knols mit einem Gespür für rasante Abläufe und berührende, aber nie in Kitsch abgleitende Momente auf die praktikable und atmosphärisch verknappte Bühne von Kaja Dymnicki gebracht. Bei der Ausstattung der handelnden Personen zeichnet sich Julia Klugs Kostümierung vor allem durch die Haartracht aus, die einen originellen Bezug auf die Plastilin-Welt der cineastischen Vorlage herstellt. Das zehnköpfige Ensemble, viele davon in Mehrfachrollen, ist angesichts rascher Umkleidungsmanöver sehr gefordert, macht seine Sache aber ausgezeichnet.
David Arnsberger ist ein großartiger Max. Apathisch, wie ferngesteuert, setzt er sich, mit Kippa auf dem Kopf und stets auf Ordnung bedacht, in Bewegung und lässt doch erahnen, dass in seinem Inneren wohl auch Gefühle und tiefe Gedanken geborgen sind. Wenn alle übrigen Mitwirkenden so gut bei Stimme wären wie Arnsberger, könnte man angesichts der räumlich-akustischen Gegebenheiten der Linzer Black Box gut auf die Verwendung von Mikroports verzichten. Die ältere Mary, von Sanne Mieloo verkörpert, zeigt eine heranwachsende Frau, die sich trotz widriger Umstände und stets von Zweifeln heimgesucht, auf den Weg macht, sich selbst und ihren Anteil am Glück zu finden. Daneben kommt Mieloo noch ein einer Reihe anderer Figuren zum Einsatz. Celina Dos Santos ist in der Rahmenhandlung die halbwüchsige Lily, der ihr Vater Henry (Karsten Kenzel) die Geschichte von Mary und Max erzählt. Vor allem aber ist sie die junge Mary, die mit ihrem Schicksal hadert, mit sich und der Welt unzufrieden ist, aber gegenüber der Umwelt, auch wenn sie von Klassenkameradinnen gemobbt wird, als durchaus kooperativ und hilfsbereit zeigt. Davon profitiert vor allem ihr Nachbar Glen, ein an den Rollstuhl gefesselter Kriegsveteran (Christian Fröhlich, der auch als ihr stoischer, keiner Regung fähiger Vater Noel auftritt).
Gernot Romic ist der beziehungsgestörte, stotternde Nachbarjunge, der den Avancen Marys ausweicht, bis sie ihn doch dazu bringt, den Mut aufzubringen und sie zu heiraten, dann aber entdeckt, dass er seinen Brieffreund doch mehr liebt als seine Frau. Sehr wandlungsfähig und spielfreudig erweisen sich Lukas Sandmann als Hahn Ethel, Kater Mief-Henry, kleiner Damian und kleiner Max, sowie Lynsey Thurgar in der Doppelrolle als schrille Ärztin bzw. betuliche Psychotherapeutin. In pointiert dargebotenen Rollen treten weiters Daniela Dett, u.a. als Marys durchgeknallte Mutter Vera, und Hanna Kastner, u.a. als Ivy, Max´Vermieterin, auf.
Die Musik von Bobby Cronin, von dem auch die von Jana Mischke ins Deutsche übersetzten Gesangstexte zum Buch von Crystal Skillman stammen, funktioniert gut und klingt beschwingt. Wenn Max auftritt, vernimmt man einmal auch Klezmer-Töne, ansonsten fällt die Musik aber nicht durch besonders eigenständige Machart auf. Für die Linzer Produktion arrangiert wurde sie von Juheon Han, der die siebenköpfige Band Ethel and the Aspies vom E-Piano aus mit Verve und Animo leitet.
In Zeiten, in denen man ein paar Schlager mit einer notdürftigen Handlung verknüpft und das dann schon ein „Musical“ nennt, ist Mary und Max jedenfalls eine Wohltat. Besonders angenehm ist es auch, zur Abwechslung einmal auf die Maschinerie perfektester Bühnentechnik zu verzichten und hautnah dabei zu sein, wie ein beherztes Ensemble mit einfachsten Mitteln eine feine Geschichte mit frischem Leben erfüllt.
Fotos (c) Landesheater Linz / Sakher Almonen
Manfred A. Schmidt, 19.12.2019
Besoderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wie
LINZ/ Black Box des Musiktheaters
LA ROSINDA von Francesco Cavalli
Vorstellung: 21. 9. 2017
Opernrarität schläfert Zuschauern ein...
Als Produktion des Oberösterreichischen Opernstudios brachte das Musiktheater Linz in der 160 Zuschauer fassenden BlackBox die Barockoper „La Rosinda oder Die verliebten Zauberinnen“ von Francesco Cavalli zur Aufführung. Das Dramma per musica in drei Akten wurde im Jahr 1651 in Venedig uraufgeführt und nun in Kooperation mit dem Institut für Alte Musik der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln gezeigt.

In der Oper La Rosinda, deren Libretto von Giovanni Faustini stammt, kämpfen zwei verliebte Zauberinnen mit allen Mitteln um denselben Mann. Die Vorgeschichte der turbulenten Handlung: Der alte Magier Meandro begehrt die junge Zauberin Nerea, die aber den Prinzen Clitofonte liebt. Aus Rache entzieht Meandro Nerea ihre Zauberkraft. Zur gleichen Zeit treffen die Kriegerin Rosinda und Fürst Clitofonte an einer magischen Quelle aufeinander. Als beide aus ihr trinken, verlieben sie sich sofort ineinander. – Nerea sucht Hilfe bei der Unterweltkönigin Proserpina. Rosinda, die mit Clitofonte auf einer Insel landet, erhält die Nachricht, dass sich ihr einstiger Liebhaber Thisandro wegen ihres Treuebruchs getötet habe. In Wahrheit jedoch verfolgt Thisandro den Plan, den Nebenbuhler zu töten und sich vor den Augen Rosindas das Leben zu nehmen. – Im weiteren Verlauf der turbulenten Handlung treffen Liebe auf Hass, Vernunft auf Wahnsinn und Magisches auf Realistisches. Durch die Künste der Zauberinnen kommt es zu vielen Verwechslungen, wozu auch der Liebesgott Amor beiträgt. – Schließlich beendet der Magier Meandro alle Liebeswirren, sodass sich die ursprünglichen Paare Rosinda und Thisandro sowie Nerea und Clitofonte wiederfinden.
Regisseur Gregor Horres verwendete in seiner Inszenierung viele Klischees aus früheren Opernzeiten: Es gibt eine geflutete Bühne, um die Insel als Spielort zu zeigen, ein paar Koffer und Aktentaschen zum Transport des Badezeugs etc. Aus einem Revolver werden Schüsse abgefeuert – mit dem Nebeneffekt, dass eingenickte Zuschauer und Zuschauerinnen wieder aufgeweckt werden. Positiv ist anzumerken, dass durch die kreative Personenführung des Regisseurs das gute Sängerensemble sich auch darstellerisch exzellent entfalten konnte.

Für die Ausgestaltung der Bühne – ein hügeliger, mit Samt überzogener Bretterboden, auf dem einige Sänger des Öfteren regelrecht trampelten, was für die Musik mehr als störend wirkte – und für die Kostüme – im Stil der Neuzeit mit ein paar Barocknuancen – war Jan Bammes zuständig. Für das Lichtdesign, das gottlob nur zu Beginn das Publikum blendete, zeichnete Bernhard Rosenbüchler verantwortlich.
Das Instrumentalensemble, von Anne Marie Dragosits vom Cembalo aus geleitet, brachte die nuancenreiche Partitur des Komponisten facettenreich zum Erklingen, wobei in diesem Werk die Klagelieder dominierten. In der Titelrolle brillierte die Sopranistin Julia Grüter sowohl stimmlich wie auch darstellerisch durch ihr temperamentvolles Spiel. Dass sie vor allem Klage-Arien zu singen hatte, die sie mit großer Leidenschaft interpretierte, lag in erster Linie an ihrer Rolle. Ihr in jeder Hinsicht ebenbürtig war die Sopranistin Fenja Lukas als Königin und Geliebte von Clitofonte, den der chinesische Tenor Xiaoke Hu recht anschaulich darstellte.
Attraktiv besetzt war die Unterwelt mit dem ukrainischen Bass Nikolai Galkin als Plutone – er gab auch den Magier Meandro – und der Linzer Sopranistin Ilia Staple, die beide stimmlich wie schauspielerisch überzeugten. Als Liebesgott Amor konnte der Pole Pawel Żolądek seine turnerische Beweglichkeit ausspielen.
Aus dem großen Sängerensemble seien noch genannt der deutsche Bariton Justus Seeger in der Rolle des Thisandro, der slowakische Bariton Rastislav Lalinski als Rosindas Knappe Rudione, die Sopranistin Gotho Griesmeier als Nereas Hofdame Cillena, der Countertenor Onur Abaci als Nereas Page Vafrillo und die Salzburger Mezzosopranistin Isabell Czarnecki in der Rolle der Zofe Aurilla.
Das bis zum Schluss ausharrende Publikum – zur Pause verließen nicht wenige Zuschauerinnen und Zuschauer die BlackBox des Musiktheaters – zollte den Mitwirkenden reichlich Beifall. Man hatte allerdings das Gefühl, dass sich bei vielen Besuchern die Begeisterung in Grenzen hielt.
Udo Pacolt 23.9.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Bilder (c) Alexi Pelekanos
LINZ/Posthof:
ALFRED
Eine Rockoper von Walter Schill und Erich Mendler
konzertante Aufführung mit Erzähler am 9.2.2017
Rockoper – ein Begriff, der in den 60er und 70ern immer wieder auftauchte, wahrscheinlich von Pete Townshend geprägt: seine Band „The Who“ nahm das erste so bezeichnete Stück 1966 auf; es dauerte nur eine LP-Seite lang und beschäftigte sich mit einem Seitensprung, unverhohlen „A Quick One, WhileHe’sAway“ benannt. Im Jahr darauf spielte eine britische Band namens Nirvana (weit entfernt von der gleichnamigen Kurt Cobains!) eine Konzept-LP mit dem Titel „Story of Simon Simopath“ein. „Tommy“ von den Who war 1969 der erste Höhepunkt des Genres, der auch bis heute immer wieder aufgeführt wird; auch „Quadrophenia“ konnte sich, zumindest als Film, durchsetzen. Weitere wichtige Titel dieser Sparte sind das sozialsatirische „Arthur (OrtheDeclineand Fall of the British Empire)“ von den Kinks und „The Wall“ von Pink Floyd – auch letzteres heute ein etabliertes Musiktheater-Stück.
Bei „Tommy“ und „The Wall“ geht es um den Lebensweg einer (Kriegs-)Halbwaise – und dieses Thema scheint auch die Autoren des neuen Stückes bewegt zu haben; in deren eigenen Worten zusammengefaßt: „Alfred – das ist die Geschichte eines Einzelkindes. Abgeschoben, schikaniert und ohne Freunde kämpft sich Alfred durch Schule und Leben. Es gelingt ihm eine Karriere als Pilot und seine Beziehung mit Mary scheint abzuheben… Eine Geschichte mit holprigem Start, aber glücklicher Landung?“ (www.alfredrockoper.com)
In Wirklichkeit ist die Sache freilich komplizierter: es gibt zahlreiche Handlungsknoten, Spannungen zwischen den Figuren teils innerhalb, teils außerhalb Alfreds Familie treiben die Geschichte voran, man verrennt sich in Fehler, kann früheren Mißlichkeiten positive Seiten abgewinnen… Die Charaktere sind in lebensnaher, erdverbundener Art gezeichnet, wie sie jeder in seinem Bekanntenkreis, wenn nicht gar in der eigenen Verwandtschaft, finden kann. Und Schwarzweißmalerei ist auch nicht die Sache der Verfasser.

Walter Schill
Walter Schill ist im Brotberuf Geschäftsführer einer international etablierten Linzer software-Schmiede und musiziert, komponiert auch seit den 1960ern, seit 2000 mit eigenem Tonstudio. Er orientiert sich an der Musik der eingangs erwähnten Phase, mitElementen des (LSD-affinen) „psychedelicrock“ (etwa von den Doors, Byrds, Jefferson Airplane, natürlich der Beatles auf „Revolver“ und vor allem „Sgt. Pepper“). Um Mißverständnissen vorzubeugen: Herrn Schills Droge ist allenfalls ein gutes Glas Wein. Auch Erich Mendler ist in der EDV-Branche tätig. Eines Tages beschlossen sie, mit passendem vorhandenen Material und mit alten Kontakten ein größeres Ganzes zu schaffen – und anders, als seinerzeit Extremschrammler Roland Neuwirth in „I und meiWampm“ feststellen musste, fanden sich genügend hochklassige Mitwirkende aus früheren Tagen für ein neues Werk, das schlußendlich aus 26 Einzelsongs besteht. Martin Seimen brachte es schließlich als Produzent und Sounddesigner in bühnentaugliche Form.

Die Band
Die Musik ist aufwendig und abwechslungsreich durcharrangiert, und man wird natürlich an Bands wie die Byrds (besonders in den einleitenden Nummern), The Who, Led Zeppelin, Genesis oder die Kinks erinnert – das bezieht sich allerdings ausschließlich auf den jeweiligen „sound“; die Komposition ist metiergemäß einfach und gradlinig, wobei aber nie der Eindruck aufkommt, die Autoren hätten sich bei existierenden Melodien „bedient“: sie haben durchaus ihre eigenen Melodien und damit einen Duktus geschaffen, der sich durch das ganze Stück zieht und es zusammenhält. Gut die Hälfte der Aufführungsdauer rockt man erdig und im Blues verwurzelt, lyrische bis romantische Töne werden aber genau so gut getroffen, und das Psychedelische meldet sichbeispielsweise mit Sitar-Klängen und soundwalls. Am Disco-sound der 80er, freilich ironisiert, kommt man (für eine Nummer) auch nicht vorbei. Einige Stücke haben überhaupt das Zeug zum Ohrwurm wie „Who theFxxxIs Alfred“, „All I Want IsYou“ oder das schlurfig-swingende „DJ Karl“, das Alfreds Nebenbuhler beschreibt. Und am Schluß kommt noch ein richtig fetziger Rausschmeißer, der richtigerweise feststellt: „Rock and Roll Will Live forever“.
Kompositionen und Arrangements sind sehr gut und bildkräftig auf die jeweiligen Situationen abgestimmt und man kann sich vorstellen, daß bei einer szenischen Aufführung die Handlung durch die Musik flott und überzeugend vorangetrieben wird. Am heutigen Abend, ohne Bühnenhandlung, übernahm Burgschauspieler Frank Hoffmann in bekannt feiner Diktion die Aufgabe, für das Publikum den Handlungsablauf zu skizzieren. Unterstützt wurde er dabei von Mark Slattery (Visuals und Grafik) sowie Martina Schettina (Tuschemalerei), welche mit einigen sehr interessanten optischen Effekten (und Kommentaren zur Handlung) der Erzählung weitere Facetten hinzufügten. Chris Laska zeichnete für das „korrekt rockige“ Lichtdesign verantwortlich und unterstützte Martin Seimen bei Inszenierung und künstlerischer Leitung.

Erich Mendler im Studio. Foto: website www.rocksection.com
Die beiden Autoren stehen auch auf der Bühne (als „Rock Section“) in der ersten Reihe: Walter Schill spielt die Rhythmusgitarre – akustisch wie elektrisch, mitunter auch 12-saitig, Erich Mendler beeindruckt an der Sologitarre, samt einigen Effektgeräten; beide singen auch recht ordentlich.
Profis mit prominenter Erfahrung, beispielsweise als Mitspieler von Hubert von Goisern, wurden als Band engagiert: Chris Harras übernimmt die wichtigsten Gesangssoli mit hörbarer Bühnenroutine und vorzüglicher Stimme, spielt auch einige sehr gute Gitarrensoli.Wolfgang Pammer ist präzise ankeyboards und Gitarre zu gange und verstärkt auch noch die Hintergrundstimmen. Helmut Schartlmüller schafft mit seinem e-Bassein rockiges Fundament und Alex Pohn am Schlagzeug erfüllt seine Aufgabe, für präzisen Rhythmus und mitreißende Akzente zu sorgen, zur allgemeinen Begeisterung. Gery Moder ist zuständig für die live-Abmischung – diese ist ihm hervorragend transparent und balanciert gelungen. (Nebenbei: Austropop-„Tonpapst“ Peter Müller mischte die gleichzeitig erscheinende CD und eine vielleicht demnächst greifbare Doppel-Vinylscheibe ab).
Dem Vernehmen nach waren mehre internationale Musical-Produzenten im Saal, auf der Suche nach Substanz für neue Produktionen. Sie hörten den großen Applaus im ausverkauften Saal, schon nach den einzelnen Nummern, und am Schluß durchaus mit Begeisterungscharakter inklusive „standingovations“: diese neue Rockoper (samt ihren Autoren) hätte sich eine große Produktion wirklich verdient!
Bilder (c) H & P Huber
Petra und Helmut Huber 10.2.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)

Erich Mendler, Walter Schill, Chris Harras, Helmut Schartlmüller, Wolfgang Pammer, Alex Pohn, Frank Hoffmann, Martin Seimen.
 Toll trieben es die alten Römer – die Linzer Musicalexperten können das aber auch. Foto: Reinhard Winkler / Linzer Landestheater
Toll trieben es die alten Römer – die Linzer Musicalexperten können das aber auch. Foto: Reinhard Winkler / Linzer Landestheater








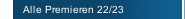




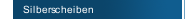
















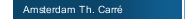













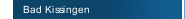




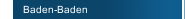





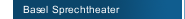




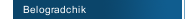

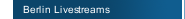





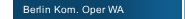



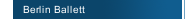





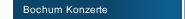



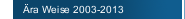





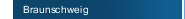

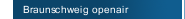




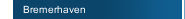




















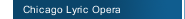


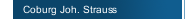





















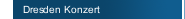



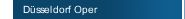



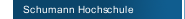









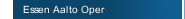




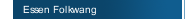










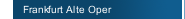
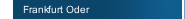





















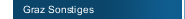








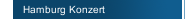
















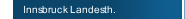

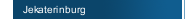

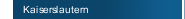











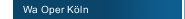


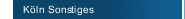
















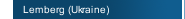





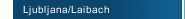





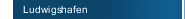























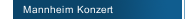













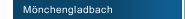





















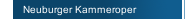
















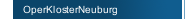


























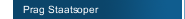
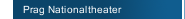

















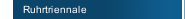

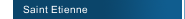







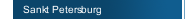



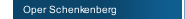
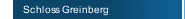














































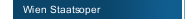

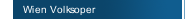

















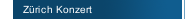
















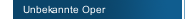




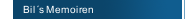


 Was rührselig klingt, wird von Regisseur Andy Hallwax und Choreograph Jerome Knols mit einem Gespür für rasante Abläufe und berührende, aber nie in Kitsch abgleitende Momente auf die praktikable und atmosphärisch verknappte Bühne von Kaja Dymnicki gebracht. Bei der Ausstattung der handelnden Personen zeichnet sich Julia Klugs Kostümierung vor allem durch die Haartracht aus, die einen originellen Bezug auf die Plastilin-Welt der cineastischen Vorlage herstellt. Das zehnköpfige Ensemble, viele davon in Mehrfachrollen, ist angesichts rascher Umkleidungsmanöver sehr gefordert, macht seine Sache aber ausgezeichnet.
Was rührselig klingt, wird von Regisseur Andy Hallwax und Choreograph Jerome Knols mit einem Gespür für rasante Abläufe und berührende, aber nie in Kitsch abgleitende Momente auf die praktikable und atmosphärisch verknappte Bühne von Kaja Dymnicki gebracht. Bei der Ausstattung der handelnden Personen zeichnet sich Julia Klugs Kostümierung vor allem durch die Haartracht aus, die einen originellen Bezug auf die Plastilin-Welt der cineastischen Vorlage herstellt. Das zehnköpfige Ensemble, viele davon in Mehrfachrollen, ist angesichts rascher Umkleidungsmanöver sehr gefordert, macht seine Sache aber ausgezeichnet.




