


http://www.theaterheidelberg.de/
RIGOLETTO
Besuchte Aufführung: 30.9.2018
(Premiere: 22.9.2018)
Objektifizierung der Frau im Schlachthof
Wieder einmal hat das Theater Heidelberg seinem Publikum einen unvergesslichen Opernabend bereitet. Was sich heuer auf der Bühne abspielte, war in höchstem Maße atemberaubend. Mit dem „Rigoletto“ ist dem bewährten Regieduo Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka, das auch für das Bühnenbild und die Kostüme verantwortlich zeigte, ein geradezu preisverdächtiges Meisterstück gelungen. Aus dieser Inszenierung geht man anders heraus als aus sonstigen Vorstellungen. Man fühlt sich angesichts der optischen Eindrücke beklommen und erschüttert. Dem neugierigen Intellekt wurde indes vollauf Genüge getan. Die beiden ungarischen Regisseurinnen haben sich über das Stück treffliche Gedanken gemacht und diese mit Hilfe einer ausgefeilten, stringenten Personenregie hervorragend umgesetzt. Das war ein „Rigoletto“ mit einer enormen Spannkraft, die den Besucher ganz in ihren Bann zog. Bis tief ins Innere hinein fühlte man sich von dem Gesehenen getroffen. Dabei haben die Damen Szemerédy und Parditka genau auf die Musik gehört. Man kann zu ihrer Arbeit stehen wie man will, der Eindruck war jedenfalls gewaltig. Hier haben wir es wahrlich mit erstklassigem Musiktheater zu tun!

James Homann (Rigoletto), Carly Owen (Gilda)
Die Regisseurinnen haben jeglicher Konvention eine klare Absage erteilt und mit einer Konzeption aufgewartet, die genauso neu wie auch packend war. Von herrschaftlichem Glanz ist in dieser Produktion nichts zu spüren. Wenn sich der Vorhang öffnet, fällt der Blick auf einen dreckigen, heruntergekommenen Schlachthof, in dem der sehr zynisch und unersättlich gezeichnete Duca und sein Hofstaat ihrem schmutzigen Treiben nachgehen. Nachhaltig werden hier die schlimmsten menschlichen Triebe ausgelebt, am laufenden Band vergeht man sich an jungen Damen. Im Keller werden Mädchen gefangen gehalten. Am Tropf hängend und mit Drogen vollgepumpt werden sie gefügig gemacht. Es gibt kein Entkommen für sie. Frauen sind dabei willige Erfüllungsgehilfen der Männer.
Gilda ist die Nummer sechs, wie eine Tätowierung auf ihrer Brust zeigt. Der von Szemerédy und Parditka zum in einer eleganten Küche seinem Handwerk nachgehenden umgedeutete Chefkoch Rigoletto versteckt sie hier nicht in einem abgelegenen Haus, sondern behält sie immer in seiner unmittelbaren Nähe. Aber auch mit diesem Vorgehen kann er die Kontrolle über sie nicht ständig aufrechterhalten. Spätestens bei Monterones Fluch wird ihm klar, dass sein Konzept nicht aufgeht. Monterone gehört der anrüchigen Gesellschaft zuerst noch an. Erst als ihm seine tote Tochter splitternackt und von Früchten umgeben auf einer großen Speisetafel vorgeführt wird, besinnt er sich eines Besseren und distanziert sich von den anderen. Die Idee des Regie-Duos, aus Monterone einen Mitläufer zu machen, der sich so lange an den Verbrechen der Gemeinschaft beteiligt, bis er selbst betroffen ist, war ungemein interessant.

Carly Owen (Gilda), Graf von Ceprano, Marullo, Borsa, Chor
Dies gilt auch für Rigoletto, der vergeblich versucht, zu Gilda eine Beziehung aufzubauen. Sie spielt in dieser Interpretation die zentrale Rolle. Ausgangspunkt für die Regisseurinnen ist die Frage, was das Mädchen dazu bewegt, sich am Schluss für den Duca zu opfern. Deutlich wird, dass sie, hin und her gerissen zwischen Liebe und Pflicht, letztendlich gar keine Wahl mehr hat. Hier geht es in erster Linie um Selbstdefinition und Selbstverwirklichung Gildas. Erst im Tod findet sie zu sich selbst. Nach dem Verständnis von Szemerédy und Parditka erlebt das Mädchen seinen Körper nicht als ihren eigenen. Sie sieht sich nur durch die Augen der sie umgebenden Männer und nimmt sich nur noch als Gegenstand war (vgl. Programmheft). Sie kann ihre Subjektivität nicht mehr ausleben und wird zum reinen Objekt degradiert. Ihr bleibt nur, dem Duca freiwillig ihren Körper zu opfern.
Hier spielen die Thesen der Psychologin Carol J. Adams eine große Rolle. Ihr Buch „Zum Verzehr bestimmt“ scheint für die beiden Regisseurinnen bei der Erarbeitung der Konzeption ganz zentral gewesen zu sein. Die von Frau Adams entwickelte Objektifizierung von Tieren, d.h. die Enteignung ihrer Subjektivität, wird analog auf Frauen angewendet. Die von der Autorin aufgedeckte Parallelität von Tieren und der Unterdrückung von Frauen wird nur zu deutlich. Es ist schon schockierend, was sich hier abspielt. Die von Carol J. Adams geforderte feministische Ethik wird auch von dem Regie-Duo ganz groß geschrieben. Laut dringt ihr Ruf nach der Befreiung der gefangenen Mädchen in den Raum. Wo aber die Macht in der Hand einer Person oder einen kleinen Gruppe zentriert ist, kann diesem Unterfangen kein Erfolg beschieden sein (vgl. Programmheft). Nachhaltig halten Szemerédy und Parditka dem Auditorium den Spiegel vor. Derartige Verhältnisse kommen in unserer Gegenwart immer wieder vor. Das geschieht leider in jeder Gesellschaft. Hier gilt es Abhilfe zu schaffen.

James Homann (Rigoletto), Graf von Ceprano, Borsa, Marullo
Dieser konzeptionelle Ansatzpunkt war sehr überzeugend. Aber auch sonst sparte das Regie-Duo nicht mit gelungenen Einfällen. So war es eine sehr gute Idee, Gilda und den Duca zu Beginn des zweiten Aktes noch einmal zusammentreffen zu lassen. Auf krasse Art und Weise wird dem Zuschauer vorgeführt, wie es zu der Vergewaltigung des Mädchens durch den Herrscher kommt. Deutlich wird auch, dass sie nur ein bloßes Amusement für ihn darstellt. Wahre Liebe ist hier nicht im Spiel. Eine echte Beziehung kommt zwischen den beiden genauso wenig zustande wie zwischen Rigoletto und Gilda. Dieser schlägt sie sogar einmal. Männerkleidung bekommt die Tochter vom Vater bereits am Ende des zweiten Aktes. Einen Leichensack gibt es in dieser Inszenierung nicht. Gilda, die nicht durch Sparafuciles Messer ihr Leben aushaucht, sondern sich freiwillig die Pulsadern aufschlitzt, stirbt auf derselben Speisetafel, auf der auch Monterones Tochter lag und wird gleich dieser von den Höflingen ihrem verzweifelten Vater präsentiert. Jetzt ist Rigoletto auch äußerlich genau in derselben Situation wie der alte Graf - ein starkes Bild!

Wilfried Staber (Sparafucile), Carly Owen (Gilda), Maddalena
Auch gesanglich bewegte sich der Abend auf hohem Niveau. James Homann ließ sich wegen einer starken Erkältung zu Beginn entschuldigen, kam aber als Rigoletto durchaus beachtlich über die Runden. Zunehmend gelang es ihm, seinem Part ein immer interessanteres Profil zu geben und mit schönen Piani und Zwischentönen auszustatten. Eine Meisterleistung erbrachte das neue Ensemblemitglied Carly Owen in der Rolle der Gilda. Hier haben wir es mit einem wunderbaren Sopran bester italienischer Schulung zu tun, dem eine Vielfalt von Farben und großes Differenzierungsvermögen zur Verfügung stehen. Die perlenden Koloraturen kamen perfekt und auch mit der sicheren Höhe vermochte sie zu punkten. Das sehr gefühlvoll und mit großer Innigkeit gesungene „Caro nome“ war der Höhepunkt der Aufführung. Das war eine ganz große Leistung! Auch darstellerisch konnte sie überzeugen. Nenad Cica, ebenfalls neu im Heidelberger Sängerstamm, gab dem Duca mit leichtem, geschmeidigem und gut sitzendem Tenor sowie eindrucksvollem Spiel eine ganz persönliche Note. Mit profundem Bass-Material stattete Wilfried Staber den Sparafucile aus. Einen tiefgründigen, imposanten Mezzosopran brachte Ewelina Rakoca-Larcher für die Maddalena mit. Ansprechend gab Ks. Carolyn Frank die Giovanna. Ein solider Marullo war Philipp Stelz. Gut im Körper sang Sang Hoon Lee den Borsa. Beeindruckende stimmliche Konturen verlieh der Bass-Bariton Daniel Choi dem Grafen von Monterone. Solide entledigte sich die Gräfin von Ceprano Irida Herris ihrer kleinen Aufgabe. Als Graf von Ceprano blieb Woo Kyung Shin eher unauffällig. Xiangnan Yao (Gerichtsdiener) und Ekaterina Streckert (Page) rundeten das homogene Ensemble ab. Nichts auszusetzen gab es an dem von Ines Kaun einstudierten Herrenchor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Carly Owen (Gilda), James Homann (Rigoletto), Gräfin von Ceprano, Statisterie
Eine gute Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Zusammen mit dem trefflich disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg tauchte er tief in Verdis Klangwelten ein und präsentierte sie mit großer Prägnanz und nuancenreich. Zeitweilig drehte er den Orchesterapparat mächtig auf, schlug aber auch kammermusikalische Töne an.
Fazit: Wer sich von dem äußeren Rahmen nicht abschrecken ließ, wurde mit einer ganz famosen, gut durchdachten, intensiven und temporeichen Aufführung belohnt, die jedem Opernfreund dringendst ans Herz gelegt wird. Die Fahrt nach Heidelberg lohnt sich!
Ludwig Steinbach, 1.10.2018
Die Bilder stammen von Sebastian Bühler
DUSK
Tanztheater von Nanine Linning UA 6.12.2017

Dusk bedeutet engl. (Abend)dämmerung und betitel das neue Tanzstück von Nanine Linning, scheidende Direktorin der Tanzsparte des Theaters Heidelberg. Es handelt sich um ein „Aufblühen“, nach und nach Erschlaffen und letztlich Vergehen und Verschwinden der der 12-köpfigen Tanzgruppe.
Es beginnt mit der von den Philharmonikern live gespielten Musik ‚Shaker Loops‘ von John Adams, einem kräftig vital geprägten allegro-Stück, wozu sich die Truppe ganz kompakt von der rechten hinteren Bühnenecke nach vorn links bewegt. Dabei kommen auch asynchrone Arm- und Beinbewegungen vor. Die Kostüme dazu von Irina Shaposhnikova sind aus sperrigen Material wie Binsengräser, die auf den Unterkleidern angeklebt sind und bei Reibung auch eigene Geräusche verursachen. Bei gedämpftem Licht erscheinen sie altrosa.

Im 2.Teil zur Musik aus einem moderato gespielten Symphoniesatz von Arvo Pärt haben die TänzerInnnen die Kostüme gewechselt und tanzen in Kleidern, die aus vielen Mosaikplättchen zusammengesetzt sind. Hier sind die Bewegungen nicht mehr so kompakt. Es ergeben sich Pas de deux‘ oder pas de troix‘, bei denen aber auch auf sehr große ausdrucksvolle Bewegungen geachtet wird.
Im 3.Teil zum Adagio aus der 9.Symphonie von Mahler findet sukzessive Auflösung statt. Hier gibt es nur noch sich abwechselnde Zweierformationen, auch von einem stehenden oder sitzenden Dritten flankiert. die Bewegungen der Paare werden aber auch aggressiver, die Partner scheinen sich ineinander zu verbeißen, sich Verletzungen zufügen zu wollen. Manchmal bewegen sich einzelne hinter Stumpfglas wie schemenhaft. Zum Schluß, nach dem Abgang fast der ganzen Truppe, geht die letzte Tänzerin in eine Dampfwolke hinein, die wie eine Meereswelle auf sie zurollt, und verschwindet in ihr.
Es ist ein sehr eindrückliches Werk, das wohl zum ersten Mal von einem live Orchester unter der Leitung von GMD Elias Grandy in Heidelberg begleitet wurde, der besonders bei dem Adams-Stück das Können seiner Spieler ausreizt, und bei Mahlers Adagio versteht, ganz große Klangeruptionen zu generieren. Alle TänzerInnen und der GMD werden danach gefeiert für diese Produktion, für deren Konzept, Choreographie und Bühne die bemerkenswerte Tanzfrau Nanine Linning steht.
Fotos (c) Anemone Taake
Friedeon Rosén 10.12.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
WIR GRATULIEREN, DER RING DES POLYKRATES
Besuchte Aufführung: 17.6.2017 (Premiere: 28.5.2017)
Imaginäre Künstlerbiographie
Das war wieder einmal ein beeindruckender Opernabend! Dem Theater und Orchester der Stadt Heidelberg ist ein grandioser Doppelabend mit zwei kürzeren Opern von Mieczyslaw Weinberg und Erich Wolfgang Korngold gelungen. Weinberg dürfte einem breiteren Publikum in den letzten Jahren durch viel beachtete Aufführungen seiner „Passagierin“ und des „Idioten“ ein Begriff geworden sein. Und Korngold kennt man von seiner grandiosen Oper „Die tote Stadt“ her. Es wäre aber verkehrt, die beiden Komponisten auf diese Werke zu reduzieren. Auch ihr übriges Oeuvre ist nicht zu verachten, wie jetzt in Heidelberg deutlich wurde. Die beiden Kurzopern atmen großen Reiz und haben es verdient, zum allgemeinen Repertoire der Opernhäuser zu zählen.

Für „Wir gratulieren“ - bei der Heidelberger Produktion handelt es sich um die deutsche Erstaufführung der Originalfassung - hat Weinberg persönlich das Libretto verfasst. Es beruht auf dem Schauspiel „Mazl tov“ des jüdischen Schriftstellers Scholem Alejchem, der in erster Linie durch seinen Roman „Tevje, der Milchmann“, die Vorlage zum berühmten Musical „Anatevka“, bekannt geworden ist. Die musikalische Ausbeute ist enorm. Weinbergs am 13.9.1983 am Kammertheater Moskau aus der Taufe gehobene, bereits aus dem Jahr 1975 stammende Oper ist gänzlich der Moderne verpflichtet, klingt aber an keiner Stelle gewöhnungsbedürftig. Wie auch bei anderen Kompositionen Weinbergs wird der Einfluss seines großen Freundes und Mentors Schostakowitsch offenkundig. Seine Tonsprache ist vielschichtiger Natur. Sehr kammermusikalischen, lyrischen und oftmals recht melancholischen Stellen korrespondieren Passagen von großer Dramatik und Fulminanz. Auch der Einfluss von jüdischer Folklore, Synagogen- und Tanzmusik wird spürbar. In einmaliger Art und Weise vereinigt „Wir gratulieren“ in sich jüdischen Witz und beißende Sozialkritik.
Korngolds „Der Ring des Polykrates“ von 1916 stellt eine freie Adaption der gleichnamigen Komödie von Heinrich Teweles dar. Es ist in hohem Maße erstaunlich, was der noch nicht zwanzigjährige Korngold hier geleistet hat. Seine polyphone Musik ist ganz und gar der Spätromantik verpflichtet, recht emotional gehalten und lässt den Einfluss von Wagner nicht verkennen. Auch hier wird mit Leitmotiven gearbeitet. Die „Tote Stadt“ ist bereits vorauszuahnen. Für beide Stile hatte Olivier Pols am Pult ein gutes Gespür. Zusammen mit dem bestens aufgelegten Philharmonischen Orchester Heidelberg breitete er den ganzen musikalischen Reichtum der beiden Kurzopern expressiv und spannungsgeladen vor den Ohren des begeisterten Publikums aus.

Gloria Rehm (Fradl), Irina Simmes (Madame), Elisabeth Auerbach (Bejlja)
Beide Werke werden von ihrer geschichtlichen Einbettung geprägt. In „Wir gratulieren“ steht die Russische Revolution unmittelbar bevor. Das Ganze spielt in einem zweigeteilten Haus. Während im oberen Teil ein großes Fest vorbereitet wird - eine Verlobung steht an - sind die Dienstboten in ihrem Bereich es müde, sich ständig für die Oberschicht abrackern zu müssen. Zwei Paare veranstalten eine eigene kleine Feier, die aber schließlich von der Madame rigoros unterbrochen wird. Die hausfremden Gäste werden von ihr gnadenlos davongejagt. Auch beim „Ring des Polykrates“ spielt die Dienerschaft eine gewichtige Rolle. Der Paukist und Notenkopist Florian Döblinger und das Dienstmädchen Lieschen sind bei dem Hofkapellmeisterehepaar Arndt angestellt. Sie leben allesamt in schönster Eintracht, bis der Hausfrieden durch Peter Vogel, einen alten Freund des Hausherrn, gestört wird. Er hat Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“ aufmerksam gelesen“ und wundert sich, warum er so viel Pech und Arndt so viel Glück hat. Er fordert seinen Freund auf, seine Frau zu fragen, ob sie schon vor ihm jemals geliebt habe. Es kommt zum Streit zwischen den Liebenden. Das Ganze endet jedoch gut und Peter Vogel wird entsprechend dem Grundgedanken der Ballade weggeschickt. Er stellt das Opfer dar, das den Frieden im Haus wieder herstellt.

Gelungen war die Inszenierung von Yona Kim. Ihre spannungsgeladene, temporeiche Regiearbeit war nicht zuletzt deshalb so beeindruckend, weil es der Regisseurin in trefflicher Art und Weise gelungen ist, einen roten Faden zu spinnen, der die beiden Stücke miteinander verbindet. Die Biographien der beiden Komponisten bilden den Ausgangspunkt von Frau Kims überzeugender Deutung: Sowohl Weinberg als auch Korngold waren Juden und mussten wegen der Verfolgung durch die Nazis aus ihren jeweiligen Heimatländern fliehen. Weinberg ging nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen 1939 nach Russland. Korngold kehrte von einer Amerikareise nicht mehr in das an das Deutsche Reich angeschlossene Österreich zurück und verdingte sich in Hollywood als erfolgreicher Filmmusik-Komponist. Hieran anknüpfend wartet die Regisseurin mit einer imaginären Künstlerbiographie auf. Gezeigt wird das Leben eines Künstlers im zaristischen Russland, der sich nach der Oktoberrevolution und dem Aufkommen der Sowjetunion genötigt sieht, seine Heimat zu verlassen und in die USA zu emigrieren. Dort wird er in Hollywood gleich Korngold ein Filmkomponist, der zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Geschickt wird ausgelotet, wie ein Künstler im 20. Jahrhundert unter den Repressalien staatlicher Macht gelebt und gewirkt hat. Derart erhält die Inszenierung eine starke gesellschaftskritische Brisanz.

Margrit Flagner, von der auch die gelungenen Kostüme stammen, hat einen Längsschnitt durch ein Haus auf die Bühne gestellt, das in seinen Schwarz-Weiß-Tönen in der ersten Oper noch etwas nüchtern wirkt. In „Wir gratulieren“ hat sich die Dienerschaft in ihrem auf der Vorbühne gelegenen Bereich versammelt, während die Herrschaft etwas abgehoben im Hintergrund residiert. Auf die Wände werden Chagall-Motive geworfen. Das Zarenehepaar ist genauso zu sehen wie Bilder von Stalin. Auf einer nach oben führenden Treppe erscheint ein Fiedler, der zu einem späteren Zeitpunkt blutüberströmt zurückkehrt. Ein Höhepunkt war, als gegen Ende des Werkes die beiden Kinder der Madame mit Stalin- bzw. Hitler-Masken auftreten und sich die Hand zum verhängnisvollen Hitler-Stalin-Pakt reichen. Jetzt gibt es nichts mehr zu lachen. Dass die Situation eigentlich keinerlei Anlass zur Freude gibt, wurde bereits vorher deutlich. Nachdem der zahlreiche Bücher von Marx’ „Das Kapital“ sein eigen nennende fliegende Buchhändler Reb Alter das Lied vom Tod seiner neun Brüder gesungen hat, legen die Protagonisten Konzertfracks an und holen ihre Geigenkästen hervor. Hier gemahnt Yona Kim eindringlich an die zahlreichen jüdischen Künstler, die während der NS-Zeit ihr Leben lassen mussten. Die Diener sind schließlich nicht mehr bereit, alle Schikanen der herrschenden Klasse widerspruchslos hinzunehmen und werden gegenüber der Madame handgreiflich.

Alexander Geller (Wilhelm Arndt)
Reb Alter und die Köchin Bejlja aus „Wir gratulieren“ lässt die Regisseurin in trefflicher Anwendung eines Tschechow’schen Elementes auch durch den „Ring des Polykrates“ geistern. Der bereits bekannte Fiedler erscheint ebenfalls wieder, diesmal in einer Clownsmaske. Hier ist das im Übrigen identische Bühnenbild ganz und gar in das Ambiente einer glanzvollen Hollywood-Villa eingetaucht, in die der imaginäre Künstler geflohen ist. Er hat es weit gebracht. Er wurde mit Auszeichnungen überhäuft und hat die Filmschauspielerin Laura Simmes - eine Hommage an die Sängerin der Laura, Irina Simmes - geheiratet. Ihre Filmplakate, wie beispielsweise „Cleopatra“ und „Die Piratenbraut“, werden immer wieder auf den Hintergrund projiziert. Die Musik zu diesen Filmen stammt von ihrem Ehemann, dem Oscarpreisträger Wilhelm Arndt, wie diese Plakate wissen. Der Fluss der Musik wird immer wieder durch das eingefügte, von Stanislav Novitsky am Flügel brillant gespielte Klavierkonzert für die linke Hand in Cis-Dur von Korngold unterbrochen. Der Komponist hatte es für den Pianisten Paul Wittgenstein komponiert, der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verlor. Video-Screems zeigen die spielende linke Hand von Herrn Novitsky. Und dem uniformierten und kriegsversehrten Peter Vogel fehlt der rechte Arm. Er wird von der Regisseurin augenscheinlich mit Wittgenstein identifiziert. Das war alles recht überzeugend. Die über drei Stunden Spielzeit vergingen wie im Fluge.

Das aufgebotene Sängerensemble war trefflich aufeinander eingespielt und sehr homogen. Ks. Winfrid Mikus, der an diesem Abend seine 25jährige Zugehörigkeit zum Theater Heidelberg feierte, betonte darstellerisch gekonnt die heiteren Seiten des Reb Alter. Gesungen hat er mit seinem flachen, überhaupt nicht im Körper gestützten Tenor weniger ansprechend. Zu einer mehr komischen als ernsten Rolle geriet auch die Bejlja, die Elisabeth Auerbach mit profundem, volltönendem Mezzosopran auch bestens sang. Eine schauspielerische Glanzleistung erbrachte Gloria Rehm in der Doppelrolle der Fradl und des Lieschens. Auch gesanglich vermochte sie mit ihrem gut sitzenden, facettenreichen Sopran gut zu gefallen. Mit wunderbar sattem, intensivem, gefühlvoll und expressiv eingesetztem, dabei hervorragend fokussiertem Sopran stattete Irina Simmes die Laura aus. Auch die ständigen Wutausbrüche der Madame waren bei ihr in besten Händen. Alexander Geller klang als Wilhelm Arndt in der Mittellage passabel, ging aber in der Höhe ständig vom Körper weg, woraus in diesem Bereich eine flache Tongebung resultierte. Auch der Tenor von Namwon Huhs Florian Döblinger hätte tiefer verankert sein können. Mangels stimmlicher Durchschlagskraft war er an einigen Stellen kaum zu hören. Mit herrlich sonorem, differenzierungsfähigem Bariton und facettenreichem Spiel gab Ipca Ramanovic den Chaim und den Peter Vogel.
Fazit: Zwei unbekannte Opern von zwei genialen Komponisten, deren Nachspielen weiteren Opernhäusern dringendst ans Herz gelegt wird.
Ludwig Steinbach, 18.6.2017
Die Bilder stammen von Annemone Taake
DER FREISCHÜTZ
Besuchte Aufführung: 14.5.2017 (Premiere: 31.3.2017)
Sozialstudie und Psychogramm
Im Programmheft der neuen Heidelberger Freischütz-Produktion ist zu lesen, „diese Oper sei einfach nur schön und geradezu der Inbegriff deutscher Gemütlichkeit“. Unter dieser Voraussetzung kann man nur schwer nachvollziehen, warum der „Freischütz“ heutzutage noch aufgeführt gehört. Die Zeiten haben sich geändert, heute werden andere Anforderungen an eine gelungene Inszenierung gestellt. Demgemäß misstraut Regisseurin Sandra Leupold dieser Aussage auch rigoros und erklärt sie demgemäß auch umgehend als „noch falscher als früher auch schon“. Gar keine Frage, dass sie damit recht hat. Konsequenterweise bewegt sich ihre Regiearbeit auch nicht in ausgetretenen konventionellen Pfaden, sondern wartet mit einer geschickten Modernisierung auf.

Alexander Geller (Max), Chor
Ihre von einer ausgefeilten, stringenten Personenregie geprägte Produktion ist eine gelungene Mischung aus scharfer Gesellschaftskritik und einem tiefschürfenden Psychogramm des Jägerburschen Max. Dass die Regisseurin die Handlung in die Entstehungszeit des Werkes nach den Napoleonischen Befreiungskriegen verlegt hat, erschließt sich dem Zuschauer nur an Jessica Rockstrohs biedermeierlich geprägten Kostümen. Das Bühnenbild von Stefan Heinrichs lässt eine konkrete zeitliche Einordnung dagegen nicht zu. Der Raum ist dunkel und leer, wirkt nüchtern und kahl. Nachhaltig wird er in das Spiel mit einbezogen und mutiert gleichsam zum Mitspieler. Von der Decke hängen verschiedene Acessoires und Versatzstücke wie das Bild des Urahnen Kuno, eine Uhr, Agathes Brautkleid, ein Hirschgeweih, ein Pilz, ein Jägerhut, eine Adleratrappe, eine Kerze, eine Baumsäge und ein Blumenstrauß herunter. Ansonsten ist der Raum leer, sodass nichts von dem dramatischen Geschehen ablenkt.

Alexander Geller (Max), James Homann (Kaspar), AP Zahner (Samiel)
Es ist eine alles andere als heile, sondern eine in höchstem Maße kaputte Welt, die Frau Leupold hier vorführt. Es geht um Macht, ihr Ausleben und die Unterordnung unter ein patriarchalisch geprägtes System. Die vom leiblichen Vater über den Landesvater bis hin zum himmlischen Vater reichende Subordination lässt die obrigkeitshörige Gesellschaft roh und gewalttätig werden. Wenn sie zu Beginn an dem beim Probeschießen erfolglosen Max vorbeidefiliert und ihn nach allen Regeln der Kunst Spießruten laufen lässt, ihn bespuckt, schlägt und ihm die Ohren lang zieht, wird dieser Aspekt nur allzu deutlich. Mit harmloser Hänselei hat das nichts mehr zu tun, sondern ist Ausfluss von totaler Rohheit und Boshaftigkeit. Man merkt, Außenseiter wie Max haben in dieser Gemeinschaft keine Chance. Gnadenlos werden sie ausgegrenzt und schikaniert. Die soziale Hackordnung des Buckelns nach oben und Tretens nach unten wird hier genau befolgt. Von einer herkömmlichen Idylle irgendwelcher Art kann überhaupt keine Rede mehr sein. Der Teufel ist in diesem Ambiente nichts Äußerliches mehr, sondern steckt im Menschen selbst drin. Hier haben wir es mit einer ausgeprägten Sozialstudie zu tun, die packt und ergreift.

Hye-Sung Na (Agathe), James Homann (Kaspar), AP Zahner (Samiel)
Max wird von der Regisseurin auf eine Stufe mit Wozzeck gestellt. Gleich diesem ist er, wie bereits erwähnt, starken Querelen und Schikanen seitens seiner Umwelt ausgesetzt. Angesichts der ihn treffenden krassen Anfeindungen bekommt man regelrecht Mitleid mit ihm. Dem jungen Mann wird der Boden unter den Füßen weggezogen, er findet keinen Halt mehr und stürzt innerlich ab. Er ist nicht mehr er selbst, sondern ein Opfer der Gewalt, das sich nicht länger wehren kann und demzufolge den Einflüsterungen des bösen Kaspar nur umso stärker erliegen muss. Das Böse ist in Gestalt des mit schwarzem Anzug, Brille, Hut und weißer Schürze auftretenden schwarzen Jägers Samiel stets präsent. Die Wolfsschlucht wird von Sandra Leupold nicht äußerlich gedeutet, sondern psychologisch. Diese Szene erscheint als innerer Ausfluss des schlimmsten Verbrechens, das ein Mensch begehen kann, nämlich des Mordes an einem anderen Menschen. So erklärt sich das Menschenopfer, das die bis auf die Unterhose entkleideten und blutbeschmierten Jäger Kaspar und Max in dem einen enormen Kraftakt darstellenden Wolfsschluchtsbild vollziehen. Bei seinem Geständnis vor dem anscheinend einem Gemälde von Spitzweg entsprungenen jungen Fürsten Ottokar mit Regenschirmbegleiter entkleidet sich Max aufs Neue als Ausdruck seiner Reue. Die Intervention des Eremiten hat nicht wirklich Erfolg. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden sich am Ende nicht zum Guten wenden. Die Entwicklung der Gesellschaft stagniert. Außenseiter werden es auch künftig schwer haben. Das war alles recht überzeugend und sehr präzise und spannungsreich umgesetzt.

James Homann (Kaspar), Alexander Geller (Max), Christian Scholl (Statist)
Darstellerisch ging Alexander Geller voll in der Rolle des Max auf. Sein von großer Intensität geprägtes Spiel war einfach großartig. Rein schauspielerisch gelang ihm ein sehr einnehmendes Rollenportrait des geschundenen, unter seiner Umwelt leidenden Jägerburschen. Gesanglich setzte er nicht auf heldentenorale Kraftmeierei, sonder näherte sich der Rolle in starkem Maße von der lyrischen Seite her. Linienführung und nuancierter Ausdruck waren durchaus ansprechend. Insbesondere an den dramatischen Stellen wurde aber offenkundig, dass seinem an sich angenehmen Tenor dennoch - noch - das letzte Quantum an solider Körperstütze fehlte. Eine wunderbare, sehr zierliche Agathe war Hye-Sung Na. Bei dieser jungen Sängerin bestachen in erster Linie die herrliche Klarheit und lyrische Emphase ihres gut fokussierten lyrischen Soprans und die hohe Ausdrucksintensität ihres differenzierten Vortrags. Gut gefiel Irina Simmes als quicklebendiges, herzerfrischendes und mit bestens gestütztem Sopran perfekt singendes Ännchen. Hier kündigt sich bereits eine gute Agathe an. An diesem Abend hätte man sich die Försterstochter und deren junge Verwandte auch mit der jeweils anderen Sängerin gut vorstellen können. Obwohl er sich zu Beginn wegen einer Erkältung entschuldigen ließ, konnte James Homann in der Partie des Kaspar mit sauber ansprechendem robustem Bariton und einprägsamem Spiel trefflich überzeugen. Sonores Bassmaterial brachte Wilfried Staber für den Eremiten mit. Einen feinen, tadellos gestützten Bariton mit imposantem hohem ‚gis“ nannte der Ottokar von Zachary Wilson sein eigen. Solide schnitt Philipp Stelz’ Kilian ab. Von der schauspielerischen Seite her recht ironisch gezeichnet, gesanglich mit halsigem Bass nicht sehr überzeugend, gab David Otto den Kuno. Bei den Brautjungefern von Ulrike Machill, Elena Trobisch, Claudia Schumacher und Bomi Lee hielten sich Positiva und Negativa die Waage. In der Sprechrolle des Samiel machte AP Zahner einen gefälligen Eindruck. Die beiden fürstlichen Jäger gaben Adrien Mechler und David Daniel Reem. Auf hohem Niveau bewegten sich der von Ines Kaun einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Irina Simmes (Ännchen), Hye-Sung Na (Agathe), Brautjungfern
Im Graben setzte Davide Perniceni zusammen mit dem blendend aufgelegten Philharmonischen Orchester Heidelberg auf einen insgesamt recht kammermusikalisch anmutenden, transparenten, von schönen Zwischentönen geprägten und sehr sängerfreundlichen Klang.
Fazit: Ein imposanter, bewegender Abend, der die Fahrt nach Heidelberg wieder einmal gelohnt hat.
Ludwig Steinbach, 15.5.2017
Die Bilder stammen von Annemone Taake
MORGEN UND ABEND
Besuchte Aufführung: 5.3.2017
(Premiere: 3.2.2017)
Grenzerfahrung eines Fischers
Zu einem in jeder Beziehung atemberaubenden Opernabend geriet die Neuproduktion von Georg Friedrich Haas’ auf einem Libretto von Jon Fosse - er schrieb auch den Roman gleichen Titels - beruhenden Oper „Morgen und Abend“ am Theater der Stadt Heidelberg. Aber dass dieses hochkarätige Opernhaus ein gutes Händchen für die moderne Oper hat, weiß man ja schon lange. Es gehört zum ständigen Konzept von Operndirektor Heribert Germeshausen, Zweitinszenierungen erfolgreicher Uraufführungen an seinem Theater zu präsentieren. Und er hat bisher damit immer Erfolg gehabt - so auch dieses Mal. Aus der Taufe gehoben wurde „Morgen und Abend“ am 13.11.2015 am Londoner Royal Opera House Covent Garden in englischer Sprache. Die Uraufführungsinszenierung war später noch an der koproduzierenden Deutschen Oper Berlin zu sehen. Und jetzt also auch in Heidelberg, wo das Werk in der deutschen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel gegeben wurde. Warum nicht in der englischen Originalsprache?

Holger Falk (Johannes)
Mit Tageszeiten im engeren Sinn hat Haas’ Oper nichts zu tun. Vielmehr geht es um Geburt und Tod des Fischers Johannes. Nicht miterleben ist hier angesagt, sondern mitfühlen. Das Stück thematisiert in sehr emotionaler Weise das Thema Sterben und mag sogar geeignet sein, so manchem die Angst vor dem Tod zu nehmen. Es geht um das Ahnen von Sachverhalten, die dem Menschen ansonsten unbekannt sind. Was ihn normalerweise erschreckt und verängstigt, wird in das genaue Gegenteil verkehrt und erscheint letzten Endes als sanft und milde. Grenzerfahrungen sind es, die hier auf so einrucksvolle Art und Weise thematisiert werden. Die Quintessenz ist, dass dem Tod nichts Schreckliches anhaftet. Es ist nicht zum ersten Mal, dass sich der im Jahre 1953 in Graz geborene Haas mit derartigen Themen auseinandersetzt. Man erinnert sich noch gut an seine in den vergangenen Jahren bei den Schwetzinger Festspielen aufgeführten drei Opern „Bluthaus“, „Koma“ und „Thomas“, in denen es um ähnliche Inhalte ging.

Holger Falk (Johannes), Hye-Sung Na (Signe)
Die Oper ist in zwei Teile gegliedert. Der erste gehört dem vom Komponisten als Sprechrolle konzipierten Fischer Olai, der bang der Geburt seines Sohnes entgegensieht. Innerlich versetzt sich Olai in den Sohn, den er Johannes nennt, hinein und vollzieht imaginär den Geburtsvorgang mit. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit Johannes. Er wacht eines Morgens in seinem Bett auf und muss feststellen, das alles anders ist als gewohnt. Seine Frau Erna und sein bester Freund Peter sind tot, nur seine jüngste Tochter Signe besucht ihn noch jeden Tag und sieht nach ihm. Zu ihr hat er ein besonders inniges Verhältnis. Auf einmal fühlt er sich leicht und luftig, viel besser als zuvor. Er steht auf. Der Schmerz ist geschwunden, und er glaubt wieder jung zu sein. Auch seine Umwelt scheint ihm ganz und gar verändert. Nacheinander erblickt er Erna und Peter, obwohl beide bereits tot sind. Sie treten mit ihm in Kontakt, während Signe, die nach ihrer Großmutter väterlicherseits benannt ist, ihn nicht sehen kann und sogar durch ihn hindurchgeht. Peter klärt Johannes auf: Johannes ist an diesem Morgen gestorben. Er, Peter, habe noch einmal etwas Materie angenommen, um seinen besten Freund ins Jenseits zu geleiten. Gemeinsam schreiten sie hinüber.

Ks. Winfrid Mikus (Olai), Hye-Sung Na (Hebamme)
Es ist schon eine ungewöhnliche Geschichte, die sich hier vor den Augen des Zuschauers abspielt. In gewissem Sinne ist sie sogar autobiographisch, denn sie beruht auf einem Nahtoderlebnis, das Haas als Kind hatte. Er musste sich als Vierzehnjähriger einer Operation an einer großen Zehe unterziehen. Dabei wurde er in Narkose versetzt und verlor das Bewusstsein. Was daraufhin passierte, schildert der Komponist in einem im Programmheft abgedruckten Gespräch mit Sebastian Hanusa: „Aber dann habe ich etwas erlebt, was man nicht wirklich als Traum beschreiben kann. Plötzlich war mir klar: Ich bin tot. Ich stieg auf in eine bestimmte Welt. Ich wartete mit vielen anderen darauf, abgeholt zu werden in einen anderen Raum. Und dann merkte ich, ich bleibe übrig. Das war für mich eines der schrecklichsten Erlebnisse in meinem Leben: dieses Bewusstsein, wieder zurück zu müssen ins Leben. Und das war verbunden mit einerseits einem gleißenden und hellen Licht und andererseits einer lauten Klangwolke von extrem hohen Tönen“.

Holger Falk (Johannes), Katherine Lerner (Erna)
Die von Haas hier erwähnte Klangwolke ist in der Oper auch zu hören, und zwar am Ende, genau in dem Augenblick, in dem Johannes und Peter ins Jenseits aufbrechen. Sie ist in höchster Lage angesiedelt und extrem laut. Man muss sich regelrecht die Ohren zuhalten, wenn sie aus dem Orchestergraben dringt. Den Musikern hat der Komponist an dieser Stelle Ohrschützer empfohlen. Laut geht es indes auch an anderer Stelle der Oper zu. So bereits zu Beginn, wenn die Pauke und die großen Trommeln die Geburt des Helden einleiten. Sie sind als mächtige Wehen der Mutter zu deuten. Man merkt: Hier wird unter größten Schmerzen und Anstrengungen ein Mensch geboren. Aber auch mit leisen Tönen wartet Haas zur Genüge auf. Insgesamt ist die dynamische Skala des Werkes recht ausgeprägt. Es findet ein reger Wechsel zwischen Singen und rhythmischem Sprechen auf den Tönen statt. Das gilt besonders für Johannes. Sein Vater Olai, wie bereits oben erwähnt, beschränkt sich auf reines Sprechen.

Angus Wood (Peter), Holger Falk (Johannes)
Ein wesentliches Element für die Tonsprache von Haas allgemein ist die Mikrotonalität, das bedeutet die „Unterteilung der Oktave in kleinere bzw. andere Schritte als die der wohltemperierten Halbtonskala“ (vgl. Programmheft). Viertel- und Sechsteltöne sind in „Morgen und Abend“ aber selten und nur der Hebamme und Signe zugeordnet. Der Grund dafür ist nach Haas’ Auskunft, dass er den Musikern in der nur knapp bemessenen Probenzeit das Lernen dieser extrem schwierigen Mikrotöne nicht zumuten wollte. Man kann indes durchaus der Ansicht sein, dass er dem Philharmonischem Orchester Heidelberg, das unter der Leitung von GMD Elias Grandy einfach grandios aufspielte und den ganzen Reichtum der ungewöhnlichen Partitur mit großem Glanz vor den Ohren des begeisterten Publikums ausbreitete, Derartiges schon hätte zutrauen können. Dieser Klangkörper ist durch lange Übung mit den Erfordernissen der modernen Musik sehr vertraut. Bei den Musikern von London und Berlin mag das anders sein. Das Heidelberger Orchester hätte diese Herausforderung sicher mit Bravour gemeistert. Haas’ Musik weist kein festes Metrum auf und scheint ständig zu schweben. Die für diesen Komponisten typischen crescendierenden und dann wieder decrescendierenden Klanggebilde ohne eine prägnante Rhythmik sind sehr atmosphärischer Natur und ziehen den Zuhörer ganz in ihren Bann. Mächtige Cluster und schwirrende Glissandi tun ihr Übriges, um den Klangeindruck zu verstärken. Und wenn Regisseur Ingo Kerkhof, der in Heidelberg kein Unbekannter mehr ist, den Chor im Rücken der Zuschauer im Rang positioniert, ergibt dies ein ganz eigenes Hörerlebnis von enormer Wirkung. Auch Peter darf einmal vom Rang aus singen.

Angus Wood (Peter), Holger Falk (Johannes)
Kerkhof und sein Team - Bühnenbild: Anne Neuser, Kostüme: Inge Medert - haben ebenfalls gute Arbeit geleistet. Es ist ihnen eine geschlossene, in sich ruhende und stille Inszenierung zu bescheinigen, die sich zudem durch eine logische, unaufdringliche Personenregie auszeichnet. Das Ganze ist in Dunkel gehüllt, der Hintergrund wird an keiner Stelle hell. Das Licht erschließt sich einem nur durch die Musik. Mit der Einbeziehung des Zuschauerraumes in der ersten Szene beweist der Regisseur seine Fähigkeiten im Umgang mit den Lehren von Bertolt Brecht. Als Einheitsbühnenbild dient ein offenes Haus mit Bett und Küche, das Johannes als Wohnstätte dient. Es ist ein recht reduzierter äußerer Rahmen, in dem die Zeit manchmal still zu stehen und dann wieder vorwärts zu schreiten scheint. Dem entspricht es, dass das Haus sich mit Hilfe der Drehbühne immer wieder dreht. Sein ständiges Rotieren symbolisiert den Fluss der Zeit. Zu Beginn sieht man Olai und seine Freunde, wie sie vor dem Haus lagern und der Geburt von Johannes entgegenfiebern. Dieses Bild kehrt am Ende wieder. Der Sinn ist klar: Das Ganze kann von vorne beginnen. Der Vorgang wiederholt sich. Ein neuer Mensch wird geboren werden, dessen Lebensbahn der von Johannes nicht unähnlich sein wird.

Ks Winfrid Mikus (Olai), Hye-Sung Na (Hebamme), Statisterie
Auch mit den gesanglichen Leistungen konnte man zufrieden sein. Holger Falk ging voll und ganz in der Partie des Johannes auf, die er darstellerisch mit intensivem Leben füllte. Vokal bestach er mit gut sitzendem, klangreichem Bariton und einer guten Diktion. In der Doppelrolle der Hebamme und der Signe bewährte sich mit substanz- und farbenreichem lyrischem Sopran die zierliche Hye-Sung Na, die ihre Parts auch überzeugend spielte. Eine wunderbare, gefühlvolle und bestens grundierte Altstimme brachte Katherine Lerner für die Erna mit. Regelrecht heldisch klang der kraftvoll und ausdrucksstark, dabei mit bester Fokussierung seines ansprechenden Tenors singende Peter von Angus Wood. Auch Ks. Winfrid Mikus’ trefflich deklamierender Olai vermochte für sich einzunehmen. Eine ansprechende Leistung erbrachte der von Ines Kaun und Anna Töller einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.
Fazit: Eine hervorragende Ensembleleistung aller Beteiligten, die die Fahrt nach Heidelberg wieder einmal voll gelohnt hat! Die hundert Minuten lange, ohne Pause durchgespielte und regelrecht preisverdächtige Aufführung wird jedem Opernfreund dringendst ans Herz gelegt. Der Besuch lohnt sich!
Ludwig Steinbach, 6.3.2017
Die Bilder stammen von Annemone Taake
HÄNSEL UND GRETEL
Besuchte Aufführung: 28.12.2016
(Premiere: 24.10.2015)
Reise ins Innere
An diesem Nachmittag hatte am Theater der Stadt Heidelberg der Krankheitsteufel zugeschlagen. Die Sängerin des Hänsel Elisabeth Auerbach und Ks. Carolyn Frank, die die Hexe und die Mutter Gertrud singen sollte, waren unpässlich. Gott sei Dank wird „Hänsel und Gretel“ derzeit auch im benachbarten Mannheim gespielt. Drei der in der dortigen Produktion besetzten Sänger/innen hatten dann auch Zeit, an diesem Tag nach Heidelberg zu kommen.
Marie-Belle Sandis war darstellerisch ein recht burschikoser Hänsel, den sie mit gut sitzendem, sauber geführtem Mezzosopran auch gut sang. Schauspielerisch perfekt erschien Uwe Eikötter in der Partie der Knusperhexe. Gesanglich machte er aus der bösen Zauberin eine maskig klingende Charakterstudie. Einen profunden Mezzo brachte Edna Prochnik für die Gertrud mit. Soweit zu den Gästen vom Nationaltheater Mannheim. Nun zu den Heidelberger Sängern/innen. Hye Sung Na erwies sich schon von ihrer kleinen, zierlichen Gestalt her als ideale Besetzung für die Gretel. Auch stimmlich vermochte sie mit ihrem vorbildlich fokussierten, kräftigen und höhensicheren Sopran zu überzeugen. Eine treffliche Leistung erbrachte auch James Homann als kraftvoll und markant singender Besenbinder Peter. Kräftig ins Zeug legte sich Marijke Janssens in der Doppelrolle des Sandmännchens und des Taumännchens. Ansprechend sang der von Anna Töller einstudierte Kinder- und Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Hye Sung Na (Gretel), Hänsel
Angesichts der vielen Gäste, die wohl nicht allzu ausführlich in die Inszenierung von Clara Kalus - Bühnenbild: Nanette Zimmermann, Kostüme: Maren Steinebel - eingewiesen werden konnten, war es nicht weiter verwunderlich, dass das Ganze von der Personenregie her an diesem Nachmittag etwas improvisiert wirkte. Gewichtigere Folgen für die Produktion hatte darüber hinaus insbesondere der Fakt, dass die Partien der Hexe und der Gertrud nicht von derselben Sängerin gesungen wurden. Frau Kalus versteht die Hexe als verzerrtes Angstbild der Mutter. Aus diesem Grunde wurden beide Rollen ursprünglich derselben Sängerin anvertraut. Die Erkrankung von Frau Frank und die daraus resultierende Besetzung beider Partien mit zwei Sängern hat dazu geführt, dass dieser Hauptaspekt der Inszenierung an diesem Nachmittag gänzlich eliminiert war und deshalb hier auch nicht weiter ausgeführt werden soll.
Ansonsten konnte man mit der Inszenierung aber durchaus zufrieden sein. Sie stellt eine ansprechende Gratwanderung zwischen Märchenoper und spannendem Musiktheater dar. Sie ist kindgerecht, andererseits aber auch psychologisch grundiert, was sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene als geeignet erscheinen lässt. Sowohl dem Auge als auch dem neugierigen Intellekt wird hier viel geboten. Die Bilder und die Kostüme erfreuen den Betrachter, gleichzeitig wird man zum Denken angeregt - eine treffliche Kombination. Die Regisseurin hat sich über das Stück einleuchtende Gedanken gemacht. Ihre Konzeption weist die verschiedensten Aspekte auf, ist neben dem Märchen auch Pubertäts- und Emanzipationsgeschichte sowie psychologische Studie. Hier haben wir es also mit einem sehr interessanten Gemisch zu tun, was den Nachmittag dann auch in hohem Maße anregend erscheinen ließ.

Hänsel, Hye Sung Na (Gretel)
Hänsel und Gretel werden in ihrem Elternhaus in bürgerlicher Strenge erzogen. Vater und Mutter legen großen Wert auf Tischmanieren und sauber gefaltete Servietten. Peter reagiert unwirsch, als Hänsel sich über die ihm nicht schmeckende Suppe beschwert. Nahrung ist immerhin Mangelware. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Die Armut regiert das Leben und treibt in erster Linie Gertrud, die sich schließlich nicht mehr zu helfen weiß, zur Verzweiflung. Aus einer Art Ohnmacht heraus wird sie letzten Endes ungerecht zu den Kindern, die sie an sich aber lieb hat. Es ist nur zu verständlich, dass Hänsel und Gretel von ihrem beschränkten Verständnishorizont aus die Lage daheim anders wahrnehmen als ihre Eltern und darauf aus sind, sich von diesen zu emanzipieren. Sie wollen endlich erwachsen werden. Auf der anderen Seite können sie es aber nicht ertragen, dass die Mutter traurig ist und sich ihnen verweigert. Irrtümlicherweise suchen sie die Verantwortung dafür bei sich selbst, was sie schlussendlich in den durch Projektionen erzeugten Wald treibt, in das verworrene Dickicht ihrer ausgeprägten Schuldgefühle.
Dieser ist symbolisch zu verstehen und als Abstieg der Geschwister in das Unterbewusste zu deuten. Das Verirren im Wald meint eine Selbstfindung, die die Kinder durchlaufen müssen, um erwachsen zu werden. In der Pantomime des zweiten Aktes wird ihre Entwicklung überzeugend aufgezeigt: Immer mehr Alter Egos von Hänsel und Gretel in verschiedenen Altersstufen, ältere und jüngere, wandeln über die Bühne. Hier wird von Frau Kalus gekonnt der Verlauf eines Menschenlebens aufgezeigt und der Weg der beiden kleinen Träumer vorweggenommen. Andererseits handelt es sich bei diesem Bild aber um ein Phantasiegebilde der Geschwister. Alles spielt sich aus ihrer Perspektive ab. In Anlehnung an Sigmund Freuds „Traumdeutung“ erzeugt der Wald in ihnen Angstvisionen, deren größte die Hexe ist. Indem die Kinder die böse Magierin am Ende besiegen, haben sie eine nicht unerhebliche Hürde auf dem Weg zum Erwachsenwerden genommen und sind nun fähig, das Verhalten der Eltern besser zu begreifen.

Hexe, Hye Sung Na (Gretel)
Eine ausgezeichnete Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Zusammen mit dem versiert aufspielenden Philharmonischem Orchester Heidelberg schöpfte er insbesondere bei den an Wagner gemahnenden Passagen - so beim Hexenritt und bei der an „Ring“ und „Meistersinger“ gemahnenden Pantomime - aus dem Vollen. Aber auch die mehr volksliedhaften Elemente klangen unter seiner Leitung recht intensiv und ausdrucksstark. Der von ihm und den Musikern erzeugte Klangteppich war obendrein recht differenziert und nuancenreich und wies eine reichhaltige Farbpalette auf.
Ludwig Steinbach, 29.12.2016
Die Bilder stammen von Annemone Taake
LA BOHEME
WA am 3.10.2016
Premiere: 29.5.2016
Die Kunst der Selbstdarstellung

Am Theater der Stadt Heidelberg ist mit großem Erfolg Andrea Schwalbachs im Bühnenbild von Nanette Zimmermann und den Kostümen von Frank Lichtenberg spielende, bereits letzte Spielzeit entstandene Inszenierung von Puccinis „La Bohème“ wiederaufgenommen worden. Und erneut wurde das hohe Niveau dieses mittelgroßen Hauses offenkundig. Alles wirkte wie aus einem Guss. Inszenierung, musikalische und gesangliche Leistungen fügten sich zu einer überzeugenden Symbiose zusammen.

Alexander Geller (Rodolfo), Wilfried Staber (Colline), James Homann (Schaunard), Ipca Ramanovic (Marcello)
Überzeugend war bereits die interessante Regie. Sie verstehen sich schon ausgezeichnet auf die Kunst der Selbstdarstellung, die vier Bohemièns Rodolfo, Marcello, Schaunard und Colline. Sie hausen in einer modernen Wohngemeinschaft und haben ihr eigenes Leben kurzerhand zur Kunst erhoben. Der aufgesetzt wirkende, künstliche Humor soll ihnen helfen, die Widrigkeiten des Alltags zu bewältigen. Dabei warten die Freunde auch mit einer ausgeprägten schauspielerischen Ader auf. Wir haben es hier mit einer groß angelegten Performance zu tun, in der jeder den anderen etwas vorspielt. Demgemäß stellt die Mansarde in Frau Schwalbachs Deutung ein Theater auf dem Theater dar, das von Schriftzügen in verschiedenen Sprachen wie „Kunst ist die schönste Lüge“, „Live ist not an rehearsel“, „Flamme éternell“, „La realité n’existe pas“ und „Normale Desires“ eingenommen wird - Ausdruck eines Lebensgefühls, das angesichts existentieller Nöte etwas aufgesetzt wirkt. Die vier Gefährten tragen gleichsam eine unsichtbare Maske. Das von Nöten geprägte Leben des Einzelnen findet sich in gleicher Weise bei den anderen. Jeder nimmt am Dasein seiner Freunde teil, das er voll und ganz akzeptiert. Alle spielen Leben.

Ipca Ramanovic (Marcello), Hye-Sung Na (Mimi), Alexander Geller (Rodolfo)
Dieses Prinzip der Selbstinszenierung und das Verstecken hinter Larven funktioniert indes nur so lange, wie Gefühle nicht ins Spiel kommen, so im ersten und dem ungemein farbenprächtig und mit opulenten Chor-Kostümen in Szene gesetzten zweiten Akt. Im von einer auf einem Hintergrundprospekt aufragenden Schneelandschaft vor einer Hochhausfassade dominierten dritten Akt ändert sich dann aber die Situation und das Ganze nimmt die Dimension eines Psychodramas an. Die Beschränkung auf die Selbstdarstellung der Figuren wird brüchig. Nun spielen bloße Äußerlichkeiten keine Rolle mehr. Das Leben mit den Mitmenschen tritt an ihre Stelle. Mitgefühl und vor allem Liebe beherrschen die Szene. Hier dringt Andrea Schwalbach gekonnt bis zum Grund der Seele der Protagonisten vor. Das gelingt ihr mittels einer ausgefeilten Personenregie. Bereits vorher war ihre Führung der Handlungsträger recht stringent und abwechslungsreich. Auch auf Tschechow’sche Elemente versteht sie sich trefflich. Mehrmals gönnt sie im Lauf des Abends den Beteiligten auch an Stellen Auftritte, an denen Puccini solche gar nicht vorgesehen hat. So beobachtet die zierliche Kindfrau Mimi von Anfang an von ihrem mit Blumen und Kuscheltieren eingerichteten, auf der rechten Seite der Bühne liegenden Gemach aus das Treiben der Bohemièns. Marcello, Colline und Schaunard bleiben während der Szene von Rodolfo und Mimi im ersten Akt noch eine Weile präsent. Im vierten Aufzug betreten die todkranke Mimi und Musetta ebenfalls früher als normal die Bühne, setzen sich hin und werden auf diese Weise Zeuginnen der ausgelassenen Aktivitäten der vier Freunde. Einmal werden sie auch in deren Spiel einbezogen. Derartige Regieeinfälle lassen die Inszenierung abwechslungsreich und spannend erscheinen.

Musetta, Ipca Ramanovic (Marcello)
Besonders interessant ist Frau Schwalbach in diesem Kontext die Figur der Mimi gelungen. Von Anfang an sehnt sie sich danach, ein Teil des Bohemièn-Kollektivs zu werden. Insbesondere Rodolfo ist sie sehr zugetan. Marcello, Schaunard und Colline bemerken dann auch, wie es um sie steht. Im Folgenden geben sie ihr die Möglichkeit, an ihrer Selbstinszenierung teilzunehmen. Nur Rodolfo muss noch überzeugt werden. Demgemäß gibt Schaunard Mimi die Kerze, die im Folgenden nicht von alleine ausgeht, wie es im Libretto vorgegeben ist, sondern von Mimi selbst ausgeblasen wird. Dieser Regieeinfall ist indes nicht mehr neu. Das hat man bei Harry Kupfer schon ähnlich gesehen. Fast heiter mutet der Augenblick an, in dem Mimi von Rodolfo geküsst werden will und deshalb einen Kussmund macht. Sie hat es schon faustdick hinter den Ohren. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will. Bemerkenswert ist, dass ihre Krankheit von Anfang an ebenfalls Selbstdarstellung ist, Ausdruck der großen Schauspielkunst der Näherin, die sogar ihren Tod zu inszenieren scheint. Um die Fassade aufrecht zu erhalten benötigt Mimi indes die Bohemièns, deshalb will sie in deren Kreis aufgenommen werden. Sie geben ihr die Illusion, ihr Leiden unter Kontrolle zu haben. Wenn diese Fiktion dann aber im dritten Akt bricht, hat es auch damit ein Ende. Im letzten Akt wird nachhaltig der Boden der Tatsachen betreten. Das Phantasiegebilde birst. Mit dem Sterben Mimis endet auch die Selbstdarstellung der Bohemièns. Die Gefühle brechen sich ihre Bahn. Angesichts des Todes fällt jegliche Art von Selbstinszenierung in sich zusammen. Das war alles sehr überzeugend und von der Regisseurin hervorragend umgesetzt.

Hye-Sung Na (Mimi), Rodolfo
Auch mit den gesanglichen Leistungen konnte man fast durchweg voll zufrieden sein. Bis auf eine Ausnahme. Diese bestand in Alexander Geller in der Rolle des Rodolfo. Eigentlich über angenehmes Tenormaterial verfügend, tat er sich in der Höhe sehr schwer. Mehrmals kam es vor, dass er bei Spitzentönen die Stütze verlor, woraus ein doch sehr fragwürdiger Klang resultierte. Das geht überhaupt nicht! Die anderen Sänger/innen der Hauptpartien waren ihm stark überlegen. Wunderbar war Hye-Sung Na anzuhören, die mit sauber fokussiertem Sopran, hoher Nuancierungskunst und sicheren Höhen ein Maximum an Gefühlen in die Rolle der Mimi legte, die sie auch anrührend spielte. Von den Männern am besten war Ipca Ramanovic, der mit herrlich italienisch geschultem, über ein gutes Legato verfügendem und elegant phrasierendem sonoren Bariton einen ausgezeichneten Marcello sang. Eine hoch erotische, schnippische Musetta war Rinnat Moriah, die sie mit solide durchgebildetem Sopran auch ansprechend sang. Fast schon überbesetzt mutete der treffliche Heldenbariton von James Homann als Schaunard an. Markantes Bassmaterial brachte Wilfried Staber für den Colline mit. Ordentlich ergänzten Philipp Stelz (Benoit), David Otto (Alcindoro, Sergeant, Zöllner) und Yang-O Na (Parpignol). Tadellos präsentierte sich der von Anna Töller einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Rinnat Moriah (Musetta), Ipca Ramanovic (Marcello)
Eine gute Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen, der zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg Puccinis Partitur mit herrlicher Italianita und sehr gefühlsbetont zum Klingen brachte. Insbesondere die reichhaltigen Kantilenen waren wunderbar anzuhören. Aber auch die mehr parlandoartigen Stellen haben Dirigent und Orchester prägnant zu Gehör gebracht.
Ludwig Steinbach, 4.10.2016
Die Bilder stammen von Annemone Taake
DIE ZAUBERFLÖTE
Besuchte Aufführung: 25.9.2016
Premiere: 23.9.2016
In einer gespaltenen Welt
Sie ist etwas für die ganze Familie, die neue „Zauberflöte“ am Theater der Stadt Heidelberg. Regisseur Maximilian von Mayenburg hat sie in Zusammenarbeit mit Tanja Hofmann (Bühnenbild) und Sophie du Vinage (Kostüme) mit viel Liebe und Sinn für Poesie auf die Bühne des Heidelberger Theaters gebracht. Herausgekommen ist eine recht ansprechende, zeitlos anmutende und schlichte Produktion, die jeder Altersstufe gerecht wird. Insbesondere über die prachtvollen bunten Kostüme erschließt sich dem Zuschauer das Märchenhafte der Handlung. Dem Auge wird wahrlich viel geboten, und auch der neugierige Intellekt wird befriedigt. Ernste und heitere Momente wechseln sich ab. Diese gekonnte Mischung verschiedener Elemente vermochte voll und ganz zu befriedigen.
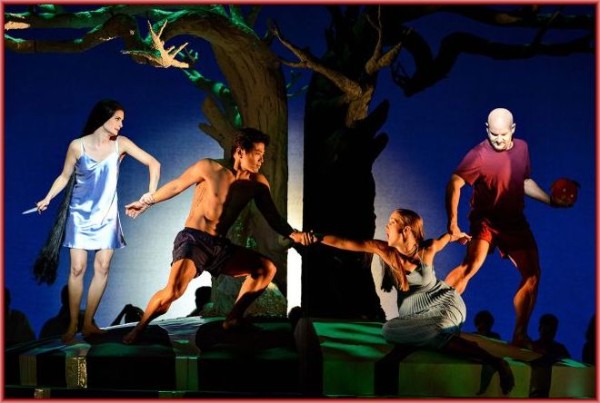
Rinnat Moriah (Königin der Nacht), Namwon Huh (Tamino), Irina Simmes (Pamina), Wilfried Staber (Sarastro)
Das Bühnenbild besteht aus einer zu Beginn noch geschlossenen, treppenförmig ansteigenden Halbkugel, aus deren Spitze ein Baum aufragt. Sehr ästhetisch mutet der blaue Hintergrund an. An die Stelle des Sonnenkreises tritt ein Apfel, der einsam an einem der Zweige hängt. Wenn sich der Vorhang öffnet, bietet sich dem Betrachter ein Bild vollendeter Harmonie. Zärtlich aneinander geschmiegte Liebespaare und Tiere leben in Eintracht zusammen. Unter ihnen befinden sich auch Tamino und Pamina, Sarastro und die Königin der Nacht. Der Frieden währt aber nicht lange. Die sternenflammende Königin und der Führer der Eingeweihten beginnen um den gepflückten Apfel zu kämpfen. Sarastro vermag den Streit für sich zu entscheiden. Hier haben wir es von der christlichen Perspektive her gesehen gleichsam mit dem Sündenfall zu tun, der die Welt aus dem Gleichgewicht bringt. Pamina und Tamino werden auseinandergerissen und die Halbkugel zerbricht in zwei Teile.

Namwon Huh (Tamino)
Im Folgenden trennt ein Abgrund die beiden Welten. Auf der einen Seite leben Sarastro und seine weiß gekleideten Priester, die ihre Weisheit aus mehreren Bücherstapeln beziehen, auf der anderen die Königin der Nacht samt gleich ihr schwarz gekleidetem Gefolge und ihren in bunten Gewändern auftretenden drei Damen. Von Mayenburgs Intention besteht darin, eine gespaltene Welt aufzuzeigen. Diese Trennung tut allen Beteiligten nicht gut. Tamino und Pamina obliegt es im Folgenden, die Einheit wieder herzustellen. Die Liebe als alles verbindende Element soll es richten. Auch die eifrig zwischen den Bereichen hin und her pendelnden drei Knaben, die hier anstelle Taminos und Papagenos die Zauberflöte und das Glockenspiel spielen, haben ihren Anteil daran. Sie verkörpern gleichsam ein übergeordnetes Prinzip, das beiden Welten nur Positives bringt. Ihre Aufgabe ist es, alles was die Menschen irgendwie bedrückt, auszuschalten.

Irina Simmes (Pamina), Rinnat Moriah (Königin der Nacht)
Ein häufig ins Spiel gebrachter Kritikpunkt an Mozarts „Zauberflöte“ ist der Bruch, der sich durch das Werk zieht. In der Tat ist es schwer nachzuvollziehen, dass die zuerst gute Königin der Nacht auf einmal böse und der als maliziös eingeführte Sarastro unvermittelt gut wird. Dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Dieser Bruch spielt aber in von Mayenburgs Deutung eine wichtige Rolle. Das wird zu Beginn des zweiten Aktes bei Sarastros Rede offenkundig. Die Königin der Nacht, für die Mozart und Schikaneder hier eigentlich gar keinen Auftritt vorgesehen haben - auch an anderen Stellen wartet der Regisseur mit vortrefflichen Tschechow’schen Elementen auf -, nimmt an der Versammlung der Priester teil und übernimmt sogar einige der ursprünglich Sarastro zugedachten Worte. Zur Kittung des Bruchs wird hier eine Einigkeit unter den Kontrahenten beschworen, die indes letztendlich nicht eintritt. Interessant ist dieser Einfall allemal.

Ipca Ramanovic (Papageno)
Das Innovative des Stücks wird vom Regisseur insgesamt trefflich herausgearbeitet. Aber auch der unterhaltende Faktor kommt nicht zu kurz. Es wird flott durchinszeniert. Leerläufe entstehen nie, Langeweile kommt an keiner Stelle auf. Insgesamt haben wir es mit einer vergnüglichen Angelegenheit zu tun, die dennoch auch einige weitere Kritikpunkte am Inhalt der Oper aufweist. Eine überraschende Aussage gelingt von Mayenburg bei der Hallenarie, die er teilweise auf den noch anwesenden Monostatos bezieht. Den Passus „Wen solche Lehren nicht erfreun, verdienet nicht ein Mensch zu sein“, wird von ihm negativ interpretiert. Und das zu Recht. Das Fazit scheint zu sein: Wer meinen Lehren nicht folgt, hat hier nichts zu suchen. In diesem Sinne wird der im Gegensatz zu dem ein buntes Federkleid tragenden Papageno mit einem schwarzen Krähengewand versehene Mohr rüde in seine Schranken verwiesen. Anschließend werden ihm auf Befehl Sarastros einige Federn ausgerissen, was ihm deutlich hörbar Schmerzensschreie entlockt. Hier offenbart sich eine durch und durch unangenehme Seite des Führers der Eingeweihten. Da vermag sich sogar eine Spur von Mitleid für Monostatos im Zuschauer zu regen. Einem Menschen Liebe zu verweigern, ist wirklich nicht schön. Dass sich der Mohr sehr danach sehnt, wurde bereits früher deutlich, als er das Es-Dur-Duett zwischen Pamina und Papageno „Bei Männern, welche Liebe fühlen“, belauschte und am Ende einen starken Seufzer von sich gab. Zudem wird hier die Frauenfeindlichkeit der Priester angeprangert. Die sonst männlichen Sklaven sind bei von Mayenburg weiblich. Man merkt, nicht nur der Königin, auch Sarastro sind nicht unerhebliche böse Charakterzüge eigen. Ihre Zwietracht bezahlen sie am Ende mit ihrem Leben. Beider Tod hebt die Spaltung des Bühnenbildes indes auf. Der Abgrund wird geschlossen und die Halbkugel erscheint wieder als Ganzes. Die beiden Welten sind erneut vereint. Ein neues, hoffentlich besseres Zeitalter bricht an.

Knabe, Irina Simmes (Pamina), Namwon Huh (Tamino)
Nun zur gesanglichen Seite. Bei dem Tamino von Namwon Huh waren insbesondere Phrasierung und Linienführung positiv zu beurteilen. Allerdings singt der junge Tenor nicht im Körper, weswegen seine Stimme nicht gerade sonor und tiefgründig klingt. In dieser Beziehung war ihm Irina Simmes in der Rolle der Pamina weit überlegen. Diese prachtvolle Sängerin zog mit warmem, bestens fokussiertem und stets ausgeglichen wirkendem Sopran sämtliche Register ihrer Rolle, die sie insgesamt sehr differenziert und nuancenreich sowie mit enormem lyrischen Glanz anlegte. Mit großer Koloraturgewandtheit, flexibler Stimmführung und mühelos bis zum f’’’ reichenden Spitzentönen bei untadeligem Stimmsitz wartete Rinnat Moriah als Königin der Nacht auf. Darstellerisch sehr wendig und lustvoll agierend gab Ipca Ramanovic den Papageno, den er mit bestens gestütztem, kräftigem Bariton auch hervorragend sang. Einen volltönenden, markanten Bass brachte Wilfried Staber für den Sarastro mit. Imposantes Heldenbariton-Material zeichnete den Sprecher von James Homan aus. Die drei Damen von Hye-Sung Na, Polina Artsis und Ks Carolyn Frank bildeten einen homogenen Gesamtklang. Solide sang Regine Sturm die Papagena. Mit stark maskiger Tongebung stattete Ks Winfrid Mikus den Monostatos aus, den er indes trefflich spielte. Als die drei Knaben bewährten sich Klara Löhr, Stella Rembalski und Ricarda Schmitt vom Kinder- und Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg. Lediglich durchschnittlich klangen Adrien Mechler, David Otto und Zachary Wilson in den Partien der drei Priester. Mit kraftvoller Tongebung machten die beiden Geharnischten von Sang-Hoon Lee und Michael Zahn auf sich aufmerksam. Gut gefiel der von Anna Töller und Ines Kaun einstudierte Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Polina Artsis (Zweite Dame), Hye-Sung Na (Erste Dame), Ks Carolyn Frank (Dritte Dame), Rinnat Moriah (Königin der Nacht), Wilfried Staber (Sarastro), Opernchor und Extrachor
Eine glänzende Leistung ist GMD Elias Grandy zu bescheinigen, der zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg einen von Anfang an prägnanten Ton in insgesamt recht flüssigen Tempi anschlug. Bei einer abwechslungsreichen dynamischen Skala wartete er zudem mit mancherlei Zwischentönen auf und zeigte sich auch in der Herausarbeitung der vielen orchestralen Farben sehr versiert.
Ludwig Steinbach, 26.9.2016
Bilder (c) Theater Heidelberg / Annemone Taake / Susanne Reichardt
Zum Zweiten
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Besuchte Aufführung: 24.4.2016
Premiere: 9.4.2016
Kriegsverherrlichung in der Militärakademie
Haftet Wagners romantischer Oper „Der fliegende Holländer“ irgendetwas Militärisches an? So muss man sich fragen, wenn man sich diese Oper am Theater der Stadt Heidelberg ansieht. Regisseurin Lydia Steier hat diese Frage mit einem Ja beantwortet und die Geschichte um den geisterhaften Seefahrer kurzerhand in einer amerikanischen Militärakademie im Stile der 1950er Jahre angesiedelt. Das von Susanne Gschwender geschaffene Einheitsbühnenbild stellt ein Klassenzimmer dar, in dem sich während des Vorspiels die von Gianluca Falaschi mit blauen kurzen Hosen und Kappies sowie roten Hemden versehenen Kadetten auf einer Videoleinwand Schwarz-Weiß-Filme vom Zweiten Weltkrieg ansehen. Johlend applaudierend beobachten die jungen Militärschüler unter der Aufsicht ihres Lehrers, des Admirals Daland, wie Bomben über Deutschland abgeworfen werden und die Alliierten in der Normandie landen.
Diese noch gänzlich unreifen, allesamt blonden Kadetten scheinen sich überhaupt nicht darüber im Klaren zu sein, welche Schrecken der Krieg in sich birgt. Je krasser die in dem Film gezeigten Szenen werden, desto mehr jubeln sie. Für sie ist der Krieg das Höchste. Ihm kommt gleichsam die Funktion einer Ersatzreligion zu, was doch recht bizarr anmutet. Hier wird Böses produziert, man ist grausam und gefällt sich darin, Außenseiter zu quälen und zu verspotten. Der Steuermann, der darob am Ende seines Liedes in bittere Tränen ausbricht, wird von ihnen übel gemobbt. Auch die ebenfalls rot-blau gewandeten platinblonden Frauen sind in diese gleichgeschaltete Gesellschaft integriert. Ihnen kommt im zweiten Aufzug die Funktion zu, Bomben und Torpedos herzustellen. Dieser Aufgabe kommen sie nur allzu bereitwillig nach. Eifrig gehen sie ans Werk und erzeugen sowohl kleinere als auch größere Sprengkörper. Ein Mädchen nimmt sogar behände auf einem der Torpedos Platz. Bereitwillig fügen sich die Frauen in diese fragwürdige Welt ein, die Grausamkeiten begeht, ohne sich dessen richtig bewusst zu sein. Es findet eine totale Kriegsverherrlichung statt. Alles am Krieg ist positiv, seine schlechten Aspekte werden ausgeblendet. Alles Negative wird aus dem Blickfeld verbannt.

Johanni van Oostrum (Senta), Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg
Einzelgänger und Individualisten haben es in diesem Umfeld schwer. Der Holländer hat den Krieg erlebt und kann es nicht verstehen, dass dieser in der Militärschule ins Positive umgedeutet wird. Für ihn ist Krieg der Inbegriff der Schrecknisse und Gefährdungen. Trotzdem lässt er sich von den Kadetten anstelle seines braunen Seemannmantels eine blaue Akademiejacke anlegen. Ein Teil von ihnen wird er dennoch nicht. Diese Mentalität ist ihm fremd. Er hat zuviel Schlimmes erlebt. Der auf ihm lastende Fluch wird zur Metapher für eine ausgeprägte Psychose. Einfühlsam zeigt Frau Steier das Bild eines traumatisierten Menschen, der schon viel Schlimmes erlebt hat, dies aber nicht verarbeiten kann und sich nichts sehnlicher wünscht als Frieden. Seine seelischen Wunden sind voll und ganz Ausgeburt der brutalen Gesellschaft, die den Frieden verachtet und den Krieg verherrlicht.
An dieser Gemeinschaft krankt auch Senta. Wie der Holländer - an die Stelle seines Bildes tritt hier ein Buch - ist auch sie das Produkt einer Welt, mit deren Werten sie sich in keinster Weise identifizieren kann. Das lässt sie ebenfalls zur Außenseiterin werden und dem Spott der Mädchen anheim fallen, die die „Johohohoe“-Rufe zu Beginn von Sentas Ballade immer wieder durch hämisches Lachen unterbrechen. Es dauert eine kleine Weile, bis die Daland-Tochter endlich richtig beginnen kann. Man merkt, dass sie innerhalb der Frauenliga keinen leichten Stand hat. Sie kann in diesem Ambiente nicht leben und lehnt den Krieg ab. Nachhaltig versucht sie ihrem Leben einen Sinn zu geben. Und hier tritt der Holländer auf den Plan. Ihn zu erlösen wird zum Zweck ihres Daseins. Die Mentalitäten der beiden sind sich sehr ähnlich. Sie lehnen die auf der Militärakademie vermittelte Kriegsbegeisterung ab und projizieren ihre Sehnsüchte und Wünsche auf den jeweils anderen.

Pedro Velázquez Diaz (Erik), Johanni van Oostrum (Senta)
Auch Erik wird hier als Außenseiter gezeigt. Er ist ein intellektueller Ausländer, der sich für die Werte seiner Umgebung wenig interessiert und jedwedem kriegerischen Treiben negativ gegenübersteht. Und Senta liebt er, weil sie ebenfalls so denkt und handelt. „Ihre Schattenseite ist der Negativspiegel der Gesellschaft“, sagt Lydia Steier im Programmheft, „Sie sind die Projektionsflächen der anderen“. Der Bezug zu Feuerbach wird offenkundig. Während des Festes im dritten Aufzug bricht diese heile Welt in sich zusammen. Mit den zombieartig schwarzen holländischen Matrosen, die mit ihren alten Militärhelmen wie Relikte aus vergangenen Kriegen aussehen, werden den Kadetten endlich einmal die Schrecken des Krieges vor Augen geführt. Nun werden sie mit der naheliegenden Möglichkeit konfrontiert, auf dem Feld der Ehre zu bleiben, wobei im Hintergrund das bis dahin ausgesparte Meer aufwirbelt. Jetzt wird ihnen schlagartig bewusst, dass Krieg etwas durch und durch Negatives ist, das sie nicht nur von außen bewundern. Dass sie sich ihm nun stellen müssen, lässt sie dem Wahnsinn verfallen. Am Ende erschießt sich Senta mit Eriks Pistole und der Holländer und seine Mannschaft sinken entseelt zu Boden. Das war alles gut durchdacht und mit einer flüssigen Personenregie auch imposant umgesetzt. Die von Frau Steier vorgenommene Neudeutung war durchweg überzeugend und einleuchtend.
 Obwohl er sich wegen einer gerade überstandenen Krankheit ansagen ließ, ist James Homann in der Titelpartie eine gute Leistung zu bescheinigen. Sein Holländer atmete darstellerisch große Kraft und Impulsivität. Auch gesanglich vermochte er mit seinem markanten, gut sitzenden Heldenbariton, der zudem über eine schöne Pianokultur verfügt, zu beeindrucken. Eine schauspielerisch intensive Senta, die ihrem Part mit wunderbarer italienischer Technik, in jeder Lage samtenem Stimmklang und emotionaler Tongebung auch vokal voll und ganz entsprach, war Johanni van Oostrum. Diese vielversprechende junge Sopranistin sei Bayreuth ans Herz gelegt. Für den erkrankten Wilfried Staber hatte der über einen soliden Bass verfügende Marek Gasztecki den Daland übernommen. Obwohl er relativ kurzfristig eingesprungen war, fand er sich gut in die Regie ein und hat seine Rolle darstellerisch glaubhaft ausgefüllt. Eine etwas tiefgründigere Tongebung hätte man sich von dem den Erik mehr lyrisch als heldisch angehenden Pedro Velázquez Diaz gewünscht. Auch dem Steuermann von Namwon Huh fehlte es an einer vorbildlichen Verankerung seins Tenors im Körper. Ordentlich schnitt Ks. Carolyn Frank als Mary ab.
Obwohl er sich wegen einer gerade überstandenen Krankheit ansagen ließ, ist James Homann in der Titelpartie eine gute Leistung zu bescheinigen. Sein Holländer atmete darstellerisch große Kraft und Impulsivität. Auch gesanglich vermochte er mit seinem markanten, gut sitzenden Heldenbariton, der zudem über eine schöne Pianokultur verfügt, zu beeindrucken. Eine schauspielerisch intensive Senta, die ihrem Part mit wunderbarer italienischer Technik, in jeder Lage samtenem Stimmklang und emotionaler Tongebung auch vokal voll und ganz entsprach, war Johanni van Oostrum. Diese vielversprechende junge Sopranistin sei Bayreuth ans Herz gelegt. Für den erkrankten Wilfried Staber hatte der über einen soliden Bass verfügende Marek Gasztecki den Daland übernommen. Obwohl er relativ kurzfristig eingesprungen war, fand er sich gut in die Regie ein und hat seine Rolle darstellerisch glaubhaft ausgefüllt. Eine etwas tiefgründigere Tongebung hätte man sich von dem den Erik mehr lyrisch als heldisch angehenden Pedro Velázquez Diaz gewünscht. Auch dem Steuermann von Namwon Huh fehlte es an einer vorbildlichen Verankerung seins Tenors im Körper. Ordentlich schnitt Ks. Carolyn Frank als Mary ab.
Eine ausgezeichnete Leistung ist GMD Elias Grandy am Pult zu bescheinigen. Er legte sich ungemein ins Zeug. Zusammen mit dem bestens disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg erzeugte er einen Klangteppich von feuriger Intensität und großer Wucht. Das soll aber nicht bedeuten, dass seine Herangehensweise an Wagners Werk lediglich dramatisch gewesen wäre. Auch fein auszelebrierte lyrische Aspekte und große angelegte Bögen kostete er genüsslich aus. Differenziertheit und Farbigkeit des Klangs wurden an diesem gelungenen Nachmittag ganz groß geschrieben und geben beredtes Zeugnis von dem großen Können des noch jungen Generalmusikdirektors, auf den das Heidelberger Theater zu Recht stolz sein kann.

Fazit: Eine spannende, gut durchdachte Neudeutung. Der Besuch der Aufführung sei jedem Opernfreund ans Herz gelegt.
Ludwig Steinbach, 26.4.2016
Die Bilder stammen von Annemone Taake
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Neuinszenierung
Vorstellung am 14.4.2016

In der Holländer-Neuinszenierung kommt es der Regisseuse Lydia Steier in erster Linie darauf an, eine Gesellschaft mit großer Lust auf Militarisierung zu zeigen. Vielleicht als gebürtige US-Amerikanerin fällt dabei ihre Wahl auf eine ameikanische Elite-Kadettenschule, in der die Kadetten auch gleich in den Uniformen der Landesfarben und bevorzugt kurzen Hosen gekleidet sind (Kost.: Gianluca Falaschi). In der Eingangsszene werden sich s.w.-Filme vom D-Day im 2.Weltkrieg mit den Siegen der Amerikaner angesehen, vom immer wieder aufbrausenden Applaus der Kadetten begleitet. Gleichzeitig vermittelt dieses Gebaren Leichtigkeit und Witzigkeit unter dem Onkel-haften Stabsadmiral Daland, der Krieg wird eher als Spiel denn als Ernst wahrgenonmmen.

Die Bühne von Susanne Gschwender zeigt einen Unterrichtsraum mit Sitzpulten, links vorn Film-, Videoleinwand, daneben erhöht ein kleiner Schreibtisch des Klassenlehrer-Admirals, daneben die US-Flagge. Einen kleiner Kontrapunkt bildet nun die Steuermannsszene, der als Außenseiter dieser Hurra-Gemeinschaft gesehen wird, indem er auch seinem Lied einen eher larmoyanten Ton verleiht und an dessen Ende in großes Weinen ausbricht. Degegen wird im 2.Aufzug die lustig verspielte Sphäre bruchlos fortgesetzt, wenn nun „Kadettinnen“ in ähnlichen Uniformkostümen auftreten, und alle kleine Raketen in den Händen haben, an denen sie herumschrauben. Alle tragen zudem blonde Marilyn Monroe-Frisuren und blaue Schiffchen darauf. Dazu werden später erst mittel-, dann ganz große Raketen hereingefahren, auf die sich einige Kadettinnen, indem sie sich sexy ihre Röcke hochziehen, daraufsetzen und quasi auf ihnen reiten.

Auch Eric ist ein eher kriegsmüder Außenseiter und wird von den Mädchen verspottet. Der Holländer wird als alter Kapitän mit braunem pelzbesetztem Seemannsmantel eingeführt, er wird ihm aber von den Kadetten zugunsten einer ihrer blaurot-weißen Uniformen ausgezogen. Er stellt letztlich mit seinen kaum sichtbaren Kumpanen eine verlotterte ‚vorkriegshafte‘ Bewegung dar, die aber am Ende des lustig inszenierten Steuermannschor doch Angst einzuflößen vermag, indem dann auch das Ambiente in sich einstürzt, und dahinter eine dunkle wellenreiche Meeresprojektion sichtbar wird. Mit diesem einbrechenden Chaos, wo in einer Orgie mit den Wellen letzte Hüllen fallen, gibt sich Senta final eine Kugel. Insofern ist Steier, was die Beziehreung zum Holländer betrifft, wieder ganz nah an der Wagner’schen Sichtweise.

Das Orchester und der Dirigent Elias Grandy legen eine stattliche Aufführung hin. Bei oft eher verhaltenen Tempi gibt es schon im Vorspiel immer wieder rasante Zuspitzungen, selten hat man ‚turmhohe Wellen‘ so schäumen gehört. Die hohen Streicher haben zu Beginn einen wunderbar fulminanten ‚Auftritt‘. Auch die neckisch empfundenen ‚Spinnerinnen‘ fügen sich großartig ein, die Holländererzählung ist spannend aufgebaut end endet in schierer Dämonie. Einem maskulin derbem Matrosenchor steht ein gewitzt-süffiger bis schneidiger Damenchor gegenüber (E.: Anna Töller). Der Steuermann ist mit manchmal leicht piepsigem Tenor Sang-Hoon Lee, der aber auch heftig einstecken muss. Eine drall komische Mary gibt der Mezzosopran Barbara Dorothea Link. Den Daland mit weißgepuderten Haaren gibt ganz köstlich Wilfried Staber, scheint’s liegt ihm Wagner noch nicht so wie Mozart, im Duett legt er aber bassal zu.

Ein stimmlich guter Eric ist Pedro VelasquezDiaz, der gut dosiert butterweiche Spitzentöne ansetzt. Einar Sigurdarsson als ‚Kavaliersbariton‘ ist aber seine große Konkurrenz bei Senta, auch wenn er außer seinem ganz belcantischen Holländer nichts extra Dämonisches mitzugeben hat.Katrin Adel überrascht als letztlich triumphierende Senta. Die derzeit in St.Gallen singende Österreicherin hat eine dramatisch glänzenden obertönig plastischen Sopran zu bieten, der sie in die höchsten Phrasen trägt.
Bilder (c) Annemone Taake
Friedeon Rosén 17.4.16
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
HÄNSEL UND GRETEL
Premiere: 24.10.2015
Die Hexe als verzerrtes Angstbild der Mutter
Zu einem enormen Erfolg für alle Beteiligten geriet am Theater der Stadt Heidelberg die Neuproduktion von Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Die Aufführung war in jeder Beziehung beeindruckend. Dass man am Heidelberger Theater aber durchweg erste Qualität geboten bekommt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das Niveau dort ist in jeder Beziehung hoch.

Ks. Carolyn Frank (Gertrud), Elisabeth Auerbach (Hänsel), Hye-Sung Na (Gretel), James Homann (Peter)
Bei diesem Werk stellt sich für jeden Regisseur die Frage, wie er es in Szene setzt: Betont er die märchenhaften Elemente oder gibt er seiner Inszenierung einen mehr geistig-intellektuellen Anstrich? In Heidelberg wählte Clara Kalus einen Mittelweg. Zusammen mit Nanette Zimmermann (Bühnenbild) und Maren Steinebel (Kostüme) schuf sie eine Produktion, die einerseits ausgesprochen psychologisch gehalten ist und Denkanstöße gibt, andererseits aber durchaus auch kindgerecht anmutet. Sowohl die Oper als auch das Märchen werden vom Regieteam ernst genommen, die daraus resultierende Gratwanderung zwischen anspruchsvollem Musiktheater und Märchenoper ist vollauf gelungen. Man kann sich an den Bildern und den Kostümen freuen, wird aber gleichzeitig auf verstandesmäßiger Ebene sehr gefordert. Hier haben wir es also mit keiner Inszenierung zu tun, bei der man sich nur bequem in den Sitz zurücklehnen und das Dargebotene in vollen Zügen genießen kann. Vielmehr ist eine sachliche Reflexion auf rationalem Terrain angesagt. Gleichzeitig wird aber auch dem Auge einiges geboten wie beispielsweise der von ausgesprochenen Köstlichkeiten bedeckte Kuchentisch der Hexe. Gerade diese treffliche Kombination ist es, die den Premierenabend in szenischer Hinsicht so ungemein interessant und spannend erscheinen ließ.

Hye-Sung Na (Gretel), Elisabeth Auerbach (Hänsel)
Frau Kalus hat sich über das Stück ausgezeichnete, stimmige und nachvollziehbare Gedanken gemacht, die sie mit einer bis ins Detail flüssigen und logischen Personenregie hochkarätig umsetzte. Ihre Regiearbeit beinhaltet die verschiedensten Aspekte, ist sowohl Märchen als auch Emanzipations- und Pubertätsgeschichte, gleichzeitig aber auch psychologische Studie. Dabei gilt ihr Interesse nicht ausschließlich dem Geschwisterpaar, sondern in hohem Maße auch der Mutter Gertrud. Diese Figur wird von ihr nach allen Regeln der Kunst hinterfragt und zur heimlichen Hauptfigur des Stückes erhoben. Hier haben wir es mit einer äußerst ambivalenten Figur zu tun mit zahlreichen charakterlichen Facetten. Sie ist nicht eigentlich böse, aber die äußere Not ihres beengten Daseins hat sie in einen seelischen Ausnahmezustand getrieben, der sie den Kindern gegenüber als hartherzig erscheinen lässt.

Hye-Sung Na (Gretel), Elisabeth Auerbach (Hänsel), Kinder- und Jugendchor
Im Besenbinder-Haus werden Hänsel und Gretel in bürgerlicher Strenge erzogen. Auf Tischmanieren und sauber gefaltete Servietten wird großer Wert gelegt. Selbstverständlich ist auch, dass man sich über die wohl nicht allzu gut schmeckende Suppe nicht beschwert. Nahrung ist immerhin Mangelware. Die Armut regiert das Leben und treibt insbesondere Gertrud zur Verzweiflung. Sie weiß sich allmählich nicht mehr zu helfen und wird aus einer Art Ohnmacht heraus ungerecht zu den Kindern, die sie an sich liebt. Ganz klar, dass die Geschwister von ihrem beschränkten Verständnishorizont aus die Verhältnisse daheim anders wahrnehmen als ihre Eltern und danach trachten, sich von diesen zu emanzipieren und endlich erwachsen zu werden. Andererseits können sie nicht ertragen, dass die Mutter traurig ist und sich ihnen verweigert. Irrigerweise schieben sie sich die Verantwortung dafür zu, was sie schlussendlich in den durch Projektionen erzeugten Wald, in das verworrene innere Dickicht ihrer ausgeprägten Schuldgefühle treibt. Dieser ist weniger realer als vielmehr symbolischer Natur und meint den Abstieg der Geschwister in das Unterbewusste. Das Verirren im Wald steht für eine Selbstfindung, die Hänsel und Gretel durchlaufen müssen, um endlich erwachsen zu werden. Ihre Entwicklung wird in der Pantomime in überzeugender Art und Weise aufgezeigt: Immer mehr Alter Egos der Geschwister in verschiedenen Altersstufen wandeln über die Bühne, erscheinen als Kinder, Teenager, junge Erwachsende, alte Leute und schließlich sogar als Engel. Die ganze Entwicklung eines Menschenlebens bis hin zum Tod wird hier aufgezeigt und der Weg der beiden kleinen Träumer vorweggenommen.

Irina Simmes (Taumännchen)
Letztlich handelt es sich hier aber um Phantasiegebilde von Hänsel und Gretel. Strenggenommen spielt sich alles aus ihrer Perspektive ab. In Anlehnung an Sigmund Freuds „Traumdeutung“ erzeugt der Wald in ihnen Angstvisionen, deren größte die Hexe ist. Diese stellt im Kontext der Inszenierung durchaus nachvollziehbar ein verzerrtes Spiegelbild der Mutter dar und ist als alptraumhafte Charakterisierung Gertruds sowie als tiefster Punkt der furchtsamen Wanderung der beiden Protagonisten in sich selbst hinein zu begreifen - ein phantastischer, psychologisch ausgesprochen fundiert anmutender Einfall von tiefem Gehalt, der der Regisseurin alle Ehre macht. Konsequenterweise hat Frau Kalus beide Partien derselben Sängerin anvertraut. Erst wenn die Hexe im Backofen verbrannt ist und die Kinder damit symbolhaft ihre Angst überwunden haben, kann sich das Verhältnis zu ihrer Mutter wieder normalisieren, die zum Schluss alle hexenhafte Elemente verloren hat und endlich fähig ist zu zeigen, dass sie ihre Kinder trotz allem doch lieb hat. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden haben Hänsel und Gretel eine nicht unerhebliche Hürde genommen und sind nun fähig, das Verhalten ihrer Eltern besser zu begreifen als zuvor. Das war alles sehr überzeugend.

Elisabeth Auerbach (Hänsel), Hye-Sung Na (Gretel)
Auf hohem Niveau bewegten sich auch die gesanglichen Leistungen. Hye-Sung Na war schon aufgrund ihrer sehr zierlichen Erscheinung rein äußerlich eine Idealbesetzung für die Gretel. Mit aufgewecktem Spiel und einem in allen Lagen gut ansprechenden, bestens fokussierten Sopran entsprach sie ihrer Rolle voll und ganz. Weniger burschikos als man es von anderen Inszenierungen her gewohnt ist, legte Elisabeth Auerbach den Hänsel an, den sie mit ausgeprägtem, emotional eingefärbtem Mezzosopran auch hervorragend sang. Ks. Carolyn Frank hat in Einklang mit der Regie die Ambivalenz der vorübergehend zur Hexe mutierenden Mutter Gertrud trefflich herausgestellt. Auch gesanglich hatte sie einen guten Tag und überzeugte mit einem insgesamt gut verankerten Mezzo-Sopran, der lediglich bei einigen Passagen der Zauberin rollenadäquat etwas härter klang. Zum szenischen Höhepunkt geriet der Hexenritt, als sie auf einer Art Lampe gänzlich ungesichert in die Lüfte entschwand. Ein stimmlich robuster, mit schöner italienischer Technik und ausdrucksstark singender Besenbinder Peter war James Homann. Als echte Luxusbesetzung für das Sand- und das Taumännchen erwies sich die wunderbar warm und gefühlvoll sowie mit ausgeprägtem lyrischem Feinschliff singende Irina Simmes. Eine ansprechende Leistung erbrachte der von Anna Töller einstudierte Kinder- und Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Ks. Carolyn Frank (Hexe), Hye-Sung Na (Gretel)
Nicht weniger beeindruckend war das, was an diesem gelungenen Abend aus dem Orchestergraben tönte. Dietger Holm dirigierte das Philharmonische Orchester Heidelberg recht intensiv und mit großer Frische, wobei er neben den mehr volksliedhaften Elementen auch den Einfluss Wagners auf die Partitur nicht verleugnete. Da ging es im Orchester manchmal schon ausgesprochen rasant und fulminant zu, sodass die Sänger/innen manchmal ein klein wenig zugedeckt wurden.
Ludwig Steinbach, 26.10.2015
Die Bilder stammen von Annemone Taake
LE NOZZE DI FIGARO
Premiere: 18.9.2015
Irrungen und Wirrungen in der Parteizentrale
Mit einem wahren Paukenschlag startete das Theater der Stadt Heidelberg in die neue Saison: Die Neuproduktion von Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“ geriet zu einem triumphalen Erfolg für alle Beteiligten. Der überaus herzliche Schlussapplaus, in den sich nur ein einziger, in keinster Weise gerechtfertigter Buhruf für die Regie mischte, war nur zu berechtigt. Hier haben wir es mit einem in jeder Beziehung einfach grandiosen, viel Freude bereitenden „Figaro“ zu tun, bei dem sich Szene, Musik und Gesang zu einem phantastischen, höchst stimmungsvollen Ganzen zusammenfügten und der als i-Tüpfelchen noch eine besondere Überraschung bereithielt. Dazu später. Aber dass man von dem schon oft bewährten Heidelberger Theater höchste Qualität erwarten kann, dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Die zahlreichen Auszeichnungen, die dem Haus in den letzten Jahren zuteil wurden, sprechen für sich. Zweifellos gehört es zu den besten Operntheatern in Deutschland, das einen Besuch immer lohnt. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass Intendant Holger Schultze und Operndirektor Heribert Germeshausen das Haus in den letzten Jahren auf ein derart exzellentes Niveau gehoben haben, das sogar größere Theater neidisch werden könnten. Und dieser exquisite „Figaro“ ist nur ein Beispiel für den hohen Standard, der in Heidelberg gepflegt wird.

James Homann (Figaro), Rinnat Moriah (Susanna)
Am Regiepult hatte zum wiederholten Male die junge Nadja Loschky Platz genommen, die in Heidelberg bereits Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ und „Cosi fan tutte“ sowie die „Carmen“ inszeniert hatte. Und erneut ist ihr eine Produktion von so großer Meisterschaft gelungen, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte, bis sie den Sprung an die ganz großen Bühnen des In- und Auslands schafft. Immerhin inszenierte sie bereits an der Zürcher Oper. In nicht allzu ferner Zukunft möchte man sie auch mal in München, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim oder Karlsruhe erleben. Sie ist eine Regisseurin, die ihr Handwerk ganz ausgezeichnet versteht. Dass sie das vorzügliche Heidelberger Ensemble schon gut kennt, mag bei ihren durch die Bank ausgesprochen präzisen, scharfen und pointierten Charakterzeichnungen sicher von großem Vorteil gewesen sein. Ganz offensichtlich hat die Chemie zwischen Regisseurin und Sängern gestimmt. Frau Loschkys ausgefeilte, stringente und auf die Persönlichkeiten der einzelnen Gesangssolisten trefflich abgestimmte Personenregie war wieder einmal vom Feinsten und trug viel zur Kurzweiligkeit des überaus gelungenen Abends bei.
 Wie man es von Nadja Loschky gewohnt ist, hat sie auch dieses Mal wieder den zeitlichen Rahmen etwas variiert und das Stück aus dem Sevilla des ausgehenden 18. Jahrhunderts in das Italien der 1960er Jahre verlegt und dem Ganzen zudem einen erfrischenden politischen Anstrich gegeben. Das von Ulrich Leitner stammende, in eichenen Braunfarben gehaltene und ästhetisch den Filmen eines Jacques Tati huldigende Bühnenbild mit verschiebbaren Wänden und einigen Pflanzentöpfen stellt eine recht nüchtern wirkende, filmartig nach vorne zoomende Parteizentrale dar. Es ist ein in sich abgeschlossener Raum, der aufgrund fehlender Sitzmöglichkeiten nicht gerade bequem anmutet. Ein Entkommen aus ihm ist nicht möglich. Dem politischen System des hier vom spanischen Grafen zum modernen italienischen Politiker mutierten Almaviva kann man sich nicht entziehen. Seine Herrschaft ist zeitlich begrenzt. Im Augenblick findet wieder ein Wahlkampf statt. An der Wand hängen überall verstreut Wahlplakate herum mit dem Bild des Conte und der Aufschrift: „Donne, votate Almaviva - Progresso“ - auf Deutsch: „Frauen, wählt Almaviva - Fortschritt“. Bezeichnend ist, dass die Adressaten dieses Anschlags nur Frauen sind, denen ja in erster Linie das Interesse des jungen, nicht unsympathisch gezeichneten Schürzenjägers gilt. Ständig lässt er seine zahlreichen, mit alten Schreibmaschinen und Aktenordnern ausgestatteten Sekretärinnen, unter ihnen auch Susanna, durch eine ebenfalls von einer Frau gesprochene Lautsprecherdurchsage in italienischer Sprache zu sich beordern, um nach einem neuen Opfer Ausschau zu halten. Das entspricht seinem Charakter voll und ganz. Aber auch das Wesen der anderen in den Bürobetrieb eingebundenen Protagonisten ist an keiner Stelle irgendwie verfälscht.
Wie man es von Nadja Loschky gewohnt ist, hat sie auch dieses Mal wieder den zeitlichen Rahmen etwas variiert und das Stück aus dem Sevilla des ausgehenden 18. Jahrhunderts in das Italien der 1960er Jahre verlegt und dem Ganzen zudem einen erfrischenden politischen Anstrich gegeben. Das von Ulrich Leitner stammende, in eichenen Braunfarben gehaltene und ästhetisch den Filmen eines Jacques Tati huldigende Bühnenbild mit verschiebbaren Wänden und einigen Pflanzentöpfen stellt eine recht nüchtern wirkende, filmartig nach vorne zoomende Parteizentrale dar. Es ist ein in sich abgeschlossener Raum, der aufgrund fehlender Sitzmöglichkeiten nicht gerade bequem anmutet. Ein Entkommen aus ihm ist nicht möglich. Dem politischen System des hier vom spanischen Grafen zum modernen italienischen Politiker mutierten Almaviva kann man sich nicht entziehen. Seine Herrschaft ist zeitlich begrenzt. Im Augenblick findet wieder ein Wahlkampf statt. An der Wand hängen überall verstreut Wahlplakate herum mit dem Bild des Conte und der Aufschrift: „Donne, votate Almaviva - Progresso“ - auf Deutsch: „Frauen, wählt Almaviva - Fortschritt“. Bezeichnend ist, dass die Adressaten dieses Anschlags nur Frauen sind, denen ja in erster Linie das Interesse des jungen, nicht unsympathisch gezeichneten Schürzenjägers gilt. Ständig lässt er seine zahlreichen, mit alten Schreibmaschinen und Aktenordnern ausgestatteten Sekretärinnen, unter ihnen auch Susanna, durch eine ebenfalls von einer Frau gesprochene Lautsprecherdurchsage in italienischer Sprache zu sich beordern, um nach einem neuen Opfer Ausschau zu halten. Das entspricht seinem Charakter voll und ganz. Aber auch das Wesen der anderen in den Bürobetrieb eingebundenen Protagonisten ist an keiner Stelle irgendwie verfälscht.

Rinnat Moriah (Susanna), Ipca Ramanovic (Conte Almaviva), Kangmin Justin Kim (Cherubino)
Der von Almaviva und der Contessa bei einer herrlich anzusehenden Tanzpantomime vermittelte schöne Schein ist strenggenommen nur eine Attrappe, eine Schauseite, die dem von der Regisseurin sehr individuell vorgeführten Chor vorgegaukelt wird. Darüber hinaus legt der Conte viel Wert auf Öffentlichkeit. Der Schuss geht aber nach hinten los. Immer wieder werden die Choristen zu Zeugen intimer Geschehnisse, die nicht für ihre Augen und Ohren bestimmt sind. Die Privatsphäre wird nicht immer gewahrt, was für die gerade
Betroffenen eine schwere Bürde darstellt. Daraus resultiert eine ganz eigene Betrachtungsweise der verschiedenen Situationen, was den Fokus einmal mehr auf das rein Menschliche legt. Komische und tragische Elemente halten sich die Waage. Das ist eben die Wirklichkeit, mit der man, so gut es eben geht, umzugehen hat. Ist hier aber wirklich alles real? Zumindest im vierten Akt, als sich immer mehr Pflanzen des Bühnenraumes bemächtigen, nimmt das Ganze einen ausgesprochen surrealistischen Charakter an. Fast hat es den Anschein, als ob dies die andere Realität ist, nach der sich die Protagonisten oft zu sehnen scheinen.

Rinnat Moriah (Susanna), James Homann (Figaro), Ks Carolyn Frank (Marcelline), Irina Simmes (Contessa Almaviva), Wilfried Staber (Bartolo) Ipca Ramanovic (Conte Almaviva)
Man merkt: Frau Loschky nimmt das Stück ernst. Trotz Modernisierung hat sie dessen Kern nicht angetastet, ja diesen vielleicht sogar noch intensiviert. An Äußerlichkeiten ist ihr wenig gelegen, sie interessiert vielmehr die innere Handlung. Und darauf legt sie alle ihre Energie. Akribisch dringt sie in die verborgensten Seelenschichten der beteiligten, von Violaine Thel fast durchweg rötlich und pinkfarben eingekleideten Personen - nur die Contessa trägt unschuldiges Weiß - vor, wobei sie ihr Hauptaugenmerk auf das Menschlich-Allzumenschliche legt, um es mal mit Friedrich Nietzsche zu sagen. Psychologisch einfühlsam spürt sie den geheimsten Wünschen und Sehnsüchten der Handlungsträger nach, nur um festzustellen, dass es sich auch bei den anscheinend edelsten doch um ausgemachte Schlawiner handelt, die gleich dem Conte auch gerne mal fremdgehen und diesem eigentlich gar nicht so unähnlich sind - einfach köstlich! In ihren Beziehungen zueinander und nach außen spiegelt sich in dieser Gesellschaft der ewige Gegensatz von Makrokosmos und Mikrokosmos wider. In der gleichen Weise, wie sie aufeinander bezogen sind, ist auch ihr Verhältnis zur Welt gestaltet. Wo der Adlatus Figaro und seine Verbündeten im großen, politischen Ambiente nichts bewirken können, versuchen sie es im kleinen, privaten Bereich. Dabei hat die Regisseurin das Wesen der Ständegesellschaft zur Entstehungszeit des Werkes, als die Französische Revolution gerade heraufdämmerte, gekonnt auf eine moderne Gesellschaft übertragen. Deutlich wird, dass die hierarchischen Strukturen damals wie heute dieselben sind, nur das äußere Gewand ist ein anderes. Das Verhältnis zwischen Herr und Domestiken ist das gleiche geblieben. Und hierin liegt das zeitlos Gültige des Stoffes, das Nadja Loschky mit dem ihr eigenen großen Scharfsinn trefflich erkannt und unter Betonung des Parabelhaften grandios umgesetzt hat. Bravo!

Auch musikalisch war der Abend in höchstem Maße bemerkenswert. Das ist Elias Grandy zu verdanken, der mit dem „Figaro“ seinen fulminanten Einstand als neuer GMD des Theaters und Orchesters der Stadt Heidelberg gab. Trotz seiner noch jungen Jahre erwies er sich bereits als ausgesprochen versierter Mozart-Dirigent, dem eine ganz große Karriere bevorsteht. Seine Auslotung der Partitur hatte Kraft, Feuer und Prägnanz. Das, was er zusammen mit dem konzentriert, intensiv und klangschön aufspielenden Philharmonischen Orchester Heidelberg da zu Gehör brachte, war so ganz anders als das, was man von anderen, auch berühmteren Dirigenten des Werkes gewohnt ist. Hört man sich den von Grandy und dem Orchester so hervorragend gezauberten Klangteppich an, drängt sich der Eindruck eines Bildes auf, das man gut zu kennen glaubt, in dem man aber auf einmal bisher unbemerkte Farben entdeckt, die einen in hohem Maße ansprechen. Den vielfältigen neuen Schattierungen und Nuancierungen, mit denen Grandy aufwartete, konnte man sich nur schwer entziehen. Sie gaben dem Werk etwas Frisches, Neues und überaus Gefälliges, um es mal mit Goethe auszudrücken.
Auch die gesanglichen Leistungen waren fast durchweg beglückender Natur. Zuerst sei hier die bereits erwähnte besondere Überraschung erwähnt, die Heribert Germeshausen dem Publikum bereitete: Er besetzte die Hosenrolle des Cherubino zum ersten Mal mit einem Mann, und zwar mit einem Countertenor. Nun ist diese im Regelfall unnatürlich klingende, weil stark auf der Fistelstimme fußende Gesangsart überhaupt nicht mein Fall. Aber was wäre die Regel ohne die Ausnahme: Kangmin Justin Kim erwies sich als wahrer Glücksfall für diese Rolle, die ansonsten eine Domäne von Mezzos und Sopranen ist. Er klingt so gar nicht wie die meisten anderen Vertreter seines Fachs, sondern wie ein echter (Mezzo-) Sopran. Der junge Sänger hat seine Stimme voll im Griff, singt volltönend und kräftig und vor allem wunderbar im Körper, was bei Countertenören eine absolute Seltenheit ist. Und auch schauspielerisch war er sehr überzeugend. Seine überaus sympathische, naive und sensitive Spielweise war einfach eine Wucht. Und viele Probleme, die sich bei einer Besetzung der Rolle mit einer Frau bei den Verkleidungsszenen für den Regisseur auftun, stellten sich hier naturgemäß gar nicht, was ein großer Gewinn für die Inszenierung war. Die Rechnung ist mithin voll aufgegangen.

Man möchte den jungen Sänger gerne einmal auch als Octavian oder Komponist hören. Phantastisch schnitt auch Irina Simmes als Contessa Almaviva ab. Spätestens mit dieser Partie ist die junge Sopranistin voll im lyrischen Fach angekommen. Sie entspricht ihrer Stimme, die seit vergangener Saison an Fülle und Sonorität zugelegt hat, voll und ganz. Herrlich, wie sie Rosinas Leiden mit beseelter, inniger und emotionaler, dabei bestens fokussierter Tongebung vermittelte. Auch darstellerisch war sie vorzüglich. Diese Contessa hatte gleichermaßen Grandezza, Witz und erotische Anziehungskraft. Ein schauspielerisch manchmal etwas ungehobelter, gesanglich mit kräftigem, markantem Bariton ansprechender Figaro war James Homann. Ein Vergnügen war es, der Susanna von Rinnat Moriah zuzusehen und -zuhören. Das war ein ausgemachter Schlingel, voll ausgelassenem Temperament und lustvollem Witz, der auch nicht davor zurückschreckte, sich einmal lediglich in Unterwäsche zu präsentieren. Gesungen hat sie mit bestens sitzendem, wandelbarem und intensivem Sopran ebenfalls perfekt. In der Partie des Schwerenöters Almaviva stand Ipca Ramanovic seinen Kollegen/innen in nichts nach. Er verfügt über einen leicht und locker dahinfliessenden, gut verankerten und profund klingenden Bariton, der im Lauf des Abends zu immer größerer Form auflief und insbesondere bei seiner großen Arie zu Beginn des dritten Aktes punkten konnte. Eine Hommage von Nadja Loschky an eine Loriot-Figur stellte der Dr. Bartolo dar, den Wilfried Staber mit voluminösem Bass imposant sang. Solide war die Marcellina von Ks. Carolyn Frank. Gut gefiel die voll und rund intonierende Mi Rae Choi als Barbarina. Mit stark maskiger Tongebung stattete Ks. Winfrid Mikus den Basilio aus. Ebenfalls flachstimmig gab Young-O Na den Don Curzio. Recht halsig klang David Ottos Antonio. Gut waren Ekaterina Streckert und Jana Krauße als die beiden Frauen anzuhören. Zum Abschluss sei erwähnt, dass die Sänger/innen hervorragend aufeinander eingespielt waren. Es wurde ein homogenes Zusammenspiel gepflegt, bei dem sich keiner in den Vordergrund drängte. Der Ensemblegedanke wurde an diesem Abend ganz groß geschrieben.
Fazit: Ein in jeder Beziehung meisterhafter, preisverdächtiger „Figrao“, der nachhaltig zu begeistern wusste und dessen Besuch dringendst empfohlen wird!
Ludwig Steinbach, 22.9.2015
Die Bilder stammen von Annemone Taake
IN MEINER NACHT
Besuchte Aufführung: 14.2.2015
(Premiere: 15.10.2014)
Tod und Liebe auf verschiedenen Ebenen
„In meiner Nacht“ ist nicht der Titel einer Oper. Vielmehr handelt es sich hierbei um das gedankliche Leitmotiv von drei Kammeropern, die vom Theater der Stadt Heidelberg in seiner zweiten Spielstätte Zwinger 1 herausgebracht wurden. Der intime Charakter dieser kleinen Bühne entspricht voll und ganz dem Wesen der drei kleinen Werke mit einer nicht sehr ausgeprägten Orchesterbesetzung und jeweils nur cirka 30 Minuten Spieldauer. Gemeinsames dramatisches Element, das die Kombination der drei Stücke an einem Abend rechtfertigt, ist der Tod. Und immer ist eine Frau am Geschehen beteiligt. Die Nacht symbolisiert in jedem Werk die Begegnung mit dem schwarzen Gesellen.

Twice through the heart – Ks Carolyn Frank (Die Frau)
Das von Pia Dederichs und Lena Schmid geschaffene Einheitsbühnenbild stellt einen von Efeu umrankten Pavillon dar, in dessen Innerem sich ein Krankenhaus- oder auch ein Totenbett befindet. In diesem Ambiente setzt Clara Kalus die drei kleinen von Mark Anthony Turnage, Christian Jost und Arnold Schönberg stammenden Opern „Twice through the heart“, „Death Knocks“ und „Erwartung“ flüssig, eindringlich und mit einer flüssigen Personenregie in Szene. Zu den Einzelheiten ihrer Regie siehe unten.

Twice through the heart – Ks Carolyn Frank
In dem 1994/96 komponierten Stück „Twice through the heart“, das auf einem realen Ereignis beruht, geht es um eine Frau, die im Gefängnis sitzt, weil sie ihren Ehemann getötet hat, der sie jahrelang misshandelte. Diesen Aspekt, der ihr bei der Gerichtsverhandlung eine Strafmilderung hätte bringen können, gab sie indes aus Scham niemals preis - eine Scham, die sie bereits dahin gehindert hatte, ihren brutalen Mann zu verlassen. Im Verlauf des Stückes begreift sie, dass diese Scham ihr eigentliches Gefängnis ist. Dieser Aspekt steht auch im Vordergrund der Inszenierung, der Clara Kraus geschickt einen psychoanalytischen Anstrich zu geben weiß. Im Rahmen einer ausgedehnten Rückschau mit Freud’schen Bezügen entlarvt sie immer mehr das Trauma dieser Frau, die ständig zwischen Pavillon und Außenbereich hin und her wechselt und damit ihren inneren Kerker trefflich veranschaulicht. Behende spielt sie mit Erinnerungsstücken an die Vergangenheit, in der es wohl auch Kinder gab. Mal vergräbt sie sie, mal gräbt sie sie wieder aus. Deutlich wird, dass sie nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Indem sie ihrer Scham nachgibt, wird sie als ursprüngliches Opfer selbst zur Täterin. Sie schafft sich ein eigenes, psychisches Gefängnis, dem sie nicht mehr entkommen kann. Dem Zwang, dem ihr Inneres sie aussetzt, hat sie nichts entgegenzusetzen. Dieser Konflikt wird von KS. Carolyn Frank mit intensivem Spiel und solidem, ausdrucksstarkem Mezzosopran trefflich vermittelt.

Death Knocks – Amelie Saadia (Der Tod)
Dazu hat Mark-Anthony Turnage eine imposante, kontrastreiche Musik geschrieben. Sehr markanten, eruptiven Klängen, die die Verzweiflung der Frau versinnbildlichen, korrespondieren recht filigrane, weiche und ruhige Töne als Ausdruck manchmal doch in ihr aufsteigender innerer Ruhe. Alles dies wird von Timothy Schwarz und dem gut gelaunten Philharmonischem Orchester Heidelberg auf einer kammermusikalischen Grundlage differenziert und einfühlsam zu Gehör gebracht.
Das Zwei-Personen-Stück „Death Knocks“ aus dem Jahr 2001 basiert auf einem Schauspiel von Woody Allen. Es geht um den erfolgreichen Geschäftsmann Nat Ackermann - der Name spielt auf die Herkunft des Stoffes von dem um 1400 entstandenen „Der Ackermann aus Böhmen“ von Johannes von Tepl an -, der Besuch vom Tod in Gestalt einer sexy Frau erhält, die ihn gleich ins Jenseits mitnehmen will. Er hält sich aber für kerngesund und ist überhaupt nicht willens, dem Ansinnen der hübschen jungen Dame zu folgen. Ackermann bringt sie dazu, mit ihm Gin Rommé um seinen Sterbetag zu spielen. Er schlägt sie haushoch und wirft sie aus seiner Wohnung. Er darf weiter leben und sie muss sich zähneknirschend geschlagen geben. Gekonnt wird hier die westliche Industrie- und Geschäftswelt auf die Schippe genommen und nachhaltig aufgezeigt, dass die ganze Welt käuflich ist und der Mensch in seinem Streben sogar dem Tod ein Schnippchen schlagen kann, wenn er es nur geschickt genug anstellt. Mit Geld, List und Tücke ist eben alles zu erreichen. Nicht der Tod an sich wird hier thematisiert, sondern die Einstellung der Geschäftswelt zu ihm. Er wird zu einem Wirtschaftsfaktor, dem man durch kluges Handeln den Schrecken nehmen kann. Die stückimmanente schöne Illusion wird von Frau Kalus um eine hoch erotische Komponente erweitert. Die gleich Ackermann mit einer Geschäftsbrille ausgestattete Todesfrau - ist sie ein Teil seiner selbst? - trägt unter ihrem eleganten Outfit keine Unterwäsche. Ihre transparente baige Bluse lässt ihre nackten Brüste durchschimmern. Einfach köstlich, wie ihr potentielles Opfer sie nachhaltig manipuliert, sie sogar ins Bett bekommt und schließlich mitsamt dem Totenbett aus dem Pavillon befördert. Dieser höchst vergnügliche Geschlechterkampf wird von der Regisseurin munter und kurzweilig und mit einem gehörigen Schuss doppelbödiger Ironie in Szene gesetzt.

Death Knocks – Amélie Saadia (Der Tod), Zachary Wilson (Nat Ackermann)
Leicht und locker ist auch die Musik von Christian Jost, dessen vor einiger Zeit in Heidelberg herausgekommene Oper „Rumor“ man noch in guter Erinnerung hat. Es sind variable, mal oberflächliche, mal tiefgründige Klänge, mit denen der Komponist die Businneswelt gehörig karikiert und konterkariert und die von Herrn Schwarz und den Musikern temporeich und spritzig vor den Ohren des Publikums ausgebreitet werden. Auch mit den beiden Sängern kann man zufrieden sein. Eine hervorragende schauspielerische Ader und einen gut sitzenden Sopran bringt Amélie Saadia für den Tod mit. Zachary Wilson gibt ihr darstellerisch trefflich Kontra. Auch gesanglich überzeugt der junge Sänger mit solide fokussiertem, frischem Bariton.

Erwartung – Hye-Sung Na (Die Frau)
Am bekanntesten dürfte die dritte der an diesem gelungenen Abend zur Aufführung gekommenen Opern sein: Die aus dem Jahre 1909 stammende „Erwartung“ von Arnold Schönberg, die in Faradsch Karaews 2004 entstandener reduzierter Fassung für 20 Musiker erklang. Die Musik ist hier noch weniger der Dodekaphonie verpflichtet, weist aber bereits ausgesprochen atonale Züge auf, die Dirigent und Orchester hervorragend herausstellen. Insgesamt warteten sie mit einem regen Wechsel von dramatischen und sehr emotionalen Tönen auf.
 Geschildert wird das Seelenleben einer Frau, die wie ein gehetztes Tier im Wald umherirrt und ihren Geliebten sucht. Gleichermaßen sehnsüchtig und eifersüchtig schwelgt sie in Erinnerungen an ihn und findet schließlich seine Leiche. Clara Kalus legt den Focus ihrer Deutung gekonnt auf die innere Handlung. Sie erzeugt ein alptraumhaftes, von Hysterie und Depression dominiertes Seelengemälde, für das Sigmund Freuds „Traumdeutung“ Pate gestanden haben könnte. Einen toten Mann gibt es in dieser Inszenierung nicht. Die Suche der Frau nach ihm ist in Wahrheit eine Reise in sich selbst, die Suche nach dem eigenen Ich, bei der viele Fragen offen bleiben. Hye-Sung Na singt die getriebene Sucherin mit einem in jeder Lage bestens durchgebildeten lyrischen Sopran und äußerster Intensität und Expressivität.
Geschildert wird das Seelenleben einer Frau, die wie ein gehetztes Tier im Wald umherirrt und ihren Geliebten sucht. Gleichermaßen sehnsüchtig und eifersüchtig schwelgt sie in Erinnerungen an ihn und findet schließlich seine Leiche. Clara Kalus legt den Focus ihrer Deutung gekonnt auf die innere Handlung. Sie erzeugt ein alptraumhaftes, von Hysterie und Depression dominiertes Seelengemälde, für das Sigmund Freuds „Traumdeutung“ Pate gestanden haben könnte. Einen toten Mann gibt es in dieser Inszenierung nicht. Die Suche der Frau nach ihm ist in Wahrheit eine Reise in sich selbst, die Suche nach dem eigenen Ich, bei der viele Fragen offen bleiben. Hye-Sung Na singt die getriebene Sucherin mit einem in jeder Lage bestens durchgebildeten lyrischen Sopran und äußerster Intensität und Expressivität.
Fazit: Einmal mehr ein in jeder Hinsicht gelungener Abend am Theater Heidelberg, dessen Besuch zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 19.2.2015
Die Bilder stammen von Annemone Taake
ABENDS AM FLUSS/HOCHWASSER
Besuchte Aufführung: 13.2.2015 (Premiere: 6.2.2015)
Politisches Bilderpanorama oder zwei Koffer im Absurden Theater

Ursprünglich sollten Johannes Harneits als Doppelabend konzipierte neue Opern „Abends am Fluss“ und „Hochwasser“ in der Spielzeit 2012/13 an der Leipziger Oper aus der Taufe gehoben werden. Aus Enttäuschung über die seinerzeitige Kulturpolitik in Leipzig schied Peter Konwitschny, der als damaliger Chefregisseur des Hauses die beiden Werke bei dem westdeutschen Komponisten Harneit und seinem aus Ostdeutschland stammenden Textdichter Gero Troike in Auftrag gegeben hatte, vorzeitig aus seinem Engagement, was auch das Aus für die geplante Uraufführung bedeutete. Es ist dem versierten Heidelberger Intendanten Holger Schultze und seinem ausgezeichneten Operndirektor Heribert Germeshausen sehr zu danken, dass sie Konwitschny die Möglichkeit gaben, diese nun am Theater der Stadt Heidelberg nachzuholen und dort gleichzeitig auch zum ersten Mal am Regiepult Platz zu nehmen, was angesichts des hohen internationalen Renommées des Regiealtmeisters Kontwitschny, der an den größten Bühnen des In- und Auslands zu Hause ist, ein hochrangiges Ereignis darstellt und den Ruhm des Theaters noch weiter fördern dürfte. Der große Erfolg gab allen Beteiligten recht: An diesem denkwürdigen Abend war alles wie aus einem Guss; Szene, Musik und Gesang fügten sich nahtlos zu einer sehr stimmigen, imposanten Einheit auf hochkarätigem Niveau zusammen. Das Ganze geriet zu einem spektakulären Triumph für das Heidelberger Theater, dessen Leitung für moderne Oper ein ausgezeichnetes Händchen hat und dessen herausragende Aufführungen so manches andere, auch größere Opernhaus vor Neid erblassen lassen könnten. Der Musiktheatersparte des Hauses kann man zu der vor kurzem erfolgten Auszeichnung mit dem von der Stiftung des Verbandes Deutscher Bühnen- und Medienverlage gestifteten Preis der Deutschen Theaterverlage nur herzlich beglückwünschen. Angesichts der enormen künstlerischen Leistungen des lediglich mittelgroßen Theaters der Stadt Heidelberg, erscheint diese hohe Ehrung nur zu berechtigt.
 Die beiden Opern sind sehr unterschiedlicher Natur. Die Legitimation für ihre Kombination stellt das in beiden Stücken vorkommende, indes unterschiedlich zu bewertende Element des Wassers dar. Symbolhafte Bedeutung kommt ihm in „Abends am Fluss“ zu. Hier versinnbildlicht es das Fließen der Zeit. Der Fluss ist laut Programmheft als Metapher für eine gefährdete, benutzte, aber nie ganz zähmbare Naturgewalt zu verstehen. Diese Oper folgt keiner herkömmlichen Dramaturgie, das narrative Element ist gänzlich ausgeblendet. Hier wird keine lineare Handlung erzählt, sondern mit einem breit gefächerten Bilderpanorama aufgewartet, in dem altbekannte Archetypen wie der schuldbeladene Greis, der soeben erst den Wunderkind-Schuhen entwachsene junge Mann, die tote Frau, der Harneit in psychologisch einfühlsamer Weise einen Schatten und eine innere Stimme zuordnet, und ein schlafender, etwas dämonisch wirkender Hund nacheinander aus dem Strom der Zeit an die Oberfläche streben. Namhafte Gestalten der deutschen Historie laden das zahlreich erschienene Publikum zu einer kontemplativen Betrachtung von deutscher Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert seit 1914 ein. In „Hochwasser“ ist das Geschehen realer. Zwei in einem Keller abgestellte Koffer, ein schwerer und ein leichter, warten in der Hoffnung, von ihm auf eine Reise mitgenommen zu werden, auf das drohende, sehr reale Hochwasser. Nur einmal werden sie von einer schönen Frau gestört, die in das Souterrain kommt und sich ein Festtagskleid aus dem schweren Koffer holt. Während letzterer am Ende durch die Flut aufgelöst wird, bedeutet sie für den leichten Koffer den Aufbruch in ein neues Leben.
Die beiden Opern sind sehr unterschiedlicher Natur. Die Legitimation für ihre Kombination stellt das in beiden Stücken vorkommende, indes unterschiedlich zu bewertende Element des Wassers dar. Symbolhafte Bedeutung kommt ihm in „Abends am Fluss“ zu. Hier versinnbildlicht es das Fließen der Zeit. Der Fluss ist laut Programmheft als Metapher für eine gefährdete, benutzte, aber nie ganz zähmbare Naturgewalt zu verstehen. Diese Oper folgt keiner herkömmlichen Dramaturgie, das narrative Element ist gänzlich ausgeblendet. Hier wird keine lineare Handlung erzählt, sondern mit einem breit gefächerten Bilderpanorama aufgewartet, in dem altbekannte Archetypen wie der schuldbeladene Greis, der soeben erst den Wunderkind-Schuhen entwachsene junge Mann, die tote Frau, der Harneit in psychologisch einfühlsamer Weise einen Schatten und eine innere Stimme zuordnet, und ein schlafender, etwas dämonisch wirkender Hund nacheinander aus dem Strom der Zeit an die Oberfläche streben. Namhafte Gestalten der deutschen Historie laden das zahlreich erschienene Publikum zu einer kontemplativen Betrachtung von deutscher Geschichte durch ein ganzes Jahrhundert seit 1914 ein. In „Hochwasser“ ist das Geschehen realer. Zwei in einem Keller abgestellte Koffer, ein schwerer und ein leichter, warten in der Hoffnung, von ihm auf eine Reise mitgenommen zu werden, auf das drohende, sehr reale Hochwasser. Nur einmal werden sie von einer schönen Frau gestört, die in das Souterrain kommt und sich ein Festtagskleid aus dem schweren Koffer holt. Während letzterer am Ende durch die Flut aufgelöst wird, bedeutet sie für den leichten Koffer den Aufbruch in ein neues Leben.

Wieder einmal eine Glanzleistung ist Peter Konwitschny zu bescheinigen. „Abends am Fluss“, das er im neuen Marguerre-Saal in Szene setzt, gerät zu hochpolitischem Musiktheater. Das stark assoziative, dem Zuschauer viel Raum für eigene Betrachtungen einräumende Geschichtspanorama, das er und sein Bühnen- und Kostümbildner Helmut Brade so hochkarätig vor den Augen des Auditoriums ausbreiten, ist ein hinreißendes, atemberaubendes, handwerklich brillant gearbeitetes Konglomerat von kurzweiligen, ernsten und heiteren, erzählenden und belehrenden Elementen von enormem geistig-innovativem Gehalt. Es ist ein sehr vielschichtiger Streifzug durch die Historie der Deutschen, den Konwitschny hier unter Einbeziehung des Zuschauerraumes - Brecht lässt grüßen - unternimmt, um das Publikum mit eindringlichen Bildern - der aus dem Strom aufsteigende Soldatenfriedhof ist nur eines davon - zu Reflexionen über die deutsche Geschichte, ihre Vergangenheit und Gegenwart sowie über die latent im Raum stehende Schuldfrage anzuregen. Es geht um den Konflikt zwischen Ost und West, um den Mauerbau und die Wiedervereinigung. Insbesondere der heimlichen Hauptfigur des Greises, die einmal modernen Soldatenlook trägt, ein anderes Mal aber in einer Uniform des Kaiserreichs auftritt und am Ende im Rollstuhl landet, kommt hier als verlässlichem Zeitzeugen mehrerer Ären große Bedeutung zu. Mit seinen Augen sehen wir nicht nur den vom Chor gebildeten Fluss, dessen Wogen durch ständiges Auf- und Niederfahren von Podien versinnbildlicht werden, sondern auch das DDR-Kaufhaus „Paradies“ und eine den 1960ern entlehnte bürgerliche Küche.
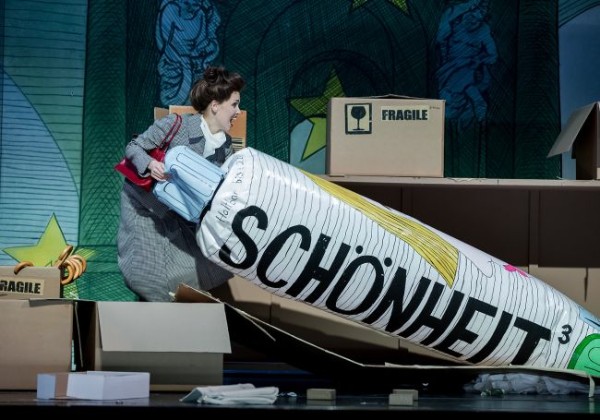
Zentrale Relevanz misst Konwitschny zudem Rosa Luxemburgs auf Ferdinand Freiligrath zurückgehendes Postulat „Ich war, ich bin, ich werde sein“ zu, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Inszenierung zieht. In Gestalt der toten Frau lässt der Regisseur die am 15. 1. 1919 erschossene marxistische Vertretern der Arbeitsgesellschaft wieder auferstehen und identifiziert den Fluss damit einwandfrei als den Landwehrkanal. Gekonnt denkt er ihr - wäre sie am Leben geblieben - weiteres Schicksal fort und identifiziert sie zu guter Letzt noch mit Ulrike Meinhof. Zusammen mit dem in die Maske von Andreas Bader schlüpfenden jungen Mann lässt er sie vom Zuschauerraum aus mit Maschinengewehren einen Terroranschlag auf das Bühnenpersonal verüben, stellt aber auch die Möglichkeit in den Raum, dass das verbrecherische Pärchen für seine Taten aufgehängt wird. Welche Option er befürwortet, bleibt dem Zuschauer überlassen. Eine ironische Umkehrung der herkömmlichen Geschlechterrollen nimmt Konwitschny vor, wenn er gegen Ende die Frau Steine für den Hausbau aufschichten und gleichzeitig den jungen Mann am Bügelbrett typischer Hausfrauenarbeit nachgehen lässt. Bereits zuvor wurde offenkundig, dass ein Schwerpunkt der Regie auf der Schilderung der Situation in der ehemaligen DDR und der Wiedervereinigung liegt. Die Mentalität der ganz nach dem Motto „Ich kaufe, also bin ich“ lebenden Konsumgesellschaft wird von Konwitschny gekonnt auf die Schippe genommen und zusätzlich mit einer kapitalistischen Persiflage auf die Schöpfungsgeschichte unter einer hoch aufragenden DDR-Fahne und einem riesigen Ein-Euro-Schein garniert. Die fragwürdigen politischen Verhältnisse gleichen einem Käfig, in den nicht nur der alte und der junge Mann eingesperrt sind und darauf warten, dass Sigmund Freud sie aus ihrem seelischen Dilemma befreit. Das ganze Volk ist in Wirklichkeit gefangen, und zwar in unterschiedlichen Ideologien, Gewalt und sexuellen Exzessen. Bewacht wird es von zwei Wächtern mit Namen Links (DDR) und Rechts (Westdeutschland), die in am linken und rechten Bühnenrand platzierten Schildwachhäuschen ihrer Arbeit nachgehen. Sie fungieren als Spitzel ihres Überwachungsstaates und tippen alle Vorkommnisse gewissenhaft in ihren Laptop ein. Wenn am Ende das ganze Volk in solchen kleinen Häusern eingezwängt ist, erweist sich, dass das gesamte Staatssystem auf gegenseitiger Bespitzelung beruht. Big Brother is watching you. Aber ist das mit dem Ende der DDR viel anders geworden? Konwitschny hat Zweifel. Mit gnadenloser Schärfe setzt er auch an unser System das politisch-gesellschaftliche Seziermesser an und erzeugt ein ernüchterndes Abbild der Gegenwart, das einerseits irritiert, andererseits aber durchaus zutreffend ist.

Nicht minder überzeugend geriet seine Interpretation des „Hochwassers“, zu dem man in den Alten Saal des Heidelberger Theaters wechselte, dessen intimer Charakter der kammermusikalischen Prägung der Oper - dazu später - bestens entspricht. Die Besucher sitzen auf zwei entgegengesetzten Seiten des Raumes, unter ihnen jeweils ganz hinten in der Mitte die Sänger der beiden Koffer, jeder auf seiner Seite. In der Mitte befinden sich das Orchester und die schmale Bühne, auf der der leichte Koffer auf dem schweren liegt. In diesem Ambiente rückt Konwitschny den Dialog der beiden Koffer, deren Darsteller ihren Platz irgendwann einmal verlassen und sich auf der Bühne treffen, auf eine abgehobene, dem Absurden Theater verpflichtete Metaebene, für die Beckett Pate gestanden haben dürfte. Die Höhepunkte des „Hochwassers“ bildeten das Erscheinen der schönen Frau in Gestalt der Bratschistin Marianne Venzago, die sich ein elegantes Kleid aus dem schweren Koffer holt, und das schlussendliche Eindringen des Wassers in Gestalt des blau eingekleideten und mit Spitzhüten versehenen Chors in den Raum - ein recht amüsanter Moment, derer es in dieser Produktion einige gab. Klar ersichtlich wurde, dass hier allgemeine Fragen humaner Existenz abgehandelt werden. Und wenn sich gegen Schluss auf einmal die Hintergrundwand öffnet und den Blick auf die Marguerre-Bühne freigibt, offenbart sich, dass bei allem Gegenwartsbezug des Gezeigten alles doch nur Theater ist - allerdings auf höchstem Niveau.
Die Hauptrolle spielte an diesem überaus gelungenen Abend aber die Musik von Johannes Harneit, der auch selbst am Pult des trefflich disponierten Philharmonischen Orchester Heidelberg stand und mit einem sehr aufwühlenden, spannungsgeladenen Dirigat beglückte. Seine Klangsprache ist gleichermaßen packend und energisch, erstaunlich und irritierend, fesselnd und stark unter die Haut gehend. Er hat in erster Linie der Moderne verpflichtete Partituren geschrieben, die indes auch einige „normale“ Töne enthalten. Was insbesondere ungewöhnlich erschien, war die hohe Anzahl an Halbtonbrechungen. Bereits in „Abends am Fluss“ mussten die Sänger/innen immer punktgenau die Mitte zwischen zwei Halbtönen treffen, was ihnen indes trefflich gelungen ist und wofür sie sehr zu loben sind. Dasselbe Verfahren wendete Harneit in „Hochwasser“ an, verlegte es dort aber in das Orchester. Von zwei Klavieren musste das eine ständig um einen viertel Ton tiefer als das andere spielen. Aus dieser zunächst gewöhnungsbedürftigen Vorgehensweise gewinnt Harneits Musik indes einen Großteil ihrer Kraft. Durch die Verteilung des Orchesters in „Abends am Fluss“ auf den Graben und den Rang - hier bewährte sich als Co-Dirigent Dietger Holm - entsteht ein ganz eigener Klangkosmos, in dessen Zentrum der Zuschauer sitzt und von der von vorne und hinten, gleichsam im schönsten Stereoton, auf ihn einströmenden Macht und Intensität der Töne bis aufs Mark getroffen wird. Dadurch kommt es zu einer enormen Intensivierung der motivischen Detailarbeit und der Transparenz des Klangs. Harneits Musik lädt dazu ein, nein, sie fordert, sich ihr voll und ganz hinzugeben und sie in ihrer ganzen Vielschichtigkeit begierig in sich aufzusaugen. Das gilt auch für die Musik im „Hochwasser“, die - wie bereits erwähnt - aufgrund der reduzierten Orchesterbesetzung einen kammermusikalischen Anstrich aufweist, dennoch aber sehr ausdrucksvoll erscheint.

Harneit arbeitet mit klanglichen Kommentaren, wobei er sich auf einem übergeordneten Terrain bewegt, das durch mannigfaltig sich reibende Töne und vielfach übereinander gelagerte Stimmungen ausgedrückt wird, gleichzeitig aber auch eine Anzahl normaler Dreiklänge und chromatischer Linien als Verbindung zur traditionellen Klangsprache einbringt. Konsequenterweise wirkt die Musik auch an keiner Stelle willkürlich, sondern wahrt stets den Charakter einer logisch-notwendigen Weiterentwicklung des Phänomens Oper, das sich von Ära zu Ära immer wieder neu definieren und seinen Platz im Geschehen des Musiktheaters finden muss. Bei aller Modernität seiner Tonsprache erweist Harneit aber auch dem klassischen Repertoire seine aufrichtige Reverenz. Dass er sich einerseits vor ihm verneigt, es andererseits aber auch mit den Spezifikationen zeitgenössischer Kompositionskunst gekonnt weiterentwickelt, ist ein guter Kompromiss. Damit verankert er die Fundamente seines außergewöhnlich interessanten Kompositionsstils fest im Geburtskanal neuer Hörgewohnheiten, was der Rezeption moderner Opern allgemein eine neue, aufgeschlossene und zukunftsorientierte Ausrichtung gibt und dem Auditorium die Möglichkeit zur musikalischen Identitätsfindung eröffnet. Allein darin kann die Funktion von Uraufführungen bestehen, die die Opernhäuser durch zeitgemäß aktuelle und politische Inszenierungen zu unterstützen haben. Hier spielt auch der allgemeine kulturpolitische Auftrag der Theater mit herein, ein Spiegel der Gegenwart zu sein. Nur so kann Oper überleben, ein lediglich museales Verständnis würde ihr Ende bedeuten. „Kinder, schafft Neues“, sagte schon Wagner. Dieser Notwendigkeit ist sich Harneit voll bewusst.

Insgesamt auf hervorragendem Niveau bewegten sich auch die gesanglichen Leistungen. In „Abends am Fluss“ war Ks. Thomas Möwes ein sowohl darstellerisch als auch stimmlich sehr intensiver Greis, der jede Facette seiner Rolle voll auslebte. Einen bestens fokussierten, in der Mittellage substanz- und farbenreichen sowie in der Höhe sicher und prägnant ansprechenden Sopran brachte Irina Simmes für die Frau mit. In nichts nach stand ihr Angus Wood, der mit ausgeprägtem, kraftvollem und ausdrucksstarkem italienischen Heldentenor als Mann sehr beeindruckte. Mit ebenfalls vorbildlich verankertem, volltönendem Sopran wertete Hye-Sung Na die kleine Rolle des Schattens auf. Solide war Carolyn Franks innere Stimme. Von den zwei Spitzeln gefielt der über prachtvolles Bass-Material verfügende Nico Wouterse besser als der nur dünn singende Ks. Winfrid Mikus. Zu hoch gestützt und recht maskig klang Namwon Huhs Hund, den er indes ausgezeichnet spielte. In „Hochwasser“ harmonierten der profunde tiefe Bass von Wilfried Staber (Schwerer Koffer) und der leicht und elegant geführte, ein phantastisches appoggiare la voce aufweisende lyrische Bariton von Ipca Ramanovic (Leichter Koffer) aufs Beste miteinander. Ein Sonderlob gebührt dem von Anna Töller einstudierten Chor.
Fazit: Ein in jeder Beziehung preisverdächtiger Abend der Extraklasse, dessen Besuch dringendst empfohlen wird!
Ludwig Steinbach, 16.2.2015
Die Bilder stammen von Annemone Taake
Grandiose Alternativbesetzung
LA TRAVIATA
Besuchte Aufführung: 19.12.2014 (Premiere: 12.10.2014)
Besser als die Premiere!
Zum erneuten Besuch der Neuproduktion von Verdis „La Traviata“ am Theater der Stadt Heidelberg lockten zahlreiche neue Sänger/innen in Haupt- und Nebenrollen. Im Folgenden wird bzgl. der hervorragenden Inszenierung von Eva-Maria Höckmayr im Bühnenbild und den Kostümen von Julia Röster auf den Premierenbericht von vergangenem Oktober (weiter untn auf dieser Seite) verwiesen und hier lediglich auf die musikalische und vokale Seite des wieder einmal sehr gelungenen Abends eingegangen.

Irina Simmes (Violetta)
Besser noch als die Sänger/innen der Premiere schnitt die bei dieser Aufführung aufgebotene Alternativbesetzung ab. Endlich war es einem vergönnt, Irina Simmes, die am 12. Oktober leider erkrankt war, in der Partie der Violetta zu erleben. Und wieder einmal vermochte die junge Sopranistin, die zu den ersten Kräften des Heidelberger Theaters gehört, voll zu überzeugen. Sie stürzte sich mit enormer darstellerischer und vokaler Intensität in die Rolle, in der sie in jeder Beziehung aufging. Schon ihr packendes, gefühlsbetontes Spiel war sehr ansprechend. Aber auch in stimmlicher Hinsicht blieben keine Wünsche offen. Frau Simmes verfügt über einen kräftigen, bestens fokussierten Sopran, der gleichermaßen über lyrische Eleganz und Koloraturgewandtheit wie auch über dramatisch-intensives Ausdruckspotential verfügt. Die in dieser Partie vereinigten drei Fächer gingen in ihrem emotionalen und beseelten Vortrag eine perfekte Verbindung ein. Es spricht für den ausgezeichneten Ruf, den das Theater der Stadt Heidelberg allgemein genießt, dass sich sogar Sänger der Wiener Staatsoper nicht zu schade sind, in seinen Aufführungen aufzutreten. Das war jedenfalls bei Carlos Osuna der Fall, der an diesem Abend für Jesus Garcia als Alfredo eingesprungen war und in jeder Hinsicht für sich einzunehmen wusste. Er hatte sich Frau Höckmayrs Regiekonzept, das die Handlung aus der Perspektive von Dumas-Alfredo erzählt, trefflich zu eigen gemacht und schon darstellerisch perfekt umgesetzt. Aber auch gesanglich überzeugte er mit einer schönen, tiefen Verankerung seines klangvollen Tenors, eleganter Linienführung und imposanter Höhe. Neben Osuna, dem eine ausgezeichnete Bühnenpräsenz eigen ist, wirkte der noch junge, schlanke und gut aussehende Ipca Ramanovics als Germont äußerlich weniger wie der Vater als vielmehr wie ein jüngerer Bruder Alfredos. Die große darstellerische Autorität, mit der bei der Premiere James Homann aufgewartet hatte, ging ihm etwas ab. Gesungen hat er indes ganz phantastisch. Mit seinem wunderbar sonoren, obertonreichen und ein vorbildliches appoggiare la voce aufweisenden weichen und nuancenreichen Bariton zog er alle Facetten seiner dankbaren Rolle, für die er rein vokal ein ausgezeichneter Vertreter ist. Einen satten Mezzosopran brachte Jana Krauße für die Flora Bervoix mit. Gut gefiel auch die Annina von Sylvia Rena Ziegler. Stimmlich imposant präsentierten sich Zachary Wilson (Baron Douphol) und Michael Zahn (Marquis d’ Obigny). Relativ dünn sang Young-O Na den Gaston. Nicht gerade klangschön und halsig legte David Otto den Dr. Grenvil an. Dem von Anna Töller einstudierten Chor und Extrachor ist für seine prächtige Leistung ein großes Lob auszusprechen.

Irina Simmes (Violetta), Alfredo
Wie bereits bei der Premiere setzten Lahav Shani am Pult und das grandios aufspielende Philharmonische Orchester Heidelberg auch dieses Mal wieder auf eine differenzierte, farbenreiche Auslotung von Verdis Partitur mit herrlicher Italianita, weit gesponnenen Bögen und breiter dynamischer Skala. Die Qualität der musikalischen Leistungen hat sich seit der Premiere sogar noch gesteigert.
Ludwig Steinbach, 19.12.2014 Die Bilder stammen von Annemone Taake
Ausgrabung mit Sinn und Humor modernisiert
Niccolò Jommelli (1714-1774)
FETONTE
Oper im Schwetzinger Rokoko zum "Winter in Schwetzingen"
Die Besprechung der Premiere vom 28.11.2014 befindet sich auf unserer Seite Schwetzingen
Wieder ein Preis!
Theater und Orchester Heidelberg
Der Preis der deutschen Theaterverlage 2014 geht für die Sparte Musiktheater an Theater und Orchester Heidelberg.
Die Stiftung des Verbandes Deutscher Bühnen- und Medienverlage vergibt im Jahresrhythmus wechselnd für den interessantesten und innovativsten Spielplan der jeweiligen Saison einen Preis. 2014 wird die Arbeit des Heidelberger Theaters, Intendanz von Holger Schultze mit diesem Preis gewürdigt. Bereits in der Kritikerumfrage 2013 der Fachzeitschrift „deutsche bühne“ wurde das Theater als bestes Theater, neben Freiburg, ‚abseits der Zentren‘ ausgezeichnet.
 Holger Schultze (Foto: Florian Merdes)
Holger Schultze (Foto: Florian Merdes)
Der Opernfreund gratuliert dem Theater, dem Intendanten Holger Schultze und Operndirektor Heribert Germeshausen pars pro toto zu der neuerlichen Auszeichnung und sieht sich in der seit langem vertretenen Auffassung bestätigt, dass der Weg aus der Stagnation im Musiktheater nur über ein attraktives, abwechslungsreiches Programm erfolgen kann, in welchem nicht allein die breiten ausgetretenen Wege der Repertoire-„Renner“ abgelatscht werden. Wegen ihrer Flexibilität. eignen sich die Theater „abseits der Zentren“ , solange sie ein eigenes Sängerensemble haben, trotz bescheidener Budgets für eine derartige Programm-Politik natürlich am besten, vor allem wenn es ihnen gelingt, das Potential des Publikums für Neues zu wecken. Dieses Potential ist nicht an allen Standorten in gleicher Weise wie in Heidelberg vorhanden, wo auch die Sitution mit dem neuen Theater zusätzliche Euphorie erzeugt hat.
Auch das Publikum in Heidelberg ist preiswürdig, denn auf dessen Mitgehen beruht letztlich der Erfolg des Hauses. Mit 211.000 Zuschauern und Auslastungszahlen – je nach Sparte – zwischen 90 und 99% war die Saison 2013$2014 die erfolgreichste seit Jahrzehnten; der Zuspruch hat sich dieses Jahr fortgesetzt. Die wiederaufgenommene Produktion von Echnaton und die Neuproduktion von La Traviata sind Monate im Voraus ausverkauft.
Die nächsten Premieren in Heidelberg
ABENDS AM FLUSS / HOCHWASSER
Zwei Opern von Johannes Harneit Fr 6.02.2015, 19.30 Uhr
Regie: Peter Konwitschny; Musikalische Leitung: Johannes Harneit / Dietger Holm
CABARET
Musical von John Kander So 12.04.2015, 19.00 Uhr
Regie: Andrea Schwalbach; Musikalische Leitung: Dietger Holm
Fioronis neue Regie-Schandtat
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Premiere 04.11.2012
Mélisande als Schwanenprinzessin; Pelléas als schwarzer Ritter - zum Schluss geht alles in Flammen auf
Debussys einzige Oper wurde 1902 in Paris an der Opéra Comique (!) uraufgeführt. Etwa 40 Jahre nach Wagners Tristan bedeutete dieses Werk einen neuen Markstein in der Operngeschichte; in Frankreich läutete es das Ende der romantischen Epoche ein; dabei beruht es paradoxaler Weise ebenso auf dem Einfluss des Übervaters Wagner wie auf dem Versuch, dessen langem Schatten zu entkommen. Es ist die erste im Repertoire gebliebene französische Oper nach der klassischen Zeit, mit der Rousseaus Behauptung, die französische Sprache sei nicht operntauglich, widerlegt wurde: Denn hier ist die Sprache Musik und die Musik Sprache. Was Wunder, dass der Komponist für seine Musik selber das Libretto aus der Vorlage sublimiert hat, aus dem gleichnamigen Märchenstück des belgischen Symbolisten und Nobelpreisträgers Maurice Maeterlinck über die totgeweihte Liebe der Titelfiguren (1893). Es ist ein rätselhaftes, feinsinniges Stück des belgischen Dichters, für das Debussy die kongeniale Musik gefunden hat. Und weil es so nahe an der literarischen Vorlage bleibt, steht es heute viel häufiger auf den Spielplänen der Oper als auf denen des Schauspiels. Wie übrigens auch andere Stücke der Epoche (Salome, Elektra), deren literarischer Wert unter der Veroperung nicht gelitten hat. Somit kommt es bei einer Inszenierung der Oper gleichermaßen auf die Würdigung der literarischen Vorlage an.
Wenn man in eine Inszenierung des notorischen Stückezertrümmerers Lorenzo Fioroni geht, erwartet man keinen Brunnen und keinen Wald, wo der Jäger Golaud auf die verlassene Mélisande trifft. Man erwartet kein düsteres Schloss, in welchem Mélisande ihrem Gefühl Ausdruck verleiht: „Je ne suis pas heureuse“. Man lässt sich also überraschen. Überrascht wird man dann mit einer neuen Schandtat des Regisseurs, der sich überhaupt um die Vorlage Materlinck/Debussy schert, sondern dem Stück Ideen überstülpt, die ihm wohl zuvor irgendwelche Träume eingegeben haben. Er beachtet wohl die musikalische Struktur der Oper, kehrt in weniger wichtigen Details sogar manchmal quasi parodistisch erstaunlich nahe zum Text zurück, gegen den er allerdings vom ersten Moment an frontal losinszeniert.

Annika Sophie Ritlewski (Mélisande), Angus Wood (Pelléas)
Ralf Käselaus erfindungsreiches Einheitsbühnenbild (mit verschiedenen Räumen, Vorhängen und Spiegeln sehr mehrfachgegliedert) führt den Zuschauer in ein nicht mehr ganz frisches Ballett-Atelier, wohl eine Ballettschule, wo für Schwanensee (Le Lac des Cygnes) geprobt wird. Die verzauberte Schwanenprinzessin ist Mélisande, die Golaud nicht im Wald an einem Brunnen, sondern als Eindringling in schwarzem Wintermantel (Kostüme: Annette Braun) im Studio entdeckt. So braucht er sie gar nicht mit heim zu nehmen. Er zieht sie gleich um und hüllt sie in weißen Tüll. Von nun an kann sie nur durch wahre Liebe aus dem Bann des bösen Zauberers befreit werden. Diese Liebe entwickelt sich zwischen ihr und Golauds Halbbruder Pelléas, der nicht bei der Balletttruppe mitwirkt. Was Golaud anscheinend nicht wirklich interessiert (ist der vielleicht schwul?), geschieht seinem Bruder: er verliebt sich in Mélisande und geht ihr richtig an die Wäsche. Zum Schluss gibt es daher auch ein (frühgeborenes) Baby. Interessierte können weiter bei Maeterlinck/Debussy und Begitschew/Tschaikowsky nachlesen, um den von Fioroni entdeckten und von der Dramaturgin Julia Hochstenbach sanktionierten Parallelen nachzugehen.

Ipča Ramanović (Golaud)
Hier und da lehnen Hochstenbach und Fioroni ihre Geschichte sogar an Geschehnisse des Originals an. Auf der Bühne ist alle fünf Akte und 15 Bilder lang ein Schild aufgestellt „Les Aveugles“. Sinn bekommt das im zweiten Akt am Brunnen der Blinden. Den sieht man zwar nicht, aber Pelléas und Mélisande bespritzen sich aus Plastikflaschen mit Wasser, ein Brunnen eben... Golauds Ring fällt in einen blechernen Wassereimer. Die beiden wollen ihn da nicht wieder herausholen. Golaud, an sich bei seinen Jagdvergnügen vom Pferd gestürzt, verletzt sich in der vorliegenden Version durch Stürze beim Balletttanz. Der Zusammenhang zwischen den von einem Digitalprojektor auf Wand, Vorhang oder Leinwand geworfenen Bildern und dem Geschehen besteht ist dagegen schon recht hergeholt. Wenn Golaud seinen Sohn Yniold berichten lässt, was er im Schlafzimmer der Mélisande sieht, werden auch Dias gezeigt – in immer schnellerer bis rasender Reihenfolge. Aber des Yniold hätte es für diese Szene gar nicht bedurft; Golaud konnte das ja alles selber sehen. Mélisandes Klage über die Düsternis des Schlosses passt nicht so recht zu dem hell erleuchteten Tanzstudio. Vielleich ist aber hier die Düsternis der Seelen des Schlossbevölkerung (Studio-Betreiber) gemeint.

Annika Sophie Ritlewski (Mélisande), Angus Wood (Pelléas)
Golaud ist gewalttätig gezeichnet. Pelléas kein schwärmerischer Weichling, sondern ein Feigling, der sich von seinem Bruder bedrohen lässt. Merkwürdigerweise ist er durchgängig in Schwarz gekleidet. Dem Golaud sind schwarze Flügel über die Augenhöhlen gemalt; er tritt entweder in einem weißen Trainingsanzug mit hochhackigen Schuhe oder in einem Ballettkleidchen für Mädchen auf. Arkel ist ein verblödeter Familienpatriarch, der nicht ohne ein großes weißes Plüschtier auskommt, natürlich ein Schwan. Da auch er der Mélisande an die Wäsche will und die Situation in der Ballettschule immer unerträglicher wird, stellt man zu Gespräch und Selbstfindung einen Stuhlkreis auf. Aber die Situation entartet sofort in Gewalt, bei welcher der Pelléas zusieht, wie sein Bruder Golaud Mélisande brutal misshandelt. Arkel und Geneviève scheint das sehr zu amüsieren. Hätte doch nur Pelléas am Anfang des Stücks seinen Plan wahrgemacht, zu seinem Freund zu reisen, wäre das ganze Unglück nicht geschehen. So aber nimmt es seinen Lauf: Golaud erschießt seinen Bruder, setzt das Haus in Flammen und die völlig in Brandverbandsstoff eingepackte Mélisande stirbt. Zum Zeichen, dass Golaud der Mörder seiner Frau ist, lässt ihn die Regie gerade zum deren Todeszeitpunkt die letzte Kerze auf einem festlich gedeckten Tisch löschen, an dem sich diese schöne Familie im rauchgeschwängerten Hause zu einem makabren Mahl getroffen hatte. Nun sei bedankt, mein lieber Schwan...

Ipča Ramanović (Golaud); hinten: Annika Sophie Ritlewski (Mélisande)
Vieles bleibt deutungsbedürftig. Aber soll man sich die Mühe machen, etwas zu deuten, was mit dem Stück nur über drei Ecken verwandt ist? Wer Pelléas und Mélisande vorher noch nicht gekannt hat, kennt es auch danach nicht, hat aber einen interessanten Abend mit vielen Überraschungen erlebt. Allerdings stellt sich die Frage des Mehrwerts eines solchen Niederrisses gegenüber dem ja nicht ganz unmöglichen Versuch, das Werk als solches ernst zu nehmen und die Tiefen des Seelendramas zu beleuchten, wie es z.B. Claus Guth in seiner preisgekrönten Inszenierung in Frankfurt 2012 gelungen ist. Im Programmheft gibt es wie üblich eine Zusammenfassung der Handlung. Im vorliegenden Falle hätte man durchaus auch das etwas konkreter zusammenfassen können, was tatsächlich auf der Bühne zu sehen ist – und vielleicht sogar eine Begründung für den Abriss des Werks in der Originalfassung geben können.
Wenn man sich neben der Befassung mit dem Bühnengeschehen noch dem musikalischen Geschehen zuwenden konnte, dann kam man an diesem Premierenabend in Heidelberg voll auf seine Kosten. Obwohl man in Pelléas etwa zweieinhalb Stunden die gleiche schwebende Musik hört, ermüdet man in keiner Weise. Yordan Kamdzhalov entlockte dem nahezu perfekt aufspielenden Philharmonischen Orchester Heidelberg genau die Farben, die in der raffinierten Mischinstrumentation so typisch für die Partitur sind. Er legte es dabei gar nicht einmal so auf das transzendentale Flirren der Klangimpressionen an, sondern erzeugte ein recht geerdetes und etwas strengeres Klangbild, aber nicht so konkret, dass die nebelartige Mystifizierungswirkung der Musik beseitigt würde.

vorne: Annika Sophie Ritlewski (Mélisande); hinten: Ks. Carolyn Frank (Geneviève), Statisterie des Theaters und Orchesters Heidelberg
Das Theater bot ein wahrlich internationales Solistenensemble auf; nicht zwei der Hauptrollen hatten die gleiche Nationalität! Fast alle konnten aus dem eigenen Ensemble besetzen. Cum grano salis gilt das auch für Annika Sophie Ritlewski, die eine bewundernswerte Mélisande gab. Sehr einnehmend von ihrer Bühnenpräsenz konnte sie zwar mit ihrer Körpergröße, an die ihre Kollegen nur knapp heranreichten, nicht das ganz zarte zerbrechliche Pflänzchen in der Titelrolle spielen, aber in den angedeuteten Ballettszenen konnte es ihr an Anmut niemand gleichtun. Stimmlich überzeugte sie mit ihrem farblichen Nuancierungsvermögen, einem runden dunklen Parlando in ihrer Mittellage sowie mit silbrig beweglichen und klaren Tönen in hoch gelegenen Passagen. Der Pelléas wurde in dieser Aufführung von einem Tenor gesungen; Angus Wood interpretierte die Rolle mit schön baritonal eingefärbter kraftvoller Stimme mit guter Höhensicherheit. Ipča Ramanović gab den Golaud mit der Rolle angemessenen kernig-hartem Bariton, aber recht hellen Höhen. Mit Wilfried Staber stand für den (König!) Arkel ein prächtig strömender voluminöser Bass zur Verfügung. In der stimmlich kleinen Rolle, die von der Regie aber zu größerer, wenn auch stummer Bühnenpräsenz aufgewertet wurde, wusste Carolyn Frank mit sanften, geschmeidigem Mezzo zu gefallen. Der Knabe Yniold war mit der schon etwas reiferen Mädchenstimme von Stella Rembalski gut besetzt. Als Arzt trat der Bassist David Otto vom Chor auf.
Der Tessiner Lorenzo Fioroni hat sein Regiehandwerk in Deutschland bei namhaften Regisseuren gelernt. Am Handwerklichen ist auch nichts auszusetzen. Das Premierenpublikum - einige Plätze blieben nach der Pause leer - nahm seine Arbeit eher gespalten auf, identifizierte sich auch nicht besonders mit dem Dirigat, während die Solisten eindeutige Zustimmung erhielten. Pelléas et Mélisande steht bis zum 13.03.2015 noch acht Mal auf dem Programm; nächste Vorstellung am 22. November.
Manfred Langer, 14.11.14 Fotos: Annemone Taake
Aus einer Mitteilung des Theater und Orchester Heidelberg
Der Preis der deutschen Theaterverlage 2014 für das Theater und Orchester Heidelberg
Die Stiftung des Verbandes Deutscher Bühnen- und Medienverlage vergibt in dieser Spielzeit den Preis der deutschen Theaterverlage an die Musiktheatersparte des Theaters und Orchesters Heidelberg. Der Preis wird im Jahresrhythmus abwechselnd an die Schauspiel- und Opernsparten der Theater im deutschsprachigen Raum für den interessantesten und innovativsten Spielplan der jeweiligen Saison vergeben.
Nach den Nominierungen für den größten deutschen Theaterpreis DER FAUST in der Kategorie Tanz und Musiktheater in der vergangenen Spielzeit wurde das Theater und Orchester für das Schauspiel – Viktor Bodos Inszenierung KÖNIG UBU in der Kategorie „Regie Schauspiel“ - nominiert. Damit ist Heidelberg eines der wenigen Theater, das hintereinander in allen drei Sparten eine Nominierung verzeichnen konnte. Hinzu kommt, dass das Theater und Orchester Heidelberg neben Freiburg in der Kritikerumfrage 2013 der Fachzeitschrift „deutsche bühne“ als bestes Theater, , „abseits der Zentren“ ausgezeichnet wurde. Mit der Verleihung des o. g. Preises erhält das Heidelberger Theater eine weitere Würdigung seiner Arbeit.
In der Jurybegründung für diese Entscheidung heißt es:
„Im Herbst 2012 eröffnete Holger Schultze, der nach erfolgreicher Intendanz am Theater Osnabrück im Jahr zuvor nach Heidelberg gewechselt war, das vollkommen umgebaute und erweiterte Heidelberger Theater. Die elegante und symbolträchtige architektonische Verbindung von alter und neuer Spielstätte liefert nicht nur den äußeren Rahmen, sondern auch den inneren Impuls für eine Spielplangestaltung, die sich das organische Weiterentwickeln gewachsener Strukturen, die Verbindung von Tradition und Moderne auf die Fahnen geschrieben hat. Unter der Leitung des Operndirektors Heribert Germeshausen, der auch für die Barock-Produktionen im Rokokotheater Schwetzingen verantwortlich zeichnet, hat die Sparte Oper des Heidelberger Theaters ein unverwechselbares Profil gewonnen, das durch große Entdeckerfreude, durch überlegten Umgang mit dem Repertoire und eine vorbildliche Ensemblepflege überzeugt. Konzentrierte sich das Heidelberger Theater beim „Winter in Schwetzingen“ bisher erfolgreich auf Wiederentdeckungen der neapolitanischen Oper, so zeichnet sich der zeitgenössische Spielplan dagegen durch einen pluralistischen Ansatz aus, der den unterschiedlichsten Strömungen des Musiktheaters im 20. und 21. Jahrhundert undoktrinär und mit einem beeindruckenden Gespür für die jeweiligen stilistischen Besonderheiten der Werke Rechnung trägt. Die perfekte Mischung von Nachhaltigkeit und Vielfalt beschert dem Theater und Orchester Heidelberg große Publikumserfolge und konstante Anerkennung in den Medien.
Die Spielzeit des Musiktheaters 2014-2015 in Heidelberg
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi
Marguerre-Saal
Der Opernfreund berichtete bereits über die Premiere am 12.10.2014 ( Besprechung unten); noch 15 Vorstellungen bis zum 18.04.2015; die drei Vorstellungen im November sind schon fast ausverkauft.
In meiner Nacht: Twice Through the Heart | Death Knocks | Erwartung
Drei Einakter Mark-Anthony Turnage | Christian Jost | Arnold Schönberg
Musikalische Leitung: Gad Kadosh; Regie: Clara Kalus
ab 15.10.2014 im Zwinger 1 und fünf weitere Termine vom 31.01. bis 14.02.
Pelléas et Mélisande
Drame lyrique in fünf Akten von Claude Debussy
Musikalische Leitung: Yordan Kamdzhalov; Regie: Lorenzo Fioroni
Premiere Sa 15.11.2014, 19.30 Uhr Marguerre-Saalund neun weitere Termine bis zum 13.03.15
Fetonte
Oper in drei Akten von Niccolò Jommelli
Musikalische Leitung: Felice Venanzoni; Regie: Demis Volpe
Premiere Fr 28.11.2014, 19.30 Uhr Rokokotheater Schloss Schwetzingen und neun weitere Termine bis zum 23.01.15 - im Rahmen der Serie neapolitanische Opern des „Winter in Schwetzingen“
Abends am Fluss / Hochwasser
Zwei Opern von Johannes Harneit
Musikalische Leitung: Johannes Harneit; Regie: Peter Konwitschny
Premiere Fr 6.02.2015, 19.30 Uhr Marguerre-Saalund sieben weitere Termine bis zum 12.05.2015
Cabaret
Musical von John Kander
Musikalische Leitung: Dietger Holm, Regie: Andrea Schwalbach
So 12.04.2015, 19.00 Uhr Marguerre-Saal und sechs weitere Termine bis zum 26.06.2015
V.E.R.D.I. – Operngala
Mit Musik von Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini und Daniel-François-Esprit Auber
Hye-Sung Na | Angus Wood | Ks. Winfrid Mikus | James Homann | Ipča Ramanović | Wilfried Staber; Philharmonisches Orchester Heidelberg; Moderation: Heribert Germershausen
So 7.06.2015, 19.00 Uhr Marguerre-Saal
Autobiographische Bezüge
LA TRAVIATA
Premiere: 12. 10. 2014
Selbststilisierung eines Schriftstellers
Sie gehört zu den beliebtesten und meistgespielten Opern: Verdis „La Traviata“, die derzeit wieder Hochkonjunktur hat. Zahlreiche deutsche Opernhäuser haben sie in dieser Spielzeit wieder in ihr Programm aufgenommen. So auch das Theater der Stadt Heidelberg, an dem Eva-Maria Höckmayr ihre bahnbrechende Neudeutung zur Diskussion stellte und bei dem zahlreich erschienenen Publikum dann auch auf einhellige Zustimmung stieß. Der Schlussapplaus war sehr herzlich. Und das zu Recht. Ihre Inszenierung weist einige bemerkenswerte neue Aspekte auf, die die Rezeptionsgeschichte der „Traviata“ erheblich voranbringen.

Jesus Garcia (Alfredo), Chor, Extrachor, Statisterie
Ausgangspunkt ist für sie der im Jahre 1848 erstmals veröffentlichte Roman „Die Kameliendame“ (im Original „La dame aux camélias“) aus der Feder von Alexandre Dumas d. J. sowie dessen auf der Grundlage des Buches am 2. 2. 1852 im Pariser Vaudeville-Theater aus der Taufe gehobenes Bühnendrama gleichen Namens. Sowohl die Erzählung als auch das Theaterstück weisen autobiographische Züge auf und schildern das Zusammentreffen des damals 20jährigen Dumas unter dem fiktiven Namen Armand mit der damals hochberühmten Pariser Kurtisane Marie Duplessis, die hier den Namen Marguerite trägt. Das Publikum wusste dennoch, wen er damit meinte. Hier war noch vieles anders als in der 1853 in Venedig uraufgeführten Oper Verdis. Dumas erzählt die Geschichte aus seinem eigenen Blickwinkel heraus in Form einer Selbststilisierung und verklärt die Liebesbeziehung zwischen Armand und Marguerite, die er als große tragische Liebe darstellt. Diese ließ er letztlich nicht nur an der Schwindsucht der Geliebten, sondern insbesondere auch an den rigiden Ansprüchen der durch Armands Vater verkörperten gesellschaftlichen Moral scheitern. Ein Landaufenthalt des Paares existiert weder im Roman noch im Schauspiel. Diesen hat erst Verdi für seine „Traviata“ dazuerfunden, wobei auch seitens des Komponisten autobiographische Züge eingeflossen sein dürften. Seit 1847 lebte Verdi mit der Sängerin Giuseppina Strepponi unter dem kritischen Blick der Öffentlichkeit in wilder Ehe auf seinem Landgut Sant’ Agata zusammen und wollte durch diesen Zusatz wohl nicht zuletzt auf seine eigene Situation hinweisen. Neben Dumas/Armand wurde auch er ein Teil der Opernfigur Alfredo.

Jesus Garcia (Alfredo), Rinnat Moriah (Violetta))
Indes ist es nicht Verdi, dem Frau Höckmayrs Aufmerksamkeit gilt, sondern allein Dumas. Gleich dem Sohn des berühmten „Musketier“-Autors, der in der „Kameliendame“ die Beziehung zu Marie Duplessis, von der er sich schließlich aus finanziellen Gründen trennte, zu verarbeiten versucht, schildert sie das Ganze aus der Perspektive Alfredos, den sie in psychologisch einfühlsamer Weise mit Dumas identifiziert. Hier steht ausnahmsweise mal nicht die Perspektive Violettas im Vordergrund, wie es in den meisten anderen Produktionen des Werkes der Fall ist, sondern die von Alfredo/Dumas. Nicht die weibliche Betrachtungsweise dominiert das Geschehen, sondern die männliche. Und diese wird von einem mangelnden Selbstwertgefühl des jungen Germont geprägt. Dumas’ im Roman zu Tage tretendes Bestreben, sich als Armand aus dem Schatten des übermächtigen Vaters zu lösen und ein unabhängiges Selbstbild von sich zu zeichnen, greift die Regisseurin geschickt auf und überträgt es in überzeugender Art und Weise auf Alfredo. Fast ständig auf der Bühne ist er durchweg darum bemüht, dem gesellschaftlichen Abseits, in das er gestoßen wurde, zu entrinnen und von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Dabei wird sein Handeln nicht von Liebe geleitet, sondern von purer Berechnung. Violetta ist für ihn unter diesen Voraussetzungen nur ein Mittel zum Zweck, um endlich die ersehnte Anerkennung zu erlangen. Eindringlich und prägnant rechnet Eva-Maria Höckmayr mit dem Egomanen Dumas ab, dessen mit Buch und Stück verfolgte wahre Ziele sie eindringlich beleuchtet.

Rinnat Moriah (Violetta), Jesus Garcia (Alfredo), Chor, Extrachor
Dabei geht sie technisch sehr versiert vor. Eine Meisterin in Sachen spannender, ausgefeilter Personenregie ist sie schon immer gewesen. Da bildet ihre bravourös umgesetzte „Traviata“ wahrlich keine Ausnahme. Sie ist eine Regisseurin, die ihr Handwerk ausgezeichnet versteht. Das erweist sich nicht zuletzt auch hier wieder an ihrem trefflichem Umgang mit verschiedenen, parallel ablaufenden Handlungsebenen. Dieses Stilprinzip, das sie öfters für ihre Regiearbeiten heranzieht - zuletzt bei ihrer Frankfurter Inszenierung von „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ - und das auch an diesem Abend reichhaltig gepflegt wurde, ist typisch für sie, gleichzeitig aber auch beredter Ausdruck einer ganz eigenen Regiesprache mit psychologischen Einschlägen. Hier wartet sie mit zwei zusätzlichen Ebenen auf, wobei sie auch dieses Mal den Handlungsträgern wieder stumme Alter Egos an die Seite stellt. Auch das ist bei ihr nichts Neues mehr. Das Ganze spielt sich in einem von Julia Röscher - von ihr stammen auch die gelungenen Kostüme - geschaffenen Theater auf dem Theater ab, auf dem bereits während der Ouvertüre eine Aufführung von Dumas’ Stück „Die Kameliendame“ zu Ende geht, die Schauspieler sich vor einem in Hintergrund der Bühne platzierten Bühnen-Publikum verbeugen und dann in Privatkleidung ihrer eigenen Wege gehen.

Jesus Garcia (Alfredo), Rinnat Moriah (Violetta), Chor. Extrachor)
Violetta erfährt eine Spaltung. Mal im kargen grauen Mantel, mal im weißen Unterkleid auftretend korrespondiert sie mit der Schauspielerin im prächtigen roten Abendkleid, die ihr Leben auf der Bühne darstellt. Dass dieses in Alfredos/Dumas Stück aber auf recht selbstsüchtige Weise manipuliert wurde, erkennt sie und geht auf Distanz zu ihm. Demgemäß zeigt die Regisseurin auch keine echte Liebesgeschichte. Sie sieht Alfredo und Traviata an keiner Stelle als echtes Liebespaar und lässt die beiden ihr Verhältnis nicht ausleben. Ihre Beziehung ist in hohem Maße gestört. Das erkennt auch Violetta, die sich dann prompt mit Germont gegen dessen Sohn verbündet. Die nur scheinbare Familienidylle der Germonts, in der der nicht gerade sympathisch gezeichnete Vater mit eiserner Hand regiert und in der Alfredo und seine Schwester noch Kinder sind, scheint während des Duetts der beiden Konspiranten hinter einer Glaswand im Hintergrund auf. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass die Protagonistin sich am Ende nur noch ausgenutzt vorkommt und kurz vor ihrem Tod nun ihrerseits zum Mittel der Selbststilisierung greift. Es ist ein sehr fragwürdiges Erbe, das sie Alfredo/Dumas mit ihrem Bild, das er seiner künftigen Frau geben soll, hinterlässt. Diese potentielle Ehe soll stets durch die Erinnerung an sie getrübt und damit nicht glücklich werden. So wird sich seine die ganze Zeit über an den Tag gelegte große Ichbezogenheit eines Tages rächen. Mit dieser Abrechnung hat Traviata ihre Funktion erfüllt. Sie stirbt lediglich einen symbolischen Tod und verlässt die Bühne. Das war alles sehr überzeugend und hervorragend umgesetzt. Aber dass Frau Höckmayr eine Meisterin in ihrem Fach ist, hat man ja schon lange gewusst. Was sie an diesem Abend präsentierte, war Musiktheater vom Feinsten, das ohne Zweifel in die Annalen des Heidelberger Theaters, das eine der ersten Adressen im deutschen Opernbetrieb darstellt, eingehen wird.

James Homann (Germont), Baron Douphol, Jesus Garcia (Alfredo), Rinnat Moriah (Violetta)
Nicht minder prachtvoll war das bei der Premiere aufgebotene Ensemble. Dessen bis in die kleinsten Rollen fast durchweg ausgezeichnetes Niveau belegt, dass Operndirektor Heribert Germeshausen ein hervorragendes Ohr für Stimmen besitzt. Leider hatte an diesem Abend der Krankheitsteufel zugeschlagen und die ursprünglich für die Violetta vorgesehene Irina Simmes mattgesetzt. Als Ersatz stand die Zweitbesetzung Rinnat Moriah zur Verfügung, die dann auch eine ansprechende Leistung erbrachte. Nach einer kleinen Anlaufzeit, die sie benötigte, um stimmlich warm zu werden, beglückte sie durch eine differenzierte, nuancenreiche und von subtilen Zwischentönen geprägte gesangliche Leistung. Eine beachtliche Pianokultur war die Grundlage ihres recht emotionalen Ausdrucks, der mit der einfühlsamen darstellerischen Leistung Hand in Hand ging. Bei den Spitzentönen des „Sempre libera“ ging sie indes noch etwas vorsichtig ans Werk. Das hohe es hat man von anderen Interpretinnen der Rolle schon kräftiger gehört. Neben ihr erwies sich Jesus Garcia als Idealbesetzung für den Alfredo. Mit edel klingendem, kräftigem und substanzreichem, dabei wunderbar südländisch fokussiertem, frei und elegant dahinströmendem Tenor empfahl er sich nachhaltig für größere Bühnen und sang sich zu Recht in die Herzen des begeisterten Auditoriums. Seinen beiden Mitstreitern in den Hauptrollen stand der Germont von James Homann in Nichts nach. Mit seinem profunden, in jeder Lage voll und klangvoll ansprechenden Bariton, dem er neben recht autoritär anmutenden auch ausgesprochen weiche, leise und geschmeidige Töne zu entlocken wusste, gab der Sänger seiner Rolle stimmlich die Huld, die ihr äußerlich von der Regie verweigert wurde. Derzeit begegnet man immer mehr Sängern, die den Gaston schön im Körper singen. Sang-Hoon Lee ist einer davon. Kräftiges Bass-Material brachte Zachary Wilson, der für den gleich Frau Simmes erkrankten Ipca Ramanovic eingesprungen war, für den Baron Douphol mit. Tadellos sang Michael Zahn den Marquis d’ Obigny. Solide vokale Leistungen erbrachten Amélie Saadia und Irida Herri in den kleinen Partien von Flora und Annina. Den einzigen vokalen Schwachpunkt des Abends bildete David Otto, der den Dr. Grenvil ziemlich im Hals sang. Auf hohem Niveau bewegte sich der von Anna Töller bestens einstudierte Chor.
Ungetrübte Freude bereiteten auch Dirigent und Orchester. Lahav Shani setzte im Graben einen trefflichen Kontrapunkt zu dem dramatischen Geschehen auf der Bühne und lotete Verdis herrliche Musik zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Heidelberg vorzüglich aus. Sein vielschichtiges Dirigat zeichnete sich durch gute Italianita, wunderbar lang gesponnene und gefühlvolle Bögen sowie einen großen Farbenreichtum aus. Den Sängern war er ein umsichtiger Partner.
Fazit: Erneut eine regelrecht preisverdächtige Produktion, zu der man dem Theater der Stadt Heidelberg und allen Beteiligten nur aufs Herzlichste gratulieren kann. Hier haben wir es mit einer der besten Umsetzungen des Werkes in letzter Zeit zu tun. Der Besuch der Aufführung wird dringend empfohlen!
Ludwig Steinbach, 13. 10. 2014
Die Bilder stammen von Annemone Taake
Mysterienspiel
ECHNATON (AKHNATEN)
Philip Glass (*1937)
Premiere am 06.06.2014
Aufstieg und Scheitern des Echnaton als spartenübergreifendes Projekt
Glass, einer der profiliertesten Vertreter des musikalischen Minimalismus, der inzwischen über 20 Opern herausgebracht hat, wurde als Opernkomponist schon mit seinem Erstlingswerk „Einstein on the Beach“ bekannt. Darin beschäftigt er sich mit der Figur des Wissenschaftlers; In „Satyagraha“ (1980) wird der Politiker Mahatma Gandhi thematisiert und mit „Echnaton“ (1983) beschließt er sein Triptychon der Portraitopern mit der Figur des gescheiterten Religionsstifters Amenophis IV. Diese drei Opern bringen nicht Leben oder Lebensabschnitte der Hauptfiguren in eine zusammenhängende stringente Handlung, sondern beleuchten jeweils tableauhaft die Hauptpersönlichkeit in ihrem Umfeld. Dabei wird in Grenzen auch auf historische Korrektheit geachtet, was natürlich bei der Oper Echnaton wegen der dürftigen Quellenlage an gewisse Grenzen stößt. Das Libretto der Oper schrieben der Komponist in Zusammenarbeit mit Shalom Goldmann, Robert Israel und Richard Riddell in Englisch, Ägyptisch, Akkadisch und Aramäisch.

Dominik Breuer (Chronist, oben Mitte), Artem Krutko (Echnaton, unten Mitte), Michael Zahn (Eje, Mitte rechts), Chor, Extra-Chor und Tänzerinnen
Es werden Szenen aus der 17-jährigen Herrschaftszeit des Pharaos Echnaton (Amenophis IV) aus dem 14. vorchristlichen Jahrhundert thematisiert. Das beginnt mit seiner Inthronisierung nach dem Tode seines Vaters Amenophis III und beschreibt die Ausrufung einer neuen Religion. Diese Neuerung war die Erhebung des Lichtgotts Aton anstelle von Amun zum neuen Hauptgott Ägyptens. (Das wird noch heute vielfach fälschlich als ein Schritt zum Monotheismus gesehen; war aber in Wirklichkeit nichts anderes als die Stilisierung eine neuen supermächtigen Stammesgottes: jedes Volk hat seinen eigenen Gott; der stärkste Gott gewinnt mit seiner Völkerschaft; ein mordendes Bekehrungsgebot findet da nicht statt.) Es kommt zum Bau der neuen Hauptstadt Achet-Aton, wohin sich Echnaton und eine Frau Nofretete begeben und die Realitäten der Welt nicht mehr wahrnehmen. Der Widerstand gegen die Neuerungen durch die überkommene privilegierte Schicht der zahlreichen Priesterschaft der Vielgötterei führen zum Schluss zur Zerstörung der neuen Stadt und zum Sturz des Pharaos. In der Oper kommen noch Echnatons Mutter, die Königin Teje, vor, der Hohepriester des Amun, der General Haremhab, sowie Eje, hoher Hofbeamter unter Echnaton und später Pharao als Nachfolger Tutanchamuns. In der Heidelberger Inszenierung endet die Oper mit der Einhüllung (und Mumifizierung) von Echnaton und Nofretete und der Einweisung einer Reisegruppe in den Besuch der Ruinenfelder von Echnatons verfallener Hauptstadt.

Artem Krutko (Echnaton), Léa Dubois (Tänzerin), Kyle Patrick (Tänzer), Amélie Saadia (Nofretete)
Mit der Inszenierung des Stücks als Hybrid Oper/Ballett war der Choreographin Nanine Linning betraut worden. Da ist von vornherein keine „Neudeutung“, oder „Lesart“ des Werks gefragt, sondern das Werk muss als Ballett und Oper verständlich gemacht werden. Da hilft der Ballett-Sicht die Konkretisierung durch Text und Bühnengeschehen, während naturgemäß die Opern-Sicht in Richtung Ballett eine weitgehende Abstrahierung erfährt, bei der die Bewegungsästhetik das Primat hat. Diesen Bewegungen stehen Bühnenbilder und Requisiten im Wege, weshalb der Bühnenbildner Marc Warning in seinen Mitteln von vornherein begrenzt ist. Der schwarze freie Raum wird mit von oben sich herabsenkenden graphischen Elementen (z.B. ein Sonnenkreis oder ein abstraktes Herrschaftssymbol) aufgelockert; gegen Ende hantieren die Darsteller mit Drahtmodellen, die sowohl die Architektur einer Stadt als auch deren Ruinen und Mausoleen darstellen könnten. Konkreter waren die Kostüme von Georg Meyer-Wiel, die neben zeitlosen auch antikisierend-stilisierende Elemente verwendeten: eine goldener Helm für Echnaton, eine Hinterkopfmaske für den General oder die Sonnenscheibe für den Hohepriester des Amun. Schwarz und Weiß sind die beherrschenden Nicht-Farben des Set, aufgelockert durch das Gold der Helme, das Blau der Frauengewänder und die Körperfarben der Ballett-Trikots.

Michael Zahn (Eje), Tanzensemble
Darüberhinaus arbeitet die Regie mit Kontrasten. Kommt der Chor in Weiß, dann ist das Corps de Ballet in Schwarz und umgekehrt. Wenn die Dance Company die Szene in Bewegung aufmischt, dann bleibt der Chor statisch. Und sicher war es eine große Herausforderung, welche die Regie meisterte: das Mit- und Gegeneinander von Chor und Ballett, zwischen denen immer ein gewisses Spannungsfeld aufgebaut werden konnte. Bühnenästhetisch war das sehr gelungen. Statisch und distant blieb die Führung der Protagonisten; sie blieben durchweg figureheads ohne Blut und Wärme. Viel hatte die Aufführung von einem Mysterienspiel, in welchem Gestik und Handbewegungen an Inszenierungen von Robert Wilson gemahnten, mit dem Glass in früheren Opern zusammengearbeitet hatte.

Tänzer Paolo Amerio, Thomas Walschot und Léa Dubois, Artem Krutko (Echnaton), Tanzensemble
Spätestens wenn man nach zweieinviertel Stunden reiner Spielzeit aus der Oper geht, weiß man, was der minimalistische Musikstil des Komponisten bedeutet. In der mit annähernd 15 Minuten sehr langen Ouvertüre hört man zunächst mit nur kleinen Variationen einen gebrochenen Akkord aufwärts und abwärts, der durch ein auf nur einer Tonhöhe gespieltes rhythmisches Motiv überlagert wird, das - immer prägnanter durch den Einsatz der Basstuba vorgetragen - die Herrschaft übernimmt und dann wieder versinkt um dem stetig fließenden Wellenspiel des Akkords wieder Raum zu geben. Das Philharmonische Orchester Heidelberg unter der Leitung von Dieter Holm spielte das in einem überzeugenden Spannungsbogen. Als Vergleich drängt sich das lange Es-Dur aus dem Rheingold an. Allerdings konnte das stets sauber intonierende Orchester diese Spannung nicht über die Spielzeit des Werks aufrecht erhalten Zum Schluss stand man unter dem Eindruck zwei Stunden lang Triolen in a-moll gehört zu haben, die nur in den beiden hochdramatischen Szenen der Erstürmung des Tempels und dem Sturz Echnatons mit ebenso dramatischem Choreinsatz (Gesang nur auf ganz wenigen Tonhöhen) unterbrochen worden waren. Einen guten Eindruck hinterließen vokal Chor und Extrachor unter der Direktion von Anna Töller. Dazu waren die Chöre ebenso stringent und präzise choreographiert wie die elf Ausführenden der Dance Company Nanine Linning vom Theater Heidelberg; die einen statisch schreitend, die anderen in harmonischen und gleichzeitig dynamischen Bewegungsbildern.

Artem Krutko (Echnaton), Amélie Saadia (Nofretete), Tanzensemble
Auch in der zeitgenössischen Musik finden sich immer mehr Rollen für Counter-Tenöre. So war die Titelrolle (fast im Stil einer barocken seria) mit dem Counter Artem Krutko besetzt, der mit zwei verschiedenen Registern zu gefallen wusste und vor allem in der Höhe mit hellen, klaren, ganz natürlich wirkenden Linien überzeugte. Amélie Saadia gab die Nofretete mit samtig weich intoniertem, betörenden Mezzo-Sopran. Die Französin, die mit 17 Jahren den »Prix du Plus Jeune Espoir« gewann, hat diese „Hoffnungen“ inzwischen voll bestätigt. In den weiteren Gesangsrollen bestand nur in geringerem Maße die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Das tat auf jeden Fall Irida Herri als Königin Teje mit einem schlanken leuchtenden Sopran, weniger Winfrid Mikus als hoher Priester des Amun mit seinem in der Höhe leicht schwankenden Tenor.

Artem Krutko (Echnaton) (Foto: Roger Muskee)
Dominik Breuer sprach den „Chronisten“ (das sollte Amenhotep sein, der schon vor der Regierungszeit von Echnaton verstorben war) über Wangenmikrophon verstärkt in Englisch – mit Übertitelung der deutschen Übersetzung. Bei der UA in Stuttgart und weiteren Aufführungen wurde der Text auf Deutsch gesprochen. Dass er nun auch dann noch verstärkt wurde, wenn der Sprecher von der vorderen Brüstung des Grabens sprach, dass dabei unnatürlich hoch verstärkt wurde und dass der gehörte Klang aus einer anderen Richtung zu kommen schien als vom Sprecher auf der Bühne, lässt diese Praxis insgesamt fragwürdig erscheinen und wirft ein unvorteilhaftes Licht auf das deutsche Sprechtheater.
Es gab am Ende lang anhaltenden jubelnden Beifall für diese ästhetisch hochstehende Aufführung aus dem vollen Premierensaal. Dass hier an einem einzigen Abend Ballett- und Opernfreunde bedient werden können, wird sicher auch für volles Haus bei den kommenden Vorstellungen führen, die in dieser Spielzeit noch am 14. und 28.06. sowie am 4., 6., und 21.07. stattfinden werden.
Manfred Langer, 08.06.2014
Fotos (wo nicht anders angegeben): Florian Merdes
Ganz schön verbogen
COSÌ FAN TUTTE
Premiere am 10.05.2014 Zweite Besprechung
Mit umgekehrter Hierarchie
Da-Ponte mit seinem berühmten Triptychon für Mozart sei einmal anders beleuchtet: Don Giovanni in großen Teilen aus dem Bertati-Libretto für Gazzanigas Oper abgeschrieben; le nozze di Figaro in weiten Teilen aus dem Beaumarchais-Text wörtlich übersetzt. Und das Libretto für Così fan tutte, dies eine eigenständige literarische Leistung von da Ponte erst einmal Antonio Salieri zum Vertonen vorgelegt! Wällisches Luder! --- Weil Salieri nicht wollte, komponierte Mozart die Oper. Welches Glück für die Nachwelt! Aber das Werk wurde im prüden 19. Jahrhundert in seiner Originalform nicht mehr beachtet, sondern – um die Musik zu retten – in wunderlichen Bearbeitungen gebracht. Erst zu einer Zeit, als Freudsche Ideen über Verhaltensmuster auch in die Musikszene eingesickert waren, nahm man sich des Werks wieder verstärkt an. Gustav Mahler (der selber bei Freund in Behandlung war) und Richard Strauss propagierten die Oper, in der aus einem läppischen Spiel um voreheliche Treue im mit dem Tiefgang einer Boulevard-Komödie ein Psycho-Spiel mit Eroberungs- und Angriffslust wird und bis bis zum Eifersuchtsdrama ausartet. Die Leute hatten früher wohl immer nur den ersten Teil der Oper verstanden...
Musik- und Psychoanalyse haben aber inzwischen auch den zweiten Teil des Werks entschlüsselt, so dass es heute zu den ganz beliebten Objekten modernen Regietheaters geworden ist. Der alte Vorwurf der Unglaubwürdigkeit des Texts wird in der heutigen Zeit, wo selbst die Barock-Opern fröhliche Urstände feiern, nicht mehr strapaziert. Aber bei der vorliegenden Regiearbeit von Nadja Loschky kommt einem dieses Argument gleich wieder in den Sinn. Sie nimmt nämlich eine erhebliche Änderung an der Dramaturgie des Stoffs vor, die zumindest einen der dramaturgischen Haken des Librettos beseitigt: warum weiß eigentlich die schlaue Despina nicht, was sich da im Hause abspielt? Das ist nun der Ansatzpunkt für die Dramaturgie von Julia Hochstenbach, das Stück insofern auf den Kopf zu stellen. Despina ist Lebensabschnittsbegleiterin des Don Alfonso, vielleicht sogar sein Eheweib; sie ist die Chefin im Hause. Von Anfang an kolludiert sie mit Alfonso zu deren beiden zynischem Vergnügen und betreibt das Spiel mit den beiden jungen Paaren. Die sind leichte Opfer für so ein Spiel, denn sie begeben sich eben in eine offensichtlich arrangierte, freudlose Vernunftehe miteinander und fallen so auf die Verlockungen echt scheinenden Liebeswerbens leichter herein, wozu noch sexuelle Neugierde kommt. Das transparent zu machen, ist ein zweiter wesentlicher Aspekt des Regiekonzepts, das sich somit auch auf die Zeit der Entstehung des Werks bezieht, in welcher J. J. Rousseaus Roman „Julie oder Die neue Heloise“ en vogue war, in dem dieser sich im Aufklärungszeitalter der Thematik Ehe aus Vernunft oder Liebe angenommen hatte. Das ganze noch mit einem Aspekt „Theater auf dem Theater“ zu verbinden, macht dann leider die Inszenierung zusammen mit etlicher Einzelsymbolik etwas Kopf-lastig, so dass sie nicht wie aus einem Guss erscheint. Dahinein müsse noch der übliche Klamauk der Doktor- und Notarszenen integriert sowie das eine oder andere Mätzchen werden.

Marija Joković (Dorabella), Irina Simmes (Fiordiligi)
Der Einfall, Despina als zugleich willfährige wie auch widerspenstige Komplizin des Don Alfonso mitgestalten zu lassen, führt zwangsläufig zu Änderungserfordernissen in der Oper. Das Auftrittsrezitativ der Despina „che vita maledetta“ muss gestrichen werden ebenso wie die elfte Szene des zweiten Akts, in welcher Despina Befehle von Fiordiligi entgegen nimmt („Tieni un po‘ questa chiave“). Das passt nun nicht mehr, denn in dieser Inszenierung sind es die nichtsnützigen Fiordiligi und Dorabella, die den Tisch abräumen, nicht Despina. An sich ein reizvolles Konzept, das aber wegen der Logik noch zu weiteren Konsequenzen führt als Streichungen: so wird ungeniert die Übersetzung verbogen oder auch frontal gegen den Text inszeniert. Da Despina nun dauernd anwesend ist, werden ihr Worte in den Mund gelegt, die zu den Rezitativen des Don Alfonso gehören. Ein wesentlicher Effekt der Oper hat nun gar keinen Sinn mehr. Denn im Original sind ja nicht nur die beiden Paare die Düpierten, sondern auch Despina, die zynisch von Don Alfonso instrumentalisiert und manipuliert wurde und das trotz ihrer Schläue erst ganz zuletzt merkt. Warum dann aber die Regie in den letzten Szenen Despina sich mit Don Alfonso in die Wolle gerät, erklärt sich nicht von selbst. Die Zahl der unglaubwürdigen Elemente der Oper ist insgesamt größer geworden.

Ipča Ramanović (Guglielmo), Namwon Huh (Ferrando)
Als prächtiges Bühnenbild hat Nina von Essen einen Salon im Stil der Zwanziger Jahre auf die Bühne gestellt mit altväterlicher halbhoher Holzvertäfelung der Sockel, Nebenräumen und ein paar Stufen im Hintergrund, die zu einem Durchgang hinauf führen, der mit einem Theatervorhang verschlossen ist: aber nur ein winziges Theaterchen. Darin tummelt sich die Gesellschaft in Kleidern der Jetztzeit – zumindest im ersten Akt (Kostüme: Violaine Thel). Noch vor der Ouvertüre bringt Don Alfonso- etwas kantig deklamiert) der dort versammelten dekadenten Feiergesellschaft ein Brindisi aus, kümmert sich dabei besonders um zwei auf der Treppe in erstarrter Pose stehende Paare: das sind unsere beiden Paare: sie sollen am nächsten Tag heiraten; die Hochzeitskleider sind in zwei Vitrinen ausgestellt. Die Vorfreude auf die Hochzeit hält sich in allerengsten Grenzen; siehe oben: offensichtlich zwei arrangierte Ehen. Möglichweise führen auch die Gastgeber Despina und Alfonso eine solche Ehe: die Maid ohne Minne vermählt dem Mann. Recht abgewirtschaftet sehen die beiden schon aus; sie trotz der platinblonden Haarfärbung; er mit Pferdeschwanz und schwarzem Rollkragen-Pullover wie ein Opernregisseur. „Top, die Wette gilt“. das wird mit einem Stafettentrinken mit etlichen kurzen Klaren gefeiert; innert von 60 Sekunden sind die beiden jungen Männer so betrunken, als hätte man ihnen den Alkohol intravenös verabreicht. Aber als das Kriegsfanal tönt, springen sie stocknüchtern wieder au die Beine: überflüssiger Schnickschnack!

Stehend: Wilfried Staber (Don Alfonso), Ks. Carolyn Frank (Despina), Statisterie; liegend: Irina Simmes (Fiordiligi), Namwon Huh (Ferrando), Marija Joković (Dorabella), Ipča Ramanović (Guglielmo)
Bevor Ferrando und Guglielmo als Türken oder Wallachen zurückkommen, hat sich Don Alfonso in einen Zirkusdompteur mit schwarzen Frack auf nacktem Oberkörper, Zylinder und Peitsche verwandelt. Nun kann er den beiden einheizen und sie auf einen Stuhl springen lassen; gekleidet sind sie wie er. Den Damen werden vor der Guglielmo-Arie („Guardate ... abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso“) die Augen verbunden, damit sie die Attribute der Männer besser beurteilen können. Die Regie will wohl sagen, dass diese Attribute gar nicht wichtig sind. Da die Oper nun in der Gegenwart spielt, in der niemand mehr an den Mesmerschen Stein glaubt, wird den beiden Liebhabern mit Riesentrichtern ein Emetikum eingeflößt; die erforderlichen Eimer stehen auch parat.
Trotz des sehr gelungenen originellen Einstiegs in die Inszenierung lief aber letztlich doch alles nach dem Schema ab: Buffa im ersten Akt, Psychodrama im zweiten. Für diesen zweiten Teil kamen noch zottelige Tierfiguren auf die Bühne, die bei den jungen Paaren erst einen Angstraum auslösten und dann immer weiter bedrohlich herumspukten. Die sich zuspitzende Situation der jungen Leute spielt sich im nordischen nächtlichen Winter mit Schneefall ab – für Heiterkeit bleibt da eben auch kein Platz. Wenn man sich an die wurmartige Verkleidung der beiden Liebhaber und die komplizierten Maskenspiele der Protagonisten gewöhnt hatte, verlief der zweite Akt in gewohnten Bahnen. An die Streichung der elften Szene mit Fiordiligis geäußerter Absicht, ins Feld zu ihrem Verlobten zu ziehen, könnte man sich gar gewöhnen. Die Oper kam in der Heidelberger Fassung immer noch auf knapp drei Stunden reine Spielzeit und endete ganz versöhnlich: die beiden jungen Paare gehen über die Treppe und durch das kleine Theaterportal ab; es war alles nur ein Spiel. Despina und Alfonso können sich, wenn sie sich wieder vertragen haben, eine neues ausdenken.

Irina Simmes (Fiordiligi), Ipča Ramanović (Guglielmo), Marija Joković (Dorabella), Namwon Huh (Ferrando)
Musikalisch stimmte in de Premiere noch nicht alles. Der noch sehr junge Heidelberger zweite Kapellmeister Gad Kadosh am Pult war sich zwar immer mit seinem Orchester einig, dem Philharmonischen Orchester Heidelberg, aber durchaus nicht immer mit dem Rhythmus auf der Bühne. Die Ungenauigkeiten waren umso größer, je weiter hinten die Sänger platziert waren; möglicherweise nahmen die ihre Einsätze nicht immer vom Dirigenten, sondern auch von Instrumentalisten. Über unwesentliche Instrumentalpatzer braucht man indes nicht zu Beckmessern; da kamen auch kaum sieben zustande. Kadosh differenzierte die Partitur in den Tempi extrem aus und betonte auch die Kontraste zwischen feinen kammermusikalischen Passagen und deutlich geschärften Tutti. Bei einigen schleppenden Tempi schien die Partitur auseinanderzufallen. Jederzeit schonte er die Sänger. Die Choreinlagen wurden komplett gestrichen und durch reine Orchestermusik ersetzt. Das hat nicht nur ökonomische Vorteile, sondern auch dramaturgische, denn die Chöre sind bei der Così wohl nur der damaligen Tradition geschuldet. Der prägnante Militärmarsch reicht. Zudem wird die Regie von der bei jeder modernen Regiearbeit diffizilen Aufgabe der Chorregie entlastet.

Wilfried Staber (Don Alfonso), Ks. Carolyn Frank (Despina)
Etwas durchwachsen sah es auch bei den Gesangssolisten aus. Bei Wilfried Staber als Don Alfonso – sonst so verlässlich – wunderte man sich über instabile Höhen und Probleme im Registerübergang. In der Pause wurde er dann als indisponiert angesagt. Dennoch konnte er Kostproben seines markanten, sonoren Basses abgeben und erhielt vom Publikum zum Schluss besonderen Dank für seinen Eunsatz unter widrigen Umsänden. Gut gefiel Ipča Ramanović als Guglielmo; er verfügt über ein kräftiges Bariton-Fundament und überzeugte mit kultiviert ausgesungenen Linien. Namwon Huh als Ferrando hatte zu Beginn Probleme mit stimmlicher Enge und Höhenunsicherheit, was man wohl der Premierenanspannung zuschreiben muss, denn im Verlauf gefiel sein zunehmend gut geführter, klarer feiner Tenor mit schöner Leuchtkraft immer besser. Bei seiner begrenzten Stimmkraft müsste ihm die Regie bei der Platzierung auf der Bühne besser unterstützen. Ähnlich erging es wohl auch Irina Simmes als Fiodiligi; sie, deren Stimme ohnehin etwas zur Schärfe neigt, konnte zunächst nicht gefallen. Nachdem sie aber ihr „come scoglio“ mit den mörderischen Tonsprüngen technisch bravourös gemeistert hatte und dort sogar in den Tiefen noch gut hörbar war, schien eine Last von ihr abzufallen. Sie gestaltete ihre Partie fortan mit viel mehr Schmelz und gelangte in ihrem Rondo im zweiten Akt „Per pietà“ zu einer schönen innigen Interpretation. Mit Marija Joković war ein samtiger Mezzosopran als Dorabella besetzt; sie verband Tiefgründigkeit und Leuchtkraft, dagegen nicht sehr nuanciert in der Farbgebung. In der ihr zugedachten Rolle konnte die dementsprechend ziemlich abgetakelt aufgemachte Ks. Carolyn Frank als Despina von der Bühnenpräsenz her punkten. Und stimmlich passte sie auch in diese Rolle; aber das ist hier kein Kompliment. Dazu hätte sie ruhig mal nach dem Taktstock des Dirigenten schauen können, denn was der schlug, schien sie streckenweise gar nicht zu interessieren.
Das Premierenpublikum war sehr angetan von dem insgesamt gelungenen Opernabend und spendete begeisterten und lang anhaltenden Beifall, über den sich das Regieteam offensichtlich am meisten erleichtert zeigte. Nächste Vorstellung am 15.05.; dann noch fünf weitere Male bis zum 10.07.2014
Manfred Langer, 12.05.2014 Fotos: Florian Merdes
Weitere Fotos: nächster Bericht
Musiktheater am Rande der Konvention
COSI FAN TUTTE
Premiere: 10. 5. 2014
Reise ins Ich mit Rousseau und Freud
Ziemlich unkonventionell geriet die Neuproduktion von Mozarts „Cosi fan tutte“ am Theater der Stadt Heidelberg. Nadja Loschky hat sich dem Stück ganz von innen her genähert und mit Hilfe einer spannenden, stringenten Personenregie derart packend und kurzweilig in Szene gesetzt, dass die 2h50 Spieldauer wie im Fluge vergingen. Handwerklich und konzeptionell gelang es der jungen Regisseurin, aus der trotz der Kürzungen noch Längen aufweisenden Oper spannendes Musiktheater zu machen. Das wirkte alles frisch und neu und durchaus auch gefällig, um es mal mit Goethe zu formulieren. Und dass das zahlreich erschienene Heidelberger Publikum zeitgenössische Interpretationen durchaus goutiert, wurde beim sehr herzlichen Schlussapplaus für Frau Loschky und ihr Team offenkundig.

Ensemble
Die Handlung erscheint in Nadja Loschkys Deutung als groß angelegter Menschenversuch Rousseau’scher Prägung, vielfältig garniert mit Freud’schen Erkenntnissen. Nina von Essen hat einen in dunklen Brauntönen gehaltenen klassizistischen Raum des gehobenen Bildungsbürgertums geschaffen, der im Lauf der Aufführung einigen Wandlungen unterliegt und am Ende in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Neben einer langen Speisetafel im Hintergrund wird dieser große Eleganz atmende Saal insbesondere von einem Theater auf dem Theater eingenommen, das immer wieder in Brecht’scher Manier in das Spiel einbezogen wird. Das ganze Leben ist eben ein Theater und alle Männer und Frauen sind nur Spieler. Diese Erkenntnis von Shakespeare hat sich auch die Regisseurin zu Eigen gemacht, wenn sie die Protagonisten in ihrer kleinen Welt als Teil eines viel umfassenderen Kosmos agieren und ihre Emotionen trefflich ausleben lässt. Sie hat dem Ganzen gekonnt eine Rahmenhandlung vorangestellt. Noch vor Erklingen der Musik öffnet sich der Vorhang und führt dem Zuschauer eine gleichsam in bürgerlichen Zwängen erstarrte, von Violaine Thel modern eingekleidete Gesellschaft vor Augen, aus der sich Don Alfonso und die bereits stark in die Jahre gekommene Despina die Personen für ihr Experiment aussuchen. Ihre Wahl fällt schließlich auf eine nahe an dem Theater auf dem Theater versammelte Gruppe von vier jungen Leuten, die im Folgenden ihre Versuchskaninchen werden, dabei aber immerhin noch einen eigenen Willen zeigen. Diese kurze, der Ouvertüre vorangestellte Szene hat die Regisseurin mit einem zusätzlichen, von ihr selber in italienischer Sprache verfassten und von den beiden Drahtziehern des Versuches gesprochenen Text garniert.

Hier HDCosi6f – Marija Jokovic (Dorabella), Namwon Huh (Ferrando), Ipca Ramanovic (Guglielmo), Wilfried Staber (Don Alfonso)
Einfühlsam nimmt Frau Loschky die Handlungsträger an die Hand und unternimmt mit ihnen eine Reise in deren Inneres. Sie zeigt den Liebenden die Grenzen ihrer bürgerlichen Begrenztheit auf, die von diesen durchaus gesehen und auch akzeptiert werden. Wir haben es hier gleichsam mit einem von Alfonso und Despina inszenierten Selbstfindungstrip der jungen Leute zu tun, denen die Möglichkeiten psychischer Selbstbefreiung aus bourgeoisen Ketten vor Augen geführt werden. Diese ausgedehnte Exkursion in tiefe seelische Gefilde ist mit einem Bruch der Realität verbunden. Das Geschehen nimmt in immer stärkerem Maße surrealistische Züge an. Es ist gleichsam eine Gratwanderung zwischen Traum und Wachen, die die Paare hier vollführen, krassem Realismus korrespondieren visionäre Impressionen. Nachhaltig wird zwischen zwei Bewusstseinsterrains hin und her gependelt, die indes beide durch die doppelbödige Musik auf recht ironische Weise als illusionär entlarvt werden. Zwischen beiden Ebenen gilt es einen Ausgleich zu finden.

Irina Simmes (Fiordiligi)
Es sind insbesondere die im Inneren der Menschen verborgenen Seiten, die Frau Loschky an erster Stelle interessieren. Gekonnt stößt sie bis in die tiefsten Abgründe der menschlichen Psyche vor, deren Auswüchse sie schonungslos aufdeckt. Es sind insgesamt nicht äußere Aspekte, auf die sie das Hauptaugenmerk legt, sondern die vielfältigen Masken, die in ihrer Interpretation weniger gegenständlicher Natur sind, sondern Ausfluss eines inneren Versteckspieles der Beteiligten. Die Larven, von denen jeder eine Vielzahl in sich birgt, stellen gleichsam verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung der jeweiligen Lebensbahn dar. Die Wahl des Weges steht den Protagonisten frei. Was für einen Pfad sie verfolgen und welche Abzweigungen sie im Einzelfall nehmen, ist ganz in ihr Belieben gestellt. Wichtig ist dabei nur, dass sie dabei immer sie selbst bleiben. Aufrichtigkeit gegenüber dem eigenen Ich wird in diesem Kontext ganz groß geschrieben, denn nur sie führt letztlich zur Befreiung aus den seelischen Abgründen und damit zur notwenigen Selbsterkenntnis. Konsequenterweise entdecken die Teilnehmer des Versuches auch immer mehr Seiten an sich, die ihnen bisher gänzlich unbekannt waren. Die Masken verhüllen ihre Gesichter in Wirklichkeit nicht, sondern bringen ganz im Gegenteil ihr wahres Wesen zum Vorschein. Was zuerst noch Spiel ist, wird Wahrheit. Damit geht eine zunehmend stärker wirkende Unmittelbarkeit der Emotionen Hand in Hand. Die Handlungsträger lernen, mit sich selbst umzugehen und sich nicht mehr von einem irgendwie gearteten gesellschaftlichen Normen- und Regelwerk beherrschen zu lassen. Ihre ausgeprägten Gefühle sind nur ein Vehikel zur Auflehnung gegen überkommene Konventionen. Diese Fahrt in das menschliche Ich ist aber nicht ungefährlich.

Marija Ramanovic (Dorabella)
Über die Risikobehaftung ihrer inneren Reise sind sich die Paare zumindest unterbewusst durchaus im Klaren. Sogar Don Alfonso und Despina als spiritus rectores des Geschehens erkennen in immer stärker werdendem Maße die Bedrohlichkeit ihres Unternehmens. Während Fiordiligi, Dorabella, Ferrando und Guglielmo sich gewissermaßen ein kindliches Gemüt bewahrt haben, geht ein solches dem alten Paar gänzlich ab. Dessen an den Tag gelegter Zynismus ist ebenfalls eine Maske, nämlich die verborgene Sehnsucht nach der Jugend. Die Liebeshändel der jungen Leute sind für Don Alfonso und Despina eine letzte Möglichkeit, mittelbar die Emotionen zu erleben, zu denen sie selber altersbedingt nicht mehr in der Lage sind. Aus der Partizipation an den Gefühlen der Liebenden suchen sie neue Kraft zu gewinnen, was indes nur halb gelingt. Zunehmend verselbständig sich die von ihnen kreierte Versuchsanordnung, entgleiten die Fäden ihren Händen. Das merkt Despina noch vor Don Alfonso, der bis zum Schluss verzweifelt versucht, das Experiment zu retten. Für sämtliche Beteiligte gilt, dass sie meinen, alle aufgeworfenen Probleme gleichsam mit links lösen zu können und an dieser Überheblichkeit schließlich scheitern. Nadja Loschky misstraut dann auch dem von Mozart und da Ponte vorgesehenen Happy End und lässt den Abend äußerst pessimistisch ausklingen. Dass die Protagonisten bis an ihr Lebensende unter den Geschehnissen leiden müssen, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Kann sein, dass sich bei ihnen auch eine Psychose entwickeln wird. Sicher ist, dass sie einmal in die Fußstapfen des alten Paars treten werden. Wenn beispielsweise der von der Untreue Fiordiligis gänzlich desillusionierte Guglielmo auf einmal in ähnlichen Kleidern wie Don Alfonso und wie dieser mit halb entblößtem Oberkörper auftritt, wird ersichtlich, dass er von der Regisseurin als würdiger Nachfolger des alten Philosophen ins Auge gefasst wird. Das Schlusstableau ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Freundschaften und familiäre Beziehungen haben einen irreparablen Schaden genommen. Auch in dem weiteren Leben der beteiligten Personen wird der Gegensatz zwischen Schein und Sein wohl eine erhebliche Rolle spielen. Das alles wurde von Frau Loschky, die ihren Freud ganz offensichtlich aufmerksam studiert hat, sehr überzeugend und hoch innovativ umgesetzt. Augenzwinkernd hielt sie dabei dem Publikum den sprichwörtlichen Spiegel vor. Die aufgezeigten Konflikte betreffen jeden. Wo einzelne kleine Teile des Librettos ihrem überzeugenden Konzept nicht entsprachen, wurden diese kurzerhand eliminiert, wie z. B. der erste Auftritt von Despina. Auch der Chor fiel dem Rotstift zum Opfer. „Bella vita militar“ wurde nur vom Orchester gespielt.

Irina Simmes (Fiordiligi)
Gesanglich hinterließ die Premiere gemischte Gefühle. Am Premierentag hatte der Krankheitsteufel im Heidelberger Theater zugeschlagen. Erwischt hatte es Wilfried Staber, den Sänger des Don Alfonso. Bereits im ersten Akt, in dem sein gut gestützter, markant geführter Bass merkbar belegt klang, wurde deutlich, dass sich der Sänger, der sich nach der Pause dann auch ansagen ließ, nicht in Bestform befand. Er hielt aber stimmlich trotz der Indisposition gut durch und vermochte schauspielerisch zu begeistern. Darstellerisch blieben auch bei KS Carolyn Franks Despina keine Wünsche offen, sehr wohl aber stimmlich. Ihr nicht gerade mehr taufrischer Mezzosopran saß stark im Hals und wies praktisch gar keine solide Klangkultur mehr auf. Daraus resultierten oft ziemlich schrille Spitzentöne. Auch Irina Simmes hat man schon besser gehört. Wie immer wunderbar war ihre sonore, farbenreiche und emotional eingefärbte Mittellage. In der Höhe neigte sie an diesem Abend aber leider manchmal dazu, vom Körper wegzugehen. Und im unteren Stimmbereich, in dem sie nicht immer gut zu hören war, ist ihr Sopran in puncto Klangvolumen noch ausbaufähig. Lediglich über dünnes, einer soliden tiefen Stütze entbehrendes Tenormaterial verfügte Namwon Huh in der Rolle des Ferrando. Einen trefflichen Eindruck hinterließ Marija Jokovic, die einen in allen Lagen gut fokussierten und tiefgründigen Mezzosopran für die Dorabella mitbrachte. Die Krone der Aufführung gebührte Ipca Ramanovic, der als stimmkräftig und mit bester italienischer Technik singender Guglielmo eine Glanzleistung erbrachte. Man würde ihn gerne einmal mit einer Rolle Verdis oder Puccinis erleben.
Bereits während des Vorspieles wurde offenkundig, dass der Abend auch vom Musikalischen her etwas anders ausfallen würde als man es sonst gewohnt ist. Gad Kadosh animierte das beherzt aufspielende Philharmonische Orchester Heidelberg zu einem markanten, robusten und forschen Mozart-Klang in recht zügigen Tempi, der im weiteren Verlauf des Abends aber etwas delikater und feinfühliger wurde. Insgesamt passte die Auffassung des Dirigenten von Mozarts Partitur gut zum Ansatzpunkt der Regie.
Fazit: Das war spannungsgeladenes, gut durchdachtes und psychologisch ausgefeiltes Musiktheater, dessen Besuch zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 11. 5. 2014 Die Bilder stammen von Florian Merdes.
Christian Jost (*1963)
RUMOR
Am Anfang und am Ende ein Mord – mehr als ein veroperter Vorabendkrimi
Christian Jost, nicht nur Komponist, sondern auch Kino-Liebhaber, hatte den Roman „Der süße Duft des Todes“ des Drehbuchautors Guillermo Arriaga („Babel“, „Amores Perros“ und „21 Gramm“) gelesen und war davon unmittelbar als Opernstoff angetan. In Zusammenarbeit mit dem Romanautor verfasste er das Libretto und heraus kam ... ein Drehbuch als Folge von fünfzehn Szenen, die zum Teil wie Überblendungen aneinandergereiht sind, mit sehr reduzierten, teilweise lapidaren Dialogen. Jost schrieb die Oper als Auftragswerk für die Vlaamse Opera; am 23.03.2012 wurde sie in Antwerpen uraufgeführt und erhielt eine begeisterte Aufnahme. Denn das Werk – bei aller Modernität der Dramaturgie – enthält, was eine Oper enthalten soll: eine Geschichte mit dramatischer Spannung, verständliche Musik, die stringent mit dem Geschehen einher geht und viele Worte ersetzt, dazu einen Text, der so auf die Musik gesetzt ist (und umgekehrt), dass eine erstaunlicher Textverständlichkeit herauskommt. Jost bleibt mit dem Stoff und seiner Realisierung nahe beim Kinofilm (auch beim zeitlichen Format von gut 100 Minuten ohne Pause), bringt Oper mit einem zeitgemäßen Thema zusammen, das in einer Zeitung irgendwo zwischen Regionalem und Vermischtem abgehandelt würde, und unterscheidet sich so allein thematisch von den anderen zeitgenössischen Opernkomponisten mit ihren historischen Themen. Nun brachte das Theater Heidelberg Rumor in deutscher Erstaufführung heraus.

Totale, Chor
Der Komponist betont, dass seine Oper keinen spezifischen Spielort braucht, wohl aber ein soziokulturelles Umfeld. Ursprünglich aber ist die Handlung in einem mexikanischen Dorf angesiedelt. Adela, ein junges Mädchen, wird ermordet, niemand hat etwas gesehen oder gehört, aber in der kleinen Gemeinschaft bilden sich schnell Gerüchte (rumor!), wer, was, wie hätte sein können. Ramón, heimlich in sie verliebt, betrauert die Tote, die Dorfgemeinschaft stilisiert ihn zu ihrem Liebhaber. Alle anderen Figuren haben keine Namen, sondern werden durch ihre Erscheinungsformen benannt. Das ist die „Geliebte“, eine verheiratete Frau des Orts, die ein Verhältnis mit dem „Fremden“ hat, der ab und zu im Ort auftaucht. „Der Alte“ ist der Polizeiinspektor, der das Verbrechen aufklären will, aber nicht so recht weiterkommt („Die Spuren ergeben ein Durcheinander“); er ist aber dem Kern der Sache sehr nahe gekommen.

Wilfried Staber (Der Alte), Amélie Saadia (Die Gefährtin), Nico Wouterse (Schlachter)
Neben dem Krimi wird ein Sittenbild einer dörflichen Gemeinschaft gezeichnet. Die Stimmung wendet sich gegen den „Fremden“. „Schlachter“, Jäger“ und „Gefährtin“ werden zu Exponenten der Volksmeinung. Sie zwingen Ramón, an dem vermeintlichen Mörder Rache zu nehmen, und zeigen ihm, wie der tödliche Streich gegen den „Fremden“ zu führen sei. Dieser, obwohl gewarnt, hält sich für ebenso unwiderstehlich wie stark, hat sich aber getäuscht: mit einem weiteren Mord endet so die Oper. Diese lineare Handlung mit offen gelassenem Ende ist der Oper unterlegt. Anstelle dramaturgischer Verwicklungen gibt es Zeitrücksprünge in die Vergangenheit: was war, was hätte sein können; die Rückblendungen erfolgen nicht nur in die vergangene Realität, sondern auch in eine geträumte Vergangenheit. Daraus saugt der Stoff seine Spannung. In den Rückblenden ersteht Adela wieder bis zu ihrem erneuten Tod. Christian Jost: „eine Oper, in der aus Illusion Wahrheit wird, Gerüchte zu Tatsachen werden, Lust und Begehren in eine Treibjagd müden, ein Todesengel noch einmal sterben muss“.

Namwon Huh (Ramón)
Das Libretto enthält keine szenischen Anweisungen. Vielleicht weil der Komponist die nicht für notwendig hält, da er sehr Konkretes gar nicht anstrebt – oder weil er weiß, dass sich die Regisseure heute daran sowieso nicht halten. Cum grano salis gelingt es dem Regisseur Lorenzo Fioroni, das Geschehen verständlich auf die Bühne zu bringen – aber auch nicht ohne ein paar seiner üblichen „Fioronis“, die komplizierend und wenig erhellend sind. Von Ralf Käselau lässt er sich ein sehr detailfreudiges Bühnenbild bauen. Es ist ein grob zusammengezimmerter Tanzboden mit Schanktisch zwischen Dorf und Wald vor mitteleuropäischer Mittelgebirgskulisse; alles heftig vermüllt wie nach einer Dorffeier (und vielen Operninszenierungen) üblich. Daneben steht die Datsche der „Geliebten“, in der sie den „Fremden“ empfängt. Durch Drehen der Elemente können in schneller Folge die einzelnen Szenenbilder entstehen. Dazu gibt es seitlich noch einen Hochstand, der mal dem Auftreten von „Jäger“, „Schlachter“ und „Gefährtin“ dient; ein andermal als Kapelle mit lauter Votivbildern behängt der „Geliebten“ einen Rückzugsort für Betrachtung und Reue gewährt. Sabine Blickenstorfer hat das Volk und die Akteure in ein buntes Gemisch von zeitgenössischer Bekleidung gesteckt. Dass die teilweise wattierte Wetterkleidung tragen, während mehr als einmal im Text von großer Hitze und ausbleibendem Regen die Rede ist, ist so ein „Fioroni“ – ebenso die Tatsache, dass sich in einer Szene alle mit entsprechenden Kopfbedeckungen als amerikanische Westler verkleiden und dass über der ganzen Szenierie (cvon hinten zu lesen) in Großbuchstaben TWISTER steht. Aber es gelingt Fioroni gut, das unterschwellige Unwohlsein zu zeigen, welches das soziale Ambiente der Dorfgemeinschaft und ihrer Exponenten erzeugt; dazu hätte es nicht der anonymisierenden Papiertüten bedurft, die man sich gelegentlich über den Kopf zieht.

Irena Simmes (Adela)
Musikalisch ließ der Abend keine Wünsche offen. Das Philharmonische Orchester Heidelberg musizierte unter der Leitung seines bulgarischen GMD Yordan Kamdzahlov in recht großer Besetzung. Zeitgenössische Musik hat Jost per definitionem komponiert; das äußerte sich vor allem zu Beginn in ein paar schrillen Dissonanzen, ehe sich die wenig neutönerische Musik Besinnung auf ihr postromantisches Fundament besann, allerdings mit den Zutaten moderner Stilistik wie prononcierten Glissandi aller geeigneten Instrumente, Vierteltonschritten und natürlich einer modernen Satz- und Instrumentierungstechnik, die für ein opulentes Klangereignis nicht mehr so viele Instrumente braucht, um einen dichten Tonsatz zu erzeugen. Plastisch-programmatische Begleitung, emotional teilweise wie Filmmusik oder überkommene große Oper ansprechend und durchaus inspiriert sind hervorstechende Elemente dieser streckenweise süffigen Orchestermusik. Das ist das Gegenteil von absoluter Musik, wie sie die akademische Avantgarde im Sinn hatte und deswegen nie mit Opern reüssieren konnte. Das Heidelberger Orchester spielte hochkonzentriert und ohne hörbare Wackler auf. Klangschön auch der von Jan Schweiger und Anna Töller einstudierte Opernchor. Dass der in doppelter Stärke wie vom Komponisten vorgeschrieben auftrat, bot der Regie bei der Bewegung wesentlich mehr Möglichkeiten.

der letzte Mord: James Homan (Der Fremde), Adela II (stumm), Namwon Huh (Ramón); vorne liegend: Irena Simmes (Adela)
Theaterwirksam auch der Satz für die Vokalstimmen. Insgesamt elf Solisten (für dreizehn Rollen) wurden bis auf eine Ausnahme aus dem Heidelberger Ensemble besetzt. Ihre Partien sind in vielfach kantabler Linienführung singbar, die Stimmlagen der Partien charakteristisch (und klassisch) abgesetzt. Namwon Huhs lyrischer Tenor war für die Rolle des Ramón besetzt. Stahlige Klarheit, sehr gute Diktion, Höhenfestigkeit, aber auch eine gewisse Enge bei Spitzentönen charakterisierten seinen Gesang. Mit James Homann stand für die Rolle des Fremden ein weich ansprechender, voluminöser, kultivierter Bariton zur Verfügung. Die streckenweise sehr tief gesetzte Rolle des Alten fand in Wilfried Stabers kernigem, donnerndem Bass ihre prächtige volltönende Umsetzung. Als Gast gab Nico Wouterse mit kräftig-dunklem Bassbariton den Schlachter; den Jäger sang Winfrid Mikus mit eher dunklem Charaktertenor. Als Adela war von der Bühnenerscheinung idealtypisch die junge Irina Simmes besetzt, die mit ihrem sehr hellen klaren Sopran zu gefallen wusste – nicht ohne kleine Schärfen bei den Spitzentönen. Die Geliebte sang mit rundem, schön geführtem und gut fokussiertem Mezzo Anna Peshes. Eine weitere Mezzo-Rolle, die der Gefährtin, war mit Amélie Saadia besetzt, die neben ihrem schönen schlanken Stimmmaterial durch ihr quirliges Spiel gefiel.
Sehr herzlicher, lang anhaltender Beifall aus dem vollen Hause für alle Mitwirkenden und auch für den anwesenden Komponisten bewies, dass zeitgenössische Oper heute ohne Vorbehalte angenommen wird – mindestens als Abwechslung von dem großen Repertoireeinheitsbrei, den man überall zu sehen bekommt. Dass gerade die kleineren Theater im Hier und Heute in dieser Beziehung die entscheidende Rolle spielen, muss nicht auch nur großen Musentempeln und deren Direktübertragungen im Fernsehen aus dem Weg gehen möchte. Mit weiteren Terminen vom 28.03. bis zum 18.05. wird Rumor insgesamt sechsmal gegeben. Man kann gespannt sein, welches Haus sich als nächstes des Werks annimmt.
Manfred Langer, 22.03.2014 Fotos: Florian Merdes
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere: 23. 1. 2014
Aufrechterhaltung von Fassaden
Es war wieder einmal ein ausgezeichneter Opernabend, die Premiere von Verdis „Un Ballo in Maschera“ am Theater der Stadt Heidelberg. Aber dass dieses grandiose Opernhaus von nur mittlerer Größe ein Garant für hohe Qualität ist, weiß man ja schon lange. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass sich eine Fahrt nach Heidelberg lohnt. So auch dieses Mal. Eine hervorragende modern-innovative Regie und ausgezeichnete Sängerleistungen ließen diesen gelungenen Abend zu einem Ereignis werden.

Gut durchdacht und technisch versiert umgesetzt war bereits die Inszenierung von Yona Kim. Sie machte aus Verdis Werk kein Ausstattungsstück, sondern legte den Focus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Nora Lau hat ihr einen kargen, bis auf Riccardos Herrscherstuhl völlig leeren Gedankenraum auf die Bühne gestellt, in dem nichts von den starken Emotionen der handelnden Personen ablenkt. Erst zum Schluss hin wandelt sich die Szene zu einem prunkvollen Saal, in dem der Maskenball stattfindet. In diesem Ambiente wird die dramatische Handlung von der Regisseurin abwechslungsreich und stringent in Szene gesetzt. Einfühlsam nimmt sie den Zuschauer bei der Hand und begibt sich mit ihm auf die Suche nach dem dramatischen Zentrum, in dem die einzelnen Handlungsstränge zusammenlaufen. Dabei legt sie das Hauptgewicht ihrer Betrachtungen auf die zahlreichen Ambivalenzen, die Verdis Oper aufweist, und lässt zudem stark die Lehren eines Bertolt Brecht und Tschechow’sche Elemente in ihre Deutung mit einfließen, wodurch die Spannung noch erhöh t wird. Den neugierigen Intellekt hat ihre einige neue Aspekte aufweisende Interpretation voll und ganz befriedigt.

Den konzeptionellen Ansatzpunkt Frau Kims bildet der Begriff der Maske. Diesen versteht die Regisseurin nicht gegenständlich, sondern nimmt ihn gekonnt unter die psychologische Lupe. Das ganze Leben ist bei ihr nur eine Larve. Sämtliche am Geschehen beteiligte Personen tragen eine Maske. Das beginnt schon bei Riccardo, der nur äußerlich einen impulsiven Herrscher abgibt. In seinen privaten Momenten wirkt er dagegen ausgesprochen introvertiert. Er kann nicht gut allein sein und sucht deswegen die Abwechslung bringende Gefahr. Er ist kein wirklich starker Staatsführer und weiß, dass sein Thron auf wackligen Beinen steht. Deswegen setzt er seine Vertraute Ulrica als Spionin in der Maske einer Wahrsagerin ein, um die wahren Gedanken sowohl des Hofstaates als auch des Volkes zu ergründen. Dass er ihr genau in dem Moment, in dem sie wirklich etwas für ihn Lebensbedrohliches entdeckt, nicht glaubt, wächst sich zu seiner ganz persönlichen Haupttragik aus. Im Schlussakt verwandelt sich Ulrica in gleicher Weise zu einem Alter Ego Riccardos - das wird durch die von Hugo Holger Schneider kreierten identischen Kostüme klar ersichtlich - wie Oscar, der hier zu einer ihren Herrn aufrichtig liebenden Frau umgedeutet wird, die ihre eigentliche Einsamkeit durch diese Beziehung zu kaschieren versucht.

Man sieht: Aus mannigfaltigen Nöten und Konflikten verschiedenster Art versuchen die Handlungsträger ihre wahren Gedanken und Gefühle zu verbergen. Alles Äußere ist nur eine Fassade, die es zum Zwecke des Selbstschutzes heraus aufrechtzuerhalten gilt. Dieses von Larven bestimmte politische System wird von Yona Kim gekonnt mit dem Theater auf eine Stufe gestellt, in dem ebenfalls alles nur eine einzige große Maskerade ist. Das wird offenkundig, wenn man im zweiten Akt Amelia in Form einer riesigen Videoprojektion durch das Heidelberger Theater wandeln und schließlich aus dem Rang heraus die Bühne betreten sieht. Bei dem anschließenden großen Liebesduett verharren die Liebenden vor einem Zwischenvorhang auf entgegengesetzten Seiten der Vorderbühne. Die äußere Distanz zwischen ihnen betont ihren Willen, sich nicht aufeinander einzulassen. Schließlich nähern sie sich aber doch einander an, mag sich Amelias Ehemann Renato auch betrogen fühlen. Der schreckliche Verdacht des Ehebruches seiner Frau lässt auch ihn die Maske des treuen, verantwortungsbewussten Freundes ablegen und seine wahren, stürmischen Gefühle zum Ausdruck bringen. Es gibt hier praktisch keine Person, die sich nicht irgendwie verstellt. Erst der eigentliche Maskenball, bei dem die vorher modern gekleideten Handlungsträger in prachtvollen, traditionell anmutenden Verkleidungen erscheinen, lässt die Larven schließlich sowohl in realer als auch in symbolischer Hinsicht fallen. Das Versteckspiel endet und es zeigt sich jeder, wie er ist. An die Stelle des Scheins tritt nun das Sein.

Ein Hochgenuss war es, den Sängern/innen zuzuhören. Wieder einmal wurde offensichtlich, was für ein hervorragendes Ensemble der erfolgreiche Operndirektor Heribert Germeshausen doch engagiert hat. Von den durchweg ausgezeichneten Solisten hat fast jeder das Zeug zu einer großen Karriere. Angus Wood hat die verschiedenen Gefühlzustände des Riccardo mit hoher schauspielerischer Kraft intensiv und einfühlsam vermittelt. Auch stimmlich erwies er sicht mit seinem kräftigen, bestens sitzenden und ausdrucksstarken italienischen Heldentenor als hervorragende Besetzung für den Gouverneur von Boston. Neben ihm lief Hye-Sung Na in der Partie der Amelia zu ganz großer Form auf. Bei dieser jungen, über gut focussiertes Sopranmaterial italienischer Schulung verfügenden Sängerin war es insbesondere die große Emotionalität ihres Ausdrucks, was einen ganz nachhaltigen Eindruck hinterließ. Ihr inbrünstig gesungenes „Morrò, ma prima in grazia“ war ein Höhepunkt der Aufführung. Einen ebenfalls vorbildlich italienisch fundierten, klaren und prägnanten Bariton brachte Matias Tosi für den Renato mit. Über weite Strecken erwies er sich als guter Vertreter seines Parts. Leider hat er bei den enormen Längen der Legatobögen des „O dolcezze perdute! O memoriere“ etwas zu oft geatmet, wodurch die Gesangslinie zerstückelt wurde. Dafür entschädigte bald darauf ein lang ausgehaltenes, kraftvolles hohes ‚g’. Mit tiefgründig und profund geführtem Mezzosopran verlieh Anna Peshes der Ulrica hohe vokale Autorität. Auch darstellerisch hat sie die neue Auffassung der Regie von ihrer Rolle überzeugend umgesetzt. Einfach umwerfend präsentierte sich als Oscar Sharleen Joynt, deren Bemühungen um eine tiefere Stütze ihres wohlklingenden, flexiblen Soprans offensichtlich von Erfolg gekrönt waren. Mit kernigen Bassstimmen statteten Wilfried Staber und Michael Zahn die beiden Verschwörer Samuel und Tom aus. Sonor präsentierte sich Zachary Wilsons Silvano. Für den Richter brachte Sang-Hoon Lee erheblich besser verankertes Tenormaterial mit, als man es bei dieser winzigen Rolle sonst gewohnt ist. Den Diener Amelias gab Dagang Zhang. Bestens disponiert zeigte sich der von Jan Schweiger, Anna Töller und Ursula Stigloher einstudierte Chor.

Dietger Holm und das Philharmonische Orchester Heidelberg erbrachten insgesamt eine solide Leistung. Indes hätte man sich manchmal etwas mehr Italianita und Rauschhaltigkeit des von ihnen erzeugten Klangteppichs gewünscht.
Fazit: Eine in szenischer und gesanglicher Hinsicht sehr zu empfehlende Aufführung, deren Besuch jedem Opernfreund nachhaltig ans Herz gelegt wird.
Ludwig Steinbach 25.1. 2014 (c) Bilder Florian Merdes
Winter in Schwetzingen 2013/2014 Veranstaltung von Theater und Orchester Heidelberg
Ausgrabung auf modern
IPHIGENIE AUF TAURIS
Ifigenia in Tauride Tommaso Traetta (1727 - 1779)
Aufführung im Rokokotheater Schwetzingen
Premiere am 15.12.2013
Kritik unter Schwetzingen
In jeder Spielzeit produziert Theater und Orchester Heidelberg für Winterbarockfest im Rokokotheater Schwetzingen eine Barockoper.
Besprechungen älterer Aufführungen in unseren Archivseiten unten unter Heidelberg - ohne Bilder