OPER LEIPZIG

GÖTTERDÄMMERUNG
Vorstellung am 10.7.2022 (Premiere am 30.4.2016)
Eine durchwachsene Aufführung
Die vom Tanz kommende Regisseurin Rosamund Gilmore blieb ihrem Konzept treu, indem sie das Bühnengeschehen durch Tänzer und Statisten aufmotzte. Ob als Ross Grane, oder als die beiden Raben von Wotan, Hugin und Munin, ob als Kammermädchen mit Widderhörnern bzw. Kellner in Livree, die mythischen Figuren sind omnipräsent. Das Einheitsbühnenbild Carl Friedrich Oberle stellte eine graue Halle mit fünf Säulen dar, aus der die germanischen Hauptgötter Wotan, Donner, Froh, Fricka und Freia von Zeit zu Zeit erscheinen und hilfesuchend nach oben stieren. Michael Rögers Lichtregie ermöglicht es den Zuschauern, dabei, abgegrenzte Schauplätze zu erkennen. Im Hintergrund gibt eine riesige Glasfassade den Blick auf den Rhein frei. Die drei Nornen lösen sich aus einer Gruppe mythischer Figuren und knüpfen mit Unterstützung dieser das Seil um zwei Säulen. Die Edda verrät uns ihre Namen, die im Personal der Götterdämmerung nur durchnummeriert werden. Es handelt sich um Urð, Verðandi und Skuld, deren Namen auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft verweisen und im Vorspiel erzählen sie auch, was bisher geschah und noch geschieht. Die dritte Norn schließlich erschaut dann das Ende der Götter im brennenden Walhall. Doch die Visionen verschwimmen und das Seil reißt, womit ewiges Wissen für immer endet!

Die zweite Szene des Vorspiels spielt auf einem Balkon, der den Felsen Brünnhildes symbolisieren soll. Im ersten Akt rollen dann Tänzer einen weißen Konzertflügel im Zeitlupentempo in die Gibichungenhalle. Dieser fungiert dann im dritten Aufzug als Aufbahrungspodest für Siegfried und später als Scheiterhaufen, den Brünnhilde in ihrem Schlussgesang besteigt. Für den Speerschwur im zweiten Akt muss ein Stilett herhalten, das Hagen wie selbstverständlich bei sich im Gewand trägt. Mit diesem ersticht er dann auch Siegfried im dritten Aufzug, der auf einem Hirschkadaver liegend von der Bühne gezogen wird. Die beige gekleideten uniformierten Mannen Hagens tragen alle, mit Ausnahme eines, ein Barrett und rufen so Assoziationen an dunkle SA-schwangere Zeiten hervor. Nachdem Hagen auf der Szene erscheint, fand der ohne Kappe singende Chorist noch rasch Gelegenheit seine Mütze aufzusetzen. Dieser humorvolle Fauxpas erinnerte mich an die Gegenwart, wo manchen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Ende der Oper versinkt der feuerrot leuchtende Flügel, auf dem Siegfried und Brünnhilde liegen, zusammen mit dem gesamten Personal, während schwarze Tücher vom Schnürboden fallen. Die Rheintöchter freuen sich über den wiedergewonnenen Ring und reißen Hagen mit sich in die Tiefen des Rheins.

Ulf Schirmer leitete das Gewandhausorchester umsichtig und mit äußerster Präzision. An einigen Stellen gelang es dem Orchester unter seiner Stabsführung spannende Bögen voller Expressivität aufzubauen, andere Passagen wiederum erklingen fast kammermusikalisch intim. Über kleinere Mängel bei den Blechbläsern und bei den auf der Bühne zum Einsatz gebrachten und extra für diese Aufführung angefertigten Stierhörner, die an Alphörner erinnern, die aber nach unten nicht gebogen sind und deshalb waagrecht geblasen werden müssen. Dazu sind pro Horn zwei Mann nötig. Sie verstärken die Basstuba im Orchestergraben kann man bei diesem Ringmarathon wohlwollend hinwegsehen. Stefan Vinke als Siegfried gab einen Helden mit strahlender Leuchtkraft seines höhensicheren Tenors. Auch darstellerisch überzeugte er als etwas dümmlicher, leicht verführbarer Wälsungenspross. Die Götterdämmerung-Brünnhilde gehört zu den wohl schwierigsten Partien im hochdramatischen Fach. Der Sopran von Lise Lindstrom als Brünnhilde hörte sich über weite Strecken gequält an. Ihre flackernde Stimme wirkte oft ermüdet, was an ihrer wackligen Intonation hörbar war.

Kathrin Göring sorgte als Waltraute für den gesanglichen und darstellerischen Höhepunkt im ersten Akt. Kaum zu verstehen, dass sie bei ihrem eindringlichen und fordernden Mezzosopran den Ring für die Rheintöchter nicht zurückgewinnen konnte. Der finnische Bassbariton Tuomas Pursio sang mit markanter, gewohnt rauer Stimme einen koksenden Gunther mit Sauerberkeitswahn. Imposant von der Statur wie von der Stimme war der ukrainische Bass Taras Shtonda als Hagen. Aufmerksam lauerte der intrigante Nibelungensohn mit dämonischer Heimtücke auf die passende Gelegenheit, seinen Halbbruder Gunther und dessen Schwester Gutrune für das verhängnisvolle Ränkespiel um die Gunst Siegfrieds und die Eroberung Brünnhildes zu verführen. Als Gutrune gab es ein freudiges Wiedersehen mit der US-amerikanischen Sopranistin Emily Magee. Die von allen gedemütigte und wie eine Ware in einer Vitrine ausgestellte Gibichungentochter wird zum willigen Spielball ihre Brüder. Am Ende ist sie völlig gebrochen als der tote Siegfried vorgeführt wird und kurz darauf ihr Bruder Gunther von Hagen getötet wird. Erst jetzt durchschaut sie die Täuschungen ihres Halbbruders Hagen und schreitet resigniert nach dem Bühnenhintergrund zu. Christiane Döcker sang die erste Norn, Karin Lovelius die 2. Norn, beide mit herrlichem Mezzosopran. Magdalena Hinterdobler ergänzte dieses Terzett als 3. Norn mit glockenhellem Sopran. Das Trio der Rheintöchter mit Olga Jelínková, Sandra Maxheimer und Sandra Janke sang ausgewogen ohne hörbare Abstriche. Der Belgier Werner Van Mechelen gefiel als der von seinem Sohn Hagen im Halbschlaf hinters Licht geführte Schwarzalberich mit erdigem Bassbariton. Der Männerchor der Oper Leipzig war von Thomas Eitler-de Lint bestens einstudiert. Einziger Wermutstropfen dieser Götterdämmerung blieb das häufige Rampenstehen der Sänger. Falls von der Regisseurin so verordnet, bleibt es der künstlerischen Freiheit der Sängerinnen und Sänger überlassen, hier eine bessere Interpretation zu finden. Manchmal würde das dieser „Inszenierung“ schon zugutekommen! Begeisterter Applaus beendete diesen Ringmarathon, zu dem auch das gesamte Orchester auf der Bühne erschien.
Harald Lacina / 12.7.22
Fotos: Tom Schulze
SIEGFRIED
9.7.2022 (Premiere am 12.4.2015)
Ein kurzweiliger Abend

Man kann darüber streiten, ob „Siegfried“ der schwächste Teil der Tetralogie ist, muss aber bedenken, dass Wagner das Modell der Tetralogie auf den vorhandenen altgriechischen Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides aufbaute und ein Teil daher folgerichtig als Satyrspiel fungiert. Bei Richard Wagner ist es der ursprünglich „Der junge Siegfried“ genannte 3. Teil. Dieser war zunächst wesentlich kürzer war. Durch Einfügung der Wissenswette im ersten Aufzug hat der Komponist aber das Werk „gestreckt“. Psychologisch betrachtet handelt es sich um eine „Initiationsgeschichte“ (so der Dramaturg Christian Geltinger) eines jungen, elternlosen Helden auf der Suche nach seiner Identität, zugleich aber auch eine „groteske Satire auf das Streben des Menschen nach Macht und Besitz.“

Die Diskrepanz zwischen Macht und Liebe scheint In der Begegnung von Siegfried und Brünnhilde für einen kurzen Moment aufgehoben zu sein und die „Utopie einer besseren Welt“ aufzuleuchten. Während es bei Tristan und Isolde „O sinke nieder Nacht der Liebe“ heißt, beleuchtet das strahlende, blendende Licht der Sonne diese aufkeimende Liebe. Die Regisseurin und Choreografin Rosamund Gilmore bleibt ihrem Stil treu und versucht mit Brachialgewalt diese an sich handlungsarme Oper mit ihren Tänzern zu beleben. Das Bühnenbild von Carl Friedrich Oberle bestand im ersten Akt aus drei großen Betonelemente mit Öffnungen. Siegfried tritt mit Latzhose auf, um dem Publikum „Jugend“ vorzugaukeln. Der Bär, den er mit sich führt, erweist sich als Tänzer, der sein Kostüm schließlich Mime aushändigt. Die übrigen Tänzer schossen während der Rätselsszene wie Würmer aus einer grünen Wiese, die sich hinter der angeramschten Behausung von Mime befindet. Eine gewollte Bebilderung der Rätsel konnte ich beim besten Willen darin nicht erkennen. Mime bricht auf einem Damenfahrrad mit Siegfried nach Fafners Höhle auf. Im zweiten Aufzug stehen nur mehr zwei Betonelemente auf der Bühne, verbunden mit einer efeuumrankten Brücke. Szenischer Höhepunkt des zweiten Aufzugs war der Auftritt Fafners in der überlebensgroßen Puppe eines Bankiers, gekleidet im englischen Tweed mit Top Hat wie im ersten Akt auf einem riesigen roten Samtsofa.

Um ihn herum wuseln viele kleine Fafner-Bankiers wie Klone und bilden so den Leib des Wurms. Der Waldvogel wird, wie allgemeiner Usus in vielen Inszenierungen der Gegenwart, von einer tanzenden Ballerina im Federkleid (Sandra Lommerzheim) dargestellt und hinter der Bühne gesungen. Im dritten Aufzug sitzt der Wanderer auf den Stufen einer verkohlten Turmruine aus deren Fundament Erda in Begleitung der drei Nornen herauskriecht. Nachdem Siegfried den Speer seines Großvaters Wotan zerspellt hat, dreht sich die Bühne und wir erblicken wieder den Brünnhildenfelsen, der durch eine Plattform angedeutet wird und die dreistöckige geneigte Wand aus dem Ende der Walküre, welche dem neoklassizistischen Palazzo della Civiltà Italiana nachempfunden ist. Siegfried erweckt Brünnhilde durch einen Kuss aus ihrem komatösen Schlaf und stellt dabei völlig überrascht fest, dass diese „kein Mann“ ist! Diese Szene barg für mich schon immer den größten Humor, zu dem Wagner, abgesehen vom „Liebesverbot“, überhaupt fähig war. Das finale Duett wird von einem als Grane verkleideten Tänzer begleitet, während Tänzer mit ekstatischen Bewegungen das Liebespaar umrunden. Das Dirigat von Ulf Schirmer ist durchwachsen. Epische Breite beherrscht große Teile des ersten und zweiten Aktes. Erst im dritten Akt blüht das Gewandhausorchester unter seinem Dirigat zu einem spannenden Furioso auf. Weiche Streicherpassagen wechselten einander gekonnt mit den tiefen Blechbläsern, die Fafner ankündigen, ab. Dem 1962 geborenen US-amerikanischen Tenor Stephen Gould gelang es darstellerisch halbwegs einen jugendlichen, sich im Selbstfindungsprozess befindlichen Knaben darzustellen. Mit seinem Heldentenor konnte er noch immer manch schöne Passage singen, wenngleich er die Spitzentöne fallweise schon stemmen musste. Sein Ziehvater Mime wurde von Dan Karlström als Kabinettsstück eines intriganten und berechnenden Zwerges angelegt. Während Siegfried aus den Trümmern des Schwertes seines Vaters Siegmund das Schwert Nothung neu schmiedet, bereitet dieser Spiegeleier vor und nimmt einen vergifteten Sud in einer Thermoskanne mit sich auf der Radfahrt zur Neidhöhle Fafners.

Seine Verschlagenheit äußert sich musikalisch in den Bratschen. Mit Michael Volle stand an diesem Abend ein Wanderer der absoluten Weltklasse mit seinem unvergleichlichen Bariton auf der Bühne. Der finnische Bass-Bariton Tuomas Pursio zeigte sich gesanglich besonders eloquent in der Auseinandersetzung mit Wotan und später mit Mime. Die Stimmen beider Sänger harmonierten aufs Beste! Für die Rolle des zum Wurm gewandelten Riesen Fafner ließ der kanadische Bass Randall Jakobsh seine furchteinflößende Tiefe aus dem Off ertönen. Aus der Tiefe auf seinem Samtsofa emporsteigend erstrahlte sein Bass dann vollends in seiner natürlichen Schönheit. Als Waldvogel gab es ein Wiederhören mit dem gleichfalls aus dem Off singenden Wiener Publikumsliebling Daniela Fally mit ihrem glockenhellen Sopran. Mit Marina Prudenskaya als Erde gab es wieder einen der Höhepunkte im tiefen Register der Frauenstimmen. Ihr abgedunkelter Mezzosopran strömte markant voller Akkuratesse. Und schließlich Daniela Köhler als stimmstarke Brünnhilde. Eine Sängerin mit Ausstrahlungskraft, die auch alle gefürchteten finalen Spitzentöne ohne Schwierigkeiten meisterte. Obwohl einige Plätze im Haus leer geblieben waren zeigte sich das anwesende Publikum von den Darbietungen an diesem Abend angetan und spendete begeistert Applaus, in den sich auch so manche Bravo-Rufe mischten.
Harald Lacina, 11.7.
Fotocredits: Tom Schulze
DIE WALKÜRE
8.7.2022 (Premiere am 7.12.2013)
Hier passen Bühne und Graben noch halbwegs zusammen

Es wird düster am ersten Tag der Tetralogie. Rosamund Gilmores Walküre ist von düsteren Vorahnungen auf das Ende der Götter überschattet. Zu Beginn sehen wir Hundings Behausung mit einer bereits abgestorbenen Weltesche, in der das Schwert Nothung stakt und gleichzeitig als Kleiderhaken dient. Darüber hängt der Schädel eines Widders, Sinnbild für Fricka, die diese unglückliche Ehe von Hunding und einer von Schächern für ihn geraubten Frau beschirmt. Der Raum ist zunächst noch hoch und auf seinem Dach mit leuchtenden Gittern aus Stacheldraht sehen wir wieder die mystischen Figuren teils als Widder, teils als Wölfe und Raben verkleidet. Lichtgittern und Stacheldraht Langsam, wie von Zauberhand senkt sich der Plafond und wird zu einem bedrückenden Kellerraum mit der obligaten gewundenen Treppe nach oben. Bei Siegmunds „Winterstürmen“ öffnet sich die hintere Wand der Bühne, draußen herrscht aber auch keine Frühlingsstimmung oder gar der Lenz, vielmehr eine dunkelblaue, unwirtliche Kälte. Nachdem nun Siegmund den Namen von Hundings Gattin erhalten hat, gibt sich die bis dahin namenlose einsame Frau, im Wissen, dass der Fremde ihr verlorener Zwillingsbruder ist, gleich den zu „Siegmund“ passenden Namen, nämlich Sieglinde.

Dunkel und düster bleibt auch der zweite Akt, der Familiensitz von Herrn und Frau Wotan, die auf einen Streit zwischen Richard und Cosima Wagner in einer brüchig gewordenen Villa Wahnfried hineindeutet. Von der einstigen opulenten Eingangshalle bleiben nur mehr zwei eingestürzte Seitenwände, in der Mitte ist ein Kamin zu sehen und ein Pianino. Fricka tritt mit einem von Tänzerinnen gebildeten Widdergespann auf, um Wotan zu zwingen, seinen Sohn Siegmund im Kampf gegen den betrogenen und entehrten Hunding im Kampf fallen zu lassen und dem Schwert Nothung die Kraft zu nehmen. Es schaudert sie ob des Ehebruches einerseits und der inzestuösen Beziehung des Zwillingspaares andererseits. Danach erfolgt die lange Wotans Erzählung, in der Wotan seine Lieblingstochter Brünnhilde auffordert, Siegmund im Kampf gegen Hunding nicht mehr beizustehen. Obwohl Brünnhilde das gemeinsame Kind von Erda und Wotan ist, lassen die folgenden Zeilen die antike Idee der Kopfgeburt von Athene aus dem Schädel ihres Vaters Zeus vermuten: Brünnhilde: „Zu Wotan’s Willen sprichst du, sagst du mir was du willst: wer – bin ich, wär‘ ich dein Wille nicht?“ und Wotan antwortet: „… mit mir nur rat‘ ich, red‘ ich zu dir.“ Diese Analogie zum griechischen Mythos wurde von Richard Wagner sicherlich bewusst gewählt. Brünnhilde ist eben anders als die übrigen Walküren und kann womöglich gar als geistiges Produkt von Erda und Wotan angesehen werden? Nach der ergreifenden Todesverkündung erschießt Hunding im finalen Kampf Siegmund, der noch von seinem Vater betrauert wird, ehe dieser der geflohenen Brünnhilde und der paralysierten Sieglinde nacheilt. Der dritte Akt zeigt uns dann ein eingestürztes Kolosseum mit einer dreistöckigen geneigten Wand, welche an das neoklassizistisches Colosseo quadrato, den Palazzo della Civiltà Italiana mit seinen markanten Rundbogenarkaden in Rom, erinnert.

In der Mitte befindet sich noch eine kleine Bühne. Zahlreiche weiße Stiefel füllen den Vordergrund der Bühne und verweisen auf die gefallenen Helden. Die Walküren erscheinen in Kampfanzügen ein Gewehr in den Händen haltend. Begleitet werden sie von Tänzern im Pferdeschritt mit weißer Kleidung und mit Helm. Wotan tritt mit einem langen blauen Mantel auf und wiegt Brünnhilde, nachdem er ihre Gottheit weggeküsst hat, in einen komatösen Schlaf, aus dem sie nur derjenige aufwecken kann, der das Fürchten nicht gelernt hat. Auch Grane ihr Ross erstarrt schlafend. Dann umgibt er sie mit einem eher leicht zu durchdringenden Feuer, das eine als Loge gekleidete Figur diensteifrig entfacht Ulf Schirmer setzte gemeinsam mit dem Gewandhaus Orchester zunächst auf eher verhaltene langsame Tempi. Die dunklen Streicher und die Hörner und Tuben unterstrichen die düstere Atmosphäre im Hause Hunding. Der zweite und dritte Akt steigerte sich dann im Tempo, wodurch leider auch einige hörbare Schwächen bei den Blechbläsern manifest wurden. Wotans geflüsterter Abschied von Brünnhilde wirkte besonders berührend, der Feuerzauber optisch leider weniger. Der deutsche Bass-Bariton Thomas Johannes Mayer bot einen Göttervater Wotan mit allzu menschlichen Regungen, frustriert von seiner Gattin Fricka und zorngeladenen, weil er in seinem Machtstreben nach Weltherrschaft gescheitert ist, ausgestattet mit stupenden Gesangsqualitäten. Die Britin Allison Oakes war eine wunderbare Brünnhilde mit kräftiger Mittellage und sicherer Höhe bei den Hojotoho!-Rufen. Kathrin Göring war wieder eine resolute ehrerpichte Fricka, die ihrem Halodri von Göttergatten ständig nachjagen muss wie Hera einst ihrem Zeus mit markantem gebieterischen Mezzo. Die in Malmö geborene Schwedin Elisabet Strid war eine starke Sieglinde, die mit guter Technik und einer exzellenten Bruststimme auch in der Höhe keine Abnutzungserscheinen erkennen ließ. Bei dem in Kansas geborenen US-amerikanischen Tenor Robert Dean Smith als Siegmund waren zunächst einmal seine lang andauernden Wälse-Rufe beeindruckend. Gesanglich war der Rest nicht immer sauber gesungen, aber er harmonierte dennoch darstellerisch mit der knapp 20 Jahre jüngeren Partnerin. Tobias Kehrer als Hunding verfügte über einen gewaltigen Bass, mit dem er bei seinem Auftritt im ersten Akt gesanglich den Ton angab. Die acht Walküren Inex Lex/Gerhilde, Magdalena Hinterdobler/Ortlinde, Maren Engelhardt/ Waltraute, Sandra Janke/Schwertleite, Jessey-Joy Spronk/ Helmwige, Sandra Maxheimer/Siegrune, Marta Herman/Grimgerde und Christiane Döcker/Rossweisse sangen mit Begeisterung und spielten voller Power. In den stummen Rollen überzeugten Ziv Frenkel als Grane im Gladiatorenoutfit und das Loge-Double Sidnei Brandão. Die Bühnen- und Kostümbilder gestalteten wiederum Carl Friedrich Oberle und Nicola Reichert, Michael Röger die Lichtregie. Am Ende gab es ausgewogenen Applaus für alle Beteiligten, mit einigen Bravirufen für die Protagonisten. Man darf nicht vergessen, es waren auch viele US-Amerikaner unter den Zuschauern, die ihrem Robert Dean Smith wohl so manche Unsauberkeit im Gesang nachgesehen haben.
Harald Lacina, 10.7.
Fotos: Tom Schulze
Das Rheingold
7.7.2022 (Premiere am 4.5.2013)
Ein musikalischer Hochgenuss in szenisch nahezu perfekter Umsetzung

Den „legendären“ Herz-Ring aus DDR-Zeiten, von dem der Chefdramaturg der Oper Leipzig, Christian Geltinger, in seinem Einführungsvortrag gesprochen hat, habe ich leider nie gesehen und muss daher auch nicht das rituelle Bekenntnis zum Antifaschismus der damaligen Zeit an dieser Stelle reflektieren. Die englische Choreografin und Regisseurin Rosamund Gilmore (1.6.1955*) setzt Wagners Opus Magnum mit den Stilmitteln des Tanzes auf handwerklich faszinierende Weise um, indem sie die Handlung durch zwölf Tänzer als sogenannte „Mythische Elemente“ kommentierend umsetzen lässt und ebenso die Umbauten anstelle von Bühnenarbeitern durch sie bewerkstelligen lässt. Das mag zwar an manchen Stellen komisch wirken, aber ein bisschen mehr an Humor hat Wagner noch nie schaden können und immerhin dem Großteil des Publikums hat es auch an diesem Abend sehr gefallen! Alle vier Szenen des Vorspiels zeigen ein einheitliches romantisierendes Bühnenbild von Carl Friedrich Oberle mit einem riesigen Entrée, das an den Seiten von zwei Wänden begrenzt wird.

In der Mitte befindet sich noch eine geschwungene Treppe. In der Mitte der Bühne befindet sich ein etwa 80 cm hohes Podest, welches im ersten Bild als riesengroßes Wasserbecken den Rhein symbolisieren soll. Ein Sofa und ein Bett auf den von den Tänzern inzwischen trocken gewischten Beckenboden lässt Wotans Wohnzimmer erahnen. Die Götter erscheinen in eleganten Kleidern um 1900, die Riesen in englischem Tweed und hohem Top hat, und Loge erinnert in Kostüm und Bewegung an Charly Chaplin als Tramp (Kostüme: Nicola Reichert). Und durch eine Bodenluke steigen dann Wotan und Loge nach Nibelheim hinab. Im vierten Bild erscheint dann Erda in Begleitung der drei Nornen, die sie an den Schicksalsfäden mit sich zieht. Am Ende der Oper erscheint die Glasdecke des Raumes in den Regenbogenfarben, die in den vorhergehenden Szenen blau, weiß und rot beleuchtet war, die Götter steigen die Wendeltreppe empor während die Rheintöchter den Verlust ihres Goldes betrauern. Das Gewandhaus Orchester unter Ulf Schirmer bot ein Vorspiel vom Feinsten. Flotte Tempi kennzeichneten sein Dirigat und er scheute auch nicht davor zurück, an den passenden Stellen geradezu pathetisch aufspielen zu lassen. Die Blechbläser ließen einen imposanten Festungsbau erahnen, während die Holzbläser die Freude der Rheintöchter an ihrem Gold hörbar unterstrichen. Das tiefe Es in den Kontrabässen deutete gemeinsam mit den Pauken bereits eindrucksvoll das unheilvolle Ende der Tetralogie an. Michael Volle bestach als Wotan mit kräftigem Bariton. Er ist ein würdevoller Göttervater, nach dessen Gebot sich scheinbar noch alle richten. Aber die Stimmung ist am Kippen, das lässt seine beginnende Entfremdung zu Fricka bereits hier erahnen. Thomas Mohr als Loge gab ein Kabinettstück eines listigen, spitzbübischen Loge. Mit seinem beweglichen Tenor charakterisierte er diesen schleimigen Halbgott als raffinierten Gauner, dem niemand schaden kann, da alle auf die Kraft des Feuers angewiesen sind. Der in Kaliforniern geborene Bariton Anooshah Golesorkhi war ein polternder Donner mit gewaltiger Röhre und aufbrausendem Temperament. Der isländische Tenor Sven Hjörleifsson unterlegte mit seinem eher hellen Tenor einen gutaussehenden Gott Froh. Friedemann Röhlig war ein stimmgewaltiger Fasolt mit exzellent geführtem Bass während der ukrainische Bass Taras Shtonda als dessen Bruder Fafner zunächst im Hintergrund blieb, bevor er sich seines Bruders durch Mord entledigt hatte. Danach hatte er auch Zeit für ein witziges Zwischenspiel mit Fricka, die begehrlich ihre Finger nach dem Gold ausstreckte, um sich doch noch ein Stück davon zu ergattern. Werner Van Mechtelen war für den erkrankten Markus Brück als Alberich eingesprungen.

Ein großer Gewinn für diesen Abend, denn hier zeigte sich ein Sänger stimmlich von seiner besten Seite und darstellerisch als sadistischer Tyrann, der seine Nibelungen und seinen Bruder Mime auspeitscht, der jedoch durch seinen Größenwahn auch leicht zu überlisten ist und schließlich in der Gestalt einer Kröte von Wotan und Loge gefangengenommen werden kann. Der finnische Tenor Dan Karlström gefiel als geschundener Mime in seinem kurzen Auftritt. Marina Prudenskaya hatte einen eindrucksvollen Auftritt gemeinsam mit den drei Nornen und ihrer hypnotisierenden Mezzostimme. Ein solcher Mahnruf an Wotan konnte von diesem gar nicht unerhört bleiben… Wotans Göttergattin Fricka war in der Kahle von Mezzosopranistin Kathrin Göring stimmlich bestens aufgehoben. Darstellerisch war sie sehr kokett, obwohl sie bereits jetzt ahnte, von ihrem Gatten betrogen zu werden. Ihre Schwester Freia wurde von Gabriele Scherer mit hellem Sopran dargeboten und spielfreudig wie sexy interpretiert. Sie hütet in ihrem Nebenberuf als Gärtnerin gleich den antiken Hesperiden das verjüngende Obst. Von den drei Rheintöchtern überzeugten Olga Jelínková als Woglinde und Sandra Maxheimer als Wellgunde mit gut geführtem Sopran bzw Mezzosopran. Einziger Wermutstropfen blieb die soubrettenhafte Stimme von Sandra Fechner, die für die erkrankte Sandra Janke eingesprungen war. Immerhin war der Abend aber dadurch gerettet, sodass man ihr kleinere Unsauberkeiten gerne nachsehen wird.

Ein Übel gibt es dennoch anzumerken: Wer während des Rheingolds auf Grund seiner/ihrer schwachen Blase auf die Toilette gehen muss, sollte der Vorstellung fernbleiben bzw. vorher nichts trinken. An der Wiener Staatsoper können sie zwar die Vorstellung verlassen, danach aber nicht mehr an ihren Sitz zurückkehren. In Bayreuth werden die Türen überhaupt versperrt. Diesfalls empfehle ich eine medizinische Leibwäsche zu tragen! Abgesehen von diesen Unterbrechungen im Parterre war die Vorstellung ein voller Erfolg und man erwartet die übrigen Teile mit größter Spannung!
Harald Lacina, 9.7.
Fotos: Tom Schulze
DIE FEEN /DAS LIEBESVERBOT / RIENZI
20. bis 23. Juni 2022
Ein einzigartiger Wagner-Marathon
Unter dem Motto „3 Wochen Unendlichkeit, Schwelgen und Rausch“ begannen am 20. Juni die lange erwarteten Richard Wagner Wochen der Oper Leipzig „WAGNER 22“, mit denen Intendant und GMD Ulf Schirmer seine Amtszeit am Leipziger Haus seit der Saison 2009/10 abschließen möchte. Wohl nirgendwo anders bekommt man die Möglichkeit, nicht nur alle 13 Opern und Musikdramen des Bayreuther Meisters in so kurzer Zeit szenisch hintereinander zu erleben, sondern auch seine drei Frühwerke, die nicht in den sog. „Bayreuther Kanon“ eingingen. Und diese Frühwerke, insbesondere „Die Feen“ und „Das Liebesverbot“, dokumentieren eindrucksvoll, welches Talent Wagner in jungen Jahren zwar schon hatte, wie sehr er es aber erst über den langen Zeitraum seines künstlerischen Schaffens ausbaute und perfektionierte. Immerhin hatten sogar Friedrich Nietzsche und Thomas Mann Richard Wagner einmal als einen genialen Dilettanten bezeichnet. Ganz anders also als sein bis zum Tode schon 1847 ebenfalls in Leipzig aktiver Antipode Felix Mendelssohn Bartholdy, der schon mit 12 Jahren seine erste Komposition drucken ließ, mit 15 seine 1. Symphonie fertigstellte und mit 17 schon Meisterwerke wie das Streichoktett in Es-Dur op. 20 sowie die Ouverture zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ komponierte. Ganz anders als Wagner also ein Meister gleich schon zu Beginn seines kurzen Lebens! Unter dem Titel „Mendelssohn und Wagner. Zwei Leitfiguren der Leipziger Musikgeschichte“ thematisierte ein hochkarätiges Internationales Symposium des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Leipzig in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Leipzig vom 23.-25. Juni das Wirken beider Komponisten in der Bürgerstadt. Namhafte Referenten aus Leipzig, Deutschland, Großbritannien und den USA waren mit interessanten multidisziplinären Betrachtungen beider Komponisten mit speziellem Bezug zu Leipzig zu hören.

Nun sollte Wagners Erstlingswerk
„Die Feen“ ja tatsächlich 1834 in Leipzig das Licht der Welt erblicken, wozu es jedoch nicht kam, da es von der Leipziger Theaterdirektion abgelehnt wurde. Der Komponist erlebte es am Ende nie. Cosima Wagner bewirkte schließlich die Uraufführung posthum 1888 an der Münchner Hofoper. Wagner komponierte „Die Feen“ in Anlehnung an Carlo Gozzis Märchenspiel „Das Schlangenweib“, welches im Kontext der romantischen Undinen-Dichtungen damals recht aktuell war, wie Christan Geltinger im Programmheft schreibt. Nun hatte Wagner im Rahmen seiner ersten Theatererlebnisse immer schon Gefallen an gewissen spukhaften, nicht erklärbaren Erscheinungen gefunden. Wenn er als Knabe im Theater war, reizte ihn besonders die „andere, rein phantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt“. Besonders das Berühren der Theaterkostüme der Darstellerinnen konnte ihn „bis zu bangem, heftigem Herzschlag aufregen“. Womit wir also mittendrin wären in der Welt der Feen mit den Protagonisten Ada und Arindal. Sie eine Fee, er ein Mensch wie Du und Ich, der sie acht Jahre lang nicht nach ihrer Herkunft fragen darf, um mit ihr unsterblich werden zu können, ausgerechnet am letzten Tage das Verbot aber bricht. Die spätere, aber schon vor Wagner bekannte „Nie sollst Du mich befragen“-Thematik des „Lohengrin“ klingt ebenso an wie „Orpheus in der Unterwelt“ und, wenn es um die Prüfungen geht, „Die Zauberflöte“, und manches andere. Wagner hatte ja noch keinen eigenen Stil gefunden. Musikalisch hört man viele Elemente von Beethoven, immer wieder wechseln teilweise erratisch Tradition mit Innovation, und man hört auch Formen des Singspiels. Irgendwie wirkt die Oper wie ein Versuch des jungen Wagner, eine Richtung für die gewünschte weitere kompositorische Entwicklung zu finden, und dazu hat sie sicher auch beigetragen.

So, wie allerdings in der bereits aus dem Jahre 2013 stammenden Inszenierung des kanadischen leading teams von Renaud Doucet für die Regie und André Barbe für Bühnenbild und Kostüme in Leipzig in Szene gesetzt wurde, hätte sie dem späteren Wagner wohl nicht gefallen. Sie wirkte wie ein Rückgriff auf die Grand Opéra mit ihren opulenten Bildern, die er ja so ablehnte, mit einem an Phantasie, Opulenz und detailreicher Fülle überbordenden, äußerst traditionellen Bühnenbild, üppigen Kostümen und Ritterrüstungen und Waffen, wie man sie seit langem nicht einmal mehr an der Met sehen kann. Das wirkte fast wie ein Zitat auf eine frühere, aber heute kaum noch nachvollziehbare Opernästhetik, ja bisweilen sogar wie eine Parodie, zu der der „Vom Winde verweht“-Charakter der Feen-Kostüme nicht gerade an klassische Feen-Vorstellungen anknüpfte. Dazu das ganz profane Wohnzimmer, wo Arindal zunächst eine paar Freunde zum Essen empfängt (womit mal wieder das doch recht gute Vorspiel kaputt gemacht wurde) und wo später immer wieder sinnierend im Sofa sitzt und, wenn erforderlich, in die die Feen-Welt eintritt, stets in alten Jeans und oranger Strickweste. Noch biederer ging es nicht. Überzeugen konnte es auch dramaturgisch nicht allzu sehr, war der ästhetische Bruch doch einfach zu stark. Manches wäre zu retten gewesen bei einer akzentuierten Personenregie. Diese schien aber fast völlig zu fehlen, immer wieder kam es auch zu längerem Rampensingen.
Guy Simard war für das relativ facettenarme Licht verantwortlich. Am Ende schwebte ein Schmetterling hernieder, scheinbar mit dem jungen Wagner an den Flügeln, und verhieß beiden die gewünschte Unsterblichkeit. Ob sie heute noch wünschenswert ist…?! Oder es gar jemals war?!
Leider mussten bei diesem Start von WAGNER 22 gleich drei Hauptrollen wegen Erkrankung ersetzt werden: Neben dem Dirigenten Christoph Gedschold die beiden wichtigsten Protagonisten Ada, bei der für Liene Kinča Kirstin Sharpin einsprang. Bei Arindal sprang für Roy Cornelius Smith Marc Horus ein. Leider präsentierte er einen Tenor, der in keiner Weise die Anforderungen dieser nicht leichten Partie meistern konnte, für die, das muss man in Rechnung stellen, es auch nicht allzu viele Sänger geben wird. Zu wenig Volumen, kaum Resonanz, und darstellerisch blieb Horus bei diesem Rollenprofil wohl unberechtigterweise auch etwas blass. Kirstin Sharpin bemühte sich, der Ada vor allem mit kraftbetonter Stimme Persönlichkeit zu geben. Ihr Sopran wurde in der Höhe jedoch oft schrill und hatte auch ansonsten wenig differenzierende Farbgebung - ein relativ gradliniger Vortrag. Stimmlich und auch darstellerisch voll überzeugen konnte das Paar Lora, gesungen von Viktorija Kaminskaite, und Morald, verkörpert von Nikolay Borchov, der mit einem samtenen und bestens geführten Bariton aufwartete, bei hoher Musikalität. Kaminskaite verfügt über einen klangschönen Sopran und beeindruckende Höhensicherheit sowie viel Anmut in ihrer Darstellung. Athanasia Zöhrer gab die Fee Zemina ebenfalls mit guter Stimme, während ihre Feen-Kollegin Sandra Maxheimer als Farzana zu soubrettenhaft klang. Das Buffo-Paar Drolla und Gernot, hier gesungen von Olga Jelínková und Randall Jakobsch, konnte ebenfalls überzeugen, insbesondere in ihrem langen Duett im 2. Akt. Die Nebenrollen waren gut besetzt.
Matthias Foremny dirigierte das Gewandhausorchester sehr engagiert, hier und da etwas zu sehr lautstärkebetont. Aber Wagners „Feen“-Partitur ist ja immer wieder auch sehr expressiv. Insbesondere das Schlagwerk meinte es bisweilen zu gut. Ganz hervorragend sang der Chor der Oper Leipzig, einstudiert von Thomas Eitler-de-Lint, mit beeindruckender stimmlicher Potenz und bei guter Transparenz. Hier sicherte Foremny stets eine gute Einbindung des Ensembles in das musikalische Geschehen.
Tags darauf folgte „Das Liebesverbot“ und damit Wagners erste selbst erlebte Uraufführung, die 1836 in Magdeburg unter chaotischen Umständen zustande kam. Diese Oper weist aber schon viel mehr als „Die Feen“ auf die kommende Entwicklung des Komponisten hin. Wenn auch noch ganz „Un-Wagnerisch“, dabei aber doch immer wieder schön herauszuhören, ist die musikalische Referenz an große italienischen Opern-Komponisten der damaligen Zeit. Die Art und Weise, wie Wagner sie vertont und in das dramaturgische Geschehen einbaute, deutet immer wieder auf sein revolutionäres Kompsitionskonzept für die Oper an. Es geht gleich mit der mitreißenden Ouvertüre los, die musikalisch perfekt das Karnevalstreiben im hitzigen Palermo dokumentiert. Hier zeigt Wagner bereits ein viel größeres Maß an musikalischer Geschlossenheit. Man könnte sie in ihrer konsistenten Dynamik und Ausdruckskraft mit dem Vorspiel zum 1. Aufzug der „Walküre“ vergleichen, freilich in total gegensätzlicher inhaltlicher Konnotation. Wieder ersetzte Matthias Foremny den erkrankten Christoph Gedschold am Pult des Gewandhausorchesters und brachte diesmal sehr viele schöne Facetten der schon viel reiferen Partitur des „Liebesverbot“ zum Klingen. Dass Orchester erwies sich als sehr vertraut mit dem Stück, das der jetzige Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, Aron Stiehl, ebenfalls im Jubiläumsjahr 2013 in Leipzig inzensierte.

Stiehl stellt mit Bühnenbildner Jürgen Kirner, Kostümbildner Sven Bindseil und dem Lichtdesigner Christian Schatz auf das Thema dieser Oper, die Unvereinbarkeit des Geistigen mit dem Triebhaften im Menschen ab. Übrigens ein Leitmotiv, wie wir es bei Wagner des Öfteren antreffen, wie Stiehl im Gespräch mit Christan Geltinger im Programmheft sagt. Das prominenteste Beispiel dafür ist wohl Alberich im „Ring“. Statthalter Friedrich versucht, das Triebhafte in den Italienern in Palermo zu unterdrücken, nicht zuletzt zur Erhaltung seiner Macht, übt also Machtmissbrauch. Weil das auf Dauer nicht durchzuhalten ist, denn das Triebhafte im Menschen, was letztlich auch ein Trieb nach Freiheit ist, bahnt sich immer wieder seinen Weg, letztlich auch bei Friedrich selbst. Also muss er an dieser Politik scheitern. Das leading team hat diesen Ansatz sehr gut herausgearbeitet mit einer exzellenten und frisch anmutenden Personenregie, obwohl die Inszenierung schon 13 Jahre alt ist. Hinzu kommt das sehr geschmackvolle, abstrakt gehaltene Bühnenbild, welches mit grünen Dschungel-Assoziationen den Drang des wilden Tieres im Menschen nach Freiheit zeigt und in einer streng arithmetischen, mit Nummern belegten Wand den Kontroll- und Verbotswahn Friedrichs widerspiegelt. Beide Wände können schwingen und somit in schneller Folge die entsprechenden Szenen und Stimmungen herstellen.

Manuela Uhl ist eine sehr agile und dezidiert auftretende Isabella, also „Die Novize von Palermo“ nach Shakespeares Komödie „Maß für Maß“. Sie ließ wegen eines Infekts zwar ansagen, was sich aber nur im weiteren Verlauf des Abends etwas andeutete. Generell war sie auch stimmlich voll überzeugend. Der Finne Tuomas Pursio, auch „Rheingold“-Wotan und Alberich in Leipzig, spielte einen starken Statthalter Friedrich, der in allen Facetten durch diese problematische Figur ging und lieh ihm seinen klangvollen Bassbariton. Mirko Roschkowski sang den Luzio mit seinem schön timbrierten Tenor, aber etwas kleiner Stimme, ähnlich wie Dan Karlström den Luzio. Stefan Sevenich gab eine köstliche Charakterstudie des Brighella. Franz Xaver Schlecht sang einen kraftvollen Angelo. Die weiteren Nebenrollen waren mit Herfinnur Árnafjall als Antonio, Padraic Rowan als Danieli, Martin Petzold als Pontio Pilato, Nina-Maria Fischer als Mariana und Magdalena Hinterdobler als Dorella ansprechend besetzt. Wieder war der Chor der Oper Leipzig, einstudiert von Thomas Eitler-de-Lint, eine tragende Säule der Produktion und wartete mit geschmackvoll aufeinander abgestimmten Kostümen auf, eine Augenweide im Vergleich zu den Karnevalskostümen des Abends zuvor, die aber gar keine sein sollten…
Am 23. Juni folgte mit „Rienzi“ das letzte der Frühwerke in einer Inszenierung von Nicholas Joël, der 2020 verstorben ist und bei Patrice Chéreau Assistent bei dessen „Jahrhundert-Ring“ in Bayreuth 1976 war. Joël war von 1990-2009 Intendant des Théâtre du Capitole de Toulouse und danach bis 2014 der Pariser Oper. Er hat sich durch großartige Inszenierungen an vielen ersten Häusern in Europa und den USA profiliert, unter anderen mit dem „Ring des Nibelungen“ in Strasbourg und Lyon und einem zweiten am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. So konnte man also eine anspruchsvolle Inszenierung des so schwierig in Szene zu setzenden „Rienzi“ erwarten. Es ging Joël offenbar um eine Reduktion der Monumentalität des auf dem Roman „Rienzi, der letzte der Tribunen“ des englischen Schriftstellers Edward Bulwer-Lytton ruhenden Stoffes, den Wagner während eines längeren Aufenthaltes in Dresden gelesen hatte.

In einem sehr spartanischen, in dunklen Grautönen und den gesamten Bühnenraum umfassenden und von Michael Röger nur spärlich beleuchteten Bühnenbild des ebenfalls schon verstorbenen Andreas Reinhardt konzentriert sich Joël total auf die Bestrebungen Rienzis, die ewige Stadt Rom gegen die Machtinteressen und -kämpfe der Colonna wieder zu einen. So stellt er die Figur des Tribunen immer wieder in dominante Positionen, wie beispielsweise auf den Souffleurkasten, was ihn optisch über alle anderen erhebt. Auch sieht man ihn einmal in einer roten Toga in weißem Gewand. Bisweilen wirkten diese Bilder etwas zu statisch, es gab immer wieder auch mal Rampensingen, obwohl generell eine gut akzentuierte Personenregie festzustellen war. Dabei kam auch die Drehbühne szenenbelebend und -wechselnd zum Einsatz. Auch die ebenfalls von Reinhardt geschaffenen Tagesanzüge der Colonna und Orsini waren in tristem Grau gehalten, wohl auch um die Tragik der ganzen Situation widerzuspiegeln.

Stefan Vinke, der erst vor kurzem einen eindrucksvollen Siegfried am Palast der Künste-MÜPA in Budapest (siehe in diesem Heft) gesungen hat, füllte dieses besonders starke Rollenprofil des Rienzi eindrucksvoll aus. Mit seinem kräftigen und bis zum Ende schier unermüdlichen Heldentenor strahlte er stets die vom Tribunen erwartete Souveränität und Erhabenheit aus, wobei ihm die baritonale Basis seines Tenors zusätzlich zugute kam. Klangvoll und mit großer Hingabe intonierte Vinke auch den berühmten Monolog „Allmächt’ger Vater, blick herab!“ In Miriam Clark hatte Vinke eine Schwester Irene mit klangvollem Sopran auf Augenhöhe zur Seite, die auch große Emotionalität in die Partie einbrachte. Sebastian Pilgrim, bewährter Haus-Bass in Leipzig, sang einen Respekt gebietenden Colonna und Franz Xaver Schlecht einen Orsini mit prägnantem Bariton und einem hohen Maß an Aktivität. Allerdings wurde zu viel mit Pistolen herumgefuchtelt.
Außerordentlich gefallen konnte wieder Kathrin Göring als agiler Adriano mit ihrem klaren und klangreichen Mezzo, und die in ihrem Kampf um Irene in der Hosenrolle darstellerisch und stimmlich alles gab – und das war viel! Sejong Chang war als Legat des Papstes in Rom nicht ganz glaubwürdig als Figur und auch stimmlich nicht ganz überzeugend, vor allem, was Volumen und Farbgebung betrifft. Matthias Stier als Baroncelli, Randall Jakobsh als Cecco del Vecchio und die als Friedensbote sehr schön singende Anna Alàs i Jové agierten in den Nebenrollen. Wieder war der Chor und diesmal auch der Zusatzchor der Oper Leipzig unter Leitung von Thomas Eitler-de-Lint in großartiger Form und repräsentierte das Volk von Rom nachdrücklich.
Der an diesem Abend planmäßig angesetzte Matthias Foremny dirigierte wieder das Gewandhausorchester und begann mit der Ouvertüre schon etwas zu marschmäßig. Im weiteren Verlauf war die Lautstärke bisweilen zu hoch, auch wenn es mit dem Geschehen auf der Bühne bis zu einem gewissen Grad harmonierte. In den Szenen mit Adriano und Irene sowie zu den Verzweiflungsmomenten Adrianos, zwischen Vater und Geliebter hin- und hergerissen zu sein, ergaben sich dann auch lyrischere Momente im Graben.
Im 3. bis 5. Akt stellte Andreas Reinhardt einige etwa personengroße Holzmodelle von bedeutenden Bauten Roms auf die Drehbühne, den Petersdom, das Colosseum, den Lateranpalast, das Kapitol und andere. Sie bildeten eine symbolische Kulisse für den Untergang Rienzis in der Stadt, die er immer einen wollte, in der er aber auch vor Gewalt nicht Halt machte, was ebenfalls gut zu sehen war, und in der er am Ende neben einem in echten Flammen stehenden Kapitol mit Irene sein Ende findet. Von außen werden aber auch alle anderen mit einem MG erschossen…
Fotos: Kirsten Nijhof („Die Feen“ und „Das Liebesverbot“), Andreas Birkigt („Rienzi“)
Klaus Billand / 29.6.2022
www.klausbilland.com
Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo
21.6.22
Des Meisters beste, aber leider einzige „Operette“ in spritziger Umsetzung
In Kooperation mit den Bayreuther Festspielen (BF Medien GmbH) zeigte die Oper Leipzig die Große Komische Oper in zwei Akten, deren Text Richard Wagner nach der Komödie „Maß für Maß“ (Measure for Measure) von William Shakespeare, der den Titel der Bergpredigt (Matth. 7:2: „Denn mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden.“) entlehnt hatte. Die Handlung spielt bei Shakespeare in Wien im 16. Jhd. Im Rahmen des Festivals Wagner 22 werden alle 13 Bühnenwerke des Meisters in der Reihenfolge ihres Entstehens, mit Ausnahme des Rings, gezeigt. Während einer Reise bekam Wagner 1834 nach der Lektüre des Briefromans „Ardinghello“ (1787) des deutschen Schriftstellers, Übersetzers, Gelehrten und Bibliothekars, Johann Jakob Wilhelm Heinse (1746-1803), die Idee zu seiner zweiten vollendeten Oper. Heinse verarbeitete in diesem Roman seine Reise nach Italien in den Jahren 1780-83 und strich die Gleichstellung der Frau und die freie Sinneslust heraus.

Zu jener Zeit verkehrte Wagner mit Heinrich Laube (1806-84), dem Autor des Jungen Europas und Jungen Deutschlands und späteren künstlerischen Direktor des Burgtheaters von 1849-67. Zu jener Zeit war Wagner aber auch in die ältere gutaussehende Schauspielerin Minna Planer (1809-66), seiner späteren Ehefrau, verliebt. „Freie Liebe“ jenseits aller Konventionen und Verbote, wie modern und gleichzeitig frivol hätte ein solcher Stoff damals wirken können? Aber der Uraufführung am Magdeburger Theater am 29. März 1836 war kein Erfolg beschieden. Sie endete in einer Katastrophe. Ort der Handlung von Wagners komischer Oper ist Palermo im 16. Jhd. Statthalter Friedrich verbietet bei Strafe alle Umtriebe im Karneval. Das erste Opfer dieses Gesetzes wird Claudio, denn seine Geliebte Julia ist von ihm schwanger. Bereit sie zu ehelichen, wird er dennoch zum Tode verurteilt. Die junge Novizin Isabella, seine Schwester, versucht ihren Bruder zu retten, indem sie sich mit dem Statthalter Friedrich auf ein amouröses Techtelmechtel einlässt.
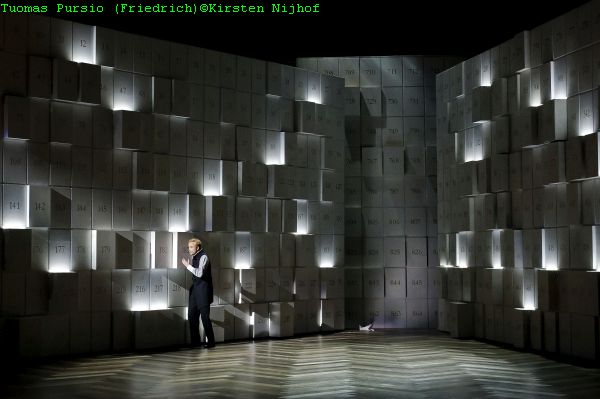
Isabella erkennt jedoch noch rechtzeitig, dass Friedrich die Begnadigung Claudios nicht unterzeichnet hat, und enthüllt dem Volk diesen Betrug. Das Volk fordert nun die Aufhebung des Karnevalsverbotes, anstatt Friedrich nach seinen eigenen Maßstäben zu richten. Der puritanische Friedrich wird abgesetzt und der herannahende König voll Überschwang gefeiert. Damit hat die Liebe durch eine Revolte schlussendlich doch gesiegt. Weshalb sich Wagner von seiner einzigen und besten „Operette“ distanzierte, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Verführung und Erlösung, spätere Hauptmotive in Wagners Werken, sind bereits erkennbar. Freilich, die rhythmische Ouvertüre erinnert an Adolphe Adam und Daniel François Esprit Auber, im Übrigen auch an den Stil der italienischen Opera buffa eines Donizettis und Rossinis. Und bereits in dieser frühen Oper erkennt man deutlich eines der zentralen Themen des Komponisten, nämlich die Unvereinbarkeit von Erotik als dionysischem- und der „hohen“ Liebe als apollinischem Prinzip, welches Thema später im Tannhäuser auftauchen sollte. Die äußerst witzige Inszenierung dieser komischen Oper hatte bereits 2013, anlässlich des 200. Geburtstag des Meisters, Premiere. Aron Stiehl, seit 2020 Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, hatte Regie geführt. Neben zahlreichen Gags ist vor allem der Verweis auf die zwölf Weihnachtstage, die vom 25. Dezember bis zum 6. Januar (Epiphanias Nacht) dauerten.

Zu Shakespeares Zeit wurden die 12 Weihnachtstage als Beginn der Karnevalszeit mit Maskenspielen gefeiert, in denen die Menschen ihre geschlechtlichen und gesellschaftlichen Identitäten durch Verkleidung vorübergehend wechselten. Das Bühnenbild von Jürgen Kirner ermöglichte durch hohe Wände und Kästen schnelle Szenenwechsel, die der raschen Dramaturgie der Oper zugutekamen. Die sinnlich-triebhafte Ebene symbolisierten exotische Pflanzen in einem angedeuteten Dschungel, während ein leuchtendes Kreuz die Szene als Kloster kennzeichnet. Statthalter Friedrich sitzt vor einem Schrank mit vielen nummerierten Schubfächern, die ihn als Ordnungsfetischist kennzeichnen. Mit ironischem Augenzwinkern hat Sven Bindseil die Kostüme gestaltet. Christian Schatz sorgte für eine abwechslungsreiche Lichtregie. Die Choristen als „Volk“, das am Ende den Siegeskranz erringt, wurde von Thomas Eitler-de Lint präzise auf ihre mannigfaltigen szenischen wie sängerischen Aufgaben exzellent vorbereitet. Matthias Foremny, der bereits die Premiere 2013 dirigiert hatte, leitete auch dieses Mal das Gewandhausorchester mit Umsicht und größtenteils zufriedenstellend. Der finnische Bassbariton Tuomas Pursio gab den in seinen psychischen Zwängen verhafteten Statthalter Friedrich von Sizilien in Abwesenheit des Königs.

Stefan Sevenich hatte für Brighella, den Chef der Polizeidiener, seinen veritablen Bassbariton erklingen lassen. Der finnische Tenor Dan Karlström und der in Dortmund geborene Tenor Mirko Roschkowski gaben das Freundespaar Claudio, der eingekerkert wird, und Luzio in jugendlicher Frische. Der irische Bariton Padraic Rowan gefiel als Wirt Danieli, unterstützt durch Tenor Martin Petzold , Mitglied des Leipziger Thomanerchors, als dessen Diener Pontio Pilato. Der auf Färöer gebotene Tenor Herfinnur Árnafjall und der deutsche Bariton Franz Xaver Schlecht ergänzten rollengerecht in den Dienerrollen von Antonio und Angelo . Manuela Uhl glänzte als Claudias Schwester Isabella mit glockenhellem Sopran. Als ihr früheres Kammermädchen Dorella gefiel Magdalena Hinterdobler mit gut geführtem Sopran und keckem Wesen. Friedrichs verlassene Frau Mariana war in der Kehle von
Nina-Maria Fischer bestens aufgehoben. Wer hätte Richard Wagner eine solche südländische Leichtigkeit, gewürzt mit viel Humor und Leidenschaft, jenseits von Liebestod und Weltenbrand schon zugetraut? Das Publikum war begeistert und goutierte diese Rarität im Œuvre von Wagner mit langanhaltendem Applaus und zahlreichen Bravo-Rufen.
Harald Lacina, 26.6.22
Fotos: Kirsten Nijhof
MASKERADE
2. Kritik
Die Oper Leipzig ist bekannt für ihren Mut, auch Opern abseits des gängigen Repertoires aufzuführen – man denke nur an Wagners Frühwerke Die Feen, Das Liebesverbot und Rienzi. Nun wurde am Haus Carl Nielsens Komische Oper Maskarade inszeniert, die 1906 in Kopenhagen ihre Uraufführung erlebte und als dänische Nationaloper gilt. Das Stück fußt auf dem gleichnamigen Schauspiel von Ludvig Holberg und erzählt von den beiden Geschäftsfreunden Jeronimus und Leonard, die ihre Kinder Leander und Leonora verheiraten wollen. Diese haben sich bei einem Maskenball allerdings in andere Partner verliebt. Zu Beginn sieht man Leander und seinen Diener Henrik nach der durchzechten Nacht in einer Herrensauna – die leeren Sektflaschen in den Armen, die bunten Spitzhütchen noch auf den Köpfen. Cusch Jung hat die Geschichte mit leichter Hand inszeniert und dabei seine Erfahrungen als Chefregisseur der Musikalischen Komödie Leipzig eingebracht. Ausstatterin Karin Fritz stellte dafür sehr unterschiedliche Szenen auf die Drehbühne – die Sauna, einen Kosmetiksalon, in dem sich Jeronimus’ Gattin Magdelone pflegen lässt, das Arbeitszimmer des Gatten mit Landkarte, Tisch und Stühlen, eine nüchterne Hafenlandschaft mit zwei hohen Container-Wänden und schließlich der Ballsaal mit einem roten Samtvorhang und extravaganter futuristischer Deckenbeleuchtung aus unzähligen Glasflaschen. Opulent sind die Kostüme, vor allem beim Ball, wo es bunte Roben, Federschmuck und aufwändigen Kopfputz mit Insekten und Blüten zu bestaunen gibt. Die flotte Choreografie von Oliver Preiß hat großen Anteil an der starken Wirkung des 3. Aktes und die drei Tänzer Elisa Fuganti Pedoni, Germán Hipólito Farias und Davide De Biasi bringen sich mit viel Lust und Können in die frechen Travestie-Nummern und homoerotischen Episoden ein. Auch der Chor der Oper Leipzig (Einstudierung: Thomas Eitler-de Lint) ist mit Spaß und Temperament bei der Sache.
Nicht zuletzt sichert Dirigent Stephan Zilias am Pult des Gewandhausorchesters der 3. Aufführung am 15. 5. 2022 den Erfolg, indem er Nielsens Musik mit ihrem geistreichen Witz, ihrem sprühenden Esprit, den wirbelnden Turbulenzen und lyrischen melodischen Inseln mit Schwung, Delikatesse und dabei stets großer Umsicht ausbreitet.
Nicht ganz ausgewogen ist die Besetzung, welche Patrick Vogel als Leander mit lyrischem Tenor anführt. Sein schwelgerisches Duett mit Leonora, seiner Angebeteten, markiert den musikalischen Höhepunkt, denn mit Magdalena Hinterdobler steht dem Tenor eine Sängerin von hoher Kunstfertigkeit und substanzreicher Stimme zur Seite. Das zweite Paar des Stückes erreicht dieses Niveau nicht. Das liegt vor allem an Marek Reichert, der als Henrik mit gutturalem Bariton wenig Eindruck macht. Matt klingt besonders die Mittellage und die nötigen Falsett-Töne stehen ihm nicht zu Gebote. Einzig im forte in der oberen Lage gibt es zufrieden stellende Momente. Henriks Interesse gebührt Leonoras Zofe Pernille, die Sandra Janke mit gebührenden Soubretten-Tönen ausstattet. Die Nebenrolle der Magdelone (mit wüster Frisur) füllt Barbara Kozelj mit strengem Mezzo und exaltiertem Auftritt solide aus.
In zwei Charaktertenor-Partien bewähren sich Sven Hjörleifsson als wunderlicher Leonard, der zuweilen an den Franz aus Offenbachs Hoffmann erinnert, und Dan Karlström als Arv, der neben den geforderten Buffotönen auch über lyrische Valeurs verfügt. In zwei weiteren Partien wetteifern Bässe um die Publikumsgunst – Magnus Piontek als Jeronimus mit ausladender Stimme, aber auch schlichtem Empfinden für so eine schlichte Weise wie „Schön war es in alten Tagen“, und Sejong Chang, der den Nachtwächter mit solch profunder Stimme singt, dass man die Kürze seine Partie bedauert. Ein flotter Kehraus in Gesang und Tanz beendet das Stück, denn Leander und Leonora sind glücklich vereint.
Bernd Hoppe, 21.5.22
MASKARADE
Besuchte Premiere am 23.04.22
Gehobene Unterhaltung
TRAILER
Die letzte Premiere des Opernintendanten Ulf Schirmer, an der er aktiv nicht beteiligt ist, gilt Carl Nielsens selten gepielter Komischer Oper "Maskarade" (dänische Schreibweise!), die er vor vielen Jahren bei der DECCA als Gesamtaufnahme eingespielt hatte. Carl Nielsen ist wohl der bedeutendste dänische Komponist und bei uns vor allem durch seine Sinfonien bekannt; doch auch "Maskarade" taucht etwas häufiger in den Spielplänen auf, so an der Oper Frankfurt schon in dieser Saison. Oft wird das Werk als dänische Nationaloper bezeichnet, doch als typische Nationaloper kann man sie nicht bezeichnen, denn weder tümelt sie in der Musik typisch dänisch, noch hat die Handlung ein irgendwie patriotisches Thema; vielleicht sollte man sie einfach als die bekannteste dänische Oper nennen. Das gereimte Libretto der um 1906 komponierten Oper fußt auf eine Komödie des großen (dänischen!) Dichters Ludvig Holberg. Zwei ältere Hagestolze wollen ungefragt ihre Kinder verheiraten, die sich allerdings schon auf dem Maskenball ineinander verliebt haben. Alles strebt auf einen finalen Maskenball zu, auf den alle, bis auf den einen besonders renitenten Vater wollen, der prompt düpiert wird. Drei Dienstfiguren, wie aus der italienischen Commedia dell`arte, lassen aus dem "Jung gegen Alt" auch ein Spiel zwischen den Sozialstrukturen werden. Die Handlung kommt also etwas harmlos daher, die Übersetzung wirkt manchmal recht bieder, manchmal jedoch auch entzückend schrullig voll altertümlicher Wendungen, und bringt bei guter Textverständlichkeit durchaus einige Lacher. Nielsen Musik fängt in ihrer Vielgestltigkeit das gesamte Spektrum des Komponisten ein, bezaubernd instrumentierte Spätromantik, trifft raffinerte Technik des Satzes, daneben fast allzu schlichte Melodik, moderne Konversationsszenen neben fast italienisch wirkender Ensemblekunst. Doch Alles insgesamt wirkt wie von leichter Hand mit grundsätzlicher Fröhlichkeit durchleuchtet. Vielleicht kein direktes "Meisterwerk", doch absolut spielenswert.

Man hat sich an der Leipziger Oper für Cusch Jung als Regisseur entschieden, der sich vor allem als versierter Fachmann für das musikalische Unterhaltungstheater (Musical und Operette) ausgewiesen hat, einem Fach, das gerne mal unterschätzt wird. Die Rechnung geht auf; und Jung versucht nicht, das Ei neu zu erfinden, sondern das Werk mit seinen biederen Brüchen möglichst gut auf die Bühne zu stellen. Wichtigen Anteil daran hat die Ausstatterin Karin Fritz, die Bühnenbilder mit vielen Anspielungen an skandinavisches Design, durchaus modern, wie elegant, selbst die farbigen Schiffscontainer wirken so schön, das das finale Bild des Maskenballes mit den hinreißenden Fünfziger-Jahre-Kleidern einen verdienten Szenenapplaus bekommt; die Sauna des ersten Bildes finde ich persönlich mit ihrer an Alvar Aalto erinnernden Optik noch schöner, trotz des Kronleuchters des Balles, der aus 466 Flaschen besteht! Im Ballakt, aber auch vorher, wird durch den Choreographen Oliver Preiß sehr gelungen das nötige tänzerische Element involviert. Man hat dabei die Komödie, die eigentlich im Jahr 1723 spielt, behutsam an unsere Zeit gerückt.

Ja, wir haben auch immer noch Corona-Zeit, die ja in der Öffentlichkeit gerne vergessen wird, doch an den Theatern durch Umbesetzungen und Erkrankungen sehr präsent ist. Was tun , wenn bei einer solchen Opernrarität, zwei Tage vor der Premiere "der Tenor" krank wird. Mit Glück einfach den wohl besten Interpreten der Partie an Land ziehen: Gert Henning Jensen hatte schon in Schirmers Aufnahme vor sehr vielen Jahren den jungen Tenorliebhaber Leander gesungen und macht den äußerst gelungenen Sprung, allerdings auf Dänisch. Jensen gelingt es auf der Bühne immer noch glaubhafte Jugendlichkeit zu versprühen und erfreut durch leuchtenden Tenorgesang und enorme Spielfreude. Die anderen Sänger sind ebenfalls hochmotivert und, was wirklich sehr auffällig ist, alle von hervorragender Textverständlichkeit (sogar das Dänisch des Einspringers kann man verstehen!), was auch einen Teil des Erfolgs ausmacht. Der oberbiestige Papa Jeronimus liegt in der sonoren Basskehle von Magnus Piontek gerade recht, wie seine Angetraute Magdelone mit dem samtigen Alt von Barbara Kozelij ausgestattet ist, bloß die ältliche Mutter nimmt man der attraktiven Sängerin schwerlich ab. Ein Kabinettstück in der Darstellung eines viel älteren Mannes gelingt Sven Hjörleifsen als lebensfroherer Papa Leonard, hier passend ein geschmeidiger Tenor.

Das Liebespaar zu komplettieren, gefällt Theresa Pilsl mit angenehm tremolierendem Sopran, die stimmlich wunderbar Gert Henning Jensens Tenor ergänzt. Musikalisch wichtig ist der Diener Henrik, ein wenig Mozarts Figaro nahegelegt, ist er mehr Leanders Freund, als angestellt. Marek Reichert singt ihn mit substanzreichem Bariton, bleibt aber als Figur etwas steif. Die kleinere Dienerrolle bietet Dan Karlström , sein Arv wirkt stimmlich und szenisch auf den Punkt. Dem Henrik zugesellt wird Leonores selbstbewußte Zofe Pernille, Sandra Janke weiß mit präsentem Mezzosopran für sich einzunehmen. Unter den vielen kleineren Gesangspartien sticht gesanglich und komödiantisch Fredrik Essunger als Maskenverkäufer heraus. Der Chor der Oper Leipzig zeigt seine Qualitäten szenisch, tänzerisch und gesanglich vor allem beim Maskenball. Stephan Zilias läßt das Gewandhausorchester schier aufleuchten, vor allem in der Ouvertüre und im Vorspiel zum zweiten Akten hört man Verzauberndes. Er sorgt aber auch für unglaubliche Durchhörbarkeit des Orchestersatzes, was ein Grund der beachtlichen Textverständlichkeit ist. Lediglich kleine Pausen zerreissen manchmal den Konversationsfluß auf der Bühne.

Von dieser Unterhaltungsnummer und der freundlichen Spätromantik Nielsens sichtlich überrascht, gab sich das Publikum gerne dem Verschnaufen des Alltags mit Krieg und Krankheit hin. Es wurde gekichert und gelacht und sich einfach mal erfreut. Die optische Schönheit der Ausstattung, nicht hoch genug zu veranschlagen dank Karin Fritz, tat das ihrige dazu. Großer und berechtigter Schlussjubel. Vielleicht ist "Maskarade" nicht das Meisterwerk, auf das die Welt gewartet hat, aber die Produktion bringt die besten Seiten der Oper zum Funkeln. Eine Reise nach Leipzig lohnt sich.
Martin Freitag, 26.4.
Fotos von Kirsten Nijhof
Lohengrin als Kammerspiel
Zweite Kritik
Nach der Absage von Katharina Wagner für die Neuinszenierung von Richard Wagners Lohengrin am Opernhaus Leipzig fiel es dessen Künstlerischem Produktionsleiter Patrick Bialdyga zu, in kürzester Frist für einen Ersatz zu sorgen. Er nutzte seine Kurzfassung des Werkes von 2020, die Corona bedingt ohne Chor auskommen musste, für eine Überarbeitung – diesmal mit dem Chor, der im Hintergrund in einem zweistöckigen Bühnenaufbau (Norman Heinrich) positioniert ist und zumeist im Dunkel bleibt. Immerhin sind der Chor und Zusatzchor der Oper Leipzig (Thomas Eitler-de Lint) wenigstens akustisch deutlich vernehmbar und glänzen in den großen Chorszenen mit Kraft und Wohllaut.
Die Idee des Regisseurs, die Romantische Oper als Kammerspiel zu inszenieren, mutet seltsam an. Er verzichtet auf große Tableaus und Aufmärsche, konzentriert das Geschehen in einem halbhohen grauen Raum, dessen hintere Wand fünf schmale Öffnungen aufweist und der mit langen Tischen und Stühlen ausgestattet ist. Pausenlos wird das Mobiliar zu verschiedenen Schauplätzen geordnet – zum Kampfplatz für das Duell zwischen Lohengrin und Telramund, das Duett zwischen Elsa und Ortrud, das Brautbett und ein Podest für Lohengrins Abschied. Darüber hinaus gibt es merkwürdige Einfälle – so Telramund als Blinden zu zeichnen, der noch dazu an einem Schachbrett sitzt und durch seine Behinderung im Kampf mit dem Schwanenritter von vornherein benachteiligt ist. Ungewöhnlich geführt ist auch der Heerrufer (Martin Häßler mit jugendlichem Bariton) im Business-Anzug (Roy Böser & Jennifer Knothe), mit dem Ortrud ein Verhältnis hat, wovon mehrere Verführungsszenen zeugen. Am Ende des 2. Aufzuges eskaliert die Situation, wenn der Heerrufer eine Pistole auf Lohengrin richtet, der ihn entwaffnet und auch Ortrud vor dem Suizid bewahrt. Wenn am Ende der vermisste Gottfried unter einem Haufen von Schwanenfedern hervor kriecht und Ortrud den Heerrufer anstachelt, den Knaben zu erschießen, richtet dieser die Waffe auf Ortrud selbst. Sonst erschöpft sich die Inszenierung in Arrangements an der Rampe, in willkürlichen Auftritten und Abgängen sowie abgegriffenen Bildern wie einem Sektkübel im Brautgemach.
Auch für den Stargast des Abends, Klaus Florian Vogt in der Titelpartie, fand die Regie keine attraktiven Auftritte. Im grauen Pullover kommt er wie beiläufig von links herein, im Arm eine Glaskugel mit einem weißen Schwan. Zunächst hört man seinen knabenhaften, anämischen Tenor, der erst später an Kontur gewinnt. In der Höhe verfügt die Stimme inzwischen an metallischer Durchschlagskraft. Im Brautgemach trägt er einen Gehrock, klingt anfangs keusch und bar jeder Sinnlichkeit. Die Gralserzählung absolviert er souverän und stattet sie mit überirdischen Tönen aus.
Elsa in Gestalt von Gabriela Scherer wird schon im Vorspiel in einem Spot gezeigt, wo sie von Ortrud Gottfrieds Kleidungsstücke erhält. Die Stimme der jugendlich-dramatischen Sopranistin ist warm und empfindsam, darüber hinaus vorbildlich in der Artikulation. Und sie verfügt auch über die Kondition zur Bewältigung der ausgedehnten Brautgemach-Szene. Kathrin Göring als blonde Gegenspielerin Ortrud im blauen Hosenanzug beherrscht die Bühne durch ihre enorme Präsenz. Dem hellen Mezzo fehlt es vielleicht an interessanter Farbe, nicht aber an Kraft und Charakter. Fulminant gerät die Götteranrufung, brutal attackiert sie danach Elsa in beider Duett, um ihr danach beim Brautchor heuchlerische Komplimente zu machen. Tuomas Pursio brauchte als Telramund einen ganzen Aufzug, um seinen tremolierenden, verquollenen Bariton in Form zu bringen. Im 2. Aufzug gab es dann imponierende Ausbrüche von grimmigem Ausdruck. Randall Jakobsh muss als König Heinrich ständig eine Papp- mit der goldenen Krone wechseln. Der Bass klingt dumpf und brüchig, dazu limitiert in der Höhe.
Christoph Gedschold hält mit dem Gewandhausorchester Bühne und Graben souverän zusammen. Dem ersten Vorspiel fehlt es noch an ätherischem Zauber, aber die düstere Stimmung der Einleitung zum 2. Aufzug trifft der Dirigent genau. Beeindruckend geformt sind die großen Ensembles der Aktschlüsse, betörend ist der Streicherglanz im Duett Elsa/Ortrud. Nach der 2. Aufführung der Neuinszenierung am 3. 4. 2022 spendete das Publikum reichen Beifall. Wagner 22 in Leipzig ist nun komplett und kann im Rahmen der Festtage im Juni/Juli als geschlossener Zyklus mit 13 Werken gezeigt werden.
Bernd Hoppe, 5-4-2022
Bilder siehe unten!
26. März 2022
Das Opernhaus Leipzig komplettiert mit Lohengrin sein Wagner-Repertoire.
Patrick Bialdyga inszenierte unter extremer Zeitnot anstelle von Katharina Wagner.
Die Lohengrin-Inszenierung von Patrick Bialdyga, deren Premiere wir am 26. März 2022 besuchten, ist der Schlussstein des Hauses für sein Wagner-Repertoire aller dreizehn abgeschlossenen Bühnenwerke des in Leipzig geborenen Dramatikers und Komponisten.

Ursprünglich wollte die Urenkelin des Komponisten Katharina Wagner, als ihren zweiten Anlauf im Leipziger Haus, die Oper bereits im November 2020 auf die Bühne bringen. Ihre schwere Erkrankung und die Corona-Pandemie führten zu einer Verschiebung des Vorhabens in das Frühjahr 2022. Mangelnde Kommunikation, Missverständnisse, was immer auch, hatte zur Folge, dass Frau Wagner sich ausschließlich auf eine Parallel-Inszenierung in Barcelona konzentrieren möchte und die Arbeit in Leipzig beendete.
Das Vorhaben der Oper Leipzig, mit dem Projekt „Wagner 22“ in einem dreiwöchentlichen Festival alle dreizehn Werke als Eigenproduktion aufzuführen, machte aber eine Neuinszenierung unabdingbar.
Am 7. Februar 2022 begannn Patrick Bialdyga mit dem Bühnenausstatter Norman Heinrich, dem Kostümbildner Roy Böser, dem Chorleiter Thomas Eitler-de Lint und den Gesangssolisten mit der Inszenierungsarbeit, um innerhalb von sieben Wochen mit „heißer Nadel“ die vorgestellte Wagener-Interpretation zu stricken.

Regietheater im Opernhaus ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Aber was Bialdyka mit dem zweiten Akt des Lohengrins auf die Bühne brachte, wie er das Wagnersche Anliegen dieser Schlüsselszenen zum Kammerspiel regelrecht eindampfte, grenzt für mich an Vollkommenheit. Auf der ansonsten kahlen Spielfläche symbolisierten unterschiedliche Anordnungen von drei wuchtigen Tischen und fünf Stühlen die Handlungsfäden, die sonst Statisten und Chor bewerkstelligen mussten, so dass der Chor auf die Hinterbühne verbannt werden konnte.
Das Schachspiel des Telramund aus dem ersten Akt, wo bereits der Nichtsehende die Logik der Figurenbewegungen nicht beherrschte, wurde von Ortrud durch esoterisches Kartenlegen ersetzt. Auch als Lohengrin vergeblich versuchte, das Schachspiel wieder „ins Spiel“ zubringen, waren das Verfremdungsaspekte, die Handlungen zügig voranbrachten.
Schlüssig auch, wenn Elsa und Ortrud um den in der Glaskugel eingeschlossenen Schwan streiten; dazu brauchte man kein Textbuch. Eine Besonderheit der Inszenierung und voller Symbolkraft war das erotische Verhältnis des Herrufers mit Ortrud: mal spielte es sich in Gegenwart des blinden Telramund ab und mal vergewaltigte Ortrud den verdutzten Beamten. Letztlich verhindert er aber Ortruds Suizid. Die Brautgemachs-Szene gestaltete die Regie fast klassisch, auch wenn das Brautbett aus den drei Tischplatten und symbolischen Schwanenfedern recht spartanisch gebildet war.
Elsas Trauer um den erschlagenen Telramund erinnerte, dass doch vor Ortruds Intrige des ersten Aktes eine intensivere Beziehung zwischen Elsa und Telramund existiert haben musste, war da aber nicht schlüssig thematisiert gewesen. Offenbar hatte sich Bialdyka etwas in der, durchaus Wagner-adäquaten Idee, Telramund als den Nichtsehen-Könnenden und den das Figurenspiel Nichtbeherrschenden darzubieten, doch etwas verrannt. Deshalb kam es im ersten Akt zu wenig schlüssigen, absurden Abläufen, die nach meinem Empfinden den hervorragenden Eindruck seiner Arbeit schmälerten.
Dass die Oper tragisch enden muss, hat bereits Wagner hinein komponiert, indem er Elsa und Lohengrin mit unvereinbaren Tonarten aufeinander prallen lässt.
Bialdyga Anliegen, das persönlichen Ringen der Protagonisten um Vertrauen, Zuneigung und Macht, um die Geschichte sehr einsamer Menschen, darzustellen, ist ihm gelungen.
Als Richard Wagner im Sommer 1846 im „Schäferschen Gut“ zu Graupa seine romantische Oper „Lohengrin“ konzipierte, wollte er zunächst einen ziemlich ausgedehnten Schlussakt gestalten. Die Gralserzählung hatte einen zweiten Teil, in dem Lohengrin eindrucksvoll die Meerfahrt des Schwans mit dem Schifflein schildert. Zudem plante Wagner in der ersten Lohengrin-Kompositionsskizze auch ein zartes „Lied des Schwanes“, bevor dieser in den herzoglichen Sohn Gottfried zurück verwandelt werde:
Leb wohl, du wilde Wasserflut,
Die mich so weit getragen!
Leb wohl, du Welle blank und rein,
Durch die mein weiß´ Gefieder glitt!
Am Ufer harrt mein Schwesterlein,
Das soll von mir getröstet sein.
Wagner habe „ wegen der Notwendigkeit dramatischer Haushaltung“ auf dieses Schwanenlied verzichtet und den zweiten Teil der Gralserzählung vor der Weimarer Uraufführung 1850 ebenfalls gestrichen, um die Tenöre nicht über Gebühr zu belasten. Von Bialdyga wurde die Rückwandelung des Erben von Brabant prosaischer vollzogen.
Das aufgebotene Ensemble der Singenden und Spielenden war hervorragend:
Den Lohengrin von Klaus Florian Vogt sollte man nicht mehr mit normalen Maßstäben messen. Seine Stimme hatte eine absolut sichere Führung, verfügte über alle Ausdrucksmöglichkeiten und verliert auch im dramatischen Bereich nichts von ihrer Klangschönheit. Seine Gralserzählung überzeugte mit lyrischen und dramatischen Aspekten. Die betörende Schönheit seiner „Taube“ können wenige Tenöre in dieser Liga bieten.
Gabriela Scherer sang ihre Elsa mit ausdrucksstarkem, variantenreichem, dynamischen Sopran, den sie fast beliebig lyrisch-zart als auch dynamisch einsetzen konnte. Nichts wirkte angestrengt, wenn sie die Elsa als unschuldige, romantische, liebenssehnsüchtige darstellerisch und sängerisch exzellent bietet. Als Ortrud überraschte uns eine starke Kathrin Göring. Verschlagen und diabolisch bot sie eine Machtpolitikerin und Manipulatorin mit kräftigem energiegeladenem Gesang, der durchaus auch maliziös über den Bühnenrand kommen konnte. Als Königsmacherin ging sie ohne Skrupel regelrecht über Leichen, um sich selbst an die Spitze Brabants setzen zu können.
Sehr stark und glaubwürdig als Friedrich von Telramund agierte auch Simon Neal. Er demonstrierte überzeugend, zutiefst im Recht zu sein, ohne zu wissen, dass er nur eine Marionette war. Einen respektablen König Heinrich der Vogler gestaltete Günther Groissböck mit seinem kraftvoll-geschmeidigen Prachtbass.
Der Heerrufer von Mathias Hausmann überzeugte mit der klaren und kräftigen Stimmführung seines wohlklingenden Baritons, wobei er auch darstellerisch einige Petitessen meistern musste.
Der Chor der Oper Leipzig bestach mit seiner Präzision, Geschlossenheit insbesondere in den leisen Passagen und den vielstimmigen Chorsätzen.
Das Gewandhausorchester mit dem Dirigat Christoph Gedscholds lieferte den Orchesterpart mit dem derzeitigen Niveau des Klangkörpers ab. Die Bläser sind erstklassisch, aber es fehlt der Kapelle derzeitig der weiche Streicherteppich und auch etwas die Präzision, so dass das „Lohengrin-Vorspiel“ die Vorstellung unwürdig einleitete.
Aber da sind wir doch etwas mäkelig auf hohem Anspruch, denn die Sängerbegleitung schien doch recht sängerdienlich und Gedschold konnte auch einige Glanzlichter setzen. Große Begeisterung der Besucher, die die Premieren-üblichen Buhrufe erstickten, über diese würdige Repertoire-Komplettierung.
Bilder (c) Kirsten Nijhof
Thomas Thielermann 29.3.2022
21. November 2021 3. Aufführung
Die Meistersinger von Leipzig 2021
Ein Versöhnungsversuch des Regietheaters mit dem konventionellen Publikum

Unser Besuch der Premiere der neuen Leipziger „Meistersinger-Inszenierung“ war dem Chemnitzer „Tristan“ zum Opfer gefallen. Die zweite Vorstellung blockierte das „Schuch-Gedenkkonzert“ in Dresden. Aber die Fachkritik der Arbeit des Briten David Poutney war derart differenziert, zum Teil unsicher, dass letztlich die Neugier siegte, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und die letzte Aufführung vor der neuerlichen Corona-Schließung zu besuchen.
Sollte am 26. März des kommenden Jahres die Lohengrin-Inszenierung der Katharina Wagner noch über die Bühne gehen, so verfügt die Oper Leipzig als eine der wenigen Häuser weltweit über den kompletten Reigen der Bühnenwerke Richard Wagners einschließlich der Frühwerke. Mithin bleibt der Oper Leipzig unbedingt auch die Aufführungskompetenz der Werke des Sohnes der Stadt.
Was bei den Regietheater-Aufführungen guter Häuser üblicherweise bleibt, ist der musikalische Eindruck. Die Musiker des Gewandhausorchesters waren vor allem professionell-souverän und das Dirigat Ulf Schirmers eben wie Ulf Schirmer, eben etwas direkt, Wohlmeinende sagen prägnant, und nicht immer bühnenfreundlich. Herausragendes boten die Holzbläser des Orchesters und über weite Strecken die beiden Chöre dank der Einstudierung en von Thomas Eitler-de Lint.

Den Hans Sachs sang mit seiner doch in allen Lagen prachtvollen Baritonstimme James Rutherford als einen eloquent, altersweisen, in sich ruhenden, geradlinigen Menschen und nicht den besserwissenden Künstler. Packend beeindruckte sein Fliedermonolog und der Wahn-Monolog. Die im Haus als Hochdramatische bewährte Elisabet Strid bewies, dass sie ihre enorme Stimme auch mädchenhafter, lyrisch-verhaltener, zerrissener einsetzen kann und damit die Eva bravourös überzeugend darbot. Die Magdalena der Haus-Mezzosopranistin Kathrin Göring fand ich charakteristisch gut spielend, vor allem spannend in den Szenen mit dem bravourös-balcantisch singenden David von Matthias Stier, einem ausgesprochenen Komödianten.
Mit seiner souveränen Strahlkraft und dem verführerisch-lockerem Spiel des Magnus Vigilius war ein passgenauer Walter von Stolzing aufgeboten, der letztlich alle Wünsche erfüllte.
Der stimmlich gewaltige Bassist Randall Jakobsh aus Kanada führte die Riege der Meistersinger als Veit Pogner eher unauffällig an. Die Gruppe mit Sven Hörleifsson als Kunz Vogelsang, Marek Reichert als als Konrad Nachtigall, Trick Vogel als Balthasar Zorn, Alvaro Zambrano als Ulrich Eißlinger, Paul Kaufmann als Augustin Moser, Franz Xaver Schlecht als Herrmann Ortel, Roman Astakhov als Hans Schwarz und Jean-Baptiste Mouret als Hans Foltz waren gesanglich und darstellerisch richtig in Ordnung, fielen vor allem durch ihre prachtvollen Gewänder von Marie Jeanne Lecca auf. Jedoch lediglich Tobias Schnabel konnte sich aus der Gruppe als Fritz Kortner profilieren.
Der Sixtus Beckmesser, dargestellt vom ausgezeichnet singenden Mathias Hausmann, gehört zwar auch, als der eigentlich gebildetere Stadtschreiber, zu den Meistersingern. Er war aber komplett in schwarz gekleidet und mit einem Käppchen ausgestattet. In den Premierenkritiken ist die zwielichtige Aufmachung des hervorragend agierenden Matthias Hausmann untergegangen, weil er da nur Playback agierte. Ein Ersatzmann sang und Hausmann begeisterte das Fachpublikum mit seiner pantomimischen Leistung. Er kann tatsächlich nicht nur singen, sondern auch Slapstick bieten.

Richtig gut besetzt auch war der Nachtwächter mit Sejong Chang
Bezüglich des Musikalischen war der Abend ein großer Gewinn.
Bleibt noch die Meinungsbildung zur Inszenierung von David Poutney:
Natürlich ist es bei der reichhaltigen Rezeptionsgeschichte der „Meistersinger“ inzwischen schwierig, etwas wirklich Neues auf die Bühne zu bringen. Das Stück auf die Dreiecksbeziehung und die Liebesgeschichten zu konzentrieren oder es als simple Volkskomödie zu inszenieren wagt heutzutage wohl kein Regisseur, der irgendwo noch weiter beschäftigt werden möchte.
Vor diesem Vorwurf hat der Brite Leslie Travers den Regisseur bewahrt, indem er parallel zur Handlung mit seinen Bühnenbauten eine Geschichte mit Episoden aus der deutschen Historie erzählt, (fast) ohne in die Handlung einzugreifen:
Im ersten Aufzug wurde uns ein Miniatur-Nürnberg als eine florierende mittelalterliche Stadt vorgestellt. Die einem Amphitheater nachempfundene Umrandung der Stadt wurde von Handwerkern weiter mit Patrizier-Häusern bebaut. Diese erwiesen sich dann allerdings als die Sitze der Meistersinger. Die Singenden und Spielenden mussten sich von einer recht geschickten Personenregie ohne rechte Not in den Gassen durchwursteln lassen, aber es passte schon.
Der zweite Aufzug erlaubte uns einen Blick aus dem Vorraum des Sachs´schen Hauses auf das Mini-Nürnberg. Die an das Nürnberger Reichsparteitagsgelände erinnernde Beton-Umrandung der Stadt wirkte mit ihrer Leere schon bedrohlich. Und tatsächlich stürzten vom rechten Treppenteil schwarzgekleidete Horden auf die vom linken Treppenteil stürmende rotgekleidete Gruppe und lieferten eine deftige „Prügelfuge“ ab, während das Nacht-gewandete Nürnberger Bürgertum von der mittleren Dammkrone, teils entsetzt, teils interessiert, zuschaute. Die Weimarer Demokratie war zerschlagen, und wer es noch nicht begriffen hatte, dem wurde ein Video vom zweiten Weltkrieg einschließlich des zerstörten Landes eingespielt.
Die Trümmer der Auseinandersetzung wurden am Beginn des Schlussbildes beseitigt und von fleißigen Handwerkern wurde eine Miniaturausführung des Berliner Reichstags, als Symbol der deutschen Wiedervereinigung in der Mitte der Festwiese aufgebaut.

Da beschlich mich sogar der Verdacht, ob bei der Betrachtung deutscher Geschichte durch die beiden britischen Herren nicht Margret Thatchers Misstrauen gegen ein einheitliches Deutschland unterschwellig zu deren Gedankengut gehört. Dieser Gedanke kam mir, als das Reichstagsmodell als Podest der Preislied-Sänger genutzt wurde und Walter von Stolzing beim Singen seines Triumphlieds auf
unserem Parlament herumtrampelte.
Eine Rezensentin der Premiere beklagte, dass der historische Kontext der Inszenierung vor dreißig Jahren abschloss und regte an, dass Poutney die Demokratiedefizite der Sachsen hätte reflektieren oder Beckmesser als Querdenker aufmarschieren lassen können.
Die „Schusterstube“ war als Kammerspiel, da wo von Wagner vorgesehen, zwischengeschaltet und mit den unumgänglichen Verfremdungen versehen, in dem der bis zu diesem Teil der Vorstellung in moderner Freizeitkleidung agierende Stolzing aus der Dusche des mittelalterlichen Hauses kam, sich die Haare trocknete und anschließend in Weiß gewandet wurde. Gleiches passierte auch David, der bis dahin mittelalterlich gekleidet war, und der Magdalena. Die Eva kam schon im Brautkleid auf die Szene, so dass das „Quintett“ nur Hans Sachs aus der „Orgie in Weiß“ ausschloss.
Im Finale erhielten auch die Gender-Feministen ihr Sahnehäubchen: als Stolzing nämlich doch noch die Macho-Meisterketteakzeptierte, verließ Eva, schon wieder zeitgemäß gekleidet, mit einer Gruppe junger Frauen fluchtartig die Szene.
Den Besuchern hat es offenbar gefallen. Selbst bekennende „Konservative“ äußerten sich begeistert.
Bei der Beschäftigung mit der Historie der Aufführungen des Wagners-Werkes in seiner Geburtsstadt, bin ich auf ein Zitat im Programmheft der „Meistersinger-Inszenierung“ der Oper Leipzig von Joachim Herz des Jahres 1960 gestoßen. Das war jene Inszenierung, mit der das Haus eingeweiht worden war. Es gab damals eine heftige Diskussion, ob bei der herrschenden Wohnungsnot ein Opernhausneubau dringlich wäre:
„Das Spiel von den Meistersingern und ihrer Zunft wurde von Wagner ersonnen, um im Gleichnis einer fernen Vergangenheit ein Ziel für die Zukunft abzustecken-ein Ziel, erträumt aus den Misshelligkeiten eines Künstlerlebens und den Stürmen der Jahre 1848; ein Ziel, das auch für uns als schönste und schwerste Aufgabe noch vor uns liegt: Künstler und Volk, Kunstwerk und Gemeinde, Produzierende und Aufzunehmende zu vereinen“.
Thomas Thielemann, 21.11.21
© Kirsten Nijhof
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
Besuchte Aufführung am 06.11.21 (Premiere am 23.10.21)
Derbes Fasnachtsspiel
Vielleicht war meine eigene Erwartungshaltung diesmal zu groß, denn ich habe in der Oper Leipzig so viele tolle Abende erlebt; mit Ulf Schirmer am Pult und David Pountney für die Szene standen erstklassige Künstler auf der Besetzung, na, ja, von Anfang an: Schon das Vorspiel ließ nichts Gutes ahnen,denn mir liegt "Meistersinger" als feine Konversationskomödie , so in der wundervollen Aufnahme unter Rudolf Kempe, am Herzen, geschwinde Tempi für den komischen Duktus der Oper mit feinen Übergängen des zwischenmenschlichen Geflechtes der Personnage. Doch Schirmer knallt einem das C-Dur direkt in die Gehörschnecke, sehr blechlastig, einzelne Orchesterstimmen eher gegeneinander absetzend, als zu einem Gesamtklang verbindend. Die Lautstärke wurde dann mit Auftreten der Sänger gekonnt modifiziert, doch die Probleme blieben die ganze Vorstellung über erhalten . Was schlimmer war,man hatte ständig das Gefühl, daß der Draht zwischen Graben und Bühne gestört war. Denn es gab keinen der Hauptprotagonisten, wo es nicht zu Wacklern kam, deutlich den Tempi des Dirigenten geschuldet. Auch der Kontakt zum Chor war nicht ideal, was man vor allem bei den Lehrbuben bemerken konnte; die Prügelfuge geriet dann auch "aus den Fugen". Ein weiteres Problem, oft konnten im Orchester nicht einzelne Töne ausklingen, sondern klangen wie abgewürgt. Insgesamt einrecht uncharmanter "Meistersinger"-Ton. Der schlechteste Eindruck, den mir der eigentlich geschätzte Ulf Schirmer, bisher hinterließ.

Leslie Travers gibt für die gesamte Oper eine Art graues Beton-Amphitheater vor, mit einem Reichsparteitag-Charme vor schwarzem Horizont. Was wirklich wunderschön ist:das filgrane mannshohe Modell eines mittelalterlichen Nürnberg, das auch robust betretbar war, hier ein ganz großes Lob an die Werkstätten der Leipziger Oper. Im zweiten Akt flankieren zwei riesige Hauselemente die Nürnberger Gasse, über das sich nach dem Chaos der Johannisnacht das Bild des zerbombten Nürnbergs senkt. Über der puppigen Schusterstube mit Butzenscheibe befindet sich dann das zertörte Nürnberg auch als Holzmodell, das zur Festwiese überdeckelt wird. Ein Reichtag mit moderner Kuppel (!) als Singhügel erzählt von der Aktualität der Verhandelbarkeit des öffentlichen Wesens. Dazu Marie Jeanne Leccas Kostüme: neben heutiger Bekleidung wird immer mit historischen Bildern gearbeitet, so treten die "Meistersinger" offiziell in nostalgischen Renaissance-Prunkgewändern auf. Der Aufmarsch der Handwerker läßt wiederum an eine Demo der Werktätigen zum Ersten Mai denken. Warum David allerdings als einziger Lehrbube eine reich geschlitzte Landsknechtshose samt Schamkapsel trägt, verstehe ich nicht ? So die optischen Gegebenheiten der Inszenierung schon mal zum Gesamtverständnis. Manko am Bühnenbild: die vielen Treppen, wo auch schon einmal Protagonisten sich verdecken und natürlich die gefährlichen Stolperfallen des Holzmodells für die Sänger.

Von Anfang an eine etwas derbe Personenführung, die mehr an einen Schwank denken lassen: oft verdoppeln die Gesten allzu grob den Text (ich denke, also fasse ich mir an den Kopf, etc.), die jungen Leute müssen juvenil herumhopsen, um ihre Jugendlichkeit zu betonen (vor allem Eva). Dadurch bekommt die ganze Personenführung etwas sehr Oberflächliches, Gespieltes, und die Figuren geraten selten an eine psychologische Dimension. Ein besonderer Fall ist ja immer der Merker Beckmesser, der eigentlich mit die spannendste Musik hat; ich glaube das Wagner durchaus sowohl ein antisemitisches Bild eines Menschen (so kann man durchaus synagogale Melismen aus seiner Musik heraushören), als auch privates Hühnchen mit dem Musikkritiker Eduard Hanslick in dieser Figur auskocht. Mathias Hausmann tritt ganz in Schwarz und einem Käppchen, das an die rituellen Schläfenlocken erinnert, deutlich als Außenseiter unter den Meistern auf, doch sein Erscheinen wirkt nicht so ältlich, das er nicht als möglicher Bewerber gelten könnte. Sein durchweg belkantesker Gesang mit virilem Bariton unterstreicht das. Ab dem zweiten Akt muß er jedoch Klamotte spielen, die die ganze Spannung des Charakters untergräbt oder eine bloße Farce daraus macht. Andere Figuren des Personals geraten Pountney zwar konventioneller , aber auch glaubhafter. Pountney möchte im Finale wohl zeigen, daß eine Gesellschaft aus verschiedenen Meinungen besteht;so läßt er Eva das Schlussbild verlassen, während Sachs Stolzing mit Ruhm und Ehre in die (Meistersinger-)Gesellschaft einholt, das kommt jedoch recht plötzlich und unmotiviert daher. Also man merkt durchaus Pountneys Intention, aber irgendwie kommt das nicht überzeugend herüber.

Die Sänger: James Rutherford als Sachs dürfte zu den führenden Sängern dieser Partie gehören, sein wundervoller Bass gefällt einfach in jeder Lage , sonore Tiefe, leuchtende Höhe, alles da, doch gelingt die vokale Umsetzung an diesem Abend mehr, als die gefühlte Durchdringung. Über die Probleme von Sebastian Pilgrim (Pogner) schrieb ich schon bei Ullmanns "Antichrist", bei einer bekannten Partie sticht das noch mehr heraus: sein eigentlich klangvoller Bass wird sehr durch eine abdunkelnde Vokalbehandlung eingetrübt, die Stimme findet nicht richtig in "die Maske" und klingt stumpf und mulmig. Tobias Schabel singt mit metallischem Bariton einen anhörlichen Kothner. Die anderen Meister sind hervorragend bis solide aus dem Ensemble besetzt. Magnus Vigilius ist zum ersten ein enorm textverständlicher Stolzing, zum zweiten ein imposanter Tenor mit enormer Stamina, der genau weiß, wann er "aufdrehen". muß. Trotzdem möchte ich prophezeihen, das der Stolzing mit seiner dauerhaft hohen Tessitur nicht zu seinen Haupt- oder Lieblingsrollen gehören wird. Elisabet Strid ist stimmlich eigentlich, durch ihre sonst dramatischeren Partien, über die Eva hinweg, es gelingt ihr allerdings wunderbar den Sopranbogen im Quintett zu spannen, ohne herauszuragen.Leichte Trübungen in der Höhe solltenbeachtet werden. Katrin Göring habe ich besser in Erinnerung als in der Partie der Magdalene, ihr Mezzosopran klingt diesen Abend unauffällig und sogar etwas unfrisch. Ganz hervorragend der David von Matthias Stier, vielleicht der farbenreichste Vortrag des Abends; sein Vortrag über den Meistergesang ist ungemein abwechslungsreich, lediglich in der Höhe kommt er an seine Grenze. Sejong Chang fällt als Nachtwächter positiv auf.
Wie bereits in der Einleitung gesagt, vielleicht war meine Erwartungshaltung einfach zu hoch, vielleicht hatte ich auch das "Pech" einer "zweiten" Vorstellung.
Martin Freitag, 10.11.2021
Bilder /c) Kirsten Nijhof
DER STURZ DES ANTICHRIST
Besuchte Aufführung am 10.10 2021 (Premiere am 25.09.2021)
Esoterische Science-Fiction-Oper?
TRAILER
Viktor Ullmann ist den Opernfreunden durch seine im Konzentrationslager Theresienstadt entstandene Oper "Der Kaiser von Atlantis" bekannt, die durch Länge und Besetzung geeignet, in der Corona-Zeit öfters auf die Bühnen fand und ihre Bühnenwirksamkeit bewies. Als erst vierte Bühne und als erstes größeres Opernhaus (nach der UA in Bielefeld (1995), noch in Hof und Olmütz) wagte sich die Oper Leipzig an eine Neuproduktion, die jetzt ,nach den Corona-Lockdowns, endlich zu ihrer Premiere kam. Das Libretto stammt von Albert Steffen, der ,nach dem Tod Rudolf Steiners, zum führenden Haupt der Anthroposophie-Bewegung wurde. Das vertonte Schauspiel stammt aus dem Jahr 1928 und wurde vom Komponisten 1935 geschrieben, die Wiener Staatsoper traute sich nicht mehr an eine Uraufführung, der Rest ist Geschichte. Soviel nur, um das Werk zeitlich zu verorten.

Die Handlung: in einem totalitären Staat versucht der Herrscher den Techniker (Überwindung der Naturgesetze durch Konstruktion eines Raumschiffs), den Priester (Segnung von Brot aus Steinen) und den Künstler (Lobpreis des Tyrannen) auf seine Seite zu ziehen; letzterer wiedersteht und wird eingekerkert. Dort wird er von einem Kerkerwärter in die Lehre des "alten Meisters" initiiert und überwindet das Körperliche durch die Erfahrung von Tod und Wiedergeburt im Hungerdelirium. Der Tyrann erschießt den Techniker, der nach einem Weltraumprobeflug das furchtbare Ansinnen des Tyrannen erkennt; der Priester wird nach Verkostung des sythetischen Brotes zum Tier und wahnsinnig. Der Herrscher schwingt sich mit dem Raumschiff ins All und stürzt zu Tode. Die Menschen können wieder aufatmen. Die Musik des Bühnenweihfestspiels, so der Untertitel klingt üppig und mondän, durchaus eigen. In der Initiationsszene kommen sowohl textlich, wie musikalisch starke Parallelen zu Wagners "Parsifal" (Karfreitagszauber!) zum tragen. Das Stück passt wie angegegossen in den diesjährigen Spielplan der Leipziger Oper , der im Frühjahr in einer kompletten szenischen Aufführung von Richard Wagners Opern gipfeln wird.

Mit Balasz Kovalik hat man wohl den richtigen Künstler gefunden, der als Ungar aus der Erfahrung arbeiten kann, wie Kunst und Presse staatlich institutionalisiert werden sollen. Und so macht er genau das Richtige und inszeniert das Werk eigentlich librettogetreu, ohne ihm irgendein "Geschmäckle" in eine irgendwie geartete Ideologie zu geben, weder einer politischen, noch anderer weltanschaulichen. Schließlich gilt es ja auch den Beitrag der anthroposophischen Anschauung zur aktuellen, sogenannten "Querdenken"-Bewegung zu berücksichtigen. Kovalik lässt den Gedanken des Zuschauers nötigen freien Raum , danke schon einmal dafür. Die Handlung an sich klingt vielleicht auch nicht so spannend, doch der Regisseur weiß durch seine Bilder sehr stark die Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln, dabei natürlich unterstützt von der sehr starken Ausstattung von Stephan Manteuffel. Vor einem Panorama einer wirtschaftlich ausgebeuteten Landschaft (trotzdem ästhetisch sehr ansehnlich), wird der Technik des Leipziger Opernhauses viel abverlangt (großes Lob an die technische Abteilung), denn die Maschinerie läuft über Drehbühne und diverse Versenkungen, dabei auch noch gleichzeitig; was sehr zum Zitat "zum Raum wird hier die Zeit" denken lässt. Valerio Figuccios Videos und Michael Rögers Licht unterstützen auf das Beste. Die Kostüme sind in der Entstehungszeit und Heute (Chor) verankert und passend unauffällig.

Gesanglich haben wir es mit einer Männeroper zu tun, denn es gibt keine weiblichen Solisten. Thomas Mohr hat sich in der fordernden Heldentenorpartie des Herrschers in den Schlussproben verletzt und singt aus einem Rollstuhl mit einem ausgestreckt stabilisierten Bein vom Bühnenrand, allein in dieser Körperhaltung eine effektive Körperspannung zum Singen aufzubauen, Respekt! Dann gesanglich so eine adäquate Leistung hinzulegen, das beeindruckt mich zutiefst. Der Regisseur hat den szenischen Part übernommen und integriert den Tenor mit Rollstuhl auf der Bühne, auch dafür großes Lob. Der Künstler steht dem Tyrannen mit leicht lyrischerem Tenor gegenüber, Stefan Rügamer singt die Partie sehr einfühlsam, kommt aber auch in den extremeren Forderungen leicht an seine Grenzen. Auch der Priester ist ein Tenor, allesdings ein Charaktertenor, mit Dan Karlström haben wir einen der gesanglich schönen, lyrischen Art vor uns. Kay Stiefermanns Karriere verfolge ich schon seit vielen Jahren, eigentlich ein lyrischer Bariton hat er sich geschickt Bereiche des Heldenbaritons ersungen und die Geschmeidigkeit bewahrt, sein Raumfahrtbericht beeindruckt mich durch seinen liedhaft gesungenen Duktus. Zu den relativ hohen Männerstimmen bildet der balsamische Bass einen spannenden Gegenpol, der Kerkerwärter hat nahezu gurmemaneske Stellen; kleine Anmerkung: noch besser wäre es mit der sanglich Aufhellung der Vokale, so klingt es manchmal etwas mulmig. Martin Petzold mit etwas schneidendem Tenor ergänzt als Ausrufer. Der Chor der Leipziger Oper unter Alexander Stessin absolviert seinen Part einfach einwandfrei. Matthias Foremny am Pult des Gewandhausorchesters sorgt für opulenten spätromantischen Klang, nur manchmal, wenn die Solisten weiter hinten auf der Bühne plaziert sind, wäre etwas mehr Rücksichtnahmen in der Lautstärke erforderlich. Resume: Die Leipziger Oper bietet einem sehr spannenden Musiktheaterabend auf sehr hohem Niveau, und das auf jeglicher Ebene!
Martin Freitag, 19.1021
Fotos: KIRSTEN NIJHOF / Oper Leipzig
9. Juli 2021
Berliner Paradiese
Barbora Horáková Joly inszeniert die Uraufführung der Oper von Gerd Kühr und Hans-Ulrich Treichel.
Mit der Konzeption der Welturaufführung der Oper „Paradiese“ stellte sich dem Kollektiv der gebürtigen Pragerin Barbora Horáková Joly (geboren 1982) eine vergleichsweise einfache Aufgabe. Keine originellen Einfälle, die die Inszenierung von den unzähligen Arbeiten des gleichen Stückes abheben, waren von Nöten. Andererseits hat aber das fast orts- und zeitnahe Sujet die Tücken, dass noch viele Besucher die Umstände im Berlin der 1970er bis zu den 1990 Jahren näher erlebten, als es den Agierenden möglich gewesen wäre.

Anders ist die Situation des Texters der Oper Hans-Ulrich Treichel (Jahrgang 1952), der durch 13 Jahre Lehrtätigkeit am Deutschen Literaturinstitut mit Leipzig verbunden, auch in Berlin lebte und lebt. Eigentlich sind seine Themen Flucht und Vertreibung. Aber erst vor wenigen Tagen ist bei Suhrkamp seine groteske Beziehungskomödie, der Roman „Schöner denn je“ erschienen, der ihn als Kenner des Westberlins der 80er-Jahre sowie der Psyche junger Menschen dieser Zeit ausweist.
In der Oper erlebten wir, wie sich der Student Albert (Mathias Hausmann) zunächst im eingemauerten Westberlin und später in der wiedervereinigten Stadt an vier jungen Frauen abarbeiten muss, um seine Sozialisierung zu suchen. Letztlich bleibt es aber dem Betrachter überlassen, wo Albert seine „Paradiese“ finden könnte: sind es die Liebe der Frauen, materieller Wohlstand, Familienleben, ein Platz in der Gesellschaft, die Freiheit (welche auch immer) und und und.

Als der Abiturient Albert aus einer beschaulichen Bundesdeutschen Provinz zum Studium nach West-Berlin kommt, gerät er unmittelbar in die Studentenunruhen, die Auseinandersetzung linker Studentengruppen mit dem Hochschul-Establishment der 1968er Zeit. Dabei lernt er auch die Studentin der Politologie Lise (Alina Adamski)kennen, die ihn ohne große Umstände in die „Freie Liebe „ einführt. Die Kollision mit Alberts romantischen Vorstellungen von der Beziehung zwischen Mann und Frau kann nur der Psychiater einigermaßen durch die Konfrontation mit Kindheitserinnerungen kompensieren.
Mit Stil und einer gewissen Anmut spielt und singt die polnische Sopranistin Alina Adamski die Studentin der Politologie Lise Mit ihrem hellen Sopran bezirzt sie nicht nur Albert sondern auch die Premierengäste.
Straffe Szenenwechsel dank intensiver Nutzung von Drehbühne und Videoinstallierung kennzeichneten diesen gelungenen Auftakt.
Im zweiten Akt wurde Albert von seiner aktuellen Freundin, der vor der Abschlussprüfung befindlichen Studentin der Zahnmedizin Friederike (Julia Sophie Wagner) überredet, sich ihr für eine Zahnwurzelbehandlung zurVerfügung zu stellen. Erotisches Geplänkel und der Rausch des Lachgases, vermutlich auch dank strafferer Mittelchen, schicken Albert in die Vision eines Schäferspiels auf der Pfaueninsel, denn in der Vision war Friederike als Braut des Fürsten der Havel-Insel mit Albert durchgebrannt. Mit einem grandios wandlungsfähigen Bühnenbild von Aida Leonor Guardia bot uns BarboraHoráková ein Intermezzo vom Feinsten, bis sich die Vision für das Paar zum Horrortrip einer Beinah-Flucht nach Ost-Berlin entwickelte.

Besonders beeindruckten die fantasievollen Kostüme von Eva Butzkies, zumal sie für die übrigen Opernteile nur die OTTO-Kataloge der Zeit bemühen musste.
Fast extremes Selbstbewusstsein bekommt die angehende Zahnärztin Friederike von Julia Sophie Wagner verordnet. Mit von Bachs Oratorien kultiviertem leicht eingedunkelten Sopran meistert sie selbstbewusst die Tücken der Partitur.
Beim Studentenjob als Theatermaler kam Albert in Verbindung mit der eigenwilligen Schauspielerin Marie (Christiane Döcker), die für eine Premiere des düster-archaischen Drama des Euripides „Die Bakchen“ bevorzugt allein und des Nachts probte. In der unvermeidlichen Beischlafszene tritt, regelrecht mystisch, in Alberts Unterbewusstsein der Chor der Bacchantinnen auf, und fordert, frei nach Euripides, von der Mutter Agaue-Marie des Pentheus-Albert den Tod des Sohnes, weil er den Kult des Dionysos verhöhnt habe. Was diese, nicht so blutig wie im Original, aber doch vollzieht.

Wieder bei Sinnen, schickt Marie ihren gehabten Liebhaber Albert wegen des Altersunterschieds weg.
Mit ihrem sicher geführten, schöntimbrierten Mezzo konnte Frau Döcker diese schwierige Aufgabe grandios erfüllen.
Sollte der vierte Akt als ein Beitrag zur Deutung der sich in der Gesellschaft noch immer verstärkenden Ostalgie gewesen sein, so halte ich ihn für absolut misslungen. Dass das Paradies des gesamtdeutschen Paares Anna (Magdalena Hinterdobler) und des nunmehrigen Doktoranten Albert in einer Hausfrauenidylle und intensiver Sexualität in einer spießigen Wohnküche am Berliner Prenzlauer Berg ist, mag es geben. Aber dass der Anna beim nostalgischen Umgang mit Artefakten ihrer Pioniervergangenheit Alpträume in Gestalt von Bacchantinnen-Schwärmen und demonstrierenden Studenten ist ein reines Produkt ost-fremder Fantasien. Mit der Erfahrung einer 19-jährigen Arbeitsemigration in Westdeutschlandbin ich mir sicher, wie wenig sich die Wessis tatsächlich mit den Menschen Ostdeutschlands gedanklich beschäftigt haben. Dieser Aspekt der deutschen Geschichte ist künstlerisch nur von Menschen mit Familiengeschichte und wahrscheinlich erst in späteren Jahren zu gestalten.
Die Sopranistin Magdalena Hinterdobler verdient aber für ihren mit warmen, bewegenden Sopran und den massiven körperlichen Einsatz bei der Gestaltung der Anna volle Anerkennung.
Mit dem Österreicher Mathias Hausmann war die männliche Hauptrolle nahezu ideal besetzt. Er sieht gut aus, hat Humor, Persönlichkeit und singt kraftvoll mit einem differenzierten Bariton.
Neben den tragenden Rollen waren noch neun recht gut besetzte Sängerdarsteller in 15 kleineren Rollen auf der Bühne tätig und ergänzten das turbulente Geschehen. Etwas herausragend empfand ich die Szene des Baritons Julian Dominique Clement mit dem Tenor Einar DagurJónsson im dritten Akt.
Dem Chor, sprich der Statisterie, gab die Regie ein recht ordentliches Aufgabenpensum. Den Auftrittenwar aber eher ein Agitprop-Charakter zugeordnet.
Mit seiner Musik bildet der aus Kärnten stammende Komponist Gerd Kühr (Jahrgang 1952) lebendig die Vielschichtigkeit des Lebens mit all seinen Reibereien ab. Bekannt ist Kühr vor allem mit seinem ausdrücklich minimalen Einsatz musikalischer Mittel. Mit seiner hier aber breiter angelegten Musik schafft er den unsicheren Stationen der Treichelschen Handlung eine sichere Kontinuität und eine gewisse Stabilität. Besonders reizvoll sind die Unschärfen, die Verschiebungen von Tonhöhen, Klängen und Tempi.
BarboraHorákováJoly sichert mit ihrer klaren Handschrift ein beeindruckendes Bild des verrückten, etwas mystischen Westberlins seiner späten Jahre, weniger des gesellschaftlichen Umbruchs der komplizierten Zeit einer vereinigten Hauptstadt.
Das Gewandhausorchester mit dem Musikalischem Leiter Ulf Schirmer hielt das Bühnengeschehen mit der gewohnten Präzision und Klanggewaltigkeit zusammen.
Dem Dresdner Besucher auffallend war die breit gestaffelte Altersstruktur der Premierenbesucher, was hoffen lässt.
Thomas Thielemann
Autorin der Bilder: Kirsten Nijhof
Spielplan 2020/2021
Rituale Ballett von Mario Schröder UA Premiere 03.10.2020
Lohengrin Premiere 07.11.2020
Il Trovatore Premiere 29.11.2020
Faust Ballett von Edward Clug Premiere 6.02.2021
Les Barbares Camille Saint-Saëns Premiere 27.03.2021
Fusion Ballett von Mario Schröder UA Premiere 21.05.2021 |
Paradiese G. Kühr / H.U. Treichel Premiere 03.07.2021
Oper Kompositionsauftrag der Oper Leipzig,
Ring Zyklus 1 14. April bis 18. April 2021
Ring Zyklus 2 05. Mai bis 09. Mai 2021
Wagner Wochenende 12. März bis 14. März 2021
Wagner Festtage 2021 18.Juni bis 20. Juni 2021
Die Feen Rienzi Das Liebesverbot
Dazu aus dem Repertoire der Oper Leipzig neben vielen anderen Werken:
La Bohème, Capriccio, Nabucco, Carmen, Zar und Zimmermann u.a.m.
Link zur Oper Leipzig: www.oper-leipzig.de
RUSALKA
Vorstellung: 9. Februar 2020 (Dernière für diese Spielzeit, 13. Vorstellung)

Das lyrische Märchen RUSALKA, uraufgeführt in Prag 1901 hat musikalisch nichts von seinem Charme, aber auch nichts von seiner Tragik verloren.
Im Gegensatz zu den Opern von E. T. A. Hoffmann und Albert Lortzing, die ebenfalls den Undine-Stoff behandeln, erzählt Dvořák die Geschichte der Wassernixe aus der Sicht der Elementargeister. Und dies macht das Werk heute, im Zeitalter der “Fridays for Future“, so aktuell. In Rusalka wird das Verhalten der Menschen gegenüber der Natur verurteilt, der Mensch hat in der Welt der Naturgeister einen sehr schlechten Ruf.
Aus diesem Grunde sind Menschen nur etwa zu einem Drittel der Zeit auf der Bühne. In der übrigen Zeit fangen Lieder und Szenen die märchenhafte Atmosphäre der Nixen- und Hexenwelt ein. Dabei hilft auch Dvorak’s Leitmotivtechnik welche mit wenigen Motiven in vielen Variationen auskommt. Dies im Gegensatz zu den späten Werken Richard Wagners.

Das Gewandhausorchester, geleitet von Christoph Gedschold, interpretiert die Komposition Dvořáks sehr dynamisch, dem Dirigat Gedscholds entsprechend. Leider sind einzelne Passagen einfach zu laut, so dass die Sänger auf der Bühne des Öfteren übertönt wurden. Dies ist speziell der Fall bei einigen Arien von Rusalka (Gal James), so zum Beispiel im ersten Akt >Wassermännchen Väterchen< oder auch im dritten Akt >Fühllose Flut ohne Mitleid< um nur zwei Bespiele anzuführen. Diese Kritik gilt auch teilweise für den Wassermann (Tuomas Pursio).
Die Personenführung von Michiel Dijkema ist sehr konventionell. Gerade diese Oper, man kann die Komposition Dvořák‘s auch als Naturoper bezeichnen, würde eine aktuellere Inszenierung mit wesentlich mehr direktem Bezug auf unsere Umwelt ermöglichen. Die in der Geisterwelt ungeliebte, ja gehasste (Hexe Jeziba) Spezies Mensch als Zerstörerin der Umwelt wird von den Wasser- und Waldgeistern kritisiert und verachtet. Dieser Aspekt wird von Dijkema nur am Rande gestreift. So entstand eine handwerklich gut erarbeitete, konventionelle Inszenierung, aber kein Highlight der Musiktheaterregie. Der Geschichte Rusalkas als Gesamtheit fehlt die emotionelle Spannung, der Bezug zu heute!

Als ausgezeichnete Rusalka agiert Gal James. Ihre subtil dargestellte Liebe zum Prinzen überzeugt sowohl durch ihren Gesang mit klarer Intonation, ausgezeichneten Höhen und gefühlten Emotionen, verstärkt durch zwingende Körpersprache, Mimik und Gestik. Brava!
Der Tenor Patrick Vogel als Prinz singt und spielt seine zwielichtige Rolle mit guter Intonation und sauberen Höhen ohne forcieren. Der finnische Bass-Bariton Tuomas Pursio singt hier in Leipzig einen sehr guten Wassermann.
Die amerikanische Mezzosopranistin Susan Maclean überzeugte als Hexe Jezibaba. Sie spielt und singt diese Rolle meisterhaft und glaubwürdig. Ihr komödiantisches Talent überzeugt!

Als fremde Fürstin erscheint auf der Bühne das Leipziger Ensemblemitglied Kathrin Göring auf der Bühne, auch in dieser Produktion überzeugend und mit sauber intoniertem Mezzosopran ohne aufgesetztes Vibrato mit starker Bühnenpräsenz, unterstrichen durch ein bei Sängerinnen und Sängern seltenes Talent für Schauspiel, genauso wie ich die Künstlerin in Carmen auf der Bühne in Leipzigt erlebt habe.
In weiteren Rollen zu sehen und hören: Der Heger Hinrich Horn mit seinem Küchenjungen und Neffen, gespielt und gesungen von Mirjam Neururer, die drei Waldelfen von Sandra Maxheimer, Sandra Fechner und Lenka Pavlovic und in der Rolle des Jägers Dan Karlström.
Die Bühne wurde entworfen vom Regisseur Michiel Dijkema. Seine Bühne ist gut gelungen. Interessant dabei sein Hexenhaus auf Hühnerfüssen, welches den Sagen von Baba Jaga nachempfunden ist.

Die Kostüme, gezeichnet von Julia Reindell sind stimmig. Etwas seltsam allerdings die Idee, die Waldelfen mit überdimensionierten, nackten Brüsten auf die Bühne zu bringen. Der Lacheffekt im Publikum war zu hören, doch wird so ein Frauenbild festgeschrieben, welches in der heutigen Zeit als unangemessen bezeichnet werden muss. Auch das abhäuten der Jagdbeute könnte der Regisseur ohne weiteres weglassen. Die Szene Heger-Küchenjunge trägt in ihrer Komik auch ohne unästhetische Regiemätzchen.
Das Publikum belohnte die Leistung des Teams auf, vor und hinter der Bühne mit dem verdienten Applaus. Etwas ärgerlich für den Berichterstatter waren die störenden Schwätzer und Schwätzerinnen!
Peter Heuberger, 14.2.20
© Kirsten Nijhof
DER FREISCHÜTZ
Premiere: 4. März 2017
Besuchte Vorstellung: 25. Januar 2020
Christian von Götz: Der Freischütz ist weniger ein Stück über das Böse als vielmehr über die Angst vor dem Bösen und darüber, was diese Angst aus uns macht. Es geht um eine Gesellschaft, die in etwas zurückzufallen droht, was längst überwunden scheint. Samiel ist ein Zeichen der Angst, die in jedem Menschen steckt. Er ist ein Dämon, der immer den Grundkonflikt der Figuren erzählt.
Die Wiederaufnahme der beliebten Oper von Weber, es war die vierzehnte Vorstellung seit der Premiere 2017, fand am 25. Januar 2020 vor fast ausverkauftem Haus statt.

Christian von Götz inszeniert seinen Freischütz ohne die übliche Verherrlichung des deutschen Waldes, ohne gemütliche Kneipe der Jagdgesellen, ohne ansprechende Stube von Agathe. Seine Ansatz wird der Gespenstergeschichte gerechter und zeigt klar, dass die Verlockung des Bösen überall sein kann, überall anzutreffen ist. Aus diesem Grund ist Samiel ist in jeder Szene präsent ohne aufgesetzt zu wirken. Mit diesem Ansatz ist die Oper aus dem Jahr 1821 fast zweihundert Jahre später immer noch so aktuell wie eh und je.
Die gut geführten Massenszenen mit grossem Chor beweisen, dass von Götz mit seiner Personenführung nicht nur die Solistinnen und Solisten anleitet, sondern seine Aufmerksamkeit dem gesamten Bühnenteam gilt, dass es für ihn keine unwichtigen Nebenrollen, Nebenakteure gibt. So bleibt Carl Maria von Weber‘s Werk auch aus heutiger Sicht lebendig und interessant. Die Inszenierung brilliert mit interessanten Details. So wird die Sprechrolle Samiels von Verena Hierholzer, eigentlich Choreografin und Tänzerin, gesprochen und hervorragend gespielt. Ihr Samiel wirkt so dämonisch wie ich es bis heute nur im Film mit dem deutschen Schauspieler Bernhard Minetti erlebt habe.

Die Mutter von Max erscheint, dramaturgisch wesentlich, im Totenbett. Max erwähnt seine Mutter als Warnerin in der Wolfsschlucht: Was dort sich weist, Ist meiner Mutter Geist! So lag sie im Sarg, so ruht sie im Grab! – Sie fleht mit warnendem Blick! Sie winkt mir zurück! Auch hier ist wiederum Samiel sichtbar.
Das Gewandhausorchester unter der Leitung von Christoph Gedschold erfüllte die Erwartung an den grossen Namen mit langer Tradition nicht vollständig. So waren die Streicherklang nicht sehr homogen, die Intonation der Hörner nicht genau und dies nicht nur beim Anblasen der Instrumente, sondern auch im Laufe der Melodieführung. Dies mag vielleicht daran liegen, dass zwischen der letzten Reprise und der heutigen Wiederaufnahme eine lange Zeit vergangen ist. Eine Erklärung aber keine Entschuldigung! Die musikalische Interpretation der Oper war sehr gut, das Eingehen des Dirigenten auf die Solisten und den Chor ausgezeichnet, so dass ein musikalisch erfreulicher Eindruck entstand.

Der Tenor Marco Jentsch interpretierte den Max als unsicheren, in Agathe verliebten Jäger im Dienste des Erbförsters Kuno. Seine Intonation war sauber und seine Diktion in Ordnung. Seine Höhen waren unverkrampft und seine Bühnenpräsenz der Rolle entsprechend. Vielleicht wirkt die Körpersprache von Jentsch noch ein bisschen aufgesetzt, dies aber ist für seine Rollenauffassung nicht unbedingt wesentlich.
Als hervorragende Agathe erlebte ich die Israelische Sängerin Gal James. Ihre Musikalität, ihre Interpretation der Rolle lässt aufhorchen. Ihre Höhen überzeugen ohne falsches Vibrato mit hervorragender Diktion.
Ihre Vertraute Ännchen gibt die deutsche Sopranistin Magdalena Hinterdobler. Ihr Ännchen strotzt vor Übermut ohne jede Übertreibung. Ihre saubere Intonation geht einher mit klarer Diktion und einem erfreulichen komödiantischen Talent. Ihre Körpersprache überzeugt in jeder Szene.

Als sehr guter Kaspar stand der finnische Bass-Bariton
Tuomas Pursio auf der Bühne. Seine Interpretation des Bösewichtes, des Dieners Samiels, überzeugt. In seinem Wolfschlucht-Auftritt überzeugt Pursio sowohl als Schauspieler als auch als Sänger.
Ebenfalls aus Finnland stammt der Tenor Dan Karlström als Kilian. Seine Arie im ersten Akt nach dem Meisterschuss: >Schau' der Herr mich an als König< überzeugt sowohl mit sauberer Intonation als auch durch klare Diktion. Sein Können als Komödiant steht seiner Gesangskunst in keiner Weise nach.
Der Bariton Jürgen Kurth, seit 1980 Ensemblemitglied an der Oper Leipzig, interpretiert die Rolle des Kuno abgeklärt mit klarer Diktion und hervorragender Intonation.
In weiteren Rollen zu sehen und zu hören sind: Als Otttokar Franz Xaver Schlecht und (Nomen est Omen) Sebastian Pilgrim als Eremit, Andreas Scholz und Klaus Bernitz geben die beiden Jäger und als Brautjungfern auf der Bühne: Dorota Bronikowska, Reba Evans, Eliza Rudnicka und Anika Paulick.
Dazu Heinrich Heine in seinen Reisebildern (1822-1828): >Haben Sie noch nicht Maria von Weber’s ‚Freischütz‘ gehört? Nein? Unglücklicher Mann! Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper ‚das Lied der Brautjungfern‘ oder ‚den Jungfernkranz‘ gehört? Nein? Glücklicher Mann!“
Der Chor der Oper Leipzig, einstudiert von Alexander Stessin löste seine Aufgabe in dieser Oper mit einigen Chorpassagen mit hoher Präzision und grossartiger Musikalität.
Das zahlreich erschienene Publikum, das Haus war fast ausverkauft, belohnte die gelungene Aufführung mit rauschendem, langanhaltendem Applaus.
Peter Heuberger, 3.2.2020
© Ida Zenna
CARMEN
Premiere: 30. November 2018
Besuchte Aufführung: 26. Januar 2020 (11. Vorstellung)
Frei ist sie geboren und frei wird sie sterben
Carmen ist eine der meist aufgeführten Opern weltweit. Die Milieuschilderung, Dramatik und schicksalhafte Tragik macht das Werk Bizets zu einem Vorläufer des Verismo. Der Komponist kann daher als Wegbereiter des italienischen „Verismo“ bezeichnet werden.

Die australische Regisseurin Lindy Hume hat Carmen das erste Mal vor fast 30 Jahren an der “West Australian Opera Perth“ inszeniert. Die #MeToo Bewegung hat ihre Sicht auf Frauen, ihre Sicht auf die Oper Carmen eindrücklich geprägt. Natürlich war die Figur Carmens nie ein Opfer, nicht nur ein Opfer. In der Auffassung der Regisseurin aber nimmt es Carmen ausgesprochen in Kauf, für ihre Freiheit sterben zu müssen. Sie wird als Wegbereiterin der Emanzipation, als starke Frau inszeniert. Die Männer welche sie umgarnen wollen sind alle eher schwach. Carmen ist nicht mehr der Archetyp der Verführerin, der “femme fatale“, sondern emanzipiert, selbstbewusst im heutigen Sinn des Wortes. All dies gelingt Frau Hume mit ihrer subtilen Personenführung ohne Mahnfinger auf vorbildliche Weise. Interessant ist Lindy Humes Art des Szenenbeginns: Alle Protagonistinnen und Protagonisten erscheinen auf der sich drehenden Bühne (Bühnen-Entwurf Dan Potra) in einer Stasis, einem Zeit-Stillstand.

Dies erhöht die Spannung und unterstützt die darauffolgende Handlung. So entstand eine Oper Carmen, welche eigentlich traditionell inszeniert daherkommt, aber unterschwellig die moderne Auffassung über Feminismus unterstützt, den männlichen Machtanspruch in Frage stellt und anprangert.
Das Gewandhausorchester unter der Stabführung von Matthias Foremny interpretiert die Komposition, die letzte Bizets, mit schön französischem Klang, obgleich in einzelnen Passagen ein bisschen mehr Legato angebracht gewesen wäre. Dies allerdings muss dem Dirigat zugeschrieben werden und nicht dem Klangkörper. Das Eingehen des Dirigenten auf seine Künstler auf der Bühne dagegen kann nur gelobt werden. Nie ist das Orchester zu laut und übertönt die Bühne, nie aber auch zu leise, so dass die Klangfarben verschwinden!

Der Chor und der Kinderchor der Oper Leipzig lösen ihre Aufgabe mit Bravour. Die Einstudierung des Kinderchores lag in den Händen von Sophie Bauer. Der Opernchor wurde geleitet von Thomas Eitler-de Lint.
Die Mezzosopranistin Kathrin Göring als Carmen beeindruckt durch eine Bühnenpräsenz, welche ihresgleichen sucht. Dabei ist zu bemerken, dass Carmen eine der längsten Rollen in der Opernliteratur ist. Leider war der Erstauftritt von Frau Göring, die bekannte “Habanera“ nicht über alle Zweifel erhaben. Die Intonation bei guter Diktion war nicht allzu sauber. Dies gilt allerdings nicht für den Rest der Oper. Hier war der Sängerin nichts anzulasten. Ihre schauspielerische Leistung, ihr Körpersprache, Gestik und Mimik verstärkten ihre Interpretation der Figur Carmen ebenso wie ihr perfektes Singen, welches bis zum Ende der Werkes keine Müdigkeit hören/sehen liess.
Die Micaela wurde gesungen und gespielt von Gal James. Sie interpretierte die Rolle der Unglückbotin, der Vermittlerin zwischen der Mutter und Escamillo und unterstützte so optimal das tragische Ende.

Der albanische Bariton Gezim Myshketa als Escamillo überzeugt mit perfekter Intonation. Die Diktion allerdings war nicht so sauber wie seine Melodieführung. Dazu ist allerdings zu bemerken, dass die französische Sprache im klassischen Gesang sehr hohe Anforderungen an die Sprachkenntnis der Sängerinnen und Sänger stellt. Ich habe perfekte französische Diktion bis heut nur bei Sängerinnen und Sängern mit französischer Muttersprache gehört. Ich bin vielleicht ein bisschen heikel, da ich zweisprachig (Deutsch und Französische) aufgewachsen bin.
Als Don José auf der Bühne zu sehen und zu hören: Der Tenor Gaston Rivera aus Südamerika, genauer aus Uruguay. Die Personenführung von Hume stellt ihn als ausgezeichneten Toreador, mit eine Schwäche für das weibliche Geschlecht dar. Sein Gesang überzeugt, seine Leistung als Schauspieler dagegen nicht auf der ganzen Linie.

In weiteren Rollen waren zu sehen und hören: Als Mercédès Sandra Maxheimer und als Frasquita Aneta Ruckova. Ferner als Offizier Zuniga Sejong Chang und als Moralès Hinrich Horn. Die Schmuggler wurden gegeben von Dan Karlström, Andrii Chakov und Julian Dominique Clement.
Der Bühnenentwurf und die Kostüme stammen von Dan Potra. für die ausgezeichnete Lichtführung ist Mathew Marshall verantwortlich. Nele Winter ist verantwortlich für die Dramaturgie.
Abschliessend darf ich sagen, dass Lindy Hume eine Carmen inszeniert hat, welche den hohen Ansprüchen an moderne Opernregie genügt.
Peter Heuberger, 3.2.2020
© Tom Schulze
© Kirsten Nijhof
Der Ring des Nibelungen - "wild und kraus kreist die Welt..."
(Bitte schauen Sie sich die sehr gut gemachten Trailer an)
Das Rheingold
Besuchte Vorstellung: 15. Januar 2020
TRAILER
„Die ganze Tragödie der menschlichen Geschichte“ erblickte George Bernhard Shaw in Wagners „Ring“. Der sympathische Vater der linken Wagner-Rezeption, dessen „Wagner-Brevier“ erstmals 1908 auf deutsch und bezeichnenderweise erst 1973 wieder erschien, bescheinigte allerdings „nur Menschen mit einem umfassenden Denkvermögen“ ein tieferes Verständnis von Wagners insgesamt 16-stündigem Weltendrama.
Regisseure, Dramaturgen und Dirigenten wissen, auf was sie sich da einlassen; sie müssen sich an den Ansprüchen des Riesenhorts aus den „Jahrhundertringen“ und all den mehr oder weniger funkelnden Facetten der fast unüberschaubaren Rezeption der Tetralogie messen lassen. Die Latte hängt gerade in Leipzig besonders hoch – war doch in des „Meisters“ Geburtsstadt das wuchtige Werk im Jahre 1876 zum ersten Mal außerhalb von Bayreuth komplett aufgeführt worden; zehn Jahre später leitete einer der größten Dirigenten aller Zeiten, Gustav Mahler, den „Ring“ als Vertreter des erkrankten Arthur Nikisch in Leipzig.
Bereits 2013 startete die Oper Leipzig mit der Inszenierung der Londonerin Rosamund Gilmore eine neue Interpretation des Zyklus, der 2016 dann in Gänze zu sehen war. Das noch junge Jahr 2020 erlebte nun eine in Details überarbeitete Neuauflage der Produktion mit teils neuer Besetzung.
Dieser „Ring“ bietet aufgrund seines komplexen Umsetzungskonzepts, zumal mit der Erweiterung durch von der Regisseurin choreographierte Tanzeinlagen, sehr unterschiedliche Wahrnehmungsebenen und dadurch auch Kritikflächen. Die vier Teile schienen so heterogen, daß sich mitunter der Eindruck einstellte, als hätten hier verschiedene Regisseure gewirkt.
Lobenswert ist die Übertitelung mit englischen Texten neben dem Original-Libretto, zumal die englischen metrisch korrekt, also singbar sind – eine sehr offene und gastfreundliche Geste. Schließlich war in den Pausengesprächen viel englisch, auch dänisch, schwedisch und spanisch zu hören. Praktischerweise bot die Leipziger Oper mehrere Bars mit Getränken und Häppchen an, weswegen entspannte Unterhaltungen innerhalb des internationalen Publikums möglich waren, anstatt die halbe Pause in der Warteschlange zu stehen.
„Das Rheingold“ ist eine Oper mit humorigem Anstrich und das darf auch entsprechend umgesetzt werden. Folgerichtig sprach der Dramaturg Christian Geltinger in seiner Einführung auch von einer „Comédie humaine“. Wagners Stabreime sind oft einfach nur komisch und mitnichten hohes deutsches Kulturgut, an dessen ernst-festem Eschenstamm nicht gekratzt werden darf. Lange vor Brecht arbeitete Wagner, der bis zu seinem Tod seinen frühsozialistischen Wurzeln zumindest in Werk und Denken treu blieb, mit Verfremdungseffekten, um seine Gesellschafts-, genauer Kapitalismuskritik unterhaltend zu transportieren. Dazu baute er einen echten Mythos, der erklärte, wie Gier und Lüge in die Welt kamen und daß sich Macht und Liebe ausschließen. Der französische Strukturalist Claude Lévi-Strauss bewunderte Wagner dafür und war begeistert vom (zer-)gliedernden und sinnbildenden Einsatz der Leitmotive, die wie eine hochkomplizierte Flechtbandschnitzerei funktionieren: das Ganze ornamental und inhaltlich zusammenhaltend und je nach Erscheinen der einzelnen Strangteile anders gefärbt und harmonisch eingefaßt durch die umgebenden Elemente.
Die Aspekte Kritik und Mythos sind für ein Verständnis und folglich auch eine Inszenierung des „Rings“ ebenso essentiell wie die Raben Hugin und Munin für Wotan: ohne die beiden geht es nicht.
Nachdem der wunderbare Es-Dur-Akkord des noch natürlich fließenden Rheins aus der traulichen Tiefe des Grabens quoll, gab es gerade im Blech des Gewandhaus-Orchesters immer wieder manches Geschepper und unsaubere Einsätze, was sich auch gegen Ende des Vorabends wiederholte. Ansonsten spielte der weltberühmte Klangkörper unter Leitung von Ulf Schirmer ausgesprochen kräftig, dabei manchmal einige der Sänger übertönend. Die Stärke der Bläser und des Schlagwerks, darunter vor allem des Beckens, formten insgesamt einen satten Wagner-Sound, der vor allem in den Forte- und Fortissimo-Stellen glänzte.
Nicht ganz klar war, was die Rheintöchter (Magdalena Hinterdobler, Sandra Maxheimer und Sandra Janke) eigentlich darstellen sollten, die wie Nischenfiguren in der fenster- und türenreichen Architektur des Bühnenbildes von Carl Friedrich Oberle standen und in der Kostümierung von Nicola Reichert eher an Bordsteinschwalben denn an niedliche Nixen erinnerten. Originell gelöst war hingegen die Verfolgungsjagd Alberichs. Kay Stiefermann, der innerhalb der Leipziger Produktion debütierte, glitt im Wasserbecken immer wieder aus. Das war echt verstandener Wagner-V-Effekt und Spaß-Theater, weil der Wandel des albernen Alben zum machtgierigen Raffer um so glaubhafter gelang.
Und hier tauchte schon die fast bei jedem Erscheinen nervende und überflüssige Tanz-Combo auf, die unterstreichend wirken sollte, aber das eigentliche Geschehen fast immer schwächte und vom tatsächlich Gemeinten optisch und inhaltlich eher ablenkte. Das hat schon bei Guy Cassiers´ „Ring“ am Berliner Schiller-Theater ab 2010 nicht funktioniert und läßt darauf schließen, daß Gilmore nicht auf das Zusammenwirken von Ton, Wort, Raum und Spiel vertraute. Geltinger verwies in seinen Einführungen mehrfach auf das „Sprachvermögen der Musik“, das die Regisseurin offenbar als nicht ausreichend empfand.
Wirklich gute Einfälle glänzten immer wieder in Details wie dem Diebstahl des Goldes aus einer Tresorvitrine, deren Glas Alberich ebenso mühelos zerschlug wie die Einbrecher das vor Kurzem im Dresdner Grünem Gewölbe taten. Das Walhall-Modell sah aus, als hätte Albert Speer eine Zikkurat in Babylon entworfen und entlarvte treffend die Großmannssucht des Göttervaters, den Iain Paterson ebenfalls zum ersten Mal in Leipzig sang. Als Wotan/Wanderer war er sehr wandlungsfähig und, wenn erforderlich, so menschlich wie es ein Ase sein kann. Nicht immer kam er gegen das dominante Orchester an.
Die ganze Szenerie mit der Götter-Mischpoke und den Riesen in einem großen Treppenhaus war wie ein Kinderbuch gestaltet, man kann und soll sie alle nicht wirklich ernstnehmen. Es ist halt alles wie ein Spiel, das aber dann immer ernster wird. Fricka (Kathrin Göring) ist ebenso mitschuldig wie die von ihr gescholtenen Männer, sie erinnerte in ihrem Interesse am geraubten Geschmeide an eine Nazi-Gattin, die nach Raubgold giert. Donner (Anooshah Golesorkhi) und Froh (Alvaro Zambrano) sahen aus wie gelangweilte Sportler-Dandies aus einer englischen Gesellschaftskomödie, Zambrano mit seinem Golfschläger drang stimmlich aber nicht recht durch. Schön war die Szene, in der die beiden zu faul sind, um sich wirklich gegen die Verschleppung Freias (Gal James) zu empören. Ihrem bunten Kostüm entsprach leider nicht ihr eher farbloser Vortrag. Donner hatte offenbar „Rücken“ und konnte nicht beim Aufstapeln des Hortes helfen. Sein Hammer war hier ein Poloschläger, was zu Golesorkhis nicht wirklich starkem „Heda-Hedo!“ paßte. Man wünscht sich aber doch zu dieser so großartigen Musik einen Donner, der mit seinem Mjölnir tatsächlich Riesenschädel einschlagen kann.
Fafner (James Moellenhoff) und Fasolt (Stephan Klemm) mit ihren großen Hüten entsprachen dem Kinderbuch-Graphik-Entwurf, beide durchaus stimmriesig, mit ihren Fluchtstangen vermaßen sie die Großbaustelle Walhall und schließlich auch den gehäuften Hort. Mit einer der Stangen beging Fafner schließlich den mythischen Brudermord und latschte dann gleichgültig immer wieder über den Leichnam hinweg.
Die Nibelungen-Hämmer hatte Wagner ja als nervende Klänge einer menschenverachtenden Großindustrie gedacht; sie klangen hier jedoch zu glockenhaft und daher harmlos.
Einer der echten Stars des Abends war Dan Karlström als Mime, gesanglich und schauspielerisch. Sein Jammern, als Alberich ihn am Ohr packte, drang durch Mark und Bein.
Charmant gelöst war die Drachenszene, wo die Tänzer ein Saurierskelett wie aus dem Film „Nachts im Museum“ darstellten. Auch als Umbauassistenten wirkten sie leicht und unaufdringlich, ebenso wie als Wickler von Erdas Schicksals-Verstrickungsfaden. Karin Lovelius sang in ihrem Leipziger Debut die Ur-Mutter großartig und respektheischend.
Die Personenregie war entweder punktuell eingesetzt oder die Sänger machten spielerisch das Beste aus ihrer Rolle. Patersons Wotan war so paralysiert vom Ring, daß er Alberichs Fluch zu überhören schien. Hier war auch das Orchester wieder etwas zu laut. Aber seine Wandlung nach der Abgabe des Fluchreifs zum Gatten, der seine Frau wieder liebend wahrnimmt, war völlig glaubhaft.
Daß die Rheintöchter beim Vorwurf der Falschheit und Feigheit ins Publikum schauen, war stimmig und wirkungsvoll. Wir hängen alle mit drin im üblen Spiel um Macht und Geld.
Über die Applausordnung waren sich die Darsteller offenbar nicht ganz klar, was aber eher liebenswürdig-menschlich wirkte.
Die Walküre
Besuchte Vorstellung: 16. Januar 2020
TRAILER
Aus dem Schneetreiben in unwirtlicher Schützengrabenlandschaft fand Siegmund (Robert Dean Smith) an Hundings Herd, passend in einen Mantel aus Wolfsfell gehüllt. Der im Haus hängende Widderschädel ehrte Fricka als Schützerin der Ehe. Das ergab Sinn, aber das begleitende Getanze mit halbem Widdergehörn, Wolfsschädeln und Rabenflügeln war bereits im ersten Aufzug wieder zuviel und wirkte wie Kindertheater, damit auch die ganz Kleinen begreifen, wer hier alles mitspielen darf.
Dafür hatte sich das Orchester warmgespielt und war dynamisch und kraftvoll auf der Höhe. Das galt auch für Smith, dessen „Wälse!“-Ruf zwar nicht ganz die 17 Sekunden von Lauritz Melchior erreichte, aber den ganzen Saal durchdrang. Randall Jakobsh war ein wunderbar ekelhafter Hunding, dessen Baß so gekonnt häßlich klang wie es dem Charakter entspricht. Melanie Dieners Sieglinde war verzweifelt angelegt, ihr kurzes Glück mit dem geliebten Zwillingsbruder war ein helles Intermezzo in einem glücklosen Leben.
Glücklos sind auch die Götter nach den faulen Verträgen und das bewährte Paar Fricka (Kathrin Göring) und Wotan (Iain Paterson) gaben einen überzeugenden Ehekrach. Wer Wagners psychologisch ausgefeilten Text in eine zeitgenössische Sprechweise übersetzt, wird über die Realitätsnähe des dialogisch Gesagten staunen und darf froh sein, wenn er das nicht aus eigenen Beziehungen kennt. Frickas Eifersucht ist ebenso glaubwürdig (der getanzte Widderwagen wiederum Jahrmarkt aus Niflheim) wie Allison Oakes als Brünnhilde, die ebenso liebende wie trotzige Tochter. Leider ist die Gestalt des Grane wieder einer der unglücklichen Einfälle Gilmores. Ziv Frenkel hat sie einen Pferdeschwanz (ja, am Haupt!) verpaßt und die Karikatur eines Sattels auf den Rücken geklebt. Dazu mußte er in Plateausohlen mit Pferdehufanmutung staksen, wenn er nicht wie ein mißglücktes Kriegerdenkmal umherstand. Im Zusammenspiel mit Brünnhilde war daher nicht klar, ob er Pferd, Gefährte, Geliebter sein sollte.
Oberles Bühnenbild, in dessen Vordergrund immer wieder (sinn-)verhüllte Gestalten krochen, erinnerte mit seiner bröckelnden und schiefen Monumentalität an Ruinen aus Mussolinis römischen Stadtviertel EUR oder an die leeren Fassaden in den Gemälden von Giorgio de Chirico. Mit diesem Abgesang auf einstige Größe bot es einen trostlosen Hintergrund zum traurigen Geschehen mit der Unmöglichkeit der Liebe der Geschwister und dem Bruch zwischen Wotan und seiner Lieblingstochter.
Sieglindes unbequeme Lage in einer der Architekturnischen führten vielleicht zum kleinen Frosch, eher einer Kaulquappe, den Melanie Diener im Halse hatte. Insgesamt schien sie an diesem Abend nicht ganz auf der Höhe zu sein. Ihr Suizidversuch mit einer Glasscherbe vermittelte schmerzhaft ihre ausweglose Situation, in die – großartig erschreckend! – Hundings Horn gellte. Daß Siegmunds Schwert einen Augenblick zu früh zerbrach, sah man wahrscheinlich nur in den ersten zehn Reihen. Das „Geh!“, mit dem Wotan Hunding wegfegt, würgte Paterson geradezu aus; die Situation ist ja in der Tat zum Erbrechen.
Der Walkürenritt hätte etwas pfeffriger sein dürfen; insgesamt waren der zweite und dritte Aufzug nicht ganz so dynamikerfüllt. Die Szene geriet darstellerisch eher zu einem Ballett der Flintenmädchen. Eine gute Idee waren die vielen weißen Stiefel, die wie auf einem Soldatenfriedhof paarig aufgereiht standen. Die nach Walhall geführten Krieger waren der Kleidung nach hingegen offenbar alle Jockeys gewesen. Michael Rögers Lichtregie unterstützte hier, wie übrigens im ganzen „Ring“, unaufdringlich und sensibel Musik und Handlung.
Daß Wotans Wut, mit der er seinen Töchtern und vor allem der ungehorsamen Brünnhilde begegnete, so gar nicht rasend tobte, sollte womöglich seinen eigentlichen Unwillen gegen die Strafaktion widerspiegeln. Seine Bestürzung angesichts dessen, mehr als nur seine Tochter zu verlieren, war tief und wahrhaft empfunden, die traute Innigkeit nahm man beiden unbedingt ab. Auch wenn Loge komödiantisch daher wackelte – es gab echtes Feuer um die minnige Maid!
Siegfried
Besuchte Vorstellung: 18. Januar 2020
TRAILER
Faschistische Architektur rahmte auch den ersten Aufzug von „Siegfried“ und leider gab es wieder Tänzer, die aus einer wuchernden Wiese ragten und mit engen Pullovern kämpften, aus denen sie einfach nicht herauskamen. So zumindest sah es aus und manche britischen oder dänischen neue Freunde konnten lernen, was der Begriff „Hupfdohlen“ bedeutet.
Wiederum gab Dan Karlström einen schmierigen, schmeichelnden und wirklich witzigen Mime mit Jammer-Tremolo. Ob mit Kinderwagen oder auf dem Fahrrad – Figur und Sänger waren eins in der Parodie eines wahren Giftzwergs, als der er sich dann später zeigen sollte.
Stefan Vinke als Jung Siegfried im Kinderanzug war herrlich frech und agil, das kindlich-spielerische Moment unterstrich ein lebendiger Jahrmarkt-Teddy, den er aus dem Wald mitgebracht hatte. Das frische Spiel des Orchesters schickte sich gut zum Inhalt und zum unterhaltsamen Duktus dieses Teils der Oper. Der mittlerweile vertraute Iain Paterson verkörperte einen würdigen, aber mit Recht müde wirkenden Wanderer, der mit seiner Souveränität den geplagten Mime in echte Verzweiflung und nervöse Huschigkeit brachte.
Selten hat man die von Wagner erfundene Gefahrenmusik so schön schauerlich gehört wie hier – wer das Fürchten noch nicht gelernt hatte, erfuhr nun, was Grusel ist!
Völlig unverständlich dagegen war die angedeutete Neuschmiedung von Nothung. Vinke, der als geübter Siegfried die Szene aus anderen Produktionen kannte und sie problemlos hätte aktiv gestalten können, stand wie ein Schlagersänger mit Mikrofon mit seinem Hammer vor dem Amboß und hieb hin und wieder mal schwach auf das Schwert. Fast vollständig drangen die Schmiedeklänge aus dem Orchestergraben. Die Wuchtszene zu „So schneidet Siegfrieds Schwert!“ verkam zur fragwürdigen Witznummer, weil Vinke meterweit entfernt vom Amboß stand. Alles geht von selbst oder was will uns der Autor damit sagen?
Bifröst, die bebende Rast, also der Regenbogen, der sich am Ende des Rheingolds über der Szene wölbte, war im zweiten Aufzug zerbrochen und lag über der Neidhöhle, Kabel hingen aus den leeren Fensterhöhlen und Efeu überwucherte den grauen Stein. Das war ebenso treffend wie die Hinwendung Alberichs (Tuomas Pursio) mit seiner bewußt unsympathisch getönten Stimme zum Publikum bei den Worten: „Euch seh´ ich noch alle vergehn!“. Fafners Fluchtstange wies leitmotivisch sinntragend auf Vermessung und Inbesitznahme der Welt. Leider wieder gar keinen Sinn hatte die Idee, gleich vier Vögel in Gestalt von weißgekleideten Flirt-Ballerinas in den Wald zu schicken. Dabei war die Flötenszene mit Siegfrieds unbeholfenem Getute wirklich komisch. Alina Adamski als jugendfrischer Waldvogel hatte Unglück mit ihrer Positionierung im S-schluckenden Orchestergraben.
Einer der besten Einfälle war, Fafner (Randall Jakobsh) als Großkapitalisten des 19. Jahrhunderts darzustellen, gleichsam in Umkehrung des V-Effekts mit dem Drachen, der liegt und besitzt. So träge wie die belebte Riesenpuppe auf dem Sofa saß, mußte er von vielen kleinen Helfern unterstützt werden, die hektisch auf Siegfried eindrangen, aber als Witzfiguren schnell besiegt waren, als der Held dem Ausbeuter das Schwert in den fetten Bauch und eben nicht ins Herz gestoßen hatte. Fast wie ein Sohn kuschelte sich Vinke dann an den Sterbenden, der das Stadium der Altersweisheit etwas zu spät erlangt hatte.
Die darstellerisch anspruchsvolle Lügenszene meisterte Karlström gekonnt, indem er Text und Gestik diametral entgegensetzte und den aufmüpfigen Jungen tätschelte, während er mit Meckerstimme in Aussicht stellte, ihm den eigenwilligen Kopf abzuhauen. Da mußte ihm Siegfried nur mit dem Schwertknauf gegen die Stirn schlagen, um dem Lügen ein Ende zu machen.
Das Bühnenbild dominierte dann eine Kriegsruine wie ein zerbombtes Kellergewölbe, vor dem Wotan und Erda (Karin Lovelius) einander innig-nahe lagen. Hier erfüllten die Tänzer, auch weil sie so diskret und verhüllt von der langen Schleppe auftraten, tatsächlich ihren Zweck als Träger des Stoffes, der das langgewirkte und wirkende Schicksal meinte, in das auch der Göttervater eingewickelt wurde.
Dieses Schicksal ereilte ihn in Gestalt seines Enkels, der ihm mit einem Schwung den Speer zerhieb. Ebenso zerbrochen wie die Vertragsgrundlage war schließlich der zentrale Faschisten-Bau; das Ende der Macht war nur noch eine Frage von 24 Stunden. In der Ruine hatte Wotan einen Koffer zurückgelassen, in dem Siegfried ein frisches Hemd und eine schwarze Hose fand, damit er nicht im Spielanzug vor die selige Maid treten mußte. Ohne sie zu berühren, löste er wie mit einem Zauberstab in Schwertform die engende Brünne, fiel dann aber ganz in die Rolle des endlich ängstlichen Kindes, das sich vor etwas Unbekanntem versteckt. Das war ein sensibles und vorsichtiges Miteinander-Agieren, zumal Daniela Köhler als Brünnhilde, nachdem sie sich noch schlaftrunken geräkelt hatte, so mädchenhaft frisch nach des Helden Dornröschenkuß sich erhob. Grane hielt sich glücklicherweise im Hintergrund, aber man hatte, als er sich langsam näherte, schon Angst vor mehr. Die Verzögerung des lösenden Liebes-Eins-Seins baute eine immense Spannung auf, bevor die beiden sich endlich selig im C-Dur-Liebeshymnus die Arme sinken konnten und…dann passierte das Unverzeihliche. Tänzer stoben auf die Bühne und hupften um das Liebespaar herum. Das war ein veritabler Coits interruptus, so, als hätte einen das schönste Mädchen der Schule endlich erhört und im entscheidenden Augenblick kommt die ganze Familie ins Zimmer und schmeißt sich mit aufs Bett. So kann man eine der wichtigsten und schönsten Szenen des „Rings“ bis auf den Grund zerstören. Zuschauer als verschiedenen Ländern: stinksauer.
Götterdämmerung
Besuchte Vorstellung: 19. Januar 2020
TRAILER
Vom dramaturgischen Entwurf und der Gesamtleistung aller Mitwirkenden her war die „Götterdämmerung“ der stärkste Teil des Leipziger Zyklus. Der wahre Opernfreund fragte sich allerdings auch hier wieder, warum manche Leute sich in ein Opernhaus verirren, die keinen Respekt vor Kunst, Ausführenden und den anderen Zuschauern haben. Immer wieder liefen Menschen türenschlagend hinaus, ein älterer Herr quasselte ständig mit seiner Frau und hörte damit auch nicht nach mehreren Ermahnungen seiner Umsitzenden auf, ein anderer hatte sein Mobiltelephon, aus dem Popgeplärre quoll, angeschaltet in der Tasche, ein weiterer öffnete lautstark eine Sprudelflasche. Der Blutdruck des Rezensenten konnte glücklicherweise durch ein Umsetzen gesenkt werden; es gab noch ein paar freie Plätze.
In der Nornenszene mit Karin Lovelius, Kathrin Göring und Magdalena Hinterdobler agierten die Tänzer einigermaßen diskret. Die Götter liefen als Schatten ihrer selbst auf der Bühne umher, ein später zweimal abgewandelter, wirklich guter Einfall. Man fragt sich ja immer wieder wie auf der letzten Seite des „Stern“: was machen eigentlich die Götter? Sie können nur tatenlos ihr Ende erwarten. Wagner hatte das altnordische Wort „Ragnarök“ mit „Götterdämmerung“ wiedergegeben; eigentlich wäre „Götter-Schicksal“ oder „Götter-Dunkelheit“ korrekter, aber in der „Dämmerung“ steckt mehr das Ahnende, zu Erwartende. Nun ist in den altnordischen Vorbildern und Wagners Oper das Schicksal der Götter mit dem der Menschen verbunden und da steht zuerst der eiskalte Mordplan gegen den unter das Intrigenrad gekommene Siegfried.
Diesen sang Thomas Mohr zu Beginn etwas quäkig, er legte dann aber umgehend an stimmlicher Fülle zu und gab eine formidable Leistung ab. Ihm zur Seite ließ Christiane Libor keinen Zweifel daran, daß sie eine große Brünnhilde ist. Die Leipziger Bühne wird in dieser Rolle sicher nicht ihre letzte sein.
Ihres Gefährten Rheinfahrt war gleichsam eine leichte und spritzige Fahrt mit dem musikalischen Motorboot, Schirmer hatte Kerosin in den Tank geschüttet. In der anschließenden Szene gab es kleine Schnitzer im Blech und einmal im Holz, aber ansonsten strahlte der Klangkörper gewohnt stark.
Auch die Gestaltung der Gibichungen und ihrer Wohnstatt war großartig gelungen. Das gut ausgeleuchtete Bühnenbild glich einem kalten Bürobau mit großen Fenstern; man war auch an die Luxusbuden der Reichen in manchen TV-Krimis erinnert, wo die Transparenz nur im Fensterglas gegeben ist. In Wahrheit ist alles von Lügen und Intrigen durchzogen. Ein Konzertflügel stand nur als Repräsentationsobjekt herum, spielen konnte und wollte ohnehin keiner darauf. Sucht bleibt in solch liebesfeindlicher Atmosphäre oft nicht aus und so spielte Tuomas Pursio sehr überzeugend einen Gunther als Alkoholiker, der mit seinem Ärmel immer wieder zwanghaft die Tropfen auf dem Glastisch abwischte, als wollte er das innerlich Schmutzige aus sich und seiner verlogenen Familie wegpolieren. Bei der Blutsbrüderschaftsszene jammerte er memmenhaft, als Hagen ihm die Hand ritzte. Dem Spiel entsprach seine sangliche Leistung, was auch für Sebastian Pilgrim als Hagen galt, der alle Register vom drohenden Flüstern bis zum donnernden Poltern beherrschte.
Seine Halbschwester Gutrune (Gal James) langweilte sich entweder am Tisch mit ihrem zunehmend angesäuselten Bruder oder in einer Glasvitrine, in der sie zuweilen wie ein Ausstellungsgegenstand saß. Albern war hingegen der Gang der Zofen und Diener, die alle drei Schritte innehielten. Das sollte wohl den Zwang darstellen, in dem sie mit ihrer unsympathischen Herrschaft leben müssen, und der auch ihre Bewegungen bestimmt. Eine herrische Attitüde legte auch Hagen an den dämmernden Tag, als er Grane herumschubste. Dieser hatte nun einen Mantel an, der mehr an einen verlängerten Hausmeisterkittel gemahnte als an die Mäntel aus einem Italo-Western, was wohl eigentlich intendiert war. Dies war aber nur ein unwichtiges Detail, das hinter den großen Momenten dieser Götterdämmerung verschwand.
Einer davon war der Streit zwischen Brünnhilde und Waltraute (wiederum Kathrin Göring); vor allem Waltrautes Wut auf die egoistische Schwester blitzte absolut authentisch. Hier übertraf sich Kathrin Göring gegenüber ihrer Rolle als Fricka deutlich. Ebenso echt und markerschütternd gellte Brünnhildes Schrei nach der Bezwingung durch den falschen Gunther – zwar befand sich der Balkon als Brünnhildenfelsen im gleichen Bühnenbild, war aber durch intelligente Lichtregie als eigener Bereich kenntlich gemacht.
Aus ihrem feurigem Refugium gerissen, sah sich die Betrogene, wie eine Jagdbeute gefesselt, vor das Gefolge der Gibichungen gezerrt, ein gleichgestalteter Block von Soldaten in Phantasie-Uniformen, die an englische oder französische Vorbilder aus dem späten 19. Jahrhundert angelehnt, aber SA-Braun gefärbt waren. Als Chor ausgesprochen kräftig und synchron, lieferten diese Untertanen eine reife Leitung ab. Die Stierhörner waren diesmal eine gelungene Spezialanfertigung, gestreckten Alphörnen ähnlich, mit durchdringendem Klang.
Passend zu den starren Mannen trug Siegfried nun ebenfalls einen Mantel in SA-Braun, auch er sichtbar gleichgeschaltet, durch den Vergessenstrank von Hagen nicht nur seiner Erinnerung an die Geliebte, sondern auch seiner Identität beraubt. Des späteren Mörders Speer wurde durch einen Dolch ersetzt, was einerseits eine oft zu beobachtende Wotan-Assoziation zurückdrängte und andererseits den Meuchelmord ankündigte.
Brünnhildes Zorn beim Eid vor dieser Tat war wieder einer dieser starken Augenblicke, dem Gunthers Schwäche, der buchstäblich am Boden – nämlich an Hagens Beinen hängend – gegenüberstand. Der Entschluß der drei zum Mord an Siegfried geriet zum finsteren, statischen Tribunal.
Dem Trio als Naturgeister entgegengesetzt wandelten die Rheintöchter jungmädchenhaft in Paillettenkleidern. Zwar brachten die Tänzer wieder Unruhe in das Geschehen, dafür schimmerten die Lichtreflexe des bewegten Wassers stimmungsvoll und klar.
Organisierte Großjagden haben in Deutschland eine düstere Tradition, die sich von Wilhelm II. über Göring bis zu Honecker zieht. Diese Assoziation lag nahe, als Siegfried hier das erlegte Wild der Mächtigen war und folglich auf der anderen Beute, einem kapitalen Hirsch, von Hagen mit dem Dolchstoß zur Strecke gebracht wurde. Als Bild funktionierte das, wenngleich es inhaltlich ein bißchen dicke war.
Nach dem folgenden Trauermarsch mit seinem genialen Wechsel von Moll nach Dur im Todesmotiv wandelten wieder die Götter umher, ratlos und stumm. Als Siegfrieds Bahre diente der Protzflügel, dazu schien er der Gesellschaft offenbar gerade gut. Sein Mörder Hagen machte sich beiläufig die Fingernägel mit der Mordwaffe sauber, ein grandios fieser Einfall.
Am 19. Januar blieben die vom Schnürboden hängenden großen Lappen bis auf einen hängen, der dann als Siegfrieds Leichentuch diente. Offenbar hätten sie alle, rot angestrahlt, auf den Boden herabfallen sollen.
Dort lagen die Attribute der Götter auf dem Haufen aus starken Scheiten, sie selbst irrten wieder im Kreise umher, wurden aber durch Huckauf-Dämone verfolgt, die ihnen ans nichtewige Leben wollten. Hier ergab die Tanztruppe Sinn.
Insgesamt hätte mehr Lametta bzw. Feuer sein dürfen beim großen Weltenbrand, aber feurig war in jedem Falle der musikalische Abgesang auf Walhalls Ende. Die Götter waren noch in den abgebrochenen Pfeilern sichtbar, bevor ihr Dasein verlosch. Aus den Ruinen der Burg wuchs neues Leben in Form einer wurmartigen Gestalt. Etwas hat überlebt und das war einer der verhüllten Tänzer, dessen Hand sich nach dem Himmel reckte. Ein neuer, besserer Mensch? Die Idee ist gar nicht verkehrt, wenn man an das Vorbild in der „Edda“ von Snorri Sturluson oder auch an Wagners Beschäftigung mit ostasiatischen Religionen denkt. Zwar stand er dem Buddhismus näher, aber möglicherweise steht hinter diesem Einfall der Gedanke an die hinduistischen Zeitalter, die sich ewig wiederholen.
Fazit der vier Tage in der Leipziger Oper: Ein „Jahrhundertring“ wie der, den Joachim Herz 1976 in Wagners Heimatstadt abgeschlossen hatte, ist es sicher nicht geworden. Die beiden schwerwiegendsten Kritikpunkte sind die oft unzureichende Personenregie und eben die fast immer überflüssigen Tanzeinlagen – Wagner haßte Ballett! Dennoch ist den Leipzigern ein großartiges Gesamtkunstwerk gelungen, mit immer wieder überwältigenden Gesamtleistungen und großartigen Solisten.
Das freundliche Personal der Oper und die gute Organisation der „Ring“-Tage im großzügigen Interieur des Haues schafften eine offene und gastfreundliche Atmosphäre. Gerade im Rückblick auf die in vieler Hinsicht tümelnde und rechtslastige Rezeption des 20. Jahrhunderts war hier erneut deutlich: der „Meesta“ verbindet!
Für das geplante Mammutprojekt der Oper Leipzig, 13 Oper Wagners im Jahre 2022 innerhalb von drei Wochen zur Aufführung zu bringen, kann man nur mit Siegfried sagen: „Frisch auf die Fahrt!“ Das wird was!
Andreas Ströbl, 24.1.2019
TRAILER (c) Oper Leipzig
Bilder siehe unten bei den Einzelbesprechungen
Und weil Wagnerianer nie genug kriegen können - hier die fünfte Kritik:
TRISTAN UND ISOLDE
Besuchte Aufführung am 10.11.19
(Premiere am 05.10.19)
Tristan und Isolde und Melot
Einen durchaus sehens -wie hörenswerten "Tristan" gibt es jetzt an der Oper Leipzig zu erleben, ich muss mich im Vorhinein allerdings für meine Meckerei entschuldigen, denn es geht dabei meistens um Kleinigkeiten, die so gehäuft den durchaus positiven Eindruck, den ich von der Vorstellung hatte, schmälern. Zunächst ist es für jedes Haus ein Wagnis, diese Oper auf den Spielplan zu setzen; ob man die passende Besetzung hat, was macht die Regie mit dieser äußerlich so minimalen Dramatik, dann natürlich die besondere Konzentration , die das Werk von allen Beteiligten verlangt.All diese Komponenten machen die Aufführung eines "Tristan" immer wieder zu etwas Besonderem.
Die Szene: Enrico Lübbe (Co.Regie Torsten Buß) inszeniert sehr reduziert, für mich oft zu reduziert, denn die Protagonisten stehen oft recht unbeteiligt zueinander, öfters mit Blick auf den Dirigenten, auf der Bühne, das ist auch bei dieser verinnerlichten Handlung einfach zu wenig Personenregie mit den Sängern. Es gibt zwei Ausnahmen: zum einen, wenn das Liebespaar nach dem Genuss des Liebestrankes schier aus dem (Neon-)bühnenrahmen fallen, zum anderen bei jedem Auftritt des Melot, denn Matthias Stier wuchert in der kleinen Partie nicht nur stimmlich, sondern spielt mit einer wirklich atemberaubend Präsenz. Den szenischen Rest fängt das grandiose Bühnenbild von Etienne Pluss auf: verrottete Architekturelemente auf der Drehbühne, erinnern manchmal an melancholische Palazzi in Venedig (Palazzo Vedramin!), Olaf Freeses magische Beleuchtungen vermischt mit Bühnennebel und den angenehm zurückhaltenden Videos von fettfilm, entfremden dazu den realen Bezug zur Realität und unterstreichen Wagners geniale Musik. Linda Redlins Kostüme zeigen moderne Menschen, Isolde hat dabei etwas wahrhaftig Königliches in ihrer Erscheinung.
Musikalisch kann man in Leipzig sehr zufrieden sein, selbst in einer eingeschränkten Aufführung, in der sich die Isolde zum zweiten Akt als indisponiert ansagen lässt. Ulf Schirmer geht am Pult des Gewandhausorchesters sofort auf die gegebenen Umstände ein und nimmt den Klang in der Lautstärke in zweiten Akt zurück, was sogar dem Gesamten etwas sehr Positives bringt, denn das Liebesduett wird auf diese Weise zu einer wundervoll intimen Szene voller Pianoschmelz. Im dritten zu den Fieberextasen zieht er den dramatischen Ausdruck wieder an.
Die Oper lebt natürlich von der Besetzung des Titelpaares: Meagan Miller muss zudem mit ihrer Indisposition beurteilt werden, im ersten Akt gefielen mir ihren wirklich "bombigen", leuchtenden Höhen, nach der Ansage nahm sie sich im zweiten Akt folgerichtig zurück, um die Oper dann mit einem ausgesungenem und intim gestalteten Liebestod zu krönen. Ich kann mir vorstellen, das die Sopranistin in gesundem Zustand eine wirklich ausgezeichnete Isolde ist, ebenso wie Daniel Kirch ein hervorragender Tristan. Verbesserung könnten manchmal beim Legatogesang sein, denn der Tenor neigt ein bißchen zum "Belfern", also etwas mehr Belcanto wäre schön. Sehr überzeugend die konditionell fordernden Fieberextasen des dritten Aktes, hier kommt der baritonal klingende Sänger mit guten Höhen zur besten Geltung. Mathias Hausmanns Kurwenal kommt sicher und solide daher, Barbara Kozeljs Brangäne kommt in ersten Akt an etwas klirrende Höhengrenzen, punktet dann aber in den Wachgesängen. Sebastian Pilgrim bringt als König Marke gewaltiges Bassmaterial mit, doch mir persönlich gefällt seine Art zu singen nicht, da wird Volumen mit viel Druck angegangen, das Legato zu wenig beachtet, die Töne oft von unten "anchromatisiert", was man bei einigen Stellen bei Wagner durchaus machen kann, doch nicht durchgängig. Pilgrim ist für mich ein großes, doch noch etwas ungeschliffenes Talent. Matthias Stier hinterläßt, wie bereits gesagt, als Melot einen sehr starken Eindruck. Martin Petzold (Hirt), Franz Xaver Schlecht (Steuermann) und Patrick Vogel (junger Seemann) komplettieren auf ansprechendem Niveau. Die Chorherren der Oper Leipzig ebenfalls. Besondere Erwähnung verdient das traumhaft vorgetragene Englischhornsolo von Gundel Jannemann-Fischer, die als szenisch gewordene Melodie von der Bühne spielt.
Insgesamt ein sehr hörenswerter "Tristan" mit grandiosem Dekor, dem jedoch oft eine szenische Intensität fehlt. Allen beteiligten muss allerdings noch eine hervorragende Textarbeit attestiert werden, was bei den großen Wagneropern keine kleine Leistung ist.
Martin Freitag, 19.11.2019
Nachschlag: vierte Kritik
TRISTAN UND ISOLDE
Premiere am 5. Oktober 2019
Eine musikalische Offenbarung
Schon das Vorspiel machte deutlich, wo die größte Stärke dieses Abends liegen würde - im Dirigat des Intendanten und GMD Ulf Schirmer, der mit dem Gewandhausorchester gleich zu Beginn einen majestätischen, breit fließenden Klang zauberte, der sich wesentlich von dem abhob, was man sonst im allgemeinen zu hören bekommt, auch wenn das schon gut ist. Diese höchste musikalische Qualität hielt im Laufe eines interessanten Abends an. Herrlich präzise und klar intonierten die Blechbläser, transparent ertönten die Streichersoli bei einem ansonsten satt klingenden Streicherteppich, der mit dem Holz stets perfekt harmonierte. Schirmer vermochte auf besondere Art und Weise die Chromatik, die Wagner im „Tristan“ zu Vervollkommnung führte, darzustellen und so auch klarzumachen, was mit der berühmten „unendlichen Melodie“ seines Oeuvres gemeint ist.

Es wurde ein musikalischer „Tristan“ der Extraklasse, diese Saisonpremiere der Oper Leipzig. Und er fand seine Entsprechung auch weitgehend auf der Bühne. Enrico Lübbe mit dramaturgischer Unterstützung von Nele Winter und Regie-Mitarbeit von Torsten Buß erzählt die Geschichte in einem die ganze Bühne umfassenden Lichtrahmen, der als Grenze zwischen Phantasie und Realität dient, wenn immer wieder Figuren aus ihm heraustreten. Zentrum des oft, aber stets dramaturgisch sinnvoll rotierenden Bühnenbildes von Étienne Pluss stellen durchaus eindrucksvolle aus Holz gezimmerte Schiffsaufbauten dar, mit klassizistischen Apercus und Treppenaufgängen ins Schiffsinnere, aus denen später das verhängnisvolle und von den Liebenden so gefürchtete Licht hervordringt. Im Laufe der drei Aufzüge verfallen diese Aufbauten immer mehr zu Wrackteilen, ähnlich wie in einer Inszenierung von Elisabeth Linton 2013 an der Finnischen Nationaloper Helsinki. Sie verdeutlichten somit optisch die immer unmöglicher werdende Liebe zwischen Tristan und Isolde in dieser gegenständlichen Welt.

Die österreichische Kostümbildnerin Linda Redlin schuf dazu geschmackvolle und passende Gewänder. Ein besonderes Lob sei der dramaturgisch exzellenten Lichtregie von Olaf Freese gezollt, der starke Stimmungsbilder schuf und insbesondere im 3. Aufzug mit einer dunkel dräuenden, ja fast depressiven Beleuchtung beeindruckte. Dazu kamen die wie immer sinnvoll und sich an der Handlung orientierenden Videos von fettFilm.

Das Regieteam zeigt eine facettenreiche und oft auch überraschende Personenregie, die aber fast immer Sinn macht. So stehen Tristan und Isolde beim Liebestrank zunächst ganz weit auseinander an den Bühnenpfosten. Dann fällt ein Zwischenvorhang, einer übrigens von zu vielen, hinter dem wohl der Liebestrank genossen wird. König Marke tritt am Schluss des 1. Aufzugs gleich mit Haus und Hof auf. Isolde muss im Laufschritt statt einer Leuchte im 2. Aufzug gleich ein halbes Dutzend von Teelichtern löschen. Seit langem sieht man mal wieder einen intensiven Kampf zwischen Tristan und Melot, der es schließlich schafft, dem Neffen des Königs das Messer in den Leib zu rammen. 
Ebenso realistisch wird der Kampf am Ende des dritten Aufzugs gezeigt, offenbar professionell einstudiert, denn er wirkt ja meistens nur peinlich. Dass im dritten Aufzug dazu auf einmal dann sechs weitere mädchenhafte Isolden auftreten, kann wohl nur mit Tristans Fieberphantasien oder jenen des Regisseurs zu begründen sein. Denn sie hatten in dieser eher veristischen Ästhetik keinen sinnvollen Platz. Bewegend war hingegen, dass Gundel Jannemann-Fischer ihr Englischhorn-Solo auch mitgestaltend spielen konnte, denn es kam dabei zu einer zärtlichen Begegnung mit Tristan. Stimmig war auch die Überraschung, obwohl bei Wagner nicht vorgesehen, dass Tristan und Isolde sich nach den zuletzt immer wieder zu sehenden emotional-aseptischen Inszenierungen (besonders am Munt in Brüssel im Mai d. J.) endlich einmal berühren und gar streicheln durften. Er starb sogar liebevoll in ihren Armen…
Das passte aber auch zum gehaltvollen Dirigat Ulf Schirmers.
Bei den Sängern möchte ich mit denen beginnen, die mich besonders beeindruckten. Das ist als erste die Slowenin Barbara Kozelj, die mit der Brangäne ihr Rollendebut gab. Sie verfügt über einen charaktervollen leuchtenden Mezzo und scheint auch mit ihren darstellerischen Qualitäten eine erstklassige Besetzung für die Warnerin Isoldes zu sein. Herrlich auch ihre entsprechenden Rufe im 2. Aufzug, bei denen sie auch sichtbar war.

Jukka Rasilainen begeisterte wieder in seiner Glanzrolle als Kurwenal mit seinem prägnanten und kraftvollen Heldenbariton bei hervorragender Diktion und starker Rolleninterpretation. Der junge Chilene Alvaro Zambrano sang den Jungen Seemann aus den Off mit einem klangvollen Tenor, der auf größere Aufgaben hinweist. Auch Martin Petzold als Hirt konnte mit einem gefälligen Tenor überzeugen. Und sogar der von Wagner so kümmerlich behandelte Steuermann mit nur zwei Sätzen war mit Franz Xaver Schlecht alles andere als schlecht besetzt. Matthias Stier rundete mit seinem Melot die gute Besetzung der Nebenrollen ab.

Die US-amerikanische Sopranistin Meagan Miller sang in Leipzig ihre erste Isolde und konnte mit einem klaren, eher hellen jugendlich dramatischen Timbre mit manchmal leicht scharfen Spitzentönen weitgehend überzeugen, darstellerisch ohnehin. Mich berührte ihr stimmlicher Ausdruck emotional aber nicht, es fehlte mir einfach das Charakterhafte, das Tragische in der Stimme, auch etwas mehr Tiefe, oder konkreter gesagt, etwas von dem, was Waltraud Meier so unvergleichlich mit ihrem Mezzo in der Isolde zum Ausdruck brachte. Daniel Kirch gab einen darstellerisch gut artikulierten Tristan mit einem durchaus kraftvollen Tenor, der meines Erachtens aber zu sehr auf Kraft setzt. Die Stimme scheint nicht wirklich frei zu sein und lässt es somit an Wandlungsfähigkeit, Variationsreichtum und auch Resonanz vermissen. Das geht bisweilen auch zu Lasten der Wortdeutlichkeit. Kirch gab aber gerade im 3. Aufzug sein wirklich letztes, und das war nicht wenig. König Marke war mit dem erst 34-jährigen Sebastian Pilgrim nicht auf dem Niveau der übrigen Protagonisten besetzt. Sein durchaus voluminöser Bass klingt tönern und weist noch nicht die Stimmkultur auf, die er für eine solche Wagnerrolle haben sollte. Vielleicht sollte man dem jungen Sänger an einem Haus wie Leipzig noch etwas mehr Zeit geben, in solch große Rollen zu gehen. Thomas Eitler-de Lint hatte den
Chor der Oper Leipzig mit seinen wenigen Interventionen kraftvoll singend einstudiert.

Dieser „Tristan“ war ein gelungener Start der Oper Leipzig in die Saison 2019/20 auf ihrem Weg, alle 13 Wagner-Werke im Juni/Juli 2022 hintereinander aufzuführen. Weitere „Tristan“-Vorstellungen am 10.11.2019, und am 14.3. und 1.6.2020.
Klaus Billand, 20.10.2019
Fotos: Tom Schulze 1-5; K. Billand 6-7
Zum Dritten
Tristan und Isolde
Premiere am 05. Oktober 2019
Brangäne und Marke...
so hätte der Titel des Werkes lauten müssen, wenn es nach den besten Sängerleistungen dieser Neuproduktion zu urteilen gälte!
Im Zuge seiner Pflege der Werke Richard Wagners präsentierte die Oper Leipzig eine Neuproduktion des Musikdramas „Tristan und Isolde“. Eine sehenswerte Produktion, die vor allem durch ein spektakuläres Bühnenbild und eine der Musik folgende Inszenierung zu überzeugen weiß.
Regisseur Enrico Lübbe erzählt, gemeinsam mit seinem Co-Regisseur Torsten Buß die Handlung, ohne große Verfremdung oder Aktualisierung. Lübbe gelingen immer wieder überzeugende Bildwirkungen, weil er der Musik vertraut und somit werden auch die Vorspiele nicht inszeniert. Welch ein Glück! Die konkrete Handlung spielt auf einer Drehbühne mit diversen Schiffsüberresten. Das Bühnenportal wird von einem Lichtrahmen eingerahmt. Durch diesen schreiten Tristan und Isolde in ihre imaginäre Welt. Manche Ideen geraten dabei manchmal zu dekorativ, etwa wenn im zweiten Aufzug ständig ein Gazeschleier hoch- und runterfährt, um beide Spielflächen von einander abzugrenzen. Es gab auch lange Leerläufe, wie etwa im stark gekürzten Liebesduett im zweiten Aufzug. Hier standen Tristan und Isolde mit unbeweglicher Miene am Portal und sangen schlicht nach vorne und damit aneinander vorbei. Plötzlich wirkte dieser Teil wie ein Auszug aus einer konzertanten Aufführung. Auch die diversen Verdopplungen von Tristan und Isolde wirkten entbehrlich. Allein sieben Isolde Doubles werden aufgewendet, um Tristans Vision von Isolde im 3. Aufzug zu beglaubigen. Tristan stirbt dann auch nicht, sondern wird von Isolde zum Leben wiedererweckt und wartet dann vor dem Lichtrahmen auf Isolde, die ihm nach dem Liebestod einen langen Kuss gibt. Dann schreiten die Liebenden auf ein goldenes Licht zu. Tristan und Isolde sind in einer besseren Welt. Ein starkes Bild! Zuvor darf die Solistin des Englischhorn-Solos (wunderbar musiziert von Gundel Jannemann-Fischer) die Musik verkörpern, was zu poetischen Momenten zwischen Tristan und der Instrumentalistin führt.
Der einheitliche Bühnenraum von Étienne Plus zeigt auf einer Drehbühne einen Schiffsfriedhof. Diese Konstruktion wirkt als Labyrinth ebenso überzeugend wie als Schauplatz, welcher leicht verändert werden kann und somit immer wieder neue Einblicke ermöglichte. Der Tod ist gegenwärtig, Gestrandete also, ein Bild des Stillstandes. Fabelhafte Bildeindrücke, die Olaf Freese ausgezeichnet beleuchtet hat. Dezent und stimmungsvoll die Videoeinspielungen von fettfilm, die den Bühnenraum z.T. unendlich weiten oder surreal erscheinen lassen.
Linda Redlin hatte kleidsame Kostüme für die Protagonisten entworfen.
Bleibt also eine Inszenierung, die durch ihre ästhetischen Bildwirkungen für sich einnehmen kann und in der Personenführung eher dezent und meistens schlüssig bleibt. Enrico Lübbe ist besonders für sein Bemühen zu loben, die Geschichte des Werkes zu erzählen. Eine große Seltenheit heutzutage, da Regisseure zu häufig sich auf Kosten eines Werkes selbst inszenieren!
Natürlich stehen bei einer solchen Produktion die musikalischen Akteure im Mittelpunkt des Interesses. Intendant Ulf Schirmer entschied sich für lyrische Stimmen für die Titelpartien. Um diese zu schonen, verwendete er leider den großen sog. „Tag-Strich“ im zweiten Aufzug und zahlreiche Retuschen an der Partitur. Somit trug der musikalische Teil des Abends zu dominant das Signum der Grenzwertigkeit in der musikalischen Gestaltung. Keiner der Protagonisten sollte zu Schaden kommen, was durchaus löblich ist. Allerdings fehlte so dieser Tristan Interpretation jedwede musikalische Überwältigung und die akustische Übervorsicht nahm der Musik dann doch zu viel an Wirkung.
Erstmals als Isolde präsentierte sich Meagan Miller in ihrem Rollendebüt. Eine solche gewaltige Rolle ist und bleibt eine Lebensaufgabe. Zu groß, zu umfangreich und zu komplex sind die Anforderungen. Miller ist eine eher lyrische Isolde, die dann auch vor allem in den weniger dramatischen Abschnitten deutlich überzeugen konnte. Sobald Dramatik gefordert war, wie etwa beim Löschen der Fackel oder bei der Totenklage geriet die Stimme noch an Grenzen, da die Stimme eher schlank als üppig strömte. Sie erreichte gut alle Töne und sang auch mühelos bis zum hohen C hinauf. Was ihr derzeit vor allem noch fehlt, ist ein gestalteter Charakter. Der Text wirkte zuweilen buchstabiert und noch zu wenig erlebt. Ein anrührender Liebestod und so manch eigene Textbetonung offenbarten ihr Entwicklungspotential. Darstellerisch wirkte sie beteiligt und engagiert, mit der Rolle innerlich verbunden. Nur sollte sie derzeit diese Partie nicht zu oft singen. Es ist eine jugendlich dramatische Stimme, die eher bei einer Tannhäuser Elisabeth zu Hause ist als bei Isolde.
Als Tristan zeigte Daniel Kirch eine problematische Leistung. Auch er ist kein dramatischer Sänger oder Heldentenor. Sein Stimmvolumen ist sehr begrenzt und lässt eher an eine Tenorstimme für die mittleren Partien Wagners denken, wie z.B. Erik oder der Max in Webers Freischütz. Seine zuweilen verquollene, dumpfe Tongebung beraubte seiner Stimme die Tragfähigkeit. Sein Vortrag wirkte eintönig, dynamisch unzureichend und im Text kaum gestaltet. Erstaunlich oft diffus in der Artikulation wirkten seine verwaschenen Konsonanten. Nahezu alles klang gleich, ohne Unterschied in der Dynamik oder im Text. Lediglich zwei bis drei Versuche, die Stimme unterhalb eines Forte zu bewegen genügen nicht, um einen Rollencharakter klanglich zu realisieren. Somit klang der todkranke Tristan genauso „gesund“, wie bei seinem ersten Auftritt im ersten Aufzug. Zunehmende Schwierigkeiten mit der korrekten Intonation zeigten, wie deutlich diese Partie über seine Möglichkeiten geht. Von ihm ging zudem als Rollencharakter keine Faszination aus. Er sollte sich einmal große Kollegen anhören, um zu begreifen, welche Farben in dieser vielschichtigen Partie stecken und wie diese in eine sinngebende, bannende Textgestaltung umgesetzt wurden. Somit fehlte dem Abend leider ein starker Gestalter.
Als Brangäne begeisterte hingegen Barbara Kozelj mit klangstarkem, sauber intoniertem Mezzosopran. Engagiert im Spiel war sie ein deutlicher Aktivposten. Selten ist die Anteilnahme, die szenische Interaktion in dieser Rolle derart glaubhaft und gekonnt zu erleben. Sauber in der Intonation erklangen die „Wacht“-Gesänge. Dazu erlebte sie den Text deutlich und intensiv, dass es eine Freude war. Eine ausgezeichnete Leistung!
Solide agierte der bewährte Kurwenal in der Gestalt von Jukka Rasilainen, der für den unpässlichen Mathias Hausmann eingesprungen war. Kernig in der Stimme und weithin sicher, wirkte seine Textverständlichkeit zuweilen verwaschen.
Dem König Marke gab Sebastian Pilgrim seine ganze Autorität und die Wucht seines voluminösen Basses. Stimmlich blieb er seiner Partie nichts schuldig und begeisterte durch große Autorität in Stimme und Spiel. Vorbildlich seine dynamische Bandbreite und seine Textgestaltung. Pilgrim zeigte äußerst eindrucksvoll, wie stark diese Komposition wirken kann, wenn passende Stimmgröße und gestalterische Intelligenz aufeinander treffen. Mit jeder Silbe seines wissenden Gesangs veränderte sich die Atmosphäre der Vorstellung. Plötzlich war ein gestaltender Mittelpunkt erlebbar. Ein großartig gesungenes und gestaltetes Rollenportrait!
Matthias Stier war ein eiskalter Melot, der gefährlich wirkte und seinen Auftritt pointiert nutzte, um sich stimmlich gut in Szene zu setzen. Ansprechende Leistungen zeigten auch die beiden Tenöre Martin Petzhold als Hirte und Alvaro Zambrano als junger Seemann. Kernig der kurze Einwurf des Steuermanns von Franz Xaver Schlecht.
Thomas Eitler-de Lint hatte den Herrenchor der Oper Leipzig stimmsicher und kompakt im Klang einstudiert. Sehr bedauerlich nur, dass die fabelhaften Sänger beim Auftritt König Markes hinter der Bühne singen mussten!
Seine musikalische Kompetenz als Wagner-Dirigent demonstrierte GMD/Intendant Ulf Schirmer. Seine Interpretation geriet dabei nicht aufwühlend oder aufschäumend. Schirmer suchte vor allem die lyrischen Momente der Partitur und nahm so das Orchester in seiner Dynamik weit zurück, so dass die Sänger auch in der Lage waren, so weit gegeben, Pianofärbungen in ihrem Gesang zu ermöglichen. Schirmer übernahm in seiner Einstudierung die Retuschen des Dirigenten der Ur-Aufführung, Hans von Bülow, eine ambivalente Entscheidung. Die Sänger mussten zwar nie forcieren, allerdings fehlte dadurch diesem Tristan-Dirigat eine ganze Dimension. Das Orchester musste mit angezogener Handbremse musizieren. Somit fehlte das Überwältigende, Narkotisierende der Musik, weil Schirmer allzu viel Vorsicht walten ließ.
Sehr gut hingegen die Entscheidung, dass die komplette Bühnenmusik live gespielt wurde, was heute keine Selbstverständlichkeit ist.
Eines lässt sich bereits jetzt sagen: diese „Tristan“-Produktion wird entscheidend durch das überragende Orchesterspiel des Gewandhausorchesters geprägt. Die stilistische Bandbreite dieses so wunderbaren Orchesters erscheint grenzenlos, ist es doch in der Oper ebenso zu Hause wie im symphonischen Repertoire. Konzentriert und ausdauernd zeigte das Orchester hohe Klangkultur. Wunderbare Soli, wie z.B. im langen elegischen Englischhorn-Solo des dritten Aufzuges, standen kompakte Tutti-Wirkungen gegenüber.
Das Publikum war hörbar angetan von der Produktion und feierte alle Mitwirkenden ausgiebig, lediglich schüchterne Ablehnungsversuche beim Team der Inszenierung.
Dirk Schauß, 7. Oktober 2019
Zum Zweiten
TRISTAN UND ISOLDE
Premiere 5. Oktober 2019
Ein Theatermann inszeniert Wagner in Leipzig - Enrico Lübbes Hausdebüt im Opernhaus Leipzig
Warum fahren Wagner-Verrückte und C.T.-Verehrer aus Dresden zu Ulf Schirmers Tristan-Premiere nach Leipzig?
Da wäre zunächst der Regisseur Enrico Lübbe, ansonsten Intendant des Schauspielhauses Leipzig und damit Nachfolger des „Skandal -Regisseurs“ Sebastian Hartmann, meines Großneffen. Und es war natürlich interessant, wie uns die Tristan-Dirigate Ulf Schirmers nach zwei Bayreuth-Erlebnissen angreifen werden. Und außerdem waren wir gespannt, wie Daniel Kirch, dessen Siegfried uns in Chemnitz extrem begeistert hatte, den Tristan bewältigt.

Wäre ich unvorbereitet in die Premiere gekommen, so wäre ich sicher gewesen, dass als Regisseur ein Filmschaffender die Inszenierung zu verantworten habe. Aber dank der Partnerschaft mit dem hochkreativen österreich-schweizerischen „Bühnenbildner“ Etienne Pluss und dem Co-Regisseur Torsten Buß war ein faszinierendes Bühnenereignis entstanden. Ein simpler Lichtrahmen übernimmt als wesentlichstes Element die Aufgabe in der eigentlich klassischen Inszenierung, eine Abgrenzung der Protagonisten von der realen Welt vorzunehmen.
Die Bühne fesselte vom ersten Augenblick. Mit faszinierend wechselnden Bildern einer Videoinstallation, der Drehbühne und den handelnden Personen wurde der Betrachter über einen grauen Schiffsfriedhof geführt, bis der Bilderlauf in der Kabine eines Seglers zur Ruhe kam. Für die erste Szene der Isolde mit Brangäne, fast etwas ablenkend, um vom Vorspiel und dem Lied des jungen Seemanns nahtlos in die Handlung zu kommen. Die Video-Drehbühnenkombination erlaubt der Regie, die Besucher auf beliebige Plätze des Schiffes zu führen.
Mit dem zweiten Akt gelang Enrico Lübbe im schier endlosen Liebesduett jenen Rausch Richard Wagners am freien Flug seinem exzessiven Ausnahmezustand gerecht zu werden. Seine wechselnden Befindlichkeiten, das psychologisch eigentlich Unerklärbare, den Tag zur Ursache allen Übels zu erklären und die Nacht, den Tod als ultimatives Lebensziel zu beschwören, wurde mit raffinierter Bühnentechnik, dem Einsatz eines Double-Paares und einer partiell schwarzen Umgebung bewältigt, so dass die Wandlungen der Gefühlswelten mit dem Wechsel von Körpernähe und -ferne auch bildhaft wurden.

Für den dritten Akt hatte Lübbe das Wrack eines verlassenen Schiffes gewählt und überließ einer Vielzahl Isolde- Statistinnen Tristans Fieberphantasien bildlich werden zulassen. Gefangen in der unerfüllten Todessehnsucht leben Isolde und Tristan weiter mit ihrem Wunsch im Tode vereint zu sein. Die Lichtgestaltung und die Videoinstallationen waren beeindruckend im Konzept umgesetzt. Die Kostüme der Linda Redlin waren als einzige Komponente der Arbeit Lübbes zeitübergreifend gestaltet.
Als Isolde war die stimmstarke amerikanische Sopranistin Meagan Miller mit ihrem Sinn für dramatische Situationen gewonnen worden. Ihre volle kräftige Stimme mit ihrer hervorragenden Höhe findet aber auch mezzopiano Stimmfarbeben, durchaus auch zynisch und selbstironisch. Sie weiß sich auf der Bühne zu bewegen und vermag die Ideen des Schauspiel-Spezialisten umsetzen.
Der Tristan von Daniel Kirch enttäuschte unsere Erwartung nicht. Aber ein „großer Tristan“ ist er noch nicht. Da benötigt seine leicht brüchige Tenorstimme noch etwas Entwicklung, wenn ihn der durchsetzungsfähige Sopran der Amerikanerin gelegentlich überstrahlt.
Die Mezzosopranistin Barbara Kozelj aus Slowenien war als die Stimme der Vernunft als Brangäne eine ideale Partnerin der Isolde auf Augenhöhe. Stimmlich mit Meagan Miller gut abgestimmt, bietet sie dank ihrer starken Präsenz ein echtes Erlebnis.
Der König Marke, mit dem Ensemble-Mitglied Sebastian Pilgrim bestens besetzt, war von der Regie von vornherein als schwacher Herrscher und wenig sympathisch angelegt. Mit profundem sicher geführtem Bass bewältigte er seine Aufgabe, in die Psyche von Isolde und Tristan einzugreifen.

Das Ensemblemitglied Matthias Stier, trifft als Melot geifernd mit seiner schneidenden Charakterstudie genau den richtigen Ton des Verräters.
Jukka Rasilainen ist als Kurwenal erst im letzten Moment in die Inszenierung einbezogen worden, verfügt aber über ausreichend Erfahrung, um den Vertrauten Tristans wacker gesanglich und spielerisch prägnant darzustellen.
Auch die „kleineren Rollen“ waren leistungsfähigen Sängern anvertraut. Der Steuermann von Franz Xaver Schlecht mit seinem elegant-dunklem Bariton und der Hirte des erfahrenen Oratorien-Tenors Martin Vogel waren schon beeindruckend. Der junge Seemann von dem lyrisch geprägten Tenor Alvaro Zambrano gesungen, war fast eine Luxusbesetzung.
Die Oboistin des Gewandhausorchesters Gundel Jannemann-Fischer bot mit ihren in der Szene integrierten Bassklarinetten-Soli eine berückende Besonderheit der Inszenierung.
Der Chor präsentierte sich kräftig und transparent, aber nicht unbedingt klangschön.
Zum Orchester möchte ich mich nicht unbedingt äußern, weil ich doch dem Dresdner Klang zu stark verhaftet bin. Das bedeutet aber keinesfalls eine Einschränkung der Orchesterqualität, denn es wurde hervorragend musiziert. Die Klangentfaltung im Leipziger Opernhaus ermöglicht allerdings keinen extrem emotionsgeladenen Tönerausch.

Ulf Schirmer leitete die Aufführung straff, facettenreich aber nicht immer freundlich unterstützend den Sängern gegenüber. Ich empfand, dass er mit seinem Dirigat einen etwas kühleren Eindruck vermittelte. Das mag an der Premieren-Nervosität gelegen haben, denn an der Darbietung der Musik Richard Wagners gab das keine Einschränkung. Schwieriger war da schon der Eventcharakter der bilderbetonten Regie, der gelegentlich ablenkte. Aber das mag meine persönliche Auffassung zur Arbeit Lübbes sein und sich aus dem Eindruck halbszenischer Wagner-Aufführungen bei den Budapester Wagnertagen speisen.
Von den Freunden der Musik des in Leipzig geborenen Meisters wurde die Leistung der Künstler um Enrico Lübbe und Ulf Schirmer stürmisch bejubelt und mit stehenden Ovationen bedacht, an denen ich mich mit viel Überzeugung beteiligte.
(c) Tom Schulze
Thomas Thielemann 6.10.2019
Zum Ersten
TRISTAN UND ISOLDE
Premiere am 5. Oktober 2019
„Langsam und schmachtend“ schrieb Richard Wagner über die Einleitung zu TRISTAN UND ISOLDE in seine Partitur – und genau so klang dieses berückende Vorspiel mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung des Intendanten und Generalmusikdirektors der Oper Leipzig, Ulf Schirmer. Diese ausgeprägte Langsamkeit ermöglichte es den Zuhörer*innen behutsam einzutauchen in den so speziellen Klangkosmos dieses Werks, mit dem zentralen Motiv des berühmt berüchtigten Tristan Akkords (F-H-Dis-Gis). Es war - um mit den Worten Isoldes zu sprechen - ein Ertrinken, Versinken, das zu höchster Lust führte. Denn das Gewandhausorchester Leipzig und Ulf Schirmer legten einen unglaublich differenzierten Klangteppich aus, mit großen, atmenden Bögen, fein ziselierten Details, intensiv im Klangerlebnis, aber nie übertrieben in der Lautstärke, so dass jedes Crescendo oder Diminuendo seine Wirkung voll entfalten konnte. Klugerweise wurde dieses Eintauchen in diese überirdisch schöne Musik ohne ablenkende „Illustration“ auf der Bühne ermöglicht, lediglich ein Rahmen leuchtete um die große schwarze Fläche des Gazevorhangs. So konnte man sich ganz ungestört den exzellenten Klangqualitäten diese Orchesters widmen, den wunderbar fein und filigran intonierenden Streichern lauschen, dem präzisen Holz sein Ohr widmen, sich an dem sauberen und kontrollierten Klang des Blechs erfreuen. Besonders hervorzuheben das wunderbar präzise angegangene Vorspiel zum letzten Aufzug, wo sich aus dem Gegrummel der tiefen Streicher die Hörner so wundervoll abheben, bevor sich die Violinen in höchste Lagen aufschwingen. Die Musikerin mit dem Englischhorn, welche die tieftraurige Melodie aus Tristans Jugend spielt, taucht auf der Bühne auf, versinkt quasi mit Tistan in einen inneren Dialog. Gundel Jannemann-Fischer spielt diese Solostellen mit berührender Ausdruckskraft. Einen Soloapplaus bekam am Ende auch Gábor Richter, welcher auf der eigens für diese Aufführung angefertigten Holztrompete die Ankunft Isoldes so freudvoll eingeleitet hatte.
Und erfreuen konnte man sich dann auch an der Inszenierung und dem Bühnenbild, sobald das Licht auf der Bühne nach der Einleitung langsam anging. Der Intendant des Schauspiel Leipzig, Enrico Lübbe, hat zusammen mit seinem Team eine großartige Inszenierung dieser nicht ganz einfach zu realisierenden Oper geschaffen, eine Inszenierung, welche mir persönlich unendlich viel für das Verständnis des Werks gegeben hat (nach geschätzten 20 verschiedenen Live-Inszenierungen, die ich gesehen habe). Dazu hat Étienne Pluss dem Regisseur ein verwinkeltes, vertracktes Bühnenbild auf die Drehbühne gebaut, das inspiriert war von einem Schiffsfriedhof. Diese Bühne mit Elementen aus schrägen Flächen, Resten von Schiffsrümpfen, Kapitänskajüten und freien Räumen war von großer Suggestionskraft. Dank des stimmig eingesetzten Lichtdesigns von Olaf Freese und den dezent und beklemmend gesetzten Video-Clips des Teams von fettFilm entstand ein konzentrierter Gesamteindruck, welcher sowohl den realeren aus auch den transzendentaleren Aspekten der Oper gerecht wurde. Dabei treten Tristan und Isolde immer mal wieder aus dem Leuchtrahmen heraus, heraus aus ihrer Umgebung, in eine andere Sphäre – und gleichzeitig sind sie in ihrer unzerstörbaren Liebe auch näher bei uns. So am Ende des ersten Aktes, nach der Einnahme des Liebestrankes, wo sie quasi zum fiebrigen Liebesrausch des Orchesters bereits in ihre eigene Welt abdriften, oder im zweiten Akt, wo sie zu O sink hernieder Nacht der Liebe je rechts und links am Bühnenrand stehen, die Bühne dunkel bleibt, alle Konzentration auf die Todessehnsucht der beiden gerichtet ist. Später treten dann auch noch Doubles von Tristan und Isolde auf, es gibt Verschmelzungen und Unklarheiten, genau wie im Text Wagners. Auch sieht Tristan im dritten Akt in seinem Fieberwahn gleich mehrere Isolden auf Kareol ankommen, der Wahnsinnige, der die Realität vor allen anderen erkennt. Sehr positiv aufgefallen ist die genaue Personenführung und Charakterisierung der Protagonisten in den realeren, kammerspielartigen Szenen durch Enrico Lübbe und Co-Regisseur Torsten Buß. Zum Beispiel die tödlichen, hasserfüllten Blicke, welche sich Melot und Brangäne zuwerfen zu Beginn des zweiten Aktes oder wie textgenau das Wüten Kurwenals gegen Ende des dritten Aktes ausgeführt wird, wo er alle Ankommenden des zweiten Schiffs gnadenlos abschlachtet, was zwar in der Handlung so extrem nicht vorgesehen ist, aber perfekt zu Markes Worten „Halte, Rasender! Bist du von Sinnen? – Tot denn alles, alles tot“ passt.
Das Glück vollkommen machten natürlich die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, von den kraftvoll und markant intonierenden Herren des Chors der Oper Leipzig, über den kurzfristigen Einspringer für den Kurwenal bis zu den beiden Rollendebütanten für Isolde und König Marke. Daniel Kirch sang einen zutiefst beeindruckenden, überaus stimmschönen Tristan, kontrolliert, nie forcierend, mit klarer, unverwaschener Diktion und klar konturierter Abmischung der Dynamik. Seiner Stimme kam sicher das einfühlsame Dirigat Schirmers entgegen, und selbst wenn Kirchs Stimme mal von einem Aufbäumen des Orchesters leicht zugedeckt wurde, geriet er nicht in Versuchung zu viel Druck auf seine Stimme auszuüben. Die Zukunft wird es ihm danken! Als Isolde debütierte Meagan Miller. Insbesondere der erste Akt geriet ihr mit herausragender, ja geradezu leuchtender Klarheit in Stimmführung, Durchdringung des Textes und kraftvollen, wunderschön abgerundeten Höhen. Auch im zweiten Akt erzeugte sie oft Gänsehaut, z.B. mit der so herrlich aufblühenden Phrase „dass hell sie dorten leuchte“ und natürlich im Liebes-Todesrausch Zwiegesang mit Tristan, unterbrochen von den warnenden, gehaltvoll intonierten Rufen der Brangäne von Barbara Kozelj. Frau Kozelj begeisterte rundweg mit ihrer vokalen Interpretation dieser wichtigen Rolle. Ihre Stimme ist eher hell gefärbt, derjenigen der Isolde im Timbre sehr ähnlich. Sie verfügt über ein beeindruckendes Volumen und beglückte (wie eigentlich alle Protagonisten) mit ihrer klaren Diktion und subtiler Phrasierung. Einen großen Erfolg konnte der stimmgewaltige Bass Sebastian Pilgrim für sein Rollendebüt als König Marke verbuchen. Mit beklemmender Stimmgewalt schmetterte er seine Fragen an Tristan und seine Enttäuschung über ihn in seinem langen Monolog im zweiten Akt heraus, dabei aber sehr wohl dynamisch-inhaltlich fein abgestuft. Wunderbar und imponierend!!! Klug bedacht auch von der Regie, dass er den Verräter Melot von sich stößt und stattdessen den treuen Kurwenal umarmt. Dieser wurde von Jukka Rasilainen kurzfristig übernommen. Der weltweit gefeierte Bassbariton sang im ersten Akt einen rabaukig-kernig klingenden Freund und Begleiter Tristans, im dritten Aufzug erschien er dann weicher, fürsorglicher, bevor er wie erwähnt mörderisch zu rasen begann. Perfekt besetzt waren der Melot mit Matthias Stier, der wunderschön das „Frisch weht der Wind“ intonierende Franz Xaver Schlecht als junger Seemann, der Hirt von Martin Petzold und Alvaro Zambrano ließ gegen Ende der Oper mit seinem kurzen Einwurf als Steuermann aufhorchen!
Am Ende dann singt Isolde ihr Mild und leise, wie er lächelt, das Licht erlischt dazu, auch sie tritt nun über die Schwelle des Lichtrahmens, wo Tristan ihrer harrt. Heller schallend singt sie sich rauschhaft in den Liebestod und gemeinsam schreiten die beiden in ein warm orangerot leuchtendes Abendlicht. Kitschig – kann sein, macht aber nichts, denn es ist gerade zusammen mit dieser Musik unglaublich berührend. Man hätte gerne noch etwas in Stille verharrt, doch schnell brandete der begeisterte Applaus des Premierenpublikums auf, der in eine standing ovation mündete. Verdient!
Fazit: Eine Oper, die in dieser Ausführung zutiefst bewegt und musikalisch begeistert! Nicht verpassen!
Kaspar Sannemann 6.10.2019
Bilder siehe oben!
GÖTTERDÄMMERUNG
14.04.2019
TRAILER
Man muss ja nicht alles verstehen...
Oft kündigt ein Scheinwerferkegel auf dem Zwischenvorhang vor Beginn der Vorstellung Unheil an: Eine Indisposition, einen technischen Defekt, eine Absage. Nicht so gestern Abend in Leipzig. Da wurde für einmal vor der Vorstellung eine erfreuliche Nachricht verkündet, nämlich dass der Sänger des Hagen, Sebastian Pilgrim, vor gut zwei Stunden Vater einer Tochter geworden sei und deshalb emotional vielleicht ein wenig mitgenommen wirken könnte. Nun, Herrn Pilgrim kann man nicht nur zu seiner Vaterschaft beglückwünschen sondern auch zu seiner Interpretation des finsteren Bösewichts. Mit profundem, subtil eingesetztem Bass und subtilem, sarkastisch-fiesem Spiel gab er den Hagen. Zurückhaltend, aufmerksam darauf lauernd, ob seine Intrigen auch funktionieren.

Sie tun es - alle tappen sie in seine Fallen, lassen sich von ihm manipulieren. Zuerst natürlich die Gibichungen, Hagens Halbbruder Gunther und seine Schwester Gutrune. Gunther wird in der Inszenierung von Rosamund Gilmore als von einem manischen Sauberkeitsfanatismus geprägter, psychisch angeschlagener und alkoholabhängiger Waschlappen gezeigt. Tuomas Pursio macht das hervorragend, große Schauspielkunst ist das, dazu kommt sein ausdrucksstarker Bariton. Wunderbar. Neben Hagen und Waltraute einer der wenigen Charaktere an diesem Abend, der auch darstellerisch echtes, unverwechselbares Profil erhält. Gutrune wird von Gabriela Scherer mit ebenmäßigem Sopran und sicherer Intonation gesungen. Sie macht das Bestmögliche aus dieser eher undankbaren Rolle, wird von allen herumgeschoben, ja gar von Gunther und Hagen in einer Vitrine wie eine zu verkaufende Ware ausgestellt. Erst nach Siegfrieds Tod erkennt sie die Täuschungen und wird richtiggehend rebellisch. In Hagens Falle tappen aber vor allem auch die Hauptpersonen der GÖTTERDÄMMERUNG, der Wälsungenspross und vermeintlich unbesiegbare Held Siegfried und Wotans Lieblingstochter Brünnhilde. Ian Storey singt den Siegfried mit markantem, beinahe baritonal gefärbtem und leicht belegtem, standhaftem Tenor. Darstellerisch jedoch bleibt er dem Helden alles Erdenkliche schuldig. Er bewegt sich wie ein alter, sehr müde gewordener Mann und nicht wie ein zu neuen Taten aufbrechender Held. Keine Emphase, keine Begeisterung, keine Neugierde.

Immerhin verfügt er über die stimmliche Stamina für die anspruchsvolle Partie, doch kein Vergleich mit Thomas Mohrs umwerfenden Titelhelden am Abend zuvor in SIEGFRIED. Lise Lindstrom, weltweit gefeiert als Brünnhilde, Salome, Elektra, Turandot, Färberin, hat mich mit ihrer Brünnhilde gestern Abend nicht restlos überzeugt. Sicher, sie verfügt über die Kraft für die Partie, doch fehlt ihr das mitreißende Leuchten und Glühen; ihre Stimme schien müde, in der Höhe oft etwas belegt und metallisch, mit ausgeprägtem Vibrato und wackeliger Intonation bei lange gehaltenen Tönen. Sie hatte wahrscheinlich nicht ihren besten Abend. Kann man auch nicht erwarten, dass eine Sängerin immer auf Knopfdruck eine perfekte Leistung abliefert. Von der Erscheinung her wäre sie eine perfekte Brünnhilde, agil, blendend aussehend mit der roten Mähne, Liebende und Rebellische zugleich. Selbst im Schlussgesang Starke Scheite schichtet mir dort stellte sich die erhoffte Gänsehaut nicht ein. Solide – ja, emotional mitreißend –nein. Da war zum Beispiel die Waltraute von Ensemblemitglied Kathrin Göring ein ganz anderes Kaliber. Hier kamen die Emotionen hoch, eine glühende Intensität, das war stimmlich und darstellerisch ein Auftritt der Extraklasse, von Eindringlichkeit kaum zu überbieten und man wunderte sich, dass Brünnhilde Waltrautes Flehen nach Rückgabe des Rings an die Rheintöchter nicht umgehend Folge leistete. Kathrin Göring sang auch noch die zweite Norn in der Anfangsszene des Prologs mit Karin Lovelius als 1. Norn und Olena Tokar als 3. Norn. Ein exzellentes Trio. Wunderbar erfrischend klang auch das andere Damen-Trio, nämlich das der Rheintöchter mit Magdalena Hinterdobler, Sandra Maxheimer und Sandra Fechner. Martin Winkler hatte einen eindringlichen Auftritt als (ebenfalls von Hagen getäuschter) Alberich.

Gnomenhaft und mit fieser Hinterhältigkeit versucht er seinen Sohn Hagen zum Raub des Ringes anzustiften, ohne zu merken, dass Hagens Halbschlaf nur vorgetäuscht ist und dieser in Wahrheit seinen Vater hinters Licht führt. Von Martin Winkler und Sebastian Pilgrim wird die Szene vortrefflich ausgespielt. Wenn man also von der Statik des Siegfried mal absieht, könnte man mit der Personenführung durch Rosamund Gilmore ganz zufrieden sein, wären da nicht wieder die Tänzer, welche als Götter, Bedienstete (mit putzigen Widderhörnchen), Bühnenarbeiter und schwarze Würmer ihr Unwesen in der Gibichungenhalle treiben. Denn ja, die gesamte GÖTTERDÄMMERUNG spielt in diesem Einheitsraum (von Carl Friedrich Oberle), wobei immerhin durch die spannende Lichtregie von Michael Röger einigermaßen abgegrenzte Schauplätze erahnt werden können. Durch ein riesiges Fenster blickt man auf eine Landschaft am Rhein. Die Szenen auf dem Brünnhildenfelsen spielen auf einem Balkon in der Gibichungenhalle. Viel Bühnennebel und einige rätselhaften Requisiten füllen oft diesen Raum. So wird im ersten Akt ein weißer Flügel von den Tänzern im Zeitlupentempo hereingerollt, von dem Siegfried ganz fasziniert ist, auf dem er dann am Ende auch aufgebahrt wird (nachdem er von Hagen erstochen lange auf einem erlegten Sechsender liegen musste). Auf diesen Flügel steigt dann auch Brünnhilde zu ihrem Schlussgesang, während die Tänzer darunter den gesamten Müll der vorangegangenen Abend des RINGS ablagern. Dies stellt meines Erachtens eine inszenatorische Todsünde dar, denn Höhepunkt-Arien oder -Szenen dürfen nicht mit wenig sinnfälligem Agieren im Hintergrund gestört werden, dies stellt einen Affront nicht nur gegenüber der Sängerin, sondern auch gegenüber dem Publikum dar, welches sich gerne auf diesen musikalischen Höhepunkt konzentriert hätte. Erstaunlich, dass der GMD und Intendant der Oper Leipzig, Ulf Schirmer, da nicht ein Veto eingelegt hatte. Am Ende dann versinkt der nun blutrot (oder eben feuerrot) leuchtende Flügel zusammen mit den Göttern und allem Personal in der Tiefe des Bühnenbodens, während schwarze Tücher vom Himmel fallen. Die Rheintöchter behändigen den verfluchten Ring gleich selbst, Hagen will ihn an sich reißen, doch die Rheintöchter stoßen ihn in den Rhein und folgen ihm mit waghalsigen Sprüngen ins Wasser. Nur einer von den mit schwarzen Ganzkörperstrümpfen getarnten Würmer-Tänzern scheint das ganze Weltuntergangs- und Erdenbrandszenario zu überleben.

Hoffnung oder Unheil? Immerhin hier wird ein Interpretationsansatz des Weltendramas Wagners spürbar. Hagens Mannen sind in an SA Sturmtruppen gemahnendes Beige gekleidet. Der Männerchor der Oper Leipzig singt diese Passage mit packender Vehemenz (Einstudierung Thomas Eitler-de Lint). Imposant dabei auch die extra für diese Aufführung angefertigten Stierhörner (haben die Ausmaße von Alphörnern, außer dass sie unten nicht gebogen sind und deshalb waagrecht geblasen werden müssen, dazu sind pro Horn zwei Mann von Nöten!). Imposant aber auch, was aus dem Graben zu hören ist. Das Gewandhausorchester unter Ulf Schirmer evoziert einen Wagnerklang, wie man ihn sich glühender, drängender und dräuender kaum vorstellen kann. Da wird (gerade auch bei Siegfrieds Tod) die akustische Schmerzgrenze zumindest geritzt – macht aber nichts, das fährt gewaltig ein. Daneben aber, wie schon am Abend zuvor, wieder ganz fein ausgearbeitete, transparente, fast kammermusikalische Passagen, die bis ins ppp das Ohr zum genauen Hinhören leiten. Diese GÖTTERDÄMMERUNG mit einer Aufführungsdauer von fünfeinhalb Stunden inklusive zweier Pausen, hat keine Längen oder Durchhänger, erklingt aus dem Graben mit soghafter Faszination und Spannung.
Kaspar Sannemann 16.4.2019
Bilder (c) Tom Schulze
SIEGFRIED
13.04.2019
TRAILER
Vieles ist ungewohnt - z.B. Tänzer als Naturelemente

in diesem Leipziger SIEGFRIED, vieles lässt aber auch aufhorchen, neu entdecken, vermag zu fesseln. Unter dem Aspekt des „Neu Entddeckens“ muss man das Dirigat des GMD und Intendanten der Oper Leipzig, Ulf Schirmer, betrachten. Die von ihm gewählten Tempi überraschen mit einer klugen Disposition von Schnelligkeit und Getragenheit und allem, was dazwischen liegt. Da gibt es Passagen, die fordern von den Sängern (im Siegfried kommen die Sängerinnen erst im dritten Akt) einen fast Rossinisch-übereilten Parlandorhythmus, welcher den Scherzo-Charakter dieses Teils des RINGS betont, dann wieder wird vom exzellent spielenden Gewandhausorchester beinahe epische Breite gefordert. Akzente setzen vor allem die (von meinem Platz aus) dominierenden tiefen Blechbläser, unter die sich aber immer wieder herrlich weich intonierte Streicherphrasen und wunderschön ausgefeilte und filigrane Begleitfiguren mischen. Vor allem die Einleitung zum dritten Akt gelang mit herausragender Intensität. Fulminant und hinreißend musiziert war das, man saß gebannt im Sessel, wurde regelrecht hineingezogen in den Strudel der Leitmotive. Ebenfalls wunderbar klangmalerisch gestaltet war der erste Akt, mit dem Eintauchen in die Unheimlichkeit des Zauberwaldes, oder auch das Waldweben im zweiten Akt.

Von Fesselndem ist von der Protagonistenseite her zu berichten: Thomas Mohr ist ein überragender Siegfried, steht die drei (langen!!!) Akte dieser Gewaltspartie ohne jegliche Ermüdungserscheinungen durch, vollführt die Wandlung vom naiven Kraftprotzknaben des ersten, zum heiß entflammten Liebhaber im dritten Akt mit feurigem, hell und klar fokussiertem Tenor, und vor allem verfügt er über die mühelose Strahlkraft in der Höhe. Tolpatschig, kraftmeierisch und naiv agiert er in seiner unmöglichen Hochwasser-Latzhose (Kostüme: Nicola Reichert) in den ersten beiden Akten, schüchtern und dann immer selbstbewusster staunend im weißen Hemd und der Bügelfaltenhose im dritten Akt. Dan Karlström als Mime ist schlicht und einfach umwerfend. Noch stärker in seinem Spiel (und auch freier im Notentext) als letzten Monat in Genf. Stimmlich wiederum absolut top. Hier in Leipzig darf er den Mime als hinterfotzige „Mutti“ geben, macht Spiegeleier, während Siegfried aus den Trümmern des Schwertes Nothung das neue sagenhafte Schwert schmiedet, schwingt sich aufs Damenfahrrad, wenn er sich auf den Weg zu Fafners Neidhöhle macht, nimmt den vergifteten Sud in der Thermoskanne mit.

Ganz großen Eindruck hiterließ an diesem Abend auch Iain Paterson als Wanderer. Der Beginn relativ eindimensional, doch schon bald, im dritten Teil der Rätselszene, legt er gewaltig an Intensität zu, wenn er von der Götterwelt berichtet oder wenn er im dritten Akt Erda um Rat fragt. Einen smarten Alberich gab es von Tuomas Pursio zu hören, vor allem in der Konfrontation mit seinem Bruder Mime im zweiten Akt verlieh er dem Nibelungen viel Profil. Randall Jakobsh sang eine soliden Fafner, mit der geforderten schwarzen Tiefe. Wunderbar klar und sauber intonierte Bianca Tognocci den Waldvogel off stage). Und dann endlich, im dritten Akt, kommen auch die gewichtigen Frauenstimmen auf die Bühne: Erst die Erda, welche von Nicole Piccolomini mit markant strömender, hoch dramatischer Altstimme gesungen wird. Beeindruckend. Und schließlich last but by far not least: Daniela Köhler als überwältigend stimmstarke Brünnhilde. Eine Brünnhilde, wie sie im Buche steht. Strahlend erregt in der Stimme (und in den Augen!!!) bei der Begrüßung des Sonnenlichts, die „Heil dir“ Rufe erregten geradezu Gänsehaut – und weckten bestimmt einige Zuschauer*innen aus dem Schlaf. Eine berauschende Stimme einer Sängerin von der man hoffentlich in Zukunft noch viel Spannendes hören und sehen wird. Zusammen mit dem wunderbaren Tenor von Thomas Mohr ersangen sich Siegfried und Brünnhilde einen veritablen Triumph. Dieser Zwiegesang am Ende war geradezu gigantisch!

Und doch war es kein ungetrübter Genuss, was nicht an am Sänger und der Sängerin lag, sondern an der Inszenierung von Rosamund Gilmore. Frau Gilmore kommt ursprünglich vom Tanz her und meinte wohl, sie müsse die handlungsarme Oper mit Choreografien aufmotzen. Nun weiss man allerdings, dass Wagner Balletteinlagen in Opern verabscheute und nur widerwillig für Paris das Bacchanale im TANNHÄUSER einfügte. Aber wenn dann hier am Ende um das Liebespaar Siegfried und Brünnhilde gymnastische Übungen oder gar der Versuch einer Apotheose veranstaltet werden, wirkt das nur peinlich. Es begann allerdings schon im ersten Akt, als bei den Rätselszenen hinter Mimes zugemüllter Behausung auf einer grünen Wiese die Ballettänzer wie Würmer aus dem Boden schossen und die Rätsel verdoppelten oder illustrierten oder was auch immer. Ansonsten war die Personenführung in Ordnung, nichts Spektakuläres, aber dank der intelligenten Sänger ganz stimmig umgesetzt. Im zweiten Akt war der Auftritt Fafners bärenstark: Fafner in der Puppe eines gigantischen Bankiers (so aus dem 19. Jahrhundert) auf einem riesigen roten Sofa, um ihn herum wimmelten ein Dutzend Fafner-Bankier Klone. Herrlich, comicartig, sinnig.

Die Bühne von Carl Friedrich Oberle zeigt im ersten Akt drei große Betonelemente mit Öffnungen, im zweiten Akt nur noch zwei, dafür verbunden mit einer Art efeuumrankten Brücke, wie ein Dornröschen-Schloss, im dritten Akt zuerst eine verkohlte Ruine, als sie sich dann für die Schlussszene auf dem Brünnhildenfelsen drehte, vermeinte man die auseinanderbrechende Fassade des Palazzo Vendramin (in dessen Seitenflügel Wagner starb) in Venedig zu erkennen. Aber warum? SIEGFRIED war ja nun nicht gerade Wagners Schwanengesang ... Nun gut, ästhetisch immerhin war es ansprechend, auch dank des wunderbaren Lichts von Michael Röger. Und man muss ja nicht immer alles verstehen...
Kaspar Sannemann 16.4.2019
Bilder (c) Tom Schulze
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Premiere 30. März 2019
Michiel Dijkema inszeniert nach Herrn von Schnabelewopski

Einer Vielzahl der Leipziger Opernfreunde dürfte noch das Debakel der Holländer- Inszenierung im Jahre 2008 des damals 29-jährigen Michael von zur Mühlen im Gedächtnis geblieben sein. Nach den Tumulten in und den verheerenden Reaktionen nach der Premiere am 11. Oktober konnte sich die Leitung des Hauses nur in eine „Rücksetzung der Inszenierung auf den Stand der Generalprobe“ retten, um den Aufwand der Vorbereitungsarbeiten zu rechtfertigen.
Die Diskussionen um eine Verletzung der Urheberrechte erübrigten sich, weil von zur Mühlen seiner vorgestellten Arbeit ohne Absprache zur Premiere verstörende subtile Video-Einblendungen zugefügt hatte. Blieben die „Verletzungen seiner künstlerischen Freiheit“, die aber gegen die Schadensersatzansprüche des Hauses wegen der geplatzten zweiten Aufführung und der Umbesetzung der Titelpartie aufgewogen werden konnten.

Angenehmere Erinnerungen an Leipziger Holländer-Produktionen reichen vor allem auf das Jahr 1964 zurück, als Joachim Herz mit dem Leipziger Ensemble eine gelungene Opern-Verfilmung vorlegte. Damals nahezu revolutionär, hatte sich der Felsenstein-Jünger von Wagners Grundgedanken des Zusammenstoßes von Menschenwelt und Geisterwelt gelöst und seiner Interpretation eine realistische Idee hinterlegt. Senta durfte dem im Nebel verschwindenden Geisterschiff hinterher blicken.
Um Richard Wagners für Leipzig unverzichtbare romantische Oper „Der fliegende Holländer“ wieder würdig im Spielplan implantieren zu können, hatte man den holländischen Regisseur und Bühnenbildner Michiel Dijkema für diese Neuinszenierung gewonnen. Er hat im Hause schon mehrfach gearbeitet und er hatte im Hessischen Staatstheater Wiesbaden 2013 eine hochgelobte Holländer-Inszenierung abgeliefert. Für die Leipziger Oper sollte er nun eine seit 1862 elfte Inszenierung gestalten.
Als potentieller Berichter über Konzert- und Opernaufführungen versuche ich vor dem Besuch der Veranstaltung mein Wissen zu den Hintergründen des zu erwartenden Werkes aufzufrischen und nach Möglichkeit auch zu vertiefen. So war vor der Leipziger Neuinszenierung der Griff in den zweiten Band der Heinrich-Heine-Gesamtausgabe das Naheliegende, denn im Kapitel VII des Romanfragments „Memoiren des Herrn von Schnabelewopski“ findet sich, wenn man von einer erotischen Abweichung absieht, das komplette Vorbild für Wagners Libretto.

Deshalb war ich auch nicht überrascht, als während Ulf Schirmer mit der Gewandhauskapelle die Ouvertüre der Oper intonierte auf der Bühne eine Zitatenreihe aus dem Heine-Fragment auf eine Bildwand projiziert wurde, die sich ausgerechnet auf das erotische Abenteuer des Herrn von Schabelewopski bezogen.
Diese Annäherung an Heines Beschreibung einer Theateraufführung im Amsterdam des Jahres 1831 behielt dann die Regie über den Abend konsequent bei, wenn man von einigen Anleihen an die Erzählungen der Großmuhme des Protagonisten absieht.
Somit war logischerweise für den zum Teil aufwendigen Bühnenaufbau von Michiel Dijkema und die opulenten Kostüme von Jula Reindell der historische Zeitbezug vorgegeben. So spielte der erste Akt auf dem Ufer, an dem nicht nur die Schiffe gestrandet, sondern auch verendete Wale angespült waren. Ein Kunstgriff der Regie hatte eines der Wal-Kadaver zum Schatz-Lager des Holländers gemacht, aufgelockert durch Kupferstiche vom Zuschauerraum eines zeitgenössischen Theaters.
Die konsequente Orientierung an Zeit und Ort ermöglichte auch eine schlüssige Gestaltung des Zweiten Aktes, denn das holländische Leiden war zu dieser Zeit ein Zentrum der europäischen Textilindustrie, so dass Dijkema die Spinnstuben –Szene in eine Werkhalle einer Spinnerei verorten konnte.

Oben rotierten die Spinnrocken und der mit Wolle be- und verarbeitender singender Mädchenchor verhinderte die in anderen Holländer-Inszenierungen oft peinlichen Notlösungen der Montage von Tischlüftern, der Umgestaltung zum Kreißsaal oder der Formierung einer Fußboden-Wischerinnengruppe.
Die bei den meisten Holländer-Inszenierungen gestrichenen Akt-Schlüsse hatte der Regisseur bewusst beibehalten, so dass es nach dem zweiten Akt zu einer Pause kam. Eine eigentlich problematische Entscheidung, die vor allem der Hausgastronomie zu Gute gekommen war. Auch akzeptierte Michiel Dijkema für seine Arbeit die für uns heute schwer vorstellbare Gepflogenheit, dass die Väter im Norwegen der früheren Zeiten die Töchter nach dem Umfang der gebotenen Mitgift dem Höchstbietenden verheirateten und die Mädchen das auch akzeptierten.
Nachdem Senta und der Holländer aus einem gemeinsamen Lager aufgestanden und Erik seinen letzten Versuch, Senta zurück zu gewinnen abgebrochen hatte, schien die Bühnenhandlung mit der vergeblichen Einbeziehung der Holländermannschaft in das Dorfleben abzuflachen. Aus der Verspottung der „untoten Matrosen“ entwickelte sich ob deren Wut eine spontane Bewegung ihres Schiffes. Auf der Bühne erschien das massiv aus Holz und Stahl erbaute Holländerschiff mit seinen blutroten Segeln. Ein Monstrum von 20 Metern Länge, sechs Meter Breite und 12 Metern Höhe schob sich über den Bühnenrand mit seiner Galion-Spitze bis über den Zuschauerbereich der siebten Reihe und schwenkte über die Köpfe der begeisterten Besucher. Blieben nur noch die Zweifel des Holländers an Sentas Treue und ihr Treuebeweis: Senta fuhr in den Himmel und ihre Leiche fand sich auf dem Bühnenboden.
Allerdings ließ die musikalische Ausführung einige Wünsche offen. Die Senta wurde von Christiane Libor mit farbenreicher, forcierter Stimme und einfühlsamen Tongebung gesungen. Besonders mit der Ballade erreicht sie eine phantastische Wirkung, wenn sie von Strophe zu Strophe an Intensität zulegte. Frau Libor war die den Abend bestimmende Sängerin. Auch mit ihrer Darstellung zeigte sie ihre hervorragende Bühnenpräsenz.

Iain Paterson singt mit wohltemperierter etwas nasaler Stimme einen teilweise wohlklingenden Holländer mit guter Ausdrucksweise und Textverständlichkeit. Plastisch gestaltet er den großen Monolog „Die Frist ist um“ und den Beginn des Duetts „Wie aus der Ferne längst vergangener Zeit“.
Einen kernigen überzeugenden Daland mit überzeugenden musikalischen Momenten bringt mit körperbetontem Bass Randall Jakobsh auf die Bühne. Für den satten Mezzosopran der Karin Lovelius als die Vorarbeiterin Mary sind in der Partitur leider nur wenige Möglichkeiten vorgesehen. Von ihr hätten wir gern noch mehr gehört.
Selbstbewusster als in vielen anderen Inszenierungen beeindruckte der Erik, von Ladislav Elgr, der mit furchtlosem Gesang gefiel. Für das Lied des Steuermannes bietet Dan Karlström eine helle lyrische Stimme, aber ohne rechte Wirkung. Damit blieb eigentlich einer der Ohrwürmer der Oper auf der Strecke.
Mit Ulf Schirmer stand ein profilierter Wagner-Dirigent vor den kraftvoll aufspielenden Musikern des Gewandhausorchesters, der weitestgehend auf eine transparente Sängerbegleitung achtete, aber auch die Partitur mit wechselvollen Farben füllte. Eins greift ins andere und beweist, dass es Schirmer gelungen ist, das Orchester der Heimatstadt des Komponisten wieder zu einem sehr guten Wagner-Klangkörper zu erziehen.
Der fabelhafte Chor, die Sängerdarsteller sowie das Gewandhausorchester und vor allem die Ausstattung könnten dafür sorgen, dass die Oper Leipzig mit der seit 1862 elften Inszenierung des „ Fliegenden Holländers“ ein weiteres Zugpferd im Spielplan erhält.
Thomas Thielemann 1.4.2019
Bilder (c) Oper Leipzig
Folgevorstellungen:
22. April; 12., 17., 30. Mai; 10. Juni; 17. Oktober; 2. und 24. November.