THEATER HAGEN


(c) Theater-Hagen.de
Schnupperticket für das Theater Hagen
Am Theater Hagen setzt man das von Bus und Bahn bekannte „9 Euro Ticket“ nun als besondere Aktion bis zum Jahresende 2022 fürs Theater um. Die Sonderaktion berechtigt zum Besuch von fast allen Vorstellungen und Konzerten zum Monatspreis von lediglich 9 Euro. So können nun alle Bürger der Stadt in das sehr sehenswerte Programm des Theaters Hagen reinschnuppern. Ausgenommen von diesem Angebot sind nur der NRW-Slam, Wilfried Schmickler, Guildo Horn – Die Weihnachtsshow, „Morgen, Findus, wird’s was geben" sowie die Schulvorstellungen. Mit dieser außergewöhnlichen Kampagne hofft das Theater Hagen, neue Publikumsschichten zu erreichen, für das facettenreiche Programm begeistern und in den verschiedenen Spielstätten begrüßen zu können.
Gleichzeitig liefert das Theater Hagen auch gleich eine Anleitung wie genau das Ticket funktioniert:
1. 9-Euro-Ticket ab sofort online (www.theaterhagen.de), an der Theaterkasse oder in der Theaterbotschaft (Kampstraße 13) kaufen. Jedes Ticket gilt jeweils einen Monat (Oktober, November oder Dezember), eine automatische Verlängerung gibt es nicht.
2. Freikarte für die gewünschte Veranstaltung vor der jeweiligen Vorstellung an der Abendkasse abholen, alternativ auch bereits 48 Stunden vorher vorbeikommen und sich eine Karte geben lassen. Lieber langfristig planen? Kein Problem! Einfach auf eine Reservierungsliste setzen lassen, 48 Stunden vorher gibt das Theater Hagen Bescheid, falls es ausnahmsweise mal nicht geklappt haben sollte.
3. Theatervorstellungen und Konzerte genießen!
Weitere Informationen und Reservierungen gibt es auch an der Theaterkasse und in der Theaterbotschaft in der Innenstadt zu den üblichen Öffnungszeiten. Auf den Opernfreund warten u. a. Aufführungen von Sour Angelica, Il Trovatore, Die Schöne Helena oder Hänsel und Gretel. Im Bereich des Musicals stehen Aufführungen von Anatevka und Monty Python´s Spamalot auf dem Spielplan. Auch ein Blick in die anderen Sparten sei an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen.
Markus Lamers, 05.10.2022
Richard Wagner
Parsifal
Premiere: 20. März 2022
Selbst für große Häuser bedeutet eine Inszenierung von Wagner „Parsifal“ einen erhöhten Aufwand. Umso erstaunter ist man, dass das kleine Theater in Hagen sich jetzt an das Bühnenweihfestspiel wagt. Vor drei Jahren gab es hier bereits eine radikale Inszenierung von „Tristan und Isolde“, weshalb man gespannt war, wie radikal dieser „Parsifal“ ausfallen würde.
Regisseurin Nilufar Münzing bringt das Stück als Geschichte über Menschen, die in einer durch Konsum und Krieg zerstörten Natur leben, auf die Bühne. Erlösung ist hier die Heilung der zerstörten Umwelt. Dieses an sich schlüssige Konzept wird aber hauptsächlich durch das Bühnenbild von Britta Lammers und die Kostüme von Uta Gruber-Ballehr umgesetzt. In der Personenführung bewegt sich Münzing im traditionellen Rahmen einer „Parsifal“-Aufführung, und man kann sich ihre Regie auch in einer Waldlandschaft, Gralsburg und Zaubergarten vorstellen. Die Bühne von Britta Lammers zeigt aber ein zerstörtes Kaufhaus, wo Gurnemanz mit seiner Büchersammlung unter einer Treppe lebt. Manchmal tauchen Wald- und Naturgeister mit Blätterflügeln oder Geweihen oder Flügeln auf dem Kopf auf, was ein schöner poetischer Einfall ist. Der Gral ist ein Bonsai, der im Schlussbild von Kundry und Amfortas eingepflanzt wird und schon nach wenigen Sekunden als großer blühender Baum erstrahlt.
In der Verwandlungsmusik des ersten Aktes erlebt Parsifal nach Einnahme eines halluzinogenen Tees, wie die Welt durch einen Atomkrieg zerstört wird, wie Kundry Jesus auf dem Weg nach Golgatha verlacht und dann von Amfortas niedergestochen wird. Klingsor ist ein größenwahnsinniger und machthungriger Wissenschaftler, der die Welt zerstört. Zum Vorspiel des 2. Aktes sieht man Videos von Fabriken, überlasteten Straßen und Tagebau. Kundry, die im 1. Akt als Umweltaktivistin auftritt, wird von Klingsor unter Zuhilfenahme von Kokain zum Glamourgirl ausstaffiert. Wer die Blumenmädchen sein sollen, wird nicht richtig klar. Vielleicht Schönheitsköniginnen, Modepüppchen oder lebendig gewordene Schaufensterpuppen? Diese postapokalyptische Welt der Inszenierung erinnert an Calixto Bieitos Stuttgarter Inszenierung von 2010 mit ihrer zerbombten Autobahn. Insgesamt hätte man sich aber gewünscht, dass diese ökologische Thematik noch schlüssiger in die gesamte Produktion eingebunden worden wäre. Es kann aber auch sein, dass viele Szenen nicht vollständig durchgearbeitet wurden, denn Intendant Francis Hüsers berichtet vor der Premiere, dass die Probenarbeit unter einer Vielzahl von Corona-Fällen gelitten hätte.
Musikalisch wird die Aufführung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton zusammengehalten. Er dirigiert flüssige Tempi und benötigt für den ersten Akt 100 Minuten. Obwohl der kleine Hagener Orchestergraben zu einem Überhang der Bläser führt, findet Trafton zu einer guten Klangbalance der Stimmen und findet mit dem Philharmonischen Orchester Hagen zu einem schönen und farbenprächtigen Mischklang. Die orchestralen Höhepunkte werden groß ausgespielt, gleichzeitig sind Trafton und sein Orchester den Sängern zuverlässige Begleiter. Das Theater Hagen trumpft mit einem starken Wagner-Ensemble auf, das zum größten Teil aus den eigenen Reihen besetzt ist. Angela Davis ist eine großartige Kundry. Sie verfügt eine klangvolle und kräftige Stimme, singt die anspruchsvolle Partie ganz unangestrengt und gleichzeitig sehr textverständlich. Von dem Gekreische und Gekeife, das viele berühmtere Interpretinnen in dieser Rolle hören lassen, ist sie meilenweit entfernt. Stimmlich kann sie besonders in der großen Szene mit Parsifal im 2. Akt auftrumpfen. Die Titelpartie verkörpert als Gast Corby Welch, der lange Jahre Mitglied der Düsseldorf-Duisburger Deutschen Oper am Rhein war. Er stellt den lyrischen Gehalt der Partie in den Mittelpunkt und zeigt den Parsifal im ersten Akt vor allem als trotziges Kind. Die Rolle teilt er sich klug ein, sodass er im 2. Akt an den entscheidenden Stellen mit einigen imposanten Tönen aufwarten kann. Sensationell ist der Gurnemanz von Dong-Won Seo. Er verfügt über einen geradezu balsamischen Bass, der über genügend Volumen und Schmelz verfügt, und genau weiß, was er singt. Seine umfangreichen Erzählungen im 1. Akt und den Karfreitagszauber im 3. Akt gestaltet er klug, dass man ihm immer neugierig zuhört. Starke Rollenporträts bieten auch die beiden Baritone: Insu Hwang ist ein markant kraftvoller Amfortas, Jaco Venter singt den Klingsor mit scharf artikulierendem Bariton. Aus dem durchweg gut besetzten Ensemble der kleineren Partien seinen Penny Sofroniadou als 1. Knappe und 2. Blumenmädchen sowie Evelyn Krahe als 2. Knappe, 6. Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe stellvertretend hervorgehoben.
Nach „Tristan und Isolde“ sowie diesem „Parsifal“ darf man gespannt sein, welche Wagner-Oper demnächst in Hagen zu erleben sein wird: Kommen „Die Meistersinger von Nürnberg“ oder vielleicht sogar der ganze „Ring des Nibelungen“. Zutrauen würde man es dem starken Hagener Theater!
Rudolf Hermes, 23.04.22
Bela Bartok:
Blaubarts Burg / Der wunderbare Mandarin
Premiere: 15. Januar 2022
Blaubart im Knast und ein gegenderter Mandarin
Neben Henry Purcells „Dido and Aeneas“ ist Bela Bartoks „Blaubarts Burg“ einer der Opernhits der Corona-Pandemie, schließlich benötigt man für das pausenlose Stück nur zwei Akteure. An Rhein und Ruhr gibt es in dieser Saison gleich vier Produktionen: Essen und Düsseldorf spielen den Einakter als Einzelstück, in Wuppertal wird es mit dem Vorspiel zu „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss gekoppelt. In Hagen steht es im Verbund mit Bartoks „Der wunderbare Mandarin“ auf dem Spielplan. Das ist insofern legitim, als der „Mandarin“ bei seiner Kölner Uraufführung im Jahr 1926 in dieser Kombination gezeigt wurde.

Die Regie von „Blaubarts Burg“ liegt in den Händen des Hagener Intendanten Francis Hüsers. Der macht aus dem Märchenspiel ein Psychodrama: Blaubart sitzt als Frauenmörder in der Einzelzelle und wird von der Psychologin Judith besucht, die ein Gutachten verfassen soll, sich dabei in ihn verliebt, aber schließlich auch distanziert und ihn am Ende alleine im Gefängnis zurücklässt.
Diese Deutung bringt viele Reibungen mit dem Text, jedoch spielen und singen Dorottya Láng und Dong-Won Seo als Blaubart so überzeugend, dass das Konzept aufgeht. Francis Hüsers und sein Ausstatter Alfred Peter finden überzeugende Bilder: Die ersten Türen, die eigentlich in Blaubarts Burg geöffnet werden, sind hier nur Zeichnungen, die er anfertigt und über die Judith einen Einblick in seine Person gewinnt. Später öffnet sich die Zelle, verschwindet sogar, und man sieht projizierte Landschaftsbilder, während sich die beiden Figuren näherkommen.
Dorottya Láng überzeugt mit ihrem klaren Mezzo, der auch viel dramatisches Potenzial enthält. Dong-Won Seo singt die Partie mit warmem und gut gerundeten Bass. Auf seinen Gurnemanz, den er hier ab März in Wagners „Parsifal“ singen wird, darf man gespannt sein.
Die Choreografie von „Der wunderbare Mandarin“ liegt in den Händen von Kevin O´Day. Im Programmheft wird betont, welch ein Skandal diese Geschichte von Zuhältern und Prosituierten, bei der ein Mandarin am Ende getötet wird, dann aber zu neuem Leben erwacht, bei der Uraufführung gewesen sei und dass Bartok aber strikt an diesem Libretto festgehalten hat. Umso erstaunlicher ist, dass O´Day zwar das Milieu beibehält, aus dem einstigen Ballett-Schocker ein durch politische Korrektheit glatt gebügeltes Tanzstück macht, dass gut gelaunt uns sportiv daherkommt.

So werden im Programmheft die Prostituierten als „Sex-Arbeiterinnen“, die Freier zu „Kundinnen“ und die Zuhälter zu „Schlepperinnen“ bezeichnet. Das wirkt als hätte O´Day Angst irgendein Zuhälter könnte sich durch diese Benennung beleidigt fühlen.
Natürlich muss auch in der Besetzung gegendert werden und in jeder drei Gruppen, gibt es Männer und Frauen. Damit sich kein Chinese diskriminiert fühlt, ist der titelgebende „Mandarin“ jetzt nur noch ein Nachtclub, in der mit einem chinesischen Lampion verziert ist. Thomas Mika stellt auf die Hagener Drehbühne große Betonwände, die sowohl die Außenfront des Lokals als auch das großformatige Innere zeigt.
Die Choreografie Kevin O´Days gelingt furios und spannend, da sieht man, dass ein Könner am Werk ist. Bei der Charakterisierung der Figuren stört aber, dass die Schlepper mit ihren Jeans-Hosen, Kapuzenshirts und Baseball-Kappen eher wie eine Hiphop-Gruppe daherkommen und nur in ganz wenigen Momenten als gewalttätig und gefährlich gezeigt werden. Aber hier soll ja niemand diskriminiert werden. Überrascht ist man, dass diese vier Schlepper auch in den Tänzen zwischen Prostituierten und Kunden dauernd ihre Finger mit im Spiel haben und das weitgehend keusche Treiben zu steuern scheinen.
Generalmusikdirektor Joseph Trafton dirigiert „Blaubarts Burg“ sehr sängerfreundlich und farbenreich. „Der wunderbare Mandarin“ wird vom Philharmonischen Orchester Hagen virtuos musiziert und hat oft eine Kraft und Schärfe, die an Strawinskys „Sacre“ erinnert.
Rudolf Hermes, 22.1.2022
Bilder (c) Theater Hagen / Landsberg
Monty Python´s Spamalot
Premiere: 02.10.2021
besuchte Vorstellung: 28.11.2021
Die Suche nach dem Heiligen Gral

Basierend auf dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“ (Originaltitel: Monty Python and the Holy Grail) entstand im Jahre 2005 ein rund 2 1/2stündiges Musical, geschrieben von den Monty Python Mitgliedern Eric Idle und John Du Prez. Aus dem Film „Das Leben des Brian“ wurde zudem der populäre Song „Always Look an the bright side of Life“ entnommen. Der Titel „Spamalot“ sollte hierbei als Verbindung des Wortes Camelot mit einem recht bekannten Spam-Sketch der britischen Komikertruppe dienen. Angelehnt ist die Geschichte sehr frei an der Sage von König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde. Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr 932, König Artus ist erst gerade zum König der Briten gewählt worden und macht sich im Auftrage des Herrn auf die Suche nach dem heiligen Gral. Hierzu wirbt er einige lustige Gesellen an, die er zu seinen Rittern seiner runden, aber wirklich sehr runden Tafelrunde ernennt. Er kämpft sich vorbei am französischen Chateau, weicht mehr oder weniger erfolgreich einer fliegenden Kuh aus, besiegt das gefährliche Killerkaninchen mit Hilfe der „Heiligen Handgranate“ und kämpft sich mit seinem Diener Patsy durch einen großen und sehr, sehr teuren Wald. In Hagen besteht dieser im Übrigen aus einer kleinen rosafarbenen Kunststofftanne vom Weihnachtswühltisch. Am Ende wird dann nicht nur den Gral geborgen, sondern alle Ritter finden auch noch ihre wahre Bestimmung. All dies strotz nur so von Blödeleien in typischer Monty Python Manier, allerdings ist das Musical auch eine wunderbare und augenzwinkernde Parodie auf das Genre Musical als solches.

Das der Vorstellungsbesuch im Hagener Theater sehr unterhaltsam verläuft, ist auch der Inszenierung von Roland Hüve zu verdanken, dem es gelingt, eine eigene Fassung der Geschichte zu finden. Beschränkt man sich auf das reine Nachspielen von bekannten Monty Python Gags aus dem Film, wird Spamalot schnell zum Rohrkrepierer. In Hagen hatte das anwesende Publikum dagegen sichtbar Spaß an diesem herrlich schrägen Musical, da viele Gags durch gutes Timing genau ins Ziel trafen. Die ausgefallenen Kostüme von Lena Brexendorff wirken auf den ersten Blick noch etwas skurril, passen dann aber doch irgendwie gut ins Gesamtbild. Sehr schön ist auch die drehbare Burg als zentrales Bühnenelement, das immer wieder neue Spielräume öffnet und mit einer geschickte Aus- und Beleuchtung punkten kann. Gespielt wird die deutschsprachige Version von Daniel Große Boymann, bei der allerdings die Songs in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln verbleiben. Diese Variante ist sicherlich auch stehts eine Frage des persönlichen Geschmackes, denn mit Ausnahme von „Always look on the Bright Side of Life“ (was fast jeder im Original kennt) sind die deutschen Übersetzungen sehr gelungen. Anderseits kommt man durch die hierzulande seltener gespielten englischen Texte auch mal in den Genuss der Originalreime. „Male“, „Grail“ und „fail“ reimen sich im englischen nun mal sehr gut. Darüber hinaus werden die Übertitel an der ein oder anderen Stelle auch für einige zusätzliche kleine Gags genutzt. So ganz vertraut man den Englischkenntnissen des Publikums aber nicht, da zumindest wenige inhaltsreichere Stücke dann doch in der deutschen Übersetzung erklingen. Bei „Denn kommt es nicht vom Broadway….“ würden in der Originalversion wahrscheinlich zu viele Gags verloren oder zumindest nicht verstanden werden.

Taepyeong Kwak leitet das Philharmonische Orchester Hagen souverän mit Tempo und Präzision durch die Vorstellung. Auch bei der Besetzung kann die Hagener Inszenierung punkten. Rainer Zaun gibt einen überzeugenden König Artus mit einem ulkigem Haarhelm, Carolin Soyka darf dank ihrer Rolle als „Fee aus dem See“ stimmlich glänzen. Alle anderen Darsteller wie Matthias Knaab, John Wesley Zielmann, Alexander von Hugo, Florian Soyka und Richard van Gemert übernehmen mindestens zwei Rollen. In Erinnerung bleibt auch Maurice Daniel Ernst als Historiker, der die Zuschauer gleich zu Beginn in die Geschichte einführt und immer wieder mal mit seinem Rollator über die Bühne „saust“. Gesanglich auf hohem Niveau und mit viel Spielfreunde, haben sich alle Darsteller den langanhaltenden Schlussapplaus redlich verdient. Zu sehen ist diese Produktion im kommenden Jahr noch an drei Terminen im Theater Hagen sowie mit einem Gastspiel im Konzerttheater Coesfeld.
Markus Lamers, 01.12.2021
Fotos: © Björn Hickmann
Paul Abraham
Die Blume von Hawaii
Premiere: 24. Oktober 2020
Besuchte Vorstellung: 22. Oktober 2021
Wenn ein Theater Paul Abrahams Operette „Die Blume von Hawaii“ auf die Bühne bringt, braucht das schon etwas Mut, denn die verworrenen Liebesgeschichten, die vor dem Hintergrund des US-amerikanischen Imperialismus in Hawaii spielen, strotzen nur so vor Klischees, die aber oft gebrochen und hinterfragt werden. Zudem kommt im Song „Bin nur ein Jonny“ das berüchtigte N-Wort vor. Man durfte also gespannt sein, wie das Theater Hagen die Ohrwürm-Operette, die erst 2017 im nahehelegen Dortmunder Opernhaus in einer starken Aufführung gezeigt wurde, auf die Bühne bringt.

Lieder wie „Ein Paradies am Meeresstrand“, „Ich hab ein Diwanpüppchen“, „My Golden Baby“ sind starke Argumente, dieses Stück, das mit seinen gutgelaunten Tanzrhythmen besticht, auf die Bühne zu bringen. Auch in Hagen sorgt Dirigent Taepyeong Kwak dafür, dass die Musik den nötigen Schwung und Swing bekommt. Regisseur Johannes Pölzgutter konzentriert sich vor allem auf die vielen Liebesgeschichten, und streift die politischen Hintergründe nur am Rande: Im Zentrum steht die hawaiianische Prinzessin Laya, die sich in den Kapitän Reginald Stone verliebt, eigentlich aber den Prinzen Lilo-Taro heiraten soll. Der Prinz soll jedoch mit Bessie Worthington, der Nichte des Gouverneur Lloyd Harrison verheiratet werden, um die sich aber auch dessen Sekretär John Buffy bemüht.
Die Vielzahl der Handlungsstränge führt dazu, dass sich einige der Charaktere gar nicht richtig entfalten können. Dabei lässt Regisseur Pölzgutter die Geschichte in flotten und pointierten Dialogen ablaufen. Von Choreograph Sean Stephens hätte man sich noch mehr Einsatz gewünscht. Zwar können einige der Akteure zeigen, dass sie nicht nur toll singen, sondern auch großartig tanzen können, jedoch vermisst man in anderen Liedern eine choreographische Umsetzung. Der Regisseur, der auch für das Bühnenbild verantwortlich ist, kommt mit drei Palmen, einem Mond und einem Sternenhimmel (für die romantischen Szenen) aus. Das hört sich zwar nach wenig an, reicht aber um das Stück in schönen Bildern auf die Bühne zu bringen.

In der Doppelrolle der Prinzessin Laya und der Susanne Provence glänzt Sopranistin Angela Davis. Sie findet nicht nur den richtigen Operettenton für ihre Figur, sondern zeigt auch beachtlichen tänzerischen Einsatz. Richard van Gemert gefällt als Lilo-Taro mit seinem wohlklingenden Tenor, bleibt als Figur jedoch blass. Den Kapitän Reginald Stone singt Kenneth Mattice mit kernigem Bariton, neigt in der Höhe aber zum Knödeln. Die Gouverneurs-Nichte Bessie Worthington wird von Alina Grzeschik zwar schön, aber etwas zu opernhaft und zu brav gesungen. Zudem hätte man sich von dieser kecken Figur mehr tänzerischen Einsatz gewünscht. Mit tollen Steppeinlagen glänzt Alexander von Hugo als John Buffy.
Besonders gespannt war man auf den dritten Akt: Würde Frank Wöhrmann, der mit tollen tänzerischen Einlagen und leichter Stimme in der Rolle des Jim Boy überzeugte, „Bin nur ein Jonny“, vielleicht in einer textlich überarbeiteten Form, anstimmen. - Nein, tat er nicht, denn in Hagen fiel der Song mit dem N-Wort dem Rotstift zum Opfer, weil „die rassistisch konnotierten Stellen gestrichen“ wurden, wie es im Programmheft heißt. Dabei waren die beiden Librettisten selbst Opfer der Nazis: Fritz Löhner-Beda wurde in Auschwitz ermordet, Alfred Grünwald überlebte den Nazi-Terror, weil er in die USA floh.

Dass man „Bin nur ein Jonny“ auch heute noch spielen kann, hat die Dortmunder Inszenierung von Thomas Enzinger aus dem Jahr 2017 bewiesen. Dort wurde die Biografie des jüdischen Komponisten, der vor den Nazis in die USA geflüchtet war und aufgrund einer verschleppten Syphilis in geistiger Umnachtung gestorben war, zum Aufhänger der Produktion. Hier war Komponist Paul Abraham selbst der im Text besungene heimatlose „Nigger“, der für Geld singt.
Mit dieser „Blume von Hawaii“ bietet das Theater Hagen einen gut aufgelegten und unterhaltsamen Operettenabend.
Rudolf Hermes, 25.102021
Bilder (c) Theater Hagen
Albert Lortzing
Zar und Zimmermann
Premiere: 1. Februar 2020
Besuchte Vorstellung: 14. Oktober 2021
Beim Publikum war Albert Lortzing früher einer der beliebtesten Komponisten, doch bei den Intendanten ist die deutsche Biedermeier-Oper, die auch von Komponisten wie Friedrich von Flotow oder Otto Nicolai gepflegt wurde, äußerst unbeliebt und so wurden in den letzten Jahren Lortzings Opern immer seltener gespielt. Im Theater Hagen, das zurzeit weltweit das einzige Theater ist, das „Zar und Zimmermann“ zeigt, hat Regisseur Holger Potocki eine originelle Inszenierung auf die Bühne gebracht, die das Stück als Spionage- und Polit-Thriller erzählt, die Musik aber unangetastet lässt.

Schon in seiner originalen Form ist „Zar und Zimmermann“ eine politische Oper, präsentiert Zar Peter I. als volkstümlichen Herrscher und karikiert den aufgeblasenen Bürgermeister van Bett. Regisseur Holger Potocki hat neue Dialoge geschrieben und die Geschichte aktualisiert. Peter Michailow ist jetzt der uneheliche Sohn des russischen Präsidenten, der inkognito in den Niederlanden in der Rüstungsfabrik von „Brown Industries“ arbeitet. Das von Witwe Brown geleitete Unternehmen verkauft seine Kriegsschiffe und U-Boote in alle Welt, was zum lokalen Wirtschaftaufschwung führt. Das spornt den großspurigen Bürgermeister van Bett an, in Trump-Manier zum niederländischen Ministerpräsidenten aufzusteigen. Die englischen, französischen und russischen Gesandten des Originals werden zu Spionen. Zusätzlich tummelt sich noch die lokale Widerstandsgruppe „Zimmermann“ durch das Stück und versucht die Rüstungsgeschäfte und Politik des Bürgermeisters zu torpedieren.

Was sich hier ungewöhnlich liest, wird vom Regisseur Potocki glaubhaft und mit leichter Hand auf die Bühne gebracht. Obwohl die Geschichte natürlich viel politische Anspielungen auf Machthaber wie Wladimir Putin, Donald Trump oder Kim Jong-un enthält, gelingt Potocki eine leichtfüßige und komödiantische Inszenierung. Das Bühnenbild von Lena Brexendorff bietet zudem gute Spielmöglichkeiten: Mal sehen wir die schick und bunt designte Konzernzentrale von „Brown Industries“, mal befinden wir uns im karg eingerichteten Büro des Bürgermeisters.
Sängerisch präsentiert sich das Hagener Ensemble sehr unterschiedlich. Zentrale Figur dieser Produktion ist Bürgermeister van Bett, der von Markus Jaursch mit trockenem Humor gespielt wird und über einen weichen und wohlklingenden Bass verfügt. Kenneth Mattice als Peter Michailow klingt sehr angestrengt und in der Höhe gepresst. In anderen Partien hat man den Bariton wesentlich überzeugender erlebt. Richard van Gemert als Peter Iwanow verfügt aber über einen selbstbewussten Tenor. Marie-Pierre Roy singt mit schönem lyrischen Sopran die Marie. Als Chateauneuf glänzt Musa Nkuna mit purem Wohlklang und einer eleganten Stimmführung.

Dirigent Rodrigo Tomillo lässt die Ouvertüre noch zu holzschnittartig musizieren, in der Begleitung der Sänger können die Musiker des Philharmonischen Orchesters Hagen aber dann mit beschwingter Heiterkeit aufspielen und zeigen, wie viel lyrischen und spritzige Qualität in Lortzings Musik steckt.
Das Theater Hagen und Regisseur Holger Potocki zeigen mit dieser Aufführung eine gekonnte Aktualisierung von Albert Lortzings scheinbar betulicher Oper. Da bekommt man Lust auf mehr!
Rudolf Hermes, 18-10-21
Bilder (c) Theater Hagen
Benjamin Britten
The Turn oft he Screw
Premiere: 20. Juni 2021
Besuchte Vorstellung: 10. September 2021

Eigentlich sollte Jochen Biganzoli im Frühjahr 2021 in Hagen Peter Eötvös Erfolgsoper „Die drei Schwestern“ inszenieren. Coronabedingt kam die Produktion nicht heraus und stattdessen inszenierte Biganzoli Benjamin Brittens kleinbesetzte „The Turn of the Screw“. Leider erlebte diese Produktion nach der Premiere am 20. Juni nur wenige Vorstellungen und auch in dieser Saison wurde die Wiederaufnahme nur zweimal gespielt, sodass am 10. September bereits die letzte Aufführung über die Bühne ging.
Regisseur Biganzoli gelingt das Kunststück, eine Inszenierung auf die Bühne zu bringen, die sowohl ganz eng am Stück inszeniert verläuft, gleichzeitig aber auch so vieldeutig und anspielungsreich ist, dass sich jeder Zuschauer seine eigene Deutung zurechtlegen kann, was da eigentlich passiert. Die von Wolfgang Gutjahr gestaltete Bühne ist ebenso einfach wie effektvoll: Auf der leeren, ganz in schwarz gehaltenen Bühne stehen die schwarz kostümierten Darsteller (Kostüme: Katharina Weisenborn) oft nur in getrennten Scheinwerferkegeln.

In den Szenen der Kinder wird manchmal die ganze Bühne beleuchtet und man sieht die von oben gefilmte Bühne noch einmal aus der Vogelperspektive auf der Rückwand projiziert.
Sehr effektvoll setzt Gutjahr neun Neonröhren ein, welche mal einen Lichtvorhang bilden, mal über der Bühne hängen, eine schräge Rückwand formen, klaustrophobische Räume formen oder zu einem sich wellenden See werden. Das ist sparsam, aber trotzdem optisch wirkungsvoll. Gleichzeitig rücken in diesen atmosphärisch-abstrakten Räumen die starken Darsteller in den Mittelpunkt. Der für das Licht verantwortliche Hans-Joachim Köster trägt einen großen Anteil daran, dass hier eine spannende und atmosphärische perfekte Inszenierung über die Bühne geht.
In dieser Regie wird die bekannte Geister-Geschichte nicht platt nacherzählt, sondern bietet viele Deutungsmöglichkeiten. Biganzoli lässt es offen, ob die Geister wirklich existieren, oder ob sich die Gouvernante diese nur einbildet. Auch greift Biganzoli die Symmetrie der Figuren auf: Manchmal erscheint die Haushälterin Mrs. Grose wie die positiv-optimistische Seite der Gouvernante, als sei diese eine multiple Persönlichkeit.
Die Geister Peter Quint und Miss Jessel sind wie die erwachsene Version der Kinder Miles und Flora kostümiert. Sind die Kinder die Wiedergeburten der Geister oder sind die Geister die bösen Charaktereigenschaften der Kinder? Trotz Corona-Abständen gelingt es Jochen Biganzoli, eine große Spannung zwischen den Figuren aufzubauen, sodass die Vorstellung wie im Flug vergeht.

Auch musikalisch hat Hagen eine starke Aufführung zu bieten: GMD Joseph Trafton dirigiert eine dichte und farbenreiche Aufführung. Streicher und Holzbläser verschmelzen sehr fein miteinander, Piano, Schlagwerk und Blechbläser könnten noch etwas genauer aufeinander abgestimmt sein.
Sopranistin Angela Davis, die in Hagen regelmäßig positiv auffällt, singt mit warmen und vollen Sopran ein perfekt ausgefeiltes Psychogram. Man darf auf ihre Kundry im nächsten Frühjahr gespannt sein, denn das Hagener Theater wagt sich in der laufenden Saison auch an Wagners „Parsifal“. Dramatische Töne lässt auch Maria Markina als Haushälterin Mrs Grose hören. Als Peter Quint gelingt es Anton Kuzenok seinen lyrischen Tenor schön zur Geltung zu bringen und gleichzeitig eine unterschwellige Bedrohung auszudrücken. Eher von der zarten Seite legt Penny Sofroniadou die Miss Jessel an. Großartig sind Benjamin Overbeck und Melissa Droste von der Chorakademie Dortmund als Miles und Flora. In anderen Produktionen erlebt man oft jugendliche Darsteller, die nur gehauchte Töne singen. In Hagen stehen jedoch zwei junge Interpreten auf der Bühne, die vorzügliche Stimmen besitzen und die Rollen auch glaubhaft verkörpern.
Rudolf Hermes 15.9.2021
Bilder (c) Theater Hagen
Joseph Haydn: L´ISOLA DISABITATA
Garvin Bryars: MARILYN FOREVER
Premiere: 12. September 2020
Besuchte Vorstellung: 15. Juni 2021
Auf den ersten Blick passen diese beiden Opern nicht zueinander: Was haben Joseph Haydns „La Isola disabitata“ von 1779 und Garvin Bryars „Marilyn Forever“ von 2013 miteinander zu tun? Hauptgrund dürfte die einfache Realisierung in Corona-Zeiten sein: Beide Stücke dauern ungefähr 70 Minuten, sind von einem Kammerorchester mit gut 12 Musikern spielbar und benötigen nur ein kleines Personal.
In der Haydn-Oper erleiden Costanza und ihre jüngere Schwester Silvia Schiffbruch auf einer einsamen Insel. Nach 13 Jahren in der Sklaverei kehrt Costanzas Mann Gernando mit seinem Freund Enrico auf die Insel zurück, findet seine Frau wieder, und auch Silvia und Enrico werden ein Paar.

Regisseurin Magdalena Fuchsberger versucht eine psychologische Deutung der Geschichte: Ausstatterin Monika Biegler lässt die Oper nicht auf einer malerischen Insel, sondern im Wohnzimmer des Ehepaares spielen. Der Schiffbruch, die Einsamkeit sind in Fuchsbergers Sichtweise nur Metaphern für die Entfremdung des Paares.
Was sich als Idee und Konzept spannend anhört, wird aber nicht schlüssig auf die Bühne gebracht: Ehemann Enrico kommt nämlich mit einem Rucksack über die Bühne angekrochen, als würde er tastsächlich durch das Unterholz robben. Freund Gernando taucht aus einer Falltür mit viel Bühnennebel auf, so dass man sich fragt, ob er nicht nur ein Wunschtraum Silvias ist? Das Hauptproblem der Regie, dass sie nicht klar trennen kann, ob das Wohnzimmer Realität und die Insel nur die Metapher ist? Oder ob es nicht genau anders herum ist?

Maria Markina ist mit großem Mezzosopran, der auch dramatische Töne besitzt, eine zerrissene Costanza. Mit viel Sopranglanz singt Penny Sofroniadou ihre Schwester Silvia. Über tenoralem Schmelz verfügt Anton Kuzenok als Enrico. Mit kernig-selbstbewusstem Bariton trumpft Insu Hwang als Enrico auf.
Das zweite Stück des Abends, „Marilyn forever“, zeigt eigentlich die Probe einer Schauspielerin, die sich gemeinsam mit einem Regisseur versucht der Figur der Marilyn Monroe anzunähern. Die Dramaturgie ist sprunghaft und traumartig. Vieles wird inhaltlich nur angedeutet.
Diese Oper ist von sich aus schon eine distanzierte und gebrochene Annäherung an die Film-Ikone. In Hagen versucht Regisseur Holger Potocki noch zusätzliche Distanz aufzubauen. Gemeinsam mit Bühnenbildner Bernhard Niechotz hat er die Bühne zweigeteilt, sodass die Schauspielerin und der Regisseur getrennt agieren. Potocki will so die Geschichte einer Schauspielerin, die in die Rolle der Marilyn schlüpfen will und die eines Regisseurs, der einen Film drehen möchte, gleichzeitig aber der Faszination der Figur verfällt, als zwei unabhängige Stücke erzählen.

Eigentlich ist diese Erschaffung zwei getrennter Geschichten aber überflüssig, da beide Figuren trotz der räumlichen Distanz textlich und szenisch interagieren. Angela Davis und Kenneth Mattice singen ihre Partien mit geschmeidigen Stimmen, überzeugen sowohl im melancholisch-tonalem Parlando als auch in den jazzigen Songs.
Das Philharmonische Orchester Hagen unter Generalmusikdirektor Joseph Trafton zeigt in beiden Stücken seine klangliche Wandlungsfähigkeit und Stilsicherheit: Die Haydn-Oper klingt beschwingt und leichtfüßig, während „Marilyn forever“ mit einem vibrierenden Klang zwischen Minimalismus und Jazz gespielt wird.
Insgesamt bietet diese Vorstellung eine spannende Begegnung mit zwei selten gespielten Werken. Jedoch wird man dabei mit Inszenierungen konfrontiert, welche beide Stücke um die Ecke herum denken.
Rudolf Hermes
Fotos von Klaus Lefebvre (Rechte Theater Hagen)
Theater Hagen macht „Couch Theater“
Im November hat sich der Kollege Jochen Rüth im kleinen aber feinen Theater Hagen die Oper „Cardillac“ von Paul Hindemith noch live anschauen können. Seinen Bericht finden Sie, liebe Opernfreunde, weiter untern auf dieser Seite. Im Rahmen des durch die Corona-Schießung ins Leben gerufenen „Couch-Theater“ ist in dieser Woche die Generalprobe der Inszenierung von Jochen Biganzoli online auf der Homepage und dem YouTube-Kanal des Theaters zu sehen. Abrufbar ist das Video vom 25. April bis zum 02. Mai 2020. Vor der rund 90minütigen Oper gibt der Intendant des Hauses Francis Hüsers noch eine rund 15minütige Einführung in das Werk und die Inszenierung. Auch wenn selbstverständlich keine Aufzeichnung das Gefühl eines echten Theaterbesuches ersetzen kann, ist das Konzept des Theaters Hagen ebenso bemerkenswert wie vorbildlich und lohnt einen Blick auf das Angebot des „Couch-Theater“ unter https://www.theaterhagen.de/.
Markus Lamers, 26.04.2020
Gluck
ORPHEUS UND EURYDIKE
Premiere 29.2.2020
Am 29. Februar konnten die Mitglieder des Theater Hagen wieder einmal eine Premiere auf die Bühne bringen, auf die sie stolz sein können. Glucks Orfeo ed Euridice gilt als erste „Reformoper“. Entsprechend minimalistisch kommt das Werk ohne Prunk und Schnörkel aus.
 In der Handlung geht es um das junge Paar Orpheus und Eurydike, sie stirbt, er trauert so sehr, daß er mit seinen Liedern die Götter erweichen kann, seine Geliebte aus dem Totenreich zurück zu holen. Bedingung ist, er darf sich die ganze Zeit nicht nach ihr umdrehen, er darf ihr nicht den Grund für seine Handlungsweise erklären. Sie zweifelt aufgrund dessen an seiner echten Liebe und will nicht mit ihm zurück zu den Lebenden kommen. Daraufhin dreht er sich in tiefster Verzweiflung dennoch um und Eurydike stirbt ein zweites Mal. Orpheus will daraufhin ebenfalls sterben, er sieht keinen Sinn in einem Leben ohne sie. Aber Amor hat Mitleid, erkennt Orpheus aufrichtige Liebe und erweckt die junge Frau erneut zum Leben. Happy End.
In der Handlung geht es um das junge Paar Orpheus und Eurydike, sie stirbt, er trauert so sehr, daß er mit seinen Liedern die Götter erweichen kann, seine Geliebte aus dem Totenreich zurück zu holen. Bedingung ist, er darf sich die ganze Zeit nicht nach ihr umdrehen, er darf ihr nicht den Grund für seine Handlungsweise erklären. Sie zweifelt aufgrund dessen an seiner echten Liebe und will nicht mit ihm zurück zu den Lebenden kommen. Daraufhin dreht er sich in tiefster Verzweiflung dennoch um und Eurydike stirbt ein zweites Mal. Orpheus will daraufhin ebenfalls sterben, er sieht keinen Sinn in einem Leben ohne sie. Aber Amor hat Mitleid, erkennt Orpheus aufrichtige Liebe und erweckt die junge Frau erneut zum Leben. Happy End.
Kerstin Steeb, die zum ersten Mal in Hagen Regie führt, legt das Stück ein wenig anders aus. Bei ihr ist Eurydike eine Frau, die aufgrund einer Erkrankung selbstbestimmt in den Tod geht, Orpheus ist dabei anwesend und man sieht seinen Kampf mit der Verzweiflung seine Frau gehen lassen zu müssen. Mehrmals unterbricht er den Prozeß, indem er ein Kabel trennt und dann doch wieder zusammen fügt, bis am Schluß dieser Phase sie selbst ein letztes Mal das Kabel verbindet. Diese Handlung findet bereits vor Beginn der eigentlichen Oper vor dem geschlossenen Vorhang statt, die Türen zum Zuschauerraum sind noch geöffnet und der Saal ist noch hell. Immer wieder spricht sie in ein Mikrofon die Sätze, „nicht die Kontrolle verlieren“ und „das ist mein Anfang, das ist mein Ende“. Das Mikro als Verdeutlichung der Sterbehilfe, sie selbst entscheidet, wann sie geht und damit beginnt die eigentliche Oper, Eurydike geht allein hinein ins Reich der Toten und übergibt ihren Körper den Schatten. Am Schluß wird sich Orfeo hier, obwohl er seine Euridice erneut zurück bekommt, mit dem Alleinsein abfinden müssen, denn sie entscheidet sich dafür, zurück zu den Schatten zu gehen.

So gibt es bei ihr nicht die Geschlechternorm männlich/weiblich. Ihre Figuren sind allesamt genderneutral. Sowohl die Solopartien, als auch Chor und Ballett sind uniform und unisex gekleidet, umgesetzt von Lorena Díaz Stephens und Jan Hendrik Neidert, denen es gelungen ist, eine schwarz-weiße Kostümpracht zu entwerfen, die perfekt mit dem Bühnenbild harmoniert, welches einen Tunnel mit einem hellen Licht am Ende zeigt. Dies soll die Erfahrung mit dem Nahtod darstellen. Anspruchsvoller Minimalismus auf hohem Niveau. Die einzige Ausnahme stellt Amor/e dar. Amor ist kein Gott, sondern eine Frau aus dem Publikum, Amor/e ist die Liebe und die Liebe ist hier weiblich, nicht enden wollend, mit ein bißchen kitschigem Glitzerstaub und süß wie ein Bonbon. Deutlich gemacht durch einen Babybauch, einen Bleistiftrock und einen pinken Pullover, der einzige Farbklecks des Abends.

Für die Rolle des Orfeo konnte die Oper Hagen die junge Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli verpflichten, die zur Zeit an der Accademia Teatro alla Scala in Mailand engagiert ist. Sie sang die Partie mit einer Ausdrucksstärke und Empathie, welches die Zuschauer die Trauer und das Leid um den Verlust des geliebten Menschen mitleiden ließ. Wohl kaum einen ließ das „Che farò senza Euridice…“ kalt.
Angela Davis, die als festes Ensemblemitglied immer wieder mit ihrer kraftvollen, virtuosen Stimme in vielen Rollen begeistert, war als Eurydike eine Glanzbesetzung, auch hier gilt, das konnte niemanden unberührt lassen.
Christina Piccardi als Amore, sang und spielte die kleine Rolle mit Komik und sorgte mehrfach für Geschmunzel im Saal.
Der Chor (Leitung Wolfgang Müller-Sadow) hatte am heutigen Abend nicht nur gesanglich, sondern auch choreografisch einiges zu leisten und zu bieten, was auch in gewohnter Weise hervorragend gelang. Es blieben keine Erwartungen unerfüllt. Aus dem Ballettensemble wirken bei jeder Vorstellung acht Tänzer*innen mit. Die Choreografie wurde von Mitgliedern der Compagnie und dem Trainingsmeister Francesco Vecchione gemeinsam erarbeitet. Eine kraftvolle, moderne, tänzerische Darbietung. Chor und Ballett verschmolzen zu einer Gruppe, deren Sogwirkung man sich nicht entziehen konnte. Sie verkörpern die Trauergemeinde, die Götter, die Furien.

Auch das Philharmonische Orchester Hagen unter dem Dirigat von Steffen Müller-Gabriel ließ keine Wünsche offen. Unter seiner Führung war die Musik in ihren vielen Varianten ein zusätzlicher Genuß.
Glucks Oper ist eine Perle der Opernkultur und diese Perle hat am heutigen Abend ihren vollen Glanz entfalten dürfen. Die Hagener zeigen wieder einmal, auch kleinere Häuser machen großartige Kunst. Nachdem der letzte Ton verklungen war durften sich die Künstler auf der Bühne mehr als verdient in einem Applaus baden, der mehr als 10 Minuten andauerte und diverse Vorhänge erforderte.
Fotos @ Klaus Lefebvre
Rene-Isaak Laube, 6.3.2020
Besonderer Dank an unsere Freunde vom, OPERNMAGAZIN
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN
Premiere am 30.11.2019
Der Intendant des Hauses, Francis Hüsers, hatte sich das Highlight der Spielzeit 2019/20 im Theater Hagen selbst vorbehalten, die Neuproduktion von Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ aus Anlass des 200jährigen Geburtstags des Komponisten, dem in seiner Geburtsstadt Köln aufgrund des Jubiläums in diesem Jahr schon etliche Kränze geflochten wurden, nicht zuletzt mit der Aufführung und Wiederentdeckung der Oper „Barkouf oder ein Hund an der Macht“. Man durfte gespannt sein, welche Sicht Francis Hüsers auf Offenbachs bekannteste opera comique finden würde, die bei Offenbachs Tod unvollendet nur in einer Klavierfassung vorlag und deren beispiellosen Siegeszug nach der Uraufführung in Paris 1881 Offenbach nicht mehr selbst erleben konnte.
Das Libretto von Jules Barbier fußt auf einem von Jules Barbier und Michel Carré verfassten und 1851 uraufgeführten Stück, das auf verschiedenen Erzählungen E.T.A. Hoffmanns basiert, wie auf Der Sandmann, Rat Krespel oder die Abenteuer der Silvester-Nacht. In der Oper erzählt Hoffmann, in der traditionellen Deutung dieser Figur Inbegriff und gleichzeitig Klischee des romantischen, mit dem bürgerlichen Leben unversöhnlich entzweiten Künstlers, diese Geschichten selbst, in denen er seinen tragischen Liebesabenteuern mit der Puppe Olympia, der Sängerin Antonia und der Kurtisane Giulietta und der daraus erwachsenden Frage nachgeht, welche Bedeutung Sex, Erotik und Liebe in seinem Künstlerdasein
spielen.

Auf die unterschiedlichen Versuche, Offenbachs Kompositionsskizzen zu orchestrieren und zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk zusammenzufügen, kann hier nicht näher eingegangen werden. In Hagen spielt man die Fassung von 1907 (Choudens-Guirod), die auf Dialoge zugunsten von durchkomponierten Rezitativen verzichtet, den Giulietta-Akt wieder als 4. Akt einfügt und die Oper mit dem Epilog in Luthers Weinkeller enden lässt. Der Entstehungszeit dieser Fassung ist nun auch der Regieansatz von Francis Hüser verpflichtet. Die Handlung in Thomas Manns großem Zeitroman „Der Zauberberg“ setzt im Jahr 1907 ein, als die Titelfigur Hans Castorp nach Davos ins Lungensanatorium reist. Castorp erliegt der Faszination des Todes, begreift das Sanatorium als eine Art höllisches Paradies und gibt sich in einer Schlüsselszene des Romans dem Alkohol hin, als er der geheimnisvollen Madame Chauchat seine Liebe gesteht. Krankheit und Tod erscheinen im Zauberberg als notwendiger Durchgang zum Leben. Wer will, mag hier einige Ähnlichkeiten zwischen Hoffmann und Hans Castorp finden, schlüssig erscheint dieser Ansatz nicht. Da hilft es auch nicht, dass Motive und Accessoires aus dem Roman als Zitate aus dem Zauberberg in der Inszenierung auftauchen: das Grammophon, der Bleistift von Madame Chauchat oder der Tisch, an dem Hans Castorp einer spiritistischen Sitzung beiwohnt.
In der Inszenierung Hüsers findet eine solche Séance im Antoniaakt zwischen den drei Frauenfiguren statt, die Olympia, Nicola (Nicklause) und Giulietta verkörpern. Immerhin passt dies vom Motiv her, da Antonia in dieser Szene die Stimme ihrer toten Mutter heraufbeschwört. Insgesamt bleiben die Bezüge zum Zauberberg aber eher blinde Motive. Auch ein weiterer Regieeinfall überzeugt wenig. Olympia, Antonia, Giulietta und auch die in Nicola umgetaufte Muse des Librettos sind Freundinnen des hier und jetzt, die mit Hilfe ihres Freundes Lindorf eine Zeitreise in das Jahr 1907 unternehmen, um den Schriftsteller Hoffmann zu verführen. Zu Beginn sieht man alle vier an einem Tisch am Bühnenrand sitzen. Ihre Kleidung (Kostüme: Katharina Weissenborn) weisen schon auf ihre Rollen hin: so trägt Giulietta aufreizende Lackstiefel, dazu eine knallrote Jacke samt kesser schwarzer Schirmmütze, während z.B. Olympia ein eher braves, türkisfarbenes Kleid schmückt. Während der Akte sind die Freundinnen als Beobachterinnen immer anwesend und ermuntern sich auch hier und da gegenseitig, in ihrer Rolle zu bleiben. Natürlich sind sie nur für Hoffmann sichtbar, der in den halluzinierten Frauengestalten immer wieder Wesenszüge seiner Geliebten, der Sängerin Stella, beschwört. Hüser verspricht sich von diesem Regieeinfall „eine Konzeption…, die mit zwei Realitäten spielt. Die eine Realitätsebene ist eine heutige, die andere eine Welt aus dem Jahr 1907 … und man fragt sich: Wer beeinflusst hier eigentlich wen? Wer inszeniert wen?“ (Programmheft, S. 12 ff.).

Dieses intendierte Spiel mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen spielt aber in der Inszenierung in Wahrheit nur eine nebensächliche Rolle. Die allseits bekannte Handlung der Oper wird ohne Brechungen und Subtexte geradlinig nacherzählt. Das Einheitsbühnenbild von Alfred Peter zeigt zu Beginn einen eher schmuck- und farblosen Gaststättenraum zu Beginn des 20 Jahrhunderts mit einem gläsernen, apsiden Abschluss, der im Antoniaakt Ort der Séance ist, als Projektionsfläche für das Erscheinungsbild der toten Mutter dient und sich im Venedigakt zu einem Sternenhimmel öffnet. Mit nur wenigen Handgriffen werden so aus der Weinschänke ein Ballsaal (Olympiakt), das Sterbezimmer der Antonia oder eben ein angedeuteter Venedigschauplatz. Die farblich gedeckten Kostüme (z.B. Herren mit Stehkragen), Mobiliar und Accessoires verorten die Handlung in den Beginn des 20. Jahrhunderts, eine große School Clock, deren Zeiger sich vor- und zurückbewegen, soll wohl die unterschiedlichen Zeitebenen symbolisieren.
Personenführung und Choreografie (Eric Rentmeister) gelingen durchaus spannende und eindrucksvolle Momente, wenn z.B. im Olympiaakt die Ballbesucher lauernd um die Puppe herumschleichen und damit schon das desaströse Scheitern Hoffmanns in seiner Liebe zu einem seelenlosen Automaten vorausdeuten, oder wenn es der Olympiadarstellerin immer mehr gelingt, ihre Rolle als Puppe durch entsprechende Bewegungen auszufüllen. Andererseits erlebt man an diesem Abend aber auch leider viel Stehtheater. Immer wieder postieren sich die Figuren an der Rampe und singen ins Publikum, anstatt in Interaktion mit den anderen Personen zu treten. Das mag sängerfreundlich sein, wirkt aber doch eher
statisch.

Musikalisch kann dieser „Hoffman“ im Theater Hagen durchaus überzeugen. Das liegt vor allem an dem vorzüglichen Sängerensemble, aus dem der österreichische Tenor Thomas Paul in der Titelpartie herausragt. Er bleibt der Partie an tenoralem Glanz, an Stimmschönheit und Phrasierungskunst nichts schuldig und empfiehlt sich mit dieser Leistung als Hoffmann auch für große Häuser. Seine Auftrittsarie , die „Ballade von Klein Zack“, sang er mit expressiver Dramatik, aber auch wunderbar differenziert und mit lyrischer Intensität. Angela Davis als Antonia verfügt über einen dramatischen, in den tiefen und mittleren Lagen äußerst klangschönen Sopran. Ein paar eher scharfe und forcierte Spitzentöne fallen da kaum wertmindernd ins Gewicht. Christina Picardi brillierte mit gestochenen Koloraturen als Olympia, die vielgefragte Netta Or verlieh der Guilietta stimmlich und schauspielerisch die nötige Leidenschaftlichkeit und Expressivität. Auch Maria Markina als Muse/ Nicklausse/Nicola gefiel durch ihren warmen, in der Höhe aufblühenden Mezzo.
Dong-Won Seo verkörperte die bösen Männer mit nie nachlassender Bass-Bariton-Gewalt und konnte auch schauspielerisch dämonische Akzente setzen. Ivo Stánchev als Luther/Crespel, Richard van Germert in der karikierend-komischen Rolle als Franz, Marilyn Bennett als Stimme der Mutter, Kenneth Mattice als Herrmann/Schlemihl sowie Matthew Overmeyer als Nathanael und Boris Leisenheimer als Spalanzanai trugen mit gelungenen Rollenportraits zum musikalischen Erfolg dieses Abends bei.
Chor und Extrachor des Theaters Hagen (Wolfgang Müller-Salow) sowie das Philharmonische Orchester Hagen unter der Leitung von Joseph Trafton agierten mit großem Einsatz und großer Spielfreude. Die Hagener Philharmoniker klangen in der Charakterisierung der karikierend-komischen und expressiv-tragischen Elemente in Offenbachs herrlicher Musik immer dann am schönsten, wenn sie sich ganz in den Dienst einer eher verhaltenen und leisen Begleitung der Sängerinnen und Sänger stellten.
Das Publikum im leider nicht ganz ausverkauften Haus feierte alle Beteiligten mit lang anhaltendem, herzlichem Beifall. Und das völlig zu Recht!
Norbert Pabelick, 02.12.2019
Biolder (c) Theater Hagen
Weitere Aufführungen: 6.12./20.12./26.12.2019
CARDILLAC
Ode an das Manifest
Premiere: 21.09.2019
besuchte Vorstellung: 10.11.2019
Lieber Opernfreund-Freund,
Paul Hindemiths erste abendfüllende Oper Cardillac ist derzeit am Theater Hagen zu erleben. Das höchst expressionistische Werk beeindruckt mit seiner Klangfülle, die Sängerriege vollbringt schier Unmögliches – doch die Inszenierung von Jochen Biganzoli beschäftigt sich kaum mit der Geschichte, die auf der Novelle Das Fräulein von Scuderi von E.T.A. Hoffman beruht, sondern verliert sich in einer Flut von Manifestationen und gerät so zum Selbstzweck.

Das Fräulein von Scuderi von E.T.A. Hoffmann ist gerne und oft Schullektüre und vielleicht ist es auch Ihnen, lieber Opernfreund-Freund, als Pennäler einmal begegnet. Doch will ich zumindest den Teil der Handlung, der in Paul Hindemiths Cardillac Verwendung findet, kurz umreißen: Im Paris der 1680er Jahre treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der des nachts Kunden auflauert, die kurz zuvor beim angesehenen Goldschmied Cardiallac Schmuck erworben hatten, diese umbringt und das Schmuckstück raubt. Keiner ahnt, dass Cardillac selbst der Täter ist, da er sich nicht von den von ihm geschaffenen Stücken trennen kann. Als ein Offizier, der um seine Tochter wirbt, eine Kette bei ihm erwirbt, überfällt ihr auch diesen und verwundet ihn. Ein Goldhändler hat den Vorfall beobachtet und bezichtigt Cardillac des Verbrechens. Der Offizier behauptet jedoch, vom Goldhändler überfallen worden zu sein, offenbart aber Cardillacs Tochter den wahren Täter. Die sagt sich von ihrem Vater los und der gesteht im Wahn der ihn eigentlich feiernden Menge, dass er selbst der Mörder ist. Der aufgebrachte Mob erschlägt ihn daraufhin.

„Die Musik hat mit der Romantik des Stoffes, mit der Gefühlswärme und so weiter, so gut wie nichts zu tun.“ schrieben Zeitungen nach der Dresdner Uraufführung 1926 und ähnliches könnte man von der Hagener Inszenierung behaupten. Sicher geht es in Cardillac auch um den Trennungsschmerz, den ein Künstler von seinem Werk empfindet – Jochen Biganzoli reduziert allerdings seine gesamte Inszenierung auf diese thematische Verbindung und nutzt die Produktion, um sich grundsätzlich mit der Frage, welchen Wert Kunst hat, ob Kunst Ware sein darf und was Kunst überhaupt sein muss, zu beschäftigen. Dazu lässt er auf der leeren Bühne von Wolf Gutjahr die rundum angebrachten Prospekte mit allerhand Text anstrahlen. Mal handelt es sich um kurze Statements wie „Art must be beautiful“, mal sind es Auszüge aus einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dann wieder darf das Publikum minutenlang Auszüge aus E.T.A. Hoffmanns Novelle mitlesen. Sicher ist die Frage nach dem Wert der Kunst heute diskussionswürdiger denn je, die bloße Aneinanderreihung von plakativen Aussagen und Forderungen allerdings verkopfen Hindemiths Werk über Gebühr. Die schroffe, energiegeladene Musiksprache des Komponisten spiegeln aus Hoffmans Erzählung vor allem die Gefühlswelt der Titelfigur wider – außer Cardillac trägt keine der übrigen Figuren überhaupt einen Namen – und mit der beschäftigt sich Biganzoli inhaltlich so gut wie gar nicht, sondern verliert sich in Konsum- und Kulturpolitikkritik. So formuliert die letzte Projektion „Wozu Kunst“, die nach de Apotheose der Titelfigur, als die Jochen Biganzoli den abschließenden Mord inszeniert, in großen Lettern erscheint, genau die Frage, die sich mir am Ende der Aufführung stellt.
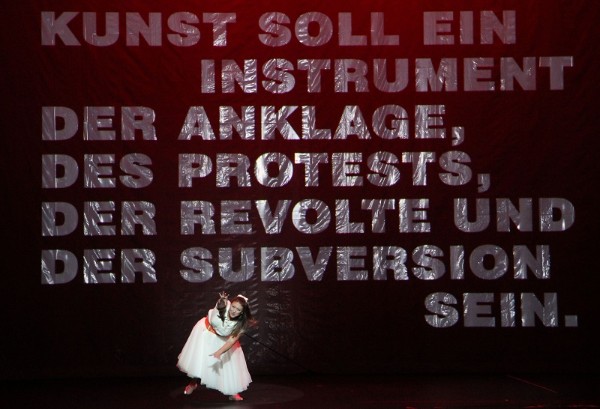
Fast könnte es Teil der Inszenierung sein, dass ein Theatersprecher vor der Vorstellung vor den Vorhang tritt und erzählt, dass aufgrund der Sparzwänge, die man dem Theater Hagen auferlegt hat, verstärkt mit externen Musikern gearbeitet werden müsse und dass just der engagierte Tubaspieler das Theater nicht rechtzeitig erreichen könnte, weshalb am gestrigen Nachmittag das Werk ohne Tuba aufgeführt werde. Doch tut das dem musikalisch hervorragenden Gesamteindruck keinen Abbruch, führt doch GMD Joseph Trafton versiert durch die klanggewaltige, teils spröde, höchst spannende und keine Sekunde langweilige Partitur. Zwar muss in der Mitte des Werkes, das in Hagen in der 1926er Urfassung erklingt (Hindemith hatte es 1952 nochmals in eine vieraktige Fassung gegossen), eine Passage wiederholt werden, doch ist das angesichts der hohen Komplexität entschuldbar und dürfte dem Großteil des zahlreich erschienenen Publikums ohnehin nicht aufgefallen sein. Das düster instrumentierte Werk – in den Streichern beispielsweise stehen sechs Violinen jeweils vier Bratschen, Celli und Kontrabässe gegenüber – gerät unter Traftons Leitung zur vollen Entfaltung und man wundert sich, dass diese vor Energie schier überquellende Oper so selten auf den Spielplänen der Theater steht.

Auf der Bühne wird bis in die kleinste Rolle hinein Hochkarätiges geboten: Kenneth Mattice wird als stimmlich forscher Führer der Prévôté hinter der Bühne abgefilmt und auf die Leinwand projiziert, Veronika Haller gibt die Dame, die Biganzoli als durch und durch selbstverliebt inszeniert und Katharina Weissenborn in einen goldenen Glitzeranzug hüllt, zu Beginn kokett und stattet sie am Ende des ersten Aktes mit dunklen, gehaltvollen Farben aus. Ihr Kavalier findet in Thomas Paul eine Idealbesetzung, die mit so kraft- wie eindrucksvoller Höhe die kurze Partie perfekt ausfüllt. Die imposante Power des Basses von Ivo Stánchev, der als Goldhändler auftritt, drückt einen förmlich in den Sessel, während Thomas Beraus Cardillac fast ein wenig zu verhalten wirkt. Dem aus Ingolstadt stammende Bariton gelingt darstellerisch eine überzeugende Charakterstudie, doch stimmlich fehlt mir das Wahnhafte, das Dunkle, das der Titelfigur zu eigen ist und das sich auch in Hindemiths Partitur durchgängig zeigt. So bleibt der Eindruck Beraus hinter dem seiner Bühnentochter und deren Galan zurück. Die junge Sopranistin Angela Davis gibt Cardillacs Tochter facettenreich, bietet vom zarten Pianissimo bis zum satten Klang eines dramatischen Soprans die volle Farbpalette und macht so den Zwiespalt der Figur zwischen Liebe zum Vater und zum geliebten Offizier glaubhaft. Die Regie zeigt sie intelligent als Geschöpf Cardillacs, von dem er sich – wie von seinen Schmuckstücken – ebenfalls nicht trennen kann. Restlos begeistert bin ich auch von der klanglichen Wucht, der endlosen Kraft und der strahlenden Höhe, die Milen Bozhkov als Offizier mitbringt. Eindrucksvoll gestaltet er die höchst anspruchsvolle Partie so, wie man es besser kaum machen kann. Ebenfalls ohne Fehl und Tadel agiert der von Wolfgang Müller-Salow betreute Chor, der in uniformes Schwarz gewandet die exzellente Sängerriege komplettiert.
Ihr Jochen Rüth 11.11.2019
Die Fotos stammen von Klaus Lefebvre.
Spring Awakening (Frühlings Erwachen)
Premiere: 15.06.2019, Wiederaufnahme: 14.09.2019
Auch nach über 100 Jahren noch aktuell
Im Jahr 1891 veröffentlichte Frank Wedekind das gesellschaftskritische Drama „Frühlings Erwachen“, welches die Geschichte mehrerer Jugendlicher erzählt, die in Ihrer Pubertät mit den großen Problemen auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen auf eine Wand von gesellschaftlicher Intoleranz stoßen. Durch das Ignorieren dieser Probleme, von kleineren schulischen Problemen bis hin zu sexuellen Gefühlen über die nicht gesprochen werden darf, wächst die psychische Instabilität der jungen Leute spürbar an. Dass dies verstärkt durch starken Leistungsdruck durchaus ernsthafte Folgen nach sich zieht, kann daher nicht verwundern. Nachdem das Bühnenstück im November 1906 in einer deutlich zensierten Version an den Berliner Kammerspielen seine Uraufführung feierte folgte im Jahr 1923 die erste Verfilmung des Stoffes. Ungefähr zur gleichen Zeit fand auch erstmals eine unzensierte Aufführung des Werkes statt. Fast ein Jahrhundert nach der Uraufführung des Schauspiels fand am New Yorker Off-Broadway im Mai 2006 die Premiere eines Musicals statt, welches auf Wedekinds Drama basiert. Die Musik stammt von Duncan Sheik, das Buch von Steven Sater. Die in Hagen gespielte gelungene deutsche Übersetzung wurde von Nina Schneider für die deutsche Erstaufführung am 29.06.2011 in München entwickelt, zuvor wurde das Musical bereits in einer anderen Übersetzung am Wiener Ronacher erstmals in deutscher Sprache uraufgeführt.

In Amerika wechselte das Werk innerhalb von wenigen Monaten an den Broadway und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter u. a. acht Tony Awards, vier Drama Desk Awards und einen Grammy. Besonders zu Gute kam dem Musical dabei sein Aufbau, bei dem der Zuschauer auch heute noch mit den Jugendlichen aus einer längst vergangenen Zeit zum Ende des 19. Jahrhunderts mitfühlen kann. Während die Sprechtexte sich entlang der Vorlage von Wedekind durch die eigentliche Geschichte bewegen, treten die Darsteller durch die Songs immer wieder heraus und stellen hier ihre eigenen Gedanken dar. Besonders beachtenswert ist auch die Tatsache, dass dies in diesem Musical lediglich den jungen Menschen vorbehalten ist, den Erwachsenen fehlt diese Fähigkeit. Die Lieder treiben somit nicht die Handlung voran, sondern schaffen eine besondere Nähe zu den Gefühlen der Protagonisten. Hierbei wird deutlich, dass viele Probleme von damals, auch heute noch aktuelle Probleme der Jugendlichen unserer Zeit sind. Sacha Wienhausen greift dies mit seiner Inszenierung geschickt auf, in der die Schüler einer nicht näher bezeichneten Schule der heutigen Zeit Wedekinds „Frühlings Erwachen“ als Theaterstück aufführen. Dabei ist die Trennung von Schüler und übernommener Rolle am Anfang noch klar erkennbar, vieles wird von den Mitschülern belächelt oder die jeweilige Rolle wird noch nicht ganz ernst genommen. Im Verlauf des Abends verwischen die Grenzen aber zusehends und die Schüler identifizieren sich komplett mit den übernommenen Charakteren.

Dies setzt Wienhausen zusammen mit Anja Schöne, die sich für die Schauspiel-Regie verantwortlich zeichnet, exzellent und handwerklich sehr geschickt um. Da für dieses Werk fast ausschließlich junge Darsteller benötigt werden, setzt das Theater Hagen seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück fort und beweist einmal mehr, dass es auch in Deutschland sehr talentierten Nachwuchs in diesem Bereich gibt. In den drei Hauptrollen überzeugt Johann Zumbült als Klassenprimus Melchior Gabor, der vom Geist der Aufklärung beflügelt gegen das Establishment auflehnt genauso wie Isabell Fischer als Wendla Bergmann, die auf Grund fehlender Aufklärung durch Ihre Mutter ungewollt von Melchior schwanger wird und Sebastian Jüllig als Moritz Stiefel. Letzterem gelingt es exzellent die inneren Sorgen und Nöte mit einem detaillierten Schauspiel auf die Bühne zu bringen. Auch die weiteren Rollen sind allesamt stimmig besetzt, stimmlich fällt hier Vera Lorenz als Ilse noch sehr positiv auf. Unterstützt werden die Darsteller vom Ballett des Theaters Hagen und Anne Schröder und Ralf Grobel, die sämtliche Erwachsenenrollen übernehmen.

Obwohl das Werk oftmals den Zusatz „Das Rock-Musical“ trägt, ist die Bandbreite hier doch etwas größer anzusetzen und bezieht ebenso Pop- wie auch Punk-Rock-lastige Nummern ein. Auch gefühlvolle Lieder kommen nicht zu kurz, hier kommt Duncan Sheik seine erfolgreiche Tätigkeit als Singer-Songwriter sicher zu Gute. Die sechs Musiker aus dem Philharmonischem Orchester Hagen samt Gästen bringen die Partitur unter der musikalischen Leitung von Dan K. Kurland kraftvoll auf die Bühne. Alfred Peter sorgt als Ausstatter für eine geschickte Bühne in der Schulaula, bei der sich hinter dem Vorhang immer wieder neue Orte ergeben. Dem Theater Hagen ist mit diesem Musical erneut ein sehr sehenswerter Musicalabend gelungen, der mit einem großen Applaus für alle Darsteller endete. Lediglich die Zuschauerzahl stimmt etwas traurig. Sind die Menschen in Hagen oder dem erweiterten Einzugsbereich wirklich nicht mehr der Lage richtig gutes modernes Musiktheater zu erkennen? Hier wäre es wünschenswert, dass die weiteren 5 Vorstellungen bis zum Jahresende etwas mehr Zuspruch erfahren würden, von mir gibt es daher eine klare Besuchsempfehlung.
Markus Lamers, 15.09.2019
Bilder: © Klaus Lefebvre
Purcells Dido / Händels Wassermusik
Spartenübergreifender Doppelabend – packend umgesetzt
Premiere: 18.5.19
besuchte Vorstellung: 30.5.19
Lieber Opernfreund-Freund,
eine spartenübergreifende Doppelvorstellung präsentiert das Theater Hagen zur Zeit, bei der man Purcells Dido & Aeneas ein Ballett zu Händels Wassermusik zur Seite stellt, das die gleiche Geschichte noch einmal tanzend erzählt. Herausgekommen ist dabei ein packender und faszinierender Theaterabend, den ich mir gestern für Sie angeschaut habe.

Sowohl die griechische als auch die römische Mythologie berichten von Aeneas, dem Sohn von Anchises und der Göttin Venus, der nach seiner Flucht aus Troja in Karthago strandet und sich in die dortige Königin Dido verliebt und sie aus der Trauer um ihren verstorbenen Mann Acerbas löst. Doch Merkur erinnert Aeneas an seine Pflicht, nach Italien weiter zu segeln und das römische Reich zu Gründen. Vergil berichtet in der Aeneis von Didos Selbstmord mit einem Schwert auf einem Scheiterhaufen, nachdem Aeneas sie verlassen hat.
Henry Purcell schuf auf ein Libretto von Nahum Tate, das auf diesem Stoff basiert, seine einzige durchkomponierte Oper, die – da sind sich die Quellen uneins – wahrscheinlich 1689 zur Uraufführung kam, ob an einem Mädchenpensionat in Chelsea oder am Königshof ist ebenfalls unklar. In seinem Werk ergänzt Purcell die mythologische Erzählung um seinerzeit durchausübliches „Hexenwerk“: eine böse Zauberin ist neidisch auf Didos Glück und lässt Aeneas von einem Geist in der Gestalt Merkurs abbeordern, um das Glück der Königin von Karthago zu zerstören.
Intendant Francis Hüsers sieht sogar das komplette karthagische Volk als Neider Didos um ihr Glück. Die Hexengemeinschaft verwandelt sich unter seiner Regie aus der Gruppe der Karthager heraus; selbst die Vertraute Belinda, die zu Beginn die trauernde, in der Hochzeitsnacht bereits zur Witwe gewordene Dido, die ihr Brautkleid nicht ablegen will, zurück ins Leben schickt und ihr den charismatischen Aeneas vorstellt, scheint ein doppeltes Spiel zu spielen. Wasser als verbindendes Element des Abends ist allgegenwärtig, in den wellenhaften Aufbauten, die Kaspar Glarner auf die Hagener Drehbühne gestellt hat ebenso, wie im Muster der ebenfalls von ihm entworfenen, an gebatikte Pilgerkluft erinnernden Kleidung, die die Karthager tragen. Die ausgefeilte Personenführung Hüsers‘ macht Spannungen und Konflikte deutlich und so gelingt auch Dank der wunderbaren Interpretin der Titelheldin ein besonderer Musiktheaterabend.

Veronika Haller singt die bedauernswerte Dido in bester Barock-Manier nahezu vibratolos und stattet sie mit einer unglaublichen Zartheit aus, spinnt betörende Piani und ist doch auch die selbstbestimmte Frau, die an ihren eigenen Prinzipien verbricht. Der Sohn der Schönheitsgöttin ist in Hagen mit einem Bariton besetzt, Kenneth Mattice darf nicht nur zu Beginn seinen adonis… Pardon… aeneashaften Körper zeigen, berührt mich mit seinem Gesang allerdings kaum. Cristina Piccardi ist eine zauberhafte Belinda mit klarer Höhe, während Marilyn Bennet die Zauberin mit diabolischen Zwischentönen ausstattet. Elizabeth Pilon und So Hee Kim sind ein teuflisch gutes Hexengespann, während Kisun Kim zwar mit einer Verletzung kämpft, aber stimmlich als Second Woman auf ganzer Linie überzeugt.
Rodrigo Tomillo lässt im Graben mit historisch informiertem Strich musizieren und präsentiert eine wunderbar schlanke Interpretation der Partitur. Lediglich seine Tempi sind mitunter etwas forsch, so dass gerade die Beweinung der Dido zum Ende des ersten Teils wenig Getragenes an sich hat. Bei Händels Wassermusik hingegen glänzt sein Dirigat durch ausgefeilte Dynamik. Die berühmte Händelkompoisition wurde durch die Ouvertüre zu seinem Judas Maccabaeus ergänzt, um eine passende Untermalung der Zaubererszene zu erhalten.

Der zweite Teil des Abends nämlich erzählt die gleiche Geschichte noch einmal. Was langweilig klingen mag, ist das genaue Gegenteil. Denn während Purcells Version die Handlung eher aus der Sicht Didos zeigt, erscheint die Choreographie von Francesco Nappa wie die männliche Sicht auf die Dinge. Mit Aeneas‘ Augen erleben wir das gleiche Stück, das doch ganz anders daher kommt. Die Liebeszene, zu der Hüsers noch die Jagdszene der Oper umgedeutet hatte (inklusive Defloration), wir im Wasser getanzt und der Compagnie gelingen auch darüber hinaus immer wieder intensive und berührende Momente. Francesco Nappa hat eine recht sportliche, teilweise beinahe akrobatische Tanzsprache gewählt, kann aber auch auf der Gefühlsebene vollends überzeugen. Die Tänzerinnen und Tänzer sind höchst engagiert, tanzen nicht nur hervorragen, sondern spielen auch vorzüglich. Ana Isabel Casquilo zeigt als Dido viel Körperspannung und schickte reichlich Emotionen über den Graben. Bobby Briscoe beweist als Zauberer, dass offen zur Schau gestellte körperliche Kraft und tänzerische Anmut sich nicht ausschließen müssen und der Aeneas von Gonçalo Martins da Silva ist schlicht eine Wucht. Der junge Portugiese tanzt mit einer Hingabe und Intensität, als ob sein Leben davon abhinge – da wagt man als Zuschauer kaum wegzusehen.

Die Produktion über Spartengrenzen hinweg wird so zum Hochgenuss. Oper und Ballett erzählen zusammen eine rundum runde Geschichte und vielleicht ist diese Kombination ja etwas, das Schule machen kann, auch weil sie Berührungsängste abbaut: Opernfans erleichtert das Theater den Zugang zum Ballett, während man den Tanzjunkies die Oper näherbringt. Also: Unbedingt hin, wer kann!
Ihr Jochen Rüth 31.05.2019
Die Fotos stammen von Klaus Lefebvre und Leszek Januszewski
Zum Zweiten
Tristan und Isolde
Premiere: 7.4.2019
Die Inszenierung bitte in den Müll

Das Theater Hagen, ein Haus von mittlerer Größe, beweist immer wieder außerordentliche Fantasie hinsichtlich seiner Repertoiregestaltung. Uraufführungen, Ausgrabungen, unorthodoxe Werkzusammenstellungen werden in schöner Regelmäßigkeit geboten. Manchmal gibt es auch den mutigen Griff über hauseigene Kapazitäten hinaus. In den vergangenen Jahrzehnten wurde beispielweise zweimal „Elektra“ auf die Bühne gebracht (natürlich in der reduzierten Orchesterfassung), nun zum wiederholten Male Wagners „Tristan“. Die letzte Produktion fand im März 1991 statt: Dirigent war Michael Halász, Regie führte Peter Rasky, die Ausstattung besorgte Reinhard Heinrich. Sänger waren Thomas Harper/Robert Bruins, Danuta Bernolak, Faith Puleston, Andreas Haller und Horst Fiehl. Die Namensaufzählung sei als Kompliment verstanden.
Die jetzige Aufführung imponiert mit ihren musikalischen Leistungen. Wie Joseph Trafton das Philharmonische Orchester Hagen zu einem ungemein disziplinierten Spiel animiert und den rauschhaften Wagner-Klang mit all seinen dunklen Vibrationen und glühendem Schimmern aufblühen läßt, ist fast schon als sensationell zu bezeichnen. Der herrliche Schlußakkord klingt noch nach, wenn man das Theater längst verlassen hat.

Das Sängerensemble von „Tristan“ besteht im Wesentlichen aus Gästen, insofern ist von einer hauseigenen Produktion nur bedingt zu sprechen. Aber das besondere Werk erfordert nun einmal besondere Maßnahmen. Um bei den Darstellern die Namensabfolge im Titel des Musikdramas zu wahren… Zoltán Nyári (derzeit fest in Oldenburg engagiert) begann seine Karriere als Schauspieler, was man seiner Bühnenpräsenz anmerkt. Der Wechsel zum Sänger geschah über Operette/Musical, bei der Oper ist der ungarische Tenor inzwischen längst im Heldenfach angelangt. Wie er zuletzt noch den strapaziösen dritten Aufzug mit nie nachlassenden Kraftreserven meistert, ist wirklich einzigartig. Doch kommen bei dem Sänger lyrische Feinheiten nicht zu kurz. Auch die international gefragte Magdalena Anna Hofmann hat sich hochdramatisch entwickelt. Nach der Hagener Isolde wird Beethovens Leonore in Bologna ihr nächstes Rollendebüt sein. Ohne jeden Spitzenton auf die Goldwaage legen zu wollen: die Tessitura der Wagner-Partie beherrscht die Sopranist mit großer Verve. Besonderer Vorteil ihrer Rollengestaltung ist das jugendlich wirkende Timbre, die weich gerundete Tongebung, was die Isolde vom Typus einer schwergewichtigen Heroine fernhält. Der Liebestod tönt lyrisch bis hin zum unangestrengten Schluß-Fis im Pianissimo.

In Hannover ist Khatuna Mikaberidze engagiert. Die Brangäne der georgischen Mezzosopranistin gefällt mit blühender, breit strömender Üppigkeit. Wieland Satter, vor kurzem eindrucksvoll in der Aachener Produktion von Bernsteins „Trouble in Tahiti“/„A quiet Place“ zu erleben, gibt einen markanten, rustikalen Kurwenal, der hauseigene Dong-Won Seo einen tragisch umflorten, dabei baßmächtigen Marke. In Hagen bereits als Steuermann zu erleben war Daniel Jenz (fest engagiert in Kassel), jetzt überzeugt er als junger Seemann und Hirt. Richard van Gemert und Egidijus Urbonas ergänzen als Melot und Steuermann das Ensemble angemessen.
Nunmehr ist auf die Inszenierung zu sprechen zu kommen. „Sind die Leute wahnsinnig? Ich muß unbedingt sofort den Intendanten sprechen.“ So könnte man einen Satz der Primadonna in der Strauss-„Ariadne“ variieren. Freilich: der Intendant des Theaters Hagen Francis Hüsers ist gleichzeitig „Tristan“-Dramaturg und versucht natürlich im Programmheft verständlich zu machen, was das Produktions-Team Jochen Biganzoli (Regie), Wolf Gutjahr (Bühne), KATHARINA WEISSENBORN (Kostüme) und Hans-Joachim Köster (Licht) auf die Bretter „gezaubert“ hat. Insgesamt sind Hüsers‘ Erläuterungen durchaus hilfreich.

Seinen Worten zufolge sind Tristan und Isolde nicht mehr von dieser Welt, gänzlich in privaten Gefühlsregionen eingeschweißt, für Belange des Gesellschaftlichen nicht ansprechbar, Diese „Symbole einer Lebensverweigerung“ sind einzig im Bereich der Kunst realisierbar. Eine simple Nacherzählung der Bühnenvorgänge schließt sich somit aus.
Biganzoli kerkert die Protagonisten also in Privaträume ein, von Gutjahr individuell gestaltet: zwischen schwarzen Wänden haust Isolde, Tristan wird von gleißendem Metall umgeben, welches zunächst von einem großen Tuch mit Selbstporträt verdeckt ist. Brangäne befindet sich in einem neutralen Raum (mit Badewanne, in welche sie sich zuletzt hineinlegt), Marke in einem leicht spießigen Schlafzimmer; Kurwenal kraxelt auf einem mit Fotos geschmückten Baugerüst herum. Sie alle haben keinen wirklichen Kontakt zueinander, bleiben in sich abgeschottet. Als erstes nimmt man übrigens einen mittigen Raum wahr, in welchem der befrackte Seemann seine Partie publikumsfrontal aus einem Klavierauszug abliest und wo später Melot einen stocksteifen Auftritt mit Schwert hat.

Es sei um Nachsicht gebeten, daß nicht noch weitere verquere Regieideen wie etwa die sich in Wandtexten austobende Isolde, die im Mittelakt angesäuselte Brangäne, der sich beim Liebesduett der Selbstbefriedigung hingebende Seemann oder der sich ständig umkleidende oder ins Bett legende Marke ausgebreitet werden. Über das szenisch Leidvolle läßt sich nicht einfach „mild und leise lächelnd“ referieren, der Frust über Gesehenes ist einfach zu groß. Regelrecht erschreckend der widerspruchslose Jubel des Premierenpublikums.
Christoph Zimmermann 8.4.2019
Bilder Theater Hagen
Zum Ersten
Tristan und Isolde
Premiere: 7. April 2019
Wagner-Fans sollten sich aber zwei bis dreimal überlegen, ob sie diese Extrem-Inszenierung wirklich sehen wollen.

Wahrscheinlich ist diese Inszenierungen die radikalste Deutung des Stückes, die es bisher gegeben hat, und damit würde sie eigentlich auf die Festspielbühnen von Bayreuth oder Salzburg gehören. Auf der anderen Seite kann das dortige Publikum aber froh sein, dass es für diese Inszenierung kein Geld ausgibt, denn sie ist so radikal, dass sie am Stück vorbeigeht.
Bereits Jean-Pierre Ponnelle inszenierte in seiner Bayreuther Inszenierung Isoldes Liebestod als Fieberphantasie des sterbenden Tristan, und Nike Wagner zeigte in ihrem Aufsatz „Der zweimal einsame Tod“, dass Tristan und Isolde eigentlich aneinander vorbeireden und jeder in seiner eigenen Welt gefangen ist.
Regisseur Jochen Biganzoli geht in Hagen aber noch weiter und lässt die ganze Oper nur in der Fantasie oder Wunschvorstellung der Protagonisten spielen. Die fünf Hauptfiguren befinden sich in geschlossenen Räumen (Bühne: Wolf Gutjahr), jeder ist allein und hat während der ganzen Aufführung keinen Kontakt zu den anderen. Das hört sich auf den ersten Blick genial an.

Wenn aber eine reale Situation fehlt, aus der sich die Figuren in ihre Fantasie oder Wahn begeben, dann ist das, was auf der Bühne passiert, total egal und berührt in keiner Weise. Stattdessen tut es dem Auge weh, fünf Stunden lang zu sehen, wie in dieser Inszenierung nur Dinge passieren, die permanent dem Text zuwiderlaufen.
Vielleicht hätte dieses Konzept mit fünf abgeschotteten Figuren funktioniert, wenn das Personal aus Wagner-Fans verschiedener Epochen bestehen würde, die sich im Radio, auf LP, CD oder auf dem Handy „Tristan und Isolde“ Oper anhören und sich aus der Realität, in der sie sich befinden, in Wagners Musik hineinsteigern. Die Hagener Produktion ist jedoch ein Beispiel dafür, wie sich ein Regisseur mit Vollgas in eine konzeptionelle Sackgasse steuert.
Umso erfreulicher Ist die musikalische Seite der Produktion. Im kleinen Hagener Theater zaubert GMD Joseph Trafton einen samtig weichen Streicherklang, der oft ganz kammermusikalisch daherkommt. Das Orchester ist aber auch zu den großen dramatischen Ausbrüchen fähig, was die Sänger gelegentlich in Bedrängnis bringt. Überraschend ist, dass selbst Nebenrollen mit Gästen besetzt sind und lediglich Marke und Melot aus dem Ensemble stammen.

Magdalena Anna Hofmann war schon im Mindener „Ring“ eine starke Sieglinde. Die Isolde singt sie mit jugendlich-frischer Stimme, hat allerdings manchmal Probleme mit der Textverständlichkeit. Zoltan Nyári ist im Oldenburger „Ring“ ein lautstarker Siegfried und zeigt sich auch als Tristan sehr durchsetzungsfähig. Gleichzeitig singt er viele Passagen aber auch sehr lyrisch.
Als Brangäne hat man Khatuna Mikaberidze von der Staatsoper Hannover engagiert, die ihre Partie mit kernig-selbstbewusstem Mezzo gestaltet. Wieland Sattler vom Pfalztheater Kaiserslautern singt den Kurwenal mit einem stattlichen Heldenbariton, der Wotan-Potenzial besitzt. Mit warmen und sattem Bass interpretiert Dong-Won Seo den König Marke.
Beim Wagner-erfahrenen Publikum in Düsseldorf, Essen oder Köln wären bei dieser Inszenierung schon während der Aufführung die Fetzen geflogen, in Hagen wird beim Schlussbeifall aber sogar das Regieteam bejubelt.
Rudolf Hermes 8.4.2019
Bilder (c) Theater Hagen
IL TURCO IN ITALIA
14. März 2019
Premiere am 2. Februar 2019
Ein türkischer Tourist in Hagen – recht nett und gagreich
Die Rezeptionsgeschichte von Rossini´s Turco in Italia liest sich eher traurig, da gerade diese Oper durch eine Heerschar von Dirigenten, Intendanten und Sängern über ein Jahrhundert lang übel zugerichtet wurde. Nach dem Premieren-Durchfall 1814 in der Mailänder Scala (man hielt die Oper nur für eine modifizierte Replik der „Italiana in Algerie“) und trotz glänzender Besetzung kam es zunächst nur zu wenigen Aufführungen. Das hatte wohl auch moralischen Gründe wegen der offen gezeigten Leichtlebigkeit. Dabei ist die Oper in Originalität und Musikalität der „Italiana“ überlegen, ist musikalisch anspruchsvoller, wahrt dabei aber die Rossinis Kompositionen eigene Leichtigkeit, Virtuosität und Fröhlichkeit.

Zu lesen ist immer wieder, dass Rossini Teile der Oper seine Mitarbeiter hat komponieren lassen und sich auch selbst um die Aufführungen wenig gekümmert hat. Das rächt sich. In der Folgezeit haben die bereits genannten Täter Bearbeitungen vorgenommen, Arien hinzugefügt oder Kürzungen durchgeführt, das Werk sozusagen gründlich verhunzt. Erst 1950 wurde unter der Regie von Zefirelli und mit der Callas als Fiorilla in Mailand eine redigierte und entschlackte Version geboten und in der Folge auch zunehmend anderweitig gespielt. Insgesamt hält sich die Zahl der Aufführungen allerdings sehr in Grenzen. Das kleine Theater Hagen hat sich nun erkühnt, die Oper auf die eigenen Bretter zu bringen, ein nicht einfaches Unterfangen, da gerade „das Leichte so schwer ist“; eine Rossini-Begeisterung kommt nur auf mit exzellenten Protagonisten und einem famosen Orchester.

Die Story ist auch nicht ganz einfach und diametral zu den beliebten Türkenopern, denn hier kommt der reiche Muselmann Fürst Selim als Tourist nach Neapel, speziell auf der Suche nach amourösen Abenteuern. Seine Ex Zaida war seinem Harem entflohen und trauert Selim nach. Der aber schmeißt sich an Fiorilla, Eifersucht kommt auf, da Selim die Zaida trifft, was der Fiorilla total stinkt. Und ihrem Gatten Geronio ebenfalls. Selim will Fiorilla entführen, da ihr Gatte sie nicht zu verkaufen gedenkt. Genau jetzt kommt der Dichter Prosdocimo ins Spiel, der auf der Suche nach einem Opernlibretto ist; bei einem Maskenball kommt es zu allerlei heillosen Verwechselungen und Beziehungsproblemen, bis sich die Paare mehr oder weniger im Originalzustand wiederfinden. Und der Dichter hat eine schöne Basis für sein Libretto – beziehungsweise für seinen neuen Film – denn das ist die Basis für die Inszenierung von Christian von Götz. “Der Türke in Italien” thematisiert Freiheit, Treue und Liebesbeziehungen. Das macht diese Oper bühnenwirksamer, als es Rossinis vorangegangene, stärker in der neapolitanischen Tradition verankerte Opern sind. Das Werk ist nach “Die Liebesprobe” und “Die Italienerin in Algier” die letzte der drei Rossini-Opern, die von der damals herrschenden Orientbegeisterung zeugen; auch Mozart´s Meisterwerk „Die Entführung aus dem Serail“ gehört dazu.

Das Produktionsteam um von Götz hat allerlei gewerkelt; so sitzen bei der Ouvertüre ein Produzent neben dem Filmemacher auf klassischen beschrifteten Regiestühlen, gemeinsam schauen sie seinen neuen hochpathetischen Stummfilm an, der aber nicht recht ankommt; das Drehbuch ist leider nur für die Tonne. Damit geht die Geschichte für den Poeten richtig los, er braucht Stoff für einen weiteren Film. Die Inszenierung strotzt nur so voller Regiegags, die zum Teil originell, aber auch sehr abgeschmackt und albern sind. Und die auch durch ständige Wiederholungen, wie in alten Filmen mit dem Kopf an eine Wand zu rennen, mitnichten origineller werden. Auch wenn Geronimo an einem langen Seil wie Tarzan, allerdings dabei singend über die Bühne schwingt, ist das vielleicht zwei mal witzig, dann aber nicht mehr. Nicht wirklich erschließt sich die Idee der Regie, die Protagonisten sackhüpfend über die Bühne zu schicken, sogar paarweise, und dabei gegenseitig diverse Unterwäscheteile zu erbeuten. Unklar bleibt auch, warum Fiorilla im schicken Ägypten-Look und mit Rollerblades hin und her über die Bühne rollen muss. Aber was auch passierte, das Publikum im leider nur halb gefüllten Opernhaus quittierte die Szenen mit viel Gelächter und Zwischenapplaus. Denn man muss nicht alles immer auf die Goldwaage legen und logisch überdenken. Rossini ist bei all seiner musikalischer Genialität auch ein Lustspiel-Komponist, wo sich ein Regisseur in einer „komischen Oper“ auch mal einfach gehen lassen und seine Fantasie ohne Angst vor Beckmessertum umherschweifen lassen kann. Denn Klamauk kann auch mal Kunst sein.

Musikalisch war durchaus Achtbares zu vernehmen. Das Philharmonische Orchester Hagen arbeitete sich in dieser sechsten Aufführung wacker durch die kritischen Klippen der Partitur, nicht immer, aber immer besser und präziser in der Synchronisation der Tempi mit der Bühne. Maestro Steffen Müller-Gabriel am Pult verstand es, mit einem beständigen Drive die Handlung und die Sänger zu unterstützen und erfolgreich zu fordern. Auch über diese gibt es Gutes zu berichten. Allen voran Marie-Pierre Roy mit viel szenischem Selbstbewusstsein, hervorragenden Spitzentönen und locker fließenden Koloraturen. Kammersängerin Merylin Bennettt als Zaida zeigte einen angenehmen kräftigen Mezzo und ein prima komödiantisches Talent. Der Koreaner Dong-Won Seo als Türke gefällt sehr mit profundem Bass, und erst recht Rainer Zaun als herrlich tiefer Buffo. Der in Hagen sehr beliebte Sänger musste das Ensemble nach dem Intendantenwechsel verlassen, was sehr viel Unmut erzeugt hatte. Hier konnte er sich in gewohnter Frische und Güte erfolgreich präsentieren. Den Dichter singt Kennth Mattice rollengerecht; immerhin erfindet er am Ende den Tonfilm. Leonardo Ferrando spielt den Don Narciso sehr engagiert, hat allerdings stimmlich in Höhe und Sicherheit noch etwas Luft nach oben.
Der Oper Hagen darf man für diese – trotz szenischer Kritik (alles ist Geschmackssache) – hübschen und musikalische reizvollen Produktion im originellen Bühnenbild (stilisierte Kameralinse von Lukas Noll) der selten gespielten Oper ein volleres Haus wünschen. Der Schlussapplaus war auf jeden Fall sehr eindeutig begeisternd.
Michael Cramer 19.3.2019
Fotos: © Klaus Levevre
Simon Boccanegra
Premiere: 29.9.2019
Im Mafia-Milieu
Das Auditorium des Theaters Hagen war relativ schwach besetzt. Ob das am Zeitungsbericht von einer Pressekonferenz zur Verdi-Oper herrührte, wie eine Pausenzuflüsterung suggerierte? Diese soll nämlich das Eingeständnis des Produktionsteams besonders hervorgehoben haben, daß es sich bei „Simon Boccanegra“ um eine schwer kommensurable Oper handle. Aber bitte: in Hagen gibt man sich doch generell spielplanmutig, nicht zuletzt durch den Einsatz für zeitgenössische Werke. Und da sollte sich das fast immer als aufgeschlossen erlebte Publikum verweigert haben?

Die Rezension an dieser Stelle kann freilich kaum Aufmunterung geben. Sie wendet sich sogar ausdrücklich gegen den frohgemuten Beifall der Zuschauer, der sich mit Recht an die Sänger, zu wenig hingegen an den Dirigenten Joseph Trafton und – bis auf einen einzelnen Protestschrei – unverständlicherweise an die Inszenatoren richtete. Ob dieser Premiereneindruck wirklich ein verbindliches Fazit ist, könnte sich u.U. am 14. Oktober korrigieren. Dann nämlich wird erstmals eine „Stunde der Kritik“ mit einem opernprominenten Moderator und Regiebeteiligten geboten. Die Quintessenz wird sicher (warnend) auch nach Lübeck dringen, wo die Koproduktion in der nächsten Spielzeit herauskommt.
Obwohl das fundamentale theatralische Gespür Verdis keinem Zweifel unterliegt, ist doch nicht zu leugnen, daß seine frühen und mittleren Werke („Luisa Miller“ und vor allem „Macbeth“ ausgenommen) heute sujetmäßig einigermaßen vergilbt wirken. Selbst noch bei „Forza del destino“ hat man mit Handlung und Psychologie heftig zu kämpfen. Ab „Don Carlos“ ist man mit der Verdi-Dramaturgie dann aber völlig d’accord.

Wie nun mit „Simone Boccanegra“ umgehen? Die Originalhandlung erzählt vom politischen und vor allem menschlichen Zwist zwischen Boccanegra und Fiesco im Genua des 14. Jahrhunderts. Diese Atmosphäre bleibt in Hagen durch die Surtitles auf (nun ja) störende Weise erhalten, denn die junge Regisseurin Magdalena Fuchsberger will partout etwas anderes erzählen. Sie sieht in den Männern der Oper eine Mafioso-Gesellschaft, total auf Macht fixiert und dabei die Rechte der Frau massiv unterdrückend. Allerdings wird in Hagen angedeutet, daß Amelia (alias Maria) eigene Initiativen zu verfolgen gewillt ist.
Das Libretto vermittelt etwas Anderes, was auch Fragen an die Ausstatterinnen (Monika Biegler, Kathrin Hegedüsch) notwendig macht, ob vier nüchterne Büroräume auf Drehbühne und moderne Kostüme dem Hagener Konzept wirklich aufhelfen. Vor allem verliert sich Frau Fuchsberger in abstruser Personenführung. Die Sänger müssen beispielsweise ständig auf Sessel, Schreibtische und anderes Mobiliar klettern. Amelia ist mal lebendig, mal zusammengebrochen, mal (offenbar) tot auf der Bühne präsent. Ihre große Arie gleicht einer dämonischen Ulrica-Beschwörung. In Folge ist die Sängerin ausgiebig damit beschäftigt, schweres Mobiliar hin und her zu wuchten. Der Symbolwert ist vermutlich noch schwerer.

Der Schlußakt ist an den Anfang vorgezogen, was nur wenig bringt. Vor Boccanegras Begegnung mit seiner verloren geglaubten Tochter fällt der Pausenvorhang. Und diese Szene ist ein besonderer Tiefpunkt in der Inszenierung, müssen beide Sänger doch harmlos durch einen steif herum stehenden Chor tändeln. Dieser hat auch sonst meist nur stupide Auf- und Abtritte. Man wird beim Zusehen zunehmend aggressiv.
Veronika Haller ist den lyrischen Anforderungen der Amelia-Partie gewachsen (einige problematische Intonationen in der Höhe). Sie hat auch ein Schlußwort zu sprechen, komplementär zur verbalen Ouvertüre von Band. Es geht hier um Humanität. Hilfsbereitschaft und andere Wertbegriffe. Die Texte nehmen Bezug auf die (etwas sentimentale) Rede des zum Hitler aufgestiegenen kleinen Juden in dem Chaplin-Film „Der große Diktator“. In Hagen glaubt man fast einer Morgenandacht beizuwohnen; politischer Appell verweht.

Die beiden Koreaner Kwang-Keun Lee (Boccanegra) und Dong-Won Seo (Fiesco) sind beeindruckende vokale Persönlichkeiten, Xavier Moreno ein tenoral flammender Adorno. Dem intriganten Albiani gibt Kenneth Mattice überzeugende Kontur, Valentin Anikin (Pietro) überflügelt ihn vokal leicht.
Der Dirigent Joseph Trafton ist ein Glücksfall für das Theater Hagen. Bereits bei Janaceks „Schlauem Füchslein“ fiel auf, wie stark er das Philharmonische Orchester zu musikalischem „Erzählen“ zu animieren versteht. Bei „Boccanegra“ beeindruckt vor allem instrumentale Detailarbeit und zupackende Dramatik. Wie gesagt: ihm hätte stärkerer Beifall gelten dürfen.
Christoph Zimmermann 30.9.2018
Bilder (c) Theater Hagen
Job Talbot
EVEREST
Europäische Erstaufführung: 5. Mai 2018
Muß man gesehen haben....

Dem Hagener Theater ist ein echter Coup gelungen: Mit Joby Talbots „Everest“ zeigt das Haus die europäische Erstaufführung einer Oper, die 2015 in Dallas uraufgeführt wurde. Thema der 75-Minuten-Oper ist der Versuch zwei touristischer Expeditionen den Mount Everest am 10. Mai 1996 zu besteigen, wobei acht Teilnehmer ums Leben kamen. Dieses Ereignis wurde auch in mehreren Büchern (z.B. Jon Krakauer: In eisigen Höhen) und 1997 und 2015 (mit Keira Knightley, Jake Gyllenhall und Josh Brolin) verfilmt.

Dem in Oregon lebenden Komponisten gelingt das Kunststück eine Oper zu schreiben, die gleichzeitig zeitgenössisch klingt, dabei auf traditioneller Harmonik fußt und gleichzeitig emotional ist, ohne kitschig zu werden. Die Musik des Berges ist von tiefen Bläsern und kratzigen Perkussionsinstrumenten geprägt. Die Musik der Menschen hingegen besitzt viel melodische und harmonische Schönheiten, wird aber immer wieder von der Berg-Musik attackiert. Das Philharmonische Orchester Hagen spielt Talbots Musik unter dem Dirigat von GMD Joseph Trafton mit großem Ausdruck und emotionaler Spannung.

Librettist Gene Scheer konzentriert sich auf vier Figuren. Bergführer Rob Hall, der mit dem Touristen Doug Hansen den Gipfel besteigt, Halls Frau Jan Arnold, die hochschwanger in Neuseeland auf ihren Mann wartet und als weiteren Bergtouristen den von Depressionen belasteten Beck Weathers, der aus gesundheitlichen Gründen die Besteigung abbricht und mit schwersten Erfrierungen überlebt.
Zu erleben ist ein erstklassiges Ensemble: Musa Nkuma singt Rob Hall mit viel tenoralem Schmelz als wahre Belcanto-Partie. Als seine Frau Jan Arnold glänzt Veronika Haller mit strahlkräftigem Sopran. Kenneth Mattice singt Doug Hansen mit kernigem Bariton. Mit viel Noblesse und Eleganz gestaltet Morgan Moody den Beck Weathers. Ganz stark präsentiert sich auch der von Wolfgang Müller-Salow einstudierte Chor, der das Geschehen immer wieder kommentiert und die Figuren befragt.

Regisseur Johannes Erath, der in der laufenden Saison mit „Der Mieter“ in Frankfurt und „Manon“ in Köln bereits zwei starke Inszenierungen präsentiert hat, begnügt sich nicht damit die Geschichte platt nachzuerzählen. Ausstatter Kaspar Glarner hat ihm ein Sanatorium im „Zauberberg“-Stil entworfen und auch Glarners Kostüme siedeln die Inszenierung in den 20er Jahren an. Auf den ersten Blick verwundert das, und man fragt sich, ob der „Zauberberg“ als literarischer Verweis für dieses Bergsteigerdrama aus den 90er Jahren funktioniert?
Da Librettist Gene Scheer aber keine lineare Handlung erzählt, sondern sich die Geschichte mosaikartig aus vielen verschiedenen Szenen und Berichten und Rückblenden zusammensetzt, geht dieses Konzept bestens auf. Man befindet sich sozusagen in einer jenseitigen Gemeinschaft der „Opfer der Berge“, die von ihren Erlebnissen berichten.

Das Hagener Publikum zeigt sich von dieser Produktion begeistert, sogar Komponist Joby Talbot wird mit Bravo-Rufen und Standing-Ovations gefeiert. Wann erlebt man so etwas schon bei einer zeitgenössischen Oper? Diese Produktion muss man gesehen haben!
Rudolf Hermes 6.5.2018
Bilder (c) Theater Hagen
TRAILER der Weltpremiere der Dallas Opera (2015)

Das schlaue Füchslein
Premiere: 25.3.2018
Weg vom plakativen Naturalismus

Die Spielzeitbroschüre des Theaters Hagen für 2017/18 vermerkt bei der Position des Intendanten noch ein „NN“. Im Mai vergangenen Jahres wurde dann aber Francis Hüsers auf diesen Posten berufen, ein vielseitiger Theatermann, u.a. 2005-2010 leitender Dramaturg und künstlerischer Produktionsleiter an der Berliner Staatsoper, in den folgenden fünf Jahren Operndirektor und Stellvertreter des Intendanten in Hamburg. Mit so viel Erfahrung dürfte er bestens geeignet sein, ein zuletzt stark gefährdetes Theater wie das von Hagen auf Kurs zu halten.
Den Spielplan der laufenden Saison hat Hüsers zwar nicht mitkonzipiert, aber er ist typisch für die in der Vergangenheit immer wieder erlebte glückliche Mischung aus publikumsaffinen Stücken (bei der Oper 2017/18 „Tosca“ und – mutig gewählt – „Der fliegende Holländer“) sowie Raritäten (zuletzt Haydns „Orlando Paladino“). Auch das zeitgenössische Schaffen wird kontinuierlich berücksichtigt (im Mai die europäische Erstaufführung von Joby Talbots „Everest). Leos Janácek gehört zwar nicht zu den Spielplanaußenseitern, doch nicht unbedingt zu den Publikumsrennern. In Hagen kam das „Schlaue Füchslein“ zuletzt 1973 heraus (dem Hause Dank für solche statistischen Angaben). Intendant Hüsers begleitete die jetzige Produktion dramaturgisch und moderierte auch die Einführung bei der Premiere.

Der Durchbruch für das „Füchslein“ in Deutschland war fraglos die Inszenierung Walter Felsensteins 1956 an der Komischen Oper Berlin. Aber die auf DVD nacherlebbare Aufführung mit ihrer Realismusakribie hat mittlerweise Patina angesetzt. Eine Eins-zu Eins-Nacherzählung ist alleine wegen der von Janácek vorgesehenen Doppelbesetzung bestimmter Rollen (Mensch-Tier-Parallelen) nicht mehr zeitgemäß. Aber auch sonst wirft die Suche nach einer angemessenen szenischen Realisierung Fragen auf. Sie betreffen etwa die (in Hagen benutzte) Übersetzung von Max Brod, welchem der Komponisten freilich weitestgehend vertraute, Aber wenn der Wilderer Háraschta seine musikalisch beglaubigte Freude „Ich lass mich mit ihr trauen“ (nämlich mit der schönen, allseits begehrten Terynka) durch ein „ich werde sie prügeln“ ersetzt, ist das sinnentstellend. In einer Liveaufführung geht dieses Detail aber wohl unter. Ob Felsenstein in seiner höchsteigenen Übersetzung diesen Moment zu umschiffen vermochte, könnte erst eine Librettoanalyse erweisen.

Brod wollte Terynka, Verkörperung männlicher Sehnsüchte, übrigens zur Ziehtochter des Försters machen und beim Schulmeister Unterricht nehmen lassen. Das fand dann aber doch keinen Eingang in das Libretto. Terynka ist eine Projektionsfigur in diesem „tschechischen Sommernachstraum“, wie man Janáceks Oper mitunter bezeichnet. Dass sich das Füchslein (Schlaukopf) für den Förster vorübergehend in das Mädchen zu verwandeln scheint, wie in einer lange zurückliegenden Inszenierung erlebt, mag freilich angehen.
Über die Vermeidung von ungebrochenem Realismus waren sich in Hagen die Regisseurin Mascha Pörzgen und ihr Ausstatter einig. Christof Cremer hat auf der uneben gestalteten Drehbühne lauter Leitern errichtet. Sie dienen als Baum“ersatz“, die Blätterkronen sind kugelige, weiße Lampenschirme. Dieses Bild verbreitet einen ganz eigenen Zauber. Bei den Kostümen sind Farben besonders signifikant (Förster grün, Füchse rot). Auf der Jacke des Schulmeisters sind Applikationen von Mücken zu sehen, der Pfarrer ergänzt sein kreuzbesticktes Gewand mit hellen Schulterüberwürfen, wenn er den Dachs zu spielen hat. Besonders skurrile Outfits bieten der Dackel und die die Hühnerschar.

Läuft die Inszenierung zunächst etwas vage an, bietet sie sehr bald ein erfrischend buntes Treiben, von welchem sich einige in der Premiere anwesenden Kleinkinder merklich entzücken ließen. Aber Mascha Pörzgen lässt auch Traurigkeit zu. Wenn Háraschta das Füchslein erschossen hat und in einem Supermarktwagen abkarrt, blickt ihm die zurückgebliebene Familie mit traurig aufgerissenen Augen nach. Und der Förster erfreut sich am Schluss nur wenig an der Wiederkehr allen Seins, hadert vielmehr mit dem Erlebten, Unverarbeitetem. Er setzt sogar den Lauf seiner Flinte an die Stirn. Lebensmüde oder einfach nur müde?
Auch in Hagen beweist Janáceks Musik ihre außerordentliche Emotionalität, dringt „in die Tiefe des Herzens“, mag vielleicht sogar Tränen hervorrufen, wie sie dem verknöchert gewordenen Schulmeister aus den Augen rinnen. Das liegt mit an der exorbitanten Leistung des Philharmonischen Orchesters, die man fast ein kleines Wunder nennen möchte. Unter Joseph Trafton werden die Farben der Partitur sorgfältig und feingestimmt herausgearbeitet, entfalten einen narkotischen Klangsog; es gibt keinerlei spieltechnische Defizite.

Zauberhaft die Besetzung des Fuchspaares. Dorothea Brandt bietet einen hellen, melodisch strömenden Sopran, den Jennifer Panara mit ihrem herben Timbre wirkungsvoll kontrastiert. Den leicht knorrigen Bariton des wie immer enorm bühnenpräsenten Kenneth Mattice kann man als durchaus rollenkonform empfinden, Olaf Haye (Háraschta) wirkte zumindest am Premierenabend leicht angestrengt. Bei den Nebenfiguren führt Boris Leisenheimer mit seinem bestens typisierten und tenorklar gesungenen Schulmeister. Markante Porträts kommen aber auch von Kristine Larissa Funkhauser (Försterin/Eule), Marilyn Bennett (Dackel/Specht), Veronika Haller (Hahn/Gastwirtin) und Rainer Zaun (Pfarrer/Dachs). Chor und Kinderchor des Theaters (Wolfgang Müller-Salow, Caroline Piffka) sind mit spürbarem Eifer dabei.
Fotos von Klaus Lefebvre © Theater Hagen
Christoph Zimmermann (5.3.2018)
AIDA
Premiere der konzertanten Aufführung am 03.03.2018
Die Damen brillieren
Rodrigo Tomillo, stellvertretender Generalmusikdirektor am theaterhagen und musikalischer Leiter der Premierenaufführung, versprach in der Theaterzeitung allen Besuchern ein „musikalisches Event“ und eine glanzvolle Aufführung dieses „kolossalen Werks mit höchsten Ansprüchen“ an Orchester, Chor und Sänger. Es gelte die Balance zu finden zwischen den kammermusikalischen Passagen der Partitur und dem groß auftrumpfenden Orchesterpart in den Massenszenen gerade des 2. Akts. Sein Augenmerk richte sich vor allem auf das „Kammerspiel zwischen den schicksalhaft verstrickten Protagonisten“. Und unlösbare Verstrickungen und seelische Konflikte bietet die wohl bekannteste Oper Verdis ja auch in reicher Fülle. Aida ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu Radames und den Forderungen einer Staatsraison, die ihr privates Glück unmöglich macht.

Amneris wird ganz von ihrer Eifersucht auf Aida beherrscht und vernichtet dadurch nicht nur Radames und Aida, sondern auch ihr eigenes Lebensglück. Amonasro, Aidas Vater, erpresst seine Tochter und zwingt sie in einem Psychokrimi ohne gleichen aus patriotischen Gesichtspunkten zu einem Verrat ihrer Liebe zu Radames. Und Radames selbst, zerrieben zwischen den politischen Anforderungen seines Amtes als Feldherr und seinen leidenschaftlichen Gefühlen für Aida, sieht den Ausweg nur im eigenen Tod.
So erzählt die Oper nicht nur eine tragische Dreiecksbeziehung, sondern thematisiert auch eine von Männern beherrschte, unbarmherzige und chauvinistische Geisteshaltung, die nur Opfer zurücklässt. In seiner berühmten Inszenierung der „Aida“ im Aaltotheater Essen hatte vor vielen Jahren Dietrich Hilsdorf Verdis Oper zu einer flammenden Anklage gegen den Krieg genutzt.

In Hagen erlebte man nun die Oper konzertant. Das ist gerade bei den Szenen des Triumphmarschs im 2. Akt schon ein schmerzlicher Verlust und man hätte sich zumindest gewünscht, dass durch eine verfeinerte Lichtregie und Videoclips inhaltliche Akzente gesetzt worden wären. So bleibt es – mit unterschiedlichem Erfolg – bei den Bemühungen der Sänger, ihrer Rolle Leben einzuhauchen. Ganz großartig gelingt dies Julia Faylenbogen als Amneris. Die Mezzosopranistin ist nach ihrem Engagement in Hannover mittlerweile festes Ensemblemitglied in Mannheim. Sie gestaltet in Spiel und Gesang die wie von Furien gehetzte Pharaonentochter mit einer Intensität, Differenziertheit und emotionalen Wucht, dass es einem schier den Atem verschlägt. Das erste Bild des 4. Aktes wird auf diese Weise zum Höhepunkt der ganzen Aufführung. Frau Faylenbogens Rollenportrait würde es rechtfertigen, in Hagen Verdis Oper in „Amneris“ umzutaufen.

Als Rivalin in der Liebe um Radames berührt die Südafrikanerin Andiswa Makana mit ihrer warmen, dunkel timbrierten Sopranstimme ungemein. Sie erinnert in Stimmfärbung und Rollengestaltung an große Vorgängerinnen wie Martina Arroyo oder Leontyne Price. 2016 stand sie zum ersten Mal bei den Schlossfestspielen Schwerin mit großem Erfolg als Aida auf der Bühne. Besonders ihre große Arie im ersten Akt „Ritorna vincitor“ und ihre leidenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrem Vater im 3. Akt sang Andiswa Makana mit nie nachlassender Glut und Gänsehaut fördernder Klangschönheit. Wenn sie auch manchmal zu forcierten Spitzentönen neigt , so z.B. in der Nilarie „O patria mia“ des 3. Akts, so ist ihre sängerische Leistung an diesem Abend nicht hoch genug einzuschätzen. Man braucht kein Prophet zu sein, um der Südafrikanerin gerade in der Rolle als Aida eine große Karriere vorauszusagen.

Die Herren konnten an diesem Abend leider das Niveau ihrer Kolleginnen auch nicht im Ansatz erreichen. Am ehesten gefiel noch der mexikanische Bariton Juan Orozco als Amonasro, der immerhin schon an der Deutschen Oper am Rhein reüssiert hat. Mit seiner kraftvollen Stimme und seinem engagierten Spiel wusste er besonders in der Auseinandersetzung mit Aida im 3. Akt zu punkten. Mario Zang als Radames mühte sich redlich, die anspruchsvolle Tenorpartie mit Kraft und leidenschaftlichem Einsatz auszufüllen. Der Stimme des kanadischen Tenors fehlt es aber leider an Pianokultur und der Kunst des mezza voce. Selbst in dem herrlichen Schlussduett der Oper, in dem Aida und Radames ihrem Tod entgegensehen, musste der Kanadier zu unschönen und gepressten Fortetönen greifen, um seinen Gesangspart überhaupt über die Rampe zu bringen. Rainer Zaun als Ramphis und Bart Driessen als König mit recht sonorer Bassstimme komplettierten ein Sängerensemble, aus denen die beiden Damen deutlich herausragten.

Rodrigo Tomillo leitete Chor, Extrachor und Philharmonisches Orchester Hagen aufmerksam und umsichtig. Nachjustierungen bei den Streichern und bei der Abstimmung der einzelnen Stimmgruppen besonders im Frauenchor sowie die Verbesserung der Koordination von Bühne und Orchester werden bei den nächsten Aufführungen sicherlich zu einer weiteren Steigerung des Hörgenusses beitragen. Auch so muss man aber konstatieren, dass dem Theater Hagen mit dieser Aida-Produktion eine für ein so kleines Haus bewundernswerte Leistung gelungen ist.
Die Premierenbesucher im leider nicht ganz ausverkauften Rund feierten alle Beteiligten mit stürmischem Beifall. Wer genau hinhörte, dem fiel natürlich auf, dass sich dieser Beifall bei Julia Faylenbogen und Andiswa Makana zum Orkan steigerte. Und das völlig zu Recht!
Norbert Pabelick 4.3.2018
weitere Aufführungen: 9.3./18.3./28.3./15.4./5.7.
Schöne Bilder von Klaus Lefebvre
ORLANDO PALADINO
Premiere: 3.2.2018
Mit Asterix-Einschlag
Die Opern von Joseph Haydn werden nicht eben häufig gespielt. Immerhin wies eine Schallplattenserie in den siebziger Jahren (Dirigent: Antal Dorati) auf die musikalischen Qualitäten der Werke hin. Doch bis auf die quirlig-futuristische „Welt auf dem Monde“ (“Il mondo della luna“) sind all die Werke stofflich doch zu sehr dramaturgischen Klischees des 18. Jahrhunderts verhaftet. Haydn dürfte das selber gespürt haben. Als er nämlich Mozarts Bühnenwerke kennengelernt hatte, schrieb er selber keine Opern mehr.

„Orlando paladino“ wurde 1782 auf Schloss Esterházy uraufgeführt. Eigentlich sollte dies in Gegenwart des russischen Großfürsten Paul und seiner deutschen Gemahlin Maria Fjodorowna geschehen, doch kam der Besuch dann doch nicht zustande. Die Premiere geriet gleichwohl erfolgreich, dreißig Aufführungen folgten in den nächsten beiden Jahren. Das Werk wurde auch in Deutschland rasch bekannt und wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein gespielt. Um dann aber ganz in der Versenkung zu verschwinden. Das „eroicocomico“-Prinzip verlor ganz einfach an Reiz. 1932 wurde der „Orlando“ für Leipzig exhumiert, auch andere Bühnen griffen wieder zu. Doch wohl erst die Gesamtausgabe der Werke Haydns (1972/73) sicherte bleibendes Interesse, woran die oben erwähnten Schallplatteneinspielungen sicher nicht geringen Anteil hatten.
Der Originaltitel von „Orlando paladino“) klingt vornehm, dem deutschem („Ritter Roland“) eignet, auch wegen der beiden anlautenden „R“s, eine gewisse Ironie Wenn man die höchst verwirrende Inhaltsangabe der Haydn-Oper gelesen hat, ist es überhaupt nicht vorstellbar, dass der Stoff ohne eine solche auf der Bühne zu verwirklichen ist. Er stammt weitgehend aus Ariosts Epos „Orlando furioso“ und bietet säbelrasselnde Helden, schmachtende Frauen, tölpelhafte Dienerchargen. Das summiert sich zu einem Personal, dem mit heutigem psychologischen Anspruch auch nicht das Geringste abzugewinnen ist.

Haydns reiche Musik, welche in Szenen mit Leidensanstrich besondere Höhepunkte bietet, adelt die Oper natürlich. Aber auch Nikolaus Harnoncourt, welcher das Werk zweimal konzertant bot (Wien 2002, Graz 2005, jeweils CD-Mitschnitte vorhanden), sah in „Orlando paladino“ primär eine „total durchgedrehte“ Oper, welche bis an die Grenze der Karikatur geht, aber „für jede Figur den (rechten) Ton findet“.
Das Karikaturistische dominiert bei Regisseur Dominik Wilgenbus in Hagen stark (nicht zuletzt in seiner eigenen wortkessen Librettoübersetzung). Aber sowohl Angelica als auch ihr Geliebter Medoro dürften ihre schwermütigen Arien, in denen Todesbereitschaft glimmt, in Ruhe und Würde aussingen, was Cristina Riccardi und Musa Nkuna auch herzerwärmend tun. Bei den männlichen Erzfeinden Roland und Barbarenherrscher (!) Rodomonte gönnt er sich aber deftige Rollenprofile, was Kenneth Mattice (Rodomonte) mit rauem Gestampfe und wilder Mimik besonders drastisch umsetzt und mit seinem kernigen Bariton vokal unterstreicht. Eric Laporte gibt sich zunächst relativ zivil, was mit seinem lyrischen Tenor harmoniert. Aber in der Folge demonstriert auch er darstellerisches Donnergrollen.
Einen starken Kontrast zu diesen wilden Kerlen bilden die Schäferin Eurilla und Rolands Knappe Pasquale, sie unermüdlich auf „den Einen“ aus, er mit ständig knurrendem Magen nach jeder sich bietenden Mahlzeit grapschend. Dass beide sich schließlich in Liebe finden, ist Buffonorm. Dorothea Brandt (mit etwas zerzauster Frisur und bebrillt) sowie Guilio Alvise Caselli singen und spielen diese Turbulenzen ganz entzückend.

Als wichtige Figur im „Roland“-Personal ist die Zauberin Alcina nachzutragen. Mit der gleichnamigen, emotional ausladenden Figur bei Händel ist sie nicht vergleichbar. Sie ist lediglich Drahtzieherin und helfende Hand in dem ganzen Liebes-Durcheinander, ohne eigene erotische Ziele zu verfolgen. Ihre letzte „gute Tat“ ist, dass Roland im Unterweltreich Charons von seiner Liebesraserei für Angelica befreit wird, so dass einem lieto fine nichts mehr im Wege steht. Kristine Larissa Funkhauser gibt die Mezzopartie mit Raffinesse.
Einige der genannten Sänger sind Gäste am Theater Hagen, was die Produktionskosten fraglos gesteigert hat. Aber zwei kleinere Partien konnten unschwer aus dem Chor besetzt werden: Matthew Overmeyer gibt den Schäfer Licone und Egidius Urbonas – mit Würde - den Charon.
Stumme Statisten agieren als Bäume oder suggerieren mit Stoffbahnen Meereswellen. Das lediglich aus einem leeren Wandrund bestehende Bühnenbild Peter Engels, vor dem sich die heitere Kostümkollektion von Christiane Luz apart abhebt, wird mit transportablen „Ortskennzeichen“, Schwertern und anderen Requisiten belebt. Sehr witzig diverse Videos. Zur Ouvertüre inszeniert Wilgenbus Szenen mit dem Knaben Roland, der unerschrocken gegen ein Ungeheuer kämpft und dafür von einer kleinen Prinzessin mit einem Trank tristanesk belohnt wird. Der Knabe betritt am Schluss noch einmal die Szene: ist Roland etwa wieder zum unschuldigen Kind geworden?

Die nahezu dreistündige Aufführung besitzt viel Charme, sorgt mit ihren optischen Einfällen für ständige Heiterkeitsreaktionen im Publikum Der Premierenbeifall war enorm. Er schloss mit Recht auch die Leistung des Philharmonischen Orchesters Hagen ein. Historische Musizierpraxis stand von vorneherein nicht zu erwarten, aber die von Joseph Trafton erarbeitete, sehr lebendige Interpretation macht das Werk auf vergnügliche Weise erlebbar. Gerne erinnert man sich bei dieser Gelegenheit daran, dass vor Jahren auch Henry Purcells „Fairy Queen“ in Hagen eine mustergültige Produktion erfuhr.
Haydns „Orlando paladino“ steht übrigens im April in Bielefeld und im Juli bei den Münchner Opernfestspielen zu erwarten.
Christoph Zimmermann (4.2.2018)
Bilder (c) Theater Hagen / Klaus Levebvre
Tosca
Premiere: 28.10.2017
Wahn und Wirklichkeit

Vor kurzem war im Fernsehen nochmal der zweite “Tosca“-Akt aus Covent Garden 1964 mit Maria Callas zu sehen. Die Diva durchfieberte, durchlitt ihre Szenen. Wie die (nicht aufgezeichneten) Rahmenakte der Zeffirelli-Inszenierung aussahen, kann man sich ausmalen: naturalistisch bis ins letzte Detail, auf die Impulsivität der großen Sängerdarstellerin zugeschnitten. Keine Folgeinszenierung dürfte sich von solcher melodramatischen Ästhetik gänzlich abgenabelt haben. Die veristische Glut der Musik packt ja auch stets aufs Neue, und der Nervenkitzel des Sujets verliert sich nicht.

Nun bringt das Theater Hagen, zehn Jahre nach der letzten Produktion, das Werk neu heraus. Eine stark umjubelte Premiere. Dem neu bestallten Dirigenten Joseph Trafton hätte man gerne noch phonstärkere Ovationen gegönnt. Wie er nämlich aus dem Hagener Orchester wirklich ein „philharmonisches“ formt (offizieller Name: Philharmonisches Orchester Hagen) besitzt durchaus Ereignischarakter. Die sicher geblasenen Hornfanfaren zu Beginn des 3. Aktes, die heiklen Cello-Soli – erstaunliche Einzelleistungen. Vor allem jedoch versteht es der junge amerikanische Maestro einen satt brodelnden Verismo-Sound zu erzeugen und diesen dann mit subtilen Farbfeldern aufzulichten. Traftons außerordentliche Leistung sollte auch von allen Verantwortlichen wahrgenommen werden, welche über die gefährdete Zukunft des Hauses zu entscheiden haben.

Die Inszenierung stammt von Roman Hovenbitzer, ständiger Regiegast am Theater Hagen. Auch er verzichtet nicht auf werktradierte Deutungsansätze. Doch lenkt er den Blick des Zuschauers sofort auf einen in der linken Loge platzierten Schminktisch Toscas (Bühne: Hermann Feuchter). An ihm verbringt die Diva nahezu ihr ganzes Leben, weitgehend abgeschottet von den Wirrnissen jenseits der Bühne. Auch der Maler Cavaradossi ist ein sich verzehrender Künstler, wenn auch nicht ganz so weltabgewandt (er durchschaut Scarpias Machenschaften und kennt den politischen Rang von Angelotti). Dennoch flüchtet er mit seiner Geliebten in ein fragwürdiges Glücklichsein, welches – da nicht genügend geerdet – stets Gefahr läuft, von brutaler Realität unterhöhlt zu werden.

Im Programmheft ist ein Beitrag des Regisseurs Willy Decker zu seiner Stuttgarter „Tosca“-Inszenierung 1998 abgedruckt (Konzept wie in den vorangehenden Zeilen beschrieben). Auf deren Grundidee nimmt Hovenbitzers Arbeit offenkundig Bezug. Die Hagener Aufführung beginnt musiklos mit einer Verbeugung Toscas (plus Partner) im Hintergrund, gerichtet an ein imaginäres Auditorium, welches im Hagener Zuschauerraum zu sitzen scheint. Dieser Vorgang wiederholt sich später noch einmal.
Der 3. Akt ist in Hagen dann wirklich ganz große Show, bei der sich Wirklichkeit und Halluzination mischen. Der eigentlich tote Lüstling Scarpia übernimmt die Rolle des Schließers, wird von der Kostümbildnerin Anna Siegrot mit schwarzen Flügeln in einen Todesengel verwandelt, lenkt - Charon gleich - die Liebenden auf einem Boot, zu welchem nun ein schon vorher symbolisch genutztes Riesenkreuz geworden ist, in die vermeintliche Freiheit.

Das Hagener Publikum zeigte sich von der eigenwilligen Deutung fasziniert, war es auch von der Ausstattung Hermann Feuchters. Diese arbeitet auf der von „Gefängnis“wänden umstandenen Bühne vor allem mit bemalten Gazeschleiern, darauf zu sehen mal Realistisches wie die Kirche Sant’ Andrea della Valle, mal ein fratzenhaftes, dämonisches Gesicht. Am unteren Rand liest man „L’arte è figlia della libertà. Der Sprung Toscas von der Engelsburg wird nota bene filmisch gezeigt – Macht des Theatralischen selbst noch im Tod.
Veronika Haller gibt die Titelpartie mit Herzblut und emotionaler Attacke, dabei im vokalen Ausdruck genügend differenziert. In der runden Formung von Spitzentönen ist ihr Xavier Moreno um Einiges voraus. Der spanische Tenor gestaltet den Cavaradossi aber nicht nur mit Forteprunk, sondern auch mit viel Piano-Verständnis, ist zudem ein überzeugender Darsteller. Karsten Mewes war in Hagen (und ist weiterhin) Wagners Holländer. Den Scarpia gibt er einigermaßen chevaleresk, ohne schwarze Dämonie. Aber damit entgeht er der Gefahr von Übertreibung und Vordergründigkeit. Starke Comprimarii: Kenneth Mattice (Angelotti) und Rainer Zaun (Mesner), zutreffend agieren Richard Van Gemert (Spoletta) und Dirk Achille (Sciarrone). Sopranlieblich tönt der Hirt von Celina Igelhorst aus dem Off. Chor (Wolfgang Müller-Salow) und Kinderchor sind untadelig, tragen ebenfalls zur starken Wirkung des Abends bei.
Christoph Zimmermann (29.10.2017)
Bilder (c) Theater Hagen
IN DEN HEIGHTS VON NEW YORK
Premiere am 17.9.2017
Großes Broadway Theater

Am New Yorker Broadway ist Lin-Manuel Miranda mit seinem Werk „Hamiton“ derzeit wohl der angesagteste und erfolgreichste Komponist der letzten Jahrzehnte. Doch bereits sein erstes Broadway Musical „In the Heights“ wurde 2008 gleich mit vier Tony Awards für Beste Komposition, Beste Orchestrierung, Beste Choreographie und Bestes Musical ausgezeichnet. Nun ist das Werk am Theater Hagen erstmals in Deutschland im professionellen Bereich zu sehen, nachdem es vor einigen Jahren bereits in Wien in deutscher Sprache aufgeführt wurde. Ein aus vielerlei Hinsicht sehr ambitioniertes Projekt für dieses vergleichsweise kleine Haus.
Vorab eine kleine „Warnung“ an alle begeisterten Opernfreunde, es handelt sich hierbei um ein „Hip-Hop- & Latin-Musical“, man sollte also auf jeden Fall bereit sein, sich auf neues und teilweise komplett unbekanntes Terrain zu begeben. Ich gebe zu, ich liebe Musical und ich hasse Rap und Hip-Hop, hier ist es aber gelungen mich komplett einzufangen, was sicherlich auch an der wirklich guten Komposition liegt, an der man bereits erkennen kann, warum erwähntes „Hamilton“ derzeit der Hit der letzten Jahre ist und warum das Cast-Album zu „In the Heights“ 2009 mit dem Grammy Award ausgezeichnet wurde. Aber auch die Inszenierung und das Ensemble trugen gestern Abend dazu bei, dass der Funke bei mir und dem gesamten Premierenpublikum schnell übersprang. Viele Abonnenten wunderen sich hierbei lautstark über die vielen „jungen Leute“ im Theater, vielleicht ist dieses Stück daher für das Theater Hagen ein echter Glücksgriff zum Start in die neue Intendanz und in eine Zeit, wo mit extremen Kürzungen das Beste aus den gegebenen Mitteln herauszuholen ist? Zu wünschen wäre dem Theater Hagen hier ein Erfolg, der auch überregional wahrgenommen wird.

Das Musical spielt in den Washington Heights, dem Stadtteil von New York benannt nach dem Lager von George Washington, welches er mit seinen Truppen während des Unabhängigkeitskrieges nördlich von New York aufschlug. Heute ist das Viertel überwiegend bevölkert von Immigranten aus Puerto Rico und der Dominikanischen Republik sowie vielen Afro-Amerikanern. So betreibt Kevin Rosario hier einen Taxibetrieb, bei dem auch Benny arbeitet. Dieser ist unsterblich in Kevins Tochter Nina verliebt, allerdings ist für den traditionellen Vater eine Verbindung seiner Tochter mit einem Afro-Amerika jenseits aller Toleranzgrenzen, zumindest zunächst. Usnavi betreibt gleich nebenan eine Bodega in Form des zentralen Kioskes im Bezirk, wo ein jeder gerne seinen „Cafe con leche“ kauft. Kurz nachdem bekannt wurde, dass ein Einwohner des Stadtteils in der Lotterie 96.000 Dollar gewonnen hat legt ein langer Stromausfall den Bezirk teilweise lahm, die Einwohner lassen sich hiervon aber nicht abhalten, das Beste aus Ihrem nicht immer einfachen Leben zu machen.

Die Produktion in Hagen entstand in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück, so sind fast alle Rollen bis auf wenige Ausnahmen mit Absolventen und Studierenden der Hochschule besetzt. Ein wahrer Glücksgriff, den allein von den Rollenauslegungen dürfe „In the Heights“ ansonsten von keinem Theater hierzulande entsprechend aufzuführen sein. Besonders bleibenden Eindruck hinterlassen hierbei Felix Freund als Usnavi de la Vega, Aniello Saggiomo als Sonny, Annina Hempel als Friseursalon-Besitzerin Daniela und Celena Pieper als Usnavis heimlicher Schwarm Vanessa. Kara Kemeny hat als Nina Rosario die gesanglich wohl schwierigste Rolle, da verzeiht man ihr auch gerne, dass bei der Premiere an zwei, drei Stellen die Töne noch nicht so richtig saßen. Vom Ensemble des Theaters Hagen glänzt KS Marilyn Bennett als Abuela Claudia, die glaubwürdig die liebenswerte Oma und gute Seele des Barrios gibt. David B. Whitley gibt den Benny mit souliger Stimme. Der Opernchor unterstützt die vielen Darsteller in den großen Massenszenen, so dass die Heights ein wirklich sehr belebtes Stadtviertel abgeben.
Aufgeführt wird „In den Heights von New York“ übrigens komplett in deutscher Sprache in der Textfassung von Laura Friedrich Tejero. Dies wirkt insbesondere beim Rap zu Beginn des Stückes noch recht befremdlich und an der ein oder anderen Stelle ist die Übersetzung auch noch etwas holprig, allerdings hilft es dabei, dass jeder Besucher der Geschichte gut folgen kann und weitestgehend ist die Übersetzung dann auch schlüssig und stimmig. Vollkommen überzeugen kann die Inszenierung von Sascha Wienhausen, der an der Hochschule Osnabrück auch für den Bereich Pop- und Musicalgesang verantwortlich ist. Hier paart sich eine perfekte Personenregie mit einem guten Gespür für eine schlüssige Erzählweise, hier erlebt der Zuschauer ein Paradebeispiel für ganz große Musicalregie. Die passenden Kostüme und die Bühne (sehr schön mit der Washington Bridge im Hintergrund) stammen von Ulrike Reinhard. Für die vielen großen Choreographien zeichnet sich Sean Stephens verantwortlich, der auch das Ballett des Theaters Hagen oft und gut ins Geschehen eingebunden hat. Das Philharmonische Orchester spielt unter der musikalischen Leitung von Steffen Müller-Gabriel den für dieses Orchester sicher ungewohnten Sound mit großer Spielfreude.

Abschließen möchte ich an dieser Stelle mit den Worten des neuen Intendanten Francis Hüsers aus der aktuellen Theaterzeitung: „Der Wechsel der künstlerischen Leitung (…) muss daher auch Neues möglich machen, denn täte es das nicht, wäre er künstlerisch verschenkt. In diesem Sinne freue ich persönlich mich auf einen behutsamen Neustart (…) mit einer Spielzeit, die bewusst an die Vergangenheit anschließt, gleichzeitig aber schon Neuheiten erlebbar machen wird.“ Auch wenn der Spielplan zum Zeitpunkt seiner Wahl bereits feststand, hier kann man nur hoffen, dass die Qualität dieses Abends über die kommenden Jahre gehalten werden kann, auch wenn das Werk musikalisch sicher nicht jedermanns Geschmack ist, eins ist es aber ganz gewiss, eine gut inszenierte Rarität und etwas ganz „Neues“ auf deutschen Bühnen, dafür ein großes Lob nach Hagen
Markus Lamers, 17.09.2017
Fotos: © Klaus Lefebvre
Geschichten aus dem Wienerwald
Premiere m 24.6..2017
Besuchte Zweitvorstellung 30.6.2017
Abschied eines Intendanten

Die jüngste Oper von HK Gruber am Theater Hagen ist die dritte Produktion nach der Bregenzer Uraufführung 2014 (die auch in Wien zu sehen war) und einer Inszenierung an der Komischen Oper Berlin. Sie markiert den Abschied des Intendanten Norbert Hilchenbach von dem kleinen NRW-Theater, welches (nicht nur) während dessen zehnjähriger Amtszeit immer wieder mit engagierten, manchmal ausgesprochen spektakulären Aufführungen aufwartete. Engagiert widmete sich man immer auch dem zeitgenössischen Opernschaffen, wagte sogar etliche Novitäten wie zuletzt Ludger Vollmers „Tschick“. Nicht nur Hilchenbach geht, sondern auch etliche andere, teilweise lang gediente Mitarbeiter des Hauses. Das bedeutet keine natürliche Fluktuation, sondern einen auch demonstrativ gemeinten Abschied. Die Stadt sitzt am Geldhahn und dreht(e) diesen langsam zu, so dass wieder einmal vom Ende dieses in der hiesigen Theaterlandschaft so wichtigen Hauses gemunkelt wurde. Mit Francis Hüsers wurde nun aber erst einmal ein neuer, sich engagiert gebender Intendant berufen. Es war auch zu hören, dass die finanzielle Daumenschraube (eigens für ihn?) mittlerweile ein wenig gelockert wurde.

Vor der gesehenen zweiten Aufführung der „Geschichten aus dem Wiener Wald“ trat Norbert Hilchenbach nochmals vor den Vorhang, um sich zu verabschieden, für Besuchstreue zu danken und um Sympathien für das Haus auch in Zukunft zu werben. Nach der dreistündigen Aufführung spendete das Publikum freundlichen Beifall, der von der Bühne aus freilich künstlich etwas gelängt wurde; für die zentrale Sängerin Jeanette Wernecke kamen sogar leise Bravos auf. Aber gefüllt war das Haus mitnichten, einige Zuschauer verließen sogar während der Vorstellung den Saal, andere kamen nach der Pause nicht wieder. Aber das ist bei einem zeitgenössischen Werk hinzunehmen (bei dem kompositorisch eher zahmen Gruber wunderte es freilich), und das Theater Hagen hat sich seine Kreativität wegen so etwas nicht vermiesen lassen

Von Ödön von Horvaths 1931 in Berlin herausgekommenen, hellseherischen Volksstück (in der Figur des steifen Nationalisten Erich leuchtet das Dritte Reich bereits unheilverkündend auf) heißt es immer wieder, dass seine Sprache Musik in sich trage. Ist da eine „Wienerwald“-Oper überhaupt noch notwendig? Die „Neue Musikzeitung“ bezeichnete nach der Bregenzer Premiere das Werk als „arg verspätete Zeitoper“, die „Nachtkritik“ resümierte über die Musik: „Macht zwar das Stück nicht besser, als es eh schon ist, aber vertont angemessen.“
Was das Schauspiel Horváths betrifft, so erinnert sich der Rezensent zumindest noch umrisshaft an eine Verfilmung von Erich Neuberg aus dem Jahre 1961, u.a. mit Johanna Matz, Hans Moser, Helmut Qualtinger, Erich Kohut, Jane Tilden, Lotte Lang und Fritz Eckart (einige der Darsteller wirkten 1979 auch in dem Streifen von Maximilian Schell mit). Das waren alles Schauspieler, welche verstanden, den sprichwörtlichen Wiener Charme mit seiner ebenso sprichwörtlichen Bösartigkeit zu verbinden. Vor allem Kohut war der richtige Typ, hinter dem Charmeur Alfred auch einen am Leben vorbei flanierenden, letztlich gefühlskalten Macho erkennen zu lassen. Kenneth Mattice in Hagen ist mit seinem festen, dabei immer geschmeidigen Bariton und seiner attraktiven Erscheinung ein Kerl, der Frauen unweigerlich anzieht. Aber ihm fehlt die zerstörerische Kälte, die freilich auch Grubers Musik kaum hergibt. Sie ist wunderbar pittoresk, zitiert immer wieder auf intelligente Weise, gibt sich durchgehend ohrenfreundlich. Aber sie wirkt für den hintergründigen Stoff allzu glättend und unverbindlich. Florian Ludwig sorgt mit dem Philharmonischen Orchester Hagen freilich für rhythmische Verve und theatralische Lebendigkeit.

Die Bühne von Jan Bammes bietet ein symmetrisch aufragendes Wandrund mit Türdurchlässen, im Detail wandelbar, ohne dass dabei wirklich couleur locale erzeugt würde. Das dominierende Dunkelgrau bewirkt eine Art Dauertristesse, welche von den zeittypischen Kostümen Yvonne Forsters farblich etwas aufgehellt wird. Mit gekonnter, unforcierter Personenführung gefällt Hilchenbachs Inszenierung durchgehend, lässt sogar den überlangen 1.Akt ausreichend lebendig erscheinen. Den Nachteil der etwas beliebigen Musik vermag seine Arbeit freilich nicht zu kompensieren.
Immerhin setzten einige Sänger charaktervolle Akzente. Die Valerie von Kristina Larissa Funkhauser beispielsweise ist ein Vollweib mit viel erotischem Esprit, vokal exzellent. Martin Blasius gibt mit seinem raumfüllenden Bass ein plastisches Porträt des zwielichtigen Zauberkönigs. Für den stets einen Gottesspruch auf den Lippen tragenden Oskar, der seiner „gefallenen“ Marianne in grausamer Selbstgefälligkeit verzeiht, ist Philipp Werner mit seiner pyknischen Körperlichkeit und dem leicht trompetenhaften Tenor eine ausgesprochen rollenstimmige Besetzung.

Den Erich gibt Björn Christian Kuhn ebenso als Ekelpaket wie Marilyn Bennett Alfreds gefühlskalte Großmutter. Jeanette Wernecke wurde bereits erwähnt. Sie besticht mit einer superschlanken Erscheinung, welche sich im 3. Akt (Maxim „Ballett“) die Fast-Nacktheit einschränkungslos leisten kann. Weiterhin besitzt sie einen mädchenhaft klaren Sopran, welcher die Naivität der sich nach Liebe und Leben sehnenden Marianne ideal vermittelt. Ihr (reichlich gedehnter) Monolog „Gott, was hast du mit mir vor?“ rührt an. Überzeugendes kommt auch von Joslyn Rechter (Alfreds Mutter), Andrew Finden (Rittmeister/Beichtvater), Richard Van Gemert (Hierlinger Ferdinand) und Rainer Zaun (Mister). Ein erneuter, großer Leistungsbeweis des Hagener Theaters, dem man alles erdenklich Gute wünscht, damit es seine aktuelle Gefährdung glücklich übersteht.
Christoph Zimmermann 1.7.2017
Bilder (c) Theater Hagen
Der fliegende Holländer
Premiere: 6.5.2017
Wasserspiele
Dem Theater Hagen steht sozusagen das Wasser bis zum Hals. So kann man die Ausstattung von Peer Palmowski für Wagners „Holländer“, eine total überflutete Bühne, als Symbolbild ansehen. Alle Sänger sind am Schluss klitschenass. Beim Schlussapplaus schützt sich Senta mit einem Frotteetuch auf dem Kopf gegen die Gefahr einer Erkältung, endet sie doch als Wasserleiche. Auch Dirigent Mihhail Gerts, Chorchef Wolfgang Müller-Salow und das szenische Produktionsteam müssen mit weißen Stiefeln durch die Fluten stapfen.

Die regieführenden Schwestern Beverly und Rebecca Blankenship (erstere mit „Freischütz“ bereits 2010 in Hagen vorstellig) betrachten die Bühne als „psychologischen Spielraum“; die Konzeptbeschreibung ihrer Inszenierung wirkt allerdings einigermaßen überpsychologisiert. Manche Interpretationsansätze haben Einiges für sich. Zitiert sei aus dem Programmheft der wohl plausibelste Gedanke: „Der Holländer, das Fremde, der Schatten, ist gefürchtet und gleichzeitig unendlich begehrenswert. (Er) ist das innerste Fürchten und Sehnen der Gemeinschaft.“ Ansonsten eher abgehobene Deutungen. In der Aufführung finden sich zudem kaum Szenen, in denen sie zu wirksamem Bühnenleben erweckt werden. Gleich zu Beginn dünkt man sich bei Humperdincks „Hänsel und Gretel“ gelandet: „Sieh nur artigen Kinderlein. Wo mögen die hergekommen sein?“ Kids plantschen während der Ouvertüre nämlich im Wasser herum. Unumwundenes Eingeständnis, hinter den tieferen Sinn dieses gewiss bedeutungsvollen Bildes nicht gekommen zu sein.

So sei lieber auf die musikalische Akzentsetzung eingegangen, wie von Mihhail Gerts bei den ersten Takten sogleich mit Sturmesgewalt realisiert. Die Ouvertüre beginnt er schneidend wie mit einem Flammenschwert; auch später romantische Konvulsionen. Das Philharmonische Orchester Hagen folgt ihm mit einer Spielqualität wie schon lange nicht mehr erlebt. Auf dem ersten Rang wirkt der Klang fraglos unmittelbarer als im Parkett, wo sich üblicherweise der Platz des Rezensenten befindet. Das mag ein dramatisches „Plus“ bewirken. Aber an diesem Ort hört man auch spielerische Defizite deutlicher, derer es am Premierenabend durchaus einige gab, die aber vor der überrumpelnden Gesamtwirkung verblassten. Der Beifall für den Dirigenten hätte gerechterweise Ovationsstärke annehmen müssen.

Zurück zur Inszenierung. Wo gibt es Überzeugendes? Vielleicht bei der Senta-Ballade, wo einige Choristinnen sich in somnambulen Verzückungen ergehen (freilich bereits in der ersten Strophe, was eindeutig zu früh ist). Dass der Holländer bei seiner Begegnung mit Senta aus den mit Nebelschwaden bedeckten Fluten auftaucht, bewahrt die Szene vor simplem Realismus. Eriks Auftritt zeigt eine zärtliche Bindung an Senta, die auch von ihrer Seite aus deutlich wird. Dieser Akzent führt freilich in die Irre. Dalands Tochter ist ja schon längst dem Fremden (Holländer) verfallen, wenn auch zunächst nur seinem Bild, in welchem sich all ihre außenseiterischen Begehrlichkeiten konzentrieren.

Im 3. Akt brennt ein riesiges Feuer inmitten des Wassers, offenkundig eine Kopie des Steilneset Memorial, Gedenkstätte für die Hexenverbrennungen in der Finmark im 17. Jahrhundert. Aber auch dieses Bild (dessen Bedeutung man keineswegs auf Anhieb erkennen muss) verliert sich im Abseits. Und schlussendlich ist zu fragen, warum das fraglos deutungsgewichtige Element des Wassers (neben allen möglichen Dämpfen) unbedingt real gezeigt werden muss. Projektionen hätten das intendiert Irreale gleichwertig und wahrscheinlich sogar stimmiger visualisiert. Personenregie ansonsten: so la-la. In der Premiere schwache, aber doch deutliche Bekundungen von Ablehnung.

Bei den Sängern entlud sich der stärkste Beifall auf Mirko Roschkowski. Der Gast-Erik demonstriert in der Tat bestes Belcanto mit dramatischer Emphase, wie es seine Partie erfordert. Sein Tenorkollege aus dem Ensemble, dessen Name besser nicht genannt sei, belastet die Rolle des Steuermanns mit qualvoll verquetschten Vibratotönen. Rena Kleifeld gibt eine mezzosatte Mary, Rainer Zaun einen schlitzohrigen Daland mit manchmal reichlich plakativem Gesang. Eine wirklich große Holländer-Aura mag Joachim Goltz fehlen. Dass aber das Wagner-Fach zu seinem festen Repertoire gehört, macht die intensive Darstellung deutlich. Nicht ohne Anstrengung bewältigt Veronika Haller die Senta, aber das mädchenhafte Flair ihrer Gestaltung nimmt sehr für sie ein.
Man spielt die pausenlose „Holländer“-Version ohne die „Erlösungs“-Passagen.
Christoph Zimmermann 7.5.2017
Bilder (c) Theater Hagen
Tschick
Premiere: 18.3.2017
Kommensurabel für Erwachsene wie für Jugendliche

Wenn ein kleines, zudem extrem gefährdetes Theater wie das von Hagen in einer Spielzeit gleich zwei Werke des aktuellen Musiktheaters präsentiert, ist kaum ein Wort des Lobes zu hoch. Intendant Norbert Hilchenbach wird im Juni HK Grubers „Geschichten aus dem Wiener Wald“ zu seinem Abschied inszenieren, jetzt gab es mit „Tschick“ von Ludger Vollmer sogar eine veritable Uraufführung. Zu dieser kam es nicht von ganz ungefähr, denn auch Vollmers Opern „Gegen die Wand“ und „Lola rennt“ wurden in Hagen aufgeführt. In dieser Saison ist Vollmer überdies „Komponist für Hagen“, kommt also auch bei Konzerten des Philharmonischen Orchesters zu Ehren.

„Tschick“ ist ein Erfolgssujet sondergleichen. Der Roman von Wolfgang Herrndorf wurde sogar zur allgemein verbindlichen Schullektüre erkoren, überdies zu einem der meistgespielten Theaterstücke umgeformt (Autor: Robert Koall) und von Fatih Akin auch verfilmt. Auslöser für Herrndorfs Roman war das Wiederlesen von Büchern seiner Jugend, nicht zuletzt von Mark Twains „Huckleberry Finn“. Herrmdorf wollte gemäß einem FAZ-Interview „herausfinden, ob sie wirklich so gut waren, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber auch, um zu sehen, was ich mit zwölf Jahren eigentlich für ein Mensch war. Und dabei habe ich festgestellt, dass alle Lieblingsbücher drei Gemeinsamkeiten hatten: schnelle Eliminierung der erwachsenen Bezugspersonen, große Reise, großes Wasser.“ Das Wasser ersetzte Herrndorf in „Tschick“ durch Straßen, welche sein Titelheld mit Freund Maik in einem geklauten Wagen abenteuerlustig befahren.

Diesem Roman folgte noch eine Fragment gebliebene Fortsetzung („Bilder deiner großen Liebe“), welche allerdings erst nach dem Tod des Autors erschien. 1965 geboren, wählte Herrndorf 2013 den Freitod, weil er mit der Diagnose eines unheilbaren Gehirntumors nicht weiterleben wollte. Ein wenig Traurigkeit prägt auch den Roman, doch im Wesentlichen ist er das Hohelied auf eine Glücksfindung von Menschen, auch wenn diese auf misstrauisch beäugten Nebenpfaden stattfindet.
Maik und der Russland-Aussiedler Tschick gelten in ihrer gemeinsamen Schulklasse als Außenseiter. Kein Mobbing, aber mitleidslose Ausgrenzung. In seinem Elternhaus findet Maik keinen Rückhalt, welcher dem Pubertierenden gut täte. Der Vater ist ein Choleriker, die Mutter alkoholabhängig. Letzteres macht Maik irgendwann sogar in der Schule publik und gilt seitdem als Weichei und „Psycho“. Dieses Detail fehlt in der Oper übrigens wie die Tatsache, dass auch Tschick gerne mal einen über den Durst trinkt. Aber das tut dem Nachvollzug der von Tina Hartmann eingerichteten Handlung keinen Abbruch. Überhaupt muss nicht alles mit akribischer Logik ins Visier genommen werden. Dass in der 11. Szene das Oberhaupt einer rein weiblichen Familie, Frau Friedemann, verdreifacht wird, vermag nicht einmal der Komponist wirklich plausibel zu begründen. Es sei eine Entscheidung „aus dem Bauch heraus“ gewesen, so Vollmer in der Einführung vor der Premiere.

Die „Botschaft“ des Romans bleibt in der Oper so oder so eindeutig ein Loblied auf das alternative Leben, unbelastet von zivilisatorischen Regularien, von dem ständigen Insistieren, dass der Mensch im Grunde nur schlecht sei. Maik: „Das Seltsame war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war.“
Nun, ganz so leuchtend positiv muss man das Leben freilich nicht sehen. Kriminalstatistiken, Drogenszene u.a. sind - jedenfalls in der Oper - als Zeitprobleme ausgeblendet. Der Zuschauer erlebt also kein ungeschminktes Abbild von Realität. Geschilderte Fatalitäten beschränken sich auf die einander entfremdeten Eltern von Maik, wobei Ähnliches bei Sia zu vermuten steht, die sich nicht von ungefähr auf eine Mülldeponie zurückgezogen hat, wo sie von den Jungs aufgegabelt und als „Dritte im Bunde“ mitgenommen wird. Dann gibt es noch einen gewissen Horst Fricke, welcher in offenbar leicht delirischem Zustand und mit Flinte bewaffnet irgendwo im Freien und mit Erinnerungen an KZ und Ostfront haust. Kritisches wird also nicht mit Paukenschlägen verabreicht. Sogar das finale Gerichtsurteil über die Ausreißer (Tschick kommt in ein Heim, Maik muss Sozialdienste leisten - Wiedersehen nicht ausgeschlossen) wirkt milde. Ohnehin befindet Maik: „Das war der schönste Sommer meines Lebens.“ Dieses Erleben kann ihm keiner nehmen. In Hagen baumelt er zuletzt gemeinsam mit Isa und Tschick in der Luft. Dieses Bild vermittelt ein schönes Freiheitsgefühl. Es entflammt sogar Maiks trinkfreudige Mutter, welche sich radikal von Zivilisationsgerümpel befreit und dieses in ihren Swimmingpool schmeißt. Im Roman taucht sie mit ihrem Sohn selber dort unter, hält die Luft an und belächelt die verdutzten Polizisten am Rande des Beckens.

Ludger Vollmer ist ein vielseitiger Komponist, wirft gerne einen Blick auf die Generation der Jüngeren. Als auch ausübender Musiker ist er mit Klassik ebenso vertraut wie mit Jazz und Rock. In das Punk-Ambiente von „Tschick“ musste er sich aber zugegebenermaßen erst ein wenig einfühlen. Seine Musik klingt fetzig, steigert sich gerne mal in einen Forterausch. Dennoch klingen immer wieder tonale Harmonien hinein, und der Coming-Out-Monolog Tschicks wirkt mit seiner breiten Cellokantilene sogar traditionell opernhaft. Wichtig für die Wirkung von Vollmers Musik ist, dass sie einen „mitzunehmen“ versteht, dass sie in keinem Moment avantgardistisch esoterisch wirkt, was freilich durch den Stoff notwendigerweise mit bedingt ist. Aber bei der Wahl theatralischer Stoffe hat sich der Komponist seit jeher als realistisch denkend und zeitbezogen erwiesen.
Die Hagener Aufführung kann eigentlich nur in höchsten Tönen gepriesen werden. Anzufangen wäre bei Krista Burgers Grafiken und Projektionen, welche die von Jan Bammes sinnfällig ausgestattete und ständig bewegte Bühne oft zur Filmkulisse werden lässt. Dies näher zu beschreiben hieße, sich unbotmäßig in Details zu verlieren. Dies gilt auch für die Inszenierung von Roman Hovenbitzer, ständiger Gast am Theater Hagen. Also auch ihm ein lediglich pauschales, aber ganz großes Kompliment. Der einsatzfreudige Chor (Wolfgang Müller-Salow) ist hervorzuheben Die Inhaber der vielen Kleinpartien müssen an dieser Stelle hingegen ungenannt bleiben. Doch sei wenigstens erwähnt, dass eine Solistenklasse des Kinder- und Jugendchores am Theater Hagen umfänglich im Einsatz ist. In größeren Solopartien profilieren sich Marilyn Bennett und Rainer Zaun (mit ziemlich rüdem Jargon) als Maiks Eltern sowie Richard Van Gemert (Horst Fricke) und Heikki Kilpeläinen (diverse Partien).

Für die Besetzung der beiden männlichen Protagonisten, im Roman Jungs von etwa 14 Jahren, hatte Vollmer eine pragmatische Entscheidung zu treffen. Hosenrollen kamen aus guten Gründen nicht infrage. Der Komponist entschied sich also ganz kontrovers für Baritonstimmen. Das macht, wie auch die Physiognomien von Andrew Finden (Maik) und Karl Huml (Tschick, a.G.) eine Identifizierung mit den dargestellten Figuren zunächst etwas problematisch. Natürliches vokales Agieren und lebendige Darstellung besiegen anfängliche Skepsis aber schon sehr bald. Kristina Larissa Funkhausers Isa ist ein rundum glaubhafter Charakter. Mutig und ohne Peinlichkeit wagt sie sogar eine oben-ohne-Szene.
Christoph Zimmermann 19.3.2017)
Bilder (c) Theater Hagen
Zum Zweiten
Lucia di Lammermoor
2. Aufführung am 27.1.2017
Brauchbares Opernglück im kleinen Stadttheater
Immer wieder hört man, und gerade bei kleineren Häusern, dass die potentiellen Opernbesucher bei Neuinszenierungen vor dem Kartenkauf erst einmal die Kritiken abwarten. Das scheint bei der Hagener „Lucia di Lammermoor“ nicht recht geklappt zu haben; bei der zweiten Aufführung und immerhin 6 Tage nach der Premiere war das Haus nicht einmal halb voll. Das ist sehr enttäuschend, zumal die Lokalpresse mit „Belcanto-Wahnsinn“ und Hinweis auf das „Sängerwunder Cristina Piccardi“ die Produktion in den höchsten Tönen gelobt hatte. Was soll das personell und finanziell krisengeschüttelte Haus denn noch alles anstellen, um „die Bude voll zu bekommen“ ? Zumal diese Oper unbestritten einen einsamen Höhepunkt des Belcanto darstellt, eines Genres, wo die Schönheit des Gesangs im Vordergrund steht, mit prächtigen Arien oder Ensembles. Das Erlebnis dieser Musik greift aber auch, wenn die Qualität einer Aufführung nicht im obersten Bereich anzusiedeln ist; Hagen ist nicht München oder Wien, aber ein sehr achtbares Stadttheater, welches mit der Lucia eine sehr ordentliche Oper auf die Bretter gebracht hat.

Die Brasilianerin Cristina Piccardi in der Titelfigur füllt diese Rolle, an der sich seit Generationen die Sängerinnen, Dirigenten und Regisseure die Zähne ausbeißen, mit einer rundum bewundernswerten Stimme und Darstellungskraft. Sie singt sehr höhensicher, mit gestochenen Koloraturen und Spitzentönen, von denen sie – eine häufige Unsitte – keinen einzigen ausgelassen hat. Bewundernswert auch ihr Duett mit der Glasharfe (Sascha Reckert); das ging in der Empathie schon in Richtung Rückenschauer. Wenngleich ihrem hellen Sopran ein wenig mehr Wärme und Erotik gut tun würde; es fehlen ein wenig die Untertöne. Andrew Finden als Enrico erfreut mit wunderbar strömendem, warm timbriertem Bariton, mit einem sehr schönem Parlando und mit rollengerechter perfekten Bühnenpräsenz.
Sein Kontrahent Edgardo (der Chinese Kejia Xiong), seit einigen Jahren festes Ensemblemitglied, stieß an diesem Abend in diese Rolle deutlich an seine Grenzen. Die Stimme klang unfrei, eher hinten im Hals, sie war nicht optimal in der Resonanz; seine große Arie im letzten Akt geriet zur Zitterpartie, sie war nur mit großer Kraftanstrengung durchzustehen. Auch Rainer Zaun als Erzieher Raimondo fehlte an diesem Abend ein wenig vom gewohnten Bassfundament. Peter Aisher als Bucklaw und die Vertraute Kristine Larissa Funkhauser sangen und spielten einwandfrei, ebenso Matthew Overmeyer als Normanno.

Szenisch gibt es über den Abend nichts Aufregendes zu berichten, Regisseur Thomas Weber-Schallauer erzählt die Geschichte relativ belanglos entlang dem Libretto und in etwas langweiligen, von verschiebbaren Säulen eingerahmten grauen Bühnenbild (Jan Bammes), welches durch wechselnde Beleuchtung und ein paar Möbelstücke modifiziert werden kann. Auch die Personenführung könnte mehr Aktivität vertragen, man stand in Alltags-Kostümen von Christiane Lutz oft einfallslos herum, so auch im herrlichen Sextett Ende 1. Akt, oder sang bequem im Sitzen. Ob der mehr als deutliche Griff Edgardos mit einem kleinen Kreuz in der Hand unter den Rock der Lucia als Anspielung auf einen derzeit sehr bekannten Politiker gedeutet werden kann, bleibt unklar. Ebenso der Mord an Edgardo durch Normanno; im Libretto ist eigentlich ein Selbstmord vorgesehen.

Mihhail Gerts, 1. Kapellmeister des Hauses, hatte eingangs einige Mühe, das Orchester zusammenzuhalten und mit der Bühne zu synchronisieren; das gab sich im zweiten Teil deutlich besser. Auch der Chor (Wolfgang Müller-Salow) geriet erst spät so richtig in Fahrt. Das Publikum war nach dem langen stehenden Applaus auf jeden Fall mehr als zufrieden. Zumal diese Musik viel zu schön ist, um sich über irgendwelche Kleinigkeiten zu ärgern und dann verdrossen nach Hause zu gehen.
Michael Cramer 28.1.17
Fotos © Andrew Finden
Lucia di Lammermoor
Premiere: 21.1.2017
Szenisch schwierige Oper, in Hagen aber dicht und atmosphärisch
Das Theater Hagen lebt derzeit in Ungewissheit angesichts finanzieller Unwägbarkeiten. Intendant Norbert Hilchenbach wird (altersbedingt) gehen, GMD Florian Ludwig ebenfalls. Gemeinsam erarbeitet man am Ende der Spielzeit aber noch HK Grubers „Geschichten aus dem Wienerwald“, was zusammen mit der Uraufführung von Ludger Vollmers „Tschick“ im März demonstriert, wie sehr sich das Haus immer wieder auch zeitgenössischem Opernschaffen öffnet. Das und auch anderes an Engagement macht einem dieses Theater so sympathisch. Jetzt aber kamen die Melomanen unter den Opernfreunden wieder einmal auf ihre Kosten: nach gut einem Vierteljahrhundert stand Donizettis „Lucia di Lammermoor“ auf dem Programm. Diese Oper wählt man in der Regel nur, wenn eine besondere Sängerin vorhanden ist. In Hagen steht sie mit Cristina Piccardi zur Verfügung.

Die junge Brasilianerin verfügt über alle notwendigen Raffinements für die „Wahnsinns-Person“: superbe Höhe, sensible Kantilene, perfekte Staccati, saubere Triller. Weiterhin überzeugt sie mit Aussehen und Spiel. Das Hagener Premierenpublikum feierte die Jung-Primadonna ausgiebig und sparte auch sonst nicht mit Beifall, zu Recht. Er galt aber wesentlich auch dem jungen estnischen Dirigenten Mihhail Gerts (seit kurzem 1. Kapellmeister des Hauses), welcher mit dem Philharmonischen Orchester Hagen Donizettis Musik sensibel umsetzte, aber auch ihr dramatisches Heißblut nicht vernachlässigte. Dass es in der Hörnergruppe schon mal kleine Probleme gab, sei der Gerechtigkeit halber erwähnt, aber nicht überbewertet. Auch der verstärkte Chor (Wolfgang Müller-Salow) trug zum musikalischen Hochniveau des Abends bei.
Als selbstgenügsames Belcanto-Ereignis möchte man „Lucia“ heutzutage nicht mehr akzeptieren. Immer wieder also die Frage: wie geht man inszenatorisch mit einer Oper um, bei der virtuos-schöner Gesang im Vordergrund steht und moderne Handlungspsychologie eine eher zweitrangige Rolle spielt? Die vom Rezensenten zuletzt erlebten Produktionen versuchten es mit der Wahl einer Nervenheilanstalt als Ort des Geschehens (Bonn 11/2016, Inszenierung: David Alden, Koproduktion mit der English National Opera) bzw. durch Verlagerung in die Zeit des Dritten Reiches (ein halbes Jahr zuvor in Köln, Eva-Maria Höckmayrs Regie berief sich überzeugend auf historische Vorgänge).

Thomas Weber-Schallauer legt es in Hagen, wo er regelmäßig arbeitet, nicht auf ein spektakuläres Zeit- bzw. Ortstransfer an, setzt sich als Regisseur auch nicht selbstverliebt in Szene. Man könnte seine Arbeit also als gediegen bezeichnen, wäre das Wort nicht so ungünstig negativ belastet. Die erste positive visuelle Eindruck kommt ohnehin von Ausstatter Jan Bammes: rückwärtige Reliefwand, seitliche „klassizistische“ Portalsäulen, ein quaderartig unterteilter Plafond mit variabel zu nutzenden Leuchten, dazu sparsames Mobiliar. Dominierende Farbe ist Grau. Die Kostüme von Christiane Luz signalisieren zeitlose Moderne.
In diesem weitgehend überzeugenden Ambiente führt Weber-Schallauer Regie, ohne das Sujet vordergründig oder plakativ neu beleuchten zu wollen. Aber er setzt intelligente Akzente. So bekommt die Figur des religiös eifernden, ständig aufdringlich mit seinem Kruzifix hantierenden Raimondo neue Beleuchtung (auch dank der dringlichen Darstellung durch Rainer Zaun), Psychologisch besonders reich ist die Figur Enricos gezeichnet. Er ist zweifelsohne ein Intrigant, aber kein bloßer Brutalo, seiner Schwester Lucia in wechselvoller Emotionalität auch eindeutig zugetan (ohne inzestuöse Konturen wie in Köln). Seine Untaten erklären sich aus starker familiärer Verpflichtung. Sie sind sicher nicht entschuldbar, aber doch nachzuvollziehen. Nicht ganz leuchtet das Finale der Inszenierung ein. Enrico sieht mit dem Tode Edgardos (erstochen durch Normanno, bestens besetzt mit Matthew Overmeyer) seinen Status nicht länger gefährdet, bleibt dann aber im Hintergrund sitzen, eine Pistole in der Hand. Doch noch Gewissensbisse?

Von der Regie wird Alisa (negativ) aufgewertet, im Libretto unscheinbar als „Vertraute“ klassifiziert. Kristine Larissa Funkhauser spielt hingegen die heimliche Aufseherin, macht sich ständig Notizen über ihre Schutzbefohlene und gibt die Aufzeichnungen nach oben weiter. Auch sorgen zwei „Krankenschwestern“ u.a. mit Fesselungen dafür, dass Lucias unberechenbares Verhalten in Zaum gehalten wird. Und Raimondo predigt ständig gotteshörig auf sie ein. In diesem Umfeld hat Lucias Liebe zum Familienfeind Edgardo wahrhaft keine Chance. Glänzend bebildert auch die geschäftsmäßig abgewickelte Hochzeit mit dem seine gesellschaftliche Entwicklung kühl kalkulierenden Arturo. Nachdrückliches Kompliment für diese stimmige Hagener Produktion; sie belässt (bei gelegentlichen Verlegenheiten - Introduktionschor, Sextett) der Musik ihre Vorrechte, ohne deswegen beiläufig zu wirken.
Den Enrico umreißt der virile Kenneth Mattice mit glutvoller Emphase. Ein dezidierter Belcanto-Sänger ist er mit seiner eher kantigen Stimme freilich nicht, ebenso wenig wie Kajia Xiong. Als Edgardo könnte ihn Peter Aisher (Gast vom Düsseldorfer Opernstudio) mit seinem lyrisch angenehm fließendem Organ ohne weiteres überrunden. Aber der chinesische Tenor bietet engagierten Gesang und ist nicht zuletzt eine starke Bühnenpersönlichkeit. Die Liebesszenen mit Lucia beispielsweise wirken plausibel, wie man es anderswo nur selten sieht.

Ein Schlusswort zur Musik. Alle in diesem Bericht angesprochenen „Lucia“-Aufführungen benutz(t)en in der Wahnsinns-Szene eine Glasharmonika, wie von Donizetti nicht grundlos vorgesehen. Gegenüber Köln und Bonn wirkt dieses exotische Instrument in der Akustik des kleinen Hagener Hauses besonders plastisch. Man erlebt tatsächlich so etwas wie Sphärenmusik.
Christoph Zimmermann 22.1.2017
Bilder (c) Theater Hagen
DIE ZAUBERFLÖTE
Premiere: 26.9.2015
Besuchte Aufführung: 26.12.2016
TRAILER
Kommt irgendwo eine neue „Zauberflöte“ heraus, stellt man sich als Kritiker immer die Frage: „Muss ich das sehen?“, schließlich wird das Stück überall gespielt. Die Hagener Inszenierung von Annette Wolf hatte schon vor über einem Jahr Premiere und wurde von mir in der ersten Saison ignoriert. Nachdem die Produktion aber in ihre zweite Spielzeit ging, warf ich einen Blick auf die Bilder und das Werbevideo des Hagener Theaters und war neugierig: Eine „Zauberflöte“ im Museum, bei der die Kunstwerke lebendig werden! Das könnte ein interessantes Konzept sein.

Tatsächlich beginnt die Aufführung vielversprechend: Tamino ist ein Museumsbesucher, der sich in die Betrachtung von Caspar David Friedrichs „Frau in der Morgensonne“ verliert. Die Frau auf dem Bild verwandelt sich in ein schlangenköpfiges Ungeheuer, vor dem Tamino von den drei Museumwächterinnen beschützt wird. Das Bild Paminas wird als Videoinstallation vorgeführt und die Königin steigt schließlich leibhaftig aus dem Friedrich-Gemälde als Biedermeier-Frau.
Soweit, so gut, doch mit dem Fortschreiten der Aufführung wirkt das Konzept wie bloße Dekoration. Zudem ist die Inszenierung nicht zu Ende gedacht: Träumt Tamino die Geschichte nur? Warum nehmen die Kunstwerke immer weniger Raum ein? Immerhin ist das Bühnenbild von Jan Bammes, das aus verschiebbaren Säulen besteht, funktional und sehenswert.

Im zweiten Teil gibt es nämlich nur noch eine große Nana im Stile von Niki de Saint Phalle, während nun die politischen Elemente in den Vordergrund rücken und die Regie Sarastros Politik immer stärker kritisiert: Während Sarastro ein salbungsvolles „In diesen heiligen Hallen“ singt, hört man die Schmerzensschreie des gefolterten Monostatos von der Hinterbühne. Im Rahmen seiner Prüfungen muss Tamino einen ganzen Aktenberg ungesehen unterschreiben. Und im Finale erkennen Pamina und (nach langem Zögern) Tamino, dass sie mit diesem Priestersystem nichts zu tun haben wollen.
Eine Konzentration auf diesen politischen und Sarastro-kritischen Ansatz, hätte die Inszenierung wirklich spannend und schlüssig gemacht.

Die Besetzung ist durchwachsen: Kejia Xiong besitzt als Tamino zwar schönes Material, seine Stimme klingt aber sehr eng. Beim Papageno von Kenneth Mattice gefällt zwar der weiche Bariton, doch stört der starke englische Akzent. Ilkka Vihavainen als Sarastro besitzt eine warme Bassstimme, fokussiert diese aber nicht in den Zuschauerraum, sodass man viele Töne gar nicht richtig hört.
Maria Klier verfügt zwar über alle Töne, die eine Königin der Nacht braucht, doch hört man ihr die Anstrengungen der Rolle an. Die Stimmen der drei Damen Veronika Haller, Kristine Larissa Funkhauser und Gudrun Pelker vereinigen sich zu einem kraftvollen Ensemble, doch schleichen sich bei ihnen auch immer wieder Ungenauigkeiten ein.

Große Klasse ist jedoch die Pamina von Dorothea Brandt, die mit ihrem kraftvollen und energischen Sopran eine selbstbewusste junge Frau darstellt. Als starker Gegenspieler Sarastros profiliert Rainer Zaun den ersten Priester, so dass man sich fragt, warum er nicht den Oberpriester übernimmt. Eine zuverlässig-muntere Papagena ist Amelie Petrich.
Am Pult des Philharmonischen Orchesters Hagen leitet Generalmusikdirektor Florian Ludwig eine kraftvolle Aufführung. Der Klang ist rund und kompakt, doch hat man manchmal den Eindruck, dass sich bei einigen Orchestermusikern zu viel Routine eingeschlichen hat, denn die Einsätze sind nicht immer auf den Punkt musiziert.
29.12.2016 Rudolf Hermes
Bilder (c) Theater Hagen
Zum Zweiten
Le nozze di Figaro
Premiere: 1.10.2016
Besuchte Zweitvorstellung: 14. 10.2016
Wahrhaft ein „folle journée“
Die Programmhefte führen erfreulicherweise Buch: zuletzt war Mozarts „Figaro“ in Hagen 2004 zu sehen. Bei dieser repertoirefesten Oper gilt halt ein ständiges Wiederholungs-Muss. Ähnliches gilt für de „Zauberfllöte“, welche eine Inszenierung durch die „Figaro“-Regisseurin Annette Wolf in der letzten Saison erlebte und jetzt in Abständen wieder gezeigt wird. Bei „Figaro“ erfreut zunächst, was Florian Ludwig mit dem Philharmonischen Orchester Hagen hören lässt. Er dirigiert tempoflott, mit Hervorhebung koloristischer Details (z.B. Holzbläserläufe am Schluss der Ouvertüre). Einige Begleitformulierungen geraten akustisch vielleicht schon mal etwas vordergründig, aber immer ist Mozart-Nähe zu spüren. Der durchgehende Esprit dieser Interpretation wurde in der besuchten zweiten Vorstellung (leider erst zwei Wochen nach der Premiere) vom Publikum merklich mit besonderem Beifall honoriert.
Annette Wolf hat in Hagen schon verschiedentlich gearbeitet, ähnlich übrigens wie Roman Hovenbitzer, der aber mehr für zeitgenössische Werke geholt wird. Annette Wolf stellt die vielschichtige und deshalb zu inszenatorischen Extravaganzen durchaus einladende „Figaro“-Komödie nicht auf den Kopf, färbt sie aber im Detail neu ein, im Verein mit der Ausstatterin Imme Kachel. Traditionelles Rokoko findet sich im Mobiliar, die gestreift tapezierten Wände (welche sich im dritten Akt zu einer Kulissenbühne formen) sind schon mehr Biedermeier, die Kostüme mäandern durch die Zeiten, wobei Susannas Rüschenkleid auf Spaniens Mode verweist. Mit einem Auto inmitten grüner Kunstnatur ist man final in der Jetztzeit angekommen. Das alles besitzt optischen Witz und muss nicht einem strengen „warum gerade so?“ unterworfen werden.
Die Inszenierung nimmt den Titel des Schauspiel-Originals von Beaumarchais („La folle journée“) beim Wort und sorgt für ein quickes, wirbeliges Spiel, wobei mit erotischen Akzenten nicht gespart wird. So hat die Gräfin Almaviva (rote Blume im Haar!) noch recht viel von der Rossini-Rosina (auch ihr legerer Kontakt zu Figaro erinnert an vergangene Zeiten). In der – sagen wir mal – recht zugewandten Art, wie sie auf Cherubinos Avancen reagiert, ist sie ebenfalls noch etwas die Kokette von einst.
Auch der Graf hat sich Gefühle aus der Zeit bewahrt, als er Rosina den Hof machte. Ehejahre und vielleicht auch der höfische Betrieb haben die heiße Liebe von früher freilich abkühlen und nüchtern werden lassen, und mannesbedingte Geilheit lässt sich bei ihm kaum unterdrücken. Aber in guten Momenten fliegt er noch immer auf seine Frau, verschwindet mit ihr im zweiten Akt sogar – freilich nachdrücklich gelockt - für kurze Zeit unter der Decke des zentralen Bettes, was der Hofstaat kichernd mitbekommt. Almavivas cholerische Eifersucht wirkt emotional somit „echter“ als üblicherweise.
Den „Perdono“-Passagen im Finalbild (sie bezwingen durch besondere Mozart-Göttlichkeit) gönnen Ludwig/Wolf gedehnte Pausen: Momente glaubwürdiger Wiederannäherung. Sie – die Klügere – gibt verzeihend nach. Ein wirkliches „lieto fine“ ist das freilich nicht. Was nach diesem sommernachtstraumartigen Wirrwarr am nächsten Tag und danach folgt, muss offen bleiben, vermutlich neuerlich bonjour tristesse. Mozarts Opera buffa lässt, so wie sie am Theater Hagen gespielt wird, mit ernsten Gedanken zurück. Es ist halt doch nicht alles Spaß auf Erden.
In dem starken Ensemble wirken Cristina Piccardi und Kenneth Mattice besonders rollenstimmig. Susanna ist ein quirliges, bodenständiges Wesen, charmant und auch gefühlvoll, aber ohne Süßlichkeit, sängerisch wie auch im Spiel. Almaviva tobt (einmal sogar mächtig eine Axt schwingend) durch das Geschehen, testosterongesteuert wie ein Hirsch in der Brunft. Es ist ein Verdienst des famosen, flammenden Sängers, dass dies nie ordinär wirkt. Veronika Haller gibt die Contessa als eine immer noch blutvolle Frau, klarstimmig - bei leicht angestrengter Höhe. Der Cherubino von Kristine Larissa Funkhauser bekam gute Premierenkritiken. Die erlebte zweite Aufführung vermittelte in vokaler Hinsicht eher ungünstige Eindrücke: eine verhärtet klingende Stimme ohne den Charme pubertär quellender Erotik. Die Darstellung freilich überzeugte.
Bei den Comprimario-Partien gute Kräfte: Anna Lucia Struck (Barbarina), Rainer Zaun (als Bartolo wie immer voll aufgedreht), Richard Van Gemert (schleimig-buffonesk als Basilio, köstlich stotternd als Don Curzio) sowie der Gast-Antonio an diesem Abend, Hiroyuke Inoue. Ganz und gar abendfüllend die bühnenpralle Marcellina der Joslyn Rechter.
Christoph Zimmermann 15.10.16
Bilder siehe unten!
DIE HOCHZEIT DES FIGARO
2. Oktober 2016
In meisterlicher Leichtigkeit
Mit seiner ersten großen Premiere in der Spielzeit 2016/17 ist dem Theater Hagen mit Mozarts DIE HOCHZEIT DES FIGARO ( „Le nozze di Figaro“) ein absolut überzeugender Start in die neue Saison gelungen. Mehr noch, die gestrige Premiere wurde zu einem Ausrufezeichen dieses Theaters und seiner beachtlichen künstlerischen Möglichkeiten. Diese Inszenierung lohnt jede Anreise und sollte auf keinem Terminplaner eines Opernfans fehlen. Eine großartige Ensembleleistung auf der Bühne, ein Philharmonisches Orchester Hagen mit echten Mozartqualitäten und alles in den besten Händen von Hagens GMD Florian Ludwig, der dem begeisterten Publikum musikalisch einen großen Abend bescherte.

Mozarts Oper buffa in vier Akten , basierend auf dem Theaterstück von Beaumarchais, erzählt die Geschichte vom Graf von Almaviva der nichts gegen eine Hochzeit seines Kammerdieners Figaro mit der Zofe seiner Gattin, Susanna, einzuwenden hat. Denn bei ihr will er das von ihm abgeschaffte „Recht der ersten Nacht“ wieder zu seinen Gunsten einführen.
Doch er ahnt nicht, daß sich Figaro und seine Susanna nicht nur mit der Gräfin verbünden, sondern auch noch den dauerverliebten Pagen Cherubino ins Spiel bringen, der seinerseits für reichlich Verwicklungen sorgt. Als auch noch die Beschließerin des gräflichen Schlosses Marzelline auf ihrer heißersehnten Hochzeit mit Figaro besteht, ist die Verwirrung komplett und findet ihren Höhepunkt , als auch die Auflösung aller Intrigen, im nächtlichen Garten des gräflichen Schlosses. Am Ende ist der Graf es, der einsehen muss, dass er die Frau, die ihn tatsächlich liebt, auf schlimme Weise hintergehen wollte. Seine Entschuldigung an seine Gräfin und deren Verzeihen beschließen Mozarts musikalischen Geniestreich.

Der Regisseurin Annette Wolf gelingt es diesen Stoff mit einer geradezu meisterlichen Leichtigkeit auf die Bühne zu bringen. Auf den ersten Blick eröffnet sie den Zuschauern den Blick auf die Rokoko-Zeit, aber spielt dann doch immer wieder mit den verschiedenen Epochen, die dem Rokoko folgten. Sei es, wenn Figaro zu Beginn der Oper ein Regal in schwedischer Selbstbauweise zusammenbauen will, oder aber, wenn im letzten Bild der Oper ein amerikanischer Luxusschlitten aus den 1970-er Jahren auf die Bühne rollt, den sie sehr geschickt in die laufende Handlung einbezieht. Zumindest sind die Kostüme der Protagonisten und das sie umgebende Bühnenbild der ursprünglichen Handlungszeit nachempfunden. Hierfür zeichnete sich in besonderer Weise die Kostüm- und Bühnenbildnerin Imme Kachel verantwortlich. Ulrich Schneider, der für die in dieser Inszenierung besonders wichtige Lichttechnik zuständig war, komplettierte ein Regieteam, welches ganz besonders vom Premierenpublikum für seine einfallsreiche und raffiniert-zeitlose Umsetzung des alten, und doch ewig aktuellen, Theaterstoffes gefeiert wurde. Ebenfalls positiv zu vermerken ist, dass diese Inszenierung auch an vielen Stellen knisternde Erotik in Form von Gesten und Blicken aufweist, dabei aber nie zotenhaft, oder gar plump, daher kommt.
Auf der Bühne agierte ein Ensemble, dem die Begeisterung für das Werk und diese Inszenierung deutlich anzumerken war. Bis in die kleinste Partien hinein wurde hier Mozart auf hohem Niveau gesungen und (was ebenfalls von hoher Wichtigkeit ist) gespielt. Die Verbindung aus Gesang und Spiel der Sängerinnen und Sänger und dem von seinem künstlerischen Leiter Wolfgang Müller-Salow bestens einstudierten Chor des Theater Hagens erst machte diesen Mozartabend zu einem wahren Vergnügen für ein begeistertes Premienpublikum.

Neele Jacobson und Ann-Katrin Niemczyk als Blumenmädchen gaben persönliche und gelungene Bühnendebüts. Richard van Gemert sang gleich in zwei Rollen. Zum einen den Don Curzio, als auch den Basilio. Ebenso wie Rainer Zaun als Bartolo und Marilyn Bennett als herrlich aufgedrehte Marcellina wussten sie beim Publikum für ihre jeweiligen Leistungen zu punkten. Viel Applaus und Anerkennung für die vermeintlich kleineren Gesangspartien.
Den Cherubino gestaltete die Mezzosopranistin Kristine Larissa Funkhauser mit großem komödiantischem Talent und stand dem auch gesanglich in nichts nach. Ein Bilderbuch-Cherubino in vielerlei Hinsicht, den Frau Funkhauser da auf die Hagener Bühne gezaubert hat.
Die Gräfin wurde von Veronika Haller gesungen. Auch bei ihr ist die Darstellung hervorzuheben und die Hingabe, mit der sie diese Rolle der frustrierten und dann später sich revanchierenden Ehefrau spielte. Gesanglich steigerte sich Veronika Haller im Laufe des Abends und sang ein hingebungsvolles „Dove sono i bei momenti“ (Arie der Gräfin, 3. Akt) und wußte ihren Sopran besonders in den Ensembleszenen wirkungsvoll einzusetzen.
Andrew Finden als Figaro durfte viele menschliche Facetten seiner Partie zeigen und durchleben und steigerte sich im Laufe des Abends zu einer sehr respektablen Gesamtleistung, die vom Publikum entsprechend honoriert wurde.
Die Susanna ist in vielen Inszenierungen immer eine der zentralen Rollen dieser Oper. So auch in Hagen. Mit der Sopranistin Cristina Piccardi verfügt das Hagener Opernhaus über eine glänzende Vertreterin dieser anspruchsvollen Mozartpartie. Die spielerische Kombination aus naiv, schlitzohrig und sexy gelang ihr vortrefflich. Dazu mit einem Sopran, der anfangs viel Leichtigkeit vermittelte, aber im weiteren Verlauf auch kraftvoll zum Einsatz kam. Ein besonderes Lob an Cristina Piccardi für dieses gelungene Rollenportrait.

Der Graf Almaviva ist nicht wirklich zu beneiden im Spiel der Geschlechter untereinander. Ist er es doch, der den eigentlichen Auslöser zu allerlei Verwicklungen und Intrigen gab. Der anfangs arrogante Edelmann muss am Ende des Stückes nicht nur seiner Ehefrau Abbitte leisten und erkennen das Macht auch immer Verantwortung anderen gegenüber mit in sich trägt. Dem Hagener Bariton Kenneth Mattice gelang eine hervorragende Darstellung und Umsetzung dieser komplexen Rolle. Ein Sängerschauspieler erster Güte. Den Grafen sang er mit nobler, mitunter elegant klingender, Stimme, auch in den höheren Gesangsbereichen dieser Partie.Ein tolles, da überzeugendes, Rollendebüt des gebürtigen US-Amerikaners, der bereits im Frühjahr dieses Jahres als Eugen Onegin an gleicher Stelle zu überzeugen wusste.
Der Hagener GMD Florian Ludwig stellte schon zu Beginn der Oper mit der Ouvertüre klar, dass dies kein schleppender Figaro wird, sondern einer mit Tempo. Das Philharmonische Orchester Hagen geht Ludwigs Tempo mühelos und kongenial mit und musizierte dabei einen klangschönen, stets präzis und dabei auch anmutig wirkenden, Mozart.
Detlef Obens 4.10.16
Fotos (c) Theater Hagen / Klaus Lefebvre
Rettet das Theater Hagen! Herr OB Erik O. Schulz: Kassieren Sie die Sparvorgabe!
Die Existenz des Hagener Theaters ist massiv bedroht. Sollten die Sparmaßnahmen in Höhe von 1,5 Millionen zzgl. des 1 Prozentes der Tariferhöhungen umgesetzt werden müssen, wird das TheaterHagen ab 2018 in dieser über die Region anerkannten Form nicht weiter existieren können.
Das Feuer des einzig verbliebenen, nennenswerten Hagener Leuchtturms wird erlöschen. Die Konsequenz werden Spartenschließungen sein, Abwanderung von hunderten Angestellten und Künstlern, Abfindungszahlungen, Prestigeverlust. Am Ende droht die Umwandlung in ein so genanntes "bespieltes Haus", was nichts anders bedeutet als der Einkauf teurer Fremdproduktionen. Und es steht zu befürchten, dass damit auch andere wichtige Kulturinstitutionen wie die MAX-REGER Musikschule, das KEO, der HOHENHOF oder die KULTURZENTREN in Mitleidenschaft gezogen werden.
Hagen würde als erfolgreicher und regelmäßig positiv besprochener Standort von der Kulturlandkarte Deutschlands verschwinden.
Zahllose Verbände und Einrichtungen haben Sie aufgefordert, ja geradezu angefleht, gemeinsam trag- und zukunftsfähige Lösungen zu erarbeiten.
Die geballte bundesdeutsche Kulturkompetenz stünde Ihnen mit Rat und Tat zur Seite: die Deutsche Orchestervereinigung, der Deutsche Bühnenverein, der Deutsche Musikrat, Medien, Künstler und kompetente BürgerInnen.
Verehrter Herr Oberbürgermeister: Geben Sie Ihren Widerstand auf. Beweisen Sie Ihren BürgerInnen, dass Sie in ihrem Interesse handeln, und setzen Sie sich für die Rücknahme der Sparvorgabe für 2018 ein. Ergreifen Sie die Chance, in letzter Minute die desaströse Entwicklung am Hagener Theater aufzuhalten.
Hagen, in seiner jetzigen Verfassung, wird diese Einschnitte bei seinem Theater nicht verkraften.
Sorgen Sie dafür, dass der Deutsche Kulturrat Hagens Theater von der Roten Liste Kultur streichen kann. www.kulturrat.de/dokumente/rote-liste-kultur/rote-liste-kultur-4.pdf.
"Die ganze Kultur ist eine große, endlose Zusammenarbeit." August Strindberg
Begründung:
"Von meiner Stadt verlange ich: Strom, Wasser und Kanalisation.
Was die Kultur anbelangt, die besitze ich bereits."
Mit diesem sarkastischen Zitat von Karl Kraus könnte man es bewenden lassen. Doch es gilt, einer unheilvollen Entwicklung - nicht nur in Hagen - aber hier im Besonderen - Einhalt zu gebieten, weil eine lebendige Kultur Spannung bedeutet im Kampf gegen den Rückschritt. Sollten die Sparpläne für das Hagener Theater ab 2018 umgesetzt werden müssen, würde das einen massiven Rückschritt nicht nur für die Kultur in Hagen, sondern für die Stadt selbst bedeuten.
Rund 180.000 Besucher - auch aus dem Umland - zieht das Theater Jahr für Jahr in seinen Bann. Eine nicht zu ignorierende Menschenmenge, die Hagen besucht. Auch die rund 300 technischen und künstlerischen MitarbeiterInnen des Theaters tragen mit ihren Familienangehörigen, ihren vielfältigen künstlerischen Betätigungen, neben denen im Theater, dazu bei, den sozialen und wirtschaftlichen Abstieg Hagens abzufedern.
Die Sparvorgabe birgt ein nicht zu kalkulierendes Risiko sowohl für das Theater, als auch für die Stadt.
Dies alles gilt es aufzuhalten. Hierzu soll diese Petition beitragen.
Hagen braucht mehr als Strom, Wasser, Kanalisation und unterirdische Mülleimer!
Jeder, der fürchtet, das TheaterHagen werde die erzwungene Selbstbeschneidung in genannter Höhe nicht verkraften, sollte diese Petition unterzeichnen.
Christoph Rösner (Initiator)

Foto (c) T. Eicher
Der Rosenkavalier
Premiere am4.6.2016
Wie Gott Amor mit den Menschen spielt
„Ihrem Ende eilen sie zu“ überschrieb ein Magazin kürzlich die Situation des Theaters Hagen. Auf 13,5 Millionen € sollen die städtischen Zuschüsse 2018 eingefroren werden. Dann sind Intendant Norbert Hilchenbach (Pensionierung) und GMD Florian Ludwig nicht mehr am Haus, andere vieleicht auch nicht mehr. Wer nachkommt (wenn überhaupt) ist ungewiss. In der nächsten Saison zeigt das stets rührige Haus im Bereich Musiktheater erst noch einmal Flagge. An Repertoirewerken gibt es „Lucia“ und „Holländer“; mit Ludger Volmers „Tschick“ (UA) und HK Grubers „Geschichten aus dem Wienerwald“ wird zeitgenössisches Schaffen besonders stark berücksichtigt. In seiner noch laufenden TV-Reihe „Wie du warst, wie du bist – Opernland Nordrhein-Westfalen“ stellte der Westdeutsche Rundfunk kürzlich auch das Theater Hagen vor, welches in seiner Geschichte schon so manche Existenzbedrohung überlebt hat, so die Bilanz des Autors Georg Quander. Aber darauf sollte man sich nicht dauerhaft verlassen.

Wie zum Trotz gibt es jetzt den personalaufwändigen „Rosenkavalier“, wo man die Kleinpartien teilweise aus dem Chor besetzt, wie schon bei der letzten Produktion des Werkes 2002/3. Pauschales Lob ohne Namensnennung. Allerdings ausdrückliche Hervorhebung des Philharmonischen Orchesters Hagen, welches fast über sich hinaus wächst. Unter Florian Ludwig gelingt die Mischung aus Klangsüffigkeit und instrumentaler Scharfzüngigkeit ganz hervorragend. Hohe Spielkonzentration. Bei den Sängern gibt es darüber hinaus zwei nachgerade exemplarische Rollenporträts: Maria Klier (Sophie) und Rainer Zaun (Ochs). Davon später mehr. Schade, dass in diesen Befund die szenische Realisation nicht einbezogen werden kann.
In der Johann-Strauß-Operette „Karneval in Rom“ gibt es eine Nummer mit dem Text „Gott Amor schickt Pfeile“. Ob Regisseur GREGOR HORRES diese Nummer kennt? Seine Inszenierung nimmt immerhin Bezug auf das barocke Gemälde „Amor und Psyche“ von Francois-Edouard Picot (durchscheinender Hauptvorhang). Diese beiden Figuren durchgeistern verschiedentlich die Aufführung als Tänzer. Nett, harmlos. Da sind die Rahmenbilder wesentlich gewichtiger.

Zu Beginn verabschiedet sich der greise „Feldmarschall“ von seiner Gemahlin, der Fürstin Werdenberg (angesichts der modernen Ausstattung sind etliche Rollenbezeichnungen freilich zu relativieren), am Ende kehrt er zurück und „ersetzt“ damit auch den Auftritt des kleinen Mohren (der zuvor eine weibliche Bedienstete ist). Das alte Leben hat diese beiden Menschen wieder. Mit undurchdringlichem Gesicht sitzt die Marschallin während des „Traum“-Duetts an der Rampe und scheint zu sinnieren (vielleicht über einen nächsten jungen Verehrer).
Auch der Regisseur scheint zu sinnieren, ohne jedoch inszenatorisch zu einem wirklichen Ziel zu gelangen. Er bildet die Konturen der Handlung ab, ohne aber die fragilen Emotionen seiner Protagonisten unter der Oberfläche zu erschließen. Lieber widmet er sich Lachen machenden Details wie dem Entsetzen von Coiffeur Hippolyte über das harsche Urteil der Marschallin, er habe „ein altes Weib“ aus ihr gemacht, oder er bevölkert das Geschehen im Beisl mit überflüssigem Nuttenpersonal.

Auch die Bühnenoptik ist ein Problem. Nicht die Kostüme (Yvonne Forster), wohl aber die bühnenhohen und fahrbaren Regalwände von Ausstattungsleiter Jan Bammes, wie zur Aufbewahrung von Stasiakten angefertigt und von gesichtsvermummten „Friedhofsbeamten“ immer wieder neu arrangiert, wann immer es passt oder auch nicht. Die kalte Nüchternheit dieser (sparzwängig ersonnen?) Bauten reibt sich permanent an der Opulenz von Straussens Musik.
Zwei Positiva hält die Inszenierung (neben der Präsenz des „Feldmarschalls“) allerdings bereit und führt fraglos auch zu den exzellenten Porträts der beiden vorhin schon genannten Sänger. Wie Maria Klier sich von einem duckmäuserischen Heimchen zu einer emanzipationsbereiten jungen Dame entwickelt, ist einfach hinreißend. Besonders anrührend ihre Reaktion, wenn ihr klar wird, dass sich der ach so liebevolle Octavian erotisch seine Hörner bereits abgestoßen hat. Die Worte „So geh‘ er doch hin“ werden kaum noch gesungen, sondern verzweifelt heraus geschrien. Vokal zeigt sich die Sopranistin zumal in den heiklen Höhen ohne Fehl und Tadel. Rainer Zaun verfügt über keinen dröhnenden, auch nicht über einen schwarzen Bass, als Persönlichkeit ist er jedoch ein Schwergewicht. Wie er den einigermaßen clochardhaft und bajuwarisch (!) ausstaffierten Rüpel (was könnte der etikettengeile Faninal von diesem Rindvieh für seine gesellschaftlichen Eitelkeiten erwarten?) souveräne Schlitzohrigkeit ersingt und erspielt und ebenso körperintensiv wie detailreich in der Gestik diesen sanguinischen Genussmenschen konturiert, fasziniert nachhaltig.

Und dann kommt ein Moment, wo man fast weinen muss, weil’s gar so schrecklich ist. Wenn im dritten Aufzug die ganze Gesellschaft rächend über den Widerling herfällt, zeigt sein Gesicht (und auch das seines Kumpanen Leopold) echte Verzweiflung. Er versteht einfach die Welt nicht mehr, sein vollsaftiges Lebensverständnis nimmt (vermutlich) irreparablen Schaden. Ein Untergang, welcher mitleidig stimmt.
Veronika Haller gibt feinstimmig und pianosanft die Marschallin (mimisch bleibt sie ein wenig äußerlich), Kenneth Mattice vollstimmig und cholerisch, aber nur bedingt differenziert den Faninal. Als Leitmetzerin präsentiert sich die wie eine Krankenschwester gekleidete Sophia Leimbach mit leicht scharfem Sopran, Kejia Xiong gibt nicht ohne Höhenstress die beiden extremen Tenorpartien der Oper (Sänger, Wirt – auch Haushofmeister). Von Kristine Larissa Funkhauser sind etliche schöne Partien in Erinnerung. Der Octavian scheint sie jedoch zu überfordern, abzulesen nicht zuletzt an der durchgehend vagen Intonation. Es tut einigermaßen weh, dies aussprechen zu müssen.
Christoph Zimmermann 5.6.16
Bilder (c) Theater Hagen
EUGEN ONEGIN
Besuchte Vorstellung: 11.3.2016
Premiere 5.3.2016 /in Deutscher Sprache
In schwarz und rot
Diese Inszenierung muss erst wirken. Sie ist zart, unaufdringlich und dennoch eindringlich, sie ist düster, sie vermittelt Tschaikowskis „lyrische Szenen“ mit herber Melancholie in einem schwarzen Raum mit wenig Licht und viel Schatten. Die dominierenden Farben des Bühnenbildes sind rot und schwarz. Sinngebende Farben für eine Inszenierung im Spannungsfeld menschlicher Leidenschaften.
Regisseur Holger Potocki hat zusammen mit seiner Bühnen- und Kostümbildnerin Tanja Hofmann die Hagener Theaterbühne als einen großen, offenen schwarzen Raum gestaltet. Deren Mitte ist der Dreh- und Angelpunkt für das weitere Geschehen der Oper. Dabei nutzt er offensiv die technischen Möglichkeiten die ihm die Drehbühne zur Umsetzung der Handlung bietet.
Wenn dort, wie in einem vorbeiziehenden Tagtraum, Onegin der sich nach ihm verzehrenden Tatjana erscheint oder der tote Lenski wie ein mahnendes Menetekel seinen ehemaligen Freund Onegin stumm umkreist, hat es was berührendes. Sicher eine der interessantesten Eugen Onegin-Inszenierungen, die ich bisher gesehen habe.
Tchaikowskis berühmteste Oper ist eines der meisterhaftesten Werke der Musikgeschichte überhaupt. Wie er mit musikalischen Stilmitteln die Personen des Stückes, und deren Gefühlsleben, beschreibt ist genial. Eine große Aufgabe auch für das Orchester und den Chor dieser Oper. Und auch immer wieder eine Herausforderung für das gesangliche Bühnenensemble, besonders für den Sänger (Bariton) des Onegin und der Sängerin (Sopran) der Tatjana.
Musikalisch konnte Hagen seinem Ruf als sängerische Talentschmiede wieder einmal gerecht werden. Sehr ansprechende Gesangsleistungen bis in die kleinsten Rollen.
Kristina Larissa Funkhauser ist eine Olga, der man ihre kindliche Naivität unbedingt abnimmt. Eine ideale Rollenbesetzung. Das gilt auch für Marylin Bennett als Larina und Rena Kleifeld als Filipjewna.
Den Wladimir Lenski sang und spielte Kejia Xiong. Der Hagener Tenor war zu Beginn noch ein wenig zurückhaltend, konnte dann aber insbesondere in der Duellszene stimmlich glänzen und gestaltete die berühmte Lenski-Arie „Wohin, wohin seid ihr entschwunden..„mit viel Gefühl und Schmelz in der Stimme. Kenneth Mattice (Eugen Onegin), Ilkka Vihavainen (Fürst Gremin), Veronika Haller (Tatjana), Chor und Extrachor
Ilka Vihavainen hat als Fürst Gremin nicht wesentlich viel mehr als eine Arie zu singen. Die ist aber immerhin eine der bekanntesten Bass-Arien der Operngeschichte schlechthin. „Ein jeder kennt die Lieb‘ auf Erden..“ mit angenehm tiefen Bass dem Hagener Publikum vorgetragen.
Richard van Gemert sang das Couplet des Triquet im 3. Akt mit besonderer französischer Akzentuierung. Paul Jadach war für den Hauptmann und den Saretzki besetzt und Sebastian Klug gab den Guillot.
Die Sopranistin Veronika Haller ist eine lyrisch singende Tatjana im besten Sinne. Die Verwandlung von der kindlich-schwärmerischen Tatjana hin zur Gattin des Fürsten Gremin gelingt ihr stimmlich wie darstellerisch höchst überzeugend. Ihre mit viel Gefühl gesungene Briefszene „Und wär’s mein Untergang..“ war sicher einer der Höhepunkte des gestrigen Abends. Großartig auch ihr Einsatz in der finalen Szene zwischen ihr als Tatjana und Onegin. Eine wirklich sehr ansprechende Leistung der aus Südtirol stammenden Opernsängerin.
Eine Entdeckung war für mich Kenneth Mattice als Eugen Onegin. Vor knapp zwei Jahren sagte er in einem Zeitungsinterview, dass es ein großer Wunsch von ihm sei, diese Rolle einmal zu singen. Er hat sich offenbar sehr gut seitdem vorbereitet auf diese ganz besondere Baritonpartie. Mattice war vom ersten Moment an präsent. Er spielte den anfangs überheblich arroganten Onegin ebenso glaubhaft und überzeugend wie eben jenen zerbrochenen Onegin, der am Ende erkennen muss, dass es für ihn kein Glück und keine Liebe mehr geben wird. Das schauspielerische Talent des jungen US-amerikanischen Baritons ist bemerkenswert und wird nur noch durch seine gesangliche Umsetzung der Partie übertroffen. Ein absolut gelungenes Rollendebüt als Eugen Onegin. Hier empfiehlt sich ein beachtliches Operntalent für eine große Karriere.
Chor und Extrachor des theaterhagen unter der Leitung von Wolfgang Müller-Salow und Malte Kühn waren bestens szenisch und musikalisch in die Opernproduktion eingebunden. Das Philharmonische Orchester des theaterhagen konnte seine musikalischen Qualitäten anhand der anspruchsvollen Tschaikowski-Partitur unter der musikalischen Gesamtleitung von Mihhail Gerts eindrucksvoll unter Beweis stellen. Insbesondere die elegischen Ausbrüche des Werkes und die großen Szenen der Oper wurden zu herausgehobenen musikalischen Momente.
Fazit: Das theaterhagen präsentiert seinem Publikum einen sehens- und hörenswerten EUGEN ONEGIN in schwelgerisch-elegischen Bildern bei hoher musikalischer Qualität.
Detlef Obens 16.3.16
Bilder siehe unten: Erste Kritik
Zum 2.)
EUGEN ONEGIN
Besuchte Aufführung: 11.3.2016
Premiere: 5.3.2016
Inszeniert und vertan
„Ich suche ein intimes, erschütterndes Drama mit denselben Gefühlen und Gedanken, die ich auch ich habe und verstehe.“ Also schrieb Peter Tschaikowsky die Oper „Eugen Onegin“. „Ich glaube nicht, dass sie jemals Erfolg haben wird.“ In Russland und hier vor allem am Bolschoi-Theater sind die „lyrischen Szenen“ aber längst eine Art Heiligtum. Aber im Grunde wird jeder fühlende Mensch die von Alexander Puschkin herzzerreißend geschilderten Situationen nachvollziehen können. Ein großes Mädchengefühl, vom angebeteten Mann großspurig weggewischt, erweckt bei diesem nach Jahr und Tag das gleiche schmerzvolle Begehren. Doch obwohl die erotische Anziehungskraft nunmehr beiderseits stimmt, ist nachgeholtes Glück nicht mehr möglich. Über die Oper und ihre verzweifelte Botschaft kommt man unweigerlich ins Grübeln. Und wer Tränen vergießt, ist nicht zu tadeln.
Am Theater Hagen stellen sich Tränen allerdings nicht ein, denn die Aufführung (gesehen wurde die zweite Vorstellung) bleibt musikalisch (die meisten Sänger ausgenommen) und szenisch weit unter dem Anspruch des Werkes. Das bilanziert sich nicht leicht bei einem Theater, welches in punkto Werkwahl und Interpretation immer wieder Großartiges anzubieten hat, zuletzt mit Ernst Kreneks „Jonny spielt auf“. Aber am jetzigen Ausfall ist einfach nicht vorbei zu schmeicheln.
Die Inszenierung, üblicherweise Stein des Anstoßes, ist einmal nicht alleine „schuld“. Der lettische Dirigent Mihhail Gerts, ein Kapellmeister mit viel Erfahrung (u.a. 2007-.2014 in Tallin tätig) vermag Tschaikowskys Musik nur wenig dinglichen Ausdruck zu entlocken. Im Orchester häufig Spielfehler wie sonst selten, der Chor (obwohl meist frontal postiert) singt dem vorgegebenen Rhythmus oft hinterher. Das Hören quält zeitweise regelrecht.
Regisseur Holger Potocki hat im Januar 2015 in Hagen einen über weite Strecken hochinteressanten „Faust“ (Gounod) erarbeitet. Sein „Onegin“ hingegen demonstriert Hilflosigkeit. Im sehr abstrahierenden Bühnenbild (Tanja Hofmann), in welchem die Drehbühne unermüdlich in Gang gesetzt wird, verharrt der Chor (schon oben gesagt) meistens starr, die Solisten bewegen sich meist wie zufällig. Mitunter möchte man gerne fliehen.
Die Rezensentenpflicht, bis zu einem (selbst bitteren) Ende auszuharren, erwies sich in Hagen zuletzt freilich als gute Direktive, denn wider Erwarten legt Potocki zuletzt inszenatorisch etwas nach. Der (hörbar aufschlagende) Papierschnee im Duellbild wird beim Tod Lenskis mit roten Schnipseln durchsetzt. Es gibt keinen hörbaren Schuss, kein letales Dahinsinken. Die den Gremin-Akt einleitende Polonaise zeigt Onegin auf den Sarg seines einstigen Freundes hingeworfen – totale Verzweiflung (Kenneth Mattice spielt diesen Schmerz beklemmend aus). In die Realität der Handlung mischen sich Erinnerungsbilder ein (teilweise symbolisiert durch den Schnee, teilweise – und etwas plakativ – durch Briefe, welche ebenfalls vom Bühnenhimmel flattern). Die Wirkung dieser optischen Details vermag die vorherige szenische Unbedarftheit freilich nicht vergessen zu machen.
Immerhin wirft sich Kenneth Mattice, welcher am Anfang mit den Händen in den Hosentaschen wie ein Rüpel auftreten muss, im Finalbild hingebungsvoll in seine Partie. Den Kriterien von Schöngesang genügt die Stimme des jungen Amerikaners vielleicht nur bedingt, aber sein etwas raues Timbre gibt für szenische Wahrheiten viel her. Der etwas flackrige Tenor von Kejia Xiong bleibt der Lenski-Figur hingegen Etliches an weicher Lyrik schuldig. Optisch erinnert seine Arie (ebenfalls mit den Händen in den Hosentaschen) an einem gemütlichen Winterspaziergang, Veronika Hallers Tatjana fehlt, bei aller Solidität und Emphase der Gestaltung, ein wenig das „Seelenhafte“. Einen noblen Gremin gibt Ilkka Vihavainen ab.
Die kleineren Partien sind zufriedenstellend besetzt: Marilyn Bennett (Larina), Rena Kleifeld (Filipjewna), Kristina Larissa Funkhauser (Olga), Richard Van Gemert (Triquet). Für Paul Jadach (Hauptmann, Saretzki) sollten bald einmal größere Partien anstehen: ein warmstimmiger Bariton von ausgesprochen vornehmem Charakter.
Christoph Zimmermann 12.3.16
Bilder siehe unten 1. Kritik
EUGEN ONEGIN
Premiere: 05.03.2016
besuchte Vorstellung: 11.03.2016
Mehr Schatten als Licht
Lieber Opernfreund-Freund,
ich bin ein großer Fan der so genannten „Provinz“. An Deutschlands kleineren Bühnen ist man oft mutiger bei der Spielplangestaltung, geht mit mehr Leidenschaft ans Werk, begeistert mit unmittelbar spürbarem Enthusiasmus und zeigt oft eine unerwartete Qualität auch ohne große Namen.Und auch am Theater Hagen, an dem ich gestern die neue Produktion von Tschaikowskis beliebtem „Eugen Onegin“ besucht habe, habe ich schon wundervolle Produktionen erlebt. Doch ließen mich eine mitunter wenig glückliche Hand bei der Besetzung, musikalische Unzulänglichkeiten und vor allem die nichts sagende Regie recht enttäuscht nach Hause zurück fahren.

Holger Potocki präsentiert die vielleicht beliebteste russische Oper auf leerer Bühne dermaßen öde, dass sich das ohnehin schon erschreckend schwach besuchte Theater nach der Pause noch weiter leert. Das Drama um die nicht erwiderte Liebe eines jungen Mädchens vom Lande zu einem Lebemann, um eine Freundestötung aufgrund übertriebenen Stolzes und die letztendliche Zurückweisung von Eugen durch Tatjana spielt sich auf sich endlos drehender Bühne ab, die wie die teils historisch, teils modern anmutenden Kostüme von Tanja Hofmann stammt. Personenregie findet quasi nicht statt, alle Protagonisten stehen herum, bewegen sich meist nur durch die Drehbühne.

Das kann als Passivität der Handelnden, als sich Treiben lassen verstanden werden, trägt aber keinen ganzen Opernabend. Zwar entsteht der eine oder andere interessante Moment dadurch, dass einzelne Figuren durch die Bühne automatisch vom Schatten ins Licht gefahren werden (für das durchaus durchdachte Licht zeichnet
Ernst Schießl verantwortlich), doch auch dieser Effekt läuft sich bald tot, die Drehbühne wird schnell zum Selbstzewck. Die Titelfigur hat ihre joviale Attitüde durch übertrieben zur Schau gestellte Hände-in-den-Hosentaschen-Haltung auszudrücken, Tatjana erscheint bieder und beherscht selbst in den Momenten, in denen sie ausbricht. Am Schluss nimmt sie auf der Bank Platz, auf der zu Beginn ihre Mutter über die vergangene Jugend philosophierte. Dabei böte der Stoff auf Grundlage von Alexander Puschkins Roman genug für einen spannenden Opernabend.
Auch die Sängerinnen und Sänger vermitteln seltsam wenig Spielfreude, sondern wirken über weite Strecken vom eigenen Spiel gelangweilt - bis auf wenige Ausnahmen. Zu denen gehört Ensemblemitglied Kenneth Mattice, der in der Titelrolle mit vollem Bariton überzeugt und auch darstellerisch - zumindest im letzten Bild - beeindruckt. Er ist zudem mit der Olga von Kristine Larissa Funkhauser, die mit wunderbar facettenreichem Mezzo und engagiertem Spiel begeistert, der Einzige, der ein wenig russische Seele in seine Stimme zu legen versucht. Ansonsten klingt es seltsam deutsch - nicht nur, weil auf Deutsch gesungen wird. Veronika Hallers kraftvoller Sopran ist zu groß für die Tatjana - zumindest im ersten Bild. Sie klingt da eher nach Senta als nach verschüchterter Leseratte. Im letzten Akt hingegen trumpft sie auf und überzeugt als erstarkte Frau.

Der schlanke, in der Höhe ein wenig enge Tenor von Kejia Xiong passt eher zu einer Mozartpartie. Doch gelingt dem jungen Chinesen eine beeindruckende Szene im zweiten Akt - die einzige Szene übrigens, in der auch die enervierende Drehbühne Sinn macht und die Regie für eine gefühlte Sekunde ein eindruckvolles Bild zu erzeugen vermag. Rena Kleifeld stattet die mütterliche Filipjewna mit warmem Alt aus, Marilyn Bennetts Larina bleibt dagegen auch stimmlich eher eindimensional. Ilkka Vihavainen gelingt ein halbwegs bewegender Gremin, Richard van Gemert zeigt einen durchaus gewitzten Triquet, dessen Szene aber von der Regie jeglichen Esprits beraubt wird.
Der Chor müht sich redlich, singt an sich sauber (Einstudierung Wolfgang Müller-Salow und Malte Kühn), kämpft aber mit einem weiteren Problem des Abends, dem Dirigat von Kapellmeister Mikhail Gerts. Dass es dem aus Estland stammenden jungen Dirigenten so wenig gelingt, Tschaikowskis Geist zu beschwören, ist so bedauerlich wie erstaunlich.

Der Abend ist durchzogen von unsauberen Einsätzen, Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Bühne und Graben, sich über Gebühr hervortuendem Blech und unausgewogenem Klang. Dabei kenne ich das Philharmonische Orchester Hagen sonst als verlässlichen Partner des Sängerensembles.
Das Publikum applaudiert dementsprechend eher verhalten bis freundlich denn begeistert.
Ich bin ein großer Fan der so genannten „Provinz“. Doch was da gestern am Theater Hagen gezeigt wurde, wird weder dem Drama von Alexander Puschkin, noch der bewegenden Musik von Peter Tschaikowski gerecht. Schade!
Ihr
Jochen Rüth / 12.03.2016
Fotos (c) Klaus Levebvre.
JONNY SPIELT AUF
Premiere: 16. Januar 2016 (Hagener Erstaufführung)

Wenn sich die Opernhäuser an ein Werk Ernst Kreneks wagen, dann ist es meist sein „Jonny spielt auf“. So auch im von Einsparungen bedrohten Hagen, wo Intendant Norbert Hilchenbach dem Publikum neben Klassikern wie „Das Land des Lächelns“ und „Der Rosenkavalier“ in jeder Saison auch eine Rarität vorstellt.
Regisseur Roman Hovenbitzer hat in Hagen viele spannende Inszenierungen auf die Bühne gebracht, besonders eindringlich sind mir Barbers „Vanessa“ und Floyds „Susannah“ in Erinnerung. Mit „Jonny spielt auf“ liefert er eine solide Handwerksarbeit, die aber kein großer Wurf ist.

Im ersten Akt steht die Dreiecksgeschichte der Opernsängerin Anita im Mittelpunkt, die zwischen dem Komponisten Max und dem Geigenvirtuosen Daniello hin- und hergerissen ist, im Zentrum. Der titelgebende Jazzgeiger Jonny ist da eigentlich nur eine Randfigur. Im zweiten Akt stehen die Selbstzweifel des Komponisten Max im Mittelpunkt des Geschehens.
Eigene Akzente setzt Hovenbitzer kaum: Zwar spielt Max am Beginn der Oper mit einem Bühnenbildmodell seiner eigenen neuen Oper, in die der Komponist dann selbst eintaucht, und am Ende schwingt sich die zu Jonny zugehörige Discokugel wie eine Abrissbirne über die Bühne und zerstört das Bühnenbildmodell. Hovenbitzer macht so deutlich, wie bedroht die Theater durch die Unterhaltungsindustrie sind, aber insgesamt ist das doch recht wenig.

Ausstatter Jan Bammes gelingt mit seiner Gebirgslandschaft aus gestapeltem und zerknülltem Paper ein eindrucksvolles Bühnenbild, während die Hotelhallen und anderen Räume eine gewisse Beliebigkeit besitzen. Alfonso Palencia hat die drei flotten Tänzerinnen choreografiert, die Jonny umschwirren.
Hagens Generalmusikdirektor Florian Ludwig macht klar, dass „Jonny“ nicht bloß eine Jazz-, sondern auch eine Künstler-Oper ist: Die Soloszenen klingen düster und grüblerisch, als sei man in Hindemiths „Mathis der Maler“. In den Jazzszenen kann sich der Schwung der Musik aufgrund der kleinen Besetzung des Philharmonischen Orchesters Hagen nicht optimal entfalten. Ein großer inszenatorischer Fehler ist es, dass Jonnys Jazzband nie auf der Bühne musiziert, sondern nur von der Hinterbühne in den Zuschauerraum schallt.

Mit der Bayreuth-erfahrenen Edith Haller ist dem Theater Hagen eine prominente Besetzung für die Anita geglückt. Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass Haller die Marschallin im demnächst anstehenden neuen Hagener „Rosenkavalier“ singt, aber auch als Anita überzeugt sie mit kräftigem Sopran, den sie sehr genau einsetzt. Während Haller ihre Partie mühelos durch die Kehle fließt, wirkt Hans-Georg Priese als Max immer wieder verkrampft, wenn er höhere Töne ansteuert. Mit seinem hellen und kraftvollen Tenor gestaltet er seine Rolle aber sehr textverständlich und liefert eine eindringliche Charakterzeichnung.
Einprägsam gestalten die Baritone Kenneth Mattice und Andrew Finden die beiden Geiger Jonny und Daniello, wobei letzterer die interessantere Stimme besitzt. Maria Klier singt das Stubenmädchen Yvonne mit flottem Soprangezwitscher.
Insgesamt gelingt dem Theater Hagen mit „Jonny spielt auf“ ein solider, aber kein überwältigender Abend. Für Freunde von selten gespielten Opern ist diese Produktion aber auf jeden Fall empfehlenswert.
Rudolf Hermes 17.1.16
Bilder (c) Theater Hagen
IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE
Redaktionelles Lob für ein gutes vorbildliches Programmheft.
Dorothee Hannappel zeichnet für die Redaktion eines sehr gelungenen Programmheftes verantwortlich und ihr gebührt dafür mein Lob. Ich finde daß hier, vergleiche ich das mit dem großen Wust der Programmhefte, die sich so im Laufe der Jahre bei mir angesammelt haben und die ich selten wirklich lese, vorbildliche Arbeit geleistet wurde. Es gibt den Inhalt kurz und prägnant wieder, lässt Krenek in wichtigen Sätzen zu Wort kommen und enthält auch einen wichtigen Beitrag zur Konzeptionsgeschichte. Nichts Überflüssiges! Dabei ist alles so übersichtlich und gut lesbar angeboten, daß es binnen 20 Minuten noch vor der jeweiligen Vorstellung auch für Unvorbereitete schnell und informativ rezipierbar ist; dazu ein paar schöne Erinnerungsbilder... Mehr braucht es nicht. Danke ;-))) P.B.
Zweite OPERNFREUND-Kritik
JONNY SPIELT AUF
Premiere am 16. Januar 2016
Die amerikanische Oper ist am Hagener Theater seit etlichen Spielzeiten ein Fixpunkt des Repertoires. Zu den Werken aus jüngster Zeit gehören Kurt Weills „Street Scene“ und Samuel Barbers „Vanessa“. Jetzt offeriert man Ernst Kreneks „Jonny spielt auf“, in den letzten Jahren – soweit recherchierbar – in Karlsruhe (1997), Wuppertal (2002), Neustrelitz (2003), Köln (2005), Kaiserslautern (2008) und Weimar (2014). Kein großer, aber doch solider Ertrag. Eine Rezension zur letztgenannten Produktion bestätigte, dass der Komponist den „Zeitgeist der ‚Roaring Twenties‘ traumwandlerisch getroffen“ habe. Nur “damit macht man heute kaum mehr Sensation“. Für die Hagener Erstaufführung sind Erfolg und Begeisterung allerdings nachdrücklich zu bestätigen.
Auch wenn Jazz-Geiger Jonny als Figur frühzeitig in die Handlung einsteigt, rätselt man doch bis zum von ihm dominierten Finale ein wenig darüber, warum er der Oper seinen Namen gab. Diesen Jonny muss man übrigens nicht unbedingt sympathisch finden. Alle Mädchen, denen er begegnet, legt er sogleich aufs Kreuz, macht sich ungeniert auch an die Diva Anita heran. Und dann klaut er dem Geiger Daniello auch noch seine wertvolle Amati und setzt damit eine Verfolgungsjagd in Gang, bei welcher Daniello tragisch zu Tode kommt. Viele andere Menschen brechen aber per Zug nach Amerika auf, unter ihnen Anita und der Komponist Max, ihr Geliebter. Mit seiner Geige hat Jonny das letzte Sagen. Sein Spiel beschwört neue Welten, ein neues Zeitalter
Der Jonny in Hagen ist mit dem virilen, baritonal etwas rauen KENNETH MATTICE attraktiv besetzt. Er gibt den Hallodri übrigens ohne schwarze Schminke, wie man es beispielsweise von Waldemar Staegemann, dem Darsteller der Dresdner Erstaufführung, vor Augen hat. Sein Konterfei (mit Saxophon) war dann 1938 Plakatmotiv für die widerliche Düsseldorfer Ausstellung „Entartete Kunst“, bei der u.a. auch Kreneks Oper mit ihrer „frechen, jüdisch-negrischen Besudelung“ angepöbelt wurde.
Dabei wollte der Komponist, welcher von den Nazis zuletzt in die USA floh, den amerikanischen Lebensstil durchaus nicht hochjubeln, fand sein Werk als „Jazz-Oper“ ohnehin falsch verstanden, obwohl er den neuen, als attraktiv empfundenen Sound ausgiebig bediente. Grundsätzlich aber hatte er die „Antithese von vitaler und spiritueller Daseinsform“ im Sinn. Das Spirituelle wird in der Figur des Max deutlich: ein fast hermetisch in sich verschlossener Mensch, der in Gletscherhöhen sein Ich zu finden glaubt, bei einem Selbstmordversuch dortselbst sogar mit den Geisterstimmen des Gebirges konfrontiert wird (eine fast schon romantisch zu nennende Szene). Anita hingegen, seine große Liebe, ist in sich gefestigt, tendiert zu einer eher Lebensauffassung des Leichthin und ermuntert Max, nicht alles so tragisch zu nehmen. Ob und wie die beiden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten (miteinander?) glücklich werden, bleibt offen. Die lockenden Geigentöne Jonnys machen immerhin Mut.
Dem Sujet eignet viel Kolportagehaftes, es atmet auch „Tatort“-Milieu, wirkt in summa aber für heutigen Geschmack doch schon etwas angegilbt. Das Introduktionsbild im Hochgebirge (man fühlt sich an Catalanis „Wally“, Henzes „Elegie für junge Liebende“ oder Lehárs „Schön ist die Welt“ erinnert) hat etwas Abgehobenes, Irreales an sich. Die exotische Zeitgebundenheit versucht die Inszenierung ROMAN HOVENBITZERs (ständiger Regiegast in Hagen) einzufangen, und es gelingt ihr auch nachdrücklich und fantasievoll. Der Hausausstatter JAN BAMMES arbeitet ihm nicht zuletzt mit schicken Kostümen (auch für den Chor) wirkungsvoll zu. Besonders gelungen ist ihm die Glitzerwelt der Berge, wobei das Gestein aus lauter Folianten besteht, das Schaffen von Max symbolisierend. Video-Einblendungen in Schwarz-Weiß imaginieren Stummfilmzeiten. Die von Krenek etwas dick aufgetragene Künstlerproblematik bei Max bleibt durch den großartigen, sich emotional voll verausgabenden Sängerdarsteller HANS-GEORG PRIESE immer glaubhaft. Er kommt vom Baritonfach her (der Fachwechsel geschah während seines Meininger Engagements, dort zuletzt Tannhäuser), was seine sattelfeste Höhe (in der Partie des Max manchmal fast rücksichtslos gefordert) nicht spüren lässt.
Zu den Gastsängern gehört auch EDITH HALLER, international gefragte jugendlich-dramatische Sopranisten, die sich (ohnehin Bayreuth-erfahren) inzwischen auch an die Isolde gewagt hat. Von minimalen Anstrengungen in der Extremlage abgesehen bezwingt ihr leuchtkräftiges Organ; auch versteht es die Künstlerin, das erotische Potential ihrer Figur (Anita) deutlich zu machen. Eine ganz und gar runde Leistung bietet auch der Australier ANDREW FINDEN als Daniello. Aus dem hauseigenen Ensemble ragen MARIA KLIER (sehr kess als Zimmermädchen Yvonne), RAINER ZAUN (Manager) und KEJIA XIONG (Hoteldirektor) mit ihren trefflichen Charakterstudien hervor. Drei Tänzerinnen geben der Inszenierung zusätzliches Show-Flair und sorgen darüber hinaus für ironische Farbtupfer. FLORIAN LUDWIG entlockt der Partitur und ihrem Stilmix mit demPHILHARMONISCHEN ORCHESTER HAGEN atmosphärischen Sound und rhythmischen Drive.
Appendix: „Jonny spielt auf“ gibt es auf CD derzeit nur in Form einer historischen Einspielung von RAI Milano (1958, Dirigent: Alfredo Symonetto). Eine Einspielung mit dem Gewandhausorchester Leipzig (1991, Dirigent: Lothar Zagrosek, Sänger: Alessandra Marc, Heinz Kruse, Michael Kraus) sollte wohl auch an die Leipziger Uraufführung des Werkes (1927) erinnern. Sie ist derzeit ebenso gestrichen wie eine einstündige Fassung von 1964 unter Heinrich Hollreiser mit dem Wiener Volksopern-Orchester und ersten Sängern wie Evelyn Lear, William Blankenship, Thomas Stewart und der jungen Lucia Popp.
Christoph Zimmermann 17.10.15
Mit besonderem Dank an MERKER-online
Bilder siehe oben "Erste Kritik"
Redaktionelle Anmerkung

Obige CD Gesamteinspielung ist via AMAZON (allerdings über Drittanbieter) aktuell ab 23 Euro erhältlich. Ich halte sie für das " Maß der Dinge" - also für Krenek Fans ein MUST HAVE - aber auch für sonstige, über die Grenzen von Aida und Cosi hinaus denkende interessierte Musiktheaterfreunde für hoch empfehlenswert. P.B.
AVENUE Q
Musik und Songtexte von Robert Lopez und Jeff Marx
Buch von Jeff Whitty
Premiere: 5. September 2015
Wie wäre es, wenn die Puppen aus der Sesamstraße ihre Sexualität entdecken würden, miteinander im Bett landen und einige Figuren sogar schwul wären? Das Broadway-Musical „Avenue Q“ beantwortet diese Fragen. Nachdem das Stück 2012 bei seiner deutschen Erstaufführung in Mannheim einen starken Eindruck machte, ist auch die Premiere am Theater Hagen ein Riesenerfolg.

Die Tatsache, dass dieses Stück beim Publikum so einschlägt, hat neben den frechen Songtexten und der flotten Musik von Robert Lopez und Jeff Marx vor allem damit zu tun, wie Puppen und Menschen hier miteinander spielen: In der New Yorker Avenue Q leben beide Spezies nämlich friedlich miteinander.
Hausmeister der Straße war in Mannheim Daniel Kübelböck (nicht der echte, sondern auch er wurde gespielt), in der Hagener Aufführung ist es ABBA-Sängerin Agnetha Faltskög, die von Marilyn Bennett verkörpert wird. Das funktioniert erstaunlich gut, weil Bennett ein beliebtes Ensemblemitglied ist und aus den ABBA-Songs immer wieder Lebensweisheiten wie „That´s the name of the game“ oder „The winner takes it all“ eingestreut werden können, die einen sicheren Lacher garantieren.
Die einzigen anderen Menschen der Straße sind das Paar Christmas Eve und Brian, sie ist Therapeutin, er ein erfolgloser Komiker. Maria Klier spielt die Eve mit präziser Hysterie, während Tillmann Schnieders den Brian mit einer tapsigen Lässigkeit versieht.

Die anderen Figuren sind Puppen: Da sind die Ernie- und Bert-Doubles Nicky und Rod, bei denen Rod mit seiner Homosexualität hadert. Kim-David Hammann und Michael Thurner gelingt das Kunststück, dass sie zwar als Puppenspieler auf der Bühne immer körperlich präsent sind, aber soviel Energie in ihre Puppe fließen lassen, dass man die Darsteller nicht mehr als die eigentlichen Akteure wahrnimmt, sondern als Menschen, die neben der Puppe stehen.
Carolina Walker und Nicolai Schwab, die das Puppen-Liebespaar Kate Monster und Princeton spielen, sind darstellerisch etwas präsenter und verschwinden nicht hinter der Puppe. Bei ihnen nimmt man den Charakter als Doppelexistenz aus Akteur und Handpuppe war. Kates verruchte Nebenbuhlerin ist die Nachtclubsängerin Lucy, die von Joyce Diederich mit großer Soulstimme angelegt wird. Der schrägste Typ der Nachbarschaft ist Trekkie Monster, der von Maciej Bittner gegrölt wird.
Trekkie verkündet in einem der Songs „Das Internet ist für Porn“ und auch ansonsten scheren sich die Texte nicht um politische Korrektheit. Da heißt es einmal „Jeder ist ein bisschen rassistisch“ und auch die „Schadenfreude“ wird groß besungen.
Regisseur Sascha Wienhausen hat sich mit Ausstatterin Ulrike Reinhard sowie Choreographin Barbara Tartaglia weitgehend am Original orientiert. Wahrscheinlich scheint es da einige Auflagen zu geben, die ein Theater erfüllen muss, um „Avenue Q“ aufführen zu dürfen, denn sowohl in Mannheim als auch Hagen wird nicht mit selbst entworfenen Puppen gespielt, sondern mit den Rick Lyon entworfenen Originalpuppen.

Dem Publikum wird ein flotter, unterhaltsamer Abend präsentiert. Die von Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel geleitete Band ist bestens aufgelegt, und die jungen Akteure, die fast durchweg ihr Musical-Studium an der Hochschule Osnabrück absolvieren, zeigen sich hochmotiviert und haben sichtbar Spaß an ihren Rollen. Natürlich haben auch einige ihrer Kommilitonen den Weg nach Hagen auf sich genommen, um die Studienkollegen zu bejubeln, aber im Publikum sitzen auch viele Inhaber eines Premieren- Abonnements, und bei denen scheint dieser Abend genauso gut anzukommen: Nach zweieinhalb Stunden gibt es stehende Ovationen.
„Avenue Q“ wird in Hagen bis Mai 2016 noch zehn Mal gespielt. Gastspiele gibt es am 24. und 25 Oktober in Minden sowie am 19. Dezember und 2. Januar im Theater Osnabrück.
Rudolf Hermes 6.9.15
Bilder Theater Hagen