

Dank an Michael Zerban (c) für das tolle Bild.
Der fliegende Holländer
Premiere: 02.10.2022, besuchte Vorstellung: 12.10.2022
Heute ins Theater oder ins Kino? - Beides!
Die Deutsche Oper am Rhein präsentiert in dieser Spielzeit eine Neuinszenierung des fliegenden Holländers, deren Ankündigung den ein oder anderen Wagnerfreund im Vorfeld vielleicht zusammenzucken ließ. Aktuell ist es offenbar im Trend der Zeit, die bekannte Oper aus Sicht der Senta zu beleuchten, erst vor wenigen Wochen feierte im Theater Mönchengladbach eine ähnlich angelegte Inszenierung der Oper ihre Premiere. Im Mittelpunkt der Handlung steht also nicht die verlorene Seele des Holländers, vielmehr ist er in diesem Fall lediglich Projektionsfläche für Sentas Träume.
Regisseur Vasily Barkhatov, der sich bei der Inszenierung des Holländers 2013 in St. Petersburg vor allem mit der Figur des Fliegenden Holländers beschäftigt hat, hat sich für die Deutsche Oper am Rhein nun auf Sentas Spuren begeben. Gleich zu Beginn des Abends lernt das Publikum die junge Senta kennen, die mit ihren Eltern in eine Kinovorstellung vom „Fliegenden Holländer“ geht. Schnell ist klar, ein intaktes Familienleben gibt es hier nicht. Statt sich auf den Film zu konzentrieren, flirtet die Mutter lieber mit anderen männlichen Kinobesuchern. Senta fasziniert der Film dafür umso mehr. Immer und immer wieder geht sie in ein und denselben Film. Begleitet wird sie hierbei durch den Opernbesucher, der durch die Kinoleinwand in den Saal schaut. Gleich hier begeistert das Bühnenbild von Zinovy Margolin zum ersten Mal, was sich während der folgenden rund 135 Minuten, gespielt wird die Fassung ohne Pause, noch öfter einstellt. Bei dieser Inszenierung gibt es auch für das Auge wahrlich einiges zu entdecken, ohne dass es vom eigentlichen Geschehen ablenkt. Im Gegenteil. Das Bühnenbild, die Kostüme (Olga Shaishmelashvili), das Licht- und Videodesign (Alexander Sivaev) und die Inszenierung entwickeln im Zusammenspiel mit der Musik fast einen Rausch, bei dem die Zeit wie im Fluge vergeht. Bemerkenswert auch mit welcher Detailverliebtheit beim Inszenierungsteam gearbeitet wurde, was sich beispielsweise bei der Kontrolle der Eintrittskarten zum Kinosaal zeigt.
In ihrer Flucht vor dem waren Leben durchbricht Senta mit Beginn des ersten Aktes die Leinwand und träumt sich quasi in die Geschichte hinein. Durch diesen geschickten Schachzug ist es möglich, dass Senta bereits hier im Mittelpunkt steht, obwohl sie in der Oper ja erst viel später ihren ersten Auftritt hat. Zum zweiten Akt wechselt die Geschichte dann in die Gegenwart. Wir befinden uns nun in einer Zwitter-Umgebung aus dem Vorraum des Multiplexkinos und einem Food-Court in einem größeren Shopping-Center. Senta lebt nun mehr denn je in ihrer eigenen Welt und ihr Vater Daland möchte sie durch eine Art Konfrontationstherapie „heilen“. So engagiert er den Darsteller des Holländers aus dem Film, damit dieser Senta nun im wahren Leben begegnen und sie anschließend verlassen könne. Auf diese Weise so hofft Daland, würde Senta von ihrem abgöttisch geliebten Idol ablassen können. Gelungen skizziert Barkhatov hier ein typisches Fan-Verhalten, welches er dann später mit dem als Fussballfans auftretendem Männerchor fortsetzt. Gelungen auch die Darstellung der Gesellschaft rund um Senta in der Spinnrad-Szene, in der sich alle Mütter nur mit dem eigenen Handy beschäftigen und als gleichförmige, fast auch etwas gleichgültige Gesellschaft einen starken Gegenpart zur stark individuell geprägten Senta bilden.
Auch musikalisch kann der Opernabend überzeugen. Die Duisburger Philharmoniker zeigen unter der musikalischen Leitung von Patrick Lange eindrucksvoll den Wechsel zwischen den kraftvollen Passagen und der doch noch vorhandenen Leichtigkeit in Wagners Frühwerk. Stellenweise agiert das Orchester fast in der Form eines Singspieles mit extremer Zurückhaltung gegenüber den Sängern um dann im richtigen Moment mit voller Wucht aufzuspielen. Mit Gabriela Scherer als Senta und James Rutherford als Holländer wurden zwei Künstler für die beiden Hauptrollen verpflichtet, die den großen Applaus und zahlreiche „Bravo“-Rufe am Ende des Abends zu Recht entgegennehmen dürfen. Bemerkenswert auch die Darstellung des Daland durch Hans-Peter König, der wiedermal mit großer Textverständlichkeit und akkuratem Gesang überzeugen kann. Überzeugend auch David Fischer als Steuermann mit seinem lyrischen Tenor. Abgerundet wird die Besetzung durch Norbert Ernst als Erik und Susan Maclean als Mary. Eine weitere Hauptrolle nimmt bei dieser Oper natürlich der Chor der Deutchen Oper am Rhein ein, der unter der Leitung von Patrick Francis Chestnut trotz Corona-Schwächung an diesem Abend stimmgewaltig und harmonisch agiert.
Ein besonderes Lob auch an das Publikum in Duisburg, dass sich an keiner Stelle zu einem Zwischenapplaus hinreißen ließ und sich jeglichen Applaus bis ganz zum Ende aufhob. Erst als sich Senta, nun sichtlich gealtert und in den Mantel des Holländers gehüllt, erneut einsam in ihren Kinosessel zurückzog und das letzte Licht erloschen war, setzte großer Jubel der recht zahlreich anwesenden Zuschauer ein.
Markus Lamers, 13.10.2022
Zwischenwelten
Premiere: 07.09.2022
Zwei Ballettstücke lenken den Blick zwischen die Perspektiven
In Kooperation mit dem Beethovenfest Bonn, fand am vergangenen Mittwoch die Premiere des neuen Ballettabends „Zwischenwelten“ im Theater Duisburg statt. Viel neues gab es hier zu entdecken, denn neben einer Neufassung von „The Little Match Girl Passion“ für die große Bühne, eine Choreographie welche Demis Volpi im Jahr 2018 mit dem Bundesjugendballett erstmals in etwas intimerer Atmosphäre auf die Bühne brachte, fand die Uraufführung von „Don´t look at the jar“ statt. Mit dieser Choreographie präsentiert sich der in Israel geborene Gil Harush erstmals mit einer Premiere dem deutschen Publikum. Die Musik zum zweiten Teil des Abends ist ein Auftragswerk des Beethovenfestes für diese Uraufführung.


In „The Little Match Girl Passion“ verschmilzt das Märchen vom kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen mit der biblischen Passionsgeschichte, genauer gesagt mit der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, aus der teilweise wörtliche Zitate übernommen wurden. Im Märchen geht es um das kleine arme Mädchen, dass am letzten Tag des Jahres nicht eine Packung Zündhölzer verkauft hat, da keiner von ihr Notiz nahm. Kalt und mit nackten Füßen setzt sie sich an eine Hauswand, da sie sich nicht nach Hause traut. Sie befürchtet Schläge vom Vater zu bekommen, da sie nichts verkauft hat und kalt sei es ja daheim auch. Nach und nach zündet sie ein Streichholz an und im hellen Licht erscheinen ihr die schönsten Gedanken an einen warmen Ofen, eine dampfende gebratene Gans, einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum und an ihre gutmütige Großmutter. Mit diesen wohligen Gedanken stirbt sie. Am Neujahrsmorgen entdeckten Passanten dann das tote Mädchen, welches mit einem Lächeln um den Mund erfroren ist.


Für „The Little Match Girl Passion“ erhielt der amerikanische Komponist David Lang im Jahr 2008 den Pulitzer -Preis für Musik. Und ja, die Musik dieses Choralwerkes ist wirklich gelungen und wird in rund 45 Minuten von Sopran (Viola Blache), Alt (Helene Erben), Tenor (Mirko Ludwig) und Bass (Sönke Tams Freier) gesanglich und an den Instrumenten ganz wunderbar vorgetragen. Großer Applaus am Ende für die musikalische Seite. Großen Applaus gab es aber auch für die Choreographie sowie die Tänzer und Tänzerinnen. Allen voran Rose Nougué-Cazenave als Mädchen, die mit ihren Stop-Motion-Bewegungen bleibenden Eindruck hinterlässt. Volpi ist mit diesem Werk eine gelungen Umsetzung des Märchens gelungen, bei dem sich die Realität und die Gedanken des Mädchens bildlich mischen und den Zuschauer in diese Zwischenwelt entführen. Zudem bringt er die im Kern traurige Geschichte des Mädchens zu einem auch bildlich gelungenen Ende. Hiervon soll nun nicht zu viel verraten werden, aber es bleibt die Erkenntnis, dass auf den Menschen nach seinem irdischen Tod vielleicht viel schönere und befreite Momente warten.


„Don´t look at the jar, but at what´s inside it.“ ist ein hebräisches Sprichwort, was übersetzt bedeutet „Schau nicht auf das Glas, sondern auf den Inhalt“. Etwas freier könnte man auch sagen: „Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband.“ Auf den Menschen übertragen bedeutet dies auch, dass man sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lassen soll, sondern auf das achten soll, was die eigentliche Person ausmacht. Gil Harush stellt sich für seine Choreographie hierzu die Frage „Wie wird Identität kreiert?“ und arbeitet hier mit diversen Wiederholungen. Viele Dinge in seiner Arbeit können vom Zuschauer (mindestens) zweimal wahrgenommen werden, einmal etwas ausführlicher und einmal in der Form einer übergebliebenen Essenz. Dies ist für den Betrachter teilweise anstrengend. Allerdings empfiehlt es sich auch gar nicht, nach diesen Dopplungen zu suchen, sondern die Darbietungen der 15 hervorragenden Tänzer und Tänzerinnen auf sich wirken zu lassen. Hierbei kann jeder für sich ganz individuell viel Interessantes entdecken. Auch wenn mit dieser Choreographie keine eigentliche Geschichte wie im ersten Teil des Abends erzählt wird, beinhaltet sie doch eine Botschaft und sei es nur die Erkenntnis, dass es an dem Mann nichts ändert ob er High-Heels oder Turnschuhe trägt, dies aber hinsichtlich einer „Vorverurteilung“ wiederum sehr wohl noch ein großer Unterschied ist. Das musikalische Fundament für den zweiten Teil dieses Ballettabends liefert ein Streichquintett-Arrangement eines ursprünglichen Popalbums der Künstlerlin SOPHIE, die vor allem im Bereich der Gender-Revolution große Bekanntheit erlangt hat. Geschaffen wurde dieses musikalische Arrangement als Auftragswerk durch die fünf Mitglieder von Wooden Elephant, die es in goldene Kostüme gehüllt auch live darboten und ebenso wie die Tänzer für interessante 45 Minuten sorgten.


Insgesamt erwartet den Zuschauer ein Abend mit zwei komplett unterschiedlichen Werken, die allerdings beide zwischen die eigentlichen Blickwinkel schauen wollen. Zu sehen ist dieser Ballettabend nun zweimal in Bonn, ab dem 24. September 2022 sind noch vier weitere Termine in Duisburg angesetzt.
Markus Lamers, 09.09.2022,
Fotos: Sandra Then
Macbeth
Premiere: 12.06.2022
besuchte Vorstellung: 15.06.2022
Blutiger Kampf um die Macht
Bereits vor einigen Jahren bot die Deutsche Oper am Rhein ihren Besuchern in Kooperation mit der Opera Ballet Vlaanderen einen eindrucksvollen „Otello“ von Giuseppe Verdi in der Inszenierung von Michael Thalheimer. Nun kann der Opernfreund die Kombination von Opera Ballet Vlaanderen, Deutsche Oper am Rhein, Giuseppe Verdi, William Shakespeare und Michael Thalheimer erneut erleben, denn am vergangenen Wochenende fand in Duisburg die viel umjubelte Premiere von Verdis „Macbeth“ statt. Zwar mit zweijähriger Corona-Verspätung, die Aufführungen in Antwerpen liegen inzwischen auch einige Jahre zurück, aber dafür in einer erstklassigen Sängerbesetzung. Mit einem hervorragenden rund 50 Personen umfassenden Opernchor wäre diese Inszenierung in den letzten Jahren in dieser Form sicher nicht möglich gewesen, da wartet man dann gerne etwas länger.

Wie bereits bei “Otello“ konzentriert Thalheimer die Oper auf das Wesentliche und fokussiert sich stark auf das Seelenleben von Macbeth und seiner Ehefrau Lady Macbeth. Auch dominiert die Dunkelheit wieder den Abend. Das weitere Leitungsteam ist ebenfalls identisch geblieben, man kann hier entsprechend von zwei zueinander passenden Werken sprechen, fast schon einer kleinen „Opern-Serie“. Henrik Ahr schuf als Bühnenbild einen Hexenkessel, der stark an eine Halfpipe aus dem Skaterpark erinnert. Immer wieder rutschen die Protagonisten in diesen Kessel, in dem es stellenweise ordentlich qualmt. Rundherum erhellen Blitze immer wieder das Geschehen auf der Bühne (gelungenes Lichtdesign: Stefan Bolliger). Am Rand des Kessels versammeln sich je nach Szene die Hexengemeinschaft oder wie im vierten Akt, eine große Menschenmenge aus Volk und Soldaten, um in die Schlacht gegen Macbeth zu ziehen. Auch mit Theaterblut wird in dieser Inszenierung nicht gespart, sowohl Soldaten wie auch Hexen sind voll des Blutes in einer Geschichte die mit Blut beginnt und mit Blut endet. Michaela Barth schuf für die Darsteller gelungene Kostüme mit vielen schottischen Elementen. Die Hexen wirken vor allem durch ihr langes weißblondes Haar als imposante Gruppe, zumal die Haarfarbe hier im starken Gegensatz zum ansonsten vorherrschenden Schwarz steht. Imposant ist auch der bereits erwähnte Opernchor (Einstudierung: Gerhard Michalski), der in dieser Oper als „dritter Akteur“ neben dem Ehepaar Macbeth eine ganz besondere Stellung einnimmt und den Opernbesucher stellenweise in Verbindung mit stark aufspielenden Duisburger Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Stefan Blunier regelrecht in die Sitze drückt. Ein großes Bravo an den Chor der Deutschen Oper am Rhein, der so lange nicht in dieser Stärke auf der Bühne erlebt werden konnte.

Auch in der musikalischen Besetzung kann dieser Opernabend überzeugen. Der isländische Bariton Hrólfur Saemundsson, der die Rolle des Macbeth in diesem Monat gleichzeitig in Duisburg wie auch am Luzerner Theater verkörpert, gibt einen innerlich zerrissenen Herrscher, der von der Macht erbarmungslos in den Abgrund gezogen wird. Gesanglich stark und immer wieder berührend in den lyrischen Passagen gelingt Saemundsson eine eindrucksvolle Rolleninterpretation. Dies gilt auch für den zweiten Gast des Abends. Mit Ewa Plonka übernimmt die derzeit stark gefragte polnische Sopranistin die Rolle der Lady Macbeth, die in der Saison 2022/23 u. a. Debüts an der Bayrischen Staatsoper, den Staatsopern unter den Linden und Hamburg sowie dem Royal Opera House in London erwartet. Da sie zum Finale des zweiten Aktes einen Asthmaanfall erleidet, nimmt sie sich im Vergleich zu ihren fulminanten Auftritten vor der Pause bei der Schlafwandelszene merklich zurück, steht den Abend aber ansonsten souverän durch, wofür sich das Publikum am Ende mit lauten Beifallsbekundungen bedankt. Die weiteren Rollen sind aus dem eigenen Ensemble passend besetzt. Bogdan Talos gibt mit starkem Bass einen prägnanten Feldherrn Banco, der auch nach seiner Ermordung als Geist durch Macbeth Kopf spukt. Ovidiu Purcel hat als schottischer Adliger Macduff zwar rollen bedingt wenig Chancen seinen klaren Tenor zur Geltung zu bringen, nutzt dies aber besonders in seiner Arie glänzend. David Fischer übernimmt die Rolle von König Duncans Sohn Malcom während Beniamin Pop vier kleinere Rollen ausfüllen darf.

In Duisburg ist diese sehenswerte Inszenierung noch dreimal als starker Abschluss der aktuellen Spielzeit zu erleben. Nach der Sommerpause findet in Düsseldorf am 04. September 2022 die dortige Übernahmepremiere statt. Ein Besuch kann an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen werden.
Markus Lamers, 17.06.2022
Bilder: © Sandra Then
Der Kaiser von Atlantis
Premiere Duisburg: 12.05.2022
Philosophische Oper in einem Akt
Nachdem „Der Kaiser von Atlantis“ bereits am Opernhaus Düsseldorf zu sehen war, bekommen nun auch alle Opernfreunde in Duisburg und Umgebung die Möglichkeit, sich diese sehenswerte Produktion anzuschauen. Mit einer Spielzeit von rund einer Stunde handelt es sich zwar um ein sehr kurzes Werk, welches allerdings sowohl musikalisch wie auch von der Inszenierung her überzeugen kann. Mitten im Grauen des zweiten Weltkrieges komponierte Victor Ullmann dieses Werk im Konzentrationslager Theresienstadt. Das Libretto stammt von Peter Kien, der dort ebenfalls inhaftiert war. Zu den besonderen Bedingungen zur Entstehungsgeschichte dieser Oper sei allen Besuchern die sehr interessante Einführung vor den Vorstellungen ausdrücklich empfohlen. Die Handlung der Opernparabel geht überraschend eindeutig mit der damaligen Situation um, was wohl auch ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass die geplante Aufführung dann doch abgesagt wurde und das Werk erstmals 1975 in Amsterdam zu erleben war. Kaiser Overall von Atlantis hat eine nahezu automatisierte Tötungsindustrie geschaffen, in der der Harlekin als Zeichen für das Leben und der personalisierte Tod nur noch tatenlos dahinvegetieren. Als der Kaiser einen Krieg Aller gegen Alle verkündet, tritt der Tod in den Streik und verweigert seine Dienste. Kein Mensch kann mehr sterben. Zunächst versucht Overall sich als Sieger über den Tod und als Überbringer des „ewigen Lebens“ darzustellen. Doch es kommt zu Aufständen, da zum Tode verurteilte am Galgen hängen, ohne sterben zu können und verletzte Soldaten von Schmerzen gequält im Leben gefangen sind. Der Tod bietet dem Herrscher an seinen Streik zu beenden, wenn der Kaiser „als erster den neuen Tod leide“. Overall nimmt dieses Angebot an und folgt dem Tod, die vorgesehene Ordnung von Leben und Tod ist wiederhergestellt. Angesichts der aktuellen politischen Lage, wirken insbesondere die letzten 15 Minuten des Werkes eindringlich aktuell, da Overall vor seinem Tod noch fragt, ob dies denn nun wirklich der letzte Krieg gewesen sei.

Ilaria Lanzino gelingt mit ihrer Inszenierung eine schlüssige und nachvollziehbare Deutung der Geschichte, die das sehr philosophische Werk mit einem feinem Gespür für die ruhigen Momente auf die große Bühne des Opernhauses bringt. Hierbei beleuchtet sie auch das Zusammenspiel von Leben und Tod auf eindrucksvolle Weise. Nur vereinzelt und an der richtigen Stelle werden große Bilder benutzt, so z. B. bei der Rede Overalls, die von einer großen Videoprojektion des Kaisers begleitet wird. Ansonsten sind es vor allem die kleinen Momente, die besonders gefallen. Sei es die Liebe von Soldat und Mädchen, die sich zu Beginn noch als gegnerische Soldaten gegenüberstehen oder das Schlussbild, bei dem der Tod sanft eine Kerze ausbläst die während der gesamten Vorstellung am Rande des Orchestergrabens brennt. Ob das Bühnenbild von Emine Güner nun eher Spinnennetz oder doch eher Marionettenfäden sein sollen ist auch beim wiederholten Besuch der Vorstellung nicht ganz so eindeutig zu bestimmen, allerdings ist dies auch egal. In beiden Fällen sind die handelnden Personen in gewisser Weise gefangen. Nach und nach zerfällt dieses Geflecht aber immer mehr. Abgerundet wird das positive Gesamtbild der Inszenierung von einem stimmigen Lichtdesign von Thomas Diek. Die Duisburger Philharmoniker spielen unter der musikalischen Leitung von Christoph Stöcker in relativ kleiner Besetzung sehr souverän und klangstark, allerdings ist es beim „Kaiser von Atlantis“ nicht unbedingt die Musik die begeistert sondern eher die Geschichte der Oper im Bezug zum gegenwärtigen Zeitgeschehen. Schön daher auch, dass sich eine ganze Schulklasse zur Premiere am Theater Duisburg eingefunden hat.

Ursprünglich war bei der Deutschen Oper am Rhein geplant, in Duisburg in identischer Besetzung zur Düsseldorfer Premiere zu spielen, allerdings machten zwei Erkrankungen sehr kurzfristige Änderungen notwendig. Der irisch-amerikanische Bariton Emmett O’Hanlon gibt wie bereits in Düsseldorf einen überzeugenden Kaiser von Atlantis. Die nicht unbedingt leichte Partie des Trommlers wurde von der Mezzosopranistin Rosarió Chavez vom Pfalztheater Kaiserslautern in kürzester Zeit bravourös einstudiert. Als Harlekin war das ehemalige Ensemblemitglied Martin Koch zu erleben, der seit einigen Jahren an der Oper Köln beschäftigt ist. Auch ihm war in keinem Moment anzumerken, wie wenig Zeit ihm zur Vorbereitung auf diese Produktion blieb. Als Gegenpart stand ihm der Tod Luke Stroker mit seinem tiefen Bass gegenüber. Abgerundet wird das Ensemble von Anke Krabbe als Mädchen, Sergej Khomov als Soldat und Thorsten Grümbel als Lautsprecher, die wie das Leitungsteam vom anwesenden Premierenpublikum mit großem Beifall bedacht wurden.
Insgesamt ist „Der Kaiser von Atlantis“ ein Stück selten gespielter Musiktheatergeschichte, die jedem empfohlen werden kann, der sich für rund eine Stunde eine sehenswerte Oper abseits des bekannten Repertoire ansehen möchte. An den kommenden Wochenenden sind noch drei Vorstellungen am Samstag Abend und eine Vorstellung am Sonntag Nachmittag angesetzt (21.05., 29.05., 04.06. und 11.06.), bevor so langsam die Sommerpause an den Theatern einsetzen wird.
Markus Lamers, 14.05.2022
Bilder: © Hans Jörg Michel
Katja Kabanova
Premiere: 05.03.2022,
besuchte Vorstellung: 08.03.2022
Ein Gewitter mit Licht und Schatten

Auch die deutsche Oper am Rhein hatte in den letzten Wochen wie viele Theater im Lande mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. So musste beispielsweise die Premiere von Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ in Düsseldorf verschoben werden. Die Neuinszenierung von Leoš Janáčeks Oper „Katja Kabanova“ konnte dagegen am 05. März 2022 in Duisburg planmäßig stattfinden. Grundlage für diese Oper ist das Schauspiel „Das Gewitter“ von Alexander Nikolajewitsch Ostrowski aus dem Jahr 1859, welches von Janáček 1921 mit Fokus auf die Familie Kabanov komprimiert wurde. Für die Inszenierung konnte mit Tatjana Gürbaca eine derzeit vielgefragte Regisseurin gewonnen werden. Da sie die Handlung in einem eher allgemeinen und abstrakten Bühnenraum ansiedelt und der Ort der Handlung irgendwo im „russische Nirgendwo“, nicht sehr exakt oder gar folkloristisch dargestellt wird, ist die Inszenierung auch in der aktuellen politischen Lage unbedenklich. Zu Beginn prägen zwar noch schöne Bilder der Wolga das Gesamtbild, doch schnell konzentriert sich die Inszenierung auf die Personen und das Familiendrama im Hause Kabanov. Hierbei schafft der Bühnenraum von Henrik Ahr eine abstrakte Enge, bietet aber immerhin einige interessante Möglichkeiten, neue Räume und Perspektiven zu schaffen. Erwähnenswert ist beispielsweise das Gewitter am Beginn des 3. Aktes. Dennoch ist das Bühnenbild leider nicht mehr als ein Beiwerk.

Mehr Wert legt Gürbaca auf die Figuren. Katja, Gattin von Tichon, leidet sehr unter den Bosheiten ihrer Schwiegermutter Kabanicha, die in Katja eher eine Gegenspielerin in der Gunst ihres Sohnes sieht. Dieser wagt zu keinem Zeitpunkt der Mutter zu widersprechen und lässt sich von ihr auf eine Geschäftsreise schicken, obwohl Katja ihn anfleht nicht zu fahren. Einsam und verlassen lässt sich Katja auf eine Affäre mit Boris ein. Unterstützung findet Katja hier bei Varvara, Pflegetochter im Hause Kabanov, die ihrerseits eine Liebschaft mit dem Lehrer Wanja Kudrjasch verbindet. Nachdem Tichon von der Reise zurückkehrt, gesteht Kaja ihm die Liebschaft und begeht Selbstmord in der Wolga. Ob dieses nun wirklich das Verhalten einer selbstbestimmten starken Frau ist oder doch eher ein feiger Ausweg, soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. Allgemein wirken einige Bilder in der Inszenierung nicht immer sehr glücklich gewählt und sorgen für einen etwas getrübten Opernabend. Wenn dann in der Schlussszene Katjas dramatischer Monolog in einer Art Endlosschleife stattfindet, in der alle Familienangehörigen ständig die gleichen Handlungsabläufe vollführen, fragt man sich als Zuschauer irgendwann doch, wann dies endlich aufhört anstatt den Gesang auf sich wirken zu lassen. Auch wenn Katja hierbei immer wieder einige Kleinigkeiten anstößt oder verändert, wirkt diese Szene relativ ermüdend.

Gefallen kann dagegen die musikalische Seite der Produktion. Unter der Leitung von Axel Kober spielen die Duisburger Philharmoniker druckvoll und lassen die teilweise sehr düstere Partitur Janáčeks stets akkurat erklingen, ohne hierbei die Sänger zu überlagern. Auch die Gesangspartien sind durch die Bank hervorragend besetzt. Sylvia Hamvasi überzeugt mit ihrem schönen lyrischen Sopran in der Titelrolle, ihr zur Seite steht mit Anna Harvey als Pflegetochter Varvara eine junge Mezzosopranistin, die mit der jugendlichen Leichtigkeit dieser Rolle perfekt spielt und gesanglich zum Star des Abends avanciert. Den Gegenpol bildet die strenge Schwiegermutter Kabanicha, die Eva Urbanová mit großer Präsenz verkörpert. Auch die Männerrollen sind mit Matthias Klink (Tichon), Daniel Frank (Boris), Cornel Frey (Wanja) und Sami Luttinen (Boris Onkel Sawjol Dikoj) stark besetzt, allerdings bleiben diese Rollen in der Inszenierung leider oft zu blass. Noch schlimmer traf es Roman Hoza als Wanjas Freund Kuligin, der einfach nur zweimal da war.

Und am Ende müssen wir dann doch auch bei dieser Produktion nochmal kurz auf das Thema Erkrankungen zu sprechen kommen. Leider konnte eine Darstellerin kurzfristig nicht antreten, so dass Ekaterina Aleksandrova kurzerhand statt einer gleich die beiden Dienstbotinnen Glascha und Fekluscha gesanglich übernehmen musste. Dargestellt wurde eine Rolle szenisch hierbei von der Regieassistentin. Nach rund 1 ¾ Stunde (ohne Pause) gab es für die Darsteller und das Orchester großen Beifall.
Markus Lamers, 11.03.2022
Bilder: © Sandra Then-Friedrich
Der Nussknacker
Premiere Duisburg: 17.12.2021
Ein Theaterbesuch für die ganze Familie

Kaum ein Ballett ist so unmittelbar mit der Weihnachtszeit verbunden wie „Der Nussknacker“ von Piotr Iljitsch Tschaikowsky. Für die Oper am Rhein hat Ballettdirektor Demis Volpi seine Inszenierung - die mit dem Ballet Vlaanderen im Januar 2016 ihre Uraufführung in der Stadsschouwburg Antwerpen feierte - für einige junge Choreografen und Choreografinnen geöffnet. Diese erarbeiten ausgewählte Szenen, wie z. B. „Die Schlacht der Mäuse“ im ersten Akt oder auch die verschiedenen Divertissements nach der Pause. Geblieben ist aber Volpis gelungene Interpretation einer Coming-of-Age-Story. Hierbei schickt er die heranwachsende Clara auf eine Reise durch ihre eigenen Gedanken, bei der die Vielstimmigkeit des heranwachsenden Geistes auch bildlich dargestellt wird. Die einzelnen neuen Choreografien bringen eine gelungene Abwechslung in dieses Gerüst und alles fügt sich zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen. So steht beispielsweise die zeitgenössisch-urbane Tanzsprache der Mäuse, choreografiert von Bahar Gökten und Yeliz Pazar, im Gegensatz zum eher klassischen Cupcake-Tanz von Michael Foster, der mit teilweise pompösen Gewändern Cupcakes anstelle von Rohrflöten tanzen lässt. Sehr schön auch die Idee, dass die Mäuse durch die Kostüme klar erkennbar Claras Familie darstellen, gegen die sich das junge Mädchen behaupten muss. Weitere Choreografien stammen von Wun Sze Chan und Neshama Nashman. Optisch besonders gelungen ist die tanzende Lichterkette von James Nix, bei der die schwarzen Kostüme lediglich mit LED-Leuchten im Kopfbereich versehen sind. Hierdurch entwickelt die Choreografie einen eigenen Reiz. Dies ist alles wunderbar anzuschauen und überfordert auch junge Zuschauer nicht, da die gesamte Inszenierung allgemein sehr kindgerecht angelegt ist.

Die Duisburger Philharmoniker spielen Tschaikowskys Musik unter der musikalischen Leitung von Marie Jacquot absolut solide, ohne nun den ganz großen Glanz zu versprühen. Dennoch ist die Produktion auch musikalisch als gelungen anzusehen. Etwas mehr Glanz geht von den wunderbaren Kostümen und dem gelungen Bühnenbild von Katharina Schlipf aus, zu dem Bonnie Beecher ein passendes Lichtdesign entwickelt hat. Auch hier können die Kinder im Publikum viele Dinge im Detail entdecken.

Tänzerisch bilden Paula Alves als Clara, Rashaen Arts als Drosselmeier und Gustavo Carvalho als Nussknacker ein harmonisches Trio. Das Elternpaar, dargestellt von Feline van Dijken und Damián Torio, wirkt in dieser Produktion teilweise etwas bieder, dafür aber umso herzlicher den Kindern gegenüber. Als Claras Bruder Fritz überzeugt Evan L’Hirondelle neben dem Tanz mit besonders gelungenem Schauspiel. Insgesamt wirken bei dieser Produktion 36 Tänzer und Tänzerinnen mit, die insbesondere in der Schneeflocken-Szene und der Blumen-Szene besonders zur Geltung kommen.

Im Gegensatz zur Nussknacker-Premiere 1892 am Sankt Petersburger Mariinsky Theater bejubelte das anwesende Publikum die Darsteller und das Inszenierungsteam lautstark mit einem langanhaltenden Applaus über mehrere Vorhänge. Hier hat die Deutsche Oper am Rhein einen respektablen Publikumserfolg geschaffen. Beim Schlussapplaus stellt sich nicht unbegründet das Gefühl ein, dass die Duisburger Zuschauer in den vielen Jahren unter Ballettdirektor Martin Schläpfer ein großes, familienfreundliches Handlungsballett regelrecht herbeigesehnt haben. Dieses findet sich nun auf dem Spielplan der Deutschen Oper am Rhein und dieser Nussknacker kann insbesondere - aber nicht nur - Familien wärmstens empfohlen werden.
Markus Lamers, 20.12.2021
Fotos: © Bernhard Weis
Ad Absurdum
Premiere: 17.11.2021
Klassiker und Uraufführung in einer gelungenen Einheit

Bekannt geworden ist der franko-rumänische Theaterautor Eugéne Ionesco vor allem mit seinen beiden frühen Werken „Die kahle Sängerin“ aus dem Jahr 1950 und „Die Unterrichtsstunde“ aus dem Jahr 1951, die nun in Duisburg in dem Ballettabend „Ad Absurdum“ zusammen zu erleben sind. Der Titel rührt daher, dass Ionesco auch heute noch oft als Meister des absurden Theaters bezeichnet wird. Im Bereich des Schauspiels sind die beiden Werke hin und wieder als Doppelabend zu finden, im Bereich des Tanzes hat aber vor allem „Die Unterrichtsstunde“ bislang große Erfolge feiern dürfen. Zu einer filmreifen Musik von Georges Delerue schuf der berühmte dänische Tänzer und Choreograph Flemming Flindt eine Ballett-Version des Stoffes für das dänische Fernsehen. Die Erstausstrahlung 1963 mit Flindt als Tanzlehrer und der französischen Ballerina Josette Amiel als Tanzschülerin wurde zu einem großen Erfolg. Bereits ein Jahr später feierte die Choreografie ihre Bühnenpremiere. Aus heutiger Sicht wirkt die Handlung allerdings alles andere als absurd. Vielmehr zeigt sie einen fast thrillermäßigen Verlauf einer Tanzstunde, bei der der zunächst schüchterne Tanzlehrer, hier von Orazio Di Bella ganz wunderbar verkörpert, im Verlaufe der Tanzstunde immer aggressiver und aufdringlicher wird. Nicht zuletzt auch deshalb, weil seine Studentin ihn mir ihrer raumgreifenden Tanzfreunde sichtlich überfordert. Elisabeth Vincenti besetzt diese Rolle mit ihrer Spielfreunde und ihrem Tanz sehr treffend. Schließlich kommt es zur Katastrophe, indem der Lehrer seine Schülerin erwürgt. Hierfür wird er zwar von der strengen Pianistin, Virgina Segarra Vidal in seiner sehr sehenswerten Leistung, gemaßregelt, allerdings hilft sie ihm dann auch bei der Beseitigung der Leiche, da bereits die nächste Schülerin vor der Türe steht. Die passende Bühnengestaltung nach Bernhard Daydé ist ebenfalls ein echter Hingucker. Dreißig packende Ballettminuten, die dem Zuschauer hier vor der Pause geboten werden.

Ganz andres angelegt ist dagegen der zweite Teil des Abends mit der Uraufführung von „Die kahle Sängerin“, für die Andrey Kaydanovskiy die Choreografie entwickelte. Der renommierte Hauschoreograph des Bayerischen Staatsballetts ist mit diesem Werk erstmals für das Ballett am Rhein tätig und überzeugt hierbei mit einfallsreichen Bewegungsmustern, die das Aneinander-vorbeileben der beiden Paare Smith und Martin absurd auf die Spitze treiben. Hierbei ertappt man sich immer wieder selbst, wie man über einige offensichtliche Unsinnigkeiten der Choreografie schmunzeln muss, was durchaus der gewünschte Zweck gewesen sein dürfte und im krassen Gegensatz zum ersten Teil des Abends steht. Begleitet wird das Geschehen auf der Bühne wie bereits vor der Pause von den Duisburger Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Maria Seletskja, die bei der kahlen Sängerin mit Musik vom Alfred Schnittke zu gefallen wissen. Bühne und Kostüme von Emma Bailey sind nach der Pause deutlich abstrakter als vor der Pause, da man sich offenbar in der fast alptraumhaften Gedankenwelt von Mrs. Smith befindet. Kaydanovskiy lässt die Darsteller passend dazu fast wie Puppen über die Bühne gleiten. Höhepunkt der Inszenierung ist sicher der Auftritt von sechs Doubles der Martins. Insgesamt können die Tänzer und Tänzerinnen des Ballett am Rhein auch in diesem halbstündigen Werk überzeugen. Sehr gelungen auch das Schlussbild, in dem sie an der Wand die Tapeten zerreißt und dahinter ihr Double in der scheinbar realen Welt sieht.

Obwohl zwischen beiden Chorografien über 55 Jahre liegen und sie aus heutiger Sichtweise mal mehr und mal weniger absurd daherkommen, ergänzen sich die beiden Ionesco-Werke auch heute noch gut zu einem unterhaltsamen Ballettabend. Das anwesende Premieren-Publikum spendet langanhaltenden Applaus und verlässt sichtlich vergnügt den Saal. Schön zu sehen, dass man mit einer gewissen Handlung innerhalb des Ballettabends offenbar den Geschmack der Zuschauer getroffen hat. Zu sehen ist diese Produktion noch bis Anfang Januar 2022 an fünf Folgeterminen.

Markus Lamers, 21.11.2021
Fotos: © Bernhard Weis
In neuem Gewand – „Tristan und Isolde“
Zweite Premierenkritik
Nach Düsseldorf erlebte nun auch das Duisburger Opernpublikum Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in der Bearbeitung von Eberhard Kloke als eine Art Kammeroper. Nur rund 30 Instrumentalisten verlieren sich im Orchestergraben, wo sonst gut und gerne 90 Orchestermitglieder den von Wagnerfans so inbrünstig verehrten Klangrausch entfalten. Ein Streichquartett, ergänzt durch ein Englischhorn, wird zum Mitspieler auf der Bühne und tritt in einen ständigen Dialog mit den Musikern im Orchestergraben. Eberhard Kloke äußert sich im instruktiven Programmheft der Duisburger Oper dazu so: „Meine Idee für die Fassung war, eine räumlich abgesetzte Klangebene zu etablieren, die mit der Vorgeschichte verbunden wird und dementsprechend die innere Handlung, das Unausgesprochene erzählt…Das Hauptorchester im Graben erzählt die Handlungsgegenwart, die äußere Handlung.“ Das gelingt vorzüglich. Das dialektische Motivgeflecht der Handlung von Tod und Leben, Tag und Nacht, Schuld und Sühne, Liebe und Entsagung wird auf musikalischer Ebene gespiegelt und verdichtet. Im 3. Akt tritt die Englischhornspielerin (eindrucksvoll: Kirsten Kadereit-Weschta) unmittelbar an Tristan heran und es entspinnt sich ein bewegender Dialog zwischen dem Titelhelden und seinem Gegenspieler, der Tristans schuldbeladene Erinnerungen und damit die Vorgeschichte der Handlung dem Hier und Jetzt gegenüberstellt.
Im 2. Akt beim großen Liebesduett, wo Tristan und Isolde den Liebestod beschließen, der allein Erlösung und im Sinne Schopenhauers Rückkehr ins Ur-Eine bedeutet, wird die Orchesterteilung folgerichtig aufgehoben. Und ein geradezu genialer Schachzug der Regie ist es, wenn Isolde in ihrem Schlussmonolog von weiteren Instrumentalisten umgeben wird, die einen „musikalisch transzendentalen Raum“ (Programmheft, S. 34) schaffen, der selbst den Tod überwindet.
Ansonsten gewinnt Regisseur Dorian Dreiher diesem musikalischen Neuansatz eher beiläufige Akzente ab. Streichquartett und Englischhorn werden an unterschiedlichen Orten auf der Bühne platziert, ins Licht gehoben und wieder ausgelöscht, ohne dass sich dadurch eine tiefere Sinndeutung erschließt. Ähnliches gilt für manche Requisiten des Bühnenbilds (Heike Scheele) im ersten Akt, das auf der unteren Ebene Einblick in die Schiffskabine von Isolde gewährt. Neben dem obligatorischen Kanapee, einem Schrankkoffer mit dem Hochzeitskleid Isoldes und weiteren Accessoires des Aufbruchs sieht man auch rätselhafte Requisiten wie einen Baumstumpf oder ein auf den Kopf gestelltes korinthisches Kapitell. Tristan und Kurwenal erscheinen im klassisch schwarzen Anzug (Kostüme: Ronja Reinhardt), Isolde trägt ein kostbares Gewand, ein Diadem im Haar und hüllt sich bei der Ankunft in Kornwall in einen himmelblauen Mantel, der ihr ein madonnenähnliches Outfit verleiht. Das Kästchen mit dem Liebestrank in Form eines goldenen Reliquienschreins und der große goldene Abendmahlkelch, den Brangäne vom Oberdeck des mit einem Rettungsring angedeuteten Schiffs durch eine Luke zu Tristan und Isolde herablässt, verleiht dem Geschehen ebenfalls einen mythisch-religiösen Anstrich. Eine Treppe verbindet das Oberdeck mit Isoldes Kabine. Es bleibt der Eindruck einer gewissen Beliebigkeit, wenn auch zugestanden werden soll, dass Dreiher die Geschichte von Tristan und Isolde verständlich und anschaulich erzählt, ohne dabei große Subtexte zu bemühen.
Schauplatz des zweiten Aktes ist der in hellem Weiß gehaltene Speisesaal im ersten Geschoss von Markes Domizil. Alle Akteure sitzen zunächst an einem langgestreckten Tisch, bevor Marke zur Jagd aufbricht. Zurückbleiben Isolde und Brangäne, bis Tristan den Schauplatz betritt. Ein weißer Vorhang verhüllt nun zunächst Saal und Tisch, Isolde und Tristan begeben sich nach draußen und nach unten in die Ebene, wo das herrliche Liebesduett leider recht unspektakulär und so gar nicht nachtromantisch (Licht: Volker Weinhart) an der Bühnenrampe erklingt. Dass die Liebe zwischen Tristan und Isolde nicht unbeobachtet bleibt, macht Regisseur Dorian Dreiher überdeutlich, wenn nun der Blick wieder auf die Tafel freigegeben wird, an der neben anderen auch Melot Platz genommen hat. Starr und unbeweglich beobachten sie die unheilvolle Begegnung der beiden Liebenden. Der Schluss des Aktes bringt dann noch eine überraschende Pointe. Melot fügt Tristan keine Verletzung zu. Die schwärende Wunde, die Tristan zu Tode quälen wird, besteht einfach darin, dass er von Isolde getrennt wird.
Folgerichtig erscheint Tristan im dritten Akt nicht als todkrank daniederliegender Patient in einem Krankenbett, sondern als einsamer und verlorener Besucher einer an Hoppers „Nighthawks“ erinnernde Cocktailbar. In seinem Inneren laufen Sehnsuchtsträume, Erinnerungen an die eigene Geburt und den traumatischen Verlust der Mutter ab, die auf der oberen Spielebene der Bühne als reales Geschehen eingeblendet werden. Dort erscheint nun doch zur Irritation des Betrachters auch Tristan in einem Krankenbett, an dem Kurwenal Wache hält und der zum Arzt mutierte Hirte seinem medizinischen Handwerk nachgeht. Nicht alle Regieeinfälle sind stimmig, wenn auch deutlich wird, dass Dreiher auf diese Weise die Vorgeschichte zu „Tristan und Isolde“ als wirkmächtige und unheilvolle Bürde für Tristan noch einmal abrundend aufgreift, eine Thematik, die schon im Entrée zum ersten Aufzug, nämlich einem Ausschnitt aus Aischylos „Orestie“, angesprochen wird. Erlösung gibt es nicht in der Liebe im Hier und Jetzt, sondern nur durch eine Entindividualisierung über den Tod hinaus. Isolde trifft deshalb auch Tristan nicht mehr im Diesseits als Lebenden an, sondern beschwört im Schlussmonolog das Ziel, „die als übermächtig empfundenen Versagungen durch Selbstvernichtung vergessen zu machen.“ (Sebastian Urmoneit im Programmheft).
Diesen Schlussmonolog singt Alexandra Petersamer in herrlichstem Piano und einer Verinnerlichung, wie man sie in früherer Zeit nur von einer Kirsten Flagstad oder aber der legendären Waltraud Meier vernommen hat. Überhaupt gibt die erst unlängst aus dem Mezzofach ins dramatische Sopranfach gewechselte Sängerin in Duisburg ein impo-nierendes Debüt als Isolde. Sie verfügt gerade in der Tiefe und der Mittellage über eine wunderbar – wie könnte es anders sein – dunkel timbrierte Stimme, die sich auch mühelos zu glasklaren Spitzentönen aufschwingt. Besonders im ersten Akt würde man sich allerdings gerade auch angesichts der kleinen Orchesterbesetzung wünschen, dass beson-ders in der Höhe Druck aus der Stimme genommen würde, damit die Spitzentöne besser in die Gesangslinie eingebettet sind. Insgesamt bleibt aber der Eindruck einer überragenden Interpretation vor allem in den lyrischen Abschnitten des Werks.
Imponierend ist auch die Leistung des schwedischen Tenors Daniel Frank. Er verfügt über eine baritonal gefärbte Stimme, die dennoch in der Höhe eine große Strahlkraft entwickelt. In den ersten beiden Akten hätte gerade auch beim Liebesduett im zweiten Akt allerdings eine stärkere Modulation, hier und da auch ein deutliches Zurücknehmen der Stimme eine noch größere Wirkung entfaltet. Im dritten Akt wächst Daniel Frank dann aber geradezu über sich hinaus. Mit großer Textdeutlichkeit, mit nie ermüdender Stimmkraft, vor allem aber mit einer wunderbarer Differenzierung lässt er den mörderischen Gesangspart der Fieberphantasien Tristans zum eigentlichen Höhepunkt des Abends werden. Eine bravouröse Leistung! Die bot vor allem auch Hans-Peter König als Marke. Der Bayreuth erfahrene Bassist, der im Wagnerfach in seiner langen Karriere an allen großen Opernhäusern der Welt gesungen hat, gibt mit seiner herrlichen, völlig unverbrauchten Stimme ein bewegendes Portrait des schmerzlich getroffenen, durch Tristan vermeintlich hintergangenen Königs. Katarzyno Kunico als Brangäne, Richard Sveda als Kurwenal, Dmitri Vargan als Melot und Johannes Preißinger als Hirte sind mehr als nur würdige Mitstreiter in diesem Terzett dreier großartiger Wagnersänger.
Rheinoper-GMD Axel Kober entlockt dem ausgedünnten Ensemble der Duisburger Philharmoniker einen transparenten und durchsichtigen, an den expressiven Stellen aber auch erstaunlich vollen und raumfüllenden Klang, sodass man fast vergaß, dass hier in Duisburg wie auch in Düsseldorf zuvor - der Pandemie geschuldet - nicht die originale Orchesterversion zu hören war.
Das Publikum im leider nicht ausverkauften Haus feierte Dirigent, Sängerinnen, Sänger und Regieteam mit minutenlangen Ovationen. Ein abgespeckter Tristan? Ja – aber diese Schlankheitskur eröffnet neue und interessante Höroptionen und gibt dem Sängerensemble reiche Möglichkeiten der Entfaltung. In Duisburg wurden sie genutzt.
Weitere Aufführungen am 06.11. und 14.11.2021
Norbert Pabelick, 5.11.2021
TRISTAN UND ISOLDE
Ein musikalischer Sonderfall
Premiere am 31. Oktober 2021

Foto: Klaus Billand
Am letzten Oktobertag feierte Richard Wagners „Handlung in drei Aufzügen“, sein legendäres Musikdrama „Tristan und Isolde“, an der Rheinoper Duisburg Premiere. Es war in gewissem Sinne eine Premiere, denn die Entstehungsgeschichte dieser Produktion ist eine ganze Besondere. Man hatte aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregeln, die im Mai 2020 auch für den Orchestergraben galten, der nun mal gerade bei Wagner-Werken sehr dicht besetzt ist, in Düsseldorf, dem Haupthaus der Rheinoper, nach einer Lösung gesucht, wie man das Orchester entflechten und dennoch eine ungekürzte Fassung spielen kann. Denn das war der Wunsch des Intendanten Christoph Meyer und von GMD Axel Kober: ein ungekürzter „Tristan“ sollte es sein, nicht wie die ebenfalls 2020 entstandene, massiv gekürzte Version an der Staatsoper Hannover.
Während Florian Dreher als Regisseur engagiert wurde, wandte man sich an den „erfahrenen und geschätzten Dirigenten, Komponisten, Arrangeur und Projektmacher Eberhard Kloke“, einen „etablierten Spezialisten für musikalische Bearbeitungen“, wie er in einem Interview mit der Dramaturgin Carmen Kovacs im zu den Besonderheiten des Projekts und der resultierenden Inszenierung ausführlich Stellung nehmenden Programmheft bezeichnet wird. Kloke, zur Zeit des Mauerfalls Chefdirigent der Bochumer Symphoniker, für die er schon einmal den 1. Aufzug des „Tristan“ „einrichtete“, hat schon etliche Opern-Fassungen und Arrangements gemacht und dabei Erfahrung mit verschiedenen Aufführungskonzepten mit Raum und Klang gewonnen. Es galt also offenbar, und das ist angesichts der damaligen Situation durchaus verständlich und nachvollziehbar, aus der (Corona-)Not eine Tugend zu machen, eine Fassung des „Tristan“ für kleines Orchester, eine ganz spezielle für die Rheinoper Düsseldorf/Duisburg – ein „Tristan“, „den die Welt so noch nie gehört hat“, wie ebenfalls dort zu lesen ist, was aber nicht automatisch ein Beleg für ein Gelingen ist.

Und damit ist das entsprechende Keyword gefallen – „gehört“. Denn das ist es, was diese Produktion in erster Linie verfolgt, und nicht immer zu ihrem Heil. Durch verschiedene Eingriffe in das musikalische Geflecht und vor allem die Instrumentierung sollte eine neue musikdramatische Sicht im Sinne einer Verdichtung, eine „komponierte Interpretation“ angestrebt werden. Diese sollte gleichzeitig immer wieder Bezug nehmen auf die Vorgeschichte, wobei man diese ja wie fast immer bei Wagner durch die Erzählung der Protagonisten im Stück selbst geliefert bekommt, wie hier von Isolde im Dialog mit Brangäne. Als weitere Beispiele mögen diesbezüglich dienen der Wotan-Monolog in der „Walküre“, der Prolog und die Waltraute-Erzählung in der „Götterdämmerung“, aber auch der „Holländer“-Monolog etc. So ist also auch im „Tristan“ nicht wirklich eine wie immer musikalisch besonders akzentuierte Vorgeschichte des Stücks zu erzählen, das ist bei Wagner alles in Wort (Isolde) und Musik schon enthalten und bezaubert jeden Wagner-Liebhaber bei einer guten Aufführung. Bei der ganzen Idee, eine spezielle Fassung zu entwickeln, spielte auch eine nicht unerhebliche Rolle, dass man – wiederum Corona-bedingt – in Düsseldorf im Juni/Juli 2020 nur jeweils immer einen Aufzug aufführen konnte, niemals das ganze Stück an einem Abend, weil es eben zu lang ist, was aber nun in Duisburg erstmalig möglich wurde.

Die Tugend, die Kloke also im Wesentlichen aus der (Corona-)Not zog, war die Etablierung einer „räumlich abgesetzten Klangebene“, die mit der Vorgeschichte verbunden wird und dementsprechend die innere Handlung, das Unausgesprochene erzählt. Das Hauptorchester im Graben erzählt hingegen die „Handlungs-Gegenwart, die äußere Handlung“. Das sieht dann so aus, dass ein Streichquartett als „kleinste orchestrale Basis“, zusammen mit dem berühmten Englischhorn aus dem 3. Aufzug auf der Bühne sitzt, einmal mehr im Vordergrund wie im 1. Aufzug, dann mehr im Hintergrund wie im 2., und manchmal ganz allein spielt, meist aber auch mit dem Orchester. Dass Vorspiel beginnt, ganz und gar ungewohnterweise, um es diplomatisch auszudrücken, mit dem Englischhorn und seiner Melodie aus dem 3. Aufzug. Diesem Instrument schreibt Kloke quasi eine „Tristan-Biographie“ zu, und deshalb ist es oft gemeinsam mit ihm auf der Bühne. Dann kommt das Streichquartett, im 1. Aufzug meines Empfindens mit seiner Solo-Rolle eher störend und die große Linie von Wagners so perfektem Klangfluss irritierend, der ohnehin alles an Gefühlen eingebaut hat, was hier denkbar wäre und ist. Im 2. Aufzug war es meist gar nicht zu hören und somit, de facto, integraler Teil des gesamten Orchesters. Kloke will dem Klang aber durch das Streichquartett auf der Bühne eine räumliche Dimension geben, die bis in den Zuschauerraum hineinreicht.

Das ist praktisch eine Inszenierung der Musik bzw. des Orchesters! Wer Bayreuth kennt, weiß, dass Wagner alles andere als genau das wollte und so das „unsichtbare Orchester“ schuf. Kloke hält aber in dem Interview den „verdeckten Bayreuther Orchesterklang spätestens seit der Erfindung der Mikrophonie und Lautsprecherklänge für obsolet“! Das Orchester dürfe nicht versteckt werden und man wolle es jetzt zeigen. Man muss sich angesichts solchen Kommentares schon fragen, ob Kloke jemals den legendären und durch keine Mikrophonie der Welt, die ohnehin nicht in die Opernhäuser gehört, ersetzbaren Bayreuther Mischklang selbst erlebt hat. Er ist ein wesentlicher Grund, warum immer noch so viele Wagner-Liebhaber alljährlich nach Bayreuth reisen, um den Begriff „pilgern“ zu vermeiden. Indem hier von einem permanenten Wechselbezug zwischen Vorgeschichte und gegenwärtiger Geschichte, also der Handlung stattfindet, will man durch die musikalische Optik auf der Bühne „diese Latenz nach außen kehren“ und so erst zwischenmenschliche Bezüge sichtbar machen. (Wer im Juli „Tristan und Isolde“ mit Anja Harteros und Jonas Kaufmann unter Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper erlebte, der kam mit der von Wagner vorgeschriebenen Orchestrierung im Graben diesbezüglich voll auf seine Kosten). In Duisburg hebt Axel Kober dagegen den Taktstock für die Musiker im Graben erst beim Tristan-Akkord des Vorspiels, nachdem zuvor außer der melancholischen retrospektiven Weise des Englischhorns und dem Spiel des stoisch dreinblickenden Streichquartetts noch ein Entrée geboten wurde, ein gesprochener Monolog aus der Orestie von Aischylos. Mir stellte sich das Ganze eher als Verzögerung dessen dar, was man erwartete, denn das war immer gut, weil Wagner genau wusste, was er komponierte und warum… Und statt einer Verdichtung wirkte es auf mich wie eine Entflechtung.

Die Platzierung der fünf Musiker auf der Bühne hatte neben einem optisch oft befremdlichen Eindruck, zumal es niemals zu einer auch noch so dezenten Interaktion in Mimik oder Blick mit den Sängern gab – um deren ganz persönliche Empfindungen es ja genau bei diesen Musikern gehen sollte – auch noch einen räumlich beengenden Effekt. Das oft auf zwei Ebenen konzipierte Bühnenbild von Heike Scheele musste erheblichen Raum an die Musiker abgeben. So kam es nur zu wenig Bewegung in der Szene, oft gar nur zu Rampensingen oder sogar Singen aus dem Sitz an einem langen Tisch im Mittelakt. Bei Markes Monolog geht der gute Hans-Peter König, ohnehin kein allzu begabter Sängerdarsteller, im Vordergrund auf und ab wie ein Eisbär im Zoo. Absurd wird es aber erst im 3. Aufzug, wenn der Hirte ein überaus geschäftiger Chefarzt ist, der büroktasich jede Regung des Patienten Tristan im Krankenhausbett aufzeichnet und einmal sogar eine Blutkonserve einhängt und erfolgreiche Wiederbelebungsversuche macht und dann noch fragt, als Arzt, „Was hat’s mit unserm Herrn?“ Was das sollte, kann wohl nur der Regisseur erklären. Kurwenal sitzt am, de facto, leeren Krankenbett, während Tristan unten an einer langen und bestens bestückten Bartheke über sein Schicksal sinniert, vokal bekanntlich äußerst fordernd. Zu einer Verletzung durch Melot war es nicht gekommen, wie auch alle am Ende überleben und die bei Wagner eigentlich Gefallenen Tristans schwarzen Sarg hinaustragen. Isolde bekommt bei ihrer Ankunft nur noch diesen Sarg zu Gesicht – auch wenn es anders gemeint sein soll, wieder einmal eine Entemotionalisierung einer emotional so bedeutenden Szene. Tristans finales „Isolde!“ kommt nur noch aus dem fernen Off…

Interessant hingegen sind einige historische Rückblicke, die vor dem dunklen Hintergrund über der Bar kurz eingeblendet werden. Man sieht kurz Tristans junge Mutter mit seinem gleich nach Zeugung gestorbenen Vater in eben dem Bette, in dem Tristan eigentlich vermutet wird, dann seine hochschwangere Mutter, ihr Tod bei Tristans Geburt und die Übergabe des Babys an König Marke – alles szenisch sehr gute Einfälle! Von den Kostümen her waren die Männer bis auf den Arzt im weißen Kittel in schwarze Anzüge gekleidet, die Damen wechselten öfter ihre Kostüme. Nichts einzuwenden, Ronja Reinhardt. Volker Weinhardt war für das kaum variierende Licht zuständig. Sängerisch stimmte viel mehr als szenisch und musikalisch. Daniel Frank war ein eindrucksvoller Tristan mit einem stabilen, etwas metallischen Tenor, der alle Höhen und Tiefen der so fordernden Rolle mit scheinbar großer Leichtigkeit meisterte und am Schluss noch ein wundervoll lyrisches „… Isolde! Wie schön bist du!“ singen konnte. Eine ganz große Hoffnung am immer grauer werdenden Wagner-Heldentenor-Himmel! Alexandra Petersamer gab ihr mit Spannung erwartetes Rollendebut als Isolde, und man merkte ihr beim begeisterteren Schlussapplaus an, das ihr ein großer Stein vom Herzen gefallen war. Sie hatte es auch einfach ganz großartig gemacht, sowohl durch eine intensive, offenbar auf eigenem Rollenstudium basierte Darstellung, wie auch durch einen eher tiefen Sopran – sie kommt ja vom Mezzofach – mit dem sie der Rolle die nötige Glut, Farbe und Dramatik geben konnte. Dass einige Spitzentöne leicht am Anschlag waren, fiel dabei nicht ins Gewicht, die hohen Cs hat sie alle gesungen. Petersamer gab zu jedem Zeitpunkt alles, was sie hat, und das war viel.

Der junge slowakische Bariton Richard Šveda sang einen wunderbaren lyrisch-klangvollen Kurwenal mit guter Resonanz und Diktion. Leider wurde er wegen der komischen Situation im 3. Aufzug von der Regie arg vernachlässigt. Man sollte ihn für höhere Aufgaben vormerken. Der bewährte Hans-Peter König war wieder einmal der stimmgewaltige souveräne König Marke. Wenn er nur etwas mehr aus sich heraus kommen könnte! Katarzyna Kuncio gab eine klangvolle und engagierte Brangäne auf guter Augenhöhe mit Isolde, sodass die Dialoge der beiden im 1. und 2. Aufzug zu den spannenderen Phasen der Aufführung gerieten. Herrlich klangen auch ihre Rufe in der Liebesnacht, die stehend als „philosophisches Gespräch“, laut Regisseur, vor einem Vorhang vollzogen wurde. Andrés Sulbarán sang einen lyrischen jungen Seemann. Dmitri Vargin als schmieriger Melot, Johannes Preißinger als „Hirt“ und Luvuyu Mbundu als Steuermann rundeten das sehr gute Sängerensemble ab.

Zum musikalischen Teil ist schon viel gesagt worden. Es war eben kein „Tristan“, wie man ihn gemeinhin kennt. Es war eine Fassung für die Rheinoper, auf die die Inszenierung zugeschnitten wurde. Corona-bedingt also am Ende wohl ein Sonderfall. Aber auch unter diesen besonderen Bedingenden machte Axel Kober mit den Duisburger Philharmonikern, ohnehin sehr Wagner-erfahren, das Beste. Er konnte das Orchester im Graben stets gut mit den fünf Musikern auf der Bühne koordinieren und dirigierte, auch aufgrund des kleineren Orchesters, natürlich sehr sängerfreundlich. Der bestens von Gerhard Michalski einstudierte Herrenchor der Deutschen Oper am Rhein sang ungewöhnlich kraftvoll aus dem Hintergrund. Bei Isoldes Liebestod kommen nach und nach viele zusätzliche Musiker aller Instrumentengattungen auf die leere Bühne und spielen mit Isolde ein emotional wirklich einnehmendes Finale. Hier stimmte dann die musikalische „Einrichtung“ einmal wirklich überzeugend. Der „Tristan“ an der Rheinoper wird wohl in die Rezeptionsgeschichte als Corona-bedingtes Experiment eingehen, dem aber das große Bemühen zu bescheinigen ist, auch bei schwierigen Umständen weitgehend bei Wagners Komposition zu bleiben. Und wer weiß, wie lange das noch so bleibt?!
Fotos: Hans-Jörg Michel
Klaus Billand/3.11.2021
www.klaus-billand.com
Meister Pedros Puppenspiel
Premiere Duisburg: 17.10.2021
Marionettenoper in einem Akt

Im Sommer 1923 feierte die Marionettenoper „Meister Pedros Puppenspiel“ von Manuel de Falla seine Premiere in Paris. Hierbei wurden seinerzeit noch alle Rollen von Puppen gespielt. Die folgenden Inszenierungen fanden meist auf größerer Bühne statt, so dass die Sänger ihre Rollen selbst spielten und die Puppentheatergeschichte durch meist stummes Spiel dargestellt wurde. Diese Variante hat auch die Deutsche Oper am Rhein gewählt, die bei ihrer Suche nach passenden Corona-Produktionen auf dieses Werk gestoßen ist. Die Premiere fand Ende September 2021 in Düsseldorf statt, geplant war sie ursprünglich schon im Jahr 2020. Am vergangenen Sonntag wurde das Werk auch erstmals in Duisburg aufgeführt. Da die Oper allerdings nur eine Spielzeit von rund 30 Minuten aufweist, entschied man sich dazu, als Vorspiel Igor Strawinskys „Danses concertantes“ zu ergänzen, zu dem auf der Bühne bereits der Aufbau des reisenden Puppentheaters stattfindet. Da Strawinsky seinerzeit auch live bei besagter Premiere im Publikum saß, hätte man keinen passenderen Komponisten finden können.

Zur Handlung: Bereits während das Puppenspiel aufgebaut wird, schaut sich Don Quijote das Treiben an und gibt sich dabei seinen Phantasien hin. Hierbei trifft er auch seinen Weggefährten Sancho Pansa. Nachdem alles aufgebaut ist und die Zuschauer Platz genommen haben, erzählen Meister Pedro und sein Junge mit dem Marionettentheater die Geschichte von der Prinzessin Melisendra, die von König Marsilius in seinen Palast nach Saragossa entführt wurde. Don Quijote ist von der Geschichte besonders ergriffen. Für den selbsternannten Ritter wird das Puppenspiel mehr und mehr zur Wirklichkeit und als es um die Befreiung der Prinzessin geht, greift Don Quijote entschieden mit seinem Schwert in die Geschichte ein. Die übrigen Zuschauer sind entsetzt und wenden sich von ihm ab, nur Sancho versteht die Fantasie und das gute Herz seines Herren.

Mit einer gesamten Spielzeit von rund 45 Minuten richtet sich das Werk vor allem an junge Zuschauer. Die Einführung zum Stück wird entsprechend kindgerecht gestaltet und auch die Inszenierung von Torge Möller und Ilaria Lanzino ist speziell auf dieses Publikum ausgelegt. Sehr gut gelungen ist hierbei die Integration des Marionettentheaters unter der Leitung von Anton Bachleitner, der die Figuren zusammen mit Anna Zamolska zum Leben erweckt. Im Übrigen ist es aktuell nahezu die einzige Gelegenheit, das Düsseldorfer Marionettentheater live zu erleben, da sie in ihrem eigenen kleinen Theater derzeit nach wie vor nicht spielen können. Die Einarbeitung der Greenscreen-Technik, mit dessen Hilfe Don Quijote in die Welt des Puppenspiels eintaucht, ist zweckmäßig. Allerdings hat man dies in den letzten Monaten an anderer Stelle auch schon deutlich effektvoller erleben dürfen. Dafür spielen die Duisburger Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Ralf Lange in gewohnter Qualität. Auch die Darsteller sind gut ausgewählt, Jake Muffett überzeugt als spanischer Ritter Don Quijote, an seiner Seite steht Frank Schnitzler als leicht tollpatschiger, aber liebenswerter Sancho Pansa in einer stummen Rolle. Johannes Preißinger als Meister Pedro und „Sein Junge“ Sander de Jong, sind leider akustisch nicht immer gut zu verstehen und da die Übertitel bei der Duisburger Premiere erst nach der Hälfte der Vorstellung einsetzen, erleichterte dies die Sache nicht zwingend. Da die Handlung aber recht einfach gehalten ist, ist dies zu verschmerzen. So fühlten sich die Erwachsenen in dem Fall wie die Kinder, die die Übertitel sowieso ignorierten. Gesanglich waren die drei Interpreten dagegen tadellos unterwegs.

Für Familien mit Kindern bietet „Meister Pedros Puppenspiel“ einen gelungenen kurzen Theaterbesuch. Aufführungen finden in den nächsten Wochen sowohl in Duisburg wie auch in Düsseldorf statt.
Markus Lamers, 19.10.2021
Fotos: © Jochen Quast
Masel tov! Wir gratulieren!
Premiere Duisburg: 25.09.2021
besuchte Vorstellung: 10.10.2021
Ein Plädoyer für die „Corona-Produktionen“
Mieczyslaw Weinberg ist sicherlich ein Komponist, von dem wenige bisher gehört haben. Wenn doch, dann wahrscheinlich vor allem auf Grund seiner Oper „Die Passagierin“. Dabei schuf Weinberg unter anderem sechs Opern, 26 Sinfonien und 17 Streichquartette. Hierbei lohnt sich ein Blick in seine interessante Biografie, zeigt sie doch vor allem in jungen Jahren ein Leben auf der Flucht. 1939 flüchtete Weinberg aus Polen vor der deutschen Invasion nach Minsk, von dort später nach Taschkent, wo er sein Geld vor allem durch usbekische Volksmusik verdiente. Im Jahr 1943 erhielt er eine förmliche Einladung von Dmitri Schostakowitsch, woraufhin er 1943 nach Moskau übersiedelte. Schostakowitsch war es auch, der sich Anfang 1953 vehement für seinen Freund einsetzte, als dieser wegen „bürgerlich jüdischem Nationalismus“ durch das Stalin-Regime verhaftet wurde. Nach Stalins Tod kam Weinberg frei und eine lange persönliche und künstlerische Rehabilitation begann. „Masel tov!“ vertonte Weinberg bereits in den 70er-Jahren in russischer Sprache, da eine Oper in jiddische Sprache zu der Zeit in der Sowjetunion keine Chance gehabt hätte. Hieraus ergibt sich auch der deutsche Doppeltitel, da es im russischen zum Begriff „Masel tov!“ keine direkte Übersetzung gab und man daher auf den russischen Titel „Wir gratulieren!“ setzte. Dennoch dauerte es bis zur Uraufführung am 13. September 1983 im Moskauer Kammermusiktheater noch eine ganze Zeit. Musikalisch greift Weinberg neben traditionellen jiddischen Lied- und Tanzformen ebenso auf bewährte Walzer-, Polka- und Galoppformen zurück.

Auf der Suche nach passenden „Corona-Produktionen“ mit einer Spielzeit von rund 90 Minuten hat die Oper am Rhein im vergangenen Jahr Weinbergs Oper „Masel tov! Wir gratulieren!“ ausgegraben, die auf einem Theaterstück von Scholem Alejchem basiert. Im vergangenen Herbst war die Oper für wenige Termine in Düsseldorf zu sehen, der geplanten Übernahme-Premiere in Duisburg kam dann der zweiten Lockdown dazwischen. In dieser Spielzeit sollte die Premiere hier nun aber wie geplant am 25. September stattfinden. Doch an dieser Stelle noch ein paar kurze Worte zur Handlung: Auf Grund der bevorstehenden Verlobung der Tochter von Madame, laufen in der Küche die Vorbereitungen auf das Festmahl. Die Köchin Bejlja hat alle Hände voll zu tun, den Ansprüchen der wenig charmanten Hausherrin gerecht zu werden. Auch das Dienstmädchen Fradl ist in die Vorbereitungen integriert, während der fahrende Buchhändler Reb Alter, nur zu einem Schwätzchen und zu einer warmen Mahlzeit vorbeischaut. Auch Chaim, der Diener aus dem Nachbaranwesen schaut vorbei, in der Hoffnung seine Angebetete Fradl zu treffen. Trotz der Arbeit lassen sich die vier den Spaß nicht nehmen und nach einigen Gläsern Alkohol hält Chaim um die Hand von Fradl an. Auch Reb Alter und Bejlja werden vom eigenen Glück überrumpelt. Alle vier beschließen im Rausche des eigenen Glückes, sich an der garstigen Madame zu rächen.

Die komische Oper bezieht ihren eigenen Charme vor allem durch die Ausgestaltung der vier Rollen voller Menschlichkeit. Die Inszenierung von Philipp Westerbarkei überzeugt hierbei durch eine gelungenen Personenführung, ohne das Werk hierbei überinterpretieren zu wollen. Bühne und Kostüme stammen von Heike Scheele, die eine schöne Küchenkulisse geschaffen hat. Auch die zeitlich angepassten Kostüme wissen zu gefallen. Unter der musikalischen Leitung von Ralf Lange spielen die Duisburger Philharmoniker auch in kleiner Besetzung gewohnt klangstark, ohne die fünf Darsteller hiermit zu übertönen. In der Rolle der Köchen Bejlja überzeugt Kimberley Boettger-Soller mit einer besonders warmherzigen Art. Norbert Ernst spielt den Buchhändler Reb Alter mit ebenso viel Charme wie gesanglicher Präzision. Lavina Dames gibt dem jungen Dienstmädchen Fradl einen sehr lyrischen Ton, während Roman Hoza als Chaim von den vier Hauptdarstellern wohl den kleinsten Part zu übernehmen hat. Nur die Rolle der Hausherrin Madame ist noch kleiner ausgefallen, tritt diese doch erst ganz zum Ende der Inszenierung persönlich in Erscheinung. Zuvor hört man sie nur immer wieder mal ihr Befehle in die Küche rufen. Sylvia Hamvasi rundet hier die passende Besetzung aller Rollen ab.

Zu sehen ist „Masel tov! Wir gratulieren!“ noch an drei Abenden im November im Theater Duisburg. Allen Opernfreunden seien die kleineren Corona-Produktionen durchaus ans Herz gelegt. So sind in den vergangenen Monaten einige spannende Werke entstanden, die es in dieser Form wahrscheinlich nie auf die große Opernbühne geschafft hätten, in direkter Konkurrenz zum etablierten Repertoire der deutschen Opernhäuser.
Markus Lamers, 17.10.2021
Fotos: © Sandra Then
LOST AND FOUND
Premiere: 19.06.2021
Ballett-Potpourri der Deutschen Oper am Rhein
Zum Ende der Spielzeit 2020/21 kommt es dann doch noch zur Vorstellung des neuen Ballettdirektors Demis Volpi am Theater Duisburg, nachdem man hier im Herbst vor dem Lockdown nur ein paar wenige „Erste Begegnungen“ mit der neuen Ballett-Compagnie des Balletts am Rhein erleben durfte. Auch Volpis neue Choreografie „A simple piece“ sollte ursprünglich bereits im Herbst auf der Duisburger Bühne zu erleben sein, wurde dann aber im wahrsten Sinne des Wortes in letzter Minute vom Lockdown eingeholt. Inzwischen war das Werk als Stream im Internet zu sehen, dennoch bildet es nun auch den Auftakt eines bunten Ballett-Potpourri unter dem Titel „Lost and Found“. Der Titel des Abends stammt daher, so Demis Volpi bei seiner kurzen Rede an das anwesende Publikum, dass man in den letzten Monaten zwar sehr viel verloren habe, aber es ein umso schöneres Gefühl ist, wenn man etwas Verlorenes dann doch noch wiederfindet. Umso schöner auch, dass Volpi und die gesamte Compagnie nach einem pandemiebedingten schwierigen Start nach der Ära Martin Schläpfer, nun hoffentlich regelmäßig vor Publikum auftreten dürfen.
 Mit „A simple piece“ schuf Volpi ein rund halbstündiges Werk mit einer sehr eingängigen a cappella Musik von Caroline Shaw, zu der jeweils vier Tänzer und Tänzerinnen sehr synchron verschiedenste sehr detaillierte Bewegungseinheiten darbieten. Hierbei tritt zwar mal der eine, mal der andere der acht Darsteller in den Vordergrund, auf größere Soli verzichtet Volpi hier aber zu Gunsten einer strikten Gesamtästhetik der acht Darsteller, die an diesem Abend einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnten. Ein gelungener Einstand in den Ballettabend. Nach einer ersten Pause folgen vier kleinere Werke, die einen Einblick in die Arbeit der letzten Monate der Tänzer und Tänzerinnen geben sollten, denn wenn auch keine Vorstellungen stattfinden konnten, wurde dennoch kreativ weitergearbeitet. Den Beginn machte Doris Becker mit Volpis Choreografie „Allure“, die er bereits 2012 zur jazzigen Musik von Nina Simone für das Stuttgarter Ballett schuf. Es folgte ein Pas de deux aus Andrey Kaydanovskiys „Love Song“, den Feline van Dijken und Eric White gefühlvoll auf die Bühne brachten. Angefangen beim ersten schüchternen Kennenlernen bis hin zum explosiven Höhepunkt erzählt Kaydanovskiy innerhalb weniger Minuten die komplette Geschichte des Liebespaares in eindrucksvollen Bildern.
Mit „A simple piece“ schuf Volpi ein rund halbstündiges Werk mit einer sehr eingängigen a cappella Musik von Caroline Shaw, zu der jeweils vier Tänzer und Tänzerinnen sehr synchron verschiedenste sehr detaillierte Bewegungseinheiten darbieten. Hierbei tritt zwar mal der eine, mal der andere der acht Darsteller in den Vordergrund, auf größere Soli verzichtet Volpi hier aber zu Gunsten einer strikten Gesamtästhetik der acht Darsteller, die an diesem Abend einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnten. Ein gelungener Einstand in den Ballettabend. Nach einer ersten Pause folgen vier kleinere Werke, die einen Einblick in die Arbeit der letzten Monate der Tänzer und Tänzerinnen geben sollten, denn wenn auch keine Vorstellungen stattfinden konnten, wurde dennoch kreativ weitergearbeitet. Den Beginn machte Doris Becker mit Volpis Choreografie „Allure“, die er bereits 2012 zur jazzigen Musik von Nina Simone für das Stuttgarter Ballett schuf. Es folgte ein Pas de deux aus Andrey Kaydanovskiys „Love Song“, den Feline van Dijken und Eric White gefühlvoll auf die Bühne brachten. Angefangen beim ersten schüchternen Kennenlernen bis hin zum explosiven Höhepunkt erzählt Kaydanovskiy innerhalb weniger Minuten die komplette Geschichte des Liebespaares in eindrucksvollen Bildern.
 Mit „Erbarme dich“ choreographierte die junge Neshama Nashman, seit Beginn der Spielzeit 2020/21 Mitglied des Balletts am Rhein, zu Johann Sebastian Bachs Auszug aus der Matthäus-Passion ein Solo für einen Tänzer. Eine beeindruckende Choreografie, die tief in die Seele eines Menschen schaut, exzellent dargeboten von Julio Morel. Nach diesem gelungenen Debüt folgte mit Hans van Manens „Solo“ ein Klassiker, welcher seine Uraufführung bereits 1997 mit dem Nederlands Dans Theater feierte. Ein nur siebenminütiges Werk, bei dem ein Solo auf drei Tänzer verteilt wird, die in einer Mischung aus enormer Geschwindigkeit und wunderbarer Eintracht die Bühne füllen. Auch dieses Werk hervorragend dargeboten von Tommaso Calcia, Miquel Martínez Pedro und James Nix, vor denen sich auch van Manen verneigte, der an diesem Abend persönlich zu Gast war.
Mit „Erbarme dich“ choreographierte die junge Neshama Nashman, seit Beginn der Spielzeit 2020/21 Mitglied des Balletts am Rhein, zu Johann Sebastian Bachs Auszug aus der Matthäus-Passion ein Solo für einen Tänzer. Eine beeindruckende Choreografie, die tief in die Seele eines Menschen schaut, exzellent dargeboten von Julio Morel. Nach diesem gelungenen Debüt folgte mit Hans van Manens „Solo“ ein Klassiker, welcher seine Uraufführung bereits 1997 mit dem Nederlands Dans Theater feierte. Ein nur siebenminütiges Werk, bei dem ein Solo auf drei Tänzer verteilt wird, die in einer Mischung aus enormer Geschwindigkeit und wunderbarer Eintracht die Bühne füllen. Auch dieses Werk hervorragend dargeboten von Tommaso Calcia, Miquel Martínez Pedro und James Nix, vor denen sich auch van Manen verneigte, der an diesem Abend persönlich zu Gast war.
 Zum Abschluss des Abends stand mit „Salt Womb“ von Sharon Eyal und Gai Behar ein Werk auf dem Programm, welches von einer selten erlebten Intensität durchzogen war. Die Musik von Ori Lichtik dröhnte in einer fast ohrenbetäubenden Lautstärke aus den Boxen, dazu explodierte das in schwarz gekleidete neunköpfige Tanzensemble förmlich zu den Perkussionschlägen. Eine gewaltige Kraftanstrengung für die Tänzer und Tänzerinnen, was man ihnen auch förmlich ansah. Nassgeschwitzt nahmen sie den großen Applaus des Publikums entgegen, welches trotz des schönen Wetters und dem zeitgleichen EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dennoch recht zahlreich den Weg ins Theater fand, zumindest unter der derzeit erlaubten geringen Auslastungsmöglichkeiten im Saal. Warum die Stadt Duisburg allerdings bei Temperaturen von 30 Grad den Verkauf von Wasser an ein zivilisiertes Publikum, welches sich an diesem Abend stets an alle Masken und Abstandsregeln hielt, für gefährlich hält, muss man bei allem gebührenden Respekt vielleicht nicht unbedingt verstehen.
Zum Abschluss des Abends stand mit „Salt Womb“ von Sharon Eyal und Gai Behar ein Werk auf dem Programm, welches von einer selten erlebten Intensität durchzogen war. Die Musik von Ori Lichtik dröhnte in einer fast ohrenbetäubenden Lautstärke aus den Boxen, dazu explodierte das in schwarz gekleidete neunköpfige Tanzensemble förmlich zu den Perkussionschlägen. Eine gewaltige Kraftanstrengung für die Tänzer und Tänzerinnen, was man ihnen auch förmlich ansah. Nassgeschwitzt nahmen sie den großen Applaus des Publikums entgegen, welches trotz des schönen Wetters und dem zeitgleichen EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dennoch recht zahlreich den Weg ins Theater fand, zumindest unter der derzeit erlaubten geringen Auslastungsmöglichkeiten im Saal. Warum die Stadt Duisburg allerdings bei Temperaturen von 30 Grad den Verkauf von Wasser an ein zivilisiertes Publikum, welches sich an diesem Abend stets an alle Masken und Abstandsregeln hielt, für gefährlich hält, muss man bei allem gebührenden Respekt vielleicht nicht unbedingt verstehen.
Markus Lamers, 20.06.2021
Fotos von oben nach unten: © Daniel Senzek / Bernhard Weis / Bettina Stöß
Boris Blacher
Romeo und Julia
Aufführung ohne Publikum 19. März 2021 / Stream bis 17. Oktober 2021
Kaum ein Komponist des vorigen Jahrhunderts hatte eine derart durch häufige Wechsel des Wohnorts bedingte kosmopolitische Jugend wie der 1903 in China geborene Boris Blacher. Sein aus Reval gebürtiger Vater war dort als Bankdirektor später dann als solcher in Sibirien und der Mandschurei tätig. Im Alter von ungefähr 20 Jahren wählte Boris Blacher nach Shanghai und Paris Berlin zu seinem Wohnort, wo er nach umfangreicher musikalischer Ausbildung Kompositionslehrer wurde und aufstieg zum Präsidenten der Akademie der Künste. Bis zu seinem Tode 1975 in Berlin war er als Komponist erfolgreich.
Obwohl er weitgehend atonal komponierte und durch zahlreiche Taktwechsel für rhythmische Abwechslung sorgte, ist seine Musik durchaus eingängig etwa in der Art von Strawinsky. Dazu trägt auch bei eine gewisse Leichtigkeit und genau dosierte musikalische Sparsamkeit führend zu „einem Minimum an Mitteln und einem Maximum an Wirkung dieser Mittel“, wie es der Musikwissenschaftler H.H. Stuckenschmidt ausdrückte.

Das gilt auch für seine Kammeroper in drei Teilen frei nach Shakespeare´s „Romeo und Julia“ in der Übersetzung von Schlegel/Tieck entstanden um 1943 und uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen 1950 unter der Leitung von Josef Krips mit Hilde Güden und Richard Holm in den Titelpartien. Nun gibt es zahlreiche – angeblich 42 - musikalische Bearbeitungen dieses Dramas. Noch 1940 wurde in Dresden eine Oper gleichen Namens von Heinrich Sutermeister unter der Leitung von Karl Böhm uraufgeführt. Boris Blacher komponierte aber mit einer Dauer von etwas mehr als einer Stunde von allen die kürzeste. Dazu konzentriert er die Handlung auf das eigentliche Drama der unglücklichen Liebe unter Verzicht auf die meisten Nebenhandlungen, fügt aber Elemente von pantomimischer Bewegung und Kabarett ein. Diese Oper wurde jetzt im Duisburger Haus der Deutschen Oper am Rhein am 19. März 2021 unter der musikalischen Leitung von Christoph Stöcker in der Inszenierung von Manuel Schmitt als Live-Stream produziert und ist als solcher bis zum 17. Oktober 2021 über operavision.eu zu sehen.
Die Handlung spielte in einem Einheitsbühnenbild, das eine viereckige von einem Lichtband umgebene Fläche darstellt (Bühne: Heike Scheele). Auf dieser „Kampfarena des Schicksals“ liefern sich auch gleich zu Beginn die verfeindeten Herren Capulet und Montague ein Degengefecht mit Julia dazwischen. Seitlich und nach hinten wurde die Bühne durch ein fast immer im Halbdunkel getauchtes (Licht: Thomas Tarnogorski) Holzgestell begrenzt, auf dem in halber Höhe ein Balkon verlief – entfernt erinnernd an eine Shakespeare-Bühne. Auf diesem Balkon durch Türen zugänglich trat der nur achtköpfige Chor in heutigen Kostümen (auch Heike Scheele) auf, einstudiert von Gerhard Michalski. Er spielte insofern eine Hauptrolle, als er oratorisch wie in der griechischen Tragödie die Handlung und die Gefühle der beiden Liebenden kommentierte, dies teils fast einstimmig teils sehr polyphon und teils in schnellem Sprechgesang. Er übernahm auch einzelne Rollen, wie etwa die des Paters, der Julia zum Scheintod riet und dessen verspätete Mitteilung an Romeo das traurige Ende des Dramas darstellte – eine großartige Leistung der Mitglieder des Opernchors und des Opernstudios. Den Bühnenvorhang hob und begann mit dem „Prolog“ ein Chansonnier als einziger nicht in heutiger Kleidung sondern in elisabethanisch-prächtigem Gewand, der auch in verändertem Kostüm bis hin zu einem der Zwanziger Jahre die einzelnen Akte eröffnete. Diesen spielte Florian Simson wie aus einem Kabarett entsprungen und milderte mit an Kurt Weill erinnerndem Tenor-Sprechgesang etwas die Tragödie der beiden Liebenden.

Als einzige ganz in weiß gekleidet konnten man bei beiden in Spiel und Gesang die zärtlichen Glücksmomente als auch die Todesverzweiflung nachempfinden. Passend zu Pandemie-Beschränkungen berührten sie sich auch in den Liebesszenen nie – immer blieb ein ganz geringer Abstand zwischen ihren Händen. Mit seinem helltimbrierten Tenor gelang Jussi Myllys in längeren Gesangslinien wie auch in kurzen Verzweiflungsausbrüchen eine eindringliche stimmliche Gestaltung des Romeo. Ebenso muß Lavinia Dames als Julia bewundert werden – Musikfreunden in NRW schon länger bekannt als Stipendiatin der Mozart-Gesellschaft Dortmund. Verzweifelt stellte sie stimmlich das Erschrecken bei der Erkenntnis dar, dass der von ihr bereits geliebte Romeo der feindlichen Familie angehörte. Mitleiderregend gelang ihr letzter Gesang vor ihrem Freitod. Das Liebesduett der beiden vor Romeos Abschied mit der Frage, ob der Gesang der Nachtigall oder der Lerche baldige oder spätere Trennung bedeutet, war ein musikalischer Höhepunkt der Aufführung, auch weil Boris Blacher hier den Text fast nicht gekürzt hat. Die weiteren sehr kurzen Nebenrollen waren passend besetzt, etwa Katarzyna Kuncio als über langes Mundstück Zigaretten rauchende Party-Lady Capulet, Günes Gürle als selbstgerechter Champagner trinkender Capulet. Aus dem ganz kurzen Auftritt der Amme gelang es Renée Morloc ihre Sorge um Julias Schicksal darzustellen.

Wieder ganz im Gegensatz zur Liebes-Tragödie und in Aufführungen meist gestrichen traten nach der Beerdigung der scheintoten Julia die dazu engagierten drei Musikanten auf, um in witziger Weise über ihren Beruf zu lästern, etwa, dass sie für ihren Goldklang nur mit Silberlingen bezahlt würden und sich über das Spiel der Kollegen lustig machten, die man deshalb „do-re-mi-fa-solen“ sollte. Die kleine Orchestergruppe von gerade acht Solisten und einem Pianisten - Mitglieder der Duisburger Philharmoniker - bildete unter Leitung von Christoph Stöcker mit den ganz verschiedenen musikalischen Formen zwischen nachempfundenen Barock-Tänzen, etwa beim Fest der Capulets, bis hin zu Jazz-Anklängen das musikalische Fundament der Aufführung. Lyrische Momente bleiben bei Begleitung von Romeo und Julia durch Flöte und Fagott in Erinnerung.
Bevor der Chansonnier den Vorhang herunterzog, lagen die gestorbenen Liebenden noch immer getrennt voneinander auf der Bühne – nicht einmal im Tode ein Happy-End. Da wirkten die Schlußworte des Chores (in deutscher Übersetzung), es gäbe niemals ein so herbes Los als das Julias und ihres Romeos um so eindringlicher.
Trotz oder auch wegen der wenigen nicht ganz so tragischen Szenen kann der Stream dieses „Sommernachtsalbtraums“, wie ihn das Theater nennt, sehr empfohlen werden.
Sigi Brockmann, 26. April 2021
Fotos: Hans-Jörg Michel
Kein Happy End im Tod
Roméo et Juliette
Premiere am 01.02.2020
Romeo und Julia sind durch Shakespeares Tragödie zum bekanntesten Liebespaar der Literaturgeschichte geworden, wenn sie auch in Hero und Leander, Pyramus und Thisbe, Tristan und Isolde, Flore und Blanscheflur sowie Troilus und Cressida bedeutende Vorläufer haben. Gounod und seine Librettisten Jules Paul Barbier und Michel Florent Carre verändern die berühmte Vorlage nur in wenigen Punkten. Juliettes Vater (mit knatschgelbem Sakko) ist nun Witwer und sorgt sich deshalb um Bestand und Erbe seiner angesehenen Familie. Die Heirat Juliettes mit Graf Paris gewinnt dadurch eine besondere Bedeutung. Für Juliette indes ist die Heirat ein Schreckensszenario. Sie will frei sein und leben. Die halsbrecherischen Koloraturen in ihrer großen Arie „Je veux vivre“ zeigen eindrucksvoll ihre Verzweiflung und Panik angesichts der bevorstehenden Zwangsheirat. Im 1. Bild des 4. Akts kommt es anders als bei Shakespeare dann tatsächlich zu der Hochzeitsfeier zwischen Graf Paris und Juliette, bei der Juliette dank des Schlaftrunks von Bruder Laurent zum Entsetzen der Festgesellschaft effektvoll scheinbar tot zu Boden sinkt. In der Oper endet die Tragödie anders als im Schauspiel nicht mit der Versöhnung beider rivalisierender Familien, sondern mit dem Tod Romeos und Juliettes.
Mit diesen Änderungen rücken Gounod und seine Librettisten den tragischen Konflikt der Liebenden ganz ins Zentrum der Partitur. Vier große Duette zwischen Juliette und Romeo zeigen die Entwicklung ihrer Liebe von der ersten Begegnung auf dem Fest der Capulets über die gegenseitige, fast scheue Erklärung ihrer Zuneigung in der berühmten Balkonszene, über den schmerzlichen Abschied bis zur Vereinigung im gemeinsamen Tod. Die Aussöhnung der verfeindeten Familien steht bezeichnenderweise bei Gounod nicht explizit wie bei Shakespeare am Ende der Tragödie, sondern der selbstbestimmte Tod der Liebenden, der als ein Sieg über das Schicksal und alle gesellschaftlichen Widerstände, als ein letzter bitterer Triumph über Engstirnigkeit, Vorurteile und unheilvolle Zufälle zu verstehen ist.
Philipp Westerbarkei verweigert in seiner Inszenierung den Liebenden ihr tragisches Happy End. Roméo stirbt, wobei er nicht Juliette, sondern deren Hochzeitskleid in den Armen hält. Juliette aber bereitet ihrem Leben mit dem Dolch in der Hand kein Ende, sondern fügt sich dem Vater und schreitet zur Hochzeit mit Graf Paris.
Im ausführlichen Interview im Programmheft erläutert Westerbakei diese Umdeutung so: Er möchte zeigen, „wie Julia durch die gesellschaftlichen Verhältnisse letztlich zur Mörderin Roméos wird und in ihrem eigenen Leben erstickt“. Er wolle den Mythos auf seinen Wahrheitsanspruch prüfen. Dem Zuschauer erschließt sich der Sinn dieser Neudeutung nicht, wie auch viele andere Regieeinfälle eher verstören als zur Erhellung der Tragödie beitragen. In den Pausen zwischen den einzelnen Bildern sieht man ein junges Liebespaar vor dem Vorhang, das aufgrund seiner identischen Gewandung offensichtlich die jungen Liebenden darstellen soll. Sie streiten und lieben sich, wenden sich voneinander ab und kommen wieder zusammen, während dumpfe, langsam ersterbende Herzklopfgeräusche wohl auf das tragische Ende dieser Liebe vorausdeuten sollen. Wie wenig diese Personenverdoppelung durchdacht ist, wird dann dadurch deutlich, dass die beiden jungen Liebespaardarsteller im 4. und 5. Akt gar nicht mehr auftauchen. Eher komisch erscheint auch die Idee, den toten Tybalt bei der Hochzeitsszene blutverschmiert auf der Bühne herumtorkeln zu lassen. Zu allem Überfluss muss er auch noch an seiner eigenen, mumienhaft eingewickelten Leiche herumnesteln, die als böses Omen auf einigen Stühlen im Vordergrund der Bühne abgelegt wird. Rätselhaft bleibt auch, warum sowohl Tybalt Mercutio wie auch Roméo Tybalt ganz offensichtlich nicht im Kampf, sondern arglistig und ohne Not erdolchen. Und warum müssen die Chormitglieder, die vor allem in den Kampf- und Festszenen arg statisch agieren, andauernd die Hände zum Himmel recken? Das im Hier und Jetzt angesiedelte Bühnenbild (Tatjana Ivschina) wirft ebenfalls viele Fragen auf, ohne schlüssige Antworten zu bieten. Die Felsenlandschaft mit illuminierter Grotte für die Gottesmutter soll angeblich auf die hitzige Stimmung während Ferragosto erinnern, bei der die allgemeine Fröhlichkeit schnell in Gewalt und Messerstecherei umschlägt. Nun gut. Aber die Massen von Stühlen, die entweder auf der Bühne herumliegen oder zu einem Turm aufgeschichtet werden, entwickeln wahrlich keinen südländischen Flair und verhindern in der poetischen Balkonszene, in der Juliette auf diesem Stuhlturm stehen muss, jegliche Stimmung. Immerhin findet dann doch noch so etwas wie Atmosphäre statt, wenn in der wunderschönen wehmutsvollen Abschiedsszene von Juliette und Roméo („Es war die Nachtigall und nicht die Lerche“) Lichter auf die Bühne sinken und von einem großen Spiegel reflektiert werden.
Und auch aus dem Orchestergraben strömt das, was die Inszenierung nicht bietet oder aber nicht bieten will, nämlich Sentiment und große Gefühle. Marie Jaquot am Pult der Duisburger Symphoniker bringt die schwelgerische, z.T. elegische, immer ungemein melodiöse vorimpressionistische Musik Gounods wunderbar zum Klingen. Sie ist eine einfühlsame Begleiterin der Sängerinnen und Sänger und treibt den Chor der Deutschen Oper am Rhein (Gerhard Michalski) zu einer bewundernswerten, fast sakralen Klangfülle. Sie trifft damit den Stil der Chorkompositionen Gounods in dieser Oper – Gounod hat sich schließlich vor seinen großen Opern in der Kirchenmusik einen Namen gemacht – genau.
Sylvia Hamvasi als Juliette ist seit 2001/02 Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein und ist in unzähligen Partien als lyrischer Sopran zu einem Publikumsliebling in Düsseldorf und Duisburg avanciert. Über das Koloraturfach ist sie eigentlich hinausgewachsen. Sie ist in dieser schönsten tragischen Liebesgeschichte der Opernliteratur kein junges Mädchen, sondern eine gereifte Frau. Die Stimme klingt deshalb auch in den eher elegischen, verhaltenen Passagen der Partitur am schönsten. Die Koloraturen und vor allem auch die expressiven Fortissimostellen in den Ensembleszenen bewältigt Sylvia Hamvasi immer noch mit Bravour, wenn auch der ein oder andere Ton etwas scharf klingt und die Leichtigkeit einer jungen Kolorateuse vermissen lässt. Als Roméo verfügt der argentinische Tenor Gustavo Gennaro über eine lyrische, für das französische Fach in Klangfarbe und Ausdruck beinahe ideale Tenorstimme, die er vor allem in den Duetten und in seiner berühmten Arie im 2. Akt geschmackvoll einsetzt. In den großen Ensembleszenen fehlt freilich die große Durchschlagskraft, da wirkt die Höhe eher angestrengt und gepresst. Besonders in der großen Todesszene im 5. Akt trumpft Gustavo Gennaro aber noch einmal mit großer Leidenschaft auf und wächst über sich hinaus. David Fischer als Tybalt, Emmett O‘ Hanlon als Mercutio, Thorsten Grümbel als Bruder Laurent, Bruno Balmelli als Graf Capulet, Katarzyna Kunico in der undankbaren Rolle als Gértrude, vor allem aber Miriam Albano als Stéphano agieren mit großem Engagement und tragen nicht unwesentlich zu dem musikalischen Erfolg des Abends bei.
Das Publikum im gut besuchten Haus feierte die Sängerinnen und Sänger mit lang anhaltendem Beifall. Auch das Regieteam wurde mit freundlichem Applaus bedacht, in den sich zwar wenige, dafür aber umso lautere Buhrufe mischten.
Fazit: Das musikalische Niveau der Aufführung lohnt den Besuch in Duisburg auf jeden Fall.
Weitere Termine: 08.02./18.02./29.04.2020
Norbert Pabelick, 03.02.2020
Zum Ersten
La Bohème
Premiere: 08.11.2019
Ist das Kunst oder kann das weg?

Echte Premieren der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg sind selten, am vergangenen Freitag war es wieder mal soweit. Mit La Bohème von Giacomo Puccini stand ein Klassiker des Opern-Repertoire auf dem Spielplan. So muss zum eigentlichen Inhalt des Stückes an dieser Stelle wohl auch gar nichts mehr gesagt werden. Dennoch schaut mal als Kritiker vor jeder Vorstellung immer wieder gerne ins Programmheft. Hierbei stolpert man dann bei der Handlung über in Fettschrift eingefügte Abschnitte. Noch vor dem ersten Bild heißt es beispielsweise: „Rodolfo liebte einst Lucia, die alle Mimi nennen. Doch es war eine zerstörerische Liebe“. Dies lässt aufhorchen, Regisseur
Philipp Westerbarkei will uns offenbar einen Rückblick auf vergangene Ereignisse aus der Erinnerung des Rodolfo zeigen. Da sowas relativ schnell schief gehen kann, geht man bereits vor der Vorstellung mit leicht gemischten Gefühlen in den Theatersaal. Da aber La Bohème wie vielleicht keine andere Oper auch in der eigentlichen Handlung von Erinnerungen zerrt, ist der bereits allzu oft gewählte Ansatz vielleicht doch kein so schlechter. Gespannt hebt sich der Vorhang, der auch nochmal mit einem eingeblendeten Schriftzug auf eben diesen Regieansatz eindrucksvoll hinweist.

Was nun folgt ist allerdings kein einfach zu verstehender Theaterabend. Die Handlung spielt komplett in einem gekachelten Raum, der wohl eine Art Sanatorium darstellen soll, so richtig ist dies aber nicht einzuordnen. Hierin bewegen sich die Darsteller als Erinnerungen in Rodolfos Kopf, relativ einheitlich gekleidet. Rodolfo schreibt permanent an seinem Roman oder auch an seiner eigenen Biografie, wie auch immer. Wenn ein Darsteller gerade nicht beteiligt ist, sitzt er dennoch in einer Ecke rum oder stellt sich mit dem Gesicht zur Wand an den Rand der Bühne. Um nochmal das Programmheft zu zitieren: „Realität, Fantasie und Wahn vermischen sich immer mehr.“ Hin und wieder gelingen Westerbarkei dabei durchaus eindrucksvolle Bilder, insbesondere wenn im zweiten Akt das Pariser Leben in Form einer alten Postkarte auf der oberen Bühnenhälfte oberhalb des besagten Raumes stattfindet. Hier zeigt auch Tatjana Ivschina, verantwortlich für Bühne und Kostüme, was möglich wäre. Ein schönes Bild für die gebliebene Erinnerung. Doch insgesamt wirkt alles allzu oft nur wirr und die Abgrenzungen zwischen Gegenwart und Vergangenheit sind einfach nicht zu erkennen.

Unklar bleibt auch, warum im dritten und vierten Akt die Wände des Raumes noch viel höher werden, fühlt sich Rodolfo zunehmend mehr gefangen und die rettende Leiter ist zudem unerreichbar im Nirgendwo endend angebracht? Man weiß es einfach alles nicht so genau. Wenn beim Schlussbild der für Mimi herbeigerufene Arzt schlussendlich zum Doktor der Gegenwart für Rodolfo wird, versöhnt dies vielleicht etwas. Solche logischen Verbindungen zwischen den zwei Ebenen hätte es vielleicht mehr gebraucht. So verwundert es auch nicht, dass das Kreativteam beim Schlussapplaus neben durchaus frenetischen Jubelrufen auch mit mehreren lautstarken Unmutsäußerungen konfrontiert wurde, die man in dieser Deutlichkeit bei dem doch sehr gemäßigten Premierenpublikum der Deutschen Oper am Rhein eher selten vernimmt
Uneingeschränkten Jubel gab es dagegen für die musikalische Seite. Liana Aleksanya als Mimi und Eduardo Aladrén als Rodolfo wurden ebenso wie das zweite Bühnenpaar bestehend aus Lavinia Dames als Musetta und Bogdan Baciu als Marcello lautstark bejubelt. Insbesondere der letztgenannte Bariton Bogdan Baciu verfügt über eine wunderbare Klangfarbe, die durchaus nochmal separat erwähnt werden muss. Auch die weitere Besetzung ist durchaus stimmig und die Duisburger Philharmoniker zeigen sich unter der musikalischen Leitung von Antonino Fogliani gewohnt gut einstudiert.

Alles in allem bleibt eine musikalisch mehr als nur solide Darbietung, bei der das Inszenierungskonzept aber leider zu konzeptlos erscheint. Dennoch ist die in der Überschrift gestellte Frage klar zu beantworten. Weg kann grundsätzlich gar keine Inszenierung, denn auch hier steckt eine Menge Arbeit vieler Beteiligten drin. Das Kunst aber durchaus spalten kann, demonstrierte das Premierenpublikum am Freitag beim Schlussapplaus sehr eindrucksvoll.
Markus Lamers, 10.11.2019
Bilder: © Hans Jörg Michel
Zum Zweiten Premierenbericht
LA BOHEME
Giacomo Puccinis La Bohème ist eine Liebesgeschichte. Vielleicht sogar eine der schönsten Liebesgeschichten, die je für die Oper vertont wurden. Die Musik des italienischen Opernkomponisten ist voller Emotionen, sie nimmt uns förmlich an die Hand und führt uns durch die Handlung und sie berührt uns auf eine nahezu kaum zu beschreibende Weise. Nicht zu Unrecht ist diese Oper einer jener Werke, die auf allen Spielplänen dieser Welt zu finden ist. Sie ist eine der am meisten aufgeführten Opern überhaupt. Sie hat ihren eigenen Zauber. Regisseur Philipp Westerbarkei hat nun in Duisburg seine Sicht auf diese Oper dargestellt. Inmitten einer kühlen, sterilen Umgebung, einem Sanatorium gleich, lässt er den Poeten Rodolfo sinnieren und leben und die gesamte Handlung (mit-)erleben. Alles spielt in einem Raum. Nur einmal, im zweiten Bild, teilt sich die Bühne und gibt die Sicht frei auf den Chor und das Treiben rund um das Café Momus, in dem sich alle treffen wollten. Eigentlich. Aber auch das ist eher angedeutet, als für den Zuschauer miterlebbar. Vieles in dieser Inszenierung wirkt analytisch und mehrfach durchdacht, aber bleibt in der Wirkung kühl und steril. Der erwähnte Zauber dieser Oper stellte sich leider nicht in dem Maße ein, der von vielen erhofft war und die lautstarken Missfallensäußerungen von Teilen des Publikums richteten sich am Ende dann auch gegen das Regieteam. Ganz anders bei der musikalischen Umsetzung: Dort feierte das Publikum das Ensemble, das Orchester und den Musikalischen Leiter des Abends, den italienischen Dirigenten Antonino Fogliani.
Mimi liegt auf einer Art Sofa, bedeckt von Tüllröcken und streckt ihre Hand aus in Richtung Rodolfo. Der kauert seitlich neben ihr und als er ihre Hand spürt zieht es ihn augenblicklich zu ihr. Da spielten Handlung, Regie und Musik gemeinsam La Boheme. Aber dann begab sich die weitere Handlung wieder auf eine andere Sichtebene. Zum Sterben steht Mimi von ihrem Sofa auf, geht in einen hinteren, für den Zuschauer dann nicht mehr zu erkennenden Bühnenbereich, in dem sich bereits schon alle weiteren Charaktere dieser Oper befinden. Ein Arzt (Psychiater ?) tritt auf, spricht Rodolfo Mut zu („Coraggio…!„) und Rodolfo schreit seine verzweifelten „Mimi…Mimi-Rufe“ heraus. Mit den letzten Klängen der Oper öffnet sich dann eine Tür und eine elegant gekleidete Mimi, mit einem frischen Blumenstrauß in der Hand, betritt die Bühne. Ein Abschied, wie sie ihn sich bereits im dritten Bild der Oper ersehnt hatte. Im Frühling, wenn die Blumen blühen. Den aber Puccini so nicht vorgesehen hatte. Bei Puccini ist es im kalten Winter, jener Jahreszeit, wo eben keine Blumen blühen. Und er macht dies auch durch seine Musik so deutlich. Der Schlussakkord der Oper spiegelt die Dunkelheit und die Kälte des Moments wieder und auch die Verzweiflung, die Rodolfo, Musetta und seine Freunde gepackt hat. Das gilt es auch den Zuhörern im Opernhaus zu vermitteln.
Selbstverständlich war es für die fiktiven Akteure dieser ursprünglichen Handlung (Romanvorlage Les scènes de la vie de bohème von Henri Murger) ein trostloses Leben. Ohne Arbeit, ohne Geld, Mietschulden, aber mit vielen unerreichbaren Plänen im Kopf, leben der Dichter Rodolfo und seine drei Freunde in einer spärlich ausgestatteten Pariser Mansardenwohnung. Alle vier Bohémiens wünschen sich ein Leben in Freude und mit Erfolg. Und sie sehnen sich auch nach Liebe. Bei Rodolfo und Marcello scheint sich zumindest dieser Wunsch zu erfüllen. Am Ende aber dann voller Tragik für Rodolfo. Aber auch in den traurigen Augenblicken dieser Oper versuchen die vier Freunde der Tristesse ihres Lebens zu entfliehen, sie lachen, treiben Scherze, foppen ihren Vermieter und doch bleibt am Ende immer eine Traurigkeit zurück. Hier weiss Philipp Westerbarkei anzusetzen. Das gelingt aber auch nur bedingt. Wenn er die vier Männer in Tüllröcken tanzen lässt, mag das zwar auch eine Form von ihm sein, einen Ausdruck, bzw. eine wichtige Szene der Oper, zu paraphrasieren, aber es hapert an der Wirkung des Ganzen. Dass die Freunde fast in der gesamten Oper, mehr oder weniger gekleidet, mit Feinrippunterhemden auf der Bühne agieren, mag auch ein Hinweis darauf sein, welch „brotlose“ Kunst sie betreiben, aber da die Oper um die kalte Weihnachtszeit herum spielt, passt auch dies nicht zusammen.
Damit komme ich auf meine eingangs gemachten Bemerkungen zurück: Eine La Bohéme ist eine Liebesgeschichte. Sie ist einfach, aber auch tiefgründig. Und sie erzählt vom Leben. Leben in seinen vielen Facetten, die wir alle kennen. Da kann man deuten und ausleuchten, was immer man will – am Ende ist es doch immer das pure Leben.
Mich hat die Duisburger Inszenierung dieser Puccinioper nicht in der Weise angesprochen, oder gar berührt, die es mir möglich gemacht hätte, hier nun im einzelnen darauf einzugehen. Andere mögen das anders sehen. Das eigene Opernerleben ist nun mal auch immer eine sehr subjektive Sicht. Sie kann nie den Anspruch der allgemeinen Gültigkeit erheben. Aber sie kann vielleicht herhalten als Erklärung dafür, dass Worte fehlen.
Ich frage mich schon länger, ob es Aufgabe des Publikums ist, Intentionen, Überlegungen oder gar Überzeugungen von Opernregisseuren zu deuten oder ob es nicht eher so sein sollte, dass uns die Regie die eigenen Ansichten und Aspekte ihrer Arbeit so verdeutlicht, dass sie auch im Sinne der jeweiligen Oper verstanden werden? Und muss das eigentlich so sein? Ist die Sprache der Musik nicht schon beredt genug?
Daher möchte ich nun auf die musikalische Seite dieser Duisburger Opernpremiere eingehen. Und da gab es durchaus sehr bemerkenswertes zu berichten:
Als Mimi fand Liana Aleksanyan berührende gesangliche Momente. Ihre Wandlung von der anfangs schüchternen und naiven Mimi hin zu der leidenden und todkranken Frau war eindrucksvoll. Mit sehr viel Gefühl und Ausdruck in der Stimme gestaltete sie insbesondere ihre Arie im dritten Bild, „D’onde lieta uscì“ und war als sterbende Mimi im letzten Bild absolut überzeugend und vermittelte dem Publikum dieses ganz spezielle „La Boheme-Gefühl“, für das sie am Ende hoch verdient vom Publikum gefeiert wurde.
Eduardo Aladrén als kraftvoll singender, insbesondere auf die Spitzentöne zuarbeitender, und engagiert spielender Rodolfo wusste das Premierenpublikum ebenfalls zu überzeugen. Der spanische Tenor lebte sich in seine Partie völlig ein. Gerade in den Szenen von Rodolfos Trauer und Verzweifelung gelang Aladrén dieses mit seinen stimmlichen Mitteln durchaus emotional zum Ausdruck zu bringen. Auch er erhielt am Ende verdienterweise großen Applaus.
Als Marcello legte Bogdan Baciu eine gesangliche und darstellerische Leistung hin, für die er auch auf vielen anderen Opernbühnen dieser Welt gefeiert worden wäre. Der rumänische Bariton, der vom Publikum bejubelt wurde, hat am gestrigen Abend auf ganzer Linie überzeugt. Bravo Herr Baciu!
Die Rolle der Musetta lag ihr: Lavinia Dames gelang der darstellerische Spagat von der flatterhaften Musetta, die sie Anfangs war, zur selbstlosen Helferin dann im letzten Bild der Oper, ungemein glaubwürdig und überzeugend. Großartig auch wieder mal Richard Šveda als Schaunard. Mit viel Körpereinsatz und starker stimmlicher Präsenz wusste er auch dieses Mal wieder auf der Bühne der Deutschen Oper am Rhein zu begeistern. Mit Luke Stoker als Colline war auch diese Partie absolut überzeugend besetzt. Voller Wehmut im Klang seiner Stimme gestaltete er die „Mantel-Arie“ im vierten Bild der Oper. Peter Nikolaus Kante überzeugte in den kleinen Partien des Benoit und Alcindoro, und auch als Dottore.
Antonino Fogliani am Pult der glänzend aufspielenden Duisburger Philharmoniker sorgte dann für den musikalischen Zauber dieser La Bohème-Premiere. Mit viel Gespür für die dramatischen – als auch für die stillen – Momente der Oper hatte er die musikalische Leitung des Abends inne. Große Anerkennung für den italienischen Dirigenten der diese Oper souverän und auch mit viel Emotionalität leitete. Jubel auch für ihn und die Philharmoniker.
Detlef Obens 11.11.2019
Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
Bilder siehe Erstbesprechung oben
PIQUE DAME
Hooray for Hollywood…
Premiere Duisburg: 28.09.2019
besuchte Vorstellung: 03.10.2019
Lieber Opernfreund-Freund,
das Theater Duisburg als kleineres Haus in der kleineren Stadt steht in der Theaterehe der Rheinoper bzgl. der Spielplangestaltung immer ein wenig im Schatten des größeren Partners Düsseldorf. So wird hier beinahe schon traditionellerweise nur eine „echte“ Neuproduktion pro Spielzeit aus der Taufe gehoben (heuer Puccinis Bohéme), während die übrigen Werke bereits vorher knapp 50 Flusskilometer rheinaufwärts gezeigt wurden. So verhält es sich auch mit Tschaikowskys Pique Dame, die man in Düsseldorf in der Lesart der US-amerikanischen Regisseurin Lydia Steier schon seit dem Frühjahr kennt und die nun in geänderter Besetzung in Duisburg auf dem Spielplan steht.

Vielleicht hat es mit ihrer Herkunft zu tun, dass Lydia Steier die Handlung der auf einer Novelle von Alexander Puschkin basierenden Geschichte ins Hollywood der 1950er Jahre verlegt. Hermann, schon in der literarischen Vorlage und später bei Tschaikowsky absonderlicher Außenseiter der Gesellschaft, ist hier der Woody Allen im Cordanzug inmitten von perfekt gestylten Stars und Sternchen der auf Kommerz ausgerichteten Filmwelt, wird verlacht und ausgegrenzt von den wild feiernden Gästen einer Poolparty und zudem nicht ganz ernst genommen von der alternden Filmdiva, zu der Steier die Titelfigur macht. Doch er ist nicht der einzige, der abseits steht. Auch Lisa passt nicht so recht ins sonst optisch aalglatte Hollywood, trägt ein dickes Kassengestell zum übergroß geblümten Kleid und fühlt sich von Hermann gerade deshalb verstanden, weil er sie trotz ihrer ungelenken Art so nimmt, wie sie ist, weil er sie dennoch „Göttin“ und „Engel“ nennt. Hermann steigert sich in der Geschichte immer mehr in den Wahn hinein, dass er mit dem geheimen Wissen der Alten um drei magische Karten beim Spiel den Jackpot knacken und dann – finanziell unabhängig – mit Lisa dem oberflächlichen Umfeld entkommen könnte. Doch, so ist das für gewöhnlich mit dem Wahn, er greift um sich, lässt Hermann den Bezug zur Realität verlieren und letztlich auch die Beziehung zu Lisa. Er kann Traum, Wahn und Wirklichkeit immer weniger voneinander unterscheiden, sieht immer öfter sich selbst als Kind. Die junge Lisa bleibt ohne Hoffnung und sucht desillusioniert den Freitod; Hermann erscheint da der Geist der Alten und der des Kindes schon permanent und er erkennt, dass es für ihn kein lebenswertes Leben mehr gibt.

Lydia Steier gelingt auf der durchdesignten Bühne von Bärbl Hohmann eine schlüssige und unterhaltsame Aktualisierung des Stoffes, auch wenn sie im letzten Bild bei der Visualisierung von Hermanns alptraumhaften, surrealistischen Wahrnehmungen mit menschenzerfleischenden Lack-Kätzchen für meinen Geschmack ein wenig zu sehr die Zügel schießen lässt. Auch der Ansatz, dass sich Hermann das körperliche Begehren der Gräfin imaginiert, beginnt da schon, sich totzulaufen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Der Hollywoodansatz ist stimmig, der überdreht gezeichnete Zeremonienmeister ein witziges Detail und die glücklicherweise an der Rheinoper nicht gestrichene Daphnis & Chloé-Szene eine zusätzliche Gelegenheit für die Kostümbildnerin Ursula Kundra, ihr ganzes Können zu zeigen und den herrlich bonbonfarbenen Petticoats überbordende Roben im Rokokostil hinzuzufügen. Der ausufernden, pseudopsychologisierenden Erörterungen im Programmheft hingegen hätte es als Erklärung der Regieidee ebenso wenig bedurft wie als Legitimation.

Dass ausgerechnet Hermann vor allem zu Beginn an seine stimmlichen Grenzen gerät, ist sehr bedauerlich. Höhe und erforderliche Kraft der Rolle scheinen Ensemblemitglied Sergej Khomov hörbar zu überfordert, so dass er im ersten Akt auf der Zuschauerseite des Grabens teils gar nicht mehr zu hören ist. Im Laufe des Abends fängt sich der Ukrainer allerdings, so dass ihm zum Finale eine stimmige und berührende Zeichnung der gebrochenen Figur gelingt. Natalia Muradyamova als seine Liebste gleicht dagegen einer stimmlichen Naturgewalt. Ihr teils zu ein wenig Schärfe neigender, voluminöser Sopran hat hochdramatische Qualitäten, wie sie in ihrer letzten Szene unter Beweis stellt, und dennoch gelingen der jungen Russin, die die unselbständige, ungeschickte Lisa zudem grandios spielt, auch zarte, mädchenhafte Passagen hervorragend – zum Beispiel im traumhaften Duett mit Polina, die von Anna Harvey mit warmem Mezzo zum Leben erweckt wird. Jorge Espino zeigt eine würdige Interpretation des Fürsten Jeletzi, auch wenn ich den Bariton des aus Mexiko stammenden Sängers schon wuchtiger gehört habe. Stefan Heidemann steuert als Tomski zwei mitreißende Erzählungen zur Geschichte bei, während aus der Unzahl kleinerer Partien der aus Costa Rica stammende Luis Fernando Piedra nicht nur wegen seiner urkomischen Zeichnung des Zeremonienmeisters, sondern auch mit hellem, klangschönen Tenor hervorsticht.

In der Titelrolle überzeugt Renée Morloc mit kehliger Tiefe und der berührenden Erinnerungsszene Je crains de lui parler la nuit. Auch wenn mir die sympathische Altistin, die seit beinahe einem Vierteljahrhundert im Ensemble der Rheinoper singt, für diese Altersrolle noch ein wenig zu jung ist, gibt sie eine eindrucksvolle Darstellung dieser alternden Diva, die an Norma Desmond in Sunset Boulevard erinnert. Im Graben befeuert der erst 31jährige Aziz Shakhikimov die Duisburger Symphoniker, entblättert die russische Seele des Werkes und fühlt sich in den klanglich überbordenden Passagen ebenso wohl, wie als filigraner Zeichner berührender Stimmungen. Die Damen und Herren des Opernchores singen ebenso bravourös wie das Orchester spielt; Gerhard Michaelski hat sie betreut. So bin ich am Ende des Abends doch voll des Lobes für die musikalische Umsetzung dieses leider allzu oft vernachlässigten, in dieser Spielzeit allerdings auch in Aachen und Essen gezeigten Tschaikowsky-Werkes und diese geistreiche, unterhaltsame Inszenierung.
Ihr Jochen Rüth 04.10.2019
Die Fotos stammen von Hans-Jörg Michel













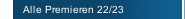




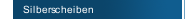
















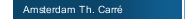













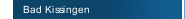




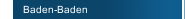





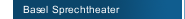




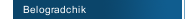

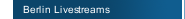





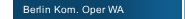



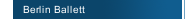





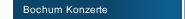



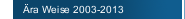





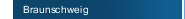

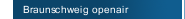




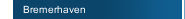




















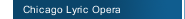


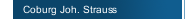





















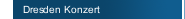



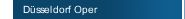



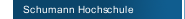









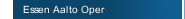




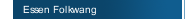










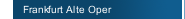
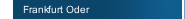





















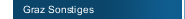








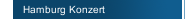
















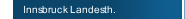

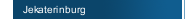

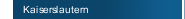











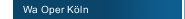


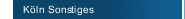
















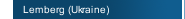





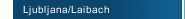





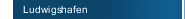























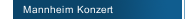













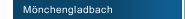





















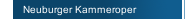
















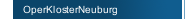


























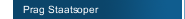
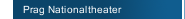

















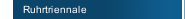

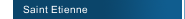







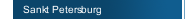



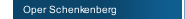
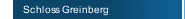














































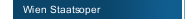

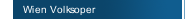

















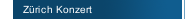
















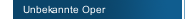




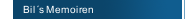



































 Mit „A simple piece“ schuf Volpi ein rund halbstündiges Werk mit einer sehr eingängigen a cappella Musik von Caroline Shaw, zu der jeweils vier Tänzer und Tänzerinnen sehr synchron verschiedenste sehr detaillierte Bewegungseinheiten darbieten. Hierbei tritt zwar mal der eine, mal der andere der acht Darsteller in den Vordergrund, auf größere Soli verzichtet Volpi hier aber zu Gunsten einer strikten Gesamtästhetik der acht Darsteller, die an diesem Abend einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnten. Ein gelungener Einstand in den Ballettabend. Nach einer ersten Pause folgen vier kleinere Werke, die einen Einblick in die Arbeit der letzten Monate der Tänzer und Tänzerinnen geben sollten, denn wenn auch keine Vorstellungen stattfinden konnten, wurde dennoch kreativ weitergearbeitet. Den Beginn machte Doris Becker mit Volpis Choreografie „Allure“, die er bereits 2012 zur jazzigen Musik von Nina Simone für das Stuttgarter Ballett schuf. Es folgte ein Pas de deux aus Andrey Kaydanovskiys „Love Song“, den Feline van Dijken und Eric White gefühlvoll auf die Bühne brachten. Angefangen beim ersten schüchternen Kennenlernen bis hin zum explosiven Höhepunkt erzählt Kaydanovskiy innerhalb weniger Minuten die komplette Geschichte des Liebespaares in eindrucksvollen Bildern.
Mit „A simple piece“ schuf Volpi ein rund halbstündiges Werk mit einer sehr eingängigen a cappella Musik von Caroline Shaw, zu der jeweils vier Tänzer und Tänzerinnen sehr synchron verschiedenste sehr detaillierte Bewegungseinheiten darbieten. Hierbei tritt zwar mal der eine, mal der andere der acht Darsteller in den Vordergrund, auf größere Soli verzichtet Volpi hier aber zu Gunsten einer strikten Gesamtästhetik der acht Darsteller, die an diesem Abend einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnten. Ein gelungener Einstand in den Ballettabend. Nach einer ersten Pause folgen vier kleinere Werke, die einen Einblick in die Arbeit der letzten Monate der Tänzer und Tänzerinnen geben sollten, denn wenn auch keine Vorstellungen stattfinden konnten, wurde dennoch kreativ weitergearbeitet. Den Beginn machte Doris Becker mit Volpis Choreografie „Allure“, die er bereits 2012 zur jazzigen Musik von Nina Simone für das Stuttgarter Ballett schuf. Es folgte ein Pas de deux aus Andrey Kaydanovskiys „Love Song“, den Feline van Dijken und Eric White gefühlvoll auf die Bühne brachten. Angefangen beim ersten schüchternen Kennenlernen bis hin zum explosiven Höhepunkt erzählt Kaydanovskiy innerhalb weniger Minuten die komplette Geschichte des Liebespaares in eindrucksvollen Bildern. Mit „Erbarme dich“ choreographierte die junge Neshama Nashman, seit Beginn der Spielzeit 2020/21 Mitglied des Balletts am Rhein, zu Johann Sebastian Bachs Auszug aus der Matthäus-Passion ein Solo für einen Tänzer. Eine beeindruckende Choreografie, die tief in die Seele eines Menschen schaut, exzellent dargeboten von Julio Morel. Nach diesem gelungenen Debüt folgte mit Hans van Manens „Solo“ ein Klassiker, welcher seine Uraufführung bereits 1997 mit dem Nederlands Dans Theater feierte. Ein nur siebenminütiges Werk, bei dem ein Solo auf drei Tänzer verteilt wird, die in einer Mischung aus enormer Geschwindigkeit und wunderbarer Eintracht die Bühne füllen. Auch dieses Werk hervorragend dargeboten von Tommaso Calcia, Miquel Martínez Pedro und James Nix, vor denen sich auch van Manen verneigte, der an diesem Abend persönlich zu Gast war.
Mit „Erbarme dich“ choreographierte die junge Neshama Nashman, seit Beginn der Spielzeit 2020/21 Mitglied des Balletts am Rhein, zu Johann Sebastian Bachs Auszug aus der Matthäus-Passion ein Solo für einen Tänzer. Eine beeindruckende Choreografie, die tief in die Seele eines Menschen schaut, exzellent dargeboten von Julio Morel. Nach diesem gelungenen Debüt folgte mit Hans van Manens „Solo“ ein Klassiker, welcher seine Uraufführung bereits 1997 mit dem Nederlands Dans Theater feierte. Ein nur siebenminütiges Werk, bei dem ein Solo auf drei Tänzer verteilt wird, die in einer Mischung aus enormer Geschwindigkeit und wunderbarer Eintracht die Bühne füllen. Auch dieses Werk hervorragend dargeboten von Tommaso Calcia, Miquel Martínez Pedro und James Nix, vor denen sich auch van Manen verneigte, der an diesem Abend persönlich zu Gast war. Zum Abschluss des Abends stand mit „Salt Womb“ von Sharon Eyal und Gai Behar ein Werk auf dem Programm, welches von einer selten erlebten Intensität durchzogen war. Die Musik von Ori Lichtik dröhnte in einer fast ohrenbetäubenden Lautstärke aus den Boxen, dazu explodierte das in schwarz gekleidete neunköpfige Tanzensemble förmlich zu den Perkussionschlägen. Eine gewaltige Kraftanstrengung für die Tänzer und Tänzerinnen, was man ihnen auch förmlich ansah. Nassgeschwitzt nahmen sie den großen Applaus des Publikums entgegen, welches trotz des schönen Wetters und dem zeitgleichen EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dennoch recht zahlreich den Weg ins Theater fand, zumindest unter der derzeit erlaubten geringen Auslastungsmöglichkeiten im Saal. Warum die Stadt Duisburg allerdings bei Temperaturen von 30 Grad den Verkauf von Wasser an ein zivilisiertes Publikum, welches sich an diesem Abend stets an alle Masken und Abstandsregeln hielt, für gefährlich hält, muss man bei allem gebührenden Respekt vielleicht nicht unbedingt verstehen.
Zum Abschluss des Abends stand mit „Salt Womb“ von Sharon Eyal und Gai Behar ein Werk auf dem Programm, welches von einer selten erlebten Intensität durchzogen war. Die Musik von Ori Lichtik dröhnte in einer fast ohrenbetäubenden Lautstärke aus den Boxen, dazu explodierte das in schwarz gekleidete neunköpfige Tanzensemble förmlich zu den Perkussionschlägen. Eine gewaltige Kraftanstrengung für die Tänzer und Tänzerinnen, was man ihnen auch förmlich ansah. Nassgeschwitzt nahmen sie den großen Applaus des Publikums entgegen, welches trotz des schönen Wetters und dem zeitgleichen EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft dennoch recht zahlreich den Weg ins Theater fand, zumindest unter der derzeit erlaubten geringen Auslastungsmöglichkeiten im Saal. Warum die Stadt Duisburg allerdings bei Temperaturen von 30 Grad den Verkauf von Wasser an ein zivilisiertes Publikum, welches sich an diesem Abend stets an alle Masken und Abstandsregeln hielt, für gefährlich hält, muss man bei allem gebührenden Respekt vielleicht nicht unbedingt verstehen.









