


www.staatstheater-nuernberg.de/
PETER GRIMES
Premiere: 19.6. 2022. Besuchte Vorstellung: 10.7. 2022
Das Grauen beginnt schon in Bayreuth – und es passt zum Stück wie zur Inszenierung. Eine korpulente Frau läuft am Zug vorbei, innen machen sich einige adrenalingeschwängerte Schwaben minutenlang über die „Fette“ lustig. Das ist, denke ich, ein guter Gärteig für eine Hetzmasse vom Schlage jenes borough, die in Peter Grimes Jagd auf die Titelfigur macht.
In Nürnberg herrscht das Grauen, weil der Regisseur Tilman Knabe es verstanden hat, dem Stück jegliche Ambivalenz auszutreiben – und zudem aus der Hetzmasse eine Truppe von prekären Outlaws zu machen, die dem Stück auch auf dieser Ebene jegliche Schärfe nimmt. Er hat nicht begriffen, dass es nicht genügt, mit den alt gewordenen Mitteln eines einst innovativen Theaters (Hauptrequisiten: Müllsäcke, Plastikstühle, Eisenzäune, Kunstblut, dreckige Klamotten, Arbeitslicht) eine im Grunde asoziale Gesellschaft zu zeichnen. Denn es wäre viel raffinierter, ja böser und zugleich erhellender, die „braven Bürger“ Bürger sein zu lassen. Auch in diesem Moment wird klar, dass Peter Grimes zu jenen Werken des Musiktheaters gehört, die nicht im Geringsten einer sog. Aktualisierung bedürfen – wer davon überzeugt ist, dass das Stück in seinem historischen Kostüm nicht immer noch die maximale Aussagekraft hat, oder wer nicht in der Lage ist, mit einer in die Gegenwart geholten Inszenierung (abgesehen von der großartigen Musik) die Relevanz des Werks zu beweisen, sollte die Finger davon lassen. Stattdessen hat sich Tilman Knabe – mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Eigenaussagen der Schöpfer der Oper vergessen werden können – auf die Seite derer geschlagen, die in Peter Grimes den kranken Mörder sehen. Der Skandal dieser Inszenierung besteht weniger darin, dass wir vom ersten bis zum vorletzten Bild auf eine schäbige wie fantasielose Szene schauen müssen, die wir seit vielen Jahren zur Genüge kennen. Er besteht darin, dass jegliche Unschuldsvermutung, wie sie in demokratischen und humanen Gerichtsprozessen üblich ist, außer Kraft gesetzt wird. Pardon wird nicht gegeben – Peter Grimes ist dem Regisseur in plattester Lesart ein neuer Jürgen Bartsch, ein pädophiler Kindermörder, ein durch und durch pathologischer Typ, der, so die Meinung des Regisseurs, in verhängnisvoller Weise von der schuldig gewordenen „Gesellschaft“ (was ist das??) abhängt. In Zwischentiteln wird lang und breit ein Text von Ulrike Meinhof zitiert, die seinerzeit in der Zeitschrift konkret über das Gerichtsverfahren schrieb. Nb: Es bleibt ein Rätsel, wieso der Name der Autorin, die kurz darauf in den aktiven Terrorismus abdriftete, nicht genannt wird – honni soit qui mal y pense. Die Pointe des Abends liegt also darin, dass der Regisseur Tilman Knabe der Hetzmasse vollumfänglich Recht gibt; daran kann die zitierte Meinung Ulrike Meinhofs schon deshalb nichts ändern, weil die Parallelisierung Peter Grimes‘ mit dem kranken Kindermörder von Text und Musik absolut nicht gestützt wird.

Mit anderen Worten: Die Inszenierung ist eine einzige Fehldeutung, d.h.: eine falsche Interpretation. Gegenbeweis erbeten (und bitte im Libretto anmerken, wo die Ermordung der beiden Jungen gezeigt wird). Man könnte noch darüber streiten, ob eine Party das richtige Synonym zu einem Sturm ist – man kann nicht mehr streiten, wenn explizite Aktionen erfunden werden, die keinen Rückhalt in Text und Musik finden. „Grimes war“, schrieb Peter Pears, für den Britten die Rolle schrieb, „fraglos ein sehr harter Lehrmeister“, er „ist weder Opernheld noch Opernbösewicht. Er ist auch weder Sadist noch eine dämonische Persönlichkeit, er ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, ein Schwacher, der im Kriegszustand mit der Gesellschaft lebt“. Sprach da jemand von „Romantisierung“ des Werks? Und muss man, um die angebliche Romantik des Stücks zu widerlegen, Peter Grimes dazu treiben, seine Freundin zusammenzuschlagen? Und muss man für Kapitän Balstrode, der kaum besser ist als seine ruppigen Kumpels, eine eigene Motivation finden, wenn es gilt, Peter Grimes zu raten, aufs Meer zu fahren und sich zu ertränken? Indem man sein erotisches Interesse an dier Freundin des zu Beseitigenden deutlichst zeigt?
Man muss es nicht, weil‘s die Figuren kleiner macht, als sie je waren.
Apropos „dämonisch“. Es ist wenigstens theatralisch ergiebig, wenn Grimes zweimal als gespenstischer Doppelgänger über die Bühne geht und einmal Ellen Orford, auch sie eine Doppelgängerin der realen Ellen Orfod, zum Traualtar führt. Spannend ist die Inszenierung nur da, wo die Hetzmasse sich formiert: da gewinnt sie eine Kraft, die über die Trivialitäten der Trash-Bühne kurzfristig triumphiert. Das Unglück aber beginnt schon im ersten Bild: wenn Peter Grimes den Gerichtsprozess in seinem wahnsinnigen Kopf nur imaginiert, was seltsam quer steht zur Aussage, dass die Stützen der Gesellschaft des Borough, die sich auch gern mal zu einer carnivoren Schwarzen Messe von wilden Tieren treffen, schon während der Verhandlung per se alle korrupt seien; dass sie alle ihre Defizite – Alkoholismus, Drogensucht etc. - haben, steht auf einem anderen Blatt. Ansonsten herrscht purer Aktionismus; dass die Interludes auch dazu da sein könnten, im Zuhörer innere Bilder sich entwickeln zu lassen und das Geschehene musikalisch hoch kunstvoll zu verarbeiten, diese Idee kam dem Regisseur offensichtlich nicht. Schade um die Musik, die nicht allein dann zermalmt wird, wenn sich Peter Grimes minutenlang über die Bühne zu strudeln hat.
Genug der Wort über die meistenteils an den Stückinhalten scharf vorbeisegelnde Inszenierung. Was bleibt, ist die grandiose Musik, die in Nürnberg erstrangig gemacht wird. Peter Marsh ist ein begnadeter Peter Grimes, der sich voll ins pathologisierte Geschehen wirft – und vokal von einer betörenden Schönheit ist. Sein Organ, voller dramatischer wie lyrischer Ausdruckskraft, bindet das Legato des poetisch unterfütterten Leidens (Grimes ist in seinen stillen Momenten ein Dichter von britischem Rang) wie das Staccato der Verzweiflung. Stünde er nicht auf der Bühne, würde die Inszenierung vollends untergehen, was nicht heißt, dass die Intensität seines Einsatzes die Fehlinterpretationen der Regie legitimieren würde. Ellen Orford ist bei Emily Newton ganz zuhaus: eine noble Erscheinung, stimmlich wie gestisch betrachtet, eine vollkommene erste Stimme im Quartett der Frauen, die nicht als Teil der Hetzmasse fungieren dürfen und, zurückgelassen, einen Viergesang ausströmen lassen, von dem sich Benjamin Britten durch das Rosenkavalier-Terzett inspirieren ließ. Almerija Delic ist Auntie, die beiden „Nichten“ heißen Chloe Morgan und Nayun Lea Kim, Sangmin Lee ist Balstrode, Hans Kittelmann Bob Boles, der an diesem Abend besonders viel auf die Nase bekommt: so wie‘s halt bei Outlaws üblich ist (aber, um es zu wiederholen, der Borough von Britten und Slater ist keine Outlaw-Gesellschaft), Nicolai Karnolsky Swallow (schweigen wir über‘s Kostüm), Marta Swiderska die Mrs. Sedley, Samuel Hasselhorn Ned Keene, Ferdinand Keller Reverend Horace Adams (privat ein ganz toller Feger, Stichwort: „Bigotterie“, ach Gottchen) und Hans-Peter Frings der Dr. Crabbe, der Chor des Staatstheaters Nürnberg unter Tarmo Vaask (Peter Grimes ist eine der bedeutendsten Choropern ever) wie immer fabelhaft. Das Ganze wird schließlich von der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Lutz de Veer musikalisch äußerst präzise zusammengehalten, getragen und zutiefst ergreifend ins Haus gebracht. Spätestens an der Bühnenkante endet denn doch das Grauen.
P.s: Und was sollte der alte Mann, der mit seinem Rollator während eines Interludes über die Bühne läuft, sich setzt und von einem Mann, Typ: Banker, ein Bündel Geldscheine bekommt? Die Zeit, in der man darüber nachdachte, war immerhin lang genug, um die Hauptsache: die Musik, um derentwillen das Werk überhaupt noch gespielt wird, vergessen zu machen.
Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Frank Piontek, 11.7. 2022
Foto: ©Ludwig Olah.
DER LIEBESTRANK
Premiere: 8.5. 2022. Besuchte Aufführung: 23.6. 2022
Dass zwei Dulcamaras auf der Bühne stehen, ersieht man aus dem Programmheft. Dass jedoch gleich zwei Adinas das Spiel um die Verdoppelungen mitspielt: das ersieht man aus dem Anschlagzettel – und mit einem Blick in die linke Proszeniumsloge. So betrachtet, hat das Konzept mit dem unfreiwilligen vokalen Ausscheiden der weiblichen Hauptrolle einen weiteren Schub erhalten.

Auf der Bühne steht, tanzt, bewegt sich also, geschlossenen Mundes, Andromahi Raptis, gesungen wird Adina diesmal von Penny Sofroniadou, einem Einspringer-Gast vom Theater Hagen, wo sie seit 2020 zum Ensemble gehört, die Adina sang – und wo sie bereits 2022 zum vorerst letzten Mal agieren wird. Im Herbst 2022 ist sie bereits Ensemblemitglied der Komischen Oper Berlin – kein Wunder ihre Nürnberger Adina ist der beste Beleg dafür, dass sie an der Spree mit der Nannetta brillieren wird. Stimmschön und -stark, vital in der Höhe, leuchtend mit noch etwas Luft nach oben: so präsentierte sich die sympathische Retterin des Abends, während die Premierenbesetzung, Andromahi Raptis, die kapriziöse wie nüchterne, lebenslustige wie, ja, dann doch herzbewegte Herzensdame Nemorinos mit Elan buchstäblich verkörperte.

Es ist ja schon erstaunlich, was man, in diesem Fall: Frau, alles mit dieser auf den ersten Blick so einfachen Musikkomödie anfangen kann. Die Psychologie der Figuren ist, bei aller typischen 19.-Jahrhundert-Schauspiel-Mechanik, denn doch, nicht zuletzt dank Donizettis genialer Musik, so ausgefuchst, dass das Werk, das ebenso viel schlichte Typenkomödie wie goldonihafte Bosheit besitzt, erstaunlich viel an „Konzept“ verträgt. In diesem Fall hat sich die Regisseurin Ilaria Lanzino, die in Nürnberg bereits mit Telemanns Pimpinone bewiesen hat, dass sie sich auf die intelligente und lustvoll komödiantische Darstellung und Interpretation älterer Geschlechterrollen versteht, Ilaria Lanzino hat sich also dazu entschlossen, zunächst einmal die Geschichte Adinas und Nemorinos im Schnelldurchlauf zu erzählen, bevor in einer Fortsetzung die geplante Heirat der Beiden unterbrochen wird, weil ein zweiter Dulcamara – sinnigerweise „Dulcamara 2.0“ genannt – die Dorfbewohner und den Gast Belcore in die digitale Welt der Partnervermittlung einführt. Dies ausgehend von der Beobachtung dass Nemorino, als romantischer Liebender, andere Ideale hat als seine Angebetete, die auf wechselnde Partner setzt: ganz so wie all jene, die sich auf den diversen asozialen Plattformen in einem Wettbewerb um auch sexuelle Akzeptanz kämpfen.

Das Erstaunliche dieser Idee ist: Sie funktioniert. Sie steht in keinem Moment quer zu Felice Romanis Text und Donizettis Musik. Sie modernisiert den Stoff rein äußerlich, ohne die zeitlos scheinende Geschichte in ihrem Wesenskern zu verletzen (die auffallend vielen jungen Leute, die die Aufführung besuchten, scheinen es gerade so empfunden zu haben). Adina bleibt über weite Strecken die wilde Katze, Dulcamara - der neue, also der mit Glatze und Gesichtsbemalung – der Einflüsterer, Belcore der brutale Kerl. Einmal singt Dulcamara 2.0 aus dem Off, während man seine Fratze, riesenhaft vergrößert, auf dem Monsterdisplay (Video: Torge Möller) betrachtet, der das Stilmittel der Ausstattung dieser Inszenierung ist. Emine Güner hat auch die fantasievollen Kostüme entworfen: Sci-Fi-Mode, individuell gestaltet, mit drei Grundfarben versehen, die die babyhaften Töne Blau und Rosa mit einem diversen Lila ergänzen. Also: Eine Infantilgesellschaft – aber eine, die sich in den Kostümen gut bewegen kann: auch in denen, die jeder Otto-Schenk-Inszenierung (nichts gegen Otto Schenk!) Ehre machen würden, und in denen die Dörfler ihr traditionelles Spiel spielen.

Dulcamara 2.0 verschwindet in jenem Moment, wie Mephisto, in die rauchende Hölle, in dem Adina weich wird. Am Ende aber betritt er doch wieder die wieder in die Tradition zurückverwandelte Szene – und das Spiel könnte von Neuem beginnen. A+N, Adina und Nemorino, diese beiden Initialen, in den „traditionellen“ Baum geschnitzt, sind, nebenbei, die Anfangsbuchstaben des Wörtchens „analog“. Das gibt Hoffnung, auch wenn der erste Dulcamara seinen Zaubertrank irgendwann selbst auszutrinken beginnt und sich angesichts des Einbruchs der teuflisch digitalen Moderne und einer Zeit, in der der Krieg ein „Live Game“ ist („Morgen um 10“) am liebsten aufhängen würde. Musikalisch klappt das alles sehr gut: mit Frau Sofroniadou an der Spitze neben Martin Platz als Nemorino, der seinen hellen Tenor nicht allein bei seinem Empfindsamkeits-„Schlager“ in romantisch hohe Regionen führt, ansonsten angemessen komisch agiert – chapeau! Samuel Hasselhorn gibt den Belcore und macht mit seinem Timbre stimmlich fast dem Dulcamara 2.0 Konkurrenz, betont szenisch und akustisch eher das Gewalttätige als das Charmante des Mannes, der die Liebe mit einem Krieg vergleicht.

Taras Konoshchenko, glücklicherweise wieder zurück aus seinem Heimatland, der Ukraine, ist ein stimmschwerer Verführer, passt also schon vokal ganz glänzend in die Neu-Interpretation des Werks. Der „echte“, erste Dulcamara heißt Michal Rudzinski; er ist ein Mitglied des Internationalen Opernstudios Nürnberg und leichter unterwegs, während es die Staatsphilharmonie Nürnberg unter dem Dirigat von Roland Böer an den deftigen Stellen krachen lässt (das Problem des Hauses) – und an den lyrischen blühen. Dass der Chor des Staatstheaters wieder exzellent aufgestellt ist, muss in Nürnberg nicht betont werden. In diesem Sinne: Addio! Also: Auf Wiedersehen und -hören, Frau Sofroniadou.
Frank Piontek, 24.6. 2022
Fotos: ©Bettina Stöß (der abgebildete Nemorino heißt Sergei Nikolaev)
NAHARIN / CLUG / MONTERO
Premiere: 23.4. 2022
„Unser Abend besinnt sich schlussendlich auf die reine Essenz des Tanzens“, sagt Goyo Montero, der Chef der Nürnberger Compagnie. Wieder hat er zwei Kollegen eingeladen, um deren Arbeiten mit einer eigenen zusammenzukoppeln; wo der Kontrast herrscht, wird Eigenes umso deutlicher und Anderes in eine Relativität gestellt, die ihr nicht immer gut tut. Oder anders: Es ist für keinen Choreographen leicht, neben dem Schwergewicht Montero die eigene Handschrift mit einer einzigen Arbeit so zu präsentieren, dass sie gleichberechtigt neben Montero bestehen könnte. Es mag ungerecht sein, aber Gelb wirkt neben Blau eben anders als neben rot, und neben grün wirkt gelb nun wieder ganz anders. Kommt hinzu der unabdingbar subjektive Blick des Betrachters, seine persönliche Vorliebe für einen oder mehrere spezifische Tanzstile und -arten der Gegenwart. Was also hat uns Ohad Naharins Secus, am Ende des Abends, zu sagen? Worin unterscheidet sich Naharins choreographischer Gestus von dem seiner Kollegen Montero und Clug?
Manieristisch: so sieht auch Clugs Arbeit Handman aus, wobei die Manier darin besteht, sich (fast immer) in Humor, ja in Komik aufzulösen. Secus ist, heisst es, sei ein „geordnetes Chaos“, aber das hat es ein bisschen mit Handman und Monteros meisten Arbeiten gemein, ist insofern auch kein Spezifikum irgendeines modernen Tanzes. Wir sehen also, im hellen, warmen Licht von Avi Yona Bueno (Bambi), auf eine urbane Atmosphäre; die sportiven Übungen erhalten einen verstärkenden Akzent durch die Kostüme von Rafeket Levy, mit denen man durch den Central Park joggen könnte.

Ganz so hell, wie manch Rezensent Secus sah, ist es jedoch nicht. Das Stück wird im zweiten Teil erst richtig interessant, wenn sich die Tänzer und Tänzerinnen selbst schlagen, in Reihen aufstellen, ihre Innenflächen und entblößten Seiten dem Publikum präsentieren und wie zwanghaft immer wieder die selben Bewegungen reproduzierenb: Variationen eingeschlossen. Nein, hell ist das nicht mehr, auch wechselt der Electro-Pop der spannenden Ton-Collage in andere Sphären – was gestisch bleibt, ist der Wechsel der Rhythmen. Man könnte Secus, wäre der zweite Teil nicht so verstörend, geradezu als abstrakte Bewegungsstudie beschreiben – aber gibt es das überhaupt: „abstrakten“ Tanz?
Es mag so etwas wie einen abstrahierten Ausdruck im Tanztheater geben. Wenn Goyo Montero behauptet, dass seine 2018 entwickelte Arbeit Submerge keine Geschichte erzählt, sondern von psychischen Zuständen berichtet, hat er zugleich recht und unrecht. Ausgehend von seinen Erfahrungen mit dem damals erlernten und praktizierten Tieftauchen entwarf er ein Ballett, in dem sich die Compagnie – diesmal etwas anders als gewöhnlich bei Montero – nicht in Widerspruch zu einem Individuum setzt. Diesmal geht es nicht um den Konflikt oder die Zusammenarbeit eines Einzelnen mit oder gegen das Kollektiv. Schält sich allmählich heraus, dass eine einzelne Tänzerin eine hervorgehobene Bedeutung hat, bleibt der Fall angenehm rätselhaft. Der Ausklang des Stücks, in dem das Licht Martin Gebhardts die Figuren auf ihrem choreographischen Tauchgang in eine innere, meist heftig erregte Welt scharf anschneidet und die Originalkomposition von Monteros Hauskomponisten Owen Belton eine zwischen Ruhe und Panik changierende Atmosphäre kreiert – der Ausklang von Submerge zeigt eben jene Frau in einem Trio mit zwei Männern, schliesslich ein Duo, in dem sie im milden Monterolicht nach hinten getragen und zugleich präsentiert wird: ein wenig christusgleich…

Bleibt Handman, eine Arbeit von Edward Clug, ein lustiges Intermezzo, ein komisches Zwischenspiel, allerdings einem mit Gewicht. Auch hier tanzt die Compagnie mit unfassbarer Virtuosität. „Wie im Leben“, so bezeichnete eine Zuschauerin in der Pause die Arbeit, in der es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, die der Choreograph in gelind groteske, lustige und ironische Bilder der Körperkomik auflöst. Schwer, das zu beschreiben. Man muss das gesehen haben, um zu begreifen, dass Humor im Tanztheater möglich ist – wenn sich Mann und Frau und Mann und Mann etc. begegnen, mit den Köpfen buchstäblich unter den Armen.

Die Gestik passt vollkommen zur jazzigen Klavier plus Schlagzeug-Musik von Milko Lazar, nicht allein der Sound ist funky, auch das Bewegungsrepertoire. Handman, lesen wir auf dem Waschzettel zum Abend, reflektiert flüchtige zwischenmenschliche Beziehungen. Exakt das ist es: in einer Sprache, die eben jene Beziehungen im ewigen Hin und Her auf den choreographischen Punkt bringt.
Riesenbeifall für alle Tänzer und Arbeiten – und die hervorragende Compagnie.
Frank Piontek, 24.4. 2022
Fotos: Jesús Vallinas
DER ROSENKAVALIER
Premiere: 3.4. 2022
Beginnen wir mit dem Einfachsten: den Sängern, die die vielen kleinen und die längeren Noten von Richard Strauss zu singen haben, um uns die Geschichte vom Rosenkavalier zu erzählen. Wenn Julia Grüter die Sophie singt, ist das Glück der Zuhörer vollkommen. Ihr leuchtender Sopran repräsentiert an diesem Abend den Strauss-Gesang par exellence.

Vielleicht liegt es auch daran, dass das Orchester, das am Premierenabend nicht unter der angekündigten GMD Joanna Mallwitz, sondern unter dem „Nachdirigenten“ Lutz de Veer spielt, im ersten Akt – deren erste Hälfte und deren Schluss bekanntlich der Marschallin und dem Octravian gehören – die Sänger so übertönt wie in keinem der beiden Folgeakte. Das macht: Straussens Instrumentierung, sein symphonisches Orchester, das für die Hofopern von Dresden, Wien und München und für die Metropolitan Opera, aber nicht für ein „kleines“ Haus wie das damalige Nürnberger Stadttheater organsiert wurde, das macht auch der Umstand, dass die Akustik des Hauses bei den großen Opern nur dann funktioniert, wenn eine Delikatesse-Spezialistin vom Range der GMD am Pult steht. So aber verschwanden Emily Newton und Mireille Lebel im ersten Akt allzu oft unter dem Orchesterklang, gegen den an sich nichts zu sagen wäre; die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt Straussens rhytmisch bisweilen vertrackte und harmonisch gelegentlich gewagte Musik mit sehr hoher Kompetenz.

Die Musiker haben hörbar Spaß daran, die Walzer und die Wozzeck-Vorklänge, die Schnadahüpferl und die Schönberg-Parodie (in der Beisl-Szene), also die denkbar unterschiedlichen Stilschichten des Rosenkavaliers herauszuspielen, der (man kann das hören, wenn man nur will) wesentlich mehr war als ein Umschwung in die musikhistorische Reaktion – wenn‘s nur im ersten Akt nicht so präpotent herausdonnern würde. Hat der Dirigent die Bläser zu oft angeschaut? Denn der Orchesterpraktiker Strauss wusste ja – er hat es in seinen Anweisungen für einen Dirigenten dekretiert –, dass die Bläser schon zu laut spielen, wenn man sie nur anblickt. Man darf also gespannt sein, wie zumal der Kopfakt klingt, wenn Joanna Mallwitz den Taktstock in der Hand hält. Glitzern und glänzen tat es ansonsten schon am Premierenabend, die Tempi kamen weder verhetzt noch schleppend, die heiklen polyrhythmischen Sequenzen wurden bravouros gemeistert – nur stellte sich an den sog. „schönen Stellen“, besonders der „schönen Stelle“ des 2. Akts, also der Rosenüberreichung, nicht immer das Gefühl ein, es mit einem besonders bewegenden Werk zu tun zu haben.
Es lag nicht an der Musik, es lag an der Inszenierung. Nun muss sich jeder Regisseur, der das Werk von Neuem inszeniert, natürlich fragen, wie er es denn mit der Ästhetik halte, die seit der Premiere des Werks vor 111 Jahren bis in die jüngere Gegenwart so dominant war, dass die ersten Aufführungen, die den Rosenkavalier aus dem Alt-Wien des ersten Bühnenbildners und Kostümgestalters Alfred Roller herausholten, vermutlich viele Zuschauer geschockt haben. Die Gretchenfrage, wieviel Gegenwart dem Werk zuzumuten ist, ist indes keine dumme – denn die sozialhistorische und gesellschaftliche Genauigkeit, mit der Hugo von Hofmannsthal sein künstliches theresianisches Wien entworfen hat, ist nach wie vor eine Hypothek, die nicht mit der Forderung, dass die Figuren „freigestellt gehören“, beiseite geschafft werden kann. Es gibt viele Wege zum Rosenkavalier, aber nur wenige, bei denen der verständliche Wunsch nach „Freistellung“ nicht Schiffbruch erleidet, weil das, was Strauss und Hofmannsthal sich damals erdachten, so konkret ist, dass es jede Interpretation gefährdet, die vom historischen Kontext – und sei es der der Enststehungszeit – so abstrahiert, wie wir es in Nürnberg nun wieder sehen.

Man kann sich dem Rosenkavalier ja auf vielerlei Wegen nähern: man nimmt eine pseudohistorische Rekonstruktion des theresianischen Wien vor und spielt eine mehr oder weniger psychologische Komödie, man setzt, wie Barry Kosky, den Stoff in die Jahre kurz vor 1914, wobei man die Nostalgie als letzte Zuckungen des Wissens um eine „heile“, vom Neorokoko und Neubarock beseelte und extrem silberne Welt interpretiert, man begibt sich, wie bei André Heller, in ein süffiges, von Japonismen und von Gustav Klimts Bildwelten regiertes Vorkriegswien, man stopft, wie bei Herheim, die Mythen des späten 19. Jahrhunderts, also der Makart-Zeit, und den neuen Mythos eines vereinigten Europa bildmächtig ins Werk, ohne das Wien der Spielzeit zu ignorieren, man lässt es, wie bei Herbert Wernicke, in einem Spiegelkabinett spielen, man seziert den Stoff und bricht ihn auf irgendeine rohe Gegenwart hinunter, wie Sebastian Baumgarten es in Kassel gemacht hat, wo die braven Bürger das Premierenorchester mit ihren Trillerpfeifen anreicherten. Marco Storman macht es mit seinen Bühennbildnerinnen Frauke Löffel und Anna Rudolph, seinem Kostümgestalter Axel Aust und dem Mann am Licht, Kai Luczak, ein bisschen wie Baumgarten, setzt aber auf die bewusste Sterilität einer Szene, die fast durchwegs in Schwarz und Grau gehalten ist, und deren Grundelemente ein paar Dutzend seitliche Drehpaneele und Drehflächen an deutlich sichtbaren Metallstangen sind, hinter denen die Figuren verschwinden können, die gerade nicht für die laufende Szene „freigestellt“ sind – so kommt‘s, dass die Marschallin nach dem Lever des ersten Akts plötzlich mit einem in Goethes Sinne „bedeutenden“ leuchtend roten Kleid, das einem ästhetischen Schock gleichkommt, wieder die Bühne betritt. Ansonsten dürfen die Figuren zufrieden sein, wenn sie ein weißes oder, wie Octavian, ein Kostüm tragen, das dunkelblaue Anteile besitzt. Der neureiche Faninal trägt immerhin noch sandgraubraun. Ansonsten ist‘s dunkel in dieser Welt – wenn nicht die Lichtstäbe ihren grellen Schein auf die Bühne lenken.

Das Problem ist eben diese Bühne. Wo die totale Abstraktion des Raums eine Gegenwart behauptet, die nichts als ein trockener Spielraum ist, wird zwar der Fokus völlig auf die Figuren gelenkt – aber was sind das für Figuren? Die Marschallin ist offensichtlich eine Frau aus bester Gesellschaft, ihr jugendlicher Amant ein Jüngelchen, das so stolz auf seinen erotischen „Sieg“ ist, als dass wir seine Entzückung(en) – als unbewusste Äußerungen eines frühen Liebesglücks – allzu ernst nehmen könnten. Der Ochs aber ist nicht der wenn auch heruntergekommene, auf seine Weie witzige, manchmal sogar charmante Landadelige, als den ihn Hofmannsthal und Strauss gezeichnet haben, sondern ein derber Vorstadtstrizzi, der in seinem Äußeren ein wenig an einen anderen großen Darsteller schiacher Gestalten erinnert: an Helmut Qualtinger. Der Ochs des Patrick Zielcke macht erst gar nicht den Versuch, eleganter zu erscheinen, als es ihm der Rang zugestehen würde, der es überhaupt möglich macht, im Schlafzimmer einer Frau vom inneren und äußeren Range der Marschallin zu erscheinen. Er ist primitiv, unsubtil und unverstellt geil und geldgierig, er muss nicht viel tun, um es sich bei Sophie zu verscherzen, und er stammt distinktionsmäßig aus einer Unterschicht, die diesen Rosenkavalier von vornherein zu einer absurden Posse macht. Gewiss: Zielcke singt großartig, er spielt den brutalen Kerl mit den Manieren eines Rockers vom Reißbrett höchst unterhaltsam heraus, er findet unser Interesse, obwohl schon sprachlich etwas Wesentliches fehlt: das österreichische Idiom, ja: Irgendwie mag man den heruntergekommenen Hallodri in seiner ganzen Unverschämtheit gern leiden – aber er spielt nicht den Ochs auf Lerchenau, der in der genau porträtierten sozialen Welt des Rosenkavaliers funktionieren würde, „Freistellung“ hin oder her. Er spielt – wie gesagt: amüsant, witzig noch in seiner letzten Obszönität, die ihn vor den gespreizten Beinen der falschen Jungfer masturbieren lässt - sein Spiel, aber im Rosenkavalier wirkt er wesentlich fremdartiger, als es Hofmannsthal und Strauss sich auch nur ansatzweise vorstellten. Es liegt gewiss nicht allein daran, dass er der „Mariandl“, von der er längst weiss, dass er mit „ihr“ einen Mann vor siuch hat, unter den Rock kriecht. Also: Eine auch sexuelle Fehlkonzeption, mit der (fast) das ganze Schiff untergeht. Nicht, dass wir eine wie auch immer realistisch gespielte Beisl-Szene vermissen würden – Mireille Lebel spielt das falsche Mariandl wirklich großartig anzüglich und erotisch - , aber wenn das gesamte Vorspiel des dritten Akts, dessen Musik die Szene wie im Micky-Mousing begleitet, als reines Orchesterstück in unsere Ohren dringt und sich erst mit dem Vokaleinsatz der Vorhang öffnet, hat sich die Regie in ihr rauchendes Mauseloch zurückgezogen, in dem sie einen denkbar „frei“ gedachten Rosenkavalier so auf das „Allgemein-Menschliche“ reduziert hat, dass die meisten Aktionen unsinnig werden. Es sei denn, dass man den gewaltigen Abschliff toleriert, der immer dann entsteht, wenn zwischen Text und Szene, behaupteter sozialer und gleichzeitig uninszenierter Realität gewaltige Lücken klaffen. In einer unkonkreten Gegenwartswelt lässt sich eben keine Komödie mit Musik spielen: nicht einmal dann, wenn ein Sänger und Darsteller wie Patrick Zielcke eine halb grandiose, halb extrabillige Figur auf die Bühne stellt.
Dass es keinen Mohren gibt, weder einen kleinen noch einen großen (wie in André Hellers Berliner Inszenierung), versteht sich von selbst. Er wird ersetzt durch eine kleine Gestalt, der die Regie eine große an die Seite gab: die kleine und die alte Marschallin, entsprungen aus ihrem Monolog, aber auch die Allegorien der Zukunft und der Vergänglichkeit, des aufkeimenden Lebens und des nahenden Todes, für die die Seifenblasen, natürlich, eine gute Metapher sind. Ironischerweise beginnt das Spiel mit dem Auftritt der Alten, bevor der letzte Vorhang vom kleinen Mädel zugezogen wird. Das Leben wird, im Zeichen der wie auch immer sich zukünftig gestaltenden Liebe von Sophie und Octavian, weitergehen; die Marschallin wird nach ihrer Blondhaarphase mit erbraunten Haaren ihren Weg verfolgen. Immerhin konnten wir im zweiten Akt – präzise an der Stelle, an der die Solotrompete in das Duett eintritt – beobachten, dass den Herrn Octavian nun offensichtlich mehr überfällt als die machismohafte Hoffnung, ein „hübsches junges Ding“ flachzulegen. Das ist tröstlich – und rettet die Figur vor dem Verdacht, genauso scheusslich eindimensional zu sein wie der Baron, den der Regisseur und sein Sänger erfunden und durchaus nicht zur Kenntlichkeit entstellt haben.

Da schaut man dann doch lieber auf den Octavian – als Octavian und Mariandel -, der mit Mireille Lebel eine annehmbare Interpretin fand, wenn man sie nur, siehe oben, schon im ersten Akt gut verstehen würde. Für Emily Newton gilt dasselbe. Schade, denn Emily Newton gestaltet eine ganz damenhafte, vornehm artikulierende Marschallin. Wichtig auch Jochen Kupfer, dessen Faninal, wie nicht anders zu erwarten, ein sehr eleganter Neureicher ist, auch wenn dessen ebenso neureiches Palais in dieser Inszenierung jeglicher Wirklichkeit entkleidet wurde. So aber wird das Beziehungsgefüge zwischen Ochs, Faninal und Sophie auch jeglichen Sinns beraubt – die Frage gebt verloren, was hier, in diesen Hallen, eigentlich für ein Spiel gespielt wird, auch wenn Julia Grüter eine phänomenale Sophie aus ihrer goldenen Kehle entlässt und sich bemüht, im seltsamen Dauergrinsen so etwas wie eine prägnante Figur zu entwickeln.
Rauschender Applaus also für die Sänger, auch den „Sänger“ Tadeusz Szlenkier und die Annina (und falscher „Witwe“) der Almerija Delic, insbesondere für Julia Grüter und Patrick Zielcke – und ein paar Buhs für das Orchester und die Regie.
Fotos: Pedro Malinowski
Frank Piontek, 4.4. 2022
PELLÉAS UND MÉLISANDE
Konzertante Premiere: 23.1. 2021
Eine konzertante Oper ist ein ästhetisches Unding, denn eine Oper wird immer im Hin-Blick (!) auf Szene und Bühne komponiert. Eine Oper ohne bewegtes Bild ist nichts als ein Fragment. Dies gilt in besonderem Maß für Debussys Pelléas et Mélisande, denn die Handlung ist, wie man älteren Opernführern entnehmen kann, kaum das, was man als „Aktion“ bezeichnen könnte. Eine Aufführung gerade von Pelléas et Mélisande ist also ein Unding hoch zwei, weil dem handlungsarmen Stück noch der letzte Rest an Dramatik abgeht, wenn man es rein konzertant gibt.
Nichts davon stimmt. Debussy selbst hätte, in seiner Eigenschaft als ironischer Musik- und Theaterkritiker namens Monsieur Croche, vom abgestandenen Quark der mumifizierten Meinungen vermeintlicher Experten geschrieben.

In Wahrheit bietet eine konzertante Aufführung von Debussys musikdramatischem Hauptwerk nämlich ein non plus ultra an Sinnlichkeit und Spannung. Nicht allein, dass die Verfasser der alten Opernführer sich gründlich irrten, als sie „Dramatik“ mit „action“ gleichsetzten (Honolka, 1966: „Debussys Vertonung verschmäht alle Operneffekte“; Steger und Howe, 1968: „Pelléas und Mélisande ist als Bühnenwerk nicht lebensfähig“, Kloiber, noch 1978: „Pelléas und Mélisande verzichtet gänzlich auf die sogenannten dankbaren Opernwirkungen“). All das ist barer Unsinn – vorausgesetzt, man akzeptiert, dass „dankbare Opernwirkungen“ und „Operneffekte“ seit der Premiere des Werks im Jahre 1902 etwas anders definiert werden können als zu Zeiten der sog. Belcanto-Oper, Giuseppe Verdis oder des sog. Verismo. Die Autoren hinkten damals, lange nach ganz anderen Opernerfolgen, weit hinter ihrer Zeit hinterher. Es hat schließlich einen Grund, wieso das Drame lyrique immer dann, wenn es (selten, aber zugleich regelmäßig, denn es bleibt ein lebensfähiges Opus für Feinschmecker) aufs Programm gesetzt wird, die Zuschauer zu entzücken weiß und tief zu beeindrucken vermag. Misst man die Vitalität dieses Werks allein am Applaus, den die konzertante Aufführung der Oper im Nürnberger Staatstheater erfuhr, ist die Sachlage völlig eindeutig: Pelléas hat sein Publikum im Innersten erreicht – und dies vielleicht nicht (doppeltes Ausrufezeichen) obwohl, sondern weil die Bühne fehlte.

Allein auch diese Aussage ist Unsinn – denn eine wenn auch konzertante Aufführung einer Oper ohne szenischen Ausdruck, ohne jene Emotionalisierungen, die, angeblich, allein eine Bühnenaufführung zu vermitteln vermag, ist unmöglich. Wenn Julia Grüter als Mélisande, Sangmin Lee als Golaud und Samuel Hasselhorn als Pelléas vor dem Orchester stehen, muss der Zuhörer und -schauer nichts (ich betone: nichts) vermissen. Wenn Julia Grüter in der Begegnung mit Pelléas wie unschuldig in sich hineinlächelt, wenn Sangmin Lee einen brutalen Golaud zum Ausbruch bringt und Samuel Hasselhorn einen zwischen Jugend und Reife changierenden Pelléas genügend andeutet, wenn sich das Liebespaar im einzigen nichtpragmatischen Gang an diesem Abend auf dieser Bühne zueinander wendet, eine der berühmten Debussyschen Pausen erklingt und sie sich plötzlich ihre seltsame Liebe gestehen, wird lediglich das Pünktchen auf ein I gesetzt, das vom ersten Takt an im Raum steht. Kommt hinzu, dass es gerade Maurice Maeterlincks Text, in Verbund mit Debussys durchaus nicht unkonkreter oder gar raunender Musik, ist, der im Zuhörer ein höchst intensives inneres Theater provoziert, das mit den sparsamsten Gesten und der deutlichen Mimik der Sänger harmoniert. Was an diesem Abend entsteht, ist ein Gesamtkunstwerk aus inneren und äußeren Bildern, die ohne Bühnendekorationen auskommen; nur das Licht am Rückprospekt sorgt für Wirkungen, die man impressionistisch nennen könnte, wäre das Wort nicht so problematisch, weil es eine Verschwommenheit suggeriert, die Debussys Musik eben gerade nicht besitzt.

Pierre Boulez hatte Recht, als er in einem bedeutenden Aufsatz über das Werk bemerkte, dass es nicht der Traum und das Unbewusste, sondern die Präzision und die Klarheit sind, die den Pelléas auszeichnen: musikalisch, aber auch dramatisch, wenn man einmal alle Informationen zur Kenntnis nimmt, die uns der Text in erstaunlich reichem Maße gibt. Manch Inszenierung der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass dem Werk mit symbolistischem Nebel nicht beizukommen ist. An die Stelle einstiger phantastischer Imaginationen (gewiss: einige Motive von Maeterlincks Drama verdanken sich dem Märchenfundus) traten „realistische“ Ansichten des Fin de siècle oder einer psychisch gestörten Gegenwart. Es scheint eine Geschmacksfrage zu sein, ob man eher kalte und harte Deutungen des „lyrischen Dramas“ bevorzugt oder fabelhaft andeutende; dass die Regie gerade in ersterem Fall übers Ziel einer schlackenlosen Deutung hinausschießen kann, muss nicht betont werden. Der Rezensent möchte auch nicht all jenen Lesern und Zuhörern Wasser auf die Mühlen geben, die das „regietheater“-geschädigte Mantra verkünden: „Konzertant ist‘s eh immer besser, denn da stört keine Inszenierung mehr die Oper“. Sagen wir so: Konzertante Glücksfälle wie die Nürnberger Premiere einer Oper, die an diesem Abend eigentlich ihre szenische Premiere hätte erleben sollen und aus bekannten Gründen durch ein Hör-Spiel, das doch viel mehr ist, ersetzt wurde, diese Glücksfälle sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Es liegt natürlich auch und zum Wesentlichen am Orchester, das die intimsten Regungen und Dialoge grundiert, begleitet, akzentuiert und ausmalt. Wenn Joana Mallwitz am Pult der Staatsphilharmonie Nürnberg steht, darf man sicher sein, eine glasklare, aber keinesfalls aseptische Interpretation von Debussys Meisterpartitur zu erhalten. Boulez hat vor über einem halben Jahrhundert geschrieben, dass jede Szene der Oper eine eigene Temponahme verlangen würde – Joana Mallwitz verbindet eine gesteigerte Flexibilität eben jener Tempi mit einer dramatisch stringenten, niemals schleppenden, niemals hetzenden Deutung des dramatischen Duktus, in dem die leuchtenden Höhepunkte (wenn die Trompete glänzt und die hohen Streicher sich aus dem Schatten Allemondes herausbewegen) zu Markierungspunkten in einem stetigen, quasi logischen musikalischen Fluss werden. Das Orchester glänzt an diesem Abend auf besondere Weise, und dies nicht allein deshalb, weil ihm, glücklicherweise, in den drei Aufführungsstunden wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden kann als in einer Bühnenaufführung.
Kommen die Sänger hinzu: allen voran Julia Grüter, die mit ihrem bekannten glasklaren Sopran eine jugendlich anrührende Mélisande singt, dann Samuel Hasselhorn, der seinen lyrischen Tenor mit einem Gran Heldenmut anreichert, zum Dritten Sangmin Lee, der mit seinem kraftvollen Bass für die dynamisch stärksten Attacken des Abends sorgt. Alma Unseld ist ein hervorragender Yniold, Helena Köhne eine sehr gute Geneviève, Taras Konoshchenko ein prägnanter Arkel. Die Wurzen sind mit Michal Rudzinski (ein Arzt) und Gor Harutyunyan (ein Hirte) ordentlich besetzt. Die Schafe schreien um ihr Leben, das Meer bewegt sich, der Wind weht, die Schatten fallen tief – auch das Hörbild der Natur war an diesem Abend vollkommen. Eine konzertante Oper ist ein ästhetisches Unding?
Was für ein Unsinn!
Frank Piontek, 24.1. 2022
Fotos: ©Ludwig Olah
GOYO MONTERO: NARRENSCHIFF
Premiere: 18.12. 201. Besuchte Vorstellung: 25.12. 2021
Natürlich gibt‘s auch im Narrenschiff einen Tanznarren: „Ich hielt nah die für narren gantz / Die freüd vnd lust hant jn dem dantz / Vnd louffen vmb / als werens toub / Mued fueß zuo machen jnn dem stoub.“ Glücklicherweise scheint es sich, folgt man Sebastian Brants Definition dessen und derer, der und die sich „müde Füße“ macht und „Freude und Lust“ im Tanz verspürt, glücklicherweise also scheint es sich bei der Nürnberger Tanzcompagnie um eine besonders fanatische Spezies dieses besonderen „Narren“ zu handeln – denn auch die üppig ausgestattete und orchestrierte Narrenschiff-Produktion des Nürnberger Staatstheaters hält es wieder mit der äußersten Intensität, Fantasie und Magie.

Das Narrenschiff Goyo Monteros – es besteht aus zwei Teilen, die durch eine kleine Bewegung und eine große Folie zusammengehalten werden. Maria, so heißt der erste Teil, er stellt die Figur der Maria Magdalena, abstrahiert, in den Mittelpunkt. Wüsste man nicht, dass die halb legendäre, halb wohl historische Geschichte und Gestalt der Gefährtin Jesu gemeint ist, käme der Zuschauer wohl kaum darauf, aber Montero kam es auf etwas Anderes an. Mit seinem Ensemble, in dem nicht ein, sondern mehrere Tänzer den „Rabbuni“ in Folge repräsentieren, spielt er die Geschichte einer starken wie von ihren Zweifeln gedrängten Frau: in Bezug auf eine Männerwelt, in der sie langfristig keine Chance hat, als eigenständig-starke Frau noch aufzutreten. Es steht also, zum wiederholten Mal – denn dies ist das Grundthema aller Montero-Schöpfungen –, der / die Eine und das Kollektiv / die Masse im Mittelpunkt der dramaturgischen Anlage. Doch bleibt es das Geheimnis des Choreographen, die Masse nicht als Formierung gesichtsloser Einzelner zu zeigen, sondern stets das Individuum in der Gruppe kenntlich zu machen. Dass die sechs Jesus- "Darsteller“ sich am Ende von „Maria“ in einem schlicht hinreißenden, gleitenden Abschied voneinander trennen und immer wieder neue Paare, mit Maria als Fixpunkt, sich bilden, ist ja schon aussagestark.

Die Moral von der Geschicht‘, die angesichts einiger Bildrätsel und gestischer Exzentrizitäten kaum in Worten fassbar ist – ansonsten bräuchte man kein Tanztheater, sondern würde mit den Begleittexten der Dramaturgin Lucie Machan auskommen -, weil Monteros Bewegungssprache, die beständig variiert wird, bei allem Stampfen, Übereinanderrollen (im Geburtsakt des ganzen Abends), Sichzusammendrehen, Sichimmerwiederneugruppieren, Sichtrennen und Rhythmischaufdenbodensichwerfen verbal nicht übertragbar ist, diese Moral muss wie immer jedem Zuschauer zur pesönlichen Deutung überlassen werden.

Was bleibt, ist die agile wie hinreissend spielende Prima inter Pares in diesem ersten Teil, also Diana Vishneva. Am Ende rudert sie einem Ausgang zu: ein schmaler Spalt, durch den das Licht dringt. Was dahinter liegt, ist – Teil II – das Narrenschiff. Wird auch, wovon schon die Kostüme Salvator Mateu Andujars zeugen, zunächst deutlich Bezug genommen auf den berühmten Text Sebastian Brants, mit dem er vor 500 Jahren die Idioteleien und „Sünden“ seiner Zeit aufs Korn nahm, so erweitert sich das Bild schnell ins Allgemeine. Dafür sorgt schon die Bühnengestaltung – verbindendes Element beider Teile sind die bifokalen Folien, die wir aus der Tagesschau und dem Tatort kennen. Gold und Silber, mit diesen beiden leuchtenden Farben und dem im wörtlichen Sinne bedeutenden Material bauen Montero, seine Bühnengestalter Leticia Ganán und Curt Allen Wilmer und der Lichtmacher Tobias Krauß ganze Landschaften auf, die an Felsformationen, das Meer und an Wände erinnern, die Wieland Wagner nicht schöner hätte erfinden können.

Um nur ein Beispiel zu nennen: wenn unten zwei fantastische, durch eine flexible Textilröhre verbundene Gestalten sich in einem Kampf bewegen und sie nur vom Dunkel umgeben sind, erblickt man über ihnen eine mild beleuchtete, ins Finstere scheinende Goldfläche – und blutrot und wild wallend wölbt sich die Fläche über den wie im Todeskampf (eine Erinnerung an die täglich sterbenden Flüchtlinge im Mittelmeer) sich bewegenden Tänzern, wenn die ersten Takte des vierten der Letzten Lieder Richard Strauss‘ den Zuschauerraum so fluten wie die hinreißende, todverheißende, tiefrote Silberplane dem Zuschauer sich aufdrängt. Montero hat wieder „alte“ Musik in sein Projekt integriert, die den Hallraum des Tanzes bisweilen rhythmisch akzentuiert, bisweilen konterkariert, ohne dass doch Unsinniges entstünde. Wenn Emily Newton (gewandet in der bekannten Meeresmüllplastik, am Ende sich selbst als Närrin krönend) das unendlich ruhig klingende Im Abendrot silbrig singt und die Compagnie dazu wild zuckt, begreifen wir bewegt, dass es mit dem Abschiednehmen von dieser Welt nicht so einfach ist, wie Eichendorff und der alte Strauss sich das vorgestellt haben – ohne dass doch Strauss und Eichendorff denunziert würden.

Strauss und, als symphonische Ergänzung von höchster dramatischer Explosivkraft, Owen Belton im zweiten Teil, Pergolesis Stabat mater in einer Übermalung und Erweiterung von Lera Auerbach im ersten Teil: so funktionieren Alt und Neu, Tradition und Gegenwart in einer Mischung aus Zuspielung und Live-Musik. Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt unter Francesco Sergio Fundarò bezwingend schön und, schon im leidenschaftlichen Barockton, bezwingend stark. Wenn ein (Tanz-)Bild, wenn auch im Stillstand, mehr sagt als 1000 Worte, vermag die Musik mehr zu sagen als das, was im Tanz aufgehoben sein könnte. Erst zusammen entfalten sie eine Wirkung, die – im magischen, auf äußerste Herausarbeitung der Körper angelegten Licht betrachtet – so berauschend ist, dass die Verzweiflung, die den Zuschauer angesichts der von Montero und seiner Compagnie gezeigten Zustände überkommen könnte, stets der „Freud und Lust“ an der Kraft und Bewegungsfähigkeit der Szene und der sich begegnenden, sich abstoßenden, sich immer wieder in neuen Gruppen findenden Tänzer weicht. Bewegungsfähigkeit – das ist es am Ende, was auch diesen Abend so besonders macht.
Frank Piontek, 26.12. 2021
Fotos: ©Jesús Vallinas
Der Troubadour
Premiere: 13.11. 2021. Besuchte Vorstellung: 10.12. 2021
„Im Herzen Afrikas und Indiens wirst du immer den Trovatore hören“ - Giuseppe Verdi sollte Recht behalten: Der Troubadour wurde zu seiner wohl beliebtesten Oper, und dies nicht obwohl, sondern vielleicht weil die Struktur dieses Werks so beschaffen ist, dass sie die deutschen Opernliebhaber und -forscher nachhaltig verwirrte. Denn keine andere Oper des größten italienischen Opernkomponisten stand lange Zeit unter dem Verdacht, zwar herrliche (oder, für die moralinsauren deutschen Opernprofessoren, leierkastenartige) Musik, doch gleichzeitig ein „unglaublich schlechtes“ Libretto zu besitzen. Tatsache ist: Das Libretto Salvatore Cammaranos und Giuseppe Verdis ist nicht besser und schlechter als das der anderen Meisterwerke Verdis, der schon früh darauf bedacht war, gute, also theaterwirksame Texte in die Hände zu bekommen (die Lektüre seiner diesbezüglichen Produktionsbriefe ist stets von Neuem ein Vergnügen). Sämtliche Informationen zum Verständnis der Handlung einschließlich der Vorgeschichte finden sich im Text selbst, und die Lücken, die zwischen den einzelnen Bildern klaffen und in denen sich wichtige Handlungsteile abspielen, sind jedem Menschen erschließbar, der in der Lage ist, den Text der Oper genau zu lesen. Wenn man freilich nur darauf erpicht ist, einer Musik zu misstrauen, die in ungeheurer Melodienfülle, dramatischer Gedrängtheit und varietà das Innen-Leben zu zeichnen vermag…

Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert. Nicht zuletzt durch einen wichtigen Aufsatz Götz Friedrichs (eines praktizierenden Regisseurs, keines bloßen Theoretikers) aus dem Jahre 1966 wissen wir inzwischen, dass der Troubadour in Verdis Gesamtschaffen eine ästhetische Besonderheit darstellt, die nicht zufällig, sondern mit Bedacht hergestellt wurde, indem der Komponist der Geschichte innerhalb eines besonderen dramaturgischen Rahmens eine spezifische, sehr düster gefärbte tinta musicale verlieh. Es brauchte indes ein wenig länger, eh man die Opernhändchen vom Theater vertrieb und anfing, den „Realismus“ dieses stets von Neuem packenden Werks in Szene zu setzen. Hans Neuenfels erobert sich 1974 die Opernbühne, als er in einer umstrittenen und berühmten Inszenierung bewies, dass sich die Bewegungen der Figuren nicht mehr in die herkömmlichen Schemata pressen lassen.

47 Jahre später ist es, am selben Ort, Peter Konwitschny, der einen typisch konwitschnyhaften Zugang zum Dramma lirico findet, wenn er auch die Inszenierung nicht selbst beenden konnte. Behauptet das Libretto mit seinen acht Szenen- und vier Doppelteilbildern eine tableauhafte, auf Schlaglichter setzende Handlung, bietet die neue Nürnberger Inszenierung eine Mischung aus Kontinuität und bewusstem Spiel, blutigem Ernst und theatralischer Lockerheit. Konkret: Beginnt das Spiel als ausdrückliches Puppentheaterspiel – womit der Zuschauer an Leo Karl Gerhartz‘ überzeugende Interpretation des Troubadour erinnert wird, derzufolge es sich bei der italienischen Oper dieser Epoche um eine Mischung aus Kasperle, Kirche und Kirmes handelt , so geht es allerspätestens dann zur Sache, wenn das Miniaturtheater auf dem Theater im Kampf um die Festung Castellor – und um Leonore – zusammenstürzt (was wieder für gute Auftrittsmöglichkeiten und beeindruckende Bilder sorgt). Wird zu Azucenas Erzählung eine Zigeunerin (eine grandiose Nürnberger Edel-Statistin, die endlich einmal auf dem Programmzettel genannt wird: Monika Schrödel-Hecht) verbrannt, fahren also die Flammen des Scheiterhaufens tatsächlich empor, sehen wir auf einen alten Theatertrick: das lodernde Feuer ist nichts weiter als ein im Wind sich bewegendes großes illuminiertes Tuch – Spiel und Wirklichkeit, Erinnerungen an die Historie und unschuldige Theaterrealität werden plötzlich eins.

Dem ideologisch besetzten Problem, heute keine Zigeuner mehr auf der Bühne darstellen zu dürfen, entkommt Konwitschny, indem es schlichtweg keine mehr gibt: die Chor-Compagnie ist (zunächst) die Soldateska, der militärische Teil eines Bürgerkriegs, dem sich auf Seiten Manricos schließlich eine Horde von Pistoleros zugesellt: als wär‘s ein Stück aus dem Wilden Westen. Der Amboss-Chor, dieses Prunkstück früherer Sonntagskonzerte, wird zum Fanal, nicht zur akustisch populären Schaunummer. Schaut man auf Timo Dentlers und Okarina Peters Kostüme, erblickt man eine Collage aus Risorgimento, spanischem Bürgerkrieg und Gegenwart.
Apropos Zigeuner: Die Sinti Allianz Deutschland dekretierte jüngst, also erst 2020, dass es „eine Zensur oder Ächtung des Begriffs Zigeuner, durch wen auch immer, nicht geben sollte und darf“. Nicht wenige Zigeuner akzeptieren diese Bezeichnung für sich selbst, vorausgesetzt, sie geschieht nicht in abwertendem Sinn. Insofern sind die Anführungszeichen bei der Nennung des Begriffs „Zigeuner“ in der Nacherzählung der Handlung im Programmheft das Zeichen einer politischen Korrektheit, die mal wieder alles besser machen will, aber die nötigen Differenzierungen so eliminiert wie die originalen Titel der vier Teile der Oper. Der zweite Teil – man muss das den Laien vermutlich erklären – heißt übrigens La Gitana, d.h. wörtlich (und ohne Gänsefüßchen) Die Zigeunerin. Im neuen Trovatore ist die Hauptfigur der Oper, also Azucena, eine Schwarze (Sängerin) – damit Angehörige einer nach wie in diversen Ländern diskriminierten Ethnie - die mit ihrer Stimme, aber auch schauspielerisch eine hinreißende Figur zum Leben erweckt. Als Außenseiterin mag sie, begreift man es im Lichte aktueller Rassenproteste, schon deshalb rollendeckend sein, aber dafür spricht wesentlich mehr. Denn Raehann Bryce-Davis verfügt nicht allein über eine breit ausschwingende, noble Höhe, sondern auch über eine emotional erregende Tiefe, die den Hörer an schwarze Gospel-Stimmen denken lässt. Damit, und mit ihrer bewegenden Darstellung einer zutiefst gespaltenen, weil zwischen Mutterliebe und Feindeshass changierenden Frau, erobert sie sich die Herzen der Zuschauer. Grandios ihr abschätziger Blick auf die sterbende Leonora (das herzbewegende „Ai nostri monti“ klingt plötzlich wie eine gemeine Provokation), hinreißend ihre Verzweiflung in der Erinnerung an die traumatisierenden Erlebnisse. Schon Bryce-Davis ist den Besuch der Produktion wert.

Der Schluss, mit Azucena, Manrico, Leonora und dem Conte Luna, ist übrigens nicht irgendeine Form von organisiertem Bühnenwirrnis, sondern eine Folge von sachlichen Abgängen, angeblich „nachts um zwei auf einem Bahnhof“. Es bleibt zurück: der Graf, der nach der Mitteilung, dass er gerade seinen Bruder hinrichten ließ, in helles Lachen ausbricht. Im Programmheft heißt es schließlich: „Der Graf wird irrsinnig.“ Allein dies ist schon eine Interpretation, die sich aus der Inszenierung selbst nicht erschließt, denn Graf Luna könnte ja auch deshalb zu lachen beginnen, weil er die Aussage Azucenas für die Worte einer Verrückten hält – soviel zum Problem von dramaturgischer Vorgabe und der Freiheit des Zuschauers, selbst über ein Stück nachzudenken, in dem sich Symbolismus und handfeste Handlung, Abstraktion und konkrete Gestik beständig kreuzen.

Steht Bryce-Davies nicht auf der Bühne, können wir uns an Emily Newton erfreuen. Ihre Leonora, ein empfindsamer Sopran, der Verdis Erinnerungen an den feinsinnigsten Belcanto bewahrt, ist eine femme fragile, die Manns genug ist, um im Krieg die Knarre in die Hand zu nehmen. Graf Luna hat mit Sangmin Lee zum einen eine elegante Erscheinung – der Dandy mit Spazierstock -, zum anderen eine höchst potente stimmliche Erscheinung bekommen. Er spielt den brutalen Lüstling, dem Verdi eine, dank Bassklarinettenbegleitung, vielleicht absichtlich schillernde wie glatte Liebesarie gewidmet hat, mit Verve und großer stimmlicher Delikatesse. Tadeusz Szenklier wurde als indisponiert angekündigt, was nicht heißt, dass er nicht so laut wie immer sang, aber genauere Mitteilungen sind diesmal kaum möglich; dass er die beiden von Verdi nicht notierten, aber tolerierten hohen Cs in „Di quella pira“ nicht sang, muss nicht unbedingt auf die vokale Einschränkung zurückgeführt werden. Wenn Nicolai Karnolsky den Ferrando singt, der im ersten Bild seine Version der Vorgeschichte zum Besten gibt, fängt der Abend schon einmal gut an – und wenn der vom Chormeister Konwitschny inszenierte und von Tarmo Vaask einstudierte Chor des Staatstheaters zusammen mit einem Extrachor auf der Bühne steht, weiß man diese bedeutende Choroper in den besten Händen: fantastisch, was dieses Ensemble in den Chorpartien stets dynamisch und artikulatorisch leistet. Nicht zuletzt muss die Staatsphilharmonie Nürnberg gelobt werden, die unter Lutz de Veer einen handfesten, im besten Sinne flotten, also ganz und gar theateraffinen Trovatore bietet, der in keiner Sekunde schleppt, aber Zeit genug hat, um die instrumentalen Subtilitäten, die dunklen Töne (die Holzbläser!), das brio und die dramatische Kraft in den Zuschauerraum dringen zu lassen.
Mit einem Wort: ein löwenstarker Abend.
Frank Piontek, 12.12. 2021
Fotos: ©Bettina Stoess (Bild 5 zeigt nicht die erwähnte Darstellerin der Azucena, sondern Dalia Schaechter)
TAMERLANO
Premiere: 23.10. 2021
Selten genug, dass man mal eine Oper von Vivaldi nicht allein zu Gehör (das machen CD und Youtube ganz gut), sondern auch zu Gesicht bekommt. Obwohl es sich „nur“ um ein Pasticcio, also um ein seinerzeit beliebtes Misch-Produkt aus eigenen und andershändigen Arien aus frischen und weniger jungen Opern und neuen Rezitativen, handelt, ist der Barockopernfreund doch froh, dass die Nürnberger Vivaldis Tamerlano aufs Programm gesetzt haben. Der Impresario und Opernschöpfer brachte das Werk 1735 im Teatro Filarmonico heraus – in Nürnberg erlebt es seine Erstaufführung, wobei man seinerseits das macht, was Vivaldi damals zu tun beliebte: Man legte eine Fassung vor, die die überlieferten Arien zum Teil durch neue ersetzte, auch zwei strich. Es ist angesichts der Baukastentechnik einer Gattung, die weniger auf psychologische Abwechslung als auf die Routiniertheit beliebter Gleichnis- und Affektarien setzte, kein Schaden, auch wenn der Purist unter den Opernbesuchern es vorgezogen haben mag, neben den anderen 21 Nummern (19 Arien und zwei Quartette) die Arie Vedeste mai sul prato aus Hasses Siroe und Geminiano Giacomellis Non ho nel sen costanza aus dessen Adriano in Siria zu hören.

Der Barockopernfreund bekommt beispielsweise eine Porpora-Arie serviert, denn nicht alle im Textbuch abgedruckten Arien wurden in der Fassung des Vivaldischen Tamerlano überliefert: Tamerlanos Arie Cruda sorte, avverso fato wurde durch eine typische Cruda sorte-Arie aus Porporas Poro ersetzt, denn hier wie dort ist das Schicksal wieder einmal schrecklich. Im Übrigen bricht in Nürnberg spätestens dann das pure Entzücken aus, wenn Asterias Arie Amare un alma ingrata aus Hasses Siroe ertönt. Almerija Delic singt dieses hochlyrische Stück einfach herzbewegend. 12 Nummern des venezianischen Meisters (die Sinfonia und zwei Quartette eingeschlossen, nicht gezählt die beiden großen, leidenschaftlichen Accompagnato-Rezitative), die innerhalb der Nürnberger Aufführung teilweise verschoben werden, sowie drei Arien von Giacomelli, fünf Arien des großen Hasse (des Großmeisters der Opera seria) und je zwei Arien von Riccardo Broschi und Nicola Porpora (der seit 2020 beim Bayreuth Baroque Festival eine grandiose Auferstehung erlebt): daraus besteht das Stückwerk, dessen stilistischer Ambitus jedoch weniger groß ist, als man es vor allem in Blick auf Vivaldi und den jüngeren Hasse bemerken könnte. Dem sog. Laien mag eh alles gleich klingen, aber dem Kenner der Vivaldischen und Hasseschen und Porporaschen Tonsprache fällt auf, dass die drei Meister ihre eigenen Rhythmen und Harmonien besaßen – am Ende werden die Kontraste – eben durch die Kontraste zusammengehalten, denn es fällt auf, dass Vivaldi für die „guten“ Figuren seine Arien einsetzte, während er für die „finsteren“ vor allem die der Kollegen (die auch Konkurrenten waren) verwertete; ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist ja schon reizvoll, die heroische Trompete und die kühn aufspielenden Hörner zu vernehmen, wenn der Titel-Tyrann – wie in Porporas grandioser „Destrier“-Arie aus dem Poro - zu einer seiner vollmundigen Verlautbarungen anhebt. Es machte und macht schon Sinn, dass Hasse seine empfindsamen Töne je zweimal dem Andronico und der Asteria (unwillentlich) zur Verfügung stellte.

Worum aber geht‘s in einer Oper, die eher durch Händels Vertonung als durch Vivaldis Pasticcio bekannt ist? Um Sex, politische Gewalt, aber gewiss nicht um gute Laune. Es geht um eine übliche Eifersuchts- und Machtgeschichte, also um einen Diktator, der einen Erzfeind (Bajazet) unter Verschluss hält, dessen Tochter (Asteria) er begehrt, während eine zweite Frau (die Königin Irene) um sein Herz kämpft und der betrogene Dritte (Andronico, der Geliebte der Asteria) im dreckigen Spiel mitzuhalten versucht. Dreckig ist es auch deshalb, weil Bajazet (so heißt die Oper laut Libretto) im dritten Akt dem Tyrannen nicht verzeiht, sondern ungewöhnlicherweise gewaltsam stirbt, bevor das obligatorische lieto fine für eine Art Frieden sorgt; die Inszenierung beharrt nicht darauf, dass damit alles alles gut sei. Nina Russi parallelisiert die weibliche Hauptfigur mit einer jener Aktivistinnen, die in Weißrussland und Russland mit pazifistischen Mitteln gegen die regierenden Psychopathen revoltieren, um schlussendlich jahrelang eingesperrt zu werden. Das Ende der Inszenierung markiert eine Utopie: Asteria bleibt, vor der schwarzen Scherenwand des Palasts und der Machtzentrale, eine politische Kämpferin, nachdem ihr Vater es nicht vermocht hatte, die Lehren, die er aus der Lektüre der Schriften Antonio Gramscis gezogen hatte, in die Tat umzusetzen – ein akzeptables Schlussbild einer Deutung aus dem Geist der unmittelbaren Gegenwart, die das Stück nicht beschädigt.

Denn Almerija Delic (als Asteria), Julia Grüter (als Irene), Nian Wang (als Andronico) und Maria Ladurner (als Idaspe, die Terrorassistentin des Gewaltherrschers) bieten beste Leistungen; wo Grüter (sie vor allem), Wang und Ladurner die Koloraturfeuerwerke eines Hasse und Broschi aus ihren geläufigen Gurgeln herauslassen, ist die Begeisterung des Publikums vollkommen, während Delic mit ihrem expressiven Alt auf einer anderen Ebene entzückt. Seltsamerweise hat der Bösewicht die höchste Stimme: David DQ Lees Counter verleiht dem Verbrecher einen Hauch von Dekadenz (Gold steht ihm übrigens besonders gut). Florian Götz ist schließlich Bajazet, der Mann im Rollstuhl und auf Krücken, ein Wrack sondergleichen, der denn seine drei Hass- und Verzweiflungsarien auch weniger einschmeichelnd als kernig heraussingt.

Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt wieder unter der Leitung von Wolfgang Katschner; zusammen mit den beiden Cembali und den Lauteninstrumenten des 18. Jahrhunderts produzieren sie so etwas wie einen Misch-Sound, der mehr nach Vivaldis Zeit als nach der Gegenwart klingt, auch wenn Dynamik und Pathos eindeutig dem Heute angehören – was nicht allein für die Szene gilt.
Frank Piontek, 24.10. 2021
Fotos: ©Bettina Stöß
CARMEN
Premiere: 2.10. 2021
Sieht sie nicht ein wenig aus wie die Senta in Dmitri Tcherniakows umstrittener Holländer-Produktion der diesjährigen Bayreuther Festspiele? Bewegt sie sich nicht so aufreizend eigenständig über die Bühne wie die junge Frau, mit der sie zumindest Eines zu teilen scheint: die Intervalle der „großen“ Nummern?
Es wäre reizvoll, einmal Wagners und Bizets Figuren miteinander zu vergleichen – um am Ende festzustellen, dass sie vielleicht mehr miteinander zu tun haben, als es Cosima Wagners Wort vom „grellen Hervortreten der jetzigen französischen Manier“ suggeriert. Im Übrigen war (ausgerechnet, denn sie saß ja im Glashaus) sie der Meinung, dass ein Mann, der seine Frau bei der Untreue ertappe, dass Recht habe, sie zu töten. Dies nur als Bayreuther Einstieg in die neue Nürnberger Carmen-Inszenierung, die, zumindest vom Optischen, gelegentlich vom Tänzerischen her, eher mediterran als deutsch anmutet, bis hin zur Tatsache, dass das Klischee vom flamencotanzenden Volk (das ja kein Klischee ist) sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauersaal – durchaus ohne ironischen Abstand (es störe sich dran, wer will) – seine Bestätigung erfährt. „Sso ssind wir“, spricht mir eine charmante und lustige Frau aus Andalusien ins Ohr, als sich auf der Bühne die drei Frauen von der folkloristischen Tanz-Compagnie, darunter zwei gebürtige Frauen aus Spanien (Miriam Fernandez Benitez und Sara Ruiz, daneben Katharina Fixl), laut und notorisch schnell schnatternd um Don Jose streiten, bevor zu Beginn des letzten Akts ein begeisterter „Ole!“-Ruf aus der 10. Parkettreihe zur Bühne schallt. „Carmen“ ist, man hört‘s an diesem Abend, eine echte spanische Oper; es macht durchaus Spaß, gerade an diesem Abend in der Spanien-Kurve zu sitzen.

Dass das Bühnenbild eher Kuba als Andalusien verpflichtet ist, verschlägt dabei nichts. Die Inszenierung Vera Nemirovas und die Szenierung Heike Scheeles (wieder eine Meisterarbeit der Herheim-Partnerin) hat nicht den Anspruch, die Oper in einer konkreten Zeit und mit authentischen politischen Inhalten auszustatten, auch wenn die Bilder des ersten, zweiten und vierten Akts dies nahelegen. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass Akt 1, 2 und 4 in einem ruinierten Theater spielen, das wir uns in Havanna vorstellen können – kam frau angesichts der Habanera auf diese Idee? - verweist auf Anderes, denn hier wird keine Positionierung vorgenommen, sondern, das macht spätestens das zweite Bild klar, ein typisch scheelescher Fantastischer Realismus gesetzt. Wenn wir den Entr‘acte zum dritten Akt hören, der den ersten Teil des Abends beschließt, versinkt plötzlich der untere Teil der Bühne auf der Bühne, um den Sternenhimmel sichtbar zu machen, unter dem die Schrecken des 3. Akts vor sich gehen werden – und Carmen, zärtlich und zärtlichkeitsbedürftig wie keine Zweite, setzt sich neben den traurigen Clown, der die Gestalt des Kaschemmenwirts Lillas Pastia (mehr als eine Charge: Anton Koelbl) angenommen hat, legt ihren Kopf an seinen und fasst seine Hand, während der sie im Arm hält. Und dazu Bizets zauberische Musik, die von einer Idylle träumt, die es für Carmen nicht geben wird. Die Schönheit der Oper...

Diese Carmen ist eine Theater-Carmen, obwohl Anna Dowsley, prachtvoll lyrisch, opernhaft groß (doch nicht forciert) und dramatisch erfüllt genug agiert, um die „Wirklichkeit“ einer Figur zu beleuchten, die sich tatsächlich, wie es im Programmheft heißt, ihre „Liebhaber“, also Sexpartner, auszusuchen pflegt, auch wenn man, vertraut man Egon Voss und seinem wichtigen Aufsatz im Carmen-Band der Rowohlt-Opernreihe von 1984, auch davon überzeugt sein könnte, dass Carmen in dieser Welt des Verbrechens und des Prekariats stets Objekt, nie Subjekt – und schon gar nicht jene femme fatale ist, für die man sie einmal hielt. Anna Dowsley ist, man sieht's in der Schmuggler-Szene, auch nur ein Opfer der brutalen Kerle, die eine eigene Art von Schmuggel betreiben – dass hier Menschen zu Ausbeutungsopfern werden, die man gegen Geldzahlungen und Passabnahmen in Container pfercht, ist weniger zeitgeistig als angemessen; zudem reibt sich diese Interpretation nicht mit dem Text, auch nicht mit der Musik, der man das Operettenhafte einer heiteren Opera comique auch dann anhört, wenn das Nürnberger Staatsorchester unter Guido Johannes Rumstadt und die Sänger nicht so luftig musizieren wie es im 19. Jahrhundert üblich (und angesichts der präzisen Bizetschen Partituranweisungen) und noch der Einspielung unter Andre Cluytens (von 1950) anhörbar ist. In Nürnberg setzt man an den dramatischen Stellen innerhalb der Dialogfassung (man spricht die deutschen Texte von Walter Felsenstein) eher auf große als auf die Tradition der „Opéra comique“ – was weder Miss Dowsleys Leistung noch die ihrer Bühnenpartnerin Julia Grüter schmälert.

Julia Grüter – wer sonst an diesem Haus könnte diese Partie so vollkommen singen und spielen? - ist eine Micaela von hohen Graden. Zauberhaft die von Bizet geforderte lyrische „simplicité“ dieser mit einem klaren Stimmprofil charakterisierten Rolle, bannend die Schönheit ihrer vokalen Linien.
Dass Tadeusz Szlenkier den Don José mit Kraft und dem leicht lagrimosohaften Pathos seiner Stimme singen wird, war klar. Es passt zur Rolle des Mannes, der schon Angst hat vor Micaela (der mütterliche Kuss kann nur durch die Luft fliegen) und vollen Gehorsam und Treue dort einfordert, wo gerade diese Forderung die Liebe – oder das, was Carmen und Don José davon halten – töten muss. Wenn im Schlussbild Carmen als Torera prachtvoll gekleidet die leere Arena vor der Bühnenbühne betritt, weil sie sich auch optisch dem Mann angleichen will, für den offensichtlich ihr Herz (zumindest jetzt) zu schlagen scheint, wird klar, wer der Stier ist, der dort am notwendigen Ende in seinem Blut zu liegen hat – doch könnte der Zuschauer auch auf die Idee kommen, dass Don José eine andere Art von toro ist: nur, dass er, indem er Carmen tötete, sich selbst getötet hat. Und er könnte vermuten, dass die Situation von Carmen freiwillig umgedreht, ja pervertiert wird: denn sie ist, sie weiß es, der Stier, der finalmente zu Boden fallen muss, damit sie, Carmen, aus einer Situation erlöst wird, für die nicht einmal Richard Wagner den rechten „Erlösungs“-Schluss gefunden hätte – „Erlösung gibt es nur dort, wo es keine Lösung gibt“, wie Vera Nemirovas Lehrer Peter Konwitschny einmal so schön sagte. Aber stimmt es noch im Zeitalter der Emanzipation, der Metoo-Debatte und der Epoche, in der ein „Nein“ nichts als „Nein“ bedeutet?

Vera Nemirovas Inszenierung wird dem sog. Mythos namens Carmen insofern gerecht, als dass sie letzten Endes auf eine allzu eindeutige „Lösung“ und Beurteilung der Konflikte, die diese Oper grundieren, verzichtet. Stattdessen setzt sie, wie gesagt: mit Heike Scheele (und der Kostümbildnerin Marie-Thérèse-Delnon), auf eine latente Offenheit, die die Figur Carmen weder sozialgeschichtlich verkleinert noch mythologisch aufbläst. Diese Carmen ist eine Frau, deren Attraktivität für die Machogesellschaft zutage liegt, und mit der sie solange spielt, bis sie sich eingestehen muss, dass es mit dem Spiel nur solange getan ist, bis die blutige Wirklichkeit auch ihr Schicksal besiegelt: zwischen Fatalismus, Wut und einer tiefen Traurigkeit, die noch das letzte Bild überschattet, während der „strahlende“, d.h.: präpotente Dritte im Bunde, also Escamillo (Sangmin Lee macht ihn kernig, stimmstark, eindeutig „männlich“), mit der Trophäe eines riesigen Stierkopfs am Ende über den Opfern der amour fatal wie ein Denkmal seiner selbst im Glanz des Bluts in der Arena die Tragödie beschließt, die im Grunde keine ist.

Wir sahen der Heldin nur bei dem Versuch zu, in einer lieblosen Gesellschaft aus Sex und Geld, die das Ausleben ihrer Triebe schon für ein Zeichen der besungenen „Liberté“ hielt, innerhalb ihrer pragmatischen Aktionen so etwas wie Würde zu bewahren – doch auch ihr wird am Ende, wie dem brutalen Polizeichef Zuniga, fast buchstäblich der Hals umgedreht. Ob sie Don José einmal wirklich „liebte“? Ob sie im BH ehrlicher war als in der Lederjacke? Die Frage gebt verloren.
Der Rest ist eh der Beifall des Publikums, der zumal von den Sängern dieser bildstarken und musikalisch erfüllten Produktion begeistert war.
Frank Piontek, 3.10. 2021
Fotos: ©Bettina Stöß
AUFTAKT: VORSTELLUNG DER NEUEN BALLETT-SPIELZEIT
25.9. 2021
„Balancé on one, balancé on two“, sagt José Hurtado und die Compagnie balanciert. Attitude, plié en face, und dann wieder: Arabesque. Der Maestro spielt auf dem Klavier-, die Vierer,- Dreier und Fünfergruppen walzern sich auf die Bühne, die Übergänge fliessen wie von selbst, der Rhythmus wird eleganter, von den einfachen geht es schließlich zu den weiten und hohen Übungen: im Walzertakt springt es sich schon so wie im Schwanensee und der Giselle. Es ist eine wahre Freude, den Tänzern bei ihren Schritten zuzuschauen – aber wir beobachten „nur“ ein typisches Aufwäremtraining, das vom Ballettmeister in einem Esperanto aus Englisch und Spanisch geleitet wird. „Is clear?“ fragt er immer wieder, nachdem er die jeweilige Übung vorexerziert hat. Is clear.
Die Compagnie des Nürnberger Staatstheaters ist inzwischen auf nicht weniger als 24 Mitglieder aus 11 Nationen angewachsen. Ein zweiter Höhepunkt: sie stellen sich, in der chorus line stehend, alle persönlich vor – und erhalten jeweils den kurzen, herzlichen Applaus, den wir spätestens aus Barrie Koskys Meistersinger-Festwiesenempfang kennen. Beim „Auftakt“, in dem der Compagniechef die neue Spielzeit ankündigt, sind sie alle vertreten: auch in der ersten Premiere der ersten Spielzeit, die nach einem schwierigen, bühnentanzlosen Jahr die Saison eröffnen wird. Montero ist stolz darauf, dass es trotz der prekären Situation gelungen ist, das Ensemble noch einmal zu erweitern: auf dass der Doppel-Abend „Narrenschiff / Maria“ noch voluminöser ausfalle als die „üblichen“ Montero-Produktionen. Die Besonderheit dieser Arbeit, sagt Montero im Gespräch mit der Dramaturgin Lucie Machan, wird darin bestehen, dass Diana Vishneva, 2013 Gründerin des russischen Tanzfestivals Context, in Maria honorfrei auftreten wird, so wie die Choreographen Ohad Naharin und Edward Clug noch einmal nach Nürnberg zurückkehren werden, um ihre Choreographien in Naharin / Clug / Montero, die kurz vor Corona schon fast fertig waren, aus Respekt vor der hervorragenden Truppe auf die Bühne zu bringen. Und „Diversity“, sagt der Chef, ist wichtig: wenn die Tänzer alle paar Jahre völlig fremde choreographische Stile tanzen müssen, bleiben sie „frisch“.
Montero hat mit seinen Leuten, sagt er, „die ambitionierteste Spielzeit seit je“ vorbereitet. Mit vier Premieren, einer Wiederaufnahme und einem finalen Russland-Gastspiel wird man dem Publikum, aber auch den Tänzern, die in der Corona-Zeit lediglich eine späte Premiere und eine (bemerkenswerte) Film-Produktion (Der Wolf) vorlegen konnten, etwas geben, was sie so vermisst haben, zumal „ein Tanzleben mit 5 Jahren sehr kurz ist“.
Die Musik wird auch mit der bewährten Kombination aus Alt und Neu 2021/22 eine Hauptrolle spielen. Beim Narrenschiff stoßen Lera Auerbach und Monteros Hauskomponist Owen Belton auf die letzten beiden Lieder aus Strauss‘ Vier letzten Lieder, wobei hier wieder Live-Gesang (Emily Newton) mit den Tänzern konfrontiert wird. Wir haben das schon einmal erlebt, als anlässlich einer Bach-Kantaten-Interpretation der Chor und die Solisten des Nürnberger Staatstheaters zusammen mit den Tänzern agiert – Bach, der auch ein grandioser Ballettkomponist geworden wäre, wenn er nicht schon sowieso seine Musik auch für Tänzer geschrieben hätte, und der, sagt Montero, sein Lieblingskomponist ist, wird im Mittelpunkt von Goldberg stehen, einem Stück zwischen „Wirklichkeit und Traum“. Montero vergleicht Narrenschiff und Goldberg und kommt zum Schluss, dass Ersteres einem Bild von Francis Bacon, zweites eher einem Gemälde von Mark Rothko ähnelt. Wir hören Pergolesi, den Beginn seines grandiosen Stabat mater, als es zur öffentlichen Probe aus einer Anfangssequenz von Maria kommt: erst stumm und relativ langsam, mit Ziffernansagen und Korrekturen, dann in Echtzeit: mit Soundtrack, größter Energie und jenen typisch Monteroschen Figuren (Gruppenzusammenballungen, Bodenarbeit, Individualdistanzen), denen der Choreograph immer wieder neue Varianten abgewinnt. Hier geht‘s, sagt Montero, um das Finden seiner eigenen Seele – die rechten Schritte haben die Tänzer schon in der Wiederaufnahme-Produktion Goecke / Godani / Montero gefunden, aus der am Ende je eine Szene präsentiert wird.
„Grandioso“, wie Jose Hurtado sagen würde.
Frank Piontek, 26.9. 2021
DER VETTER AUS DINGSDA
Premiere: 17.7. 2021. Besuchte Vorstellung: 28.7. 2021
Der strahlende Mond ist ein Lampion. Julia de Weert, die, wie eine andere Rusalka, nach ihrem Traumgeliebten schmachtet, ist ein Girlie von heute.
Mit Eduard Künnekes einzigem Langzeiterfolg, der Operette Der Vetter aus Dingsda, die just vor 100 Jahren im Berliner Theater am Nollendorfplatz uraufgeführt wurde, wo in den 80er Jahren ein anderes (Alb-)Traumstück eine Aufführungsserie erlebte – Brittens Sommernachtstraum - , hat das Nürnberger Opernhaus in kurzer Frist einen weiteren Erfolg auf dem Gebiet der Operette der 20er Jahre erringen können. Nach Paul Abrahams Märchen im Grand Hotel haben wir es bei Künnekes Opus mit einem durchaus anderen Werk zu tun. Beginnt der einstige Welterfolg wie eine Spieloper von Lortzing, sind wir bei „Onkel und Tante“ akustisch schon bald in jener Zeit angelangt, der das Werk seine Existenz verdankt, bevor Künnekes unverwechselbare Einsprengsel einer etwas älteren – und immer zauberhaften – Musik wiederkehren. Anders als das Nürnberger Märchen im Grand Hotel wird die Geschichte weniger vom Blatt, als von heute aus erzählt. Natürlich hat Vera Nemirova, als getreue Schülerin Peter Konwitschnys, sich nicht damit begnügt, eine mehr oder wenige brillante Inszenierung hinzulegen, die, bei aller Frische der Musik, das Historische des Sujets betont.

Bei ihr agieren alle Figuren aus einem Jetzt heraus, das ihre Emotionen verständlich macht – also ist die anfangs zitierte Julia eine junge Frau, die mit ihrem Traummann, den seit Jahren in Batavia lebenden Roderich, nur in Form von Selfies, in Chats und in Twitternachrichten kommuniziert. Nemirova hat den Vetter auf 90 Minuten eingedampft, was schon deshalb genügt, weil 1. die Musik vollumfänglich zum Einsatz kommt und 2. die Julia und ihr wahrer Roderich von Andromahi Raptis und Martin Platz gesungen und gespielt werden: sie als ansprechend artikulierender Sopran, der das rechte Zwitschern in der Stimme hat, das schon und gerade im Mondlied beglückend in den Zuschauersaal tönt, er als scheinbar ewig jugendlicher Luftikus, der das helle Tenorherz gleichsam auf der Zunge trägt. Erscheint sie ihm zunächst buchstäblich wie eine Fee des Smartphone-Zeitalters (die Blondhaarperücke fällt passgenau in jenem Moment, in dem er mit dem Lied vom Wandergesellen einen der „Schlager“ des Stücks anstimmt), lässt er sich auf das fröhliche Spiel mit der „Prinzessin Rührmichnichtan“ im selbstgebauten Glashaus ein – das Stück ist, alles in allem, eine Bildungsoperette: Julia oder der Weg zum wahren Ich und Anderen. „Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken; küss mich, und alles ist gut“ klingt da plötzlich nicht wie ein typisch operettenhaftes Machospruch, sondern wie eine existentielle Aufforderung, sich von der medialen Fiktion weg- und einem wirklichen Partner zuzuwenden. Eignet dem Stoff auch jenes Operettenmärchenhafte, das die Librettisten schon in den Text brachten (und das in der neuen, sprachlich ins Heute gebrachten Fassung bewahrt blieb), wird der Konflikt doch ganz ernst genommen: wie eine Frau, in diesem Sinn eine Nachfolgerin der Elsa von Brabant, den „echten“ Namen ihres Geliebten erfahren will, um „sicher“ zu sein, dass sie am Ende eventuell den Falschen bekommt, obwohl sie mit Shakespeares Julia weiß (und rezitiert), was nicht in einem Namen ist. „Liebst du mich nur, wenn ich Roderich bin?“, fragt der Fremde mit dem seltsamen Namen August Kuhbrot. Die Inszenierung nimmt die Frage, was hinter der Frage steht, angemessen ernst, lässt neben der Lohengrin-Nähe auch den Tristan-Akkord erklingen, wenn die Überlegung ventiliert wird, wann denn Tristans und Isoldes Liebe, hätten sie sich gefunden, am Ende gewesen wäre. Spätestens dann, wenn Isolde gesagt hätte: „Tristan, bring den Mülleimer runter

Vor die Lösung des Konflikts hat der Operettengott den dramaturgisch seinerzeit ungewöhnlichen 3.-Akt-Auftritt, hier mit einer alte Schrottkarre, des „zweiten Fremden“ gelegt. John Pumphrey spielt den „echten“ Roderich, sein Hannchen ist die Paula Meisinger – das letzte Mal erlebte man sie in Nürnberg als Grisette in Massenets Manon, nun ist sie eine freche und stimmstarke wie charmante Variante des weiblichen Parts des „niederen Paars“, die keine Selfies machen muss, um ihren Instant-Geliebten für sich zu begeistern. Doch auch für Julia de Weert gibt es eine Rettung: Roderich schafft es tatsächlich, sie von ihrer Handysucht abzubringen – die Kürze des Abends zwingt dazu, die Botschaft schnell und vielleicht ein wenig zu plakativ an den Mann, mehr noch an die Frau zu bringen (aber als Videogroßbild ist Andromahi Raptis auch schauspielerisch-mimisch bezwingend).

Bleiben der geschädigte Dritte – Hans Kittelmann als Egon von Wildhagen – und die enttäuschten Erbschleicher namens Onkel und Tante. Hält Egon sich, in einem gewitzt inszenierten, mit diversen Stimm- und Lautimitationen und gymnastisch choreographierten Übungen der Beteiligten ausgestatteten Strand- und Meerbild, das die Sehnsucht nach Batavia koloristisch und parodistisch ausmalt, hinter der rhythmisch wackelnden Kulisse in gegenseitigem Vernehmen an der Tante schadlos, haben die Verwandten, durchaus „werktreu“, immer noch die Fresstafel für sich. Taras Konoshchenko und Franziska Kern haben zwischen Pizzakarton und Schweinekopf sichtlich Spaß auf und an derselben. So gelang ein temporeicher Abend, der – das ist so ein Konwitschny-Ding – mit Licht im Zuschauerraum und einer inszenierten Verbeugungstour endet, ganz nach dem Motto: Der Vorhang zu und alle Fragen (an die Zuschauer) offen. Man hätte es nicht gebraucht, aber nach dem starken Abend war‘s in Ordnung, denn der wurde zu wesentlichen Teilen von der Staatsphilharmonie unter Lutz de Veer getragen. Wie sie Künnekes quicklebendige, brillant instrumentierte, mit Anklängen an Humperdinks Hänsel und Gretel und gleichzeitig mit dem harmonischen und rhythmischen Standard der 20er Jahre angereicherte Partitur realisierten, war schon die glückliche Reise wert – aber das ist schon ein anderes Künneke-Stück.
Frank Piontek, 29.7. 2021
Fotos: ©Ludwig Olah
GOECKE / GODANI / MONTERO
Premiere: 10.7. 2021
Vor einigen Jahren konnte man in einer nordoberfränkischen Tageszeitung anlässlich einer Rezension eines Werther-Balletts die Behauptung lesen, dass „Liebe“ nicht getanzt werden könne. Die Meinung der Rezensentin war ungefähr so sinnvoll wie die Aussage, dass man „Liebe“ mit Worten wiederzugeben vermag. Natürlich kann man „Liebe“ tanzen, und dies schon deshalb, weil der Begriff so viele Bedeutungen, dass er nicht mit ein, zwei Schritten dargestellt werden kann. Ja: „Liebe“ kann schon deshalb eher getanzt als verbalisiert werden, weil sie eine Sache der Geste und des Ausdrucks und weniger einer Behauptung ist. Warum denn gibt es so viele Ballette und Tanztheater-Abende, in denen das, was wir gemeinhin unter „Liebe“ verstehen – getanzt wird?

Die Erinnerung an die Behauptung kommt wieder, als ich mir den ersten Teil des dreiteiligen Tanztheaterabends anschaue. Der Choreograph Marco Goecke hat mit Woke up blind eine Produktion vorgelegt, deren Bewegungsmuster nicht überraschend sind – zumindest nicht für den, der schon einige seiner Choreographien gesehen hat. Sie tanzen also wie Besessene, dabei sehr elegant und formbewusst, nutzen im Stehen den maximalen umgebenden Raum, lassen mit rasender Geschwindigkeit ihre Gliedmaßen wedeln, schieben und schaufeln: als wollten die Körper Maschinen werden. Das typische Zucken verstärkt sich, wenn die Gitarreneinsätze in Jeff Bickleys Rocksongs schroffer werden. Wir kennen das Bewegungsrepertoire des Choreographen, der behauptet, dass er während der Choreographie keine Emotionen bezüglich eben dieser Choreographie verspüre, schon von seiner Nürnberger Produktion Thin skin. Nun setzt er seine Arbeit mit einem Nachtstück fort, in das ein inneres Feuer fährt: „als ob sie“, heisst es im Programmheft, „von allen Seiten gleichzeitig entzündet würden“, was nicht heisst, dass die Abläufe in irgendeiner Art objektiv erklärbar wären. Schrieb ich 2019, dass die Ästhetik dieser Körpersprache auf die Dauer ermüdend sein und eine Kürze von 15 Minuten vollkommen ausreichen würde, um angesichts der technischen Exercises erfreut zu werden, endet Woke up blind tatsächlich nach einer Viertelstunde, doch gibt es einen Unterschied: diesmal bewegen die Begegnungen zwischen den zwei Tänzerinnen und den fünf Tänzern, weil zwischendurch tatsächlich (erotische) Begegnungen stattfinden – ganz abgesehen davon, dass im zweiten Teil in Form von roten Samthosen jene Farbe ins Spiel kommt, die wir im dritten Teil des Abends wiedersehen werden.

Sofie Vervaecke ist auch in Teil II präsent; als prima inter pares führt sie die 13 Tänzer an, die Bartóks 4. Streichquartett in einer Choreographie von Jacopo Godani – nein, nicht vertanzen, aber direkte Entsprechungen von Rhythmus und Einsätzen gibt es doch auch. Die fünf Sätze des Quartetts erlauben es, jeweils fünf verschiedene Gruppen-Kombinationen aufzustellen; auf das Ensemble folgt ein gleichgemischtes Quartett, auf das zwei Männer folgen, den Mittelsatz (No. 3) macht ein Quintett aus einem Quartett und einem Solisten, im vorletzten Satz treten alle Tänzer minus zwei auf die Bühne, und schließlich erleben wir die gesamte Truppe im Finale. Nach Goeckes Arbeit wirkt Godanis Metamorphers wie eine Übung in Langsamkeit, in der sich die Tänzer schlangengleich über die Bühne bewegen: zunächst vor einem relativ schmalen Raum-Licht-Streifen, dann auf der dunkleren Bühne – doch niemals so heftig wie in Goeckes Woke up blind, sondern mit Bewegungen, die eher zärtlich als brutal anmuten: selbst dann, wenn Bartòk gleichsam zur Sache geht. Vervaecke gibt scheinbar Zahlenkommandos an, aber sie vollführt auch mit Edward Nunes einen lyrischen pas de deux, den man nicht erklären muss. Für Godani ist Tanz um seiner selbst willen da, womit er nicht einmal den Standpunkt Goeckes vertreten mag, dass es beim Tanz um die Begegnung und die Erkenntnis des (Tänzer-)Körper geht. Metamorphers ist deshalb doch nicht autistisch, sondern betont publikumsfreundlich; der Beifall beweist es.

Während in der zweiten Pause Verdis „Va pensiero“ über den Platz klingt und die „goldenen Flügel“ ins Gedächtnis rufen, liest man im Programmheft den Text von Lennon/McCartneys Blackbird, in dem die „broken wings“ eine seltsam paradoxe Rolle spielen. Goyo Monteros Blitirí hat es zunächst weniger mit gebrochenen Flügeln als mit einer ungeheuren, in seinem Nürnberger Werk eher seltenen fröhlichen Vitalität zu tun. Die Choreographie scheint zuletzt einige der Themen zusammenzufassen und weiterzuführen, die bei Goecke und Godani verhandelt werden: die Bedeutung des Körpers und der Körper, die sich begegnen, die Farbe (und das Licht) im Dunkel der Bühne, das Verhältnis zum Publikum, das offensichtlich problematisch ist, weil es zwischen Zuneigung und Verstörung changiert. In der Mitte des 3. Teils, wenn Mozarts Gluck-Variationen verklungen sind, kommt es zu zaghaften und unsicheren Verbeugungen: der Beifall des Publikums ist echt, das Ritual, als gebrochenes, einstudiert. Was nach dem fröhlichen Kehraus der circensich und komödiantisch aufgefassten Variationen bleibt, ist ein Kampf. Hat sich Montero hier von Goecke inspirieren lassen? Goecke ließ einst seine Tänzer in Sweet Sweet Sweet inmitten eines schwarzen Meers aus 3500 Luftballons sich mit präpotenten Zittergesten bewegen. Blitirí (das Wort bedeutet ein Wort, das Nichts bzw. Unsinn anzeigt) endet mit einem gewaltigen, geräuschvollen, aggressiven Kampf mit schwarzen Ballons und Ballonfiguren. Der Rest ist nicht ein lustvolles gemeinsames Atmen (wie in den Gluck-Variationen), ist nicht der Versuch, mit der Hilfe seiner Freunde die Schwerkraft zu besiegen (ein schönes Bild: wenn Ana Tavares kurz nach oben fliegt), sondern, während wir PJ Harvey hören, der Klang zerknallender Luftballons. Er wollte, sagte Montero, mit dem Schlussstück der Trilogie etwas Zugängliches schaffen. Das ist ihm und der Compagnie zweifellos gelungen: auf jenem Niveau, das immer komplex ist und gleichzeitig immer etwas Neues enthält, auch wenn zum wiederholten Mal sein langjähriger Musikpartner Owen Belton dabei ist. Also Riesenbeifall für die Compagnie.
Frank Piontek, 11.7. 2021
Fotos: ©Jesús Vallinas.
THE RAPE OF LUCRETIA
Premiere: 13.6. 2021
„Abstand“, rief die Hofdame der Infantin in der Operette, die vorgestern Premiere hatte. Auf Abstand will auch Lucretia – das altrömische Exemplum für Tugend und Leiden einer Vergewaltigten – ihren Vergewaltiger halten, doch mißgelingt‘s bekanntlich. In der Nürnberger Premiere möchte auch der Regisseur Jens-Daniel Herzogs Benjamin Brittens und Ronald Duncans Rape of Lucretia auf Abstand halten: und dies nicht allein aus den bekannten infektionstechnischen Gründen. Auch an diesem Abend berührt man sich nicht, zumindest nicht körperlich; von seelischen Verwundungen und heftigen Kämpfen vielerlei Art sehen die Zuschauer genug, die diesmal nicht ganz so zahlreich kamen wie noch beim Pimpinone-Blaubart-Duett und bei Abrahams Märchen im Grand-Hotel. Es mag am Stück selbst liegen, das 1. dem Nürnberger Publikum eher unbekannt sein dürfte (ein Hinderungsgrund für altgierige Theaterbesucher) und 2. das Werk Probleme aufweist, die vermutlich selbst für strenggläubige Christen kaum lösbar sind. Duncan und nicht zuletzt der Komponist hatten, was an sich nicht originell war, da christologische Deutungen der Lucretia-Geschichte seit dem 17. Jahrhundert begegnen, der Fabel eine Interpretation im Geist des Neuen Testaments angehängt. Lucretias Suizid galt ihnen als Vorwegnahme des Schicksals des Heilands, der wie sie sein Leben für eine zu erlösende Menschheit gab: 500 Jahre nach dem mythischen Tod der „Heidin“. Britten und sein Librettist hatten 1946 das Problem des politischen Ge- und Missbrauchs der zuerst von Titus Livius erzählten Geschichte zwar nicht ausgeklammert, aber im Vergleich zur religiösen Überdeutung banalisiert.

Das Problem war schon für die Zeitgenossen der Uraufführung in Glyndebourne offensichtlich: dass der propagierten Botschaft, die am Ende von den beiden Kommentatoren der Handlung, dem Male und dem Female Chorus, verkündet wird, vermutlich nicht einmal in Bezug auf die gerade erlebten Gräuel des 2. Weltkriegs eine konkrete Realität entspricht. Die Mystifizierung der Wunden, die in der Rape of Lucretia das „Heil“ verbürgen soll, bleibt eine Provokation. Die Nürnberger Inszenierung geht nun durchaus produktiv mit dem Problem um. Um das Stück zu retten, das – als echter Britten – ein großartiges Stück mit einem verstörend seltsamen Finale ist, entschloss sich Jens-Daniel Herzog mit der Dramaturgie zu einer Umdeutung; nur nebenbei sei erwähnt, dass rein christliche Deutungen dann funktionieren, wenn uns die Regie auf Lucretias Passionsweg gleichsam mitnimmt: so gesehen und geschehen in Fiona Shaws grandioser Glyndebourner Inszenierung von 2013 (interessanterweise hat selbst diese Regisseurin bekannt, dass der ideologisch verkleisterte Schluss des bösen Stücks kaum einen heilenden Sinn habe). Bei Herzog aber packt Lucretia, der – man kann, aber man muss das nicht so deuten – ihren Schmerz nicht ernst nimmt, einfach ihre Koffer und verlässt die Bühne, nachdem sie ihren Klavierauszug zu Boden geworfen hat. Der Trick besteht darin, dass diese Lucretia in zweierlei Sinn aus ihrer Rolle fällt: als Bühnenfigur und als Opernsängerin – sodass der intrigante Junius, der den Tarquinius dazu anstachelte, Lucretias „Keuschheit“ zu prüfen, zum piano score greift, um sich in Brittens Partitur von Neuem zu orientieren.

Wir kennen das Bild schon vom letzten Bayreuther Tannhäuser: dass die Figur gleichsam aussteigt, weil Leben und Theater einfach nicht mehr vereinbar scheinen. Und schließlich verlassen alle Sänger, die im epischen Theater dieses Abends am Bühnenrand sitzen, wenn sie gerade nicht dran sind, verstört und wütend die Bühne. Was bleibt, ist die Heilsbotschaft der beiden Chor-Kommentatoren, aber auch hier sehen wir, dass es sehr viel Kraft kostet, die Zeilen über die Lippen zu bringen: der charismatische Fernsehprediger ballt energisch die Fäuste und schließt, scheinbar nach innen sehend, die Augen. Mehr Ratlosigkeit als Heilsgewissheit, wie der Dramaturg Georg Holzer schrieb. Wer aber glaubt, dass diese Deutung grundstürzend neu sei, irrt, denn schon André Obey, der die Vorlage für Duncans Libretto lieferte, lässt die Sprecherin von einer Flucht Lucretias träumen. „Eine feministische Version, in der Lucretia durch ihren gegen den Willen ihres Mannes vollzogenen Selbstmord ihren Körper und ihr Ich zurückfordert, muss erst noch geschrieben werden“ ( Germaine Greer). Voilà, hier ist sie.
Warum also spielt man dieses Stück, wenn man, gesetzt den Fall, man geht nicht aufs Ganze wie Fiona Shaw, gegen den Willen der Autoren agieren muss, um dem Stück auf einer höheren, realistischen Ebene gerecht zu werden? Weil es von einem der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts komponiert wurde, und weil es mit nur 13 Instrumentalisten und 8 Sängern eine ideale Corona-Oper ist, „aber das tut ja“, sagte Britten zur Miniaturbesetzung seines Kammerorchesters, „keinem weh“. Im Gegenteil: an den Forte-Stellen genügt es völlig, wie auch in den vielen Pianissimo-Passagen, in denen die Harfe und die Flöte brillieren darf. Unter Björn Huesteges Leitung präsentiert die Staatsphilharmonie Nürnberg die Partitur, von den Klavier-Rezitativen über die Tutti-Explosionen zur Passacaglia und den deliziösen kammermusikalischen Dissonanzen, denn auch ohrenöffnend für Brittens köstliche Extravaganzen und sein gebrochenes Pathos.

Zudem kann man auch dieses Stück – wie wohl jedes, wenn‘s was taugt – auf einer fast leeren Bühne spielen lassen, als wär‘s eine Inszenierung von Peter Brook. Ein paar Stühle und Notenständer, ein Lichtquadrat auf dem Boden, eine Videowand im Hintergrund, mehr braucht es nicht, um Brittens und Duncans Welttheater szenisch auszustatten. „Follow the Bible“, lesen wir zu Beginn, das Christenherz glüht und brennt (Lucretias Herz wurde ja auch geröstet), am Anfang wie am Ende, an dem das Opfer, das keines sein will, zur Heiligen erklärt wird: auch dies eine Sage, freilich aus dem neueren Rom. Das von Stefan Bischoff produzierte Video zeigt auch, zu Tarquinus‘ Teufelsritt durch den Tiber, ein eilendes Pferd im Bild-Negativ, dem die graphischen Verstörungen flimmernd eingezeichnet wurden. Erscheint Lucretia, schauen wir auf 12 Schmink-Münder; die Bilder erstarren im Moment des vollzogenen Schocks, der im Silhouettenbild der Vergewaltigung (zwei schwarz ausgeschnittene Körper vor der Lichtwand) szenische Realität wird. Herzog inszeniert das Werk als Parabel zwischen Bühnenrealität und entlarvtem Schein, was die Männergesellschaft, die für Lucretias Unglück verantwortlich ist, nicht bagatellisiert. Collatinus, der Mann der tief verwundeten Frau, ist nicht besser als Tarquinius, der sie schlug, und als Junius, der Intrigant im Hintergrund, der schließlich dafür sorgt, aus der Vergewaltigung durch den Etruskerherrscher politisches Kapital zu schlagen, indem er die Römer zum (bei Titus Livius schließlich erfolgreichen) Aufstand anzustacheln. Ohne den Vergewaltiger in Schutz zu nehmen, muss allerdings angemerkt werden, dass er nicht zu Lucretia geht, um sie zu Boden zu ringen. Sein Plan liegt lediglich darin, so steht‘s geschrieben, ihre „Keuschheit“ zu beweisen. Natürlich ist dies ein widersprüchliches Projekt, dem das Scheitern eingeschrieben ist, aber erst die „Wollust“ und die Fehlinterpretation ihrer „feuchten Lippen“ macht aus ihm den Berserker und nützlichen Idioten, den Junius braucht, um den Gegner zu erledigen. Sangmin Lee spielt ihn denn auch als brutalen Kerl, der nicht besser ist als seine meisten bierdosenknackenden Kumpel. Wonyong Kang ist ihm als Junius, auch vokal, und etwas lyrischer eingestellt, ein ebenbürtiger Gegner, während Nicolai Karnolsky als gehörnter Ehemann den Collatinus als politisch übervorsichtig, also plump agierenden Diplomaten gibt; sein allzu offensichtliches Abwiegeln angesichts von Lucretias Geständnis ist bewusst stupid – so wie die letzten zehn Minuten der Inszenierung eine Deutlichkeit besitzen, die möglich und verständlich, aber weniger subtil ist als Vieles, was wir vorher sahen.

Wenn aber die Frauen, Lucretia und ihre beiden Dienerinnen, mit den eigentlich auf Christi Opfertod verweisenden, aber vorher uneigentlich als Schwitztücher (man hält sich für die Kerle in Form) benutzten Tüchern den Schmutz beseitigen, den die Männer im ersten, fast symmetrisch gebauten Akt anrichteten, und wenn der Female Chorus dies kommentiert: „Die Zeit trägt die Männer, aber die Zeit schreitet voran auf den müden Füßen der Frauen“, ist des Glück des Zuschauers vollkommen. Es ist schon dann da, wenn es das Frauenterzett hört: Hanna Larissa Naujoks als Lucretia, die ihre besten, weil erregtesten Passagen nach der Vergewaltigung hat, Marta Świderska als ältere Amme Bianca und die goldtonstrahlende Julia Grüter als Lucretias junge Dienerin Lucia. Bleiben die beiden Primae inter pares: Emily Newton als Female Chorus und Tadeusz Szlenkier als Male Chorus, zwei Erzähler, die ihren Part mit Genauigkeit und Pathos erfüllen – bis zum bitteren Ende.
Riesenbeifall auch für diese Sänger und Darsteller und eine Produktion, die als Abschluss einer kleinen, großen Premieren-Trilogie das Publikum offensichtlich und zurecht begeisterte.
Frank Piontek, 14.6. 2021
Fotos: © Ludwig Olah
MÄRCHEN IM GRAND-HOTEL
Premiere: 11.6. 2021
„Abstand!“ ruft die auf Etikette bedachte Hofdame Gräfin Inez de Ramirez, wenn sich der jugendliche Held und die Primadonna endlich umarmen wollen. Tatsächlich: Auch an diesem Abend bewegt man sich auf der Bühne des Nürnberger Opernhauses sichtlich auf Abstand – aber berührend ist die Produktion doch: durch ungewöhnlich viel Witz (hier hängt nichts durch), ein bisschen Sentiment, durch Perfektion der Technik und eine schier beglückende Operettenmechanik, nicht zuletzt durch eine Musik, die neben der der drei bekannten „Hauptwerke“ des Komponisten (der Blume von Hawai, dem Ball im Savoy und der Viktoria) absolut bestehen kann.

Das Märchen im Grand-Hotel ist, wenn es derart charmant gebracht wird, das, was man im Jargon der 30er vermutlich einen „Knaller“ genannt hat. Kein Wunder, dass es nach seiner Premiere im Theater an der Wien, die 1934 schon im ersten Exil vor sich ging, zunächst erfolgreich war. Dass es erst 2018 in Mainz seine szenische deutsche Erstaufführung erlebte, nachdem die Komische Oper Berlin im Vorjahr eine konzertante Erstaufführung ermöglicht hatte, muss verwundern, doch die Paul-Abraham-Renaissance hat inzwischen auch dafür gesorgt, nach Roxy und ihr Wunderteam dem Hotel- und Filmstück, einer musikalischen Screwball-Comedy ersten Ranges, zum verdienten Erfolg zu verhelfen. Wer nun einwenden mag, dass Texte wie „Jedes kleine Mädel will glücklich sein“ nicht besser ist als ein Kitschschlager, könnte sich vom Czárdásfürstin-Regisseur Peter Konwitschny sagen lassen, dass die Sehnsucht nach einem geglückten Leben nicht denunziert werden sollte.

Natürlich geht auch der Weg des verliebten Albert Chamoix, der auf Wunsch seines Vaters in dessen Hotel als Zimmerkellner dienern soll, um das Geschäft „von der Pike auf zu lernen“, und der Infantin Isabella, die von der stolzen Zicke zur empfindsamen Frau mutiert, im Fall des Librettos von Fritz Löhner-Beda (Das Land des Lächelns) und Alfred Grünwald (Gräfin Maritza) – natürlich geht auch dieser Weg über die üblichen Mechanismen der Gattung. Erstaunlich ist, dass sie noch nach 90 Jahren funktionieren. Sie funktionieren freilich „nur“ deshalb, weil der Regisseur Otto Pichler, der sein eigener Choreograph ist, auf Tempo, Timing, Körperkomik, Eleganz und stetige Bewegung setzt.

Der wunderbare Jörn-Felix Alt bewegt sich wie ein graziöser Pan durchs Grand-Hotel, wenn er Freude und Verzweiflung der Verliebtheit ins Tanzbein leitet. Andromahi Raptis ist ihm eine ebenbürtige Partnerin: in „melodramatischer“, also komischer Kunst-Ohnmacht, in entzückend abscheulicher Aristokrateneitelkeit, die das Ende schon ahnen lässt, beim wahren Gefühl jugendlicher Liebessehnsucht (ein Höhepunkt: ein Duett in Grün, zusammen mit Ulrich Allroggen, also dem alternden und lebens- wie liebeserfahrenen Monsieur Chamoix am Klavier). Wahres Gefühl? „Träum heute Nacht von der Liebe“ – im Glitter wird die Welt wahr, das ist die Operettenwahrheit. Doch wenn sie, die erst durchs Tal der Tränen gehen muss, bevor sie zu ihm, dem wahren Operettenmenschen kommt, sich zum „Republikaner“ bekennen vermag, vor dem reizvoll gebrochenen und durchaus nicht banalen Happy End buchstäblich am Boden liegt, beginnt‘s, als wären wir im dritten Tannhäuser-Akt, plötzlich zu schneien.
Schließlich heißt das Stück nicht „Liebe im Grand-Hotel“, sondern Märchen im Grand-Hotel. Was sonst nur falscher Schein ist, ist flimmernde Leinwand; das Stück spielt auch im Film-Milieu. Die zweite, nicht nachgestellte Dame, heißt Marylou, ist Tochter des Filmmoguls Sam Makintosh und darf reizvoll intrigierend (und an- bzw. ausgezogen) die Prinzessin dazu bringen, im Film mit einer „Real Life-Story“ ihren Part zu spielen, um die Traumproduktionsfirma zu sanieren. Das ist so zynisch wie selbstkritisch; Abraham und seine Librettisten haben schon gewusst, wie viel Traum und Lüge in der Industrie steckt, von der sie auch lebten. Makintoshs „Ich brauch etwas Pikantes / Und doch nicht zu Riskantes“, ein echter, mitreißender Abraham-Schlager, wird zum Rondo-Thema des Abends (Hans Kittelmann macht das einfach typengerecht: eine brillante Schablone).

Die Nürnberger Inszenierung löst die Darstellung des Film-Milieus in eine grandiose Show auf. Schon kurz nach dem Aufziehen des Vorhangs sehen wir die sechs Tänzer des Abends in einer King-Kong-Chorus-Line über die Bühne affeln: als Pendant zum Quartett der Stubenmädchen im äußerst kleinen Schwarzen, das den 2. Akt eröffnet, nachdem die Powerfrau Marylou, also Maria-Danaé Bansen, uns nach der langen Pause schon schnell auf Touren gebracht hat. Übrigens entsprang sie an diesem Abend nicht, wie Athene, dem Kopf ihres Papas, sondern dem des Übervaters King Kong: ein guter Witz unter vielen.
Schon optisch wird also viel geboten: vom symbolischen Rosenrot der Infantin („Zwei rote Rosen“ ist das lyrische Signum des Werks) über den Zebra-Ton der agilen Filmfrau zum weißen Smoking des beglückend arroganten Prinz Andreas Stephan, der vom grandiosen Entertainer Jens Janke gespielt / gesungen / gemimt / getazt wird; die Kostüme Falk Bauers sind als Teil des Gesamtkunstwerks eine Augenweide. Wir sehen, bei Jörn-Felix Alt, einen Federfächertanz im Schwarzlicht, einen improvisierten Mikrofontausch mit hereintänzelndem Glitzerdienstmann (Szenenapplaus), und wir blicken auf Fragonards berühmtes Schaukel-Bild, ein Abbild einstiger aristokratischer Herrlichkeit und jetziger erotischer Wunschvorstellung im Riesenrahmen (die Bühne wurde von Jan Freese entworfen).

Wir ergötzen uns an der witzigen Perlenketten-Ariette der Hofdame, die mit Almerija Delic glänzend besetzt ist, ebenso an Jens Krause, der den Hoteldirektor Matard spielt und, trotz Embonpoint, sehr lustig an den ölig-aufgeregten Typ erinnert, wie er gern von Hubert von Meyerinck gespielt wurde. Wir finden schon Marylous Auftrittsnummer „Jonny“ hinreißend, Raptis‘ / Isabellas „Ein Märchen von Liebe“ durchaus nicht schmalzig und lassen uns vom Orchester unter Lutz de Veer davon überzeugen, dass Paul Abrahams Operetten schon deshalb gut sind, weil er seine haltbaren Melodien und 20er-Jahre-Rhythmen durch eine brillante Instrumentation geadelt hat: mit zwei Klavieren, Harfe und Banjo, Tuba und Gitarre, Schlagzeug und Glockenspiel.
Also: Riesenbeifall für eine märchenhaft gelungene Produktion.
Frank Piontek, 12.6. 2021
Fotos: ©Pedro Malinowski
PIMPINONE / HERZOG BLAUBARTS BURG
Premiere: 9.6. 2021
„Nun haben wir, wonach man brennt: das Happy, Happy, Happy, Happy Ende.“ So steht‘s geschrieben am Balkon des Nürnberger Opernhauses – das lieto fine, das wir am Ende des ersten Opernabends nach Schließung de Hauses erleben, ist ein doppeldeutiges. Paul Abrahams „Märchen im Grand Hotel“, dem Dramaturgie und Intendanz das Motto des Monats entnahmen (die schrecklichen präsenzopernlosen 7 Monate haben endlich ein Ende!), wird morgen seine öffentliche Nürnberger Premiere haben, am ersten Tag aber stehen zwei Stücke auf dem Programm, deren Glück in der Güte der Werke, weniger in dem der Protagonisten bestehen.

Telemanns dramaturgisch und musikalisch entzückend leichtfüßigen „Pimpinone“ mit Bartóks „Blaubart“ zu koppeln ist vermutlich nur dem ein Problem, der davon ausgeht, dass Bartók nur zusammen mit Bartók einen Sinn ergibt. Man kann seine einzige Oper also mit dem Konzert für Orchester verbinden (so geschehen in der letzten Münchner Inszenierung) oder mit den 4 Orchesterstücken op. 12 und der „Cantata profana“ (wir haben‘s 2008 in Salzburg erlebt). Man kann den Einakter jedoch auch mit scheinbar Fremdem zusammenhören; Calixto Bieito vermählte den Herzog an der Komischen Oper Berlin mit „Gianni Schicchi“. Ihn mit „Pimpinone“ zu vereinigen ist jedoch schon auf den ersten Blick sehr sinnvoll: auf die Komödie vom alten Deppen und der jungen Frau folgt die Tragödie des älteren Mannes mit der anderen jungen Frau. Doch ist „Pimpinone“ wirklich eine Komödie? Oder nicht auch eine Tragödie, weil in jeder guten Komödie – zumindest in deutschen Landen - ein Trauerspiel zu stecken pflegt? Der Regisseurin Ilaria Lanzino gelang es, aus dem heiteren Intermezzo um die kluge, ja verschlagene Magd und den reichen, dummen Mann ein Kapital zu schlagen, das vom blutigen Gold des „Blaubart“ nicht weit entfernt ist – nur, dass die Konstellation hier noch zugunsten der Frau ins Burleske umzuschlagen vermag. Vespetta, dieses schlaue „Wespchen“, summt und rollt buchstäblich ins Leben Pimpinones hinein. Der, angestachelt von der TV-Werbung, möchte sein frauenloses Leben durch eine Haushaltshilfe erleichtern, die, so die These, nur als Arbeitsmaschine, also als weiblicher und nicht widersprechender Roboter, die Interessen des Mannes zu befriedigen vermag.

So wird das barocke Maschinenwesen, ein Männertraum in Gold, ein „Weib“ mit leuchtenden Brustwarzen, ins Haus geliefert – und emanzipiert sich alsbald vom Mann, der Herr und Meister sein will, aber schon bald an den Tücken einer sich selbst entwickelnden KI scheitert. Pimpinones „realitätsferne Vorstellung von einer Beziehung“ rechnet nicht mit der Eigenständigkeit eines Wesens, das sich von der Puppe zur Autonomen entwickelt. Die „wilde Hummel“ entschnürt sich, schickt ihn dorthin zurück, wo sie einst herkam und lässt ihn verstummen. So nimmt sie Rache am jahrtausendealten Patriarchat. Das Lachen ist, auch wenn Pimpinone im Hummel-Duett zusammen mit der Widerspenstigen ein Lach-Duo anstimmt, auf ihrer Seite – doch nach dem Preis wird nicht gefragt. It‘s just a comedy – mit tiefem Sinn.

Am Ende des „Blaubart“ wird nach eben diesem Preis gefragt. Wenn Judith, nicht schnell, aber deutlich genug, den Mann verlässt, der sich als beziehungsunfähig erwies, weint auch sie die Tränen, die in der sechsten Kammer verschlossen sind. Die drei Frauen, schwer verletzte Opfer des Mannes, haben sich schon vorher befreit, indem sie einfach gingen. Die Tragödie beginnt nicht mit Béla Balász‘ Prolog, sondern mit einem Gedicht von Else Lasker-Schüler: „Du hast ein dunkles Lied mit meinem Blut geschrieben…“ Balász‘ Text hat viel mit jenem Blut zu tun, das im zweiten Teil des Abends nicht allein in der Musik fließt. Lanzino inszenierte den „Seelenmythos“ (so der Librettist über sein Werk), in dem die Burg und ihre Kammern pure Gebäude einer verschlossenen Innerlichkeit sind. Betreten Judith und der Herzog den Raum, so betreten sie – getrennt – zwei gleichgebaute Schlafzimmer: nur, dass bei Blaubart ein warmes Licht den Raum erhellt und bei Judith das kalte Licht die blutigen Flecken an den grauen Wänden offenbart. Man weiß schon, wie es ausgeht, wenn Blaubart alle persönlichen Gegenstände, die sie in die Ehe mitbringt, beseitigt. Räumlich getrennt, sind sie doch verbunden: v.a. durch die Gewalt; agiert Blaubart links, so reagiert Judith rechts, als stünde er im Raum. Folter- und Waffenkammer: es sind Schläge und ein brutaler Geschlechtsverkehr. Schatzkammer und Garten: es ist ein Schmuckstück und eine Schwangerschaft – aber das Blut klebt am Hals wie auf dem Bauch. Wird endlich die Trennwand zwischen Mann und Frau beseitigt, hören wir also die grandiose – und erschütternde – Musik von Blaubarts Land, erscheint für einen kurzen Moment die Utopie einer Öffnung. Der Rest ist eine Befreiung, die keine sein kann: Judith geht, auch dieser Preis ist hoch, der Mann bleibt in seiner Finsternis zurück: ein Opfer seiner Psyche, aber auch ein Gewalttäter an den Frauen, deren Liebe er verriet.
So findet die Regie eine gerechte Sicht auf das Blaubart-Problem, das weder im Sinne einer bloßen Anklage noch einer billigen Entschuldigung erledigt werden kann. So betrachtet, sind Pimpinone und Blaubart durchaus vergleichbare Typen in diesen beiden Ehekriegen - und die eigensinnige Vespetta und die fragende Judith Schwestern im Geist. Es ist schließlich kein Zufall, dass im alten Stück Thonet-Stühle von 1900 eingesetzt werden und im neuen Stück von 1900 Stühle im Rokoko-Stil zu sehen sind: eine schöne Idee der Kostüm- und Bühnenbildnerin Emine Güner, die zwei starke, aufs Wesentliche reduzierte Bühnenräume entwarf. Die Hauptsache aber sind die Sänger: Maria Ladurner und Hans Gröning bieten uns, schneidig begleitet vom Kammerorchester des Staatstheaters Nürnberg unter Andreas Paetzold, eine Menage á deux, die sich vokal und szenisch gewaschen hat. Sie ist lustig wie Offenbachs Olympia – und er ist ein dicker Depp, dessen Stimme weniger Fett als Kraft angesetzt hat. Je länger das Gebalge dauert, desto brillanter werden die beiden Protagonisten: auch stimmlich. Großer Beifall für eine kurzweilige Komödie – und ein längerer für den von Guido Johannes Rumdtadt dirigierten „Blaubart“ (in der Kammerfasssung des einstigen Nürnberger GMD Eberhard Kloke).

Denn Jochen Kupfer und Almerija Delic sind zusammen eine bewegende Idealbesetzung für die beiden Partien: sie, weil ihr dramatischer Sopran der Judith eine Eigenständigkeit verleiht, die noch in der Angst eine enorme Kraft enthüllt, und er, weil sein vornehmer Bariton die Verwundbarkeit dieses verwundenden (und blendenden) Mannes vollkommen zeigt. Kupfer hat mit dieser Partie sein Register – nach Onegin, Wolfram, Kurwenal, Orest, dem Beckmesser, Mandryka, Gunther, Wozzeck und Stolzius – um eine weitere bedeutende Rolle erweitert – und Delic von Neuem gezeigt, wie sehr sie ergreifende Figuren ergreifend und ganzheitlich zu gestalten vermag. Fassen wir zusammen: Vor der möglichen platten politischen Korrektheit der Interpretation des „Blaubart“-Finales rettet die Musik, so wie die Umwandlung der „an sich“ problematischen Deutung der Roboterin Vespetta in eine selbstbewusste Frau: und dies nicht zuletzt dank des exzellenten Sänger-und Schauspieler-Quartetts.
Vielleicht muss man sich also bei Corona auch dafür bedanken, dass es hervorragende Zwei-Personenstücke möglich machte, die vordem nicht einmal angedacht waren.
Frank Piontek, 10.6. 2021
Foto: ©Ludwig Olah
L'ORFEO
Premiere: 2.20. 2020
Besuchte Vorstellung: 10.10. 2020
Man könnte sagen, dass die erste Premiere der Spielzeit 2020/21 ebenso wichtig ist wie die der ersten Spielzeit, die der regieführende Intendant Jens-Daniel Herzog zu verantworten hatte. Denn Monteverdis „L'Orfeo“ ist eine genauso hinreißende und – mit gänzlich anderen Mitteln – spektakuläre Produktion wie Prokofjews „Krieg und Frieden“.
Orpheus und Euridyke und der vergebliche Versuch, den Tod zu besiegen. Mitten in der Corona-Krise fasste Herzog den Plan, sich des ersten „richtigen“ Musikdramas der Musiktheatergeschichte anzunehmen. Am 2. Oktober fand übrigens nicht nur die Premiere dieses „Orfeo“ in Nürnberg, auch die Uraufführung einer Neufassung von Shakespeares (also Edward de Veres, 17. Earl of Oxford) „Maß für Maß“ im Hamburger Thalia-Theater statt – an beiden Abenden hatten wir es mit Virus-Interpretationen dieser beiden, übrigens fast gleichzeitig geschriebenen Hauptwerke der Autoren zu tun. Hier wie dort geht es um den Tod, hier wie dort – in den jeweiligen Interpretationen der Schauspiel- und Opernhäuser – geht es um eine „schwedische Seuche“ (der Fall „Maß für Maß“) bzw. um eine plötzlich eintretende, tödliche Atemwegserkrankung: dass die Todesbotin (eindringlich gestaltet von Almerija Delic) laut Übertitel davon singt, dass man versucht habe, die Sterbende mit „Luft“ statt mit den vom Librettisten Alessandro Striggio d.J. ausgewiesenen „Gesängen“ zu heilen, ist keine Übersetzungsmanipulation, sondern eine Reaktion der Opernszene auf die aktuelle Kulturkrise: wo Gesänge nur noch bedingt möglich sind, fehlt nicht nur den Sängern die Luft zum Atmen. Immerhin aber darf das Nürnberger Ensemble vor knapp einem Drittel der möglichen Zuschauer singen.
Der glückliche Zuhörer und -schauer muss sich schon deshalb nicht beklagen, weil Jens-Daniel Herzog zusammen mit dem Bühnenbildner Mathis Neidhardt, dem Videographen Stefan Bischoff, dem Choreografen Ramses Sigl und der Dirigentin Joana Mallwitz und „ihrer“ Staatsphilharmonie Nürnberg, nicht zuletzt mit dem Lichtgestalter Kai Luczak ein Gesamtkunstwerk geschaffen haben, das vom ersten bis zum letzten Augenblick packt. Der Sound, notiert in einer Bearbeitung von Frank Löhr und Joana Mallwitz, realisiert Monteverdis sparsame Anweisungen, indem es den Ton der Zeit zwischen 1600 und der Gegenwart mit bewussten Brüchen realisiert, denen doch nichts Brüchiges anhaftet. Wo sich der Bigbandswing eines fröhlich in die Oberwelt wandernden Orfeo mit der sonoren Nostalgie der Monteverdizeit verschwistert und romantische Violinexaltationen auf den trockenen Ton des im Partiturdruck genannten Intrumentalensembles des Gonzagahofs treffen, wird der Abend zum Hörerlebnis – und wo das so einfache wie sinnfällige Streichermotiv, das nach der Toccata, dem musikalischen Wappen der Gonzaga, ertönt, am Ende, an dem alles alles aus zu sein scheint, mit den mozartnahen Trübnissen eines modernen Holzbläsersatzes erklingt, ist das Glück des Montevedi- und Opernfreundes vollkommen.

Es ist schon deshalb vollkommen, weil mit der ersten, richtungsweisenden Produktion der neuen Spielzeit eine starke Ensembleleistung gelang. Zuerst also Martin Platz als lyrisch beseelter und expressiv begabter Orfeo, der durch die Hölle der Verlassenheit und der Erinnerungen an die zerstörten und brennenden Gefilde dieser Erde läuft, in denen Orfeos Innen und das Aussen der Welt identisch zu sein scheinen. Dann Julia Grüter als zunächst lustige, dann zarte Euridyke, Andromahi Raptis als glitzerblondhaarige Allegorie der Musik (schon dieser Auftritt verzaubert zutiefst) und Echo.

Emilie Newton als expressive Speranza, die hochdramatische Almerija Delic als Messagiera und Proserpina in einem kurzen, aber wichtigen und herzhaften Auftritt, zusammen mit Nicolai Karnolsky als Plutone, der die kurze eheliche Auseinandersetzung in eine lustvolle Begegnung der unteren Zonen münden lässt: eines von vielen eindrücklichen Bildern dieses auf sensitiv und lustvoll optische Effekte setzenden Abends.

Schliesslich Wonyong Kang als Fährmann, Hans Kittelmann als Apollo (ein Riesenmund als Videoprojektion) und vor den Fährnissen und bösen Überraschungen des Lebens warnender Hirt. Dazugezählt die Damen und Herren des Opernstudios, und alle zusammen bilden das Generalensemble der Hirten und gelegentlich der Geister, die eine dunkle Unterwelt mit ihren dunklen Einwürfen begleiten. Nebenbei: wenn sie Monteverdi a capella summen, braucht es keine Instrumente mehr, um dem Musiktheater zu seinem Recht zu verhelfen.
Herzog hat also, dem Stücktext nichts abschneidend, die bekannte Geschichte als Parabel auf ein vergnügliches, im Hier und Jetzt konzentriertes Leben interpretiert, dem der Tod ein schnelles Ende zu bereiten vermag.

Hier aber wird nicht die Partystimmung der Feiernden denunziert, sondern mit den Überlebenden getrauert. Um diese Botschaft in diesen Bildern und dieser spezifischen, ergreifenden Tonschicht zu transportieren, hätte es der Corona-Krise übrigens kaum bedurft. Wenn Orfeo sein Liebesglück in die Welt singt und die Messagiera ihre Botschaft verkündet, wenn sich Pluto durch die Bitte seiner Frau zu einem Gnadenakt mit eingebauter Unmöglichkeitsbedingung erweichen lässt und Euridike in einer monumentalen Videoprojektion hinter dem noch zuversichtlichen Geliebten nach oben wandert (eines der stärksten Bilder des Abends), bevor das Gesicht der abschiednehmenden Geliebten nach und nach sich auflöst, begreifen wir auch so, dass das Leben und das, was wir für Liebe halten, kostbar ist – in jedem gelebten Augenblick: und gerade in der Oper, die alles andere als alt ist.

Am Ende reicht es immerhin zu einem Denkmal, denn Orfeo telefoniert bekanntlich mit seinem „Padre cortese“, seinem gütigen Vater Apoll, der ihm die Früchte der Tugend anpreist. Dass sich Orfeo auf dem Sockel nicht wohlfühlt, weil, wie Brecht gesagt hätte, „etwas fehlt“, versteht sich von selbst. Die Projektion der Denkmäler der Größten, unter ihnen die vergöttlichten Heroen der Musik (nur Wagner fehlt in dieser Inszenierung des Opernhauses am Nürnberger Richard-Wagner-Platz), verschwindet. Was zuletzt bleibt, ist die Traurigkeit des Zurückbleibenden – und heftiger Applaus.
Fotos: ©Ludwig Olah
Frank Piontek, 11.10. 2020
NABUCCO
Premiere: 29.5. 2010. Besuchte Vorstellung: 9.2. 2020
Die Produktion ist zehn Jahre alt – ein Ewigkeit also für Nürnberger Operninszenierungen – und wurde wieder aus der Versenkung geholt. Dabei dürfte sie schon damals ästhetisch alt gewirkt haben, als der Regisseur Immo Karaman auf die Idee kam, die Geschichte der altbabylonischen und hebräischen Helden im Stil eines Stummfilms Marke „Cabiria“ über die schwarzweiße, im konventionellen Finale farbige Bühne gehen zu lassen. Dass das Prinzip, eine klassische Idée fixe, so altbacken wirkt, liegt vermutlich weniger an der Idee selbst als an der unausgegorenen Gestik, die denn doch nicht stummfilmmäßig genug ist. Kommen hinzu die Brüche zwischen einem antikisierenden Stil, wie „man“ sich ihn vielleicht zwischen 1910 und 1925 vorstellte, und Einschlägen der Kostümmode der 20er Jahre, wie sie die machtgeile Abigaille im palmendurchwedelten Boudoir zu tragen pflegt. Kommt man mit diesen auf die Dauer einschläfernden Mitteln Verdis und Temistocle Soleras Figuren wirklich nahe, die über etwas mehr Psychologie verfügen, als es die gelegentlich statischen (!) Bewegungen suggerieren?

Reden wir lieber über die Sänger der Wiederaufnahme-Serie. Leider hat Katia Pellegrino als stark schrillende Abigaille keinen guten Abend; Lautstärke sollte schon deshalb nicht mit Ausdruck verwechselt werden, wo die höchsten Höhen stets nur detonieren, wozu die bekannte Akustik des Opernhauses ihren Teil fast unvermeidbar beiträgt. Ganz anders klingt Almerija Delics Fenena: von der leuchtenden Höhe zu den extrem tiefen Regionen. Neben ihr steht der Ismaele des Tadeusz Szlenkier, der wieder lauter singt als nötig: Oper für Taube. Es mag ja stimmen, dass Verdi mit dem „Nabucco“ sein angeblich lautestes Werk schrieb. Dass der Beginn der radikal gekürzten Ouvertüre in den Saal hinein kracht, war zu erwarten, doch gelingen dem Orchester unter der Leitung von Esteban Dominguez-Gonzalvo jene instrumentalen Kammerstückerln, die Verdi mit dem größten Sinn für Delikatesse seiner jugendfrischen Partitur beigab. Insbesondere die Violoncellisten der Staatsphilharmonie Nürnberg verdienen an diesem Abend den vollen Applaus – natürlich auch der stark erweiterte Chor unter Tarmo Vaask, der in dieser Choroper sein Bestes zu geben vermag.

Bleiben neben dem prägnanten Oberpriester des Baal, also Taras Konoshchenko, die beiden dunklen Herren, die mit ihren Bässen auf ihre Weise das schwarzweiße bis graue Bühnengeschehen zum Leuchten bringen: Nicolai Karnolsky macht den Zaccaria mit der ganzen Unnachgiebigkeit eines religiös beseelten Fanatikers, und Sangmin Lee ist ein Nabucco, der dem Filmpappkameraden durch Spiel und Ton wenigstens ein bisschen innere Bewegung zu geben vermag. Es wäre schön gewesen, hätte man diesen beiden großartigen Sängern, die bekanntlich auch spielen können, Rollen gegeben, die aus dem „Nabucco“ eine wirklich packende Oper machen. Die Musik allein reichte, glaube ich, an diesem Abend leider nicht aus, um zu beweisen, dass auch dieses Jugendwerk dramaturgisch von erster Güte ist: allen musikalischen Glanzpunkten zum Trotz. Trotzdem, natürlich, starker Beifall für ein nicht ganz zusammenstimmendes Vokal-Ensemble sowie für Chor und Orchester.
Frank Piontek, 10.2. 2020
Fotos: © Ludwig Olah
MANON
28.1.2020
„Wie kaum ein anderer Komponist im 19. und ausgehenden Jahrhundert hat Massenet für die Stimme komponiert.“ Es ist eine steile These, die Helmut Heissenbüttel, der sich als herausragender Experimentalautor auf Klang und Sprache verstand, 1985 im Münchner Programmheft zur „Manon“ veröffentlichte. Vielleicht stimmt sie ja, auch wenn vielleicht in den meisten Analysen, die der Oper gewidmet wurden, eher vom äußerst differenzierten Orchestersatz und der scheinbar kleinteiligen, in Wahrheit aber textgetreuen und psychologisch genauen Motivarbeit in Massenets Partitur die Rede ist. Dass das Glück einer Opernaufführung weniger von einer wie auch immer gearteten Inszenierung, sondern von den singenden Menschen gemacht wird, könnte glatt vergessen werden, wenn man sich manch Rezension anschaut. Doch auch im Fall der Nürnberger „Manon“ muss zunächst von den Sängern/Schauspielern geredet werden, die diesen Abend letzten Endes zu einem Triumph machen.

Manon also. Ihr Charakter changiert bei Massenet, über die Musik und die Figurenzeichnung ein- und gleichzeitig vieldeutiger als im Roman des Abbé Prevost angelegt, zwischen aufreizender Kokotte, naivem Mädchen und Opfer der Verhältnisse; das letzte Wort behält ihr musikalisch ergreifender Abschied: in Vorgriff auf Mimis Tod. Eleonore Maguerre kann das alles: vom unbeschwerten „Voyons, Manon, plus de Chimères“, mit dem sie am Anfang ihrer fatalen Emanzipation steht, über ihre berühmte Gavotte – die Kehle gurrt sinnbetörend – zum erhitzten Duett mit dem abgefallenen Liebhaber und schließlich zur letalen Erschöpfung. Die auf verzweifelte Weise lebenslustige Frau hat am Ende des drei Stunden kurzen, immer packender werdenden Abends nun wirklich keine Kreide gefressen. Beseelt war ja schon ihre Anfangsarie „Je suis encore tout étourdie“. Eine gute Manon muss gleichsam über mehrere Stimmen verfügen, um zunächst die begeistert Entflammte, dann, auf der Promenade des Cours-la-Reine, die Königin der Pariser Nacht zu spielen, indem sie sie singt; kommt hinzu der körperliche Einsatz, mit dem sie am Ende des Ball-Bildes, einer Danceshow-Queen gleich, im leuchtenden Kreis gen Himmel schwebt (aber der Himmel wird nicht nur an diesem Abend von der Decke begrenzt). Riesenbeifall also für Eleonore Maguerre, die ihrer Stimme, und scheinbar ohne Mühe, alle möglichen Töne zur Charakterisierung dieser vieldeutigen, halb gezogenen, halb ziehenden Frau entlockt. Nach ihrer Natascha in der in jedem Sinne erstklassigen „Krieg und Frieden“-Aufführung, in der Eleonore Maguerre eine bewegende Natascha sang, hatte man nichts anderes erwartet. Nicht nur ihre Haarfarbe und ihre Perücken und ihre mehr oder weniger extravaganten Kostüme (gute Arbeit: Silke Willrett) wechseln bewusst von Szene zu Szene: bis zum giftigen Grün der Todesstunde, in der sie ein T-Shirt mit dem bezeichnenden Schriftzug „Born my way“ trägt – aber vielleicht ist auch dieses Bekenntnis zu individueller Autonomie nur ein Irrtum der, pardon, letzten Endes „abgefuckten“ Frau.

Ihr Des Grieux heißt Tadeusz Szlenkier. Wieder singt er gelegentlich zu laut, und wieder muss man bemerken, dass er's gar nicht müsste. Denn wohltönend „lagrimoso“ stattet er den ehrlichen Jungen aus: im Holzfällerhemd die Szene betretend, so viel Symbolismus müsste vielleicht nicht sein, aber gut. Nach seinem Don Carlos hat er seinem Repertoire und seiner kräftigen wie sensiblen Stimme eine neue Rolle angeschneidert, die seinem sanft dahinströmenden, voluminösen hellen Tenor gut passt: vornehmlich in den verzweifelten Passagen der Partie, die den Sänger von der Straße in die kleine Kammer führt, in der Manon auf unvergessliche Weise den kleinen Tisch, Symbol ihrer kurzen Idylle, ansingt. Wer den Mann sieht, der kurz davor steht, gleich ins Kloster zu gehen, weil ihn die Geliebte verriet, ahnt schon aus vokalen Gründen, dass der Übertritt nicht geschehen wird. Wenn er sich ins mörderische Getümmel der Spielbank im Hotel Transsylvanie stürzt, um schließlich zu einem letzten traurigen Duett mit der ihre Seele förmlich aushauchenden Geliebten findet, hat der Sänger einen Abend hinter sich gebracht, der ihn vollgültig neben die Titelfigur stellt.

Wer daneben steht, steht kaum im Schatten: Levent Bakirci singt einen optimal austarierten, baritonal charakteristischen Lescaut, bei dem freilich auch die (spezifische) Szene die vokale Figur macht, aber dazu später. Hinreißend bassdunkel und prägnant: Taras Konoshchenko als Vater Des Grieux. Hans Kittelmann singt und spielt den Guillot de Morfontaine, der das Paar schließlich ins Verderben schickt, mit körnigem Organ, also geradezu rollendeckend, und Richard Morrison ist in der relativ kleinen, aber wichtigen Rolle des Brétigny, der sich Manon einfach kauft, ideal besetzt, weil er auch schön, also gut fokussiert und deutlich zu singen vermag: bei aller Gemeinheit dieses Charakters. Nicht zu vergessen: das teuflisch schöne Terzett der drei Rheinnixen, pardon: der drei Grisetten Poussette, Javotte und Rosette, also Julia Grüter, Nayun Lea Kim und Paula Meisinger; dass Julia Grüter am deutlichsten hervorsticht, ohne das Trio vokal zu überblenden, ist für jene Zuschauer, die die Sängerin in einigen Hauptrollen bewundern konnten, natürlich wunderbar. Bleibt, neben dem erstklassigen Chor unter Tarmo Vaask, der (ceterum censeo: das ist ein grundsätzliches Problem der Akustik des Hauses) zu laut, aber klangschön und rhythmisch genau aufspielenden Staatsphilharmonie Nürnberg unter Guido Johannes Rumstadt und dem betont „sexy“ agierenden Ballett von Federgirls eine nicht immer stumme, von Massenet und seinen Librettisten Henri Meilhac und P.E.F. Gille nicht vorgesehene Figur, die den Abend, gleichsam als Faktotum des Teufels, vom ersten bis zum letzten Bild böse begleitet: Johannes Lang spielt diesen Diener / Pförtner und schleimig-räuberischen Mesner (des Klosters) / Croupier und Sergeant mit schön gezügelter Inbrunst.

Faktotum des Teufels? Der Teufel ist, wie schon bei Prévost, das Kapital, das wie ein Höllensaft in die Herzen und Hirne der Protagonisten dieser Oper hineinfährt. Eben deshalb scheinen die Damen im Etablissement in Amiens neckische Teufelshörnchenreifen zu tragen: gleichsam als gefallene Bunnys. Die Regisseurin Tatjana Gürbaca macht vom ersten Ton an klar, dass es in der Welt des „schönen Scheins“ und der „Koketterie“, in der die Frauen von der finanziellen Gunst der Männer abhängig sind, nichts zu beschönigen gibt. Sex, Drogen und Gewalt im Rotlicht-Milieu: so beginnt es, und im Knast, in dem die Kerle sich noch an der Sterbenden buchstäblich reiben, endet die Geschichte. Gürbaca inszeniert also in einer Eindeutigkeit, die die Oper über weite Teile brutalisiert, während die Arbeit des Komponisten und seiner Librettisten wesentlich diskreter vorgeht, wenn es die Gewalt der von den Menschen gemachten Verhältnisse beschreibt. Sie bietet, hinter einem von Marc Weeger entworfenen, zugleich abstrakten und bedeutenden dreifachen Lichtkranz, die Geschichte des 18. Jahrhunderts, die zugleich als Histoire aus der Epoche Maupassants und Prousts, aber nicht umstandslos als unsere Geschichte gelesen werden kann, „im Lichte unserer Erfahrung“ (wie es bei Thomas Mann heißen würde). Mit dieser unoriginellen und ästhetisch nicht mehr aufregenden und zum Nachdenken anregenden, wenn auch gerade noch möglichen Umdeutung aber beginnt die Inszenierung nur einseitig: mit einem Cousin Lescaut, der die anvertraute Verwandte nicht ins Kloster, sondern als Prostituierte über eine von Wachsoldaten bewachte Grenze (Mexiko??) schickt, bevor er sich selbst ins SM-Gewand schmeißt, wenn er beim Pärchen aufkreuzt. Natürlich wird Des Grieux zusammengeschlagen, man hat es erwartet.
Das alles wäre (immerhin) fragwürdig, wären da nicht auch die intimen Momente. Gürbaca gönnt ihren traurigen Helden jene lyrischen Ruhepunkte, die erst den Kontrast – und den Rang – dieser Oper ausmachen. „Lasst uns dem Ruf der Liebe folgen“: Wenn Manon nach einem Freezing im Ballbild diese Aufforderung den käuflichen und gekauften Damen ins Gesicht sagt, begreift man es nur, weil man vorher gesehen und gehört hat, wie das Gegenteil aussehen könnte: befreit von den Interessen, die das Kapital zu provozieren vermag. Nebenbei: in der sexuell glamourösen Szene klingt eine Musik an, die auffallend an einen Csárdas von Johann Strauss erinnert. Mit dem unglaublich glitzernden Unterkostüm wird Manon dann in der nächsten Szene ihren Geliebten zurückholen, doch nur, damit er sich im Spielsalon ins Russische Roulette wirft.

Man könnte also mutmaßen, dass die Inszenierung zwar meist am Text bleibt, indem es das Kapital als Motor des Bösen mit heutigen Bildern zeichnet, aber denn doch nur mit den üblichen Vereindeutigungen und Brutalisierungen aufwartet. Dem ist jedoch nicht so. Nach der Pause nämlich, die vor der Klosterszene platziert wurde, nimmt der Zug der Verdammten noch einmal richtig Fahrt auf. Vom St. Sulpice-Bild bis zum Finale wölbt sich ein musikalisch-dramaturgischer Bogen, in den die inszenierten Brutalitäten ihren guten Platz haben; das Hotel Transsylvanie-Bild gerät zum äußeren Höhepunkt. Pech also für alle, die es vorzogen, in der Pause das Opernhaus zu verlassen: Sie haben einen sehr spannenden, mätzchenlosen und bewegenden zweiten Teil verpasst, der einige Überakzentuierungen und Umdeutungen des ersten Teils vergessen ließ.
Starker Beifall also für einen Abend, in dem Massenets, Meilhacs und Gilles Meisterwerk denn doch zu seinem Recht kam. Empfehlung: Hingehen – denn häufig wird „Manon“ bekanntlich nicht gespielt.
Frank Piontek, 29.1. 2020
Fotos: © Ludwig Olah
STRAWINSKY
Premiere: 21.12. 2019. Besuchte Vorstellung: 11.1. 2020
Es ist paradox: immer wieder darauf hinzuweisen, dass sich Goyo Monteros Arbeiten immer wieder unterscheiden, obwohl die Handschrift des Choreographen deutlich sichtbar ist. Liegt es daran, dass er zwar einige Grundthemen bearbeitet, aber über ein unerschöpfliches szenisches Repertoire zu verfügen scheint? Denn die Arbeiten des Nürnberger Choreographen sind szenische, nicht allein tänzerische Ereignisse. Im unmittelbaren Vergleich zur Arbeit, die den zweiteiligen Strawinsky-Abend eröffnet, wird der Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Choreographen offensichtlich: setzt Douglas Lee in seiner Interpretation des „Petruschka“ - bei allen Abstraktionen im fast leeren Raum - auf die Wiedererkennbarkeit der Vierergeschichte zwischen dem Magier, Petruschka, der von ihm vergeblich verehrten Ballerina und dem Mohren, so geht Montero bei seiner Version des „Sacre du printemps“ in den Kern der Handlung hinein, um der bekanntlich extrem impulsiven und energetischen Musik gerecht zu werden: „Alle Impulse“, sagt er, „kommen vom Körper. Es gibt keine darübergelegte Ästhetik. Es gibt schon choreographische Linien und Definitionen, aber es funktioniert eher wie Energiewellen.“

Und also inszeniert er, zusammen mit Eva Adler (Bühne) und Karl Wiedemann (Licht), von Neuem eine Geschichte, in der es um das „Opfer“ und das Individuum geht, das sich gegen die „Gruppe“ zur Wehr zu setzen hat – ohne dass die Mitglieder der Compagnie zu austauschbaren Teilchen einer amorphen Masse werden würden; dies verhindert schon die Individualität jeder Bewegung. Kein Wunder, dass manchen Zuschauern der relativ brave „Petruschka“ besser gefiel und etliche Besucher diesmal dem grandiosen, sich auch grandios verausgabenden Ensemble den Applaus verweigerten: weil diese Arbeit Strawinskys Musik und der ursprünglichen Handlung außerordentlich nahe ist. Es ist amüsant, zu sehen, dass ein Stück, das vor 107 Jahren einen ungeheuren Skandal machte, auch heute noch auf Ablehnung zu stoßen vermag, wenn es in der choreographischen Annäherung an die Gegenwart schlicht und einfach Ernst genommen wird. Wo es aber ans Eingemachte geht und die Mitglieder der Compagnie in zwei aggressiven und verzweifelten Durchgängen durch jeweils ein Gruppenmitglied den Versuch unternehmen, durch ihren Tanz einen gigantischen Lichtring (ein neues System mit 40 „moving lights“, die einzelne Figuren verfolgen können) in Richtung Bühnenboden zu bringen, auf dass die Gruppe schließlich in irgendeine Zukunft springen kann, die vielleicht weniger verzweifelt ist als die gegenwärtige: wo die Gruppe also buchstäblich um ihr (Über)-Leben kämpft und Strawinskys Musik so klingt, als habe der Maestro sie für die Nürnberger Compagnie komponiert, muss man schon ziemlich abgebrüht sein, um die Gegenwärtigkeit des „Sacre“ zu ignorieren.

Großartig also, wie zunächst Daniel Roces als „Auserwählter“ vergeblich agiert, um schließlich von der frustrierten Truppe ermordet zu werden. Bewegend, wie Kate Gee als „Auserwählte“ den leblosen Körper des Mannes umschlingt, und spannend, wie sie endlich die Mitglieder dieser Not-Gemeinschaft zu Paaren treibt, weil sie begriffen hat, dass „es“ nur zusammen geht. Nein, Monteros Choreographie – kraftvoll wie immer – ist nicht „schön“. Sie ist „nur“ packend, relevant und bar allen Ästhetizismus: so wie Strawinskys denkbar unterschiedliche Partituren, die von der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Björn Huestaege zum Vergnügen der Zuschauer gebracht werden. Der Komponist meinte übrigens einmal, dass seine Partituren nicht interpretiert, sondern nur so gespielt werden müssten, wie er sie notiert habe. Mag sein, dass das geht (es geht nicht), aber ein Ballett, das 1913 uraufgeführt wurde, muss neugedeutet werden. Es sei denn, man schaut sich, was immer faszinierend ist, die Rekonstruktionen der Ballettproduktionen der „Ballet russes“ an, die die seinerzeit vielbeachteten und umstrittenen Ballette kreierten.

Nicht, dass sich Douglas Lees „Petruschka“ in der Nacherzählung eines historischen Ballettes erschöpfen würde. Im Gegenteil: die Tänzer haben, bis auf einige zarte Andeutungen des Kostüms wenig Konkretes an sich. Petruschka trägt Kragen, und es gibt sogar den Bären, wenn auch mit um 180 Graf verdrehtem Kopf. Der Zylinderhut des Magiers erinnert sympathischerweise daran, dass Strawinsky mit der Uraufführungschoreographie Michel Fokines unzufrieden war, denn er stellte sich den Magier als einen Mann im Frack des 19. Jahrhunderts, nicht als Metropoliten vor – im Programmheft der Produktion wird mehrmals an E.T.A. Hoffmann und dessen Idee des „Automaten“ und einer „dunklen Macht“ erinnert, die „einen Faden in unser Inneres legt, woran sie uns dann festpackt und fortzieht auf einem gefahrvollen verderblichen Wege“.

Lees Protagonisten – Nicolás Alcázar als Petruschka, Yeonjae Jeong als Ballerina, Lucas Axel als Mohr und Edward Nunes als Magier – scheinen, mehr oder weniger (denn der Mohr ist mehr Spielmacher als Petruschka), die Körper und Köpfe der Mitspieler zu packen und zu ziehen, während sich das Ensemble im fast leeren Raum an zwei langen, mit Lichträndern versehenen Schiebetischen und vor einem rückseitigen schwarzen Theatervorhang in eleganten Gruppenbildern ergibt, bevor wir in den letzten Sekunden die Tänzer, wie abgelegt, an der Rückwand ruhen sehen. Ist es ein Zufall, dass Lee 2014 am Nürnberger Haus ein Ballett mit dem Titel „Doll Songs“ choreographierte?

Der Unterschied zu Monteros Arbeit, der aufgrund der Abfolge der beiden Stücke unausweichlich festgestellt werden muss, liegt nicht nur in der Grundfarbe begründet: hier blutiges Rot, dort Lila. Der Hauptunterschied besteht in der Haltung des Choreographen zu seinen Figuren, was weniger mit tänzerischer Qualität als mit dem Grad der Versenkung in eben diese Figuren zu tun hat. Ist der Zuschauer bei „Petruschka“ in der Lage, einem hochästhetischen Schauspiel mit Tänzern, die ihre Rollen von außen spielen, distanziert und wenig bewegt zuzuschauen, so sieht er bei Montero vom ersten Moment an eine Geschichte, deren Gewalt und Dringlichkeit er sich gerade dann nicht zu verschließen vermag, wenn er es vorzieht, diese „Sacre“-Interpretation einfach furchtbar zu finden; die Abwehr ist hier sozusagen das Anzeichen für einen inneren Widerstand, der weniger mit Kunst als mit Weltanschauung zu tun hat. Was jedoch, nebenbei, schon der rein körperlichen Leistung der hochtrainierten tanzenden Künstler absolut nicht gerecht wird. Ansonsten: der übliche verdiente große Beifall für Monteros Compagnie.
Frank Piontek, 12.1. 2020
Fotos: © Jesús Vallinas
LA BOHÈME
Premiere: 21.11. 2015. Besuchte Vorstellung: 30.12. 2019
„Ilker Arcayürek ist ein Rodolfo, der immer dann am besten ist, wenn er seine lyrischen Bekenntnisse in der Mittellage formulieren darf; das gelind Heldische einer strahlenden Höhe geht ihm leider ab.“ Vielleicht war ich damals, als die Premiere der Inszenierung von Alexandra Szémeredy und Magdolna Parditka über die Bühne des Nürnberger Staatstheaters ging, ein wenig ungerecht. Heute würde ich das „leider“ streichen – denn Ilker Arcayürek, der noch nach vier Jahren den Rodolfo singt und damit neben dem nach wie vor sehr schön artikulierenden Colline des Nicolai Karnolsky als einziger im Solistenensemble übrig geblieben ist, singt glücklicherweise so, wie er singt: empfindsam, mit einem Timbre, das man als „südamerikanisch“ bezeichnen könnte. Sein Rodolfo ist ein noch nicht ganz im Leben stehender, um sich kreisender, aber gutartiger Kerl, dem die Liebe zu Mimi – oder das, was er dafür hält – und ihr Tod spürbar nahe gehen, wofür es, wie gesagt, keiner „heldischen“, also brüllenden Höhe bedarf. Schon als Idomeneo und Odysseus hat dieser spielerisch, optisch und vokal sympathische Sänger ja gezeigt, wie differenzierte Charaktere auf der Opernbühne aussehen können.

Und Mimi? Sie ist bei Emily Newton gut aufgehoben: eine Frau, halb dem Typus der „femme fragile“ zugehörend, halb selbstbestimmt ihre Geschichte bis zuletzt meisternd. Ihre größten, anrührendsten Momente hat sie mit ihrem empfindungsreich gestaltenden Sopran im dritten Akt, also dem Abschiedsbild in dieser gelungenen, weil widerspruchsfrei in die frühe Pariser Nachkriegszeit transponierten Inszenierung. Sind diese emotionalen Höhepunkte natürlich? Die Frage stellt sich im Blick auf die Charaktere: Wachsen ihre Stimmen auch im Verlauf der Handlung, in der die vier „Helden“ eine wichtige Lebenslektion zu lernen haben? Zumindest braucht es eine Weile, bis Sangmin Lee seinen Marcello in sicheres vokales Gelände gebracht hat, nachdem er zunächst noch sein Stimmorgan in die Höhe presste. Dann aber spielt und singt er einen ergreifend ernsten, fast strengen Marcello: bisweilen fern von den neckischen Klischees des Mannes im Dauerkampf mit jener Frau, mit der er nicht zusammen leben kann, ohne die er jedoch auch nicht frustrationsfrei zu leben vermag.

Dieses Teufelsweib, das doch nur „frei“ sein will, wird an diesem Abend von Andromahi Raptis gebracht, die nicht nur in der Alcindoroschen Hundedressur entzückt. Großartig, wie sie zum einen die girrende Schlange gibt, die gern mit den schwarzen Army-Soldaten flirtet, zum anderen die „gute“ Freundin, der das Sterben Mimis so an die Nieren geht, dass ihr Mitleid tätig wird. Ebenbürtig: der Schaunard des Daeho Kim, der noch im Nürnberger Opernstudio steht, aber schon jetzt zeigt, was sein warmtönender Bass alles noch zu singen kann.

Der zweite Blick auf eine Inszenierung aber macht nicht nur mit neuen Sängern bekannt, die die Rollen mit neuem und anderem Leben erfüllen. War damals schon aufgefallen, dass der Spielzeughändler Parpignol nicht nur im abendlichen Treiben vor dem Café Momus, sondern auch im dritten Bild, das in dieser Inszenierung am selben Ort spielt, seine kleine, aber wichtige Rolle spielt? Präsentierte er am Heiligen Abend eine Mädchenpuppe, die an die „kleine“ Mimi erinnerte, so trat er auch, passend zu den parallelen Quinten am Beginn des dritten Akts, in der nächtlichen Szene auf, wo ihn Puccini und seine beiden Librettisten nicht verortet hatten. Macht das Sinn? Ja – denn der Akkord, mit dem er im zweiten Bild auftritt, ist jener, der zunächst über der Barrière d'enfer lastet. Eduard Hanslick, der sich auch im Fall Puccini schwer irrte, fand noch, dass diese parallelen Quinten von „aufdringlicher Hässlichkeit“ seien und keinen Sinn machten. Inszenierungen wie diese aber zeigen, dass eine „schöne Oper“, die das Weihnachtspublikum so begeistert, dass es in den leise verklingenden Schluss des ersten Bildes skrupellos hineinklatscht, durchaus „hässlich“ sein kann. Sie übersetzt Puccinis, Illicas und Giacosas Realismus in Bilder, die bis zum gewaltsamen Happening gehen. Kein Zweifel: Puccini und seine Librettisten hätten es abscheulich gefunden. Kein Grund für uns, nicht über die Charakterzüge der Bohemiens und ihrer Freundinnen nachzudenken – wozu nicht zum wenigsten der empfindsame Ton von Ilker Arcayüreks Stimme beiträgt.
Frank Piontek, 31.12. 2019
Fotos: © Pedro Malinowski (die Fotos zeigen nicht den erwähnten Sänger des Rodolfo, sondern Arthur Espiritu).
DIE ITALIENERIN IN ALGIER
Premiere: 21.1. 2017.
Besuchte Vorstellung: 24.11. 2019
Seltsam: Da werden hintereinander zwei Opern gespielt, die beide – freilich im Abstand von 150 Jahren – in Venedig uraufgeführt werden, und in denen es beide Male um die seltsamen Beziehungen eines alten Mannes zu einer jungen Frau geht, die er begehrt. Nur, dass in Rossinis Meisterwerk, im Gegensatz zu Cavallis „La Calisto“, die Geschichte zwischen den Geschlechtern ein wenig anders endet, weil es die Italienerin, die es nach Algier verschlagen hat, mit dem geilen Sack aufnehmen kann, obwohl er ihr hierarchisch übergeordnet ist. Ein Mustafà ist eben, so betrachtet, mehr als eine Frau – aber eine kluge Italienerin ist einem Mann, so die theaterwirksame Botschaft, immer überlegen; mögen die anderen die Sexarbeit machen.

„Die Italienerin in Algier“ hat im Januar 2017 ihre Nürnberger Premiere erlebt, die der Autor dieser Zeilen als „tollen Abend“ bezeichnet hat. Der Abend ist immer noch toll, weil Laura Scozzi ihn damals in Szene gesetzt hat. Nun aber stehen einige andere Sänger auf die Bühne, die den Blick auf die Figuen ein wenig verändern, denn ist ist durchaus ein nicht allein vokaler Unterschied, ob Marcell Bakonyi oder Taras Konoschenko den Mustafà singt. Damals war der geile Hahn mit seiner Jugendlichkeit und seiner Körpergröße von 1,90 und seinem Bariton eher ein moderner Casanova, während Konoshchenkos algerischer Tyrann eher dem Typus des altbackenen Diktators entspricht, der freilich durch sein Volumen auch ein gehöriges Gran Tapsigkeit in die Rolle bringt. Volumen: der Begriff darf auch auf die Stimme bezogen werden, dessen Bass wirklich ein Bass, kein tiefgelegter Bariton ist. Also Bravo für diese Rolleninterpretation, die nur in einer Szene, rein stimmlich betrachtet, etwas leidet. Es ist eben ein wenig schwierig, einen in ein Bett fixierten Bass zu hören, der gerade damit beschäftigt ist, mehrere luftig bekleidete Damen von sich abzuwehren, die seine einstigen GV-Bewegungen, über und vor allem vor ihm sitzend, provokant imitieren.

Isabella war damals Ida Aldrian, nun sehen wir Almerija Delic bei der Arbeit. Diese Italienerin ist eine pure Powerfrau, die keine Sekunde daran zweifeln lässt, dass ihr die Kerle haushoch unterlegen sind und dass sie sich den greift, den sie haben will. Das Wunderbare aber liegt nicht nur in der Vitalität dieser Darstellung. Es liegt auch in der Stimme, denn Almerija Delics Isabella lacht und wütet so vokal, dass es eine Freude ist. Sie spielt gleichsam mit allen Sinnen, indem sie mit feinsten Mitteln ein körperliches und akustisches, dabei doch nicht derbes Vollweib auf die Bühne bringt. Voilà: eine ideale Interpretation – und ein kleines Wunder, dass sie nach der vorabendlichen Diana in Cavallis „Callisto“, gewiss keiner Nebenrolle, zu einer derart energischen wie witzigen Gestaltung fand.
Martin Platz ist auch an diesem Abend dabei; wieder ist er der Lindoro, und er ist wieder – es mag an seiner vorabendlichen Linfea liegen – in den höchsten Höhen seines empfindsam-eleganten lyrischen Tenors nicht ganz so rein, wie man es sich wünschen würde, aber man soll nicht beckmessern: er spielt und singt die dankbare Partie zum größten Vergnügen des Publikums. Den Taddeo singt diesmal Michael Fischer: im besten Sinn verlässlich, wie man so sagt, und war damals Inka Yoshikawa die Elvira, so darf nun Nayun Lea Kim, ein Mitglied des Opernstudios Nürnberg, die kleine Partie singen, die doch über einen unüberhörbaren – und unüberhörbar herrlichen – Spitzenton verfügt. Innerhalb des ersten Finales, in dem sich die Raserei in der berühmten Rossinischen Walze austobt und in der die Sänger nur eine Pflicht haben: auf den Dirigenten zu achten (weshalb sie die Regisseurin auch klugerweise statisch stehen lässt), innerhalb dieses wahnsinnigen Schlusses darf Nayun Lea Kim ihre Stimme über dem Ensemble schwingen lassen – und auch das macht sie gut.

Keine Aufführungskritik der „Italienerin“ aber wäre vollständig, würde man nicht den Chor erwähnen, der in diesem Prachtstück von musikalischer Komödie von der ersten bis zur letzten Szene auf der Bühne steht. Der Nürnberger Opernchor ist wieder exzellent, und dies nicht nur, weil er auf der Szene gelegentlich von der Frau oder dem Mann „dirigiert“ wird, die sich als höchst seltsames Paar den ganzen Abend über lustvoll, blutig und sehr sehr komisch bekriegen und während des statischen Ensembles des ersten Finales für jene Bewegung sorgen, die ansonsten fehlen würde; die Regie hat das schon sehr klug angelegt. Pawel Duduś darf nun, zum allergrößten Vergnügen des Publikums, zusammen und gegen Tyshea Lashaune Suggs antreten, wobei ich davon ausgehe, dass nicht nur die Männer mit angeregterem Interesse auf die Nackttänzerin Tanja Brunner geschaut haben: mit gutem Gewissen angesichts dieser paradoxerweise höchst lust- und kunstvollen Ausstellung des sex- und geldbetonten Verhältnisses zwischen Mann und Frau.
Ein Fortschritt (?): Calistos Jupiter hätte für diese Nacktshow vermutlich keine Drachme lockergemacht.
Frank Piontek, 25.11. 2019
Fotos: ©Ludwig Olah
LA CALISTO
Premiere: 23.11. 2019
„Wahrlich hat Francesco Cavalli nicht seinesgleichen in Italien“. Dies war auch die Meinung Zuanne Zittios, die er in seinem Buch Le cose notabili, et maravigliose della città di Venezia im Jahre 1662 notierte, um sie der Nachwelt zur Prüfung zu überlassen. Zwar fügte er noch an, dass Cavalli „weder in seinem ausgezeichneten Gesang noch in seinem edlen Orgelspiel“ übertroffen werden könne, aber der Satz hat seine Gültigkeit bewahrt, sofern er nicht nur die vergänglichen Talente, sondern auch die unvergänglichen Werke des italienischen Meisters betraf. Tatsächlich hat sich von keinem der großen Opernkomponisten des frühen 17. Jahrhunderts soviel erhalten wie von Cavalli. Ein Glücksfall, denn von Monteverdi, dem man im Wettbewerb um den „bedeutendsten“ Opernkomponisten der Epoche die Krone reichen würde, sind zwar viele Opern bezeugt, doch nur drei vollständig überliefert. Anders sieht es im Falle Cavallis aus: nicht weniger als 27 (oder 28) der rund 40 bezeugten Opern haben sich in Partituren erhalten, weil der Meister selbst für deren Überlieferung sorgte. Eine der wenigen Opern, die bereits in der Frühzeit der praktischen Beschäftigung mit der sogenannten „Alten Musik“ gespielt wurden, war La Calisto – es wurde Zeit, dass, nach der glanzvollen Aufführung von Monteverdis Ulisse am Ende der letzten Spielzeit, nun auch ein Werk des bedeutendsten Schülers des Meisters der frühen Oper in Nürnberg auf die Bühne kam.

Liebestod und Liebeswahn, Liebesleid und Liebesglück: dies ist das Thema der venezianischen Oper. In La Calisto wird es in diversen Varianten auf besonders infame Weise dargestellt: das jungfräuliche Mädchen aus dem Gefolge der Diana wird von Jupiter verführt, der sich in die Gestalt der Diana verwandelt, um auf diesem Weg die lesbische Calisto zu überwältigen. Die Getäuschte wird gemeinerweise von Juno in eine Bärin verwandelt und – das soll ein Trost sein – bekommt am Ende von Jupiter die Verheißung geschenkt, dass sie nach ihrem irdischen Tod als Sternbild, also buchstäblich als „Star“, in den Himmel aufsteigen wird. Paar Nr. 2: Der junge Endimion, der seinerseits in Diana verliebt ist, wird am Ende in den ewigen Schlaf versetzt, wo sich die Göttin ihres Geliebten, dem sie sich aufgrund ihres Keuschheitsgelübdes nur heimlich nahen darf, bedienen kann, nachdem er fast, aus Hass und Eifersucht, von den wilden Waldwesen Pan, Silvanus und dem kleinen Satyr getötet wurde, die ihrerseits mit ihren Trieben kämpfen. Schließlich haben wir es mit Linfea, einem weiteren Mädchen aus dem Gefolge der Jagdgöttin, zu tun: sie, offensichtlich eine „alte Jungfer“, will endlich einen Mann, nachdem sie eingesehen hat, dass ein Leben in Keuschheit nicht ihr Ding ist, bekommt ihn aber nicht.

Wie man sieht: wir befinden uns mitten in einer Tragikomödie, zugleich, so der Regisseur Jens-Daniel Herzog, in einer „fiesen Geschichte“, in der die Macht (des höchsten Gottes) über den Idealismus (des naiven Mädchens) und die normative Kraft des Faktischen (Endimions ewiger Schlaf) über das siegt, was wir als „normale“ Liebesbeziehung definieren würden. Die Nürnberger Inszenierung unterschlägt nun nicht die traurigen Aspekte dieses „Dramma per musica“, das zurecht immer wieder gespielt wird. Sie bindet sie jedoch in eine insgesamt komische Dramaturgie ein, in der sich etwa der Gott – kongenial verkörpert von Jochen Kupfer – in Dianas Kostüm wirft, um sich unter der Dusche quasi nackig zu machen und die junge Frau in falscher Gestalt zu vögeln. Wir schauen also auf eine Burleske, die, man muss das bewundernd anerkennen, so gut wie nie dem Text widerspricht. Die Übertragung in die Gegenwart ist einfach, aber stimmig – einfach deshalb, weil die Idee zunächst einmal simpel ist, dass es sich bei der trockenen Öde, die der Krieg auf der Welt hinterlassen hat, und die der oberste Gott beseitigen soll (stattdessen verfolgt er lieber junge Nymphen), um die Folgen des Klimawandels handelt. Falsch ist sie schon deshalb nicht, weil eben jener „höchste aller Götter“ sich gerade nicht für die Ökologie, sondern für sein Sexleben interessiert. Insofern haben wir es bei dieser „Calisto“ mit einer Fortsetzung jenes politisch-satirischen Kabaretts zu tun, das schon im Venedig des mittleren 17. Jahrhunderts so populär war; an den Zuständen, die Obrigkeit betreffend, scheint sich nicht viel geändert zu haben. Und wenn die junge Calisto als Musterschülerin eines von Mathis Neidhardt entworfenen Mädcheninternats in die Handlung eingeführt wird, die die Leiterin eben dieses Instituts mehr als gewöhnlich verehrt und neben ihre physikalischen und mathematischen Formeln zur Erläuterung der Klimakatastrophe die Anweisung „Si deve agire! Subito!!“ schreibt, gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass diese Sympathisantin der Greta Thunberg von den politischen Gewalten nur enttäuscht werden kann. Wichtiger aber ist das, was und wie Julia Grüther singt: denn phänomenal ergreifend und stimmschön sind nicht nur ihre beiden Lamenti über den schrecklichen Betrug, den sie erleiden musste. Wie anders agieren da die anderen jungen Frauen in Dianas Schule: doch eher als Fightergirls.

Der Rest ist eine raue Komik, auch die der wilden Kerle auf ihren heißen Maschinen, die nichts daran finden, einen Nebenbuhler mit Elektroschocks zu foltern, der Rest ist aber auch: weitere Ergriffenheit. Wenn der Endimione des David DQ Lee unter einem falschen Mond, der von den acht weißgewandeten Schülerinnen des Internats über den Orchestergraben, bis in die erste Parkettreihe also gehalten wird, seine tiefen Gefühle für Diana lyrisch ausströmen lässt, dürfen wir einem hervorragenden Altus bei der Arbeit zuhören. Weniger lyrisch als deutlich sind die Übertitel, die notwendigerweise den umfangreichen Text von Cavallis Dauerlibrettisten Giovanni Faustini verkürzen, freilich auch vergröbern. Wenn der „größte Gott“, der moralisch bekanntlich klein ist, als „Sau-Bär“ tituliert wird, mag man den Wortwitz noch in Bezug auf das in einen Bären verwandelte Opfer seiner Triebe goutieren. Anderes ist wesentlich derber, als es eine Übersetzung im Geist des Originals legitimieren würde, das sprachlich deutlich genug war, doch egal. Die Dramaturgie dieser Aufführung bleibt, es ist die Hauptsache, nah dran an den Informationen von Text und Musik: bis zum hier buchstäblich interpretierten „Brechen“ der Calisto durch Junos böse Furien und Jupiters ebenso bösem Versprechen auf ewigen Ruhm in den Weiten des Sternenhimmels - als Preis für eine furchtbare irdische Not. Am Ende landet Calisto in einem Rollstuhl, dort, wo sie einmal ihre Formeln und Parolen an die Tafel schrieb, sitzt sie nun im mächtig glitzernden Sternenhimmel, bevor sie plötzlich aufsteht, um im Nichts eines leeren weißen Raums nur noch ihre wenn auch stehende Silhouette zu zeigen. Und Cavallis Musik entbindet noch einmal all ihren Glanz über all dem Elend der Bezwingung einer einst idealistischen Seele, die mit ihrem Schicksal zufrieden, ja glücklich zu sein scheint: „Le stelle / più belle / svallinino, / e brillino.“ Wie gesagt: eine fiese Geschichte.

Die Musik, das Orchester: wieder steht Wolfgang Katschner am Pult, der die in den Quellendokumenten aufgelistete, ursprüngliche Kleinbesetzung der Uraufführungsfassung im Teatro Sant' Apollinare um zehn Musiker erweitert, somit auf 16 aufgestockt hat, sodass neben der Generalbassgruppe (Spinett, Cembalo, Theorbe) und den Obligatoinstrumenten der Violone und der beiden Violinen drei Posaunen für die Götterszenen, weitere Bläser, eine Barockharfe, Schlagzeug, eine Orgel und ein Regal, auch Chitarrone und Barockgitarre hinzutreten. Das ergibt einen satten, an wenigen Stellen sogar modernistischen Sound, der doch, so schön er sich auch ins Ohr schmeichelt, in dieser Deluxebesetzung nicht nötig wäre. Der Beweis: als Wolfgang Gayler vor über 20 Jahren im selben Haus die Poppea dirigierte, genügten akustisch gerade einmal sechs Musiker, um ohne jegliche Verstärkung einen dynamisch und farblich ausreichenden Sound zu kreieren, der bis in die oberen Ränge drang. Der Hinweis auf die Größe des Hauses, die eine erweiterte Orchesterbesetzung nötig machen würde, ist schon angesichts der bekannten, extrem offenen Akustik des Hauses irrig – das Vergnügen aber am Orchesterklang, auch an den von Katschner in die „Calisto“ integrierten 13 Zusatzstücke wird dadurch nicht berührt. Auch nicht durch die Tatsache, dass man etwa 45 Minuten Cavalli aus dem Stück herausschnitt; es verträgt die Kürzungen, auch die Umstellungen im letzten Akt, in dem das Liebesduett von Diana und Endimion die Aufnahmevorbereitungen Calistos in den Himmel zweiteilt. Diana ist Almerija Delic, die neben dem lyrischen Opfer Calisto die Kraft der dominanten Lehrerin, die doch auch ein Opfer ihrer Gefühle ist, sehr vital ausspielt und -singt. Dritte/r im Bund: Martin Platz als Linfea, das Prachtbild einer komischen Jungfer bietend, koloratur- und höhensicher wie Jochen Kupfer, der als Bassbariton plötzlich viele Noten nach oben klettern muss (und dabei immer noch schön singt). Das homogene Ensemble ergänzen John Carpenter als Mercurio, Irina Maltseva als Satirino, John Pumphrey als Pane, Wonyong Kang als Silvano und die als indisponiert angekündigte Emily Bradley, die ihre Giunone als Göttergattin glänzend sang.

Bleiben die nicht zu unterschlagenden acht Nymphen, die in den diversen Kostümen Bella figura machen und den verstocktesten Gegner der Musik der Spätrenaissance bzw. des Frühbarock davon überzeugen müssten, dass sich mit der sog. Alten Musik durchaus jugendliche Effekte erzielen lassen. Das Publikum, das sich besonders im zweiten Teil – angesichts der komischen Verwicklungen, denen die von Martin Platz glänzend chargierte Linfea ausgesetzt ist – amüsiert zeigte, war mit der für die Nürnberger Rezeptionsverhältnisse völlig ausreichenden Aktualisierung der vor 370 Jahren entworfenen Handlung hörbar zufrieden, denn Oper wird immer noch in erster Linie für das regionale, nicht aus Spezialisten bestehende Publikum, also nicht für Reisekritiker gemacht. In diesem Sinne erlebten die Nürnberger einen so amüsanten wie politisch gewissermassen korrekten, dabei durchaus nicht dummen Abend. Herzlicher Beifall also für alle – und dies auch, weil hier (bitte nicht vergessen) wohl zum ersten Mal in der Nürnberger Theatergeschichte, ein Werk des großartigen Venezianers auf die Bühne kam.
Frank Piontek, 25.11. 2019
Fotos: ©Ludwig Olah
WEST SIDE STORY
Premiere: 26.10. 2019
„Build the wall“ - wir können den Spruch nicht nur als Projektion auf dem Vorhang sehen, der sich gleich heben wird. Wir lesen die Sentenz auch auf dem T-Shirt von Action, der nach der Tötung Riffs zum „Chef“ der Jets ernannt wird. „Build the wall“, der Satz wurde bekannt durch einen miserablen Präsidentendarsteller, der schließlich höchstselbst auf dem Vorhang zu sehen sein wird, und der mit dafür verantwortlich ist, dass Rassenhass, Intoleranz und Gewalt quasi salonfähig wurden. „Send them back“, das ist auch so ein Spruch, der dem Gedicht der Emma Lazarus Hohn spricht, das auf dem Sockel der Freiheitsstatue gelesen werden kann – auch diese Sätze stehen auf dem Vorhang, in denen es nicht, wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika erst kürzlich sagte, um „Shithole Countries“, sondern um „heimatlose“ und um vom „Sturm getriebene“ Exilanten geht,. Dahinter wabert es im grauen Rauch, die Jets und die Sharks fangen schon mal an zu kämpfen, schließlich haben sie nie etwas Anderes gelernt, als mit Gewalt auf die Anderen einzuschlagen. Und Leonard Bernsteins geniale Musik gibt immer noch den Soundtrack ab zur Romeo-und-Julia-Variation.
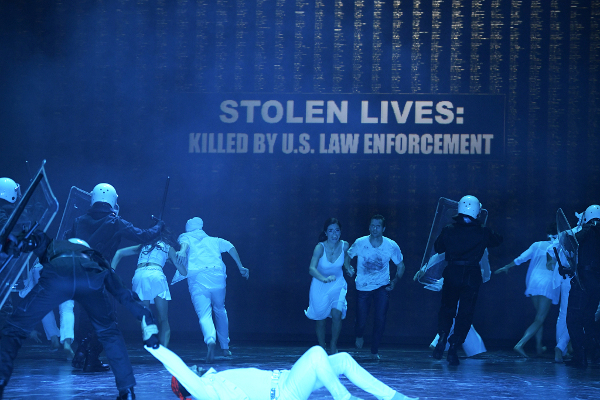
In Nürnberg klingt er besonders heftig in den Saal. Das unkaputtbare Meisterwerk von Bernstein und seinen Kollegen (16 Musikstücke – und alle brillant) wird unter der Regie und Choreographie von Melissa King und einigen Herren des Ensembles noch einmal aufgerauht, indem es sprachlich und körperlich in die Gegenwart transportiert wird. Der harte Sound und die verrohte Sprache (deutsche Fassung von Frank Thannhäuser und Nico Rabenald), die extreme Vitalität der Kampf- und sonstigen Begegnungsszenen passen zur Situation, die in 70 Jahren nicht besser wurde; wenn fast am Ende eine endlose Liste von Amerikanern und solchen, die in den USA ihr Glück finden wollten und die durch Polizeigewalt ums Leben kamen, projiziert wird, kapieren wir, dass die „West Side Story“ nicht nur ihrer Musik wegen alterslos scheint. Das Publikum versteht es, glaube ich, weil es immer wieder nicht nur der großartigen musikalischen und choreographischen Interpretation zujubelt, sondern vielleicht auch den zeitgenössischen Kontext mitdenkt.

Im Übrigen besitzen die Kampfszenen eine eigene Ästhetik, die tatsächlich, aber es ist nur scheinbar paradox, sondern eine hohe Kunst, nichts anderes als schön ist, weil nicht nur die „Herren des Ensembles“, sondern auch die dazugehörigen Damen mit größter Vollkommenheit agieren. Hart ist hier nicht nur das grundlegende Intro des Kampfes zwischen den neuen Montagues und Capulets, sondern auch die – wahrlich coole – Nummer namens „Cool“. Und fantastisch hinreissend ist nicht allein der festliche Doppeltanz der Jets und Sharks, in dem so etwas wie eine mögliche Harmonie aufscheint. Chapeau!

Zugegeben: es gab wohl kaum je eine schwache „West Side Story“-Aufführung, aber was am Premierenabend geleistet wird, ist mehr als normal, wofür die Namen der Interpreten David Boyd (als Riff), Nivaldo Allves (als Bernardo), Adrian Hochstrasser (als Action) und Annakathrin Naderer (als Anybodys, die sich aggressiv und verzweifelt in die Männergang hineinkämpft) stehen mögen – natürlich neben den Jet Girls und den „kleinen“ Jets und Sharks und ihren chicas, aber was heisst bei einem derartig körperlichen und szenischen Einsatz hier „klein“?. Knut Hetzer hat dem Ensemble ein paar einfache wie sinnfällige und leicht verschiebbare, mit Sprossen besetzte Eisenwände gebaut, zwischen denen der tödliche Bandenkrieg ausgetragen wird und die Solisten und Gruppen in schier aufregenden Lichtspielen nervös hin- und hertigern: auf der Suche nach einem Heimatort, denkbar differenziert in einem Raum inszeniert, den sie mit ihrer ganzen körperlichen Präsenz in höchst bewegten Tableaus (ich weiß: das ist ein Widerspruch) ausfüllen. Choreographie heisst hier nicht „nur“ Tanz. Choreographie ist hier ein so sinnfälliges wie ästhetisch schönes Arrangement von brillanten Bewegungsszenen, die mit der von Lutz de Veer dirigierten, meist harten und rhythmisch überaus prägnanten Musik durchwegs d'accord gehen. Voilà: ein Gesamtkunstwerk.

Bild 4
Meist hart? Die Inszenierung hat mit der wunderbaren Andromahi Raptis und dem sensibel spielenden und intonierenden Hans Kittelmann zwei Mitglieder des Opernensembles gefunden, womit sie sich schon stimmlich vom Rest der verfeindeten Lager unterscheiden. Wunderbar die in jedem Sinne weiße Traumsequenz „Somewehre“: kein Hass, keine Schläge, kein Tod. Stimmungsvoll und (auch) beifallprovozierend ihre Duette, insbesondere das zweite, „One hand, one heart“, bevor die Polizeitruppe „aufräumt“ und Anita von den Jets vergewaltigt wird. Soviel Brutalität muss dem Publikum einfach zugemutet werden, zumal mit diesem grausamen Akt, der nicht von den Machern des Stücks erfunden wurde, eine völlig verständliche Motivation für Anitas fatale Lüge (Chino habe Maria getötet) gegeben wird. Was aber wäre eine gute, nein: eine sehr gute „West Side Story“ ohne eine Anita wie diese? Myrthes Monteiro ist, in allen ihren Talenten, den tänzerischen und den sängerischen wie den schauspielerischen, schlicht und einfach: überragend.
So wie diese ungewöhnlich heftige und brillante Aufführung mit einem erstklassigen Ensemble, das das Publikum schließlich, völlig zurecht, lange jubeln lässt – und dies nicht obwohl, sondern weil der Schluss, Marias unstillbare Trauer und ihr Schluchzen über dem Leichnam des Geliebten, eher in der Dunkelheit als in einem Hoffnungsschein der Versöhnung verklingt.
Frank Piontek, 27.10. 2019
Fotos: Bettina Stöß / Staatstheater Nürnberg.
DON CARLOS
Premiere: 29.9. 2019. Besuchte Vorstellung: 13.10. 2019
Natürlich gibt es auch an diesem Abend keine wie auch immer geartete „Erlösung“ für den Infanten. Für Verdi selbst war die Szene der Entrückung des Don Carlos in ein Kloster mit Hilfe eines Mönches, der vielleicht ein Wiedergänger Karls V. oder gar dieser selbst sein könnte, zurecht ein „schwarzer Punkt“, dem auch die Vermutung, dass eine Oper per se irreal ist, nicht wirklich weiterhilft. Zweifellos ist hier eine Interpretation nötig: zumal dann, wenn die Oper in einem gegenwärtigen Opern-Ambiente spielt. Dass aber schließlich die Königin mit einem Baseballschläger hingerichtet wird, indem die bad guys aus Phillips mieser Mafiatruppe ihr den Schädel einschlagen – das ist, glaube ich, zu viel des Schlechten. Denn irgendwann hat man begriffen, dass die Welt eben schrecklich ist: auch, dass man „Don Carlos“ mit exzessiver Brutalität keinen Dienst erweist, was nicht heißt, dass die Einblendung schrecklicher Dokumentarfilme aus Bürgerkriegen „stören“ würden; ob wir es mit Toten aus den spanischen Niederlanden oder aus einem laufenden Krieg zu tun haben, ist (leider) gleich gültig. Der König aber, wie ihn die Librettisten und, dies vor allem, Verdis genaue Musik zeichnen, ist nicht der Killertyp, den die neue Nürnberger Inszenierung des regieführenden Intendanten Jens-Daniel Herzog auf die Bühne bringt, zumal das Entsetzender Ekel Philipps vor den eingespielten Real-Videos angesichts seiner sonstigen Brutalität das Gegenteil von glaubwürdig ist – oder wollte man hier einen gespaltenen Charakter andeuten? Dessen realistische Zeichnung am Ende dem bloßen Einfall geopfert wurde?

Freilich passt die Stimme Nicolai Karnolskys zu eben dieser Rollenauffassung. Sein Philipp ist, in seiner berühmten Schmerzensarie, weniger von des Gefühles Blässe angekränkelt als dass er seinen Schmerz buchstäblich coram publico verkündet. Gestört wird er – leider auch das Publikum – allerdings durch sein Kind, die kleine Infantin, die im Hintergrund sitzt und Computerspiele spielt (und im Übrigen gut agiert: Jana Beck). Es genügt, um sensiblere Zuschauer vom Wesentlichen abzulenken, denn man ignorierte hier leider wieder das gute alte Bühnenmotto: Keine Kinder! Die Szene ist, trotz Karnolskys Deutlichkeitseinsatz, leider musikdramatisch hin; weniger wäre auch hier wesentlich mehr gewesen. Um diese These zu belegen, muss man sich nicht einmal uralte Filme mit Boris Christoff anschauen, der bekanntlich einen wirklich tiefgründig-bohrenden Bass sein eigen nannte. Im neuen „Don Carlos“ wird Philipp dagegen zu einem Autokraten der Macht, dessen Empfindlichkeit sich darin äußert, dass er sein Kind schlägt und Posa persönlich von hinten niedersticht, vulgo: hinrichtet. Zugegeben: es gibt Ansätze der Differenzierug (so etwa, wenn der König Posa den Bombenkoffer zurückgibt und ihn schreiend vor dem Inquisitor warnt), aber das grundsätzliche Problem dieser Auffassung liegt nicht nur darin, dass die Psychologie, die Verdi und seine Librettisten dem König schenkten, beim Teufel ist. NEIN, der König ist kein Killer, sondern eine tragische Persönlichkeit, über die zu richten unmöglich ist! Das Problem dieser Inszenierung liegt wieder einmal darin, dass das Kunstwerk Oper mit der sog. Wirklichkeit verwechselt wird und Verdis Subtilitäten, in den Volksszenen und in den Killerarrangements, zu simpel ins Heute gebracht werden, was einzelne Erschütterungsmomente und beeindruckende Bilder nicht immer ausschließt: wenn der Schatten des sich nahenden Inquisitors (eindrücklich, aber nicht gespenstisch: Taras Konoshchenko) riesig auf die hohen Drehwände der holzgetäfelten Machtarchitektur (Mathis Neidhardt) fällt, ahnt man, dass auch der Dreckskerl ein Opfer der Macht ist. Und wenn Emily Newton als Elisabeth und Tadeusz Szlenkier als Carlos im höchstbewegenden, geradezu metaphysischen zweiten und im erschütternden letzten Liebesduett im weißen, kahlen Raum aufeinandertreffen, machen es diese beiden Sänger, dass Verdi am Ende doch gerettet ist – trotz abschließender Hinrichtung, trotz der Tragödie, dass ein Bühnenstück erst dann zuende ist, wenn wirklich alles, alles zerstört wurde. Gewöhnung an Brutalitäten und weiße Räume aber stumpfen auf Dauer ab. Warum hat sich das auf dem Theater noch nicht herumgesprochen?

Die Sänger also. Tadeusz Szlenkier beginnt so, wie er immer singt: schön, aber laut, doch im Lauf des Abends findet er – liegt es an nachlassender Stärke oder an einem stimmlichen Konzept? - zu zerbrechlichen Tönen, die die labile Seite des Carlos ziemlich gut abbilden. Emily Newtons Elisabeth ist eine femme fragile, die zumal im letzten Akt zu sensiblen Tönen des Verzichts findet: mit einer Vokalfärbung und -dynamik, die nicht aufs Grelle setzen muss, um zu wirken. Dagegen repräsentiert die Eboli der Martina Dike eine sexy gekleidete Powerfrau, die sich den überrumpelten Pagen (gut: Emily Bradley) in einem satirischen Beitrag zur Me-too-Debatte buchstäblich zur großen Brust nimmt und in ihrer Glanznummer „O don fatal“ das Publikum rockt; zu laut ist sie m.E. hier nicht: „nur“ brillant und vital, hinreißend energetisch und doch charakterlich feingezeichnet.

Sangmin Lee ist dem Prinzen zuletzt ein stimmlich guter Partner: als väterlicher, nicht als brüderlicher Posa, der den Infanten als politisches Spielzeug einsetzt und sich als gescheiterter Mann zwischen Idealismus und Realismus (dafür steht der schließlich unbenutzte Bombenkoffer ein) an den Widerständen des Systems die Finger verbrennt. Und dies auch, weil er sich dieselben schmutzig macht, wenn er sich an der Hinrichtung der Gesandten beteiligt: ein Un-Sinn, der durch keinerlei Information Camille du Locles und Verdis gedeckt wird. Natürlich entnehmen wir dem Textbuch auch nicht, dass die Königin am Ende den toten, mit einem zynischen „Liberté“-Schild drapierten Posa ansingt und nicht den Geist Karls V. Allein diese Deutung, die die Brücke zur Gegenwart schlägt, wird durch Text und Musik nicht widerlegt. Wie gesagt: der Bürgerkrieg, von dem Schiller und Verdi sprachen, und in dem sich die Königin engagiert, indem sie – es wirkt freilich auch wie eine Anbiederung an die pardon: platte Tagesaktualität – Pässe verteilt, ist kein Phänomen der Vergangenheit. Die Frage bleibt nur, ob jedes szenische Mittel die Botschaft heiligt. Nicht zuletzt Verdis Ringen um den Schluss der Oper beweist, dass sie nicht mit den alleinigen Mitteln einer vermeintlichen oder gar tatsächlichen Wirklichkeit in die Gegenwart transportiert werden kann.

Abgesehen davon, dass das akustische Problem des Nürnberger Hauses nach der nächsten Renovierung hoffentlich nicht mehr besteht: dass laute Sänger hier noch lauter wirken, was auch für's Orchester gilt – doch nicht an diesem Abend. Die GMD Joana Mallwitz weiß, wo sie die Zügel loslassen und anziehen kann. Immer wieder ist es ein Vergnügen, dem Spiel der Stimmen zu lauschen: wenn ein Horn eine Melodie der Mitte anstimmt oder der Streicherchor des symphonischen Vorspiels des zweiten Akts der französischen, hier (durch den ersten Ur-Akt ergänzten, doch nicht nur um die Holzfällerszene gekürzten) Fassung von 1884 wunderschön ins Haus klingt. Was sonst fehlt, ist, man hat's nicht anders erwartet, das Ballett, es fehlt auch der Maskentausch der Eboli und der Königin. Dafür bekommen wir die Ansicht der öffentlichen Entjungferung der Elisabeth a tergo durch die königliche Hand höchstselbst geschenkt, wir dürfen der Hinrichtung der flandrischen Gesandten beiwohnen, wir dürfen zuschauen, wie der Mönch sich die Brust aufritzt und die Gräfin d'Aremberg, ebenso öffentlich, denn wir sollen ja lernen: wir befinden uns in einem Terrorstaat, den Kopfschuss empfängt, bevor die Königin ihr Abschiedslied singt. Auch hier geht es zu Herzen – doch nicht aufgrund der Hinrichtung. Wir sehen, im Autodafé, nicht nur eine Vergnügungsgesellschaft aus Dragqueens, Clowns und Karnevalisten, sondern, man hatte es erwartet, eine Stimme von oben (wie immer wunderbar goldsopranig: Julia Grüter), die als Rauschgoldengel erscheint, also wie eine geschmacklose, Verdis Intentionen wieder einmal unnötig widersprechende Inszenierung, wie wir sie inzwischen zur Genüge kennen, als müsste Oper auf Teufel komm raus immer und ewig „realistisch“ sein, doch seltsam: das Bild bleibt zweideutig, bleibt, wenn man's denn so sehen will und kann, ein Bild zwischen Show und Traum.

Soweit ist alles klar, Nur das, was den Don Carlos wirklich antreibt, bleibt ein wenig nebulös. Haben wir es beim traurig auf seinem Sessel sitzenden Mann mit einem Träumer zu tun? Erinnert er sich? Schreibt er gerade einen Roman? Halluziniert er sich in eine Handlung, die schon einmal war?
Egal, denn zumindest einige Szenen, die ihre Dignität vor allem, aber nicht nur, aus den sängerisch-schauspielerischen Leistungen ziehen, vermögen das Publikum denn doch, aller brutalen Eindeutigkeiten zum Trotz, davon zu überzeugen, dass Verdis „Don Carlos“ eines der bewegendsten Hauptwerke der Oper des 19. Jahrhunderts ist. Also starker Beifall – zurecht für die Sänger, das glänzende Orchester der Staatsphilharmonie Nürnberg und den wie immer guten Chor des Nürnberger Staatstheaters.
Frank Piontek, 14.10. 2019
Fotos: ©Ludwig Olah / Staatstheater Nürnberg
JAKOB LENZ
Premiere: 23.6. 2019
„Lenz ging übers Gebirg“ - so beginnt eine der berühmtesten Erzählungen der deutschen Literatur. Sie blieb fragmentarisch wie das Leben des Autors, Georg Büchner, und sie schilderte das fragmentarische Leben eines Mannes, der im 20. Jahrhundert, nicht zuletzt durch eine bedeutende Oper, wiederentdeckt wurde. Jakob Michael Reinhold Lenz aber war nicht allein für den Komponisten der unvergleichlichen „Soldaten“ interessant. Vor 40 Jahren schrieb der damalige Shooting Star der Neuen Musik, Wolfgang Rihm, eine „Kammeroper“, die sich seit der Uraufführung im Seitenrepertoire der Moderne einen komfortablen Platz gesichert hat. Liegt's daran, dass das Werk, obwohl es orchestral sparsam besetzt, wenn auch technisch notorisch schwierig zu exekutieren ist, in Wahrheit die Züge einer großen, wenn auch relativ kurzen Oper aufweist?

Man hat zumindest den Eindruck, wenn man die Neuinszenierung von Tilman Knabe besichtigt. Als die Oper 1981 an der Deutschen Oper Berlin erstaufgeführt wurde, fand, das war eine typische und ungewollt unterschätzende Haltung gegenüber dem Werk, das Kammerstück vor dem Eisernen Vorhang statt: mit den Stimmen, die Lenz bedrängen, und die aus seinem Kopf quellen, im Orchestergraben oder der Gasse. In Nürnberg wird die gesamte Bühne genutzt – und die „Stimmen“ sind Rollen (in Nürnberg also Andromahi Raptis, Julia Grüter, Irina Maltseva, Almerija Delic, Daeho Kim und Tadas Girininkas, gewiss nicht die Schlechtesten ihres Fachs). Ganz abgesehen davon, dass der Anspruch, den Rihm seinerzeit und heute an den Interpreten der Titelrolle stellte, exorbitant sind. Lenz steht die gesamte Zeit auf der Bühne, er hat in den diversen Ausdrucksmitteln einer Neuen Vokalität zu glänzen, er entäußert sich zudem auf exzessive Weise, er hat – gut – zu sprechen und zu spielen, er ist praktisch der Held einer Anti-Held-Oper. Denn der in den (scheinbaren?…) Wahnsinn abdriftende Dichter und Denker, der „zu viel grübelt“, steht immerzu an (s)einer Grenze. Hans Grönig ist dieser Mann, er spielt und singt ihn mit Inbrunst und voller Kontrolle der akustischen Mittel, er wirft sich in die prekäre Gestalt, um uns klar zu machen, dass die Verrückten nicht Leute wie er, sondern die Angepassten wie der von Hans Kittelmann messerscharf artikulierte Herr Kaufmann, der Vertreter einer althergebrachten Regelpoetik, sind. Grönig bringt Büchners und Lenz' Idee einer Kunst, die es mit dem Schmutz zu tun haben muss, derart überzeugend über die Rampe, dass nur ein junges Pärchen während der Aufführung aus dem Saal flüchtet.

Ist eben nicht „schön“, dieses Werk, das die Probe aufs Exempel macht, indem die „Penner“ und Huren – ganz im Sinne Büchners - als darstellungswürdige Individuen gezeichnet werden: in all ihren brutalen Widersprüchen. Riesenbeifall also für diese Leistung, die vergessen lässt, dass manch Regiemittel sich in der Drastik längst erschöpft hat. Fatalerweise aber ist eine niedergeknüppelte Demo, in der die Parolen der Gegenwart wie Fanale aufscheinen (per exemplum: „Rettet die Bienen“), oder der Knüppel-Terror, dem Lenz auf der Polizeiwache ausgesetzt ist, so banal wie realistisch. Dilemma des „Regietheaters“… Auch Knabe, der ein Gespür für szenische Abwechslung, für psychologisch starke Ausdeutungen der miniaturhaften Szenen hat, entkommt ihm nicht; am Ende aber siegt das Musik-Theater über bloße Behauptungen: denn dieser Lenz ist ein Opfer jener verlogenen Gesellschaft, die im Lauf der Jahrhunderte nur ihr Kostüm gewechselt hat. In diesem Fall bewegen wir uns im Zwischenraum zwischen der bunten Welt der schicken Werbeplakate und der schmutzigen Straße. Annika Haller hat, mit den Arbeiten des vor allem in Asien tätigen Fotografen Michael Wolf, einen technisch schnell verwandelbaren Kunstraum entwickelt. Und wenn am Ende Dutzende von Din-A-4-Blättern mit Büchner- und Lenz-Texten von den Rängen ins Parkett fliegen, haben wir es mit einem wunderschönen wie, im Sinne Goethes, „bedeutenden“ Bild zu tun. „Der Hessische Landbote“ war schließlich auch ein Vorläufer der Flug(!)-Schriften der Weißen Rose, und Lenzens bittere Gedichte ein Ausdruck seines Fühlens.

Und also sehen wir Lenz zunächst als Penner mit dem bekannten Tütenkarren an einem EC-Gerät, Karten ausprobierend, die nur noch beweisen, dass alle Konten leer sind. Halt gibt fast nur noch der Albtraum der toten Geliebten, die im Blaulicht – so langsam wie viele der schemenhaften Stimmen – zeitlupenhaft über die Bühne wandelt. Ist Lenz wirklich wahnsinnig? Ist die Ironie, mit der er in der Speaker's corner seine unverständliche Predigt herauslässt, nicht der Vorschein einer höheren Wahrheit? In höherem Sinne vernünftig scheint es, wo Büchners berühmtester Slogan absurd verdreht wird: „Krieg dem Frieden – Hütten den Palästen“ - man kann das auch richtig lesen. Grönig wechselt vom falschen Pathos zum richtigen, schwingt und zertrümmert dann verzweifelt ein Lichter-Kreuz, wie auch Büchner an den Lehren Jesu interessiert war; die Armenspeisung für die Angehörigen des untersten Prekariats ist eine Regie-Idee, die sich, wie die allegorische Miss Liberty, die Lenz zum Schreiben zwingt, ganz auf Büchners Ethos berufen kann – so wie die Lyrik dieser Partitur als nötiges Korrektiv zu Lenzens Exaltationen herüberklingt. Sie wird von der Staatsphilharmonie Nürnberg zusammen mit einem Kinderchor unter
Guido Johannes Rumstadt mustergültig gebracht.
Am Ende wird Lenz blutüberströmt, wie ein zweiter Erbärmdechristus, auf dem Boden liegen. Auch Oberlins Bemühungen konnten ihn nicht retten, so stimmschön auch Wonyong Kang die kleine und wichtige Partie gestaltet, deren Motivation Knabe übrigens aus einer seltsamen Stelle bei Büchner herausdestillierte: der Kuss, den der philantropische Pfarrer seinem Schäfchen da auf die Lippen drückt, ist bei Knabe weit sexueller. „Konsequent“, wie es bei Büchner und, hier besonders extrem, weil 17mal gesungen, bei Rihm am Ende heißt. „Nicht lustig“, so nennt man das wohl – aber die Nürnberger haben Rihms nach wie vor interessantes und interpretierbares Werk so spannend und musikalisch differenziert gebracht, dass man ein unverständiger Kaufmann sein müsste, um vorzeitig den Saal zu verlassen.
Frank Piontek, 24.6. 2019
Fotos: ©Bettina Stöß
EXQUISITE CORPSE IV
Premiere: 15.6. 2019
Kann so ein Abend mit Choreographien von Montero-Tänzern beginnen? Wie eine Erinnerung und eine Hommage an Ballette der 50er und 60er Jahre?
Schon dreimal haben einzelne Tänzer aus der Compagnie des Nürnberger Tanztheaterdirektors Goyo Montero Abende inszeniert, in denen sie zeigen konnten, dass sie nicht allein gut tanzen können, sondern auch zu choreographieren verstehen – aber noch niemals haben sich für ein solches Nürnberger Programm 14 Tänzer zusammengetan, um dem Publikum nicht weniger als 12 Arbeiten vorzustellen. Was eint sie? Ein Zitat des surrealistischen Wunderdenkers André Breton, der einmal vom mehrfach gefalteten Blatt Papier sprach: „so, dass jeder die Zeichnung seines Vorgängers fortsetzt, ohne diese jedoch zu kennen. Wenn das ganze Blatt so bearbeitet ist, wird es entfaltet und das so entstandene Kunstwerk bestaunt.“

Fabula noctis: Natsu Sasaki und Nura Fau
Noch einmal: Kann so ein Abend mit Choreographien von Montero-Tänzern beginnen? Natürlich – denn wenn man Daniel Roces' Mozart-Micky-Mousing genauer betrachtet, wird man in der erstaunlich musiknahen Vertanzung des Schluss-Satzes aus Mozarts d-Moll-Klavierkonzert eine Art Basis erblicken: Klassischer Tanz, gekoppelt mit gemäßigt modernen Elementen eines Nachkriegs-Neubeginns, dessen Spuren noch in den neuesten Arbeiten heute arbeitender Choreographen zu beobachten sind. Als harmlose Eröffnung eines komplexen Abends, als unkomplizierte Einschwingung in die Suite moderner Choreografien machte Roces' „Mantodea“ („inspiriert von den Insekten der Spezies Gottesanbeterin“) schon einen guten Sinn: auch als Erinnerung an die Vorgeschichte dessen, was in Nürnberg seit 20 Jahren besichtigt werden kann. Denn was folgte, war so kontrastiv wie nur möglich.

Beat the meat
Die unwillkürliche Frage aber lautet natürlich, auch wenn laut Robert Musil, womit er natürlich Recht hatte, nichts „natürlich“ ist, die Frage also lautet: Wie hältst du's mit Montero? Wie viel Montero also ist in Deiner Arbeit? Viele choreographierende Tänzer wurden, es war vermutlich kaum vermeidbar, vom Meister inspiriert. Pardoxerweise aber ist man ihm dort, wo man sich tanzsprachlich von Monteros Handschrift am weitesten entfernt, am nächsten: in der Freiheit, den Tanz für sich neu zu erfinden. In diesem, und nur in diesem Sinne, waren Nobel Lakaevs und Joel Distefanos „Beat the meat“ (eine relativ lange, absurde wie beklemmende, lustige wie gruselige Revue mit „Memen“, die auch mal einen sich enthemmenden Sirtaki und Disco tanzen, und die neben einem weiteren, ins Komische aufgelösten Filmzitat aus „Full Metal Jacket“ an Woody Allens Spermien aus „Was Sie schon immer über Sex wissen wollten“ und zugleich ein wenig an die Höllenbilder aus Boschs Gemälden erinnerten) und Isidora Markovic' „Milk Teeth“ (die latent aggressive Begegnung von fünf jungen Leuten: auf dem Schulhof? Auf der Straße?) fast näher an Montero dran als Stephanie Pechtl mit ihrer „Fabula noctis“: Vier Frauen, zusammen und gegeneinander, einsam und im Corps. Was immer wieder, in fast allen Arbeiten, durchschimmert, ist das Thema, das vielleicht Monteros Kernmotiv ist: das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, das immer wieder neu definiert werden muss, selbst in den Arbeiten, in denen „nur“ ein einzelner Mensch wie Andy Fernández (in seiner hochvirtuosen „Recreación fisica“) auf der Bühne steht. Der Schluss, Nuria Faus und Esther Pérez' „Free Willy – Hetwich“ macht es unerbittlich klar: wie ein Mann namens „Free Willy“ in der Stadt der Äußerlichkeiten vergessen wurde, um auf ein Wesen namens Hetwich, einem guruhaften Ego, zu treffen, das schließlich die gesamte Compagnie in einem Gruppenbild eines fröhlichen Gänsemarschs vereint.

Inferno
Der Rest war ein wenig krude (die langen geschüttelten Wuschelblondhaare in Alexsandro Akapohis „Inferno“, „ein Ort in unseren Köpfen...“), war auch die erst sehr lustige, sehr schnelle, dann tief berührende, schwierige Begegnung eines Paares („Bonita casulidad“ von Laura Armendariz). Auch in Tal Eitans „Sheket“, übrigens begleitet von einem der schönsten Sätze von Peter Handke („Als das Kind Kind war“, man kennt es aus dem „Himmel über Berlin“), wurde im betörend vernebelten Leer- und Lichtraum ein Pas de deux aus Nähe und Abstoßung (und auch das ist ein Montero-Motiv) inszeniert, bevor – eine offensichtliche Fortsetzung der vorangetanzten Choreographie – der Broken Dance des Andy Fernández den mit dem Publikum kommunizierenden Tänzer in der selben Ecke auftreten ließ, an der das Paar verrschwand. Traurigkeit und Humor – auch so könnte man die Arbeiten überschreiben, die niemals, selbst nicht in der seltsam atavistischen Höllenparodie Alexsandro Akapohis, das Niveau unterschreitten, an das sich das Nürnberger Publikum gewöhnt hat. Hier die Komik (Sofie Verwaeckes energetische wie witzige Szenenfolge „At this point“), dort die ernste Auseinandersetzung mit den Themen Frau und Gesellschaft (Luis Tenas „N.O.S.T.“), die einen zuletzt davon überzeugt, dass Tanz nicht nur ein bezaubernder Pas de deux, sondern auch auf subtile Weise politisch sein kann: so wie in Rachelle Scotts „Without us“ der Terror und die Gefangenschaft – und wieder im Widerspiel von Individuum und Masse – in Tanzbilder gebracht werden können, die zwischen den Körperschwingungen der Moderne und dem gestischen Theater vermitteln.

Bonita casulidad: Esther Pérez und Lorenzo Terzo
Also: Aleksandro Akapohi, Laura Armendariz, Iván Delgado, Joel Distefano, Tal Eitan, Nuria Fau, Andy Fernández, Dayne Florence, Olga Garcia, Nobel Lakaev, Isidora Markovic, Stefanie Pechtl, Esther Pérez, Daniel Roces, Natsu Sasaki, Rachelle Scott, Luis Tena, Lorenzo Terzo und Sofie Vervaecke haben zusammen, als Choreografen und als Tänzer, die in eigenen Choreographien und den Arbeiten ihrer Kolleginnen und Kollegen auftreten, einen insgesamt erstaunlichen, kurzweiligen und denkbar vielfältigen Gruppenabend mit je individuellen Akzenten kreiert: mit Musik von Mozart, Händel (sein „Ombra mai fu“ erklang in der Musikcollage zum grotesken wie nachenkenswerten „Beat the meat“) und Satie, auch von Max Steiner (wunderbar sein Thema aus der Filmmusik zu „A summer place“ in Sofie Vervaeckes „At this point“), mehr noch von modernen Geräusch-Komponisten, Electro-Meistern und Klangexperimentatoren. Ein Abend voller Brüche, aber auch voller Gemeinsamkeiten, voller Virtuosität und Poesie, abgründiger Komik und absolut unlustiger Betrachtungen zur conditio humana, ein Ensemble-Abend. Riesenbeifall – was sonst?
Frank Piontek, 16.6. 2019
Fotos: © Bettina Stöß.
KRIEG UND FRIEDEN
Premiere: 30.9. 2018. Besuchte Vorstellung: 14.6. 2019
Wie doch die Zeit vergeht… Vor knapp 9 Monaten ging die Premiere über die Bühne, nun hat man eine letzte Vorstellung gewuchtet, denn Prokofjews chef d'ouevre ist mit seinem Orchester, dem großen Chor samt Extrachor – der in dieser Choroper wahrlich viel und anspruchsvoll zu singen hat - und der Statisterie, den über vier Stunden reiner Spieldauer und den nicht weniger als gut 60 Solopartien ein wahres Schlachtschiff der Operngeschichte. Umso erstaunlicher, dass es am Ende der Nürnberger Spielzeit noch einmal in einer Sondervorstellung realisiert werden konnte: auf vielfachen Wunsch der Zuschauer, wie es heißt.

Man versteht's, denn mit dem Intendanz-Einstand hatte Jens-Daniel Herzog, der regieführende Chef des Nürnberger Hauses, einen Coup gelandet und die Belastbarkeit der Institution unter Beweis gestellt, auch wenn hier „nur“ 28 Solisten in „nur“ etwa 40 Rollen eingesetzt wurden. Und wieder begeisterte die rasante Verwandlungstechnik, mehr noch die Vollkommenheit, mit der die Affekte von Liebe und Hass, Sex und Gewalt, Trauer und Tod mit einem bis in die letzten Nebenpartien glänzend besetzten Solistenensemble ausgespielt wurden. Nicht zuletzt gefeiert wurde die phänomenal aufspielende Nürnberger Staatsphilharmonie unter ihrer Leiterin Joana Mallwitz: bisweilen sehr laut, doch nicht lärmend, in den lyrischen Passagen (typisch: die Kantilene Andrejs und die impressionistisch flirrende Frühlingsstimmung auf dem Gut Otradnoje), den meist bösen Walzern, den Kriegskatarakten und den satirischen Episoden immer auf dem genauesten Punkt.
Reden wir über einige Sänger, weil die Produktion beweist, dass es in Nürnberg möglich ist, selbst solch herrliche Monster wie „Krieg und Frieden“, wenn's glückt, vocaliter lückenlos gut auszustatten. Witzig war ja schon die Ansage: Hatte sich Denis Milo, der glänzende Interpret des Denisow, der ganz am Ende eine kurze, aber umso eindringlichere Arietta zu singen hat, für seinen auch tänzerischen Auftritt im zweiten Bild entschuldigen müssen, weil er vor Kurzem einen Unfall erlitt (hier vertrat ihn Michael Fischer), so vertrat Milo im Schlussbild wiederum seinen Kollegen, weil der wiederum einen französischen Offizier zu spielen hatte, der im Schnee-Finale zu krepieren hat, so dass wir es schlussendlich mit zwei Denisows zu tun hatten. Nicht, dass es wirklich aufgefallen wäre, Prokofjews Personal zeichnet sich ja auch durch viele Kurzauftritte aus – aber bemerkenswert war es schon. Im Übrigen standen neben Fischer noch zwei weitere Mitglieder des Internationalen Opernstudios Nürnberg in kleinen, aber unverzichtbaren Partien, die auch „gemacht“ werden müssen, auf der Bühne: Wie gesagt: Eine Ensemble-Leistung.

Wieder begeistern nicht nur die drei Hauptfiguren. Jochen Kupfer ist als Andrej, vom ersten melancholischen, von Verzweiflungstönen durchsetzten Auftritt über die Borodino-Szene bis zum Sterbebett (und Sterbewalzer), gesegnet mit seinem warmen Bariton und einer schlanken schönen Ausstrahlung - eine ABSOLUTE Idealbesetzung wie die Natascha der Eleonore Margerre, die ein bisschen wie die junge, schöne Romy Schneider aussieht und selbst dann wie ein empfindsamer Engel singt, wenn Natscha sich einen Schwips antrinkt. Nicht nur in ihrer Konfession, die sie als Ausgesperrte vor der Tür des zukünftigen Schwiegervaters Bolkonski tief bewegend anstimmt, rührt sie bis zuletzt. Nun fällt, Prokofjew war halt ein genialer Komponist, auch auf, dass ihr Freudenbekenntnis im Ball-Bild schon von Schmerz beseelt ist…

Der Dritte im Bunde ist Pierre, der gute Mensch von Moskau und St. Petersburg, also Zurab Zurabishvili, ein intelligent artikulierender, mächtiger Tenor vom Scheitel bis zur Sohle, dessen Potenz der inneren Unsicherheit des Pierre Besuchow zu widersprechen scheint. Was mir nun wieder auffiel, waren einige Vertreterinnen einiger sog. „Nebenrollen“, aber was heißt in einem derartigen Panorama-Gemälde schon „Nebenrolle“? Von glänzender, dramatisch eindringlicher Statur die Damen: Martina Dike als strenge und doch mit Natascha mitfühlende Achrossimowa, die sich, höchst bravourös, mit Natascha in ein technisch schwieriges Duett und zuletzt in den Krieg schmeißt, Almerija Delic als zutiefst unsichere, in Konventionen befangene Bolkonskaja, die es nicht schafft, sich vor der verschlossenen Tür ihrer Wohnung der Natascha zu nähern. Wieder bewegend die böse Doppelbelichtung der Szene: links der projektierte Schwiegervater, Nicolai Karnolsky mit Stalin-Bart, der vor seiner Frau die „Gouvernante“ provokativ umfängt, während Natascha sich gerade buchstäblich draußen vor der Tür in Verzweiflung auflöst.

Weiter mit den weiblichen „Nebenrollen“. Betörend auch Irena Maltseva als Hélène Besuchowa, das blonde Gift. Bewundernswert auch die Besetzung der „kleineren“ Partien: die nicht nur stimm-schöne Andromahi Raptis als Peronskaja, die im wie die Achrossimowa mit einem Petroleumkanister in den Krieg stürzt (im originalen Libretto sind's übrigens zwei andere Rollen: Dunjascha und Mawra Kusminitscha). Bleiben die Männer, allen voran Nicolai Karnolsky, der die, ja: herrliche und herrlich patriotische Arie des General Kutusow herrlich bringt, während die Toten und Verletzten vom Schlachtfeld geräumt werden und sich Andrej und der Verführer seiner einstigen Verlobten ein kurzes und letztes Mal schwerverletzt – in jedem Sinne – in die Augen schauen. Derartige Doppelbelichtungen gibt es, siehe oben, noch öfter: so etwa, wenn sich Pierre vor den monumentalen, patriotischen Schlusschören des ersten und zweiten Teils und auf dem Fest vereinsamt sieht. Bemerkenswert auch der Karatajew des Martin Platz, und auch schön, dass er, im Gegensatz zu vielen seiner Kolleginnen und Kollegen, allein in dieser Rolle agiert – denn ein Gottesnarr ist eben ein Gottesnarr und kein Anderer.
Was für eine technisch glänzende, menschlich bewegende und inszenatorisch gelungene Aufführung! Ein Gruß also ans KBB und die Leitung des Hauses, denn selbstverständlich ist ein Einschub dieses Kalibers, gegen den, rein besetzungs- und bühnentechnisch betrachtet, eine „Götterdämmerung“ wie eine Kammeroper wirkt, ganz und gar nicht.
P.s. Pünktlich zur Aufführung erschien ein kleiner, feiner Symposionsband, das Ergebnis einer Nürnberger Opern-Tagung zur letztjährigen Premiere von „Krieg und Frieden“: „Krieg und Frieden – Konstruktionen von Geschichte(n).“ Das Heft kann zum Dumping-Preis von 3,50 in der Oper erworben werden. Es sei allen Opernfreunden ans Herz gelegt, die sich für die historischen und politischen Hintergründe des Stücks, auch für die Inszenierungsarbeit an Prokofjews Meisterwerk interessieren.
Frank Piontek, 15.6. 2019
Fotos: © Ludwig Olah
LOHENGRIN als Supermann ?
Premiere: 12.5. 2019
Möglicherweise soll das lustig sein...
Angeblich weiß ja jeder Regisseur, wer oder was das ist: Lohengrin. Für Wagner war er, jedenfalls hat er das einige Jahre nach dem Entwurf des Textbuchs ungefähr so ausgedrückt, der Ausnahmekünstler an sich (also er selbst: Wagner). Für die einen ist er eine Traumgestalt, Elsas Wunschvision (die Version Kupfer), für die anderen ein frauenfeindlicher Faschist (die besonders schreckliche Variante war vor Urzeiten in Augsburg zu sehen), für die dritten ein Chemielehrer (Konwitschnys Vorstellung), für Neo Rauch und Rosa Loy der Mann vom Elektrowerk, für Henning von Gierke und Werner Herzog war er ein Mann, der aus den Tiefen der deutschen Romantik kam. Für Lorenzo Fioroni war er, das war in Kassel, und es war gut, drei verschiedene Figuren aus drei Epochen. Für Hinz und Kunz ist er eine Art Supermann. Genau so tritt er auch in der neuen Nürnberger Inszenierung auf: wie eine Figur aus einem Marvel-Comic. Und Elsa und ihre Gegenspieler ähneln auffällig, nein: SEHR auffällig den kostümierten Figuren aus dem „Game of Thrones“. Die Kostümgestalterin Katharina Tasch hat fröhlich im Fundus gewühlt, den ihr die Filmserie zur Verfügung gestellt hat. Einfaches Googeln bringt die Vorbilder, bis hin zu den Perückendetails, zum Vorschein: von Ortruds und Telramunds wodanistischen Rabenüberzügen zu Elsas blondem Haarkranz. Hinzu kommt, bei den Deutschen, ein peinlicher Schuss Mittelalter-Historismus im Stil der Historienschinken der 50er Jahre. Ich sage nur: Prinz Eisenherz. Möglicherweise soll das lustig sein, aber wenn zwischen Ironie und relevanter Anspielung kein Partiturblatt mehr passt, hat die Regie irgendetwas falsch gemacht. Eine Inszenierung im konsequenten Stil von Monty Python wäre vielleicht nicht besser, aber lustiger gewesen.

Auch weist der Besetzungszettel neben den bekannten Namen und den vier Edelknaben, die hier als buchstäblich aufgescheuchte Hühner mit silbernen Engelsflügeln über die Bühne wedeln, zwei weitere Figuren explizit aus: Wotan und Parzival. Sie stehen im ideologischen Hintergrund des Konflikts, werden auch von Wagner ausdrücklich genannt, wobei wir mal eine Sekunde vergessen, dass Wotan bei Wagner, gut sächsisch, mit weichem „d“ geschrieben wird (Textkenner können ja, auch und gerade in der Oper, so lästig sein…). Der Besetzungszettel hätte eine dritte Figur listen können. Nennen wir sie die „Rabenmutter“ oder „Rabenfrau“ - ein Teil jener heidnischen Gemeinschaft, die der Regisseur David Hermann und der Dramaturg Georg Holzer als „Brabanter“ definiert haben. Telramund darf im zweiten Akt heftig mit der kleinen Frau rummachen, die der Ortrud so ins Ohr flüstert wie Parzival seinem Sohn im Brautgemach. Dafür fehlt nur der Schwan... aber der ist, wir erfahren es am Ende, kein Anderer als Telramund, der flugs von den Toten aufersteht, um die Herrschaft an sich zu reißen. Zugegeben: diese Szene ist so hirnzerreissend originell wie der Beginn des dritten Akts, den man gewiss noch nie so gesehen hat. Der wilde Wotan feiert da, samt Spanferkel, mit seinen Walküren oder Mitgöttinnen eine wilde Sauf- und Fressorgie. 30 Minuten später wird der wilde Geselle neben dem toten Telramund stehen und höhnisch lachen.

Nun kann man ja den Gegensatz von Heiden und Christen, wie er sich im Wiederspiel von Ortrud und Elsa niederschlägt, zur Grundlage einer Inszenierung machen und den wilden Wotan hier und den – wie gesagt: im Stil von Filmen wie „Ivanhoe, der schwarze Ritter“ erscheinenden – Parzival persönlich aufeinander treffen lassen. Die Brabanter werden in dieser Lesart zu einem Volksstamm, der unzureichend christianisiert wurde und nur durch die Gewalt der deutschen Ritter daran gehindert wird, zu den alten Kulten der „vermoderten Götter“ (O-Ton Wagner) zurückzukehren. Nur dumm, dass das sog. Konzept schon bald nicht mehr funktioniert, weil Wagners Text, sehen wir einmal von der Kleingruppe der vier Edlen ab, blöderweise eine ideologische Einheit von Brabantern und Deutschen behauptet, die auch durch bekannte Regietricks (die Brabanter meinen nicht wirklich das, was sie jubelnd singen, weil ihnen die Deutschen Textblätter in die Hände drücken: billiger geht’s nicht) nicht beseitigt werden kann. Ergo: Die neue Nürnberger Inszenierung ist ein hervorragendes Beispiel für ein absurdes Operntheater, das sich – unbeeindruckt von relevanten Informationen des Textbuchs und, was schlimmer ist, der Musik und ihrer konkreten Motivik – mit Brachialgewalt den Stoff zurichtet.

Zugegeben: eine „stimmige“ Interpretation der Oper, die mit unseren Erfahrungen zu tun hat, ist furchtbar schwer. Die besten Regisseure sind an dieser Oper gescheitert; Hermanns und sein Team aber reduzieren Wagners gewiss nicht einfache, vielleicht, seien wir ehrlich, für uns letzten Endes unverständliche Botschaft auf eine Pointe, die zwar gelegentlich für witzige und gelinde bildmächtige Szenen sorgt, aber leider nichts als gut gemeint ist. Die Buhrufe am Ende waren nur allzu verständlich – die Begeisterung zumal für die Sängerinnen schon etwas weniger. Denn Emily Newton liegt die Partie der Elsa noch nicht so gut in der Kehle, auch wenn man nicht jeden etwas tiefergelegten Ton auf die Goldwaage legen sollte, und Martina Dikes Ortrud zeichnet sich bisweilen durch unschöne Tongebung und undeutliche Artikulation aus. Wo es um die absolute Genauigkeit der Sprache und den Wortsinn geht, ist auch Sangmin Lee als Telramund, zumindest in den schnelleren Passagen, ein problematischer, wenn auch kraftvoll auftretender, dramatisch und dunkel timbrierter Sänger, der wie ein wilder Asiate eine wilde Horde anführt. Daneben glänzt Karl-Heinz Lehner als äußerst profunder König, während Daeho Kim, der wie der kleine Bruder der Turandot auftritt, als Heerrufer gut, aber eben nicht mehr als das ist. Merke: Heerrufer müssen so exzellent sein, dass man sie jederzeit als Hauptrolle wahrnimmt.

Bleibt die Hauptrolle: Eric Laporte ist ein Sänger, der sie tatsächlich ausfüllt. Gesegnet mit einem warmen Tenor, hat er beides im Repertoire: das Heldische und das Lyrische, das Piano und das ausgewogene Forte. Als Typ, der während des Vorspiels in der Gralsrunde steht, wo ihm die Aufgabe erteilt wird, der gerade als Imago erscheinenden Elsa zu Hilfe zu eilen, ist er von Beginn an ein Fremdbestimmter, der am Ende von seinen Genossen mit Gewalt abgeholt wird und der Frau nicht als „Held“, sondern als einer entgegen tritt, der keine Erfahrung mit Frauen hat. Zärtlich: ihr erster Kuss, vor allem Volk. Das ist rührend, auch nicht ganz falsch, zumindest auf einem Niveau psychologisierend, das dem allzu einfachen Konzept des Antagonismus von Heiden- und Christentum etwas Intelligenteres entgegen setzt. Man ist ja inzwischen schon dankbar, wenn Elsa im Brautgemach nicht mit Stromkabeln fixiert wird… Der Rest bleibt Behauptung – und mehr oder weniger amüsantes Kasperletheater. Die zentrale Ortrud-Telramundszene bietet an diesem Abend leider kein wirkliches Gegengewicht.

Gab es sonst noch Schönes? Durchaus. Das Bildkonzept (Jo Schramm) steht zwar quer zum historistisch-modernistischen Kostümbild, um einen symbolistischen und abstrahierten Eklektizismus zu ermöglichen. Die Riesenstäbe, die zunächst wie im Mikadospiel durcheinander stehen, ordnen sich mit dem Auftritt des Supermannes zu regelmäßigen Reihen, die immer wieder, in der Vertikale und der Horizontale, neue Raumstrukturen und -verwandlungen, Reihen und Wände ermöglichen. Die Gralserzählung wird, zum Beispiel, separiert vom Chor gesungen, der übrigens während derselben abgeht (wie gesagt: absurdes Theater). Hier hat der phänomenale, von Tarmo Vaask geleitete Chor genügend Platz, auch wenn mal ein Riesengefährt, auf dem sich Telramund und Ortrud triumphierend positionieren, die Bühne erobert. Endlich steht wieder die GMD Joana Mallwitz am Premierenpult. Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt einen ganz exzellenten Wagner, indem jede „Nebenstimme“ so lebendig aus dem Orchestergewebe heraustönt, wie Wagner es konzipierte. Im Gegensatz zur Regie setzt die orchestrale Interpretation auf eine Genauigkeit, die die großen Bögen mit den kleinteiligsten Phrasen ins Gleichgewicht bringt: sublim die Holzbläser, erhaben die Posaunen, im Ganzen zügig bewegt (typisch: das Brautgemachlied), immer um dramatische Klarheit bemüht. Riesenbeifall für Sänger und Orchester, gemischter Applaus oder eben: auch Nichtapplaus fürs Regieteam, das die Frage, wer denn Lohengrin sei, nicht ganz falsch beantwortete, um sein konzeptionelles Glück denn doch auf eine fixe Idee zu setzen.
Frank Piontek
Fotos: © Bettina Stöß
LAZARUS
Premiere: 2.2. 2019. Besuchte Vorstellung: 26.4. 2019
In der „Walküre“ haben die Helden es noch leicht: Sie fallen im Kampf und werden von der Titelheldin wunschgemäß abgeholt (wenn sie sich nicht weigern wie Siegmund). In „Lazarus“ hat es die der Held gar nicht leicht. Im Gegenteil: Thomas Jerome Newton hat einen zweistündigen Albtraum zu durchleiden, bevor ihm so etwas wie „Erlösung“ zuteil wird.
Wir erinnern uns: Thomas Jerome Newton, so hieß der Alienmensch, der 1976 in Nicolas Roegs genialischem Film „The man who fell to earth“ auf die Erde fiel, um seinen vertrocknenden Heimatplaneten zu retten – und hier unten letzten Endes als Geblendeter zu scheitern. Ein Alien kann sich eben nicht zwanglos an die Erde und ihre Sitten gewöhnen. Newton, das war damals David Bowie, der ein brillanter Maskenträger und Rollenspieler war, sich wohl auch im Alien selber spiegelte. Kurz vor seinem Tod nahm er einen Song auf, der das Musical in nuce enthält: „Lazarus“. Lazarus, das ist der Mann, der zweimal sterben musste, weil er einmal, warum auch immer, von Jesus auferweckt wurde. Im Video sieht man einen geblendeten Mann, gespenstisch hin- und herzuckend auf seinem Totenbett; Bowie wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. 2015 kam auch beim New Yorker Theatre Workshop sein einziges Musical heraus – natürlich nicht am Broadway, sondern am Off-Broadway, denn Bowies Musik ist gewiss nichts für die sog. Breite Masse.
Am Abend verlassen einige wenige Zuschauer die Vorstellung, vermutlich, weil sie Bowies Musik nicht kannten, die, wie die Geschichte, die sich der Dramaturgie einer linearen Erzählung verweigert, mit der gängigen Musical-Ästhetik der Gegenwart wenig zu tun hat. Bowies Musik ist originell, schräg, oft dunkel, harmonisch interessant, gelegentlich auch im bürgerlichen Sinne schön, an diesem Abend auch erstklassig instrumentiert und interpretiert.

„Lazarus“ ist eine Art Fortsetzung des Films von 1976, bewegt sich aber in den Sphären eines traumatischen Nahtoderlebnisses. Figuren aus dem irdischen Leben Newtons erscheinen ihm wie Wiedergänger, ein Mädchen namens Marley, das von Pauline Kästner stimmstark, -schön und schauspielerisch wendig gespielt wird (wir sitzen in einer Aufführung des Staatstheaters, nicht der Staatsoper), soll dem Mann, der nur noch sterben will, die „Erlösung“ verheißen, obwohl sie tot zu sein scheint, der Serienkiller Valentine – höchst „cool“ und kompromisslos gespielt und gesungen vom famosen Nicolas Frederick Djuren, bedroht am Ende auch Newton, nachdem er sich an einem alten Mann (Frank Damerius spielt diesen Michael) und einem futuristischen Musikpärchen (Anna Klimovitskaya und Yascha Finn Nolting als hipplackiertes Superpaar Maemi und Ben) würgend und genickbrechend gütlich tat. Ein Höhepunkt der Aufführung, die zwischen einer Show, einem Schauspiel mit Musik und einer unorthodoxen Revue hin- und herchangiert: wenn Valentine als Bowie-look-alike vom Himmel schwebt und auf Newton zu liegen kommt, um ihm am aggressiven Ende von „Valentine's day“ lautstark an die Gurgel zu gehen.

„Lazarus“ gruppiert sich um 17 Songs aus Bowies Gesamtwerk, in dem „Heroes“ und „Absolute Beginners“ nicht fehlen, und das doch vom Willen der Autoren, auch des Librettisten Enda Walsh beseelt ist, wesentlich mehr zu bieten als ein Pasticcio populärer Nummern. Es gelang – und dies auch, weil die Inszenierung von Tilo Nest, im Dauerdampf des fleißig hereingeblasenen Bühnennebels, einerseits viele starke Bilder zeigt, andererseits Raum lässt, um die Fragen, um die Bowie in seinen letzten Jahren kreiste, immer wieder zu beleuchten: Warum wurden wir geboren? Wie hältst du es mit Deinem „guten Tod“? Was bist du im Kosmos? Wohin und wie willst du einmal „zurückkehren“? Die Aufführung gibt, naturgemäß, darauf keine – oder doch nur andeutende Antworten, denn jeder stirbt bekanntlich allein.
Sascha Tuxhorn spielt diesen mit seinen schrecklichen Visionen ringenden, zunächst nur gintrinkenden und auf der Parkbank sitzenden, „traurigen und unnahbaren“, dann von seinen Ängsten und Sehnsüchten panisch aufgepeitschten Sterbenden mit Inbrunst, durchaus ohne Erinnerung an den realen Bowie, was die Interpretation von der in anderen Produktionen unterscheidet, es sei denn, man nähme seine wohl absichtlich undeutliche Aussprache als Hommage an Bowies eigentümliche Sprechweise. Die beeindruckendsten Soli singen daneben Djuren, Kästner (ganz wunderbar: ihr lyrisches wie genrehaftes „Life on Mars“) und Lea Sophie Salfeld. Sie spielt Elly, die Frau, die auch „nur“ einen großen Sack voll Liebe sucht, privat und beruflich gescheitert ist und sich in einer verzweifelten wie grotesken Aktion als blauhaarige Marie-Lou verkleidet, um ihrem Pflegefall Newton nahe zu sein. Ansonsten begegnen uns seltsame Rituale der Solidarität: wenn Newton hinfällt, fallen auch die Statisten zu Boden, die zugleich die Musiker und die anderen Spieler sind – und der Gewalt: die drei „Teenage Girls“, die zunächst als rhythmisch nickende Electro-Pop-Ikonen in Rot über die Bühne marschieren und den Helden durch den Abend begleiten, richten in „Killing a little time“ eine Windkanone auf Newton, während sie sein Videobild live auf die Bühne und deren Rand projizieren.

Die Ästhetik des Bühnenbilds (Stefan Heyne), der Kostüme (Anne Buffetrille) und des Lichts (Tobias Krauß) steht immer wieder quer zu den scheinbar vertrauten Klängen, die hier zu den 60ern grüßen („Changes“), dort ein wildes Posaunen-Solo im angedeuteten Fluxus-Stil entbinden („Dirty boys“). Sie machen den Abend auch für den auf Innovationen erpichten Opernfreund zu einem gelungenen. Hinreißend die Posaune (Denis Cuní Rodriguez), wunderbar sonor das Saxophon (Martin Krechlak), souverän das Soloklavier (Kostia Rapoport) – und schön, dass „die Band“ nicht im Hintergrund ihr Ding machte, sondern als integraler Bestandteil der Inszenierung buchstäblich mitspielte: auch im zentralen Bühnenelement, einem runden offenen Turm, der irgendwo dort oben endet, von wo Newton einst herkam, und der auf der oft in Bewegung gebrachten Bühne über dem Partykeller steht, wo einmal, wenigstens einmal, der Bär steppt, in dessen Kinderkostüm sie, das Mädchen, die „Erlöserin“, der Traum und zugleich die Erinnerung an die Frau steckt, die damals ermordet wurde: was ihr offensichtlich ein längeres Traumleben im Hirn des an sich und der Welt dahinsterbenden Newton garantiert und den Wagnerianer daran erinnert, dass Tristan sich im letzten Akt den Auftritt seiner Geliebten vielleicht auch nur imaginiert (wie Jean-Pierre Ponnelle es in Bayreuth inszenierte).

Beginnt der Abend mit dem stummen und wiederholten Auftritt trenchcoatiger Rollkofferschieber, die an eines von Bowies markantesten Kostümen erinnern, endet er mit dem in Stummheit daliegenden, nun endlich gestorbenen (??) Newton. In zwei pausenlosen Stunden zieht ein bildmächtiges Schauspiel mit sehr viel Musik und symbolischen wie konkreten Bildern an uns vorüber, in dem viel Platz ist für Panik und Poesie, Lyrik und verzweifelter „Liebe“ (Bowie mochte das Wort nicht besonders), Krankheit und grotesker Komik.
Also fast wie in einer gelungenen „Walküre“.
Frank Piontek, 27.4.2019
Fotos: © Konrad Fersterer
KYLIÁN / GOECKE / MONTERO
Premiere: 13.4. 2019
Worum geht's? Um einen Begriff, der seit etlichen Jahren für erregte Diskussionen sorgt: um „Gender“. Was er objektiv bedeutet, scheint den Diskutanten und Diskutantinnen unklar zu sein; Streitigkeiten über die Relevanz von Streitigkeiten über eben jenen Begriff und seine gesellschaftlich-sexuell-moralischen Auslegungen gehören offensichtlich zur Sache. Wenn Männer zusammen mit Frauen tanzen, haben wir es mit einer getanzten diskursiven Auseinandersetzung zu tun - vielleicht selbst dann, wenn wir so etwas (scheinbar!) Simples wie einen traditionellen „Schwanensee“ oder eine „Giselle“ betrachten, denn die Frage, wie sich Mann und Frau im Rahmen der gesellschaftlichen Konvention verhalten, wurde ja auch dort verhandelt, wo der Begriff noch gänzlich unbekannt war. Insofern könnte man es (fast) für einen Trick halten, drei unterschiedliche Choreographien dreier Choreographen, die gänzlich verschiedene Hand- und Fußschriften ihr eigen nennen, unter dem Oberthema „Gender“ zu vereinigen.

Tatsächlich ist der Fall etwas einfacher - und etwas komplizierter. Denn in der Konfrontation einer neuen Arbeit des Nürnberger Compagniechefs und Bühnzauberers Goyo Montero mit zwei älteren Arbeiten zweier renommierter Kollegen hat man auf ein so einfaches wie differenziertes Konzept gesetzt. Marco Goecke arbeitete mit gemischten Paaren, Jiri Kylián mit einer Schar von Frauen, und Montero liess eine reine Männergruppe auf die Bühne. Zusammen ergibt das ein stark kontrastives Terzett, in dem der Blick auf die Geschlechter jeweils andere Perspektiven erlaubt - und dies schon durch die pure Lichtregie: Stehen die scheintätowierten Tänzerinnen und Tänzer in Goeckes "Thin Skin" in einem kalten, meist blauen Licht, so hat Kylián seine Frauencompagnie in einen warmen Ton getaucht. Bei Montero gibt es, man erwartet es, alles: kühle Nachtfarben, glühendes Rot und schwarze, nur von schwachem Seitenlicht beleuchtete Finsternis. Montero ist, und wieder wundert man sich nicht, der einzige Choreograph, der seinen Tänzern den Ab- und Aufstieg in die Vertikale erlaubt: Vom Gleiten in einem Geburtskanal zu einer wie auch immer deutbaren Auferstehung. Die Musik markiert den nächsten Unterschied: Goecke kreierte ein Patti-Smith-Ballett, Kylián peitscht uns mit einem Perkussionsstück des Minimalisten Steve Reich fast in die Trance - und Montero bringt neben seinem Lieblings-Original-Komponisten Owen Belton Kompositionen von Jethro Tull, Miguel Poveda und Lou Reed. Sehr anders sind, natürlich, bereits die Gesten, auch wenn plötzlich Ähnlichkeiten ins Auge fallen: Goeckes Figuren bewegen sich so zackig wie, in aller Radikalität, auf seltsame Weise elegant über die Bühne, Kyliáns Frauen agieren so weich wie das Licht, das sie einhüllt und vorzüglich beleuchtet, Monteros Menschen bieten eine ganze Enzyklopädie von Bewegungsrhythmen auf.

Der einzige relevante Unterschied aber wird auf der Ebene der Kommunikation und der Emotion gestiftet: Goeckes Tänzerinnen und Tänzer bieten - zumindest nach meiner Meinung - wenig mehr als autistische Exercises auf hohem technischen Niveau, mag auch die Dramaturgenlyrik der Alexandra Karabelas im (ausgezeichneten) Programmheft davon schwärmen, dass Goecke sich „um UNS: um sein Publikum und um jene Menschen kümmert, die für uns und ihn gerade tanzen“. Tatsächlich zeigt die Wortwahl unbewusst an, dass es bei Goecke nicht um das zweite wesentliche Element geht: denn nur Tänzer, die sich bewusst sind, dass es (auch) um sie geht, können UNS vermitteln, dass sie eben für uns tanzen. Der Unterschied zu Monteros Choreographien, in denen das Verhältnis von Kollektiv und Individuum in jedem Moment ein lebendiges ist, macht klar, dass Goeckes Kunstfiguren mit ihren aus Abstraktion und einer seltsamen Heftigkeit gewirkten Körperfiguren einsame Gestalten sind - selbst dann, wenn sie nebeneinander stehen und parallele Gesten exekutieren. Die Musik der Patti Smith ist wenig geeignet, diesen Eindruck zu relativieren, mag man auch fasziniert sein von den Bewegungen des Wedelns, Schiebens, Klapperns, Schaufelns undundund. Nach einer Viertelstunde hat sich, aber das ist nur meine Meinung, der Reiz erschöpft.
Auch bei Kylián und seinen „Falling Agels“ spielt die Frage, wie sich das Individuum - in diesem Fall: die Frau im Zeitalter einer nicht gänzlich gelungenen Emanzipation - zu ihren Kolleginnen ins Verhältnis setzt. Kylián holt immer wieder aus seiner acht Tänzerinnen umfassenden Truppe eine heraus, stellt sie vor die Anderen, lässt sie als "Vortänzerin" ihre Soli machen, ohne dass man und Frau den Eindruck hätte, dass es hier um Einsamkeit und Autismus ginge. Im Gegensatz zu Goeckes Choreographie bewegt sich Kyliáns Arbeit passgenau auf den Grundrhythmus von Steve Reichs „Drumming“. Die Tänzerinnen arbeiten auch - und auch dies begegnet bei Kylián - mimisch, die Gesichter werden eingerahmt und verdeckt, die Frauen gehen zu Boden und versuchen sich zu erheben: ein Versuch, gesellschaftliche Rollenmuster mit dem Schein einer Turnstunde in Einklang zu bringen; der Versuch gelingt auf beeindruckende Weise.

Schliesslich Monteros „M“: ein erzählender Essay über die „Männlichkeit“, wieder ausgestattet mit komponierten Gedichten, diesmal mit zwei Texten des großen spanischen Lyrikers Federico Garcia Lorca und einem Song von Lou Reed. Männer werden als „Falling Angels“ auf die Welt geworfen, üben sich in kraftstrotzend-vitalen Ritualen - zu denen Jethro Tulls fröhliche Musik hervorragend passt -, geraten in Krisen (die inneren Einschläge kommen akustisch und körperlich beängstigend nah), die (Homo)-Sexualität gerät ins Blickfeld einer intoleranten Gesellschaft, die Gruppen formieren sich immer wieder neu - und schliesslich entfliegen die Männer in einem Coup de theatre gen Himmel: als aufsteigende Engel? Als "Erlöste"? Als Träumer? Vorher hörten wir so etwas wie einen fernen gregorianischen Choral...
Wieder hat uns Montero durch neue Bilder überrascht und verzaubert: Die wilde Horde in Blutrot, die Ascensione: so haben wir das noch nicht gesehen. Was bleibt, wird vielleicht eine bewegende, auch bewegend musikalisierte Zeile von Lou Reed sein: „Looking for a Kiss“.
Der Beifall des Publikums für die brillanten Tänzer und Tänzerinnen klang, nach jedem Teil, wie eine lange, leidenschaftliche Umarmung.
Frank Piontek, 15.4.2019
Fotos: © Jesus Vallinas
MADAMA BUTTERFLY
Premiere: 23.3.2019
Besuchte Vorstellung: 8.4.2019
Gibt es eigentlich immer noch Kritiker und Opernbesucher, die Puccini, besonders aber „Madama Butterfly“ für kitschig halten? Vermutlich, denn sonst wären nicht im hinteren Parkettbereich der Nürnberger Oper – zugegeben: an einem Montagabend – sichtbar viele Plätze freigeblieben. An der Produktion kann's nicht liegen, obwohl sich, vielleicht, manch Butterfly-Freund von den Szenenbildern abgestoßen fühlte, die seit der Premiere der Neuinszenierung veröffentlicht wurden. Kein Grund zur Panik: Weder für „Opernfreunde“ noch für „Opernfeinde“. Dazu genügt es zunächst, eine dezidierte Meinung zu Puccinis Meisterwerk zu zitieren. Kürzlich erschien nämlich ein entzückendes Miniaturbüchlein mit dem Titel „In der Oper mit Donna Leon“. Frau Leon schreibt bekanntlich nicht nur Venedig-Krimis, sondern auch kundige Essays über die Gattung Oper, besonders über den (zurecht) geliebten Händel. Im Bändchen finden wir nun den hübschen kleinen Text „Drei Operntipps für Einsteiger“. Wir können da Folgendes lesen: „Puccinis 'Madame Butterfly' ist der Coupe Dänemark der Oper: Etwa alle zehn Jahre einmal schlage ich mir mit diesem üppigen Melodram den Magen voll, einer wahren Kalorienbombe. (…) Die Ästhetin in mir bekommt zwar jedes Mal Gallenschmerzen, doch ich koste das Ganze immer bis zum letzten Löffel aus. Nach der Vorstellung schwöre ich jedes mal, nie wieder schwach zu werden. Doch ich kann einfach nicht widerstehen.“

Wer sich die Neuinszenierung von Tina Lanik anschaut, dürfte, wenn man die Aufführung nur optisch betrachtet, kaum auf den Gedanken kommen, es bei „Madama Butterfly“ mit einem „Coupe Dänemark der Oper“ zu tun zu haben. Nürnberg ist weder Verona noch Mailand, auch kein Fernsehstudio der frühen 70er Jahre (nichts gegen Mailand, Verona und den TV-Film mit der Freni und Domingo!). In Nürnberg steht mit der dramatisch höchst bewegten (und bewegenden) Emily Newton eine herbe, ganz und gar nicht folkloristische Cio-Cio-San auf der Bühne, die zusammen mit der Regisseurin eine Butterfly entdeckt hat, deren Probleme in einem Kulturkonflikt begründet liegen, in dem die japanischen Elemente zwar deutlich sichtbar sind, doch die Erinnerung an irgend einen Exotismus kaum aufkommen lassen. Im Gegenteil: Wenn sich die verheiratete Frau - die, das ist ihr Missverständnis, in Windeseile aus ihrer angestammten Kultur herausspringen will, als ob sie es angesichts der Wirklichkeit könnte - schon während des Liebesduetts (JA, LIEBE IDEOLOGIEKRITiKERINNEN: ES IST EINES) entkleidet, um ein schon darunter getragenes nüchtern-langweiliges West- und Alltagsoutfit sichtbar zu machen, wird klar, was gemeint ist: übertragbar auf alle Kontinente, auf denen es Sexsklavinnen und Sextouristen gibt. Was, im Sinne des Komponisten und seiner Librettisten, fremd ist, bleibt jedoch fremd. Interessanterweise ist es Suzuki, also die vokal und gestisch enorm beeindruckende Almerija Delic, die die eigentliche optische Exotik ins Spiel bringt. Weniger „Kammerzofe“ als Schutzgeist, mehr Repräsentanz einer weiblichen Priesterschaft als ängstliches Wesen, im Ganzen eine Begleiterin der Tragödienheldin, die, wie im griechischen Trauerspiel, nur zuschauen und kommentieren, nicht helfen kann. Wenn sie den Kuppler und Verleumder Goro (mit seinem auch symbolisch zu verstehenden Haustier namens Leguan haftet ihm, gespielt von Hans Kittelmann, tatsächlich etwas Krötenhaftes an) zu Boden schlägt, ahnen wir, welche tigerhaften Kräfte hinter dieser beeindruckenden Frau stecken. Und wenn Wonyong Kang als „Onkel Bonze“ die Verwandte verflucht, indem er wie ein Totengeist im theatralischen Schauerlicht steht und einen dämonischen Schatten wirft (man merkt die Absicht und ist nicht verstimmt), registriert man mit Vergnügen, dass Beides zusammen geht: die nüchterne Deutung eines fast abstrakt betrachteten „clash of cultures“ und die fantasievolle Nachschöpfung einer originalen, in einem mit von Stefan Hageneier entworfenen, obligatorischen Schiebewänden ausgestatteten Einheitsraum spielenden „Butterfly“.

Original? Man spielt in Nürnberg Puccinis letzte Fassung, also keine der ersten drei oder gar sechs, wenn man es sehr genau nimmt und die Zählung der einzelnen Versionen auf die Spitze treibt. Was Puccini in seiner schließlich durchgesetzten Schlussversion dem Konflikt an Schärfe und seinem traurigen „Helden“ Pinkerton an Arroganz nahm, ersetzte er bekanntlich durch ein wenig mehr Weichheit, auch durch die Arietta „Addio fiorito asil“. Nein, ein echter Opernfreund kann und will, nur weil die erste oder zweite Version „härter“, ja „realistischer“ ist (Oper ist nie realistisch), nicht auf so eine melodisch-harmonische Perle verzichten. Schließlich sorgt die Inszenierung dafür, dass die Aussage deutlich genug ist: Pinkerton tritt, wie man's gewohnt ist, als Kolonialherr auf, er schaut sich, als distanzierter Zuschauer, zunächst die „Show“ an, die Freundinnen Butterflys gerinnen unter der Regie des schmierigen Kupplers zum Standbild – mann könnte sich ja auch noch eine andere der halbnackten, präsentierte Frauen ins Bett holen -, er flätzt sich, er macht, im wahrsten Sinn des Wortes, „auf dicke Hose“ - aber dann geschieht ein Wunder. Es ist das Wunder der Musik, dem sich die kluge Regisseurin nicht entgegenstellen wollte noch konnte. Denn Pinkerton wird umso lyrischer und zärtlicher, je westlich-normal-durchschnittlicher die gekaufte Frau aussieht. Ja, er glaubt in diesem längsten aller Liebsduette Puccinis wirklich, was er sagt: „Sì, per la vita.“ Wir sehen es, die Regie denunziert ihn nicht. Nur so wird verständlich, wieso wir ihm im letzten Akt den labilen Ex-Liebhaber abnehmen. Und nur so verstehen wir, wieso Miss B.F. Pinkerton nicht den stimmlich und optisch ansehnlichen Fürsten Yamadori (Denis Milo) heiratet.

Nein, mit „Kitsch“ hat das, selbst wenn wir's rein musikalisch betrachten, nichts zu tun. Natürlich hören wir diese seltsamen, weil unbeabsichtigen Lehar-Anklänge (oder gibt es bei Lehar nicht eher Puccini-Zitate??), doch immer wieder vernehmen wir, dass Puccini ein eminenter Wagnerverehrer und -kenner war. Oft schimmert in fahlsten Farben die „Götterdämmerung“ hinein: Weltende, Abschiedsstimmung, und es stimmt ja: mit der „Kreuzigung“ der Frau (wie Raina Kabaivanska die Handlung der Oper einmal beschrieb) bewegen wir uns – was für eine einfache wie geniale Musikdramaturgie! - klanglich von der flirrendsten Leichtigkeit in die dunkelsten Regionen des Todes. Emily Newton spielt, begleitet von der eher mythisch und religiös aufgeladenen Suzuki der Almerija Delic, eine zutiefst menschliche und ergreifende Opferfigur, die auch deshalb so grausam scheitert, weil die Regie in ihr wesentlich mehr sieht als die traditionelle, weißgeschminkte und, zugegeben, ganz anders bewegende Femme fragile. Für diese Menschlichkeit sorgt freilich auch die fundamentale Mutter-Kind-Beziehung; schlichtweg entzückend ist die kleine Anastasia Heinz, die das Frauenpaar durch den letzten langen Todesakt begleitet. Und wenn der exzellente Sangmin Lee als Sharpless in der unvergleichlich beklemmenden Briefszene bei jedem Opernbesucher und jeder noch nicht ganz verhärteten Opernbesucherin mit dafür sorgt, dass die Augen feucht werden, bevor Cio-Cio-Sans tragische Heiterkeit und das Blumenduett für neue Erschütterungen sorgen, hat die Oper ihr Ziel erreicht. Nicht nur der erfahrene Opernfreund und die -freundin haben übrigens geweint. Selbst bei einigen Vertreterinnen der Generation Handy konnte man nach dem Ende des 1. Akts Tränenspuren glitzern sehen. Gut so – denn so wird es, hoffentlich, auch mit der Opernwelt und dem Publikum der nächsten Gegenwart weitergehen. Muss ja nicht jede Opernbesucherin so offensiv kühlherzig und versnobt auftreten wie die von ihrer Klasse zum coolen Weibchen verschandelte Kate, die von Katrin Heles nahe an eine Karikatur geführt wird. Aber solche „Tussis“ mag es geben: Das Kind mit Gewalt von der gerade gestorbenen Mutter fortzuziehen ist nicht schön, aber theatralisch wirksam – und passend zur unaufgelösten Dissonanz des Schlussakkords.

Bleibt die männliche Hauptrolle: Tadeusz Szlenkler. Für ihn gilt das Gleiche wie für die Staatsphilharmonie Nürnberg unter Björn Huestege: Weniger wäre mehr. Er müsste gar nicht so viel Dynamik geben, um sein Ziel zu erreichen. Wieso vertraut er nicht seinem schönen, auf den Lagrimoso-Ton eingestimmten Tenor? Wieso muss er ins Publikum singen, als säßen dort unten lauter Schwerhörige? Weil das Orchester an vielen Stellen viel zu laut spielt? Dass es Puccinis subtile Farbmischungen so gut kann wie die dramatischen Entwicklungen und Eruptionen, dass sich der Zuhörer innerlich zurücklehnen kann, wenn die Terzen glänzen, bevor die Schlagzeuger und das tiefe Blech für die nächsten Schocks sorge: Wir wüssten es auch dann, wenn es 10 bis 20 Prozent weniger an Lautstärke gäbe. Ich bin sicher, dass sich auch der wie immer formidable Chor (unter seinem Leiter Tarmo Vaask) darüber freuen würde.

Ps.: Der Opernfreund empfiehlt, soweit es die Verfilmung der Oper betrifft, Frédéric Mitterands kongeniale, als DVD leider vergriffene Umsetzung aus dem Jahr 1995 mit einer anrührenden Ying Huang als aufgespießte Schmetterlingsfrau: https://www.youtube.com/watch?v=V7SlRuZln0s
Frank Piontek, 9.4.2019
Fotos: © Ludwig Olah
(Die Fotos zeigen nicht Emily Newton, sondern Barno Ismatullaeva als Cio-Cio-San).
RUSALKA, MEERJUNGFRAU
Premiere: 3.2.2019
Besuchte Vorstellung; 1.4.2019
Eine Krake war erst kürzlich auf der Nürnberger Opernbühne zu sehen: in „Idomeneo“. Da opferte das Volk von Kreta dem Untier in einem barbarischen Akt so allerlei. Diesmal ist die Krake eine gute: denn wir befinden uns in einer Kinderoper.
Konzipiert hat sie die Dramaturgin Wiebke Hetmanek zusammen mit dem Musiker Samuel Bächli und der Regisseuse Ilara Lanzino. Die Oper heißt auch nicht einfach „Rusalka“, sondern „Rusalka oder Wie angel ich mir einen Prinzen?“ Eigentlich ist es ja der Prinz, der auf dem Steg sitzt und angelt, aber die Metapher passt schon.

Die – im übrigen schon von Anfang und dann immer stumme – Meerjungfrau neckt den Angler, hängt jeden Tag etwas Anderes an seinen Haken – zum Beispiel eine wertvolle Muschel, wofür es als Gegengabe einen silbernen Armreif gibt – und sorgt zügig dafür, dass sich der junge Mann in sie verliebt. Die Musik dazu ist von Dvořák, aber wir hören außer ein paar charakteristischen Ausschnitten aus der Opernpartitur noch ein paar Slawische Tänze – denn die Jungfrau, die, wie gesagt, niemals singt oder gar spricht, liebt es, kindgerecht-schwungvolle Choreographien von Ingo Schweiger (der auch die Krake namens Chobot pantomimisiert) zu tanzen. Daneben gibt es ein Scherzo aus der 8. Symphonie (zu dem Rusalka und der Wassermann tanzen) und ein Zitat aus dem „Siegfried“. Wenn die Hexe den Zauber an Rusalka ins Werk setzt, der sie zu einem Menschen machen soll, erklingt plötzlich Siegfrieds musikalische Visitenkarte. Ich habe zwar ebenso wenig wie die Kinder in dieser Kindervorstellung verstanden, was dieses Wagnersche Einsprengsel aus dem tiefen deutschen Wald soll, aber egal: den Kindern hat der Zauberspuk offensichtlich Spaß gemacht. Und auch das schreckliche Verzischen der Hexe im Kunstnebel und Getöse der stroboskopischen Bühnentechnik: Das gab ein Gejohle!

Die Hexe, ein „Feuerwesen“, wie der Wassermann ganz richtig bemerkt, aber ist ein Feuerwesen, eine schicke Dame. Originell: Bei Dvořák gibt es die „Fremde Fürstin“, die sich den Prinzen angeln will, in der Kinderoper ist die Konkurrentin keine Andere als die Hexe selbst, die mit ihrem feuerroten Regenschirm in der Gegend herumzaubert und einen Zaubertrank als Cocktail kredenzt. „Das ist die Falsche!“, ruft eines der Kinder, als die Dame sich den Prinzen schnappt, der partout nicht kapiert, dass er gerade die echte mit einer falschen Rusalka verwechselt. Dummer Prinz! Aber so sind sie eben, die Männer. Wäre nicht die Krake, die die Hexe und ihren Galan im Verführungsspiel zu stören weiß, wäre der Junge schon früher den Reizen der Hexe erlegen. So aber braucht es die List: erst, als die Hexe, die „spitzzüngige Zauberzicke“, im Wasser verzischt, während Rusalka sich in ihrem Element wohlfühlt, kapiert der junge Mann, mit wem er es zu tun hatte. Und anders als bei Dvořák siegt natürlich das Gute über das bzw. die Böse. Und auf der Bühne, die Emine Güner entworfen hat, gibt es etwas, was es nur noch in tschechischen Freilicht- oder in Off-Bühnen wie der Pasinger Fabrik zu sehen gibt: Anmutungen von Natur, also eine Unterwasserszenerie samt Rusalkafelsen und Wasserwellen (belichtet von
Frank Laubenheimer).
Zwischendurch gab's, um das jugendliche Publikum am Spiel zu beteiligen, einen Crahkurs in „Etikette“. Immerhin hat der Wassermann, verkleidet als Kammerzofe, der Kleinen schon mal gezeigt, wie man, richtiger: Frau einen Rock und ein Oberteil anzuziehen hat. Jetzt fehlen nur noch die korrekten Begrüßungsformen; das ganze Auditorium darf aufstehen und sich üben: unter der Leitung des Wassermanns, der alles hat, was sich ein Kind beim Wassermann vorstellen könnte: ein Matrosenhemd, eine Seifenblasenpfeife und Schwimmflossen. Nett. Dafür steht Sebastian Häupler vom Staatstheater auf der Bühne. Die Meerjungfrau ist Aoi Nishikawa, die schicke Hexe Katrin Heles, wie der tenoral höchst erfreuliche Prinz des Michael Fischer ein Mitglied des Nürnberger Opernstudios. Francesco Greco leitete das kleine Kammerensemble, Klavier, Geige, aber auch Bassklarinette, das sich zwischendurch in ein Strandorchesterchen (Sonnenhut und -brille) verwandelt. Für die Großen gab es eine interessante Variante der Dreiecks- bzw. Vierecksgeschichte, für die Kleinen die Begegnung mit einer musikalischen Sage samt schöner Musik, die immer noch nicht zu Ende erzählt ist. Der Beifall war jedenfalls enorm.
Frank Piontek, 1.4.2019
Fotos © Pedro Malinowski
NORMA
am 17.3.2019
mit Meistersingerin
TRAILER

Dieses herrliche gallisch-römische Epos mit der süchtig machenden Musik des Sizilianers Vincenzo Bellini – dem Novalis unter den Komponisten – steht ja leider viel zu selten auf den Spielplänen, überhaupt nördlich der Alpen. Und der Ausflug nach Franken, in die Meistersinger Stadt lohnte sich absolut.
Eine wirkliche Meistersingerin war für die Titelpartie aufgeboten: Ytian Luan aus China, die im letzten Jahr bereits als Lucrezia Borgia und Anna Bolena am Landestheater Niederbayern überzeugte, sich auch nicht zu schade ist, zuletzt im Müpa in Budapest di Mi im Land des Lächelns zu übernehmen, und der man nach dieser Leistung jetzt getrost eine steile Karriere voraus sagen kann. Es war erst ihre dritte Norma-Vorstellung an diesem Abend – und die war so sicher, so überzeugend interpretiert wie wenn sie schon etliche Produktionen bestritten hätte. Das bezog sich nicht nur auf Ihre Bühnenpräsenz – sobald sie auftritt ist sie da, zieht in ihren Bann, erzeugt Spannung – sondern auch auf ihre raffinierte musikalische Gestaltung.

Schon das große erste Recitativo wird gestaltet, modelliert, zeugt von Verständnis und Rollenidentifikation. Die casta diva erklingt behutsam im piano, mit gut geführtem langem Atem und vielen Schattierungen, während sie bei der Cabaletta so richtig auftrumpft, und das C bombensicher im Haus steht. Ja und so geht’s weiter, über die berührende Szene mit den figli, mit den großen Duetten, dem Furor, wenn sie den treuelosen Pollione entdeckt, und ihre Hingabe im Finale, wo einem schon die Tränen aufsteigen. Ihr Sopran verfügt über die Leuchtkraft, Flexibilität und viele Schattierungen, weiters hat sie Italianitá und große Musikalität auf ihrer Habenseite. Eine exzellente, stark bejubelte Leistung!
Und mit Freude kann ich auch von der Adalgisa berichten: Almerija Delic bringt die positive sympathische Ausstrahlung für die Adalgisa mit und überrascht mit einem voluminösen Mezzo – Gott sei Dank wurde hier nicht der aktuellen Mode gefrönt und diese Partie mit einem leichten Sopran besetzt! Passend zu ihrer Stimme spielt sie die verführte Priesterin nicht als „Hascherl“, sondern als attraktive junge Frau, die getäuscht wurde. Voll strömt ihr Mezzo, den sie auch wunderbar zurücknehmen kann und singt schöne Kantilenen. Ohne zu „drücken“ oder abdunkeln zu müssen steuert sie klangschöne tiefe Passagen bei.

Und nach oben sind im forte, das fast hochdramatisch klingt, ebenfalls keine Grenzen zu orten. Da bietet sich ein breites Betätigungsfeld für die aus Bosnien gebürtige und in Essen – und kurzzeitig auch in Graz – studiert habende Mezzosopranistin an, die nach Dortmund nun hier in Nürnberg im Ensemble ist und in der neuen Butterfly die Suzuki sein wird. Aber in der Ferne läßt da schon Amneris und ähnliches grüßen. Glücklich ein Haus mit solch einer vocone im Ensemble!
Schon der Beginn war erfreulich, als Orovesos Eingangsszene mit dem Chor durch die voll strömende Stimme des Litauers Tadas Girininkas das ihr zustehende Gewicht bekam. Mit markantem „basso profondo“ und einer imposanten Bühnenerscheinung verlieh er dieser Vaterrolle Würde und Präsenz, was nicht jedem Oroveso so selbstverständlich gelingt.
Für den vorgesehenen, aber kurzfristig erkrankten Pollione wurde in letzter Minute aus dem Ulmer Ensemble Joska Lehtinen geholt, der sich gut aus der Affäre zog, wenngleich sein eher heller, manchmal ein wenig greller, zwar durchschlagskräftiger Tenor nicht unbedingt in dieser Partie am Besten aufgehoben scheint. Er meisterte diese sicher nicht einfache Aufgabe aber trotzdem sehr anständig und lieferte alle geschriebenen Noten ab, inclusive dem – notierten , aber auch von berühmteren Kollegen ausgelassenen – C mitten in der Arie.

Es komplettierten Nayun Lea Kim als Clotilde und Chang Liu als Flavio: beide mit angenehmen Stimmen, gut einstudiert und beide im Opernstudio, wo sie von niemand Geringerem als Siegfried Jerusalem betreut werden.
Ausgezeichnet der Chor unter Tarmo Vaask und auch die Staatsphilharmonie Nürnberg, die echte Italianitá hören ließ und offenkundig mit großer Freude musizierte. Ein weiterer Pluspunkt des Abends war Björn Huestege am Pult: von der ersten Attacke an konnte er einen Bogen spannen, ließ die Bellinische Partitur mit Brio funkeln und leuchten und war ein auf alle Eventualitäten immer rasch reagierender Koordinator und Mitatmer mit den Solisten!
Die Produktion hatte in Nürnberg im Mai 2017 Premiere und ist eine Co-Produktion mit St. Etienne und dem Theatre des Champs-Elysees. Das quasi Einheitsbühnenbild war immerhin akustikfreundlich, ein grauer Steinrahmen war prägend, in der Mitte eine grosse drehbare Wand – für Auftritte nutzbar, ein Bäumchen, das auf den Souffleurkasten gestellt wurde; nur im Schlußbild dann ein großer, ausladender Baum bot eine optisch ansprechende Szene dann.

Pollione im Anzug kommt zum Duett mit Adalgisa als Rosenkavalier mit einem Strauss roter Rosen, die er dann mal zornig auf den Boden wirft, Flavio fuchtelt während seiner Szene mit einem Revolver herum, die Damen alle in blauen Kleidern - Choristinnen und Norma und Adalgisa, nur Clotilde im kleinen Schwarzen; ein lächerliches Hüftschwingen der Chor -Damen zweimal – das wär nicht mal bei einer Fasnachtsitzung gut angekommen. Na ja, ansonsten wenigstens nichts, was besonders gestört hätte. Stephane Braunschweig führte Regie und zeichnete fürs Bühnenbild verantwortlich, Thibault Vancraenenbroeck für die Kostüme, und Johanne Saunier für die sogenannte Choreographie.
Großer Jubel des Publikums, erfreulich viele jüngere Personen inclusive, für die Protagonisten und den Maestro. Eindeutig hieß es prima la musica –dopo gli attori – dopo la scena!
Michael Tanzler 21.3.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online Wien
Fotos (c) Staatstheater Nürnberg / Jutta Missbach
BALL IM SAVOY
Premiere: 19.1.2019
Wer als Operettenfreund den Blick in Richtung Metropolregion Nürnberg lenkt, könnte den Eindruck haben, dass gerade eine Paul-Abraham-Renaissance im Gang ist. In Hof kam Mitte Dezember „Viktoria und ihr Husar“ auf die Bühne, gestern abend erlebten wir den „Ball im Savoy“ im Nürnberger Staatstheater. Mit Blick auf die Operetten-Ausgrabungen der letzten Jahre, die sich vor allem den Werken der 20er und frühen 30er Jahre gewidmet haben (erst Anfang der Woche konnte man Oscar Straus' „Eine Frau, die weiß, was sie will“ in der kongenialen Interpretation der Komischen Oper Berlin erleben), handelt es sich dabei jedoch um etwas Größeres. Im Programmheft der Nürnberger Aufführung – übrigens der lokalen Erstaufführung – wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Operetten der 20er Jahre erst in den letzten Jahren wieder so auf die Bühne kamen, wie es sich die Macher einst vorstellten: im Soundgewand des adaptierten Jazz, im Revueton der 20er, also nicht in jenem Stil, der von den Nazis als „deutsch“ definiert wurde und bis weit in die Nachkriegszeit für den Ruf der Gattung sorgte: das Ganze sei doch nur für Oma und Opa interessant. Auch „Das weiße Rössl“ klang einmal schnoddriger, fetziger und moderner, als es uns die (auf ihre Weise hinreißende) Einspielung mit Peter Alexander, Erika Köth und anderen Interpreten der 50er und 60er Jahre suggerierte.

In Nürnberg also tanzt man nun mit einem Orchester durchs Savoy-Hotel, das flotter nicht sein könnte. Vermutlich stehen hier nicht die von Abraham vorgeschriebenen drei Klaviere auf der Hinterbühne, dafür hat Kai Tietje die „bühnenpraktische Rekonstruktion“ der Partitur, die Matthias Grimminger und Henning Hagedorn vornahmen, musikalisch eingerichtet und arrangiert, weil sie (so der Regisseur Stefan Huber) „den Stimmen unserer diversen Besetzung entspricht und andrerseits die vielen rhythmischen und tänzerischen Elemente der Vorlage heraushebt und sie mit einem Schuss Ironie garniert“. Volker Hiemeyer leitet das klangverstärkte Orchester; man sieht's erst, wenn Daisy Parker alias Christoph Marti in elegantem weißem Frack und mit Zylinder nicht nur das Savoy-Publikum rockt. Marti ist überhaupt eine der Trumpfkarten der Aufführung. Neben den beiden anderen Mitgliedern der „Geschwister Pfister“, die die beiden „Hohen“ Hauptrollen gestalten, und neben der anderen „komischen“ Gestalt, dem Mustapha Bei der grandiosen Andreja Schneider, macht Marti eine herrliche Bella Figura.

Im Geschlechter- und Rollentausch nimmt die Inszenierung eine Bühnentradition auf, die in den gewandelten Rollenmodellen der 20er Jahre zu einem Höhepunkt geriet; dieser Transvestitismus schlägt sich in Nürnberg auch aufs männliche, von Danny Costello inszenierten Ballettensemble durch, das einmal als Damencompagnie im leicht burlesken Stil über die Bühne fegt. Marti aber ist ein wunderbarer Entertainer, dessen Szenen mit „der“ Mustapha, die ihn/sie als 7. Frau/Mann fürs Leben engagiert, durchaus mehr als komisch sind. Die 6. war übrigens eine Dame aus Nämberch…

Zwar: das Stück über eine Ehefrau, die sich an ihrem Ehemann rächt, weil der sie – angeblich – betrog, braucht ein bisschen, ehe es an Fahrt gewinnt, auch wenn das Bühnenbild und die Auftritte aus und die Abgänge im leergeräumten Orchestergraben sehr elegant und ästhetisch sind. Timo Dentler und Okarina Peter kamen mit ein paar drehbaren Ecksäulen und einigen Pflanzen im Graben aus, um Atmosphäre und wechselnde Schauplätze zu generieren. Art deco, ein paar Lichtelemente: voilà, c'est tout. Denkt der strenge Kritiker zunächst noch, dass es angesichts der nicht besonders inspirierten Musiknummern vielleicht doch sinnvoller gewesen wäre, zum wiederholten Mal die „Fledermaus“ anzuhören, die im Hintergrund der Dramaturgie des Stückes steht, so wird er schließlich eines Besseren belehrt. Abraham gelang es mit seinen Schlagern, die mal berlinerisch („Es ist so schön, am Abend bummeln zu geh'n"), mal „exotisch“ („Tangolita", wobei die Musik an Alfred Schnittkes genialen Tango aus seiner Faust-Kantate erinnert), mal wunderbar sentimental („Toujours l´Amour") oder schlichtweg sinnfrei, doch sehr im wunderbar zeitgeistigen Stil der 20er („Wenn wir Türken küssen") über die Rampe kommen, ein Stück zu schreiben, das denn doch weniger substanzlos ist, als es zunächst den Anschein hat. Der Konflikt, die „Treue“ betreffend (ja, es ist einer, und er ist zeitlos), offenbart sich im langsamen Rhythmus eines eleganten Walzers. Als sich Madeleine, die für den Fehltritt, der in einer Lüge und einer schwachen moralischen Haltung besteht, die Revanche nimmt und sich die Eheleute in einer quasi falschen Verführungsszene anschauen – sie maskiert und im herrlichen wie erotischen Goldkleid, er buchstäblich demaskiert - scheinen sie sich zu erkennen. „Toujours, l'amour“... Zugegeben: Hätte Peter Konwitschny oder Luc Bondy das Stück inszeniert, würde der Abend nicht so konventionell und happy-end-gedrängt ausgehen wie an diesem Abend. Man hätte das Finale, das im Sinn der Konvention der Gattung sein muss, durchaus nachdenklicher inszenieren können, doch wär's am Ende nicht auf einen Klatschmarsch hinausgelaufen.

So bleiben ein paar grandiose Darsteller, insbesondere, um's nochmal zu sagen, Andreja Schneider und Christoph Marti, neben denen die Madeleine der Frederike Haas und der Marquis Faublas des Tobias Bonn im Rahmen des ersnt genommenen Genres erstklassig agieren, sodass sich die unsentimentale Rührung und die professionelle Komik (die frustrierte Hausfrau und der lustige Türke, der sie in ihrer Ehekrise aufzumuntern weiß) die Waage halten. Bravo! Stand am Anfang noch das vielleicht ironisch gemeinte Kitschbild des filmisch vermittelten „Bella Venezia“, in dem das glückliche Paar sich wie in einem Musikfilm der 30er Jahre in der Gondel vor der Rialtobrücke ansingt und -himmelt, herrscht am Ende Partystimmung. Die Bühne öffnet sich, Miss Parker, die/der als Komponist „Jose Pasodoble“ Triumphe feiert, macht eine Supershow, schon vorher hat sie/er ja bei „O Mister Brown“. also der ersten einprägsamen Nummer der Partitur, die Choreographie hinreißend angeführt. Auch bemerkenswert innerhalb des Ensembles, das als „homogen“ zu bezeichnen untertrieben wäre: Andromahi Raptis als La Tangolita, die Verflossene des Lebe/Ehemanns. Und wunderbar – sowohl als Madame Albert, die Chefin des Modesalons, die der auf Rache sinnenden Ehefrau das Goldkleid anmisst, und als Celestin Formant, der herzhaft verdruckste und grundehrliche Glückssucher, der einmal im Jahr einen Ball besucht, den Ball im Savoy, um dort die Liebe seines Lebens zu finden, um an diesem Abend auf eine Frau zu stoßen, die auf Teufel komm raus ihren Mann betrügen will: Cem Lukas Yeginer. Und ganz nebenbei ist der Abend auch ein höchst unterhaltsames und undogmatisches Plädoyer für die Homosexualität.
Hat jemand was gegen „die Operette“? Dann möge er nach Nürnberg fahren, um sich eine durchaus tiefsinnige Screwball-Comedy anzuschauen, die, nach einer musikalischen Durststrecke von 40 Minuten, vor allem im zweiten Teil des Abends zu sich selbst kommt: dank einer denn doch substanziellen Schlager- und Walzermusik und, einschliesslich des fleissigen und exzellenten Chors des Staatstheaters Nürnberg unter Tarmo Vaask, eines Dreamteams von singenden Akteuren.
Frank Piontek, 20.1.2019
Fotos: © Bettina Stöß
XERXES
Premiere: 24.11.2018. Besuchte Vorstellung: 16.12.2018
Eine Szene in Augsburg, am nächsten Tag, gegen Mittag: Zwei Jungs stehen an einer Ampel und warten auf Grün, das Skateboard des einen steht nicht auf den Rollen, sondern liegt quasi auf dem Rücken, der Junge tippt es mit seinem Fuß an, es kommt in die Vertikale, so dass es der junge Mann greifen kann.
Seltsam, oder auch nicht: Erst am Vorabend hat der Rezensent die gleiche Szene im Opernhaus Nürnberg gesehen. Da war es Nicolai Karnolsky, der ganz am Ende des Abends die selbe Geste ausgeführt hat, denn Händels „Xerxes“ spielt in der Inszenierung von Clarc-Delouel > le lab in einer Skaterhalle. Wer aber ist „Clarac-Deloeuil > le lab“? Sie sind, erfährt man, „eine Künstlergruppe um Jean-Philippe Clarac und Olivier Deloeil, die sich 2009 in Bordeaux gegründet hat. Le Lab erarbeitet interdisziplinäre Kunstereignisse von der großen Opern- und Theaterbühne bis zu leichteren performativen Aktionen.“ Eben dies trifft's: „Leichtere performative Aktionen“. Sie setzen die komische Handlung des „Xerxes“, der weder Opera seria noch Opera buffa ist, in die Jugendwelt, in der sich die jungen Leute mit ihren Liebe- und Eifersüchteleien austoben können. Das hat Charme, zumal dann, wenn echte Nürnberger Skater vom Kornmarkt als Edelstatisten agieren und mit schönen Videoeinspielungen die Skater interviewt werden und sich ein Skateboard wie magisch aus dem Opernhaus begibt, um nach einer Rundfahrt am Ende tatsächlich auf die reale Nürnberger Opernbühne zurückzukehren, wo es Nicolai Karnolsky, siehe oben, in Empfang nehmen kann.

Dummerweise aber kommen dem Opernkritiker einige Bilder und Erinnerungen in die Quere. Stefan Herheim hat 2011 das Werk an der Komischen Oper glanzvoll, ungeheuer komisch und hintersinnig inszeniert: als Barockrevue. Mit dieser Opulenz kann die Nürnberger Inszenierung nicht mithalten; soll sie auch nicht – doch hat mancher Besucher den Eindruck, dass der, das ist angesichts der Szene kaum ein Schade, um ein Drittel gekürzten Partitur ein wenig mehr an optischer Abwechslung gut täte. Nach einer Stunde hat sich der Reiz des Bühnenbildes erschöpft; die Wandlungen, die die Figuren, die ja nicht psychologisch konturiert sind, erfahren, spiegeln sich eben nicht in der Szene – auch wenn im Schluss einige Helden und Heldinnen dieser amourösen Abenteuer, die sich um einen „Anführer“ drehen, in so etwas wie Erwachsenenkostümen auftreten.

Insofern: Ja, man kann die Geschichte um den Kerl und seine Entourage im heutigen Nürnberg ansiedeln, aber man müsste es denn doch mit noch mehr Esprit und barockem Ungestüm tun, so wie es, beispielsweise, eine Atalanta mit ihrem deutlichen Outfit und Avencement ins Erotische umsetzt. Völlig unbenommen von der szenischen Einöde, die spätestens in der 3. Stunde – allerdings sympathisch unterbrochen von den Filmeinspielungen – den Zuschauer zu ermüden droht, woran auch die drei Skaterjungs nichts ändern können, sind die musikalischen Leistungen des Ensembles. Die Premiere hat Wolfgang Katschner geleitet, der uns in der letzten Spielzeit eine auch musikalisch überwältigende „Rückkehr des Odysseus“ schenkte. Er hat wieder mit der Staatsphilharmonie Nürnberg zusammengearbeitet; diesmal klingt der Händel, immerhin 140 Jahre jünger als der Monteverdi, wie eine Mischung aus Alt und Neu, die nicht immer befriedigt, weil sie eher unentschieden zwischen dem „Alte-Musik“-Sound der 60er Jahre und der heutigen Aufführungspraxis vermittelt. Theorbe, Barockgitarre und Cembalo ergänzen das Ensemble, das diesmal von Björn Huestege geleitet – und ausgiebig gefeiert wird. Das Sängerensemble wird angeführt vom Xerxes der Almerija Delic, die sich bereits mit ihren ersten Partien in die vorderste Rehe des Nürnberger Ensembles gesungen hat. Ausgesprochene „Barocksänger“ finden sich zwar nicht in dieser Gruppe, aber mit der Romilda der Julia Grüter, deren glockenreine, ausdrucksfähige Goldstimme wieder entzückt, findet der Hörer einen weiteren Pluspunkt dieser Interpretation.

Als sexuell attraktive, weil attraktiv sein wollende „Intrigantin“ hat Andromahi Raptis (als Atalanta) einige prägende Auftritte; dazu passen die Interviewschnipsel, in denen sich die sympathischen Skater vom Kornmarkt über die Rolle der (wenigen) „Skatergirls“ auf dem Platz und im Freundschaftsgefüge der Gruppe und der einzelnen Sportler äußern. So viele Skatergirls wie auf der Xerxes-Bühne scheint es, proportional gesehen, in der Nürnberger Wirklichkeit nicht zu geben. Dafür tritt eine weitere Figur ins Spiel, die sich nur deshalb als Skaterboy verkleidet, um den erotisch lässigen „Anführer“, also Xerxes, wieder zu erobern. Katrin Heles singt diese Amastre mit der Würde der im Beziehungskrieg übel Ausgeboteten. Den Part des (vokal hervorragenden!) Falsettisten hat diesmal Zvi-Emanuel-Marial übernommen, der in einem – na, sagen wir mal – eher ungünstigen Jungskostüm herumlaufen muss. Was dem Wagnertenor der Matrosenanzug, ist dem Händelsänger die kurze bunte Hose. Bleibt der Komiker, also Wonyong Kang als Elviro, der den Verpeilten liebenswürdig spielt und ansprechend singt: nicht nur die berühmte Blumenstelle.

Und das berühmte „Ombra mai fù“? Was hatte das nun zu bedeuten? Ganz einfach: Der Baum, den der King dieses Miniimperiums da anbetet und -minnt, ist nichts weiter als – genau: das „Holz“. Zugegeben, so hat das der Librettist nicht gemeint, auch lässt er Xerxes ausdrücklich von einer Platane, dann von etwas „Vegetabilem“ singen, aber was soll's. Wo ein Baum zu einem geliebten Skateboard wird und die Verwirrung der nicht ganz ernst zu nehmenden Gefühle eh schon – für einen Barockopernherrscher – unziemlich schräg ist, darf die Obertitelei sich Freiheiten erlauben, die im Sinne des „Konzepts“ funktionieren müssen. Falls man jedoch auf das Interesse einer jüngeren Schicht von Opernbesuchern gehofft hat, so müsste man, fürchtet der Opern- und der Händelfreund, schon etwas mehr auf die Bühne bringen als eine simpel ausgeleuchtete Skaterhalle. Vielleicht doch so etwas wie jenen Theaterzauber, den Stefan Herheim und sein Dreamteam damals entfachten. Denn sonst wird die schönste Händeloper zu einer letzten Endes nicht besonders interessanten Angelegenheit.
Frank Piontek, 18.12.2018
Fotos: © P. Malinowski
Premiere: 15.12.2018
Es ist nicht die erste, es wird nicht die letzte Interpretation des „Midsummernight's dream“ sein, die das Werk des Edward de Vere, 17. Earl of Oxford, auch bekannt unter seinem Künstlernamen „Shakespeare“, erfuhr. Da es sich aber um eine Deutung – und es ist eine explizite Deutung, verbunden mit einer Weitererzählung des Stücks – Goyo Monteros und des Nürnberger Tanztheaters handelt, haben wir es in keinem Fall mit einer klassizistischen Erzählung zu tun, wie sie nicht nur die Altmeister des Balletts, also Frederik Ashton und Georges Balanchine, sondern noch John Neumeier vorgelegt hat. Der Hinweis steht bereits auf dem Titelblatt: „Nach William Shakespeare“, um nicht zu sagen: „nach 'Shakespeare'“. Zwar benutzt Montero zwei Stücke aus jener klassisch gewordenen Schauspielmusik, die nach wie vor symbiotisch mit dem Schauspiel verbunden zu sein scheint, doch bietet er kein „neckisches“, gar „romantisches“ Tanzstück, das man, bequem in seinem Sessel sitzend, genüsslich an sich vorüberlaufen lassen kann, mag auch die Musik Mendelssohns – aber auch dies ist nur scheinbar – dazu einladen. Die Staatsphilharmonie Nürnberg spielt den Mendelssohn unter Lutz de Veer ja auch ohrenschmeichelnd, bisweilen etwas krachend.
Wieder hat Montero „seinen“ Komponisten Owen Belton ins Boot geholt, und wieder fand Belton krasse, aggressive und finstere, bisweilen schroffe geräuschhafte Töne: als Begleitmusik zu einem Psychodrama. Im Übrigen kam Montero auf die naheliegende Idee – ist eigentlich schon ein anderer Choreograph darauf gekommen? -, weitere Musik Mendelssohns in die Partitur zu integrieren: aus den Symphonien „Lobgesang“, der „Reformationssymphonie“ und der „Italienischen“. Wer noch die üppige, gleichsam spätviktorianische Verfilmung des Stücks mit Michelle Pfeiffer, Kevin Klein, Rupert Everett und Sophie Marceau im Gedächtnis hat, wird sich an die Drehorte in der Toscana erinnern. Schon damals wirkte die Lokalisierung des Stücks in Norditalien überzeugend, und dies wohl auch, weil dem Earl of Oxford das „Klein-Athen“ des herzoglichen Planstädtchens Sabbionetaals unmittelbare Vorlage für das „Athen“ seines Stücks diente. Wer's nicht glaubt, möge nachlesen, was Richard Paul Roe über die Italienbezüge der Werke „Shakespeares“ am Ort und in den Archiven herausfand: https://politicworm.com/oxford/oxfords-education/travel-shakespeares-italy-with-richard-roe/

Nun begleitet der wilde Saltarello aus der „Italienischen Symphonie“ das böse Treiben Pucks, eines Wesens zwischen Baum und Elementarwesen, Mensch und Elf.Alexsandro Akapohi tanzt ihn in Monteros Sprache, die zwischen Pantomime und Modern Dance so vermittelt wie der „score“ zwischen klassischer Romantik und Moderne. Puck aber ist kein anderer als der von den Gestalten aus der Anderswelt geraubte Sohn Zettels; die Idee, das Stück mit dem „Erlkönig“ (gesungen von Fischer-Dieskau) und einem wie üblich souverän inszenierten Reiterstück beginnen zu lassen, ist so verblüffend wie überzeugend.Oscar Alonso mutiert als Vater vom agilen Mann zum Clochard: bis er sich zum letzten Mal – hier liegt die wahre Tragödie dieser Shakespeare-Weitererzählung – von seinem Sohn zu trennen hat. So wird der Mythos weitergedacht, so erhält er eine poetische Grundlage, die der komplexen Geschichte um Liebe und Liebeswahn, Traum und Albtraum, eine weitere Schicht einzieht, die aus der komisch angelegten eine tragische Figur macht. Nein, heiter ist nichts in diesem verwirrenden Wald der Gefühle, dessen Dunkelheit von der Beltonschen Musik akkompagniert wird. Doch gönnt Montero seinen Helden am Ende doch so etwas wie Glück, wenn er aus der 2. und 5. Symphonie die elegischen langsamen Sätze herbeizitiert.. Er liefert seine Paare nicht, was möglich und üblich wäre, der Verzweiflung über ihre (eminent körperbetont) ausgetragenen Verstreitungen aus, sondern lässt sie schließlich wieder oder zum ersten Mal zueinanderkommen.

Auch Oberon und Titania vereinigen sich von Neuem, nachdem sie sich bis aufs Blut gestritten haben: in Seilen hängend, ein zauberhaftes wie teuflisch verkettetes Paar bildend. Rachelle Scott und Luis Tena, dieses überragende Paar aus der Zauberwelt des Goyo Montero schenkt sich nichts, bevor sie, das Luftwesen (daher eindeutig überlegen), dem Erdmann seine silberglänzenden Elfenkleidung abstreift. Symbolismus pur – aber mit welcher gestischen Ausdruckskraft! Die beiden Paare, die zueinander und doch nicht zueinander gehören, weil ein fauler Zauber genügt, die Beziehungen im Innersten sichtbar zu machen, werden von Nuria Fau (Hermia), Esther Pérez (Helena), Dayne Florence (Lisander) und Joel Distefano (Demetrius) durchaus unterscheidbar getanzt, obwohl sie in ihren Affekten ähnlicher sind, als es sich die Figuren vermutlich wünschen. Zu den Eigenheiten der Monteroschen Geschichtenerzählungen aber gehört immer das äußerst vitale Wiederspiel von Individuum und Masse. Die Compagnie, die im „Hochzeitsmarsch“, einem engen, zeremoniellen Schaustück in den Hofgewändern der Zeit des Earl of Oxford, betont zackig im Corps auftritt, macht schon schnell eine interessante Mutation durch: Kaum sind die hohen Herrschaften verschwunden, beginnt ein Zanken und Kreischen, das sich zu einem ungeheuren Chaos steigert: als Vorgeschmack auf das, was sich zwischen den Paaren dieser buchstäblichen Nacht noch zutragen wird.

Montero hat, zusammen mit seiner Bühnengestalterin Eva Adler und dem kongenialen Lichtmacher Karl Wiedemann, seine Menschen diesmal in einen Raum gestellt, der sich zum einen durch eine beständig sich bewegende Schräge, zum anderen durch Seile mit montierten Lichtelementen auszeichnet. Man steht und tanzt hier förmlich in einem unheimlichen Zauberwald, in dessen Lianen man sich leicht verstrickt, und unter dessen Blitzlichtern sich die extatische Zuneigung der verzauberten Titania zum armen Eselskopf Zettel buchstäblich austobt, nachdem dieser auf die großartige Idee kam, wieder einmal das Stück von Pyraus und Thisbe zu inszenieren – doch diesmal mit den beiden Menschenpaaren (und mit einer grotesk verjaulten Synchronisation).

Keine Romantik, keine Erleuchtung, nirgends – bis der Zauberer Montero sich entschließt, mit dem Stücktext in der Hand den armen Verwirrten die Erlösung von ihren Qualen zu gönnen. Am Ende, ja, steht so etwas wie Liebe. Wer Montero kennt, weiß, dass er zusammen mit seinen wunderbar agilen, zärtlich wie brutal auftretenden Tänzern, alles kann: den heftigsten Streit – und die liebevollste Versöhnung. Der Rest ist nicht Schweigen, sondern das Brahms-Lied „Gestillte Sehnsucht“, gesungen von Kathleen Ferrier. Wer diese Aufnahme kennt, weiss, wie innig es klingen kann, ja muss: https://www.youtube.com/watch?v=EcYN5jnvsO0 Nur einer bleibt einsam zurück: der Mann, mit dem der Abend begann.
Kein Wunder, dass auch diesmal, nach 90 dichten und erfindungsreichen Minuten, die dem Ouevre des Choreographen einen weiteren, noch nicht gekannten Stein in die Krone setzten, das Publikum lange und frenetisch applaudierte.
Frank Piontek, 16.12.2018
Fotos: © Jesús Vallinas
HÄNSEL UND GRETEL
Premiere: 2.11.2014
Besuchte Vorstellung: 9.12.2018
Zum Weinen schön und ergreifend
Wäre der Rezensent ein übler Sentimentalist, würde er zugeben, dass er nicht der einzige war, der spätestens mit dem Auftritt des Sandmännchens bemerken musste, das sein Blick auf die Bühne bis zum Schluss des 1. Akts durch plötzlich eintretende Tränenflüssigkeit empfindlich gestört wurde. Dabei ist es doch gerade die Kombination aus genialer, stets überwältigender Musik und einer ausgefuchsten und hochpoetischen Bildkraft, die den mehrmaligen Besuch der 2014er-Produktion von „Hänsel und Gretel“ im Nürnberger Staatstheater immer wieder zu einem Erlebnis macht. Mehr Rührung geht in der Oper schlicht und einfach nicht; wer's nicht glaubt, möge sich in die Vorstellung setzen und das Schniefen reihum wahrnehmen, das man sogar hört, wenn die an diesem Abend (die Hörner...) leider nicht ganz waldrein intonierende, sonst aber phänomenal lebendige Staatsphilharmonie Nürnberg unter Guido Johannes Rumstadt den Regler hochstellt, bevor und wenn der Nürnberger Jugendchor des Lehrergesangvereins (unter der Leitung von Klaus Bimüller) zuletzt seinen zunächst zarten und rührenden, dann springlebendigen Auftritt hat.

Über die Inszenierung Andreas Baeslers, die in einer Kopie des Hauses Wahnfried beginnt, sich dann in einen surrealen - aus den Horrorvorstellungen eines von der bösen Haushälterin unterdrückten Geschwisterpärchens gewobenen – Fantasiewald inmitten des plötzlich aufgebrochenen Raums begibt, um am Ende unversehens, aber nachvollziehbar wieder im bürgerlichen Elend des Pleitemachers der Familie Besenbinder zu enden: über diese hochmusikalische und feingesponnene wie bildmächtige Inszenierung wurde hier schon zweimal geschrieben. Was neu ist, sind die meisten Sänger, die in der gerade begonnenen Intendanz Jens-Daniel Herzogs zum ersten Mal die Nürnberger Bühne betreten haben.

Noch immer aber stehen der phänomenal wortverständliche und stimmschöne Bariton Jochen Kupfer und der Hänsel der Irina Maltseva im realen Raum und im Märchenwald des bürgerlichen Traumheims. Beide zeigen das Staatstheater auf dem hohen Niveau, das es in der Intendanz Peter Theilers errungen und ersungen hat. Neu ist Emily Newton. Wie wandlungsfähig sie zu agieren und zu singen vermag, zeigt sich schon, im Vergleich zur Hausherrin in der Villa, an ihrem Nürnberger Einstand als Busenmodell Anna Nicole Smith in Turnages Meisteroper. Größer könnte der Abstand zur Gertrud nicht sein, was nicht nur an Maske (Helke Hadlich, Gerti Hauser) und wilhelminischem Kostüm (Gabriele Heimann) liegt. Emily Newton singt eine charakterstarke, wenn auch verständlicherweise labile Frau (und es ist immer wieder schön, zu bemerken, dass ein Satz wie „Ja, da liegt nun der gute Topf in Scherben“ sich in der Lesart Andreas Baeslers und seines Ausstattungsteams nicht auf die kaputte Keramik bezieht. Ebenso hellsichtig und tiefsinnig wirkt ja auch Hänsels schlichtes „Gretel, ich weiß den Weg nicht mehr“). Schade nur, dass Emily Newton nicht immer so wortverständlich singt, wie es die vielen kleinen und großen Kinder in der Nachmittagsvorstellung verdient haben. Gretel aber ist die beste Trumpfkarte dieser Stunden. Julia Grüter verbindet Natürlichkeit mit einer glasklaren Artikulation, spielt gut, sieht dazu noch gut aus – Opernherz, was willst du mehr?

Almerija Delic, die als Bolkonskaja in der fulminanten Intendanzeröffnungspremiere „Krieg und Frieden“ auf sich aufmerksam machte, spielt, um es mal missverständlich auszudrücken, die Hexe gleichsam rollendeckend, wofür nicht allein ihr teuflisch-groteskes Gelächter spricht. Fast wirkt sie gemütlicher als Leila Pfister, die 2014 die Rolle in dieser Inszenierung kreiert hat, doch ganz gewiss: „You love to hate her“. Bleiben die beiden Männchen: mit Nayun Lea Kim wurden diese beiden „kleinen“, aber unverzichtbar wichtigen „Nebenrollen“ vollkommen besetzt.

Also: Wir, die Schniefer und wohl auch die, die vor soviel Schönheitszauber trocken bleiben können, freuen uns schon auf die nächste Wiederaufnahme dieser zugleich kindgerechten wie erwachsenentauglichen Inszenierung. Wie sagt Hänsel nach der Traumpantomime: „S'war wunderschön.“
Man kann es nicht besser ausdrücken.
Frank Piontek, 10.12.2018
Fotos: © Jutta Missbach
MEISTERKLASSE
Premiere: 14.11.2018
„Sie war ungebildet, primitiv in ihren Regungen von Hass und Liebe, abergläubisch religiös, vom Geld besessen (daraus resultierte ein Teil der Attraktivität Meneghinis, in viel gigantischerem Ausmaße natürlich die von Aristoteles Onassis). Sie war kleinlich, engstirnig und bösartig gegenüber echten und vermeintlichen Feinden, von kindlichem Egoismus beseelt und entsprechend grausam. Selbst gute Freunde mussten zugeben, dass Abende mit ihr nicht unbedingt anregend waren, denn außer über sie selbst, ihre Karriere, ihre Auftritte, ihre Kleider und ihren Schmuck konnte man mit ihr über nicht eben viel sprechen, schon gar nicht über ihre Rollen, die sie sich nicht durch Reflexion erzwang, sondern durch Instinkt und Intuition erzwang.“ Zudem steht und stand ihre Stimme bei Vokalexperten nicht gerade in einem hohen Ruf: ein hässliches Timbre, ein dünner Ton, hartes Metall statt Schmelz, ein gutturaler Klang beim Übergang vom tiefen zum mittleren Register, all das wurde diagnostiziert – und doch gilt die Callas als eine der größten, für viele Kenner als die größte Sängerin wohl nicht nur des 20. Jahrhunderts. Für Jens Malte Fischer, einem eminenten Sängerkenner, dem wir das Eingangszitat verdanken, das wir in seinem wunderbaren Große Stimmen“-Buch finden, war sie die Opernsängerin der letzten 400 Jahre (obwohl er, glaube ich, weder die Malibran noch die Catalani je live erlebt hat). Sie war, alles in allem, ein Ereignis, das bis heute – und wohl noch die nächsten Jahrhunderte – tief beeindrucken, aber auch polarisieren wird. „Ich bin ka Fan von der Callas“, wie eine Besucherin in der ersten Pause bemerkte. Selber schuld, dachte sich der Rezensent.

Etwas von diesem einzigartig Ereignishaften, zugleich Abstoßenden wie Faszinierenden, Egomanen wie Bannenden hat Terrence McNally in seinem Meisterstück „Meisterklasse“ eingefangen: eine Performance für eine herausragende Schauspielerin, einige wenige Sänger und einen Pianisten (und einen stummen, aber auffallenden Bühnenarbeiter). 1971/72 hat die Diva einige Meisterklassen in der Julliard School of Music gegeben; der Autor, dessen „Catch me if you can“ gerade seine Nürnberger Erstaufführung erlebte, hat einiges Material in sein vielgespieltes Stück eingearbeitet. Für das Callas-Stück von 1995 erhielt er zwei bedeutende Theaterpreise; man versteht's, wenn man Annette Büschelberger auf der Bühne sieht. Seit über 20 Jahren spielt sie nun schon die „Maria“, wie ihre Rolle im Programmheft benannt wird – aber spielt sie nicht noch mehr? Die verlassene Frau an sich? Denn die Callas dieser „Meisterklassen“ bezieht – egoman und dramaturgisch völlig verständlich – ihre negative, aber bewegende Energie aus der totalen Identifikation mit ihren großen Rollen. Egal, ob sie den ahnungslosen Eleven, die „nur singen“ wollen, die Sonnambula oder die Lady Macbeth – ganz abgesehen von der archetypischen Verlassenen, der Medea – erläutert und/oder vorspielt, sie ist sie immer die von Onassis gedemütigte, beleidigte, in den Schatten gestoßene Frau, damit stets sie selbst. Dies aber war die wahre Callas: eine Frau, deren Rollenporträts bis heute vorbildlich sind – bei allen stimmlichen Defiziten, die nicht die Überzeugungskraft eines darstellenden Sängers ausmachen.
Ja, diese „Maria“ ist unerträglich arrogant, widersprüchlich, sprunghaft, divenhaft, unverschämt – aber hat sie, künstelrisch betrachtet, nicht immer recht? Es geht nicht ums „reine Singen“, sondern um die „Wahrheit“. Sie beleidigt den Sopran, der overdressed in die Klasse kommt - „Gehen Sie anschließend noch aus?“ - und scheucht die kleine Koreanerin von der Bühne, als die nicht so schnell begreift, was Singen vom Sein unterscheidet. Sie plaudert mit dem Publikum, den anderen Schülern, auf die sie herabschaut, wirft immer wieder Spitzen ins Parkett – und reißt ihr Herz auf, als sie sich an die großen Rollen erinnert, die gerade von den kleinen Schülerinnen probiert werden. Der Regisseur Manuel Schmitt hat zusammen mit Bernhard Siegl einen einfachen, getreppten Raum geschaffen, der sich an den beiden Opern-Stellen in Lichtschneisen öffnet, die der Diva (schwarzes, fast antikisierendes Kostüm an einer schlanken Frau) pathetische wie erschütternde Auftritte ermöglicht. Zwei Geistergespräche konfrontieren die fast Schizoide mit den männlichen Gespenstern ihrer Vergangenheit: mit dem alten Meneghini und dem vulgär-brutalen Onassis, der sie wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Ja, diese „Maria“ ist eine „schwierige“ Frau - klar, sagt sie an einer Stelle, die Kunst und damit Alles ist natürlich schwierig -, aber sie ist auch ein Opfer ihrer selbst. Annette Büschelberger macht das grandios. You love to hate her – aber am Ende siegt so etwas wie Verständnis. Wäre sie „normal“ gewesen, wäre sie schließlich nie die Callas geworden.

An ihrer Seite sitzt ein Korrepetitor, jung und verdruckst, in summa ein netter Typ: Francesco Greco vom Internationalen Opernstudio Nürnberg. Gleichfalls aus dem Studio: Nayun Lea Kim, die die Arie der Amina singt. Wir begreifen, was schon wenige deutliche Hinweise auf die Rolleninterpretation zu bewirken vermögen. Singt Frau Kim die Herzschmerzen des Mädchens zunächst im Unschuldston heraus, beweist sie im nächsten Versuch, dass mit einer lyrischen Stimme ein wenig mehr an Inbrunst drin ist. Der gutaussehende und mit seinem offensichtlich typisch sein sollenden Gehabe komische Tenor – eine Gelegenheit für die Diva, einen Tenorwitz zu machen – singt die erste Arie des Cavaradossi; Chang Liu, auch er aus dem Opernstudio, macht das so schön, dass selbst die Lehrerin stumm bleibt. Und die „weitere Sopranistin“, die an die Briefszene der Lady Macbeth herangeht und erst einmal die Ohren lang gezogen bekommt, weil sie ihren Shakespeare nicht kennt, ist mit Rafaela Fernandes gut besetzt. Sie setzt den Schlusspunkt, weil sie im Finale die Callasbüste zertrümmert, die wie eine erstarrte Kopie der Sängerin selbst auf der Bühne stand. Soviel Symbolik in diesem so logisch wie typmässig vielfältigen und daher verschiedenste Situationen ermöglichenden Stück muss sein.
„Soso“, sagt die Callas und geht bald mit Alfredo, dem Pudel (gespielt von Alfred) ab. Das Denkmal Callas wurde bereits zu Beginn des Abends gestürzt und zugleich neuerrichtet: als ätzende wie faszinierende, rechthaberische und doch so oft rechthabende Frau, als ganzer Mensch.
Sehr langer Beifall für Annette Büschelberger und die gute Truppe, die wie im Nebenbei beweist, dass in der Zusammenarbeit zwischen Oper und Schauspiel schönste und spannungsreichste Abende entstehen können - vorausgesetzt, man hat es mit einer exzellenten Darstellerin und einem hochunterhaltsamen wie lehrreichen Stück zu tun: für Opernfreunde und solche, die es werden sollten.
Frank Piontek, 15.11.2018
Fotos: © Konrad Fersterer
ANNA NICOLE
Premiere: 3.11.2018
Sie war vielleicht das einzige „Model“, dem das Playboy-Magazin jemals eine einzige exklusive Sonderausgabe gewidmet hat. Sie: Das war Anna Nicole Smith. Bürgerlich (soweit man diesen Begriff angesichts der prekären Verhältnisse im Süden der USA verwenden kann) geboren und getauft auf den Namen Vicki Lynn Hogan, war für einige Jahre das bekannteste Busenmodell - kein Werk der Natur, sondern eines der Plastischen Chirurgie. Wer ihre letzten Auftritte im US-amerikanischen Fernsehen miterleben konnte, und wer heute diese grausigen Dokumente einer Selbstzerstörung auf Youtube anschaut, ahnt allerdings, dass der kurzlebige Ruhm dieser Frau schon auf Trümmern erbaut wurde.

Der britische Komponist Mark-Anthony Turnage und der Librettist Richard Thomas haben 2011 eine Oper über eben diese Frau auf die Bühne gebracht, die 2013 in Dortmund ihre deutsche Erstaufführung erlebte. Genau diese Produktion ist nun samt praktikablem Bühnenbild (Frank Hänig und Norman Heinig haben zunächst einen großen leeren Raum mit einem US-amerikanischen Deckenneonstern gebaut) in Nürnberg zu sehen, da der heutige Intendant Jens-Daniel Herzog damals und dort Regie führte. Selbst die Anna Nicole der Dortmunder Produktion steht heute auf der Nürnberger Bühne – glücklicherweise, denn sie erspielt sich auch hier einen riesigen Erfolg. Turnages Musik nämlich geht so unter die Haut wie der exzessive Verfall der einstigen Trash-Diva, die ihren Ruhm mit gesundheitlichen Problemen, damit einhergehendem Tablettenkonsum, nicht zuletzt mit der Selbst- und Fremdausbeutung dessen bezahlte, was sie für ihr Leben hielt. Spektakulär wurde die Live-Übertragung der Geburt ihres zweiten Kindes im Bezahl-Internet, schauderhaft blieb der Drogentod ihres geliebten Sohns, den sie eines Morgen leblos neben sich im Bett fand. Sie selbst starb, wie ihr großes, nie erreichtes Vorbild Marilyn Monroe, an einer überhöhten Dosis Tabletten. Was bleibt, sind viele Nacktbilder mit ihrem künstlich aufgeblasenen Busen, vielleicht die Erinnerung an Film- und TV-Auftritte, die schlicht und einfach zum Fremdschämen waren – und die Trauer über ein letzten Endes, im grellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit ausgestelltes verpfuschtes Leben. Warum sollte man darüber eine Oper machen?

Weil sie vielleicht als Spezial-Fall – ja, es war buchstäblich ein Fall - etwas sehr Typisches zeigt und vor allem: weil es vielleicht allein die Oper ist, die uns für zwei Stunden tief hinein zieht in ein Leben, auf das wir schlussendlich weniger mit Häme als mit (freilich nutzlosem) Mitleid sehen. Die blendend gut singende und zwischen Aufbegehren, Triumph und Verzweiflung genau agierende Emily Newton macht das aber auch fantastisch. Ist sie im ersten Teil des dramaturgisch relativ (!) einfachen wie konsequenten Bilderbogens vom Aufstieg und Fall einer „Ikone“ das selbstbewusste Mädchen aus der Provinz, die in einem einzigen Moment, der in seiner melodischen und harmonischen Schönheit zweiffellos scheint, tatsächlich glaubt, dass sie „es“ schaffen wird, so sehen wir ihr im zweiten Teil beim Untergang zu. Wir machen das nicht genüsslic, aber mit Turnages spannender und facettenreicher Musik im Ohr haben wir ein ästhetisches Vergnügen an dieser im Grunde schrecklichen Geschichte aus dem Speckgürtel kaputter Familienverhältnisse und amoralischer Verwertungsmethoden eines Menschenlebens. Dass eine Zwischenszenenmusik im 2. Teil, nach der es gleich noch schlimmer kommen wird, wie eine Zwischenaktmusik aus dem „Wozzeck“ klingt, ist gewiss ein Zufall, passt aber zur Idee dieser Oper: Sie ist eine Passionsgeschichte; die Auferstehung der zunächst toten Anna Nicole, die sogleich anfängt, dem Chor, also uns allen ihr Leben zu erzählen, geht mit einem „Requiem aeternam“ vor sich. Vergebliche Hoffnung, für Anna Nicole gibt es, scheint's, keine Erlösung. „Sie vergewaltigt den amerikanischen Traum“, heißt es an einer Stelle des mit Slangjargon reich gesegnetem Libretto. Nein, der Traum, der ein Albtraum war, hat sie vergewaltigt, indem sie einen Greis ehelichte, sich in unsinnige und schließlich verlorene Erbschaftsgefechte begab und am Ende ihrem eigenen Verfall zusehen musste. Dabei war sie am Anfang doch das, was der Dramaturg Georg Holzer als „vulgäre Schönheit“ bezeichnete. Wir schauen also gebannt dabei zu, wie die Frau, die auf Teufel komm raus ein „Star“ werden wollte (und es eine Weile auch war), mit den Gesetzen des Neoliberalismus im Kopf ihren Körper, damit auch ihre Seele missbrauchte. Damit ist sie definitiv nicht der Marie Duplessis, also Verdis Traviata vergleichbar – aber ähnlich ist die Stellung der Frau im Geflecht einer mörderischen Unterhaltungsgesellschaft, die sich einen Teufel um die sog. Würde des Menschen schert und am Ende elend krepiert.

Und doch verstehen wir – Effekt der Kunst – dieses Mädchen. Natürlich, sie will raus aus der „Familien“-Hölle. Natürlich, wenn man als Lap-Dance-Girl mit kleinen Brüsten keine Karriere machen kann, müssen größere her, und wenn einem ein mephistophelischer Doc einredet, dass Größer besser ist als Groß: dann macht frau es eben (großartig und neu im Nürnberger Ensemble: Tadeusz Szlenkier, der schon in „Krieg und Frieden“ auffiel). Das „nihilistische dunkle Märchen“ wird erzählt mit den Mitteln der Revue, des Musicals und der Großen Oper, aber es ist weder das eine noch das andere. Der Stilmix, der nur scheinbar ist, wird zusammengehalten vom bisweilen grausamen Witz und der Dignität der orchestralen Tonsprache, in der die Pop-Phrasen und -Klänge wie Zitate aus einer – und auch das ist nur scheinbar – besseren Welt klingen. Das Musical des 1. Teils besteht aus musikalisch angeschrägten Nummern, bevor zuletzt das Finale die pure Verzweiflung und Trauer über diesen „Aufstieg“ herausschreit: mit Mollbrüllereien des schweren Blechs in Forte. Herrlich! (sagt der Opern-Gourmet). Bläst Anna Nicole ihrem bald 90jährigen Ehemann keinen Kuss entgegen – dies macht sie erst in der letzten Sekunde der Oper, in der sie schon tot ist -, sondern etwas durchaus Anderes, wird der „act“, den wir nicht sehen, nur ahnen (denn, das ist wirklich tricky, der Chor umgibt die Szene und kommentiert die ersten Versuche dieses Blaskonzerts mit einer ironischen Pantomime), scheinbar von einer „coolen“ Barmusik begleitet. Allein das ist schon böse – und sehr, sehr gut komponiert. Doch erliegt das Werk nicht der Versuchung, die seltsame Ehe zu denunzieren. Im Gegenteil: Wir verstehen sowohl die geldgeile Anna wie den alten Herren, der in seiner Sterbeszene zu schönsten lyrischen Tönen des Abschieds vom Leben findet. Jeff Martin spielt und singt diesen durchaus beeindruckenden, lebenslustigen alten Knacker: durchaus beeindruckend, vielleicht und notwendigerweise ein wenig grotesk.

Komplett grotesk ist nur die Sterbehilfe Annas, die den Greis zum Sarg geleitet und den Deckel eigenhändig schließt. Richtig grausam aber ist das, was die Mutter Anna Nicoles – eine Frau, die permanent in ihrer Polizistenuniform agiert – immer wieder herauslässt. Ein musikalisch-dramatischer Höhepunkt des Werks: Ihre Verfluchung der Männer, vor auf dem Steg, während hinten Anna Nicole gerade Mr. Marshall heiratet. Gänsehautmusik und -stimmung mit der zurecht umjubelten Almerija Delic. Ach, ich liebe die US-amerikanische Oper, wenn sie so stark über Rampe und Steg kommt. Sie ist so unkompliziert – und so effektvoll.
Zeichnet der zweite Teil, wie gesagt, den Fall der Anna Nicole nach, so gibt es doch auch hier noch Musikszenen, die an einen Rossini von Heute erinnern: das brillante Lachterzett in der TV-Show, in der die Frau mit ihren Lieblingen, den Hunden telefonierte, und der Fress-Walzer: die tragisch aufgeschwemmte Anna, umgeben von den Schemen und Figuren ihrer Vergangenheit, die – das ist banal, aber so ist eben meist die Welt – mit Pizzakartons um sie herum tanzen. Weiter zu loben: die 8 Lap-Dance-Solistinnen – kein Walküren-Oktett, sondern eine Riege von auch mal lyrisch gestimmten Damen. Bis auf Nayun Lea Kim stammen sie alle aus dem glänzenden Chor des Staatstheaters, der diese Chor-Oper unter der Leitung ihres Chefs Tarmo Vaask bravourös singt. Richard Morrison singt und spielt gut böse den schlimmsten Buben in dieser Geschichte: den Anwalt Howard Stern, definitiv kein Freund der Anna Nicole. Der Rest des Ensembles muss sich diesmal mit musikalischen Mucken begnügen, auch wenn sie lange auf der Bühne stehen. Selbst Martin Platz hat in der Hauptnebenrolle des ersten Sohns, kurt nach seinem Tod, wenig mehr als eine Medikamenten- und Drogenliste zu singen.

Und schliesslch ist es eine reine Freude, diese aus etlichen Stilanklängen (zwischen der Westside Story, dem Broadwaymusical und den „Soldaten“) gemixte und doch stringent organisierte und gemäßigt originelle, dabei erstklassig instrumentierte, vor allem aber: immer packende Partitur mit der Staatsphilharmonie Nürnberg unter Leitung von Lutz de Veer zu erleben. Das Ensemble wurde, ohne Abstriche, am Abend lange gefeiert. Der Rezensent hat nur einen einzigen Besucher gesehen, der das Haus schon in der Pause Richtung Bahnhof verliess. Vermutlich wollte er so schnell wie möglich zu seinem Anna-Nicole-Sonderheft zurückkehren.
Er hatte das Stück vermutlich nicht verstanden – und einen ganz anders erregenden, durchaus gut gebauten zweiten Teil der spannenden Oper verpasst.
Frank Piontek, 4.11.2018
Fotos: © Ludwig Olah
CATCH ME IF YOU CAN
Premiere: 6.9.2018
2002 waren es Leonardo Di Caprio und Tom Hanks, die Katz und Maus spielten. Nun sind es David Jakobs und Rob Pelzer, die die beiden Männer spielen, die symbiotisch miteinander verbunden waren: der Gejagte und sein Jäger. Sie sind es zum großen Vergnügen des Publikums, die den Hochstapler Frank W. Abagnale Jr. und den FBI-Agenten Carl Hanratty nicht nur spielen sehen, sondern auch singen hören.

„Catch me if you can“: das ist der Stoff des Lebens, aus dem man höchst unterhaltsame Filme, Theaterstücke, Memoiren und Musicals schmiedet. 2009 erlebte das Musical seine Uraufführung im 5th Avenue Theatre in Seattle, Washington, erst zwei Jahre später im Neil Simon Theatre am Broadway, 2013 konnten es die Wiener zum ersten Mal in ihrer Stadt sehen. Demnächst wird Terrence McNallys „Meisterklasse“ in Nürnberg gespielt, jetzt kann man schon mal seine Arbeit am Musical würdigen. Neben vielen Musicalbüchern schrieb er übrigens auch Libretti: für Robert Beasers „The food of love“ und für drei Werke Jack Heggies. Kommen hinzu einige Filmskripts, unter denen das für „Frankie und Johnny“ (1991) herausragt: mit dem charismatischen Al Pacino und der nicht minder charismatischen Michelle Pfeiffer. Dabei ging es bei „Catch me if you can“ „nur“ darum, die Autobiographie Frank W. Abagnales, diese Mischung aus Wahrheit und ein bisschen Dichtung, für die Bühne einzurichten. Es ist, bis zur Verhaftung des Mannes dem Film folgend, glänzend gelungen.

Was damals in der Huffington Post zu lesen stand, ist übertragbar auf die Nürnberger „Show“: „Catch Me If You Can is a sheer delight from the poignant and brilliant book by Terrence McNally to the sexy but character-driven choreography by Jerry Mitchell to the perfect sets by David Rockwell to the spot-on costumes by William Ivey Long to Kenneth Posner's marvelous lighting. It's all tied together by the superlative direction of Jack O'Brien which is seamless in weaving together drama, comedy, dance, acting, genuine scenes of pathos and casual banter with the audience and orchestra.“ Ersetzen Sie den Namen des Regisseurs durch Gil Mehmert und den des Choreographen durch Melissa King, haben Sie den Eindruck, den der Abend beim begeisterten Publikum hinterließ. Dem eher traditionalistisch eingestellten Musicalbesucher kommt übrigens die Musik deutlich entgegen. Nicht, dass er sich auch nur eine Melodie merken könnte – aber die Instrumentation und der Stil dieses Opus sind bemerkenswert unorthodox gemacht. Der „score“ klingt längst nicht so durchschnittlich wie der eines durchschnittlichen Allerweltsmusicals (mag es auch jahrelang am Broadway gespielt werden). Marc Shaiman, der in Zusammenhang mit den Filmklassikern „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“ genannt werden muss, komponierte eine Musik, die der Spielzeit angemessen ist: wir hören den Big-Band-Sound der 60er, vernehmen rhythmische und harmonische Anklänge an die Musik der 50er, ein bisschen „Westside Story“ wird herbeizitiert, die „Rat Packs“ sind auch in dieser Partitur unterwegs, und fast über allem weht ein Hauch des wohnzimmerkompatiblen 60er-Jahre-Jazz. Einmal klingt sogar der Sound eines Film noir durchaus ironisch auf die Szene: wenn der FBI-Agent die „femme fatale“, also die Mutter des Helden über ihren Sohn ausquetscht, als wär's ein Stück von Raymond Chandler. Sie machen es aber auch klasse in Nürnberg: die 12 Mann des „Frank Abagnale Junior Orchestra“. Die Trompeten, die verschiedenen Blasinstrumente namens „Reed“, die Posaunen, Drums etc. spielen unter Leitung von Jürgen Grimm so lustvoll, dass es (ziehen wir mal die bisweilen schmerzhafte Dynamik ab) selbst jenem Musicalfreund Spaß macht, der eher bei „My fair Lady“ und „Hair“ als in der Gegenwart zuhause ist. DIESE Musik aber klingt, um es mit Hans Sachs zu sagen, so alt und ist doch so neu – und umgekehrt.

Ein modernes Musical besteht, trotz leiserer Solonummern wie der der von Abagnale geliebten Brenda Strong, weniger aus tiefen Emotionen als aus gut gemachten Extrovertiertheiten. Darum muss zuallererst die Leistung der erstaunlich wenigen, daher ungeheuer fleissigen Damen und Herren der Compagnie gewürdigt werden, die fast permanent auf der Bühne tanzen: Alexandra Farkic, Inga Krischke, Tanja Schön, Yara Hassan, die entzückend hochwangige Anneke Brunekreeft, Amber-Chiara Eul und Peter Lesiak, Tim Hüning, Robert Johansson, Adrian Hochstrasser, Christian Louis-James. Melissa King hat die hübschen Stewardessen, Krankenschwestern und Showtänzer in Arrangements gestellt, die, so sexy sind sie eben, die Me-to-Debatte fröhlich in den Hintergrund drücken. Wer hier mit Ideologiekritik anrückt, indem er darauf hinweist, dass das doch alles Opas Musical ist, hat das falsche Haus besucht. Man könnte die Strategie der Durchsexualisierung sogar kritisch aufwerten. Seht her, so etwas war „damals“, als ein Frank W. Abagnale Jr. Karriere machte, der Stil der Playboy-Ära: unbenommen locker und herzhaft anzüglich. Ein Pluspunkt auch für die technische Vollkommenheit, mit der sich die Truppe in die zum Teil rasanten Choreographien begibt; das ja auch parodistisch gemeinte Ballett der Gesetzeshüter ist wahrhaft zackig. Und wenn die üblichen fünf Damen sich als Bunnies um das Duett von Vater und Sohn versammeln, um mit ihren schneeweißen Federfächern zu wedeln und die beiden einzuschließen, gibt es sogar eine Bilderfindung, die man poetisch nennen könnte. Gut grotesk ist dagegen, das ist so ein optischer Höhepunkt, der Aufzug der maskierten Doubletten der in Unigrün gekleideten Bürgerfamilie, in die der Held schließlich einheiraten will, bevor das FBI ihn auf dem Flughafen schnappt, in dem das alles reinszeniert wird.

Bleiben die „main actors“, die vor der schönen Videowand (erdacht vom „Comic Artist“ mit dem schönen nome de guerre Fufu Frauenwahl) mit den jeweiligen riesigen Fensterausblicken über eine Showtreppe oder die Drehtür die von Jens Kilian schnittig und luftig entworfene Szene betreten: als Fiktion einer TV-Show, in der der reaktionsschnelle Betrüger sich und dem Publikum, nicht zuletzt dem Jäger, sein Leben bis zu seinem 19. (!). Lebensjahr vorspielt. Wer den Film kennt, wird in David Jacobs zwar keinen wirklichen Wiedergänger erblicken, aber die Dramaturgie sorgt immer wieder für Erinnerungen an den Film; im Übrigen hat Jakobs eine ferne Ähnlichkeit mit dem jungen realen Typen aus New Rochelle. Ohne dem Musical die Dimensionen eines Shakespeare-Dramas zu verleihen, ahnen wir den tiefen Widerspruch zwischen Schein und Sein, der in dieser Figur gearbeitet hat – bis der reale Frank Abagnale vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, um als Sicherheitsspezialist bei jener Behörde zu arbeiten, die ihn zuvor verfolgt hat. Heute ist Abagnale, der ein sympathischer Bursche zu sein scheint, ein hoch angesehener Experte in Fragen der Sicherheit (aber gibt es überhaupt noch so etwas wie Schecks??). Verdienter Beifall also für den tollen David Jakobs – auch für den Kontrahenten. Rob Pelzer, ein Mann aus den Niederlanden (man hört es seiner Stimme reizvoll an), war Mozart in Wien und Passepartout in seiner augenblicklichen künstlerischen Heimat Linz. Er spielt den (erfundenen) FBI-Agenten Carl Hanratty stets nervös; dass ihm das Skript auch einige nachdenkliche Momente über seine eigenen seelischen Defizite schenkt, fällt nur wenig ins Gewicht. Und wenn er am Ende seinen buchstäblich an ihn gefesselten Gegner umarmt, weil wir das märchenhafte Ende der wahren Geschichte kennen, ist's gar zu schön, um falsch zu sein.

Last but not least: Dirk Weiler als Papa, der sich angesichts der sozialen Pleite in den Untergang trinkt, also die einzige wirkliche Charakterrolle dieses Stücks, daneben Alexandra Farkic als französische Mama. Nein, sie machen aus diesem Musical noch kein herzbewegendes Theaterstück mit Musik, was angesichts der durchschnittlich holzschnitthaften Musical-Ästhetik in Text und Sprache nicht erwartet werden kann, aber sie zeigen mit gerade noch erlaubter emotionaler Wärme, welche Tiefen diese Geschichte aufweisen könnte, die ansonsten, für drei kurze Stunden gut unterhaltend, technisch sehr gut gemacht über die Bühne kommt.
Frank Piontek, 7.9.2018
Fotos: © Staatstheater Nürnberg / Pedro Malinowski
KRIEG UND FRIEDEN
Premiere: 30.9.2018
Es gab Zeiten, da begannen Opernintendanten ihre Ära vorzugsweise mit den „Meistersingern“ oder dem „Fidelio“, manchmal auch mit Abseitigerem. Immer aber ist der Beginn einer Intendantenära eine Setzung. Götz Friedrich eröffnete seine Intendanz an der Deutschen Oper – lang, lang ist's her, aber unvergesslich – nicht mit einer „leichten“ Oper, sondern mit einer schweren und seinerzeit selten aufgeführten Maschine aus dem slawischen Repertoire: mit dem inzwischen öfters erscheinenden „Aus einem Totenhaus“.
Jens-Daniel Herzog ist ähnlich kühn, wenn er zum Beginn seiner Intendanz ein Großwerk der Russischen Oper aufs Programm setzt, das – leider – gleichfalls nur sehr selten „live“ zu erleben ist; bei den Salzburger Festspielen, die ja nun wirklich die Bühnen haben, um die halbe russische Armee einreiten zu lassen, fand diese Oper im Jahre 2004 (immerhin) zu einer konzertanten Aufführung – doch auch sie war, wie die Inszenierung Jens-Daniel Herzogs unter dem grandiosen Dirigat der neuen GMD Joana Mallwitz, gekürzt. Mit Blick auf das gesamte Werk mag der Prokofjewianer den Verlust einer knappen Stunde Musiktheater bedauern, aber dramaturgisch sind die kleinen und großen Schnitte, vor allem im Kriegs-Teil mit seinen wiederholten Partisanen-, Jäger und Kosakenaufmärschen, vertretbar. „Krieg und Frieden“ also, ein Meisterwerk Sergej Prokofjews, der nie das Glück hatte, eine komplette Aufführung dieses (unter Rostropowitschs Leitung) 4 Stunden und 5 Minuten dauernden Werks zu erleben. Dabei bezeichnete der Komponist genau dieses Opus als sein bedeutendstes: ein Schmerzenskind, das unter die Räder der sowjetischen Kulturpolitik geriet und keine Chance hatte, unter Stalin und dem ebenso schrecklichen Kulturideologen Shdanow adäquat aufgeführt zu werden. Dabei hatte Prokofjew doch alles getan, um den Vorschlägen des Politbüros nach „Volkstümlichkeit“ (gegen den immerzu vermuteten „Formalismus“) entgegenzukommen. Man hört es dem Werk deutlich an – dies ist sein Faszinosum, doch zugleich seine Last: dass sich der Komponist, naiv wie er war, vor den Karren des Stalinismus spannen ließ, um künstlerisch zu überleben, was ihm kein Kritiker seines Werks verdenken sollte. Denn Prokofjew schrieb selbst dann, wenn er eine Huldigungskantate für Stalin („Heil Stalin!“) oder eine grandiose Festmusik zum Jubiläum der Oktoberrevolution schrieb, handwerklich exzellente und ästhetisch schillernde Musik. An „Krieg und Frieden“ aber hing sein Herzblut – und die Hypothek, die die Zeitläufte ab 1942 mit sich brachten, wenn es darum ging, ein nur scheinbar historisches Thema zu einem aktuellen zu machen. Dass in Prokofjews Oper gezeigt wird, wie Menschen – allesamt „Späne in einer großen Maschine“, wie Pierre Besuchow ganz richtig bemerkt – hingerichtet werden, ist ausnahmsweise nicht Schuld des sog. Regietheaters. Es steht schon im Buch der russischen Geschichte, die da abgespiegelt wird – und in der Partitur. Was heißt: Es wummert gewaltig an diesem gewaltigen, weil gewaltig erregenden Abend.

Wie also geht Jens-Daniel Herzog mit dem stalinistischen Erbteil des Werks um, das, fehlte es ihm, seltsamerweise auf eine Leerstelle hinauslaufen würde? Denn pünktlich zum Kriegsbeginn einen lange hin- und hergewälzten Stoff auf die Bühne zu bringen, der für das sowjetische Publikum der 40er Jahre noch und nöcher Identifikationsmomente bereit hielt, ging schlicht und einfach nicht ohne jene patriotischen Gesten, wie sie die Sowjetpropaganda seit jeher kannte. Herzog macht etwas, was nicht in jeder Inszenierung funktioniert; hier aber ist es der Weg zum (inszenatorischen) Glück: er entdeckt, natürlich, in der Oper alle 4 Zeitschichten, die das Werk mit der Gegenwart verbinden: 1809-1812, Tolstois Epoche, die Stalinzeit, Putins Russland. Die Kostümfrage ist entscheidend: wo sich die Damen der Moskauer Gesellschaft heute in pseudohistorischen Schick werfen und die Folklore eines Huldigungsgesangs an den (neuen) Zaren quasi herbeizitiert wird, wo Militärmäntel ein Einheitsgrau aufweisen und die Franzosen in nationalfarbige Kunstuniformen gekleidet werden, wo ein General Kutusow wie eine Bilderbuchgestalt aus einer opulenten Verfilmung auftritt. Und so singt er ja auch: gewaltig schollernd, das nationale Thema aus der Filmmusik zu „Iwan dem Schrecklichen“ aufnehmend, das dort den Zug zur Schlacht von Kazan begleitet, die Kraft, Leidensfähigkeit ud Gefährlichkeit des russischen Volkes preisend: „Mit den Knochen unserer Feinde wird sich unser Land bedecken“. Wo es schliesslich egal ist, ob Natascha wie eine Dame von 1809 oder ein verwirrtes junges Mädchen von 2018 aussieht, gelingen der Inszenierung auch in Sachen Kostüm überzeugende Lösungen: ein zugleich historisierendes und modernes Patchwork, aber ein durchdachtes. Im Übrigen ist schon die Interpretation eines „Wunderdoktors“ als eines Schönheitschirurgen für die Upper Class der reichen Russinnen so sinnvoll wie hintersinnig. Ein Abrieb des Textes an der Interpretation findet an diesem Abend nicht statt.

Herzog bewältigt, zusammen mit dem Bühnenbilder Mathis Neidhardt und der Kostümbildnerin Sibylle Gädecke, nicht nur die optische Frage, sondern auch die politische. Er ist nicht so dumm, den Feldmarschall Kutusov, dem das Finale des letzten Bildes gehört, wie ein Abziehbild von Stalin auftreten zu lassen (eher erinnert der alte Bolkonski, also Fürst Andrejs Vater, mit seinen buschigen Augenbrauen und seinem Schnurrbart an das böse „Väterchen“ Stalin, der es liebte, seine Untertanen zu demütigen und zu vernichten). Er denunziert nicht die schrecklich markigen Volkschöre, die mit ungeheurer Wucht in den Raum knallen: das Epitaphium, das Prokofjew erst für die überarbeitete, um einige martialische Bilder, aber auch um eine Ball-Szene erweiterte Fassung komponiert hat, donnert nicht zu Beginn oder am Anfang des zweiten Teils in den Saal, sondern am Ende des ersten. Der Schock ist gewaltig, doch man versteht: Krieg ist eine Katastrophe sein, aber man begreift. Man stimmt zu, aber die Aggression der Masse ist zugleich gegen alle Zivilisation. Die Sache ist barbarisch – aber die Musik ist eben doch furchtbar mitreißend. Das Dilemma bleibt, es ist dem Stück eingeschrieben, es wird nicht glattgebügelt: weder affirmatorisch noch besserwisserisch. Diese offene Strategie mag auch mit der großen Qualität des Nürnberger Opernchores zu tun haben, der unter der Leitung von Tarmo Vaask schon am Beginn der Intendanz Jens-Daniel Herzog die Gelegenheit hat, sich von Neuem in einer Hauptrolle zu beweisen. Ich vermute übrigens auch, dass die Stückwahl nicht allein auf die Überzeugung zurückgeht, es bei „Krieg und Frieden“ mit einem großartigen Stück und einem, leider, wichtigen Thema zu tun zu haben. Wo sich das Ensemble in vielen Rollen zeigen (im Original treten nicht weniger als 72 Solisten auf) und das Orchester mit der neuen GMD glänzen darf, muss es ein Stück wie dieses sein. Man hätte ja auch „Palestrina“ spielen können – doch wären hier die Frauen fast komplett in der Gasse geblieben.

Dass dieses Russland nicht mehr das Russland eines Historienfilms sein kann, macht schon das erste Bild klar. Russische Birkenwälder sind nur noch ein abblätterndes Bild. Seltsamerweise funktioniert das alles: weil sich das Drama im ersten Teil, mehr oder weniger, um die Geschichte Andreis und Nataschas dreht, auch um die Spiele in der russischen Gesellschaft. Jochen Kupfer ist dieser Andrej, man hätte in Nürnberg keinen Besseren finden können: bis zur abgründigen Sterbeszene, diesem tief bewegenden, eher lyrischen, wenn auch verzweifelten Kontrasts innerhalb des Kriegs-Teils. Andrej muss auch nicht, im Stil des Micky-Mousing, mit Natascha tanzen. Doch doch, er tut es, aber die Choreographie (Ramses Sigl) beschränkt sich nicht auf Walzerschritte, sondern betont – in einem von Kai Luczak psychologisch ausgeleuchtete Raum – das komplizierte Verhältnis zwischen den beiden Figuren. „Richtig“ tanzen werden sie erst, wenn Andrej stirbt: sich in Erinnerung an ihren „ersten Tanz“ in einen Totentanz stürzend. Die Inszenierung ist, nebenbei gesagt, von hoher Musikalität; man merkt's an Bildern wie diesen. Mit Eleonore Marguerre hat dieser Abend mit einer vokal annähernd idealen und schauspielerisch vollkommenen Rollengestaltung eine überwältigend gute Natascha gewonnen. Der enorme Beifall des Publikums war dieser genau agierenden, die Natascha als autonome wie verwirrte junge Frau auf dem Weg zu sich selbst porträtierenden Sängerin sicher. Auch neu im Haus: Zurab Zurabishvili. Mit seinem dynamisch voluminösen wie differenziert artikulierenden italienischen Tenor und deutlich gehemmten Gesten zeigt er den Pierre Besuchow als einen Gerechten unter Ungerechten. Anatol Kuragin, der flotte und feige Verführer, ist Tadeusz Szlenkier: die glänzende Ansicht eines dominant singenden Hedonisten. Ein moralischer Gegenpart: Nicolay Karnolsky orgelt ganz wunderbar den alten, einäugigen Haudegen Kutusov; dessen heroisch-sentimentale „Arien“ sind in Karnolskys Kehle wie zuhause, aber der Bassbariton „kann“ auch die kleine, aber wichtige Partie des alten Bolkonski, der seine ungebetenen Gäste in Unterhose begrüßt und beschimpft, bevor er sich, bewusst provokant und abschätzig, an seine Sekretärin heranmacht (der einzige Einspruch meinerseits gegen die Regie: Ich verstehe die Szene: als ätzenden Kontrast zu Nataschas authentischer und herrlich ausgesungener Herzensnot, aber als Zuschauer wird man – da ein bewegtes Bild immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als ein statisches – von der Hauptsache abgelenkt. Ob man will oder nicht.).

Napoleon tritt übrigens auch auf, doch zunächst – gegen die Anweisung der Partitur - nur vermittelt: die Russen spielen, um ihre Angst zu überwinden, sich den Napoleon vor. Sangmin Lee macht das mit einem mächtigen Bariton – den falschen wie den richtigen Bonaparte, der Pierre Besuchow in einer Vision vor die Pistole läuft. Beeindruckend: Martina Dikes strenge Achrossimowa, die dem jungen Ding nach der lächerlich missglückten Entführung zurecht Vorhaltungen macht, auch wenn das noch nicht weiß, dass Anatol ein leichtlebiger Bigamist, doch kein Mann für die Ewigkeit ist. Wieder großartig mit seinem leicht geführten Charaktertenor: Martin Platz, dessen lebenskluger wie phlegmatischer Plato Karatajew, der noch kurz vor dem Endsieg erschossen wird, ein wenig die Rolle des obligatorischen Gottesnarren einnimmt. Der Rest ist ein Ensemble, das man erst einmal zusammenschmieden muss: Irina Maltseva als Luxuspuppe Hèléne Besuchowa, Katrin Heles u.a. als Sonja, Nataschas Vertraute, Alexey Birkus als Pokerspieler und Vater des Töchterchens, Taras Diriinkas als Dolochow, der skrupellose Kumpel Anatols, Almetija Delic als Mutter Andrejs, die sich schließlich, doch zu spät, gegenüber der im Vorzimmer des Alten abservierten Natascha zu einer rührenden Bemerkung durchringt, undundund. Sie spielen irgendwann, zusammen mit dem Chor und dem Extrachor sowie dem Miniheer der Statisten, fast alles: Soldaten und Huren, französische Schauspielerinnen und Marodeure. Und als sie es besonders wild treiben – die Schauspielerinnen treiben es im wahrsten Sinn mit ihren Landsleuten: freilich mit vorgehaltener Waffe -, kracht die ganze Herrlichkeit zusammen. Moskau brennt bekanntlich, bevor eine gewaltige Projektionswand Richtung Vorderbühne fällt und mit einer gewaltigen Staubwolke krachend aufschlägt. Ein Triumph der Bühnentechnik – und des szenographischen Theaters. Denn die Virtuosität, mit der die Bühnentechnik (ein Lob an den technischen Direktor H.-Peter Gormanns und seine Leute, die diesen Ablauf in größter Virtuosität möglich machten, als sei das alles ein Kinderspiel) und die Akteure die Bilder schiebend verändern und mit einigen Wänden und Grundeelementen immer wieder neue Räume schaffen, die inhaltlich bespielt werden, ist schier beeindruckend. Nur ein Beispiel: die Franzuski müssen, das ist sehr mühselig, im letzten Bild und in Richtung Westen durch und über jene Streben krauchen und klettern, die mit dem Fall der Videowand zum Liegen kamen. So greift in dieser Dramaturgie, die im Grunde aus großen Fragmenten besteht, ein Rad in das andere.

Der ganze enorme Aufwand aber dient nur einem Zweck: eine Geschichte in Geschichten zu erzählen, die bis heute packt. Sie erreicht das Nürnberger Publikum auch deshalb, weil Prokofjews gewaltige (die Massenchöre, die Kriegsmusik) und schräge (die Ballmusik, die Musik Anatols) wie lyrische Musik (der Walzer Nataschas und Andrejs, der Fernchor der Sterbeszene, die harmonisch und instrumentatorisch subtilen Zwischentöne) von der Staatsphilharmonie Nürnberg unter der Leitung der GMD Joanna Mallwitz deliziös gemacht wird. Das Monumentale wie das Private, das Grelle wie das Vorsichtige, der delikate Farbenreichtum und die bezwingend einfache Faktur werden an diesem Abend beifallprovozierend realisiert. Der Komponist, der aus einem Porträtfoto in der Heldengalerie berühmter Russen im Haus der Achrossimowa auf uns blickt (und dem man damit eine so ironische wie verdiente Ehre zukommen lässt), wäre vermutlich begeistert gewesen: trotz (nachvollziehbarer) Kürzungen.
Joanna Mallwitz arbeitet, soviel ist auf dem Bildschirm zu Beginn der beiden Teile zu sehen, mit genauen Anweisungen. Es wäre schön, wenn auch die nächsten Spielzeiten der Intendanz Jens-Daniel Herzog im Orchestergraben, aber auch darüber, mit dieser Bildhaftigkeit und Differenzierungskunst gemacht würden. Hoffnung ist bekanntlich immer. Davon wissen ja nicht nur die leidensfähigen Russen. Letztes Wort: Ein fulminanter und bewegender Saison-Auftakt mit einer grandiosen Arbeit an einem immer noch viel zu wenig gespielten Meisterwerk.
Frank Piontek, 1.10.2018
Fotos: © Ludwig Olah
Zum Zweiten
DIE RÜCKKEHR DES ODYSSEUS
Premiere: 3.6.2018.
Besuchte Vorstellung: 18.7.2018
Dass man innerhalb von 6 Wochen zweimal in die selbe Oper mit der selben Besetzung gehen, sich keine Sekunden langweilen und neue Details wahrnehmen kann: dies spricht für eine sehr gute Produktion, in der alles stimmt. Die allerletzte Aufführung des „Ritorno d'Ulisse in Patria“ - nein, so schön wird er nie wiederkommen - war denn auch sehr gut besucht; frühere Abende scheinen nicht ganz so ausverkauft gewesen zu sein wie die ZLM („Zum letzten Mal“)-Aufführung. Es mag am warmen Sommerwetter gelegen haben, bei dem sich die „normalen“ Opernzuschauer lieber ausruhen als in so etwas wie einer „unbekannten“ Oper anstrengen wollen. Es sei ihnen gegönnt, doch alle, die nicht dabei waren, haben etwas verpasst: einen so leichten wie intelligenten, humorvollen wie tiefsinnigen Opernabend erster Güte. Denn Mariame Clément hat zusammen mit Julia Hansen einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem die Konflikte und Themen von 1640 unmittelbar wirken., wofür man nicht einmal irgendein pseudo-„realistisches“ Theater braucht – nur ein paar sehr hübsche Zaubereffekte und die Naivität eines lustvollen Theaters (samt Revuenixen, in deren Bad sich Held Odysseus witzigerweise älter machen lassen kann). Die Zuschauerin neben dem Kritikerplatz hatte schon Recht, als sie den Zuschauerraum betrat: „Der Blick auf das Meer ist schon mal gut“. Was macht: die Bänder, die, zusammen gesehen, ein monumentales und ruhiges, mit griechischem Licht durchgoldetes Meer zeigen und sich ganz zart im zufälligen Luftzug bewegen, somit die Wellen ganz leicht zum Tanzen bringen. Und vergessen wir nicht die Kostüme: wenn Penelope in der Bogenszene mit einem höchst stilvollen, zudem dramaturgisch sinnvollen, tiefschwarzen, doch durch zarte Silberpunkte akzentuierten Kleid auftritt, ist nicht nur das Glück des Couturiers unter den Zuschauern vollkommen.
Eine zweite Rezension birgt zudem die Chance, auf Versäumtes aufmerksam zu machen; der Kritiker ist, man glaubt es nicht, ja auch nur ein Mensch. Also darf und muss ich das Lob für Yongseung Song verstärken: der Tenor besticht, wie ich geschrieben habe, nicht nur mit den parodistischen Koloraturen des komischen Schmarotzers Iro. Man hört nämlich deutlich, dass Song auch, bei guter Pflege, erstrangige Tenorpartien singen könnte, in denen das sog. Heldische und das Lyrische gleichermaßen glänzen würden. Über die Penelope der Jordanka Milkova muss ich nichts Neues schreiben, denn noch immer betört sie durch den dunklen Glanz ihrer Stimme, durch Intensität im Ausdruck des Leids, durch Genauigkeit der Diktion – und durch ihr faszinierendes Spiel. Zu den Höhepunkten der Aufführung gehört sicher das Mienenspiel zwischen ihr, die gerade von den Freiern bedrängt wird, weil sie scheinbar kurz davor stehen, sie mit Odysseus' Bogen zu gewinnen, und ihm, dem Bettler, hinter dessen Maske sie – das scheint mir eindeutig zu sein – bereits ihren verschollenen Mann erkennt. Was für eine Aura!
Nebenbei: komplexe Inszenierungen wie diese, die nur aufs erste Zuschauen relativ einfach (wenn auch theatralisch äußerst ergiebig) daherkommen, verstärken beim zweiten Mal nicht ganz unwichtige Fragen. Wie also verhält es sich mit Penelopes radikalem Treueschwur? Ist er wirklich moralisch so glanzvoll – oder besitzt die Unbeugsamkeit, mit der sich die Gattin schier durchs Leben quält, nicht auch etwas Pathologisches? Und wie sieht es aus mit dem Dienerpaar, also der glänzenden Irina Maltseva und dem Eurimaco des Dávid Szigetvari? Ist diese Melanto wirklich nur „sexy“, weil sie nur ein Interesse zu haben scheint, indem sie sich von ihrem Eurimaco gern begrabschen lässt? Nun erst fiel mir auf, dass das Gespräch zwischen der Dienerin und ihrer Herrin ungewöhnlich vertraulich ist. Nicht allein, dass sie, die eine soziale Welt trennt, ihre Hände wie Freundinnen aufeinander legen – ist es nicht so, dass die Dienerin wirklich mit ihrer Herrin mitleidet und nicht nur aus egoistischen Gründen möchte, dass endlich wieder am Hof das fröhliche Leben der Vergangenheit wiederkehrt? Ist nicht ihre Ansicht, dass man den Toten und sich selbst nichts Gutes tut, indem man ihnen und sich ewig treu bleibt, zutiefst menschlich und vernünftig? Erweist sich hier nicht die Dienerin als moderne Psychologin: gegen den Mythos der angeblich ewigen Liebe? Und ist ihre Musik nicht wesentlich tiefsinniger als das, was die Worte sagen? „Ein so schönes Band wird niemals reißen“, singen die beiden jungen Leute am Ende ihrer ersten Vereinigungsszene, aber die Musik weiß es besser. Sie weicht plötzlich in ein tieftrauriges Moll aus. Man ahnt etwas, am Ende weiß man, dass wieder einmal mehr Hoffnung als Erfüllung war. Die beiden Turteltäubchen scheinen es selbst schon im tiefsten Unbewussten, das nur die Musik eröffnen kann, zu wissen. Was für eine sensible, gar nicht banale Musikdramaturgie!
Und so fällt noch einmal und von Neuem vieles auf, was im ersten Durchgang zwar schon existierte, aber von der Fülle der Informationen ins Unbewusste des Beobachters verschoben wurde. Wie gesagt und immer wieder: Ein Kerl soll zwar, wie der Kritiker Alfred Döblin ganz richtig bemerkte, eine Meinung haben, aber er ist auch nur ein Mensch. Und so entdeckt er erst jetzt, dass mit der Metapher des Theaters auf dem Theater noch einmal mehr gespielt wurde: Odysseus spielt, indem er sich als alter Mann maskiert, Theater auf dem Theater auf dem Theater. Was wieder auffiel, aber jetzt ausdrücklich gewürdigt werden muss: die Statisten und Choristen spielen alle phänomenal gut. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass jeder Kleindarsteller und jedes Chormitglied in jedem Augenblick „in der Rolle drin“ ist. Allein wie sie, die südländischen Machos, beim Aufruf zum Fest, um die (eine und einzige und bedrängte) Frau herumtanzen – das ist, in der ambivalenten Mischung aus Freude und latenter Gewalt, großes Kino. Ich habe mir auch beim ersten Mal das Gehirn darüber zermartert, welcher Gott neben Zeus, Poseidon, Hera und dem Sohn des Meeresgottes, Polyphem, in der olympischen Kneipe herumsitzt – keine Frage mehr: es ist Apollo, der es liebt, mit seinen Pfeilen auf die Dartscheibe zu zielen – und immer noch witzig ist es, wie einer dieser Pfeile durchs Fenster nach unten fällt, um von den Menschen als göttliches Zeichen fehlinterpretiert zu werden.
Auch so kann man Mythen kritisieren: mit Augenzwinkern.
Apropos Poseidon: Habe ich schon geschrieben, dass der Sänger des Nettuno, Alexey Birkus, über einen 1a-Bass verfügt? Dafür habe ich mich getäuscht, als ich (falsch) bemerkte, dass die schöne und kluge Athene gerne Bücher liest. Da war der Wunsch Vater des Gedankens. Zwar firmiert sie im Mythos als Göttin der Weisheit, doch blättert sie lieber in Zeitschriften. Ich tippe inzwischen auf „Gala“ und ähnliche Yellow Mags. Schließlich wirft sie sich ja auch nur in ihren „klassischen“ blütenweißen Look, wenn sie den Sterblichen erscheinen muss. Ansonsten liebt sie bunte, um nicht zu sagen: hippe, eher körperenge Klamotten. Michaela Maria Mayer sieht in beiden gut aus – und singen tut sie… bei Gott! Und hat sie nicht recht, wenn sie gelangweilt abwinkt, weil der alte Langeweiler Nettuno zum wiederholten Mal auf die pflichtvergessenen Menschen schimpft?
Nein, hier musste niemand mehr schimpfen über irgendein „Regietheater“ oder defizitäre Sängerleistungen. Oder anders: Wenn „Regietheater“ so aussieht, dann wird es höchste Zeit, diesen Begriff aus dem Vokabular zu streichen. Der Beifall war groß, und dies auch, weil an diesem letzten Abend einige Sänger am Ende der Dekade Peter Theilers aus dem Ensemble verabschiedet wurden: nicht nur die wunderbare Michaela Maria Mayer, auch der auch an diesem Abend hervorragende Ilker Arcayürek. Viel Glück! Und kehrt, wenn auch nur gastweise, wieder nach Nürnberg zurück.
Frank Piontek, 20.7.2018
Fotos siehe Premierenbesprechung weiter unten!
TOSCA
Premiere: 4.6.2011
Besuchte Aufführung: 19.7.2018
Wie gesagt: Der Kritiker ist auch nur ein Mensch. Auch er darf und kann sich irren, falls es überhaupt so etwas wie die totale Wahrheit auf dem Theater gibt. Oder anders: Er kann nach Jahren durchaus freundlich auf eine Produktion schauen, weil andere Sänger/Schauspieler auf der Bühne stehen und die vertrauten Rollen mit anderem Leben erfüllen oder weil man nun anders auf diese Sänger schaut.

Im Fall der „Tosca“, inszeniert vom designierten Nürnberger Intendanten Jens-Daniel Herzog, schrieb also der strenge Kritiker anno 2011: „Das Unglück wird im ersten Akt fundamentiert. Von ihm aus – der metaphorischen Idee, dass wir uns in einem Theaterraum befinden – erklären sich die Auswüchse der Sinnlosigkeit: bis hin zum Finale, in dem Tosca erwürgt werden muss, da man von einer völlig leeren Bühne nur in den Orchestergraben springen kann, aber dummerweise (dumm für die Regie) sitzen hier die Musiker.“ Also ein eindeutiger Fall von Konzeptionitis, die vorn und hinten wackelt. Der 2. Akt spielt in der modernen Garderobe der Sängerin, nachdem der erste zunächst in einem (scheinbar, wenn man nicht auf Details achtete,) vollkommenen, auf Alt getrimmten „realistischen“ Raum vor sich ging, also der bekannten römischen Kirche S. Andrea della Valle. Der dritte dann – man „liebt“ ja als Kritiker dieses verbrauchte Bild – auf der nackten, völlig leergeräumten Bühne des Theaters, in dem gerade die Oper gespielt wird. Also insgesamt ein Fall von Kopftheater, in dem, wie der Rezensent damals befand, „die Ängste und Sehnsüchte, die im letzten Akt gespielt werden, sinnlos werden, wenn Tosca im ersten Akt nur als Schauspielerin ihrer künstlichen Gefühle, nicht als pathetisch Liebende, als rasend Eifersüchtige agiert und die Leidenschaft des Begehrens zum bloßen Spiel erklärt werden.“ Das sei, so weiter im kategorisch-apodiktischen Ton, „ein Unsinn, der das Werk, wie es im Programmheft im schönsten Dummdeutsch heißt, 'hinterfragt', um die Affekte nicht ernst zu nehmen, um derentwillen Menschen auf und jenseits der Bühne leiden.“

Tatsächlich kann man das alles, ohne sich zu verbiegen, auch ganz anders sehen. Ziehe ich nämlich einige Sonderbarkeiten und Widersprüche ab, die aufs Konto der gar nicht so dummen Idee vom falschen Schein, vom Theater auf dem Theater, von einer propagandistischen Kunstwelt innerhalb einer Diktatur gehen, bleibt tatsächlich ein ungeheuer spannender Abend, bleiben die absolut ernst genommenen Affekte und Leiden der drei Protagonisten übrig. Nun fand ich es gar nicht so schlimm, dass inmitten des fröhlichen Minstrantengesinges ein Kamera- und Regieteam für kurze Zeit die Illusion eines „schönen“ (Opern-)Inszenierung bewusst bricht. Geschenkt. Es konnte die Spannung und die dramaturgische Genialität des ungeheuren Bogens dieses Eröffnungsakts zwischen einer nur unwesentlich vom fliehenden Angelotti gestörten Liebeskomödie und dem ungeheuren Tedeum nicht stören. Auch der gesamte zweite Akt, also der Garderobenakt, ist von packendster, logischster Stärke; dies nicht allein deshalb, weil Puccinis, Giacosas und Illicas blutige Dramaturgie nicht zu schlagen ist. Es ist tatsächlich logisch, das Verhör in einem heutigen Theater selbst und das Gespräch mit der Diva in „ihrem“ Haus, dem Zentrum ihrer Kunstwelt anzusiedeln.

Dies nämlich ist purer Realismus; dass ein Terroropfer auf der leeren Bühne eines Opernhauses von den Handlangern und Bluthunden der Macht skrupellos hingerichtet wird ist nicht weniger wahrscheinlich als das Massaker an einer Volksgruppe in einem Fußballstadion. Man hat es erlebt, denn die Wirklichkeit ist bekanntlich viel grausamer als jedes „Regietheater“. Und der italienische Tenor David Yim, der schon 2011 der Cavaradossi war, und die wunderbare Katrin Adel spielen so berührend und detailgenau, dass die Frage, wo das alles stattfindet, relativ unwichtig ist. Nicht abgesehen von den spannungsvollen und bösen Begegnungen zwischen Scarpia und Tosca. Wieder spielt Mikolaj Zalasinski (auch dieser großartige und intensiv agierende Sänger und Schauspieler verlässt nun das Haus) den sadistischen Polizeichef mit rollendeckender Deutlichkeit. Nicht nur der spektakuläre erste Auftritt gelingt hier auch szenisch erschreckend. Gänsehautmusik! Und der hervorragende Chor des Staatstheaters tut wieder sein Allerbestes.

Überhaupt die Adel: Das Mädel von Fürth hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere am Nürnberger Haus absolviert. Mit der Tosca krönt sie ihre Mitgliedschaft, die mit dieser Aufführung, dank Entlassung, zu einem ersten Schluss kommt. Sie realisiert so etwas wie eine Quadratur des Kreises, indem sie sowohl die lyrischen als auch die dramatischen Teile der Rolle drauf hat. Sie rührt, bewegt und lässt den Opernaficionado nicht automatisch an die berühmteste Rollenvertreterin dieser anspruchsvollen, weil vielfältigen Partie denken. Und man begreift, warum Cavaradossi die „feurige“ Floria Tosca liebt, obwohl oder besser: weil sie ihm so herrliche Szenen macht – und weil sie, die über eine eigene emotionale Intelligenz verfügt, sich mit dem Geliebten in einen zärtlichen langsamen Walzer hineinschwingen kann, wenn es an der Zeit ist, die Furie beiseite zu legen (dies gegen den wie üblich dogmatischen Attila Csampai geschrieben, der im Rowohlt-Opernführer „Tosca“ den Charakter der Tosca überkritisch, damit wohl auch tendenziell falsch sah). Also: auch en detail bietet diese „Tosca“ ein erfülltes, weil genaues und zugleich musiksensibles Theater.
Wer bleibt noch zu nennen? Jens Waldig, der wie Katrin Adel und der in Nürnberg vokal und gestisch ins Große gewachsene David Yim, singt einen guten Messner, Wonyong Kang einen ausgezeichneter Angelotti, Hans Kittelmann einen Dreckskerl von Spoletta: ein Technokrat des Terrors mit einer vergleichsweise schütteren Stimme. Ida Aldrian (auch diese gute Sängerin verliess leider mit dieser Aufführung das Haus) sprang in der kleinen, aber immer wieder berührenden Partie des Hirten ein; dass er jetzt eine Sie, nämlich eine Putzfrau auf der leeren Opernbühne war, hatte Sinn – denn die Seufzer, die ein Hirte im Jahre 1800, im Uraufführungsjahr des Meisterwerks und im Juli 2018 aussingt, dürften identisch sein.
Keine Einwände also, euer Ehren. Riesenbeifall für einen glanzvollen, packenden und – ja – konzeptionell überzeugenden Opernabend, in dem die unüberhörbare Schönheit (so haben es die Schöpfer der „Tosca“ gewollt) irgendwo am zeitlosen Dreck klebt, den die brutale wie realistische Handlung auch nach 118 Jahren noch aufweist.
Frank Piontek, 20.7.2018
Fotos © Jutta Missbach
DIE RÜCKKEHR DES ODYSSEUS
Premiere: 3.6.2018
Äußerst kurzweilig, witzig, ernst und tiefsinnig
Kennen Sie den Film oder den Roman „Malpertuis“? Da finden sich einige höchst seltsame Gestalten in einer Familiengruft namens „Malpertuis“ zusammen; erst am Ende stellt sich heraus, dass es sich bei diesen verlodderten Gestalten nicht um Belgier des 19. Jahrhunderts, sondern um die alten, eigentlich schon längst verstorbenen griechischen Götter handelt, die Kraft der Zaubermacht des Familienoberhaupts – im Film spielte es der unvergleichliche Orson Welles – in die Gegenwart geholt wurden.
Wer sich in Nürnberg die Neuinszenierung von Monteverdis zweiter überlebender Oper „Il ritorno d'Ulisse in Patria“ anschaut und Jean Rays Roman und/oder Harry Kümels Film kennt, fühlt sich vielleicht daran erinnert. Denn so, wie die Götter in Mariame Cléments äußerst kurzweiliger, witziger und tiefsinniger, ernster und komischer, mit einem Wort: perfekter Inszenierung aussehen, könnten sie geradewegs aus jener Vergangenheit kommen, die von den belgischen Großmeistern des subtilen Horrors erfunden wurde. Neptun ist ein Kapitän, Jupiter ein alter Zausel, seine Göttergattin steht in der olympischen Kneipe hinter dem Tresen, Athene ist eine aufgemotzte junge Dame, die, als Göttin der Weisheit und des Wissens, gerne in Büchern blättert, und selbst Polyphem, der immer noch aus dem Auge blutet, fehlt hier nicht.
Ein wenig ähnelt das einer Travestie à la Offenbach, der sich bei den alten Griechen ja gut auskannte. Was travestiert wird, hat jedoch, und Cléments höchst einfallsreiche wie detailreich subtile – und textgetreue! - Inszenierung macht da kein Ausnahme, einen tiefen Sinn. Schon bei Monteverdi und seinem erstklassigen Librettisten Giacomo Badoaro waren die Götter Sprachrohre und Subjekte der Fantasie und sentenzenhafter Weisheit, die nur im Venedig des 17. Jahrhunderts entstehen konnte. Elend die Menschen, die von der Zeit und den Spielen der himmlischen Mächte abhängen – und töricht der Mensch, der sich gegen die Götter versündigt. Doch wäre Monteverdis Oper kaum für eine moderne Inszenierung zu gebrauchen, reduzierte sich der Gehalt auf derlei Setzungen. Die kongeniale Inszenierung wagt, nachdem man quasi in Champagnerstimmung in die Pause gegangen ist, nach der Pause den radikalen Sprung. Nun sind es die Götter in ihrem nicht sonderlich edlen himmlischen Quartier, die selbst – und erfolgreich - von der Rache jenes Menschen getroffen werden, mit dessen Leben sie vorher gespielt haben, weil sie sich selbst nicht vertragen konnten. So, und nur so, kommt es schließlich zum „Lieto fine“: durch Vernunft und einem Gran von Mitleid, durch das Wissen, dass man auch die Menschen nicht zum Äußersten reizen darf. Denn selbst Minerva, also Athene, die ja auch eine Kriegsgöttin ist und ihren Liebling bis zum bitteren Ende des Freierabschlachtens geführt hat, ist schockiert vom Effekt ihrer liebevollen Bemühungen um die glückliche, aber notwendigerweise blutige Heimkehr des listenreichen Odysseus.

Doch könnte die Oper nicht auch schlicht „Penelope“ heissen? Denn die wartende Gattin, die nur deshalb auf die Hand eines der vielen frechen Freier verzichtet, weil sie sich den Schmerz, den die Liebe im Fall des Falles auszulösen vermag, kein zweites Mal antun will, steht vielleicht im Zentrum der Anteilnahme. An diesem Abend könnte Monteverdis „Ritorno“ auch den Namen einer Titelheldin tragen, weil Jordanka Milkova mit ihrer profunden tiefen Stimme – eine vokale Novität in der Frühgeschichte der Oper – und ihrer vornehmen Ausstrahlung als Königin von Ithaka, ja: königlich wirkt. Wunderbar ist nicht allein ihr Lamento im großen, doch viel zu leeren Bett auf der Bühne auf der Bühne. Schlicht ergreifend ist alles, was Jordanka Milkova allein und zusammen mit ihrem Stückehemann macht. Erkennt sie ihren verloren geglaubten Mann nicht schon, als er in Bettlergestalt die Freier provoziert? Und ist es nicht bewegend, Minerva durch ihren Mund sprechen zu hören, als sie verkündet, dass nur der sie zur Frau nehmen könne, der es schaffe, den Bogen des Odysseus zu spannen? Was im Übrigen nur das umsetzt, was Penelope selbst bemerkt: „Was hat da mein Mund leichtfertig versprochen, was meinem Herzen widerspricht?“ Wie gesagt: die Inszenierung ist zugleich einfallsreich und strikt textgetreu.
„Magisch“: so nennt man wohl derart intelligente und herrlich sensible Momente, die aus Monteverdis und Badoaros Opus das pure, mit Verfremdungseffekten agierende Welttheater machen und die subtilste Psychologie im Musikdrama entdecken. Doch wieso, könnte man fragen, wehrt Penelope sich schließlich so lange, zu akzeptieren, dass Odysseus wirklich ihr Ehemann und kein Gott in Menschengestalt ist? Sie sagt es selbst: Sie sei die Gattin des „verlorenen“ Odysseus. Kein Wunder: das Blutbad, in das der Rachegott Odysseus die Freier getaucht hat (auch der Diener muss dran glauben, doch nicht, wie in der „Odyssee“, die Dienerin), zeigt ihn als einen Anderen: als Massenmörder. Der Schluss aber ist, denn die Regie respektiert das „Lieto fine“, keine Entfremdung, sondern die Wiedervereinigung der beiden Liebenden – und ein Blick auf die endlich ruhige und sonnendurchlichtete See.

Dass die Oper versöhnt und im glücklichen Schluss eine Hoffnung auszudrücken vermag statt auf irgendeine „Realität“ zu setzen: auch dies macht ja, gelegentlich, den Reiz der Gattung aus. Und realistisch, bei Gott, ist diese Inszenierung nun wirklich: in der Zeichnung der liebenswerten und komischen und zynischen Charaktere wie in der kompromisslosen Abrechnung mit den Freiern, in der Trauer über so viel Vernichtung; wenn die Dienerin übrigbleibt, die gewiss gerade an ihren Geliebten denkt, und den Schmutz aufzuräumen hat, während sich Penelope und Odysseus zum ersten Mal „richtig“ begegnen, sagen das Bild und die Musik mehr als 1000 Worte. Tua res agitur, diese Botschaft wird ja schon im Vorspiel ausgegeben, wenn die Allegorie der „Menschlichen Zerbrechlichkeit“ auf das Schicksal, auf die Dame Glück, die gleichzeitig das Unglück ist, und die Liebe trifft. Doch wahrt die Regie stets eine genaue und schöne Form: wenn Minerva NACH dem eher symbolischen Abschuss der Freier die Treppe mit Blut überschüttet, wenn ein plötzlicher Lichtschein – ein schlichter, doch beeindruckender Coup - auf den plötzlich den Bogen spannenden Odysseus fällt und alle Aufmerksamkeit in einem lebenden Bild fokussiert.

Schöne Bilder: Die gibt es in dieser Inszenierung zuhauf. Julia Hansen hat eine Bühne gebaut, die auf der Bühne zwei weitere Bühnen – ganz oben das öfters geschlossene Himmelstheater – und eine elegante Wandverschiebetechnik aufweist, um die Szene jeweils zu vergrößern oder zu intimisieren. Herrlich der monumentale Glitzervorhang, der so gut zum kokett beflügelten Glitzersmoking von Amor passt. Sie, die Liebe, spielt auch die Minerva: Michaela Maria Mayer meistert betörend die koloraturenreichste und in ihrer Beweglichkeit ungewöhnlichste Partie dieser auf die Deklamation gestellten Oper. Sie ist (auch wenn sie, pardon, unmöglich an „meine“ Theatergöttin aller Theatergöttinnen heranreichen kann, weil keine Darstellerin an die Pallas Athene der Jutta Lampe in Peter Steins Schaubühnen-„Orestie“ heranzureichen vermag) – kurz: die Mayer ist eine wunderbare, im Glanz ihrer frohlockenden Stimme und ihres souveränen Auftretens agierende Schutzgöttin, der sich Odysseus zurecht vertraut fühlen kann. Von ihrer Hand würde sich vermutlich auch manch Zuschauer wie zufällig berühren lassen, um jene Kräfte zu erlangen, über die ihr Heros einen Akt später verfügen muss… Wunderbar schon ihr Auftritt im „göttlichen Wagen“, mit dem sie witzigerweise den Telemaco nach Hause bringt – ein silbernes Luftsofa mit leuchtenden Druckknöpfen, die, unsachgemäß betätigt, auch eine Göttin ins Schwitzen bringen können.

Habe ich schon geschrieben, dass diese Meisterinszenierung den Homer mit tiefem Ernst, aber auch mit charmantem Humor ins Heute bringt? Darum bewegt auch die Erkennungsszene von Vater und Sohn, vor der prachtvoll illusionistischen Bergkulisse, hier so bezwingend und rührend. Telemaco, auch er hat bewegteste Koloraturen zu singen, ist mit Martin Platz glänzend besetzt. Nach dem Tamino, dem Matthäuspassionsevangelisten etc. etc. hat er seiner Rollenliste ein weiteres Glanzstück hinzugefügt. Auffallend auch der Tenor des Alex Kim, dessen guter Schweine-Hirt Eumete rollendeckender und vokal genauer nicht sein könnte. Es ist überhaupt erstaunlich, dass die Technik des „recitar cantando“, die einem „normal“ ausgebildeten Sänger vielleicht nicht unmittelbar zu Gebote steht, an diesem Abend stilistisch meist sehr überzeugend gemacht wird. Also müssen auch genannt werden: Iestyn Morris als „menschliche Zerbrechlichkeit“ und Freier Pisandro, Alexey Birkus als „Zeit“ und als Nettuno, die gefeierte Irina Maltseva als blondes Gift namens „Schicksal“ und als Sexy Melanto, die sich vom ungerecht und furchtbar gestraften Eurimaco alias Dávid Szigetvari gern begrabschen lässt. Hans Kittelmann ist Giove und der Freier Anfinomo. Unter der Gruppe der Amanten, die der zu heiratenden Frau die Modelle ihrer Eigenheime als Geschenke eitel darbringen, ragt Wonyong Kang als Primus inter pares heraus. Er ist es, der vergeblich ein Komplott gegen Telemaco und seinen Vater startet – kein Wunder: der Mann ist ein dramatisch profunder Bass. Yongseung Song besticht mit den parodistischen Koloraturen des komischen Schmarotzers Iro. Martina Langbauer überlebt, als treue Amme Ericlea (mit züchtiger Kopfbedeckung, denn Kleider machen Leute, auch und gerade auf dem Symboltheater), das Massaker und darf wenige, aber wichtige Sätze rezitativisch beisteuern. Nicht ganz unwichtig sind auch die Statisten; die drei Najaden, in denen Odysseus buchstäblich badet, dürfen während des Freierschlachtfests jene Spruchblasen hochhalten, die wir aus Comics kennen: Smash, Bang, Slosh… Humorvolles Verfremdungstheater, das Spaß in die Sache bringt – und den Kontrast zur ernsten Frage, was denn das alles für Götter und Menschen bedeute, umso markanter ermöglicht.
Bleibt – die Hauptrolle neben der Hauptrolle der Penelope. Mit Ilker Arcayürek tritt ein Mann auf die Bühne, der vor einigen Wochen als anderer berühmter Opernheimkehrer aus dem Trojanischen Krieg, also als kretischer König Idomeneo, einen schönen Erfolg hatte. Wieder lässt er, diesmal nicht nur in Trauer, auch in wütendem Zorn und viriler Agilität, seinen warmen Bariton zu Gunsten einer tief empfundenen dramatischen Gestaltung ausströmen. Müsste man zwei Gründe benennen, die zum Erfolg dieses Abends wesentlich beigetragen haben, so würde man zuerst Arcayürek und seine Partnerin nennen. Und natürlich die Mayer…

Und das Orchester, das am Ende so gefeiert wird wie das Ensemble und die „Schwarzen“. Wolfgang Katschner, Leiter der Lautten Compagney, hat ein Spezialteam zusammen gestellt, das Monteverdis sparsam notierte Partitur mit Fantasie zum Leben erweckt. Die Frage, die letzten Endes nicht entschieden werden kann, bleibt: Führt man den Notentext mit wenigen Streichern und Cembalo auf? Vor 20 Jahren wurde in Nürnberg eine Aufführung der „Incoronazione di Poppea“ mit einer derartigen Besetzung gemacht; sie war klanglich und akustisch völlig ausreichend. Dies nur als Argument gegen die These, dass das Orchester eines Hauses, das doppelt so viele Zuschauer fasst wie das Teatro S. Cassiano, in dem Monteverdis Werke gespielt wurden, mit wesentlich mehr Spielern ausgestattet werden muss, obwohl ein venezianischer Orchestergraben nicht mehr als etwa ein Dutzend Spieler aufnehmen konnte. Nikolaus Harnoncourt entschied sich vor einem halben Jahrhundert dafür, das Instrumentarium mit Holz- und Blechbläsern, einer Harfe, nicht weniger als drei Posaunen und allerlei anderen schönen zeitgenössischen Instrumenten zu erweitern, wobei er auf nicht weniger als 29 Instrumente kam. Als Ivor Bolton das Werk 2001 im riesigen Raum des Münchner Nationaltheaters realisierte, begnügte er sich mit 20, wobei der Kritiker der „Zeit“ bemerkte, dass der Klang etwas unausgewogen sei. In Nürnberg glückt mit 5 Streichern, einer Blockflöte, einem Cornett, nur einer Posaune, zwei Lauten, einer Harfe, einer Gambe und einer Lirone, zwei Cembali, einer Orgel und einem Regal, also einer Art Kleinorgel, eine nicht ganz kleine, mittlere Lösung. Die Personencharakterisierung durch Instrumentation, die in der Partitur des „Orfeo“ etwas eindeutiger angelegt war, klappt hier hervorragend: Nettuno darf mit der göttergemäßen Posaune rezitieren, Jupiter klingt in Orgel und Regal, Penelopes Rezitative und Ariosi leuchten in Cembalo, Laute, Harfe. Um die Vor- und Zwischenspiele zu gestalten, hat Katschner, basierend auf der Pariser Fassung des Werks (von Emmanuelle Haim), auf Sätze der italienischen und deutschen Zeitgenossen Cavalli und Uccelini, Schein und Scheidt & Co. zurückgegriffen. Wenn zwischen dem letzten Chor der Götter und der Erkennungsszene, in der es gleichsam ans Eingemachte geht, eine Bearbeitung einer Toccata aus den Violinsonaten Alessandro Stradellas erklingt, die den tiefen Ton der Trauer über Götter und Menschen ins Stück einsenkt, verschwistern sich Schönheit und Schmerz. Wolfgang Katschner hat gesagt, dass es keine „alte Musik“ gäbe. Auch in diesem Sinne herrscht an diesem Abend das pure Opernglück. Das Venedig des Jahres 1640 ist plötzlich sehr nah in dieser modernen und zugleich klassischen Interpretation der tief bewegenden „Tragedia di lieto fine“.
Ungewöhnlich starker Beifall, schon zur Pause. Die Nürnberger Oper hat ihrem Programm, als Abschluss der Intendanz Peter Theiler, einen Edelstein hinzugefügt, der nicht mit der letzten Spielzeit des scheidenden Intendanten in der Versenkung verschwinden sollte.
Frank Piontek, 4.6.2018
Fotos: ©Ludwig Olah