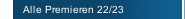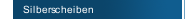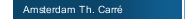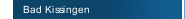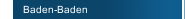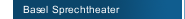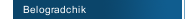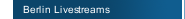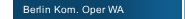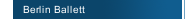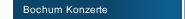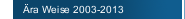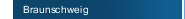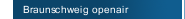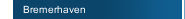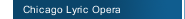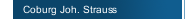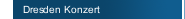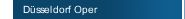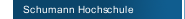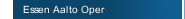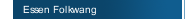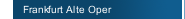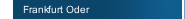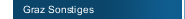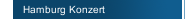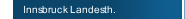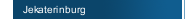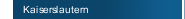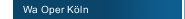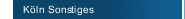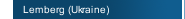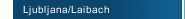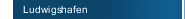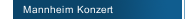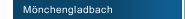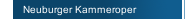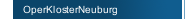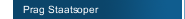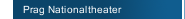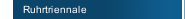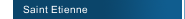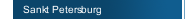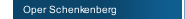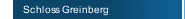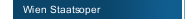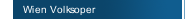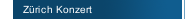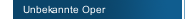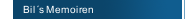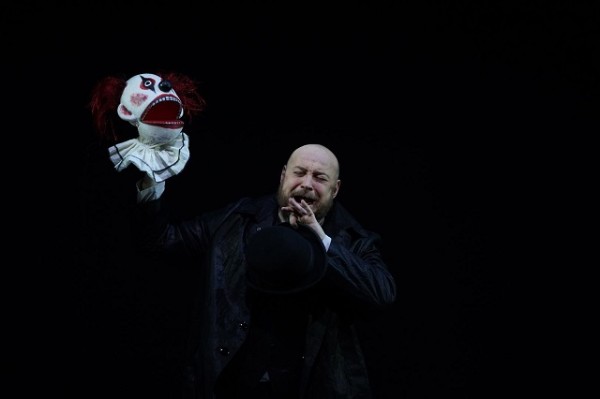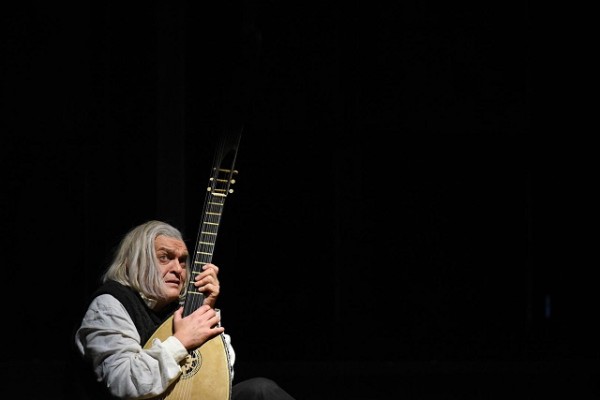Foto: Sven Helge Czichny

www.staatstheater-wiesbaden.de
Friedrich-von-Thiersch-Saal, Kurhaus Wiesbaden,
am 02. September 2022
Beethoven Violinkonzert D-Dur op. 61
Tschaikowski Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64
Anne-Sophie Mutter Violine
Pittsburgh Symphony Orchestre
Manfred Honeck Leitung
Krönender Abschluss
Das diesjährige Rheingau Musik Festival verwöhnte sein treues Publikum mit herausragenden Konzerten aller Art. Gestern gab es einen finalen musikalische Superlativ zu erleben, welcher zu den unbestreitbaren Höhepunkten der diesjährigen Saison gehört.
Zu Gast war das traditionsreiche Pittsburgh Symphony Orchestra und dessen langjähriger Chefdirigent Manfred Honeck. Als Solistin konnte die einzigartige Anne-Sophie Mutter gewonnen werden. Was für eine Kombination!
Zu Beginn erklang das 1806 uraufgeführte Violinkonzert von Ludwig van Beethoven. Zu seiner Zeit war dieses Konzert so völlig andersartig. Allein der erste Satz dauert mit knapp 30 Minuten so lange wie manches gesamte Violinkonzert. Klopft hier in den Pauken beständig die Revolution oder gar das Schicksal an?

Dieses hoch virtuose Konzert gehört zum Kernrepertoire aller Solo-Geiger. Wie oft mag es die große Geigerin Anne-Sophie Mutter gespielt haben? Gerade einmal mit sechzehn Jahren nahm sie dieses Konzert mit Herbert von Karajan auf und seither spielte sie es auf der ganzen Welt.
In diesem Jahr sind es unglaubliche 45 Jahre, die Anne-Sophie Mutter in ihrer überragenden Weltkarriere zurückgelegt hat. Wie wunderbar war die gestalterische Frische und Beherztheit, mit der sie in Wiesbaden spielte, frei von jeglicher Routine, sondern äußerst energiegeladen! Manfred Honeck begann sehr akzentuiert mit der Einleitung. Spannung und Erwartung lagen in diesem Beginn. Honeck sorgte mit deutlichen Akzenten, vor allem auch in den wiederkehrenden vier Paukenschlägen für die notwendige Spannung. Das „Allegro ma non troppo“ nahm Honeck, wie gefordert, nicht zu eilig.

So konnte Anne-Sophie Mutter mit höchster Kantabilität ihre herrlich ausphrasierten Melodiebögen für sich sprechen lassen. Dabei ertönte ihr Spiel schnörkellos, stets natürlich und dabei völlig unaffektiert. In der Solokadenz nahm sich Mutter viel Zeit, die ausgebreiteten Themen weiterzudenken und virtuos zu gestalten. Und bereits hier war spürbar, dass Mutter mit ihrer Violine intensive Zwiesprache hielt. Mit höchster Andacht lauschte das Publikum diesen Zauberklängen. Keinen Muckser gab es! Dabei wirkte die Geigerin zutiefst mit dem hingebungsvoll begleitenden Orchester verbunden. Mit welchem Zartgefühl sodann das großartige Orchester mit feinsten abgetupften, äußerst leisen Pizzikati einstieg, verdient höchste Bewunderung.
Das Larghetto wurde äußerst leise und sehr getragen musiziert. Das Orchester agierte hier kammermusikalisch zurückgenommen, da ein Teil der Bläser und die Pauken in diesem Satz schweigen. Kontemplation und Reinheit fanden hier einen besonderen Raum in bester musikalischer Umsetzung. Hier demonstrierte Anne-Sophie Mutter ihre Sonderklasse. Bis ins kaum hörbare Pianissimo nahm sie den Seelenton ihres kostbaren Instrumentes zurück und verzichtete in weiten Teilen komplett auf das Vibrato. So erlebten die gebannten Zuhörer eine Reinheit und Innigkeit des Vortrages, wie er in dieser Perfektion und Hingabe einzigartig ist.

Wie groß dann der Kontrast in das beschließende Rondo, das zuweilen an Jagdmusik denken lässt! Voller Überschwang spielte Mutter dann ihre überragende Virtuosität aus, wiederum gekrönt durch eine ungemein schwierige Kadenz, die verblüffend selbstverständlich geriet. Honeck gab seinem Orchester die Sporen und dieser spielerische Überschwang gestaltete das Finale mitreißend in imperialer Klanggeste. Die große Künstlerin Anne-Sophie Mutter demonstrierte in Anmut, Bescheidenheit und höchster Könnerschaft, warum sie immer noch die Königin der Violine ist. Glücklich kann sich jeder schätzen, wer diese besondere Frau und Virtuosin live erleben konnte. Ein unvergessliches Erlebnis!
Riesige Begeisterung für die Künstler. Wie ein Mann erhob sich das Publikum zu einer stehenden Ovation. Anne-Sophie Mutter bedankte sich in einer kurzen, persönlichen Ansprache. Sie verlieh ihrer Freude Ausdruck, wieder in Konzertsälen spielen zu können und widmete ihre Zugabe („Sarabande“ aus Partita Nr. 2 d-moll BWV 1004) all jenen Menschen, die diesem besonderen Konzert nicht beiwohnen konnten. Eine berührende Geste.

Im Jahr 1888 entstand Tschaikowskis fünfte Sinfonie, die er als persönliches Bekenntnis seiner Seele verstand. In seinen drei letzten Sinfonien verfasste der Komponist programmatische Angaben, die er dann wieder verbannte. Zu viele Einblicke in sein Innerstes wurden von ihm formuliert. Das verbindende Element in diesen Werken ist die Macht des Schicksals. In den Sinfonien vier und fünf führt der Kampf mit dem Schicksal am Ende ins Licht, während in der beschließenden sechsten Sinfonie der Tod das letzte Wort hat.
Manfred Honeck nahm sich für den klagenden Beginn mit den wunderbar intonierenden Klarinetten viel Ruhe, das Schicksalsmotiv, das dieses Werk so prägt, intensiv zu beschwören. Wie aus dem Nichts blendeten die tiefen Streicher sich zunächst kaum hörbar ein. Mit untrüglichem Instinkt und tiefer Verbundenheit zur Musik traf Honeck traumwandlerisch sicher den rechten Puls, um diesem Meisterwerk alles zu geben. Großartig seine ausgewogene Dynamik, das Hineinhören in die Strukturen und das Ausmusizieren der weitläufigen Melodiebögen.

Und dann war es so weit! Der zweite Satz mit einem der schönsten Sologesänge des Horns, hingebungsvoll vorgetragen und mit schlankem Ton phrasiert. Gäbe es einen Oscar für die beste Solo-Darbietung eines Orchestermusikers, dann wäre der famose Solo-Hornist William Caballero eindeutiger Sieger in diesem Jahr! Mit perfektem Ansatz und feinster Agogik bot er sein Solo, das unvergesslich bleibt für jeden, der diesen Edelgesang hören konnte! Eine innige Zwiesprache mit den meisterhaften Kollegen an Klarinette und Oboe verlieh diesem Andante Cantabile eine faszinierende Wirkung. Mit größtem Gespür und perfektem Timing beschenkte Honeck und das Pittsburgh Symphony Orchestra sein Publikum mit einer gewaltigen Kulmination größter Sehnsuchtsklänge, ehe das wild aufbrausende Schicksalsmotiv alles auflöste.
Leichtfüßig, mit erneuten Eintrübungen des Schicksalsmotivs und spitzen Dissonanzen in den Hörnern führte Honeck durch den Walzer, bevor er dann im beschließenden Andante Maestoso alle Schleusen öffnete und das hingebungsvolle Pittsburgh Symphony Orchestra völlig entfesselt aufspielen ließ.

Mit welchem Furor und größter Präzision dieser Elite-Klangkörper gerade diesen Satz interpretierte, gehört zu den Sternstunden in diesem Konzert-Jahr! Honeck baute immer wieder neue Klangballungen und Spannungsmomente auf, bevor die umwerfend dargebotene Coda, alle Zeugen dieses so denkwürdigen Konzertabends in ein kraftvolles Licht von Trost und Hoffnung stellte. So spannend und aufwühlend, tief bewegend kann die Musik des russischen Meisterkomponisten klingen, wenn ein hingebungsvoll wissend dienender Dirigent seine Passion auf ein Orchester überträgt, welches mit ihm diesen gemeinsamen Weg beschritt! Die Streicher begeisterten in ihrer sonoren Klangkultur und die Blechbläser spielten um ihr Leben, blitzsauber und perfekt in der Intonation.
Das Publikum war nun völlig euphorisch in seiner Begeisterung und jubelte aus vielen Kehlen. Manfred Honeck und das Pittsburgh Symphony Orchestra bedankten sich mit einem Ausschnitt „Panorama“ aus Tschaikowskis Ballett „Dornröschen“ und einem umwerfend virtuos vorgetragenen Galopp aus Aram Khachaturians „Maskerade“.
Dieser denkwürdige Konzertabend war ein Fest und großes Geschenk zugleich für das dankbare Publikum im ausverkauften Friedrich-von-Thiersch-Saal. Sternstunden sind selten, am 02. September 2022 war sie in Wiesbaden zu erleben!
Dirk Schauß, 03. September 2022
(c) Ansgar Klostermann
Rheingau Musik Festival 2022
Besuchtes Konzert am 07. Juli 2022, Wiesbaden
Jean Sibelius Sinfonische Dichtung „Finlandia“ op. 26
Robert Schumann Violinkonzert d-Moll WoO 1
Edward Elgar Enigma-Variationen op. 36
Julia Fischer Violine
Bamberger Symphoniker
John Storgårds Leitung
Ein vielschichtiges Programm präsentierten die gastierenden Bamberger Symphoniker in Wiesbaden. Zu Beginn erklang von Jean Sibelius dessen erfolgreichste Komposition Finlandia. Die 1900 uraufgeführte Komposition gilt den Finnen auch heute noch als „geheime Nationalhymne“. Die große Feierlichkeit im einleitenden Bläserchoral verfehlt selten seine Wirkung. Und bereits in den ersten Takten zeigten die Bamberger Symphoniker eine hervorragende Klangqualität. Perfekt im Zusammenspiel und in der Intonation erklang die Gruppe der Blechbläser. John Storgårds, ist mit der Musik seines Landmanns bestens vertraut. Zeugnis seiner beeindruckenden Kompetenz ist seine sehr hörenswerte Gesamteinspielung aller Sibelius Sinfonien. In seinem Dirigat betonte John Storgårds die große, gesangliche Linie in seinen Phrasierungen, vor allem im ruhigen Mittelteil. Klar und zupackend gerieten die Eckteile der beliebten Tondichtung. Pulsierende Streicher, dazu innige Farben der Holzbläser, ergänzt durch hinreichend prasselnde Beckenschläge ergaben einen spektakulären Beginn, wie er gelungener nicht sein konnte. Mit großer Verve gestaltete Storgårds mit den alles gebenden Bamberger Symphonikern einen unvergesslichen Auftakt!
1853 entstand das letzte Orchesterwerk von Robert Schumann, sein d-moll Violinkonzert. Ein Schmerzenskind, das erst 84 Jahre (!) später uraufgeführt werden sollte. Bis heute haftet diesem Konzert so manches Vorurteil an. Schumann sei hier schon zu sehr seiner geistigen Kräfte beraubt gewesen und was nicht alles sonst noch als Unsinn verbreitet wurde! Komponist Paul Hindemith bearbeitete die Partitur, um sie „spielbarer“ zu machen. Diese Version geriet wieder in Vergessenheit. Schumanns Violinkonzert begreift sich eher als Seelenmusik, denn als Schauplatz für solistische Virtuosität.
Der erste Satz gibt Solist und Orchester viel Raum zur musikalischen Gestaltung. Ein dominantes Hauptthema prägt diesen Satz. Nervös und unruhig beginnt das Orchester, dann übernimmt die Solo-Violine das Thema. Die Violine erhält vielerlei Gelegenheit für barock anmutende Ornamentik. Und doch bestimmt das Fragende und Suchende diesen Eingangssatz. Im zweiten Satz stimmt die Violine ein lyrisch-gesangliches Solothema an. Orchester und die Solovioline tauschen in der Folge mehrfach melodische Führung und Begleitung. Darauf folgt die Überleitung zum tanzartigen dritten Satz. Im dritten Satz zeigen sich Rondo-Elemente ebenso wie Anklänge an eine Polonaise. Schumann verzichtete auch hier wieder auf eine Solokadenz.
Bereits zu Beginn des ersten Satzes umfängt die klangliche Homogenität der Bamberger Symphoniker und gibt dem tieferen Register der Solovioline großen Gestaltungsraum. Solistin Julia Fischer sucht die Gemeinsamkeit im Spiel und verbindet sich fortwährend mit dem herrlichen Tuttiklang des Orchesters. Im zweiten Satz bot Fischer eine breite Gefühlspalette voller Anmut. Herrlich gefühlt gab sie der Eingangskantilene weiten Raum, sekundiert von der edel grundierten Celligruppe des Orchesters. Kontemplation, die leider nur kurz währte. Manchmal sehr zurückgenommen, nach innen musiziert, dann wieder zupackend im Wechselspiel. So ergab sich ein völlig natürlich anmutender Übergang in die Zuversicht und überbordende Lebensfreude des Finalsatzes. Julia Fischer war ganz eins mit ihrem wunderbaren Instrument und beschenkte die Zuhörer mit hingebungsvollem Spiel.
John Storgårds dirigierte mit klaren rhythmischen Impulsen, die von den Bamberger Symphonikern bestens umgesetzt wurden. Jederzeit war die tiefe Kenntnis von Schumanns Violinkonzert bei Storgårds zu erleben. Der Dirigent und Geiger hat dieses Werk bereits etliche Male selbst gespielt und dirigiert.
Große, berechtigte und langanhaltende Begeisterung im Auditorium. Und Julia Fischer bedankte sich mit einer virtuos dargebotenen Caprice von Niccolo Paganini.
1898 schrieb der englische Komponist Edward Elgar eine seiner bekanntesten Orchester Kompositionen, die „Enigma Variations“. Dabei handelt es sich um ein zutiefst biographisches Werk, denn Elgar portraitierte in diesen 14 Variationen die wichtigsten Menschen und Tiere seines Lebensumfeldes.
So lernt der Zuhörer Elgars Frau Alice bereits in der ersten Variation kennen. Besonders berührend und bekannt ist die neunte Variation „Nimrod“. Gewidmet ist sie Elgars engem Freund August Jaeger, der Elgar aus einer tiefen Schaffenskrise führte. Jaeger zog als Vergleich Ludwig van Beethoven heran, dem es ähnlich erging und so sang Jaeger Elgar Beethoven Themen vor. Diese führten zur melodischen Inspiration Elgars für „Nimrod“. Und nicht vergessen werden darf Dan in der elften Variation! Wer war Dan? Elgar beschrieb dessen Missgeschick, ein Sturz in den Bach, aus dem er sich dann wassertriefend befreien konnte. Dan, die englische Bulldogge! Schlussendlich portraitierte sich Elgar selbst in der letzten Variation mit aller orchestralen Pracht!
Große Gelegenheit also für die Bamberger Symphoniker, ihre herausragende Klangkultur und virtuose Spielfreude einem hingerissenen Publikum zu präsentieren. An diesem Abend zeigten die Bamberger Symphoniker eine Qualität, die sie zu den besten Orchestern Deutschlands erscheinen lässt. John Storgårds gab dem Orchester jede Gelegenheit, mit seinem gestalterischen Potential Elgars Freunde charakteristisch wiederzugeben. Die dynamische Bandbreite wurde mit größter Raffinesse entwickelt, so dass für das grandiose Finale alle orchestrale Pracht zur Verfügung stand. Storgårds ließ die Streicher kantabel aufspielen und bot auch den kompakten Blechbläsern reichlich Raum für klanglichen Effekt. Besonders beeindruckte Storgårds Fähigkeit, die Musik ganz natürlich atmen zu lassen. Immer wieder setzte er überzeugende Ruhepunkte, um daraus neue Spannungsmomente zu entwickeln. Die Holzbläser nutzten diese Augenblicke für besondere Farbtupfer und intensive Phrasierungsbögen.
Als Zugabe, noch einmal Sibelius. Mit einem äußerst hintergründig musizierten „Valse triste“ klang dieser anregend schöne Konzertabend aus.
Dirk Schauß, 08. Juli 2022
Geisterstunde in Wiesbaden
Il Trovatore
Premiere: 19.09.2021
besuchte Vorstellung: 26.06.2022
Lieber Opernfreund-Freund,
Verdis Dauerbrenner Il Trovatore in der düsteren Lesart von Philipp M. Krenn geht nach der Premierenserie im vergangenen Herbst in die zweite Runde. Beschränkt sich die Regie auf eine schöne Bebilderung ohne Mehrwert fürs Werk, lässt die musikalische Seite hingegen aufhorchen.

Der österreichische Regisseur Philipp M. Krenn versucht sich bei seinem Troubadour an einer übersinnlichen Deutung. Dazu hat er die Welt der Geister ins Visier genommen, spiegelt einzelne Figuren, hüllt sie in an Schleier erinnernde Plastikfolien und bemüht die Symbolismen des mexikanischen Día de los Muertos, um seine düstere, obskure Interpretation zu visualisieren. Einen Mehrwert für das Verständnis der ohnehin schon verworrenen Geschichte bietet dieser Ansatz nicht und auch das Programmheft des Staatstheaters Wiesbaden leistet dabei keine Hilfestellung, erschöpft sich eher in Besinnungsaufsätzen über Rache, Liebe und Schicksal, anstatt das Regiekonzept in irgendeiner Form zu erklären – wenn es die Regie selbst schon nicht tut. Dabei hat der Bühnenbildner Rolf Glittenberg dem Regisseur eine eindrucksvolle, Verfall und Melancholie preisgegebene Kulisse auf die Bühne gestellt, historische Möbel (außer der Badewanne, deren Sinn sich mir ebenso wenig erschlossen hat wie der Regieansatz selbst) verstärken zusammen mit den hinreißenden Kostümen, die seine Frau Marianne Glittenberg entworfen hat, die Morbidität der Szene. Meisterlich hingegen führt Krenn die Personen und den von Albert Horne exzellent betreuten Chor, der immer die passende Stimmung parat hat – ob als kämpferische Soldaten, okkulte Totenmasken oder als zarter Nonnenchor – und darüber hinaus mit einem hohen Maß an Präzision glänzt.

Sängerisch habe ich überhaupt wenig zu beanstanden am gestrigen Abend. Elena Bezgodkova erweist sich als einfühlsame Leonora mit warmem Timbre, verkörpert stimmlich wie darstellerisch die innere Zerrissenheit ihrer Figur in idealer Weise. Aaron Cawley ist ein gewohnt stimmgewaltig auftrumpfender Manrico. Sein hörbares Abmühen in der Stretta verzeihe ich ihm schnell, so gefühlvoll und metallisch glänzend überzeugt sein Tenor mich im letzten Bild gleich wieder als fürsorglicher Sohn und eifersüchtiger Liebhaber. Die Azucena von Jordanka Milkova kommt düster und undurchsichtig daher. Die Bulgarin packt mich mit ihrer Mischung aus Rachedurst und von schmerzhaften Erinnerungen geplagter Frau, die ihren Ziehsohn, den sie wie den eigenen liebt, opfert, um ihren Racheauftrag zu erfüllen. Schlicht eine Wucht ist Aluda Todua als Conte di Luna; der Georgier zieht alle Register seines facettenreichen, vor Kraft strotzenden Baritons und wird so mein Star des Abends. Young Doo Park hat als Ferrando einen imposanten Auftritt und auch die kleineren Rollen lassen keine Wünsche offen.

Alexander Joel hat die Partitur des Trovatore in einem Interview als „voller Drive“ beschrieben und interpretiert sie genau so, überrascht durch zahlreiche, teils halsbrecherische Tempiwechsel – an der einen oder anderen Stelle offensichtlich sogar das Sängerpersonal. So kommt es gleich mehrmals zu hörbaren Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Bühne und Graben. Wo der Parforceritt allerdings gelingt, zu dem der britische Dirigent die Musikerinnen und Musiker des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden anspornt, erklingt ein spannender, emotionsgeladener Verdi, der aufwühlt und bewegt. Bis Mitte Juli ist dieser Trovatore noch dreimal in der hessischen Landeshauptstadt zu erleben.
Ihr
Jochen Rüth
27.06.2022
Die Fotos stammen von Karl & Monika Forster und zeigen zum Teil die Alternativbesetzung.
DON CARLO
Premiere am 20. März 2022
Zwischen formaler Strenge und politischer Agitation
Die erste Frage bei einer Neuinszenierung von Verdis Don Carlo nach dem Drama von Friedrich Schiller ist: Welche Fassung wird gespielt? Ursprünglich in Paris 1867 als fünfaktige Grand opéra samt Balletteinlagen mit fünfstündiger Dauer herausgebracht, setzte sich zunächst für etwa ein Jahrhundert die gekürzte Mailänder Fassung von 1884 auf internationalen Bühnen durch. Bei ihr entfallen der komplette erste Akt und das Ballett, zudem sind auch etliche Szenen in den übrigen Akten verkürzt. So kommt man auf eine reine Spieldauer von knapp drei Stunden. Für diese Fassung nun hat sich auch das Staatstheater Wiesbaden in der aktuellen Neuproduktion entschieden. Ist man an die fünfaktige Fassung gewöhnt, so fühlt man sich an jene Opernquerschnitte auf Schallplatte erinnert, die sich im vergangenen Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten: Eine schöne Stelle folgt auf die nächste, den Zusammenhang muß man sich jedoch erschließen oder vorher angelesen haben. In Wiesbaden hilft mitunter auch die Übertitelanlage nach. In der Ursprungsfassung erzählt der erste Akt davon, wie der spanische Thronfolger Don Carlos der französischen Prinzessin Elisabeth im Wald von Fontainebleau begegnet, beide sich ineinander verlieben, was sich gut trifft, denn sie wurden bereits ohne ihr Zutun von ihren Herrscherhäusern einander versprochen. Dann jedoch muß Elisabeth aus Staatsräson Carlos‘ Vater, König Philipp, heiraten. Im zweiten Akt dann gesteht Carlos seinem Freund Posa, daß er noch immer Elisabeth liebe, die er entsprechend ihrer Stellung als Ehefrau seines Vaters als seine „Mutter“ bezeichnet. Die in Wiesbaden verwendete gekürzte Fassung setzt nun genau mit diesem zweiten Akt ein. Die Vorgeschichte wird also nicht erläutert. Wenn Carlos nun erklärt, er liebe seine Mutter, könnte der unbedarfte Zuhörer an einen Ödipus-Komplex denken. Die Übertitelanlage beugt der Verwirrung vor und übersetzt „Madre“ hier mit „Stiefmutter“.

Durch den Wegfall der Vorgeschichte, aber auch verbindender Handlungselemente hat die gekürzte Fassung etwas Tableaux-Artiges: In dramatisch verdichteten Szenen werden Schlaglichter auf Schlüsselmomente geworfen. Das von Rolf Glittenberg verantwortete Einheitsbühnenbild nimmt das adäquat auf: Die vordere Hälfte der Bühne wird von einer strengen, nach hinten offenen schwarzen Holzummantelung bestimmt, in der hinteren Hälfte werden passend zur jeweiligen Szene die wechselnden Orte des Geschehens mit wenigen Requisiten markiert: Ein bühnenhohes Kreuz steht für das Kloster, goldgrundierte Gartenbänke für den Innenhof des Escorial, Lampions für einen nächtlichen Garten. Die Kostüme von Marianne Glittenberg nehmen eine unaufdringliche Aktualisierung vor, zeigen überwiegend strenges Schwarz, vor dem sich gezielte Farbakzente in den elegant geschnittenen Kleidern und Roben der weiblichen Protagonisten wirkungsvoll abheben.

Diese formale Strenge nimmt auch der inszenierende Intendant Uwe Eric Laufenberg zu Beginn auf, indem er immer wieder symmetrische Aufstellungen der handelnden Personen bevorzugt und etwa in der ersten gemeinsamen Szene von Carlos und Posa die beiden Freunde gleichsam ritualisierte Aktionen spiegelbildlich ausführen läßt. Dieses Inszenierungselement wird jedoch schnell zugunsten einer flüssigen Personenregie aufgegeben, welche unprätentiös und werkdienlich die Handlung abbildet. Ein weiteres zu Beginn eingeführtes Regieelement zieht sich jedoch als roter Faden durch die gesamte Inszenierung: Der eigentlich nur zu Beginn und zum Ende auftretende Mönch, bei dem es sich im Libretto um den Geist Kaiser Karls V. handelt, spukt als stumme Rolle (dargestellt vom Tänzer Gabriele Ascani) durch den gesamten Abend. Immer wieder wird er durch deutlich sichtbare Wundmale mit dem gekreuzigten Christus identifiziert und weist so auf den Mißbrauch der Religion durch den Großinquisitor hin. An anderen Stellen wirkt das Auftreten des stummen Mönches weniger eindeutig in seiner Symbolkraft. In der Schlafzimmerszene von König Philipp erweist er sich gar als Vexierbild. Wie nebenbei entdeckt man im zerwühlten Bett des Königs eine schlafende Gestalt, deren Nacktheit samt wallend gelocktem Haar unter der Bettdecke hervorlugt. Eine schlafende Schöne, mit welcher der König die Nacht verbracht hat, denkt man.

Irgendwann erhebt sich die Gestalt, in deren schlanken Formen man eine Frau hatte sehen wollen, und erweist sich, durch die Seitenwunde eindeutig gekennzeichnet, als die Christusfigur, welche sich den Mönchshabit überstreift, um den blinden Großinquisitor hereinzuführen. Diese Szene läßt eine ganze Bandbreite von Deutungen zu und steht im Kontrast zu der plakativen Eindeutigkeit, mit der Laufenberg das Publikum in der Autodafé-Szene in die Pause geschickt hatte. Hier hat er der Versuchung nicht widerstehen können, die flandrische Opposition gegen die spanische Herrschaft und die Hinrichtung von Ketzern mit allzu wohlfeiler Aktualisierung zu übermalen. Die flandrischen Deputierten führen die rot-weiße Fahne der belarussischen Opposition mit sich. Als zu verbrennende Ketzer werden Bilder osteuropäischer Oppositioneller vom in Rußland inhaftierten Alexander Nawalny über den von Belarus entführten Roman Protassewitsch bis zur ermordeten Kremlkritikerin Anna Politkowskaja gezeigt.

Die Hinrichtungsszene hatte mit dem Einzug eines lebensgroßen Prozessionsbildes vom Kreuzweg Christi mit Dornenkrone begonnen. Die Bilder der Dissidenten werden jedoch wider Erwarten nicht verbrannt, sondern auf dem Boden ausgebreitet. Der gemarterte Christus aus dem Prozessionsbild legt sich schließlich auf sie, bevor der Vorhang fällt. Diese religiöse Überhöhung von politischer Verfolgung muß man nicht schlüssig finden. Insgesamt nimmt man den Eindruck mit, daß hier zwei Inszenierungsideen miteinander gerungen haben: Die Herausarbeitung des überzeitlich Gültigen aus dem Geist von Schillers Tragödie, welche auch durch Einblendungen von markanten Zitaten auf Zwischenvorhängen präsent ist, und eine plakative Aktualisierung. Uns hat die ritualisierte Strenge des Beginns stärker überzeugt und im Folgenden die Inszenierung immer da gepackt, wo Laufenberg dem Text vertraut hat. Aber angesichts der aktuellen Weltlage mag man die Parteinahme für die Unterdrückten der Gegenwart dem Produktionsteam nicht verübeln. Allerdings werden diese Teile der Inszenierung schnell altern.

Die musikalische Bilanz fällt gemischt aus. Unter der Leitung von Antonello Allemandi spielt das Orchester deftig auf, vieles wird mit breitem Pinsel gemalt. In der Autodafé-Szene erinnert das Fernorchester in seinem unbekümmerten Drauflosmusizieren mit manchen Unsauberkeiten in Intonation und Metrum an eine italienische Dorfblaskapelle (was womöglich sogar den Intentionen des Komponisten nahekommt). Oft tönt es recht laut aus dem Orchestergraben. Das bestimmt auch gerade bei den männlichen Protagonisten die Grundhaltung: Rodrigo Porras Garulo neigt in der Titelrolle zum Forcieren, zeigt mehr als einmal Unsauberkeiten in der Höhe und kann sich gegen das Orchester mitunter nur durch mit letzter Kraft nahe dem Schreien herausgestellten Töne behaupten. Aluda Todua erweist sich als Posa intonationssicherer, erringt aber manche Höhe auch nur mit Druck, was zu uneinheitlichen Lautstärken zwischen den Stimmregistern führt. Ausgeglichener präsentiert sich Timo Riihonen in der Partie des Königs Philipp. Sein dunkler Baßbariton beglaubigt den kühlen Machtmenschen, kann aber auch in der berühmten Arie „Sie hat mich nie geliebt“ mit differenzierter Gestaltung überzeugen und erhält dafür zu Recht starken Szenenapplaus. Young Doo Park kann als Großinquisitor sein prächtiges Baßmaterial voll ausspielen.

Christina Pasaroiu bietet mit ihrem tadellos durchgeformten Sopran als Elisabetta mit differenzierter Gestaltung den denkbar größten Kontrast zu der auftrumpfenden Virilität der männlichen Protagonisten. Dabei gibt sie die zwangsverheiratete Königin nicht nur optisch als Doppelgängerin von Melania Trump: Eine attraktive junge Frau, die sichtlich angewidert vom plump-brutalen Gatten ist. Ihm gegenüber läßt die Pasaroiu ihre Stimme geradezu unterkühlt klingen. Auch gegenüber dem von seinen Emotionen getriebenen Carlos zeigt sie rollengemäß allenfalls eingehegte Gefühle. In ihrem mitreißenden Schlußauftritt schließlich kann sie auch die leidenschaftliche Seite ihrer Figur musikalisch beglaubigen. Dies ist das in jeder Hinsicht überzeugendste Einzelporträt des Abends.
Demgegenüber bietet Alessandra Volpe als Eboli eine lediglich solide Leistung. Die beiden Wunschkonzertnummern ihrer Partie bewältigt sie achtbar, aber nicht bemerkenswert: Für das Schleierlied fehlt es ihr am letzten Quäntchen Geläufigkeit für die arabesken Koloraturen (über die sich allerdings auch schon bedeutende Rollenvertreterinnen hinweggemogelt haben), für die große Selbstabrechnung „O don fatale“ an innerer Glut.
Der Chor wird am Ende weniger für seinen tadellosen Einsatz in der Oper als für den Vortrag eines ukrainischen Liedes im Schlußapplaus gefeiert. Im Übrigen zeigt das Publikum sich mit Regie und Musik zufrieden. Die Heftigkeit im Einzelapplaus entspricht der jeweiligen Durchschnittslautstärke der Sänger, so daß etwa Aluda Todua für seinen phonstarken Posa scheinbar größere Zustimmung erfährt als Christina Pasaroiu für ihre besser abgestufte Elisabeth.
26. März 2022 / Michael Demel
© der Bilder: Karl und Monika Forster
Musikalisches Erlebnis mit Altmännerphantasien
Pique Dame
Premiere: 29.01.2022
besuchte Vorstellung: 13.02.2022
Lieber Opernfreund-Freund,
gut 20 Jahre nach der Inszenierung von Ansgar Haag präsentiert das Staatstheater Wiesbaden seit Ende Januar wieder Tschaikowskys Pique Dame. Dabei kann die musikalische Seite mehr überzeugen als das Setting von Hauschef Uwe Eric Laufenberg.

Von Rolf Glittenberg hat der sich einen riesigen Einheitsbühnenraum bauen lassen, den er abwechselnd mit einem ausladenden Spiel- oder Speisetisch, der auch als Laufsteg für das Defilee der Eitelkeiten dienen darf, und nur wenigen Requisiten wie einem Sofa oder einem Schminktisch bestücken lässt. Das macht Intimität in den leiseren Szenen schlicht unmöglich, auch wenn Laufenberg dank des raffinierten Lichts von Andreas Frank durchaus schöne Bilder gelingen. Die will er durch die eine oder andere Altmännerphantasie aufbrechen, zeigt Damen, die unter den Pelzmänteln nackt sind, und auch die Zarin hat am Ende der Maskenballszene kaum etwas an. Klar wird: hier geht es um Gier in jeder Form, nach Spaß, nach Sex, nach Alkohol und Geld, auch wenn eine tiefere psychologische Deutung des Stoffes unterbleibt. Stattdessen versucht sich Uwe Eric Laufenberg an einer Symbiose von literarischer Vorlage und Oper, lässt das Publikum zwischen den einzelnen Bildern Auszüge aus Puschkins Erzählung lesen und verweigert Hermann am Ende den von Modest Tschaikowsky, dem Bruder des Komponisten, in seinem Libretto vorgesehenen Bühnentod von eigener Hand, sondern lässt ihn wie in Puschkins Vorlage lediglich wahnsinnig werden.

Dessen Darsteller Aaron Cawley ist auch der Primus inter Pares in einer ausnehmend guten Sängerriege. Das Ensemblemitglied trumpft von seiner ersten Szene an stimmgewaltig auf und zeigt als Hermann Heldentenorqualitäten mit nicht nachlassender Kraft und bombensicherer Höhe. Doch auch die leiseren Töne trifft der Ire wunderbar, zeigt glaubhaft, wie Hermann mehr und mehr von den drei Karten besessen ist und darüber seine Liebe zu Lisa vergisst. Die findet in Elena Bezgodkova eine einfühlsame Interpretin, die mit farbenreichem Sopran die Stimmungen und Zustände der jungen Frau überzeugend zu verkörpern weiß. Romina Boscolo in der Titelpartie ist eigentlich viel zu jung für die greise Fürstin und macht doch deren Erinnerungsszene ganz zu der ihren, erzeugt allein mit ihrer tiefen, mysteriösen Stimme Gänsehaut, da sie die Regie nahezu bewegungslos an den Rollstuhl fesselt. Dagegen präsentiert Benjamin Russell die große Arie des Fürsten Jeletzki dermaßen nüchtern, dass es nicht verwundert, dass Lisa schnurstracks in die Arme des leidenschaftlichen Hermann rennt, auch wenn der nicht nur gesellschaftlicher Außenseiter ist, sondern auch bei seinen Militärkumpanen nur als Opfer ihres Spotts geschätzt wird.

In den kleineren Partien überzeugen Almas Svilpa als eindrucksvoller Tomski und Silvia Hauer, die mit hingebungsvollem, weich timbriertem Mezzo als Polina gefällt und in den Duetten mit Elena Bezgodkova zu Höchstform aufläuft. Der von Albert Horne betreute Chor, wie nahezu alle Protagonisten von Marianne Glittenberg vorzugsweise in noble Abendrobe gehüllt, interpretiert die imposanten Szenen meisterhaft, auch wenn Laufenberg seine Auftritte eher schablonen- und kulissenhaft inszeniert.

Im Graben schlägt Oleg Caetani mitunter forsche Tempi an, was zur einen oder anderen unsauberen Abstimmung mit dem Bühnengeschehen führt. Dennoch gelingt es dem erfahrenen Italiener, die russische Szene der Musik zu entfalten, so dass es alles in allem musikalisch ein beeindruckender Abend wird. Gespielt wird die schön bebilderte Inszenierung in dieser Spielzeit noch bis in den Mai hinein und das Staatstheater Wiesbaden durfte jüngst die Kartenkontingente für die kommenden Veranstaltungen aufstocken. Also nichts wie hin!
Ihr
Jochen Rüth
14.02.2022
Die Fotos stammen von Karl und Monika Forster.
WERTHER
Besuchte Aufführung am 13.01.2022

Fleuranne Brockway, Ioan Hotea.
Eine völlig neue Konstellation von „Werther“ (Jules Massenet) bot sich am Hessischen Staatstheater Wiesbaden zur Sichtweise des Regisseurs Ingo Kerkhof welcher alle Nebenfiguren ausblendete und lediglich die vier Hauptpersonen ins Zentrum des Dramas rückte. Dank des großartigen Engagements der Sänger-Darsteller entstand ein spannendes Kammerspiel á la Strindberg dieser tragischen menage a troit. Unterstützt wurde die optische Sogwirkung zudem von der leeren Bühne (Dirk Becker) beherrscht lediglich vom quadratischen Plateau mit einem Baum von oben herabhängend und zuweilen in die Bühnenschräge abgesenkt. Im zweiten Bild vereinte sich das Quartett friedlich zum Picknick bis zur dramatischen Eskalation der Gefühle. Im letzten Aufzug war die Baumumgebung mit Briefen bedeckt welche, als sich dieser letztmals in die Horizontale nach oben bewegte, eindrucksvoll nach unten flatterten. Die Créationen der einfachen jedoch sehr kleidsamen Kostüme entwarf Britta Leonhardt. Fazit: eine sehenswert-anspruchsvolle „moderne“ Produktion von ganz besonderem Flair – bravo!
Dem Dirigenten Peter Rundel sei Dank, dass das Hessische Staatsorchester Wiesbaden wieder in seinen altbewährten Qualitätslevel fand und unter seiner umsichtigen Stabführung den bestens disponierten Klangkörper zu typisch französischen „Sound“ animierte. Rundel vereinte filigrane Akkorde, herb-süße Klänge des Saxophons mit dominanten dramatischen Klangfarben und verlieh der Partitur besonders realistische Dimensionen. Dank subtiler Kombinationen schicksalhafter instrumentaler Einschläge unterstrich der umsichtige Dirigent das tragische Bühnengeschehen auf vortreffliche Weise.
Das relativ sehr junge Solisten-Quartett schien sich bar dieses orchestralen Passepartouts sehr wohl zu fühlen und glänzte mit Höchstleistungen. Allen voran der Titelträger Ioan Hotea, er schenkte der schwärmerischen Lichtgestalt Werther nicht nur darstellerische Gefühlsskalen, sondern setzte auch jene in hinreißend wundervolle Töne um. Der inzwischen 31-jährige rumänische Tenor begeisterte mich in div. Partien so auch insbesondere beim Frankfurter Gastspiel des Elvino. Der smarte Sympathieträger bot dem Antihelden sowohl die optische Idealfigur als auch die vokal-emphatischen Attribute. Hotea sang die Partie in filigran-feinsten Nuancen, hielt stets die Balance zwischen intensivem Ausdruck und wohldosierter Distanz. Der Sänger ließ sein lyrisches Timbre frei strömen, schenkte den exponierten Höhen glanzvolle Strahlkraft, dem Mezza voce dennoch kernig-maskuline Spannkraft. Legatissimo in innigem Schmelz erklangen Piani von umwerfender Schönheit. Eine absolut hinreißende Interpretation!
Darstellerisch wie vokal brachte Fleuranne Brockway für Charlotte ein ideales Rollenprofil mit ein. Zur anmutig ausgespielten Bühnenpräsenz beeindruckte die junge Mezzosopranistin mit überraschend stimmlicher Bandbreite, füllig-dunklen Tiefen mit erregendem Vibrato vereinte die charmante Sängerin zu fein differenzierten Farben, leuchtenden Höhen und zarten tragfähigen Piani. Diese Charlotte dürfte in bester Erinnerung bleiben.
Einen sympathischen, jungen, bestens phrasierenden Albert bot Christopher Bolduc, verlieh der sonst strengen Partie weichere Wesenszüge. Zudem punktete der Sänger mit beweglichem, schön timbriertem, volltönend geführtem Kavaliersbariton auf großer Linie.
Der mädchenhaften Sophie schenkte Michelle Ryan lieblich-silbernen Wohlklang und darstellerische Anmut.
Das den Pandemie-Vorschriften wenige Publikum sowie der Rezensent feierten die Künstler mit langanhaltender Begeisterung. Ich werde mit Sicherheit die letzte Vorstellung am 19. Februar am Vortag zur Elektra-WA mit Catherine Foster, quasi mir beide Aufführungen nicht entgehen lassen.
Gerhard Hoffmann, 15.1.22
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
Foto (c) Monika und Karl Forster
Tristan und Isolde
Aufführung am 13.11.2021 (Premiere am 7.11.2021)
Musikalisch großartig und interpretatorisch interessant!
Das Staatstheater Wiesbaden zeigte die erste Reprise der Neuinszenierung des Hausherrn Uwe Eric Laufenberg von „Tristan und Isolde“ vor einem nur schütter gefüllten Haus - wohl Ausdruck der erneuten Corona-bedingten Auflagen für Theater- und ähnliche Veranstaltungen einerseits und der Angst großer Teile des Publikums, bei den gegenwärtigen Bedingungen hoher Inzidenzen unter Leute zu gehen. Denn an dieser Inszenierung des „Tristan“ und vor allem an der wahrhaft großartigen musikalischen Gestaltung durch Michael Güttler am Pult des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden konnte es nicht liegen. Das hatte man schon in den Premieren-Kritiken lesen können. Nach der bedenklichen Duisburg-Erfahrung am 31. Oktober war es ein Genuss, ein herrlich zur Steigerung gebrachtes „Tristan“-Vorspiel von Beginn seiner Komposition an hören zu dürfen, und drei Viertel davon sogar noch vor geschlossenem Vorhang! Es ist unglaublich, was es zur Einstimmung in das Werk ausmacht, wenn dann zu den letzten Takten der Vorhang hochgeht. Rolf Glittenberg, man kennt seine Ästhetik auch bei Wagner, schuf eine Bühne mit nur wenigen, aber dramaturgisch sinnhaften Elementen. Die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer glänzten wie immer mit fantasievoller und rollenbezogener Eleganz.

Andreas Frank schafft dazu einen Lichtraum, der meist das tiefe „Tristan“-Blau thematisiert und ansonsten manchmal auf grünliche Töne und im Schluss-Aufzug eher auf helle setzt. Generell wird große visuelle Ruhe geschaffen. Die Videos von Gérard Naziri befinden sich in ihrer nur schemenhaften Andeutung gewisser Situationen, Objekte und Assoziationen in beachtlichem Einklang mit der Lichtregie. Zunächst glaubt man Schiffselemente und Wrackteile wahrzunehmen. Am Ende des 1. Aufzugs ist andeutungsweise gar ein auf Grund liegendes Schlachtschiff zu erkennen, wohl Hinweis auf die bald folgenden tödlichen Auseinandersetzungen. Wenn sie auf diese Weise zur Unterstützung optischer Wahrnehmungen dezent assoziativ beitragen, können Videos gerade auch im Einklang mit der Wagnerschen Musik sehr große Effekte haben. Weniger ist mehr, scheint auch hier zu gelten.
Im zweiten Aufzug wird das Bild von einigen zeitweise übertrieben agierenden Tänzer-Pärchen bestimmt, die künstlerisch gestylt sind und sich auch so bewegen, ja manchmal wie altgriechische Marmorstatuen wirken. Sie sollen mit ihren verspielten erotischen Aktionen unter und auf großen Tüchern wohl die Atmosphäre der kurzen Liebesnacht von Tristan und Isolde in all ihren möglichen Facetten metaphorisch ausleuchten. In der Tat wird es einmal so dunkel, das auch das Liebespaar nicht mehr zu erkennen ist. Herrlich dominieren dann der Brangäne-Ruf und das Orchester! Insgesamt ist die Personenführung sehr gut.

Im dritten Aufzug gibt es einige Überraschungen, die aber in einem Thema liegen, welches den Regisseur und seinen Dramaturgen Wolfgang Behrens besonders interessiert: Und zwar, dass die vier „Augenblicke“ zwischen Tristan und Isolde immer unter prekären Bedingungen stattgefunden haben bzw. stattfinden, bedroht sind, oder von vorneherein verschoben. Der erste fand ja vor der eigentlichen Handlung statt und wird von Isolde Brangäne gegenüber mit „Er sah mir in die Augen…“ referiert. Es war eine widrige Situation, denn Isolde erkannte in dem Moment, dass Tristan ihren Verlobten Morold im Kampf getötet hatte. Im 1. Aufzug schreibt Wagner beim gemeinsamen Genuss des Liebestrankes „Beide blicken sich in höchster Aufregung unverwandt in die Augen“, wobei die Gemeinsamkeit fast fehlschlägt. Denn Tristan trinkt vor Isolde und scheint ihr kaum etwas übrig zu lassen. Eine „Ungeschicklichkeit“, wie Behrens völlig zu Recht schreibt, hätte fast das vorzeitige Scheitern ihrer Liebe bedeuten können! Auch dieser „Augenblick“ ist jedenfalls von kurzer Dauer und prekär, denn schon stellt sich König Marke mit seinem Gefolge ein. Dass es dem Regieteam vor allem auf den „Augenblick“ ankommt, zeigt es auch durch eine winzige Schale für den Liebestank.
Im 2. Aufzug ist Tristans und Isoldes „Augenblick auf eine Länge gedehnt, die dem Wort ‚Augenblick‘ Hohn zu sprechen scheint“, meint Behrens wiederum plausibel, denn Wagner operiert hier mit „himmlischen Längen“, um ekstatische Zustände - wenn auch anderen Charakters - zu strecken. Durch die Bewusstheit der Theorie von Tag- und Nachtwelt findet das Paar wieder zur Welt- und Selbstvergessenheit. Somit sind Tristan und Isolde erwachsener geworden. Sie reflektieren mehr als bei den beiden ersten „Augenblicken“ in der Vorgeschichte und im 1. Aufzug.

Im 3. Aufzug ist die Erwartung eines gemeinsamen und langen „Augenblickes“ wieder prekär. Denn Tristan stirbt zuerst, kann bei seinem finalen „Isolde“ nur noch einen letzten kurzen Blick auf die zu spät Gekommene werfen. Sie sterben also getrennt, Tristan in seinen Fieberphantasien, Isolde im darauf folgenden Liebestod. Es gibt, de facto, nicht die so ersehnte Gemeinsamkeit im Tode, die „höchste Lust“, von der Isolde am Schluss singt. All diese Überlegungen von Laufenberg und Behrens scheinen mir für eine differenzierte, ja vielleicht gar neue Sicht auf das Oeuvre „Tristan und Isolde“ äußerst interessant und sinnhaft. Nur, wie sie ihren Wunsch nach einer tatsächlichen Erfüllung des letzten und damit wohl ewigen „Augenblickes“, also der „höchsten Lust“ eines gemeinsamen Übergangs in den Liebestod szenisch darstellen, erscheint mir dramaturgisch nicht überzeugend und in dieser Form auch gar nicht erforderlich. Und es ist im Sinne Wagners auch nicht richtig. Nachvollziehbar, ja sogar eindrucksvoll ist ja noch, dass der gesamte Hofstaat Tristans in Kareol in schwarzer Trauerkleidung entsetzt dessen Leiden sieht. Dass sich dann aber alle angesichts des zu erwartenden Endes - der schwarze Sarg ist schon da - eine/r nach dem/r anderen gewissermaßen als letzten Treuebeweis in ein offenes Grab stürzt, wirkt schon recht bizarr. Sie hätten doch mit gesenkten Köpfen abgehen können. Dass dann aber der in einem ohnehin ästhetisch überhaupt nicht zur eher mythisch konzipierten Regie in einem profanen Stationsbett liegende Tristan sich in der Ekstase bis auf den Verband entkleidet und ebenfalls in das Grab steigt und später ein nackter Mann aus diesem hervorkommt und sich tot in das Bett legt, wirkt dezent gesagt, allzu überraschend und verstörend. Im Gerangel des Kampfes am Ende wird dieser Mann - für die Zuseher nicht sichtbar – schnell gegen den „echten“ Tristan ausgetauscht, der dann zusammen mit Isolde eben doch noch den einen letzten „Augenblick“ genießen kann, der nicht prekär oder abgeschnitten, sondern ewig ist, den gemeinsamen Übergang in den Liebestod mit „höchster Lust“. Das hätte man doch viel einfacher haben können, wie es einst in Nürnberg zu sehen war. Der beim Anblick Isoldes verstorbene Tristan erwacht bei ihrem Liebestod - und eben durch dessen Intensität - zu einem transzendierten neuen Leben, das beide den gemeinsamen Übergang ermöglicht. Außerdem hat er, anders als nun in Wiesbaden, eben doch noch einen letzten kurzen „Augenblick“ mit Isolde gehabt… Das konnte also nicht überzeugen.

Marco Jentsch singt einen edel wirkenden Tristan mit einem schlanken lyrisch dramatischen Tenor. Er wird sicher ein guter Parsifal sein, und weitere Optionen auch bei Wagner deuten sich an. Barbara Havemann kommt als Isolde am besten mit den dramatischeren Tönen zur Recht, auf die sie sich mehr als man sollte zu konzentrieren scheint. Denn ihre Mittellage hat nicht die Fülle und Geschmeidigkeit, die man bei einer Isolde gern hören möchte. So stellt sich keine runde und klanglich ausgewogene vokale Leistung ein. Darstellerisch macht sie ihre Sache jedoch ausgezeichnet, bei etwas begrenzter Mimik. Young Doo Park ist ein ganz vorzüglicher Körnig Marke mit profundem und technisch bestens geführtem Bass sowie einer Lust, auch den oft zu passiven Marke-Monolog einmal schauspielerisch zu gestalten. Sein langer Monolog wird somit auch theatralisch zu einem Ereignis. Michael Kupfer-Radecky sprang als immer wieder bewährter Kurwenal mit kraftvollem Bariton und guter Aktion ein. Diese Rolle scheint ihm auf den Leib geschrieben. Khatuna Mikaberidze ist eine Brangäne mir sehr klangvollem und schön timbriertem, bisweilen fast dramatischem Mezzo sowie einer rollenentsprechenden Darstellung, wie sie hier relativ begrenzt verlangt wird. Julian Habermann singt den jungen Seemann mit einem guten Tenor aus dem Off. Erik Biegel ist mit seinem Sprechgesang ein sehr aktiver Hirt in einem viel zu großen, aber deshalb interessanten Gewand. Andreas Karasiak singt dem Melot mit einer etwas zu engen Stimme. Yoontaek Rhim absolviert die zwei Zeilen des Steuermanns zuverlässig.
Das beste von allem war jedoch Michael Güttler mit dem Hessischen Staatsorchester Wiesbaden. In einem Haus, das nicht nur ein prunkvolles Foyer aus „längst vergang‘nen Zeiten“ aufweist und einen daran denken lässt, was alles noch da sein könnte, wenn die Jahre 1944/45 anders gelaufen wären, hat das Wiesbadener Staatstheater offenbar auch eine ausgezeichnete Akustik. Aber auch bei der muss man gut musizieren. Güttler bewies durch ein ungemein nuancenreiches Dirigat und im Nachfühlen emotionaler Momente auf der Bühne seine große Kenntnis von Wagners opus summum. So war es eine Freunde, diesem Klangerlebnis beiwohnen zu können. Ganz nebenbei sei gesagt, dass es durchaus auch wunderbar sein kann, wenn das Englischhorn wie in Duisburg nicht die ganze Zeit auf der Bühne ist, sondern im Graben gespielt wird. Der von Albert Horne einstudierte Chor des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden bewies ebenfalls seine große Kompetenz. Ein weitgehend szenisch, aber vor allem musikalisch erfreulicher Abend - mitten im prekären neuen Berliner „Ring“ an der DOB!
Fotos: Monika und Karl Forster
Klaus Billand/4.12.2021
www.klaus-billand.com
Giacomo Puccini
IL TRITTICO
Streaming-Premiere am 09. Mai 2021, Hessisches Staatstheater Wiesbaden
Packender Opernabend voller Überraschungen
TRAILER
Als erstes Theater in Hessen präsentierte das Hessisches Staatstheater Wiesbaden einen großen Opernabend in voller Besetzung. Um es vorwegzunehmen: es war ein außergewöhnliches Erlebnis!
Wunderbar spielfreudig agierte das sehr engagierte Ensemble, das mit ungemeiner Wandlungsfähigkeit begeisterte.
Diese spannende Premiere verblüffte mit vielen Überraschungen. Da ist zunächst einmal die gelungene Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg. Nach seinem schwachen „Ring“ und einem unsäglichen „Rigoletto“, gelang ihm seine bisher überzeugendste Regie-Arbeit. Laufenberg verfremdet zu keinem Zeitpunkt die Handlungsverläufe, meidet im Gianni Schicchi jeglichen Klamauk und erzählt jeweils schlüssig, packend die Geschichten. Die Personenführung wirkt en Detail gut gearbeitet.

Der „Tabarro“ spielt in einer Industrielandschaft, Kräne sind im Bühnenhintergrund zu sehen. Allerdings wirkten die sehr neu wirkenden Kostüme etwas beißend im Kontrast. Hier fehlte der Schmutz der anstrengenden Arbeit. Gut wurde die Entfremdung zwischen Giorgetta und Michele aufgezeigt, die den Verlust des Kindes nicht verkraftet haben. Leidenschaftlich verzehrt sie sich an ihrem Liebhaber Luigi. Dieser wird am Ende von Michele erstickt, in dem dieser ihm das Knie auf die Kehle drückt. Amerika lässt grüßen....
„Suor Angelica“ wird in einem minimalistischen Bühnenbild geboten. Die Bühne öffnet und schließt sich, gibt unterschiedliche Einblicke. Die Nonnen führen ein karges Dasein. Einzige Freude ist die Fontäne eines Brunnens und ein leibhaftiger Esel. Sehr autoritär agiert die Äbtissin in diesem Kloster.
Höhepunkt der Aufführung war das spannende Duett zwischen Suor Angelica und ihrer Tante. Spannend wie ein Thriller umkreisten sich die Sängerinnen. Dann verkroch sich Suor Angelica vor Angst unter dem Tisch, während die Tante den Tisch bestieg und sich selbst überhöhte. Nach deren Todesmeldung von Angelica, geriet Angelica in völlige Apathie. Daher wurde sie von den Mitschwestern gezwungen, das Testament zu unterzeichnen, in dem eine Schwester ihr dabei die Hand führte. Als Strafe zog ihr die Äbtissin mit kalter Wut den Stuhl weg, so dass Angelica zu Boden sank. Das ging unter die Haut.
Am Ende erscheint nicht die Madonna, sondern Jesus mit dem verstorbenen Kind von Angelica und schenkt somit Angelica die ersehnte Erlösung.

„Gianni Schicchi“ ist hier die Geschichte von Neu-Reichen, die es richtig krachen lassen wollen. Witzig mit viel Situationskomik agiert das vortreffliche Ensemble. Auch hier überzeugt die Inszenierung auf ganzer Linie.
Bühnenbildner Gisbert Jäkel schuf passende Bühnenräume, die jeweils eine eigene Stilistik für das jeweilige Stück boten. Sekundiert wurde er durch die gelungenen Kostüme von Jessica Starge. Andres Jung schuf beeindruckende Lichteffekte. Chordirektor Albert Horne sorgte für blitzsauberen Chorgesang.
Bis auf wenige Gäste demonstrierte das Wiesbadener Sängerensemble eindrucksreich seine Kompetenz und Vielfalt.
Im Mittelpunkt stand die Sopranistin Olesya Golovneva, die alle drei Sopranpartien begeisternd darbot.
Sie war eine verletzt wirkende Giorgetta, die überzeugend ihren Hunger nach Lebensfreude, Ausbruch aus ihrer Ehe und nach Leidenschaft aufzeigte. Der Verlust ihres Kindes war ihr jederzeit anzumerken. Habe ich sie bislang immer reichlich unterkühlt erlebt, so wirkt sie hier überraschend anders! Wie ausgewechselt agierte sie mit Volleinsatz und größter Risikofreude. Sehr textbezogen, dynamisch im Vortrag, manchmal leicht gefährdet in der extremen Höhe, gab sie ihrer Rolle alles. Fabelhaft!

An ihrer Seite agierte als wuchtiger Michele Daniel Luis de Vicente mit machtvoll, dunklem Bariton. Es gelang ihm ein vielschichtiges Charakterbild, gleich einem ruhenden Vulkan, der in der Kulmination seines Monologes beeindruckend explodierte. Einzig beim Mord an Luigi wirkte er etwas gebremst. Hier fehlte das völlig Unkontrollierte, wie es z.B. Juan Pons unnachahmlich realisierte. Davon abgesehen war er eine sehr gute Wahl.
Haustenor Aaron Cawley zeigte seine bisher beste Leistung am Haus. Klar und selbstsicher die Darstellung. Den großen Schwierigkeiten seiner vertrackten Partie begegnete er mit staunenswerter Lässigkeit. Zudem öffnete sich seine Stimme herrlich in der Höhe. Leider artikuliert er immer noch verwaschen, so dass ihm immer noch die letzte Wirkung zu herausragender Größe fehlt.
Wunderbare Charaktere schufen die hinreißende Romina Boscolo (Frugola), Wolf Mathias Friedrich (Talpa) und Eric Biegel (Tinca).
In Suor Angelica durften viele Chorsängerinnen kleinere Solopartien übernehmen, was ausnehmend gut gelang.
Olesya Golovneva war eine Idealbesetzung für die schwierige Rolle. Wunderbar lyrisch mit leuchtender Höhe durchmaß sie alle Stationen ihrer fordernden Partie mit größter Identifikation. Und doch war es die überragende Romina Boscolo als Zia Principessa, die sie in die Schranken verwies. Mit pastoser Altstimme und größter Bühnenpräsenz war sie eine perfekte Besetzung auf allerhöchstem Niveau. Verblüffend erinnerte sie zuweilen an die große Fedora Barbieri.
Zu loben ist Fleuranne Brockway für ihre große Wandlungsfähigkeit, die dann als äußerst zickige Ciesca im Gianni Schicchi kaum wiederzuerkennen war. Sie war eine grausam furchteinflößende Äbtissin, die die Szene beherrschte und dazu mit ihrer Stimme gefiel.
Feine Sopranfarben steuerten Stella An (Genoveva)und Britta Stallmeister (Dolcina) bei.

Ein leichtfüßiger Ausklang bot dann schlussendlich „Gianni Schicchi“. Herrlich losgelöst sang und spielte Daniel Luis de Vicente den schlitzohrigen Strippenzieher.
Einmal mehr begeisterte Olesya Golovneva nun als Lauretta. Mit sehr eigener Note verwöhnte sie mit fein abdosierter Dynamik ihr „Oh mio babbino caro“.
An ihrer Seite mit fein schmachtendem Tenor Ioan Hotea als Rinuccio.
Das übrige Ensemble wurde angeführt von der wunderbaren Romina Boscolo als dominate Zita.
Auch aus dem Orchestergraben gab es eine große Überraschung. Selten war das Staatsorchester Wiesbaden derart ausgewogen und subtil zu vernehmen. Da klapperte kein Einsatz, alle Instrumentengruppen harmonierten trefflich miteinander. Die Einsätze, vor allem in den Bläsern gelangen mustergültig. Und auch Gast-Dirigent Alexander Joel wirkte erneuert. Nach seinem äußerst faden Ring-Dirigat überzeugte er hier auf ganzer Linie mit einer fein ausgehörten Interpretation. Immer bei den Sängern, zeigte er viel Nähe zum Impressionismus. Dabei scheute er auch nicht die Härten und Eruptionen. Die dynamische Kontrolle geriet vorbildlich. Einzig beim „Gianni Schicchi“ bereiteten die vielen Taktwechsel dem Orchester noch etwas Schwierigkeiten. Dies mag sich aber noch leicht beheben.
Fazit: Dieser Abend ist eine der besten Opernproduktionen, die Wiesbaden bisher in der Verantwortung Laufenbergs zeigte! Auch die musikalische Einstudierung hat beste Vorarbeit geleistet, da die Sänger ihre Rollen wunderbar textbezogen gestalteten.
Zu loben ist überdies die sehr gute Kameraführung und die feine Tonqualität der Übertragung. Diese Produktion ist in diesem Monat noch mehrmals als Stream auf der Internetseite des Hessischen Staatstheaters buchbar. Unbedingt empfehlenswert. BRAVO an das Hessisches Staatstheater!
Dirk Schauß, 13.5.2021
Bilder (c) Forsters
MATTHÄUSPASSION
Bericht von der zweiten Aufführung am 22. Januar 2020 (Premiere am 18. Januar 2020)
Nicht Fisch, nicht Fleisch
Die Passionsgeschichte des Evangelisten Matthäus bietet bereits im biblischen Original großes Kino: eine dramatische Verhaftungsszene, ein spannender Prozeß, drastische Folterberichte und eine Hinrichtung mit apokalyptischen Begleiterscheinungen samt Finsternis, Erdbeben und aus den Gräbern erstehenden Toten. Johann Sebastian Bach hat diesen Text in lebendigen Rezitativen und plastischen Turbachören wirkungsvoll vertont. Nimmt man alleine dieses Gerüst, dann hat man ein traditionelles Passionsspiel. Daß dieser starke Handlungsverlauf immer wieder reflektierend und kontemplativ von Arien unterbrochen wird, unterscheidet das Passionsoratorium rein formal nicht von einer typischen Barockoper. Es ist vielmehr das von Bach bei der Wahl der Arientexte und ganz besonders beim Einflechten von Kirchenchorälen dezidiert verfolgte theologische Programm, welches das Werk als tönende Predigt für Opernbühnen heikel erscheinen läßt. Die wenigen gelungenen szenischen Adaptionen, etwa das Ballett von John Neumeier oder die „Ritualisierung“ genannte halbszenische Einrichtung von Peter Sellars, sind einen Weg der gestischen Abstraktion gegangen. Dem Programmheft ist in einem Doppelinterview mit der Regisseurin Johanna Wehner und dem Dirigenten Konrad Junghänel zu entnehmen, daß es die gemeinsame Linie des Produktionsteams war, keine szenische Umsetzung des Passionsgeschehens auf die Bühne zu bringen. Ein solches Vorgehen bezeichnet die Regisseurin als „Oberammergau“ und „Horrorvision“. Leider bleibt die Frage, was denn sonst dargestellt oder gezeigt werden soll, den gesamten Abend über unbeantwortet.

Das Bühnenbild von Volker Hintermeier wird dominiert von einem riesenhaften, liegenden Kreuz, welches leicht abschüssig in den Orchestergraben hineinragt. Es zitiert barocke Formen und wird baldachinartig von einer modernen und mit Neonröhren bestückten Kreuzesvariante in der Höhe gedoppelt. Im Hintergrund sind allenfalls schemenhaft die Umrisse der Rosette eines Kirchenfensters zu erkennen. Sie verschwindet fast vollständig hinter dichtem Dauernebel, so als habe die Regisseurin diese Andeutung eines sakralen Raumes im letzten Moment wieder unsichtbar machen wollen. Die gewaltige Kreuzesskulptur entfaltet eine solche Wucht, daß man ihr szenisch irgendetwas von vergleichbarer Stärke entgegensetzen müßte. Das gelingt im Verlauf der Aufführung kaum, auch weil die Regisseurin ersichtlich nichts mit dem theologischen Programm Bachs von Schuld, Sündentilgung und Blutopfer anzufangen weiß. Worum es aber sonst gehen soll, bleibt in ihren Erläuterungen im Programmheft blaß („… ich will nur sagen, daß wir in eine Auseinandersetzung damit treten müssen, wen wir anklagen oder wen wir beschützen, wenn wir meinen, es gäbe dort jemanden, der für uns die Sünden trägt.“), auf der Bühne bleibt es unsichtbar.

Julian Habermann (Evangelist) mit Chor
Die beiden Kreuzbalken dienen bloß als Laufstege, auf denen die Protagonisten mal herumschreiten, mal verharren. Der Chor findet seinen Platz links und rechts davon. Die längste Zeit sitzt oder steht er einfach da. Irritierend ist, daß die Chorsänger Notenpulte vor sich haben. Der Inszenierungsgedanke dahinter erschließt sich nicht. Womöglich war es ihnen einfach nicht möglich, den Text auswendig zu lernen, so daß die Regie das Aus-den-Noten-Singen einfach mitinszeniert hat. Gekleidet ist der Chor in wahllos erscheinende Kostüme aus mehreren Jahrhunderten, die von der Trauerfarbe Schwarz dominiert werden. Mitunter werden Sonnenbrillen getragen, warum auch immer. Leider läßt die Textverständlichkeit des Chores zu wünschen übrig. Er bewältigt ansonsten seine umfangreichen Einsätze musikalisch insgesamt ordentlich. Wenn man einen Opernchor dabei im Hinblick auf Lockerheit bei den Koloraturen und Transparenz im polyphonen Partiturgeflecht nicht an den Maßstäben mißt, die auf Barockmusik spezialisierte Ensembles setzen, kann man mit der Leistung zufrieden sein.

Konstantin Krimmel (Jesus) mit Chor
Optisch und musikalisch ist Konstantin Krimmel ein idealer Darsteller des Jesus. Von großer Gestalt, mit langen Haaren und Bart sieht er aus, als ob er aus einem Altarbild gestiegen wäre. Sein Bariton verfügt über eine attraktive Mittellage, eine leuchtende Höhe und ein kernig-sattes Fundament in der Tiefe. Der junge Tenor Julian Habermann tut sich in der ersten Hälfte des Abends ein wenig schwer mit der hohen Lage der Partie des Evangelisten. Auch zeigt er leichte Textunsicherheiten. Mehr und mehr faßt er aber Tritt und hinterläßt so insgesamt mit deutlicher Artikulation einen soliden Gesamteindruck. Szenisch hat die Regie für ihn wie für alle anderen oft nichts anderes zu tun, als zu schreiten oder zu verharren. Immerhin darf er gelegentlich mit einer Handgeste auf andere Beteiligte weisen, die gerade erwähnt werden oder deren Auftritt bevorsteht.

Einen guten Eindruck hinterlassen die beiden Solistinnen. Anna El-Kashem kann ihren hellen, schlanken und koloraturensicheren Sopran stilgerecht einsetzen. Sehr schön, in schlichter Trauer und ohne Pathos etwa gelingt im Zusammenspiel mit Oboen und Flöte die Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“. Der Alt von Anna Alàs i Jové klingt im Kontrast dazu opernhaft-üppiger. Aber auch sie gestaltet ihre Arien geschmackvoll und überzeugt mit dunkler Abtönung ihrer Stimme gerade auch in der inzwischen zur Wunschkonzertnummer verkommenen Arie „Erbarme dich“. Die Bariton-Arien bewältigt Wolf Matthias Friedrich kernig und mit sehr intensiver Artikulation. Er hat dabei die Eigenart, immer wieder einzelne Töne und Silben dynamisch zurückzunehmen, was auf Kosten der Gesangslinie geht. Gerne hätte man gehört, wie Benjamin Russell mit seiner frischeren und samtigeren Stimme diese Arien interpretiert. Er darf lediglich in den Kleinpartien des Judas und Pilatus zeigen, über welches Potential er verfügt.

Konrad Junghänel hat die Musiker wie gewohnt zu historisch informiertem Spiel angehalten mit vibratoarmen Streichern und Holzbläsern sowie sprechender Artikulation. Doch anders als bei seinen farbigen Mozart-Interpretationen wirkt der Klang hier monochrom, stellenweise ruppig und grobkörnig. Auch scheinen die szenischen Aktionen und die Verteilung der Protagonisten in der Tiefe der Bühne sich ungünstig auf die Koordination der Einsätze ausgewirkt zu haben.
Insgesamt kann die ordentliche musikalische Qualität für sich genommen nicht begründen, warum man mit einem Opernensemble ein Werk aufführt, bei dem die Erwartungshaltung des Publikums seit Jahren von in immer höhere Sphären der Perfektion entschwebenden Spezialensembles geprägt wird. Wenn man der Regisseurin zugestehen will, daß sie keine platte Bebilderung des Textes gewollt hat, dann hätte deutlicher werden müssen, wofür der szenische Aufwand mit Bühnenbild und Kostümen denn sonst betrieben wurde. Daß nämlich, wie die Regisseurin sagt, das Passionsgeschehen nur in der Musik stattfinde und sich ausschließlich vor dem inneren Auge des Zuhörers entfalte, gilt für jede herkömmliche konzertante Aufführung ebenso. Die Wiesbadener Produktion ist damit weder Fisch noch Fleisch: Sie überzeugt nicht als reines Oratorium, und als Opernaufführung verläßt sie sich zu sehr auf die Wirkung eines starken Bühnenbildes, dem sie gestisch wenig entgegenzusetzen hat.
Michael Demel, 29. Januar 2020
© der Bilder: Karl und Monika Forster
DER ROSENKAVALIER
Premiere am 10. November 2019
Walzer am Rande des Abgrunds
„Kommt mir bekannt vor“, sagt der Premierengast zu meiner Linken. So wie hier hätten Regisseur und Bühnenbildner seinerzeit bereits ihren Rosenkavalier an der Berliner Staatsoper ausgestattet. In der Pause findet er auch Beweisphotos dazu – das Internet vergißt nichts. Tatsächlich zeigen die Bilder aus Berlin eine sehr ähnliche Rotunde, einen eineiigen Zwilling des Wiesbadener Bettes im ersten Akt und auch einen unmittelbaren Modellvorgänger der vergoldeten Globus-Minibar im zweiten Akt. Warum auch nicht? Man muß das Rad nicht immer neu erfinden, insbesondere nicht, wenn es optisch so wirkungsvoll ist wie dieses Bühnenbild von Raimund Bauer. Die klassizistische Rotunde, deren Säulen im ersten Akt hinter zugezogenen, bodenlangen Gardinen durchscheinen, bietet einen noblen, etwas unterkühlt wirkenden Rahmen für die lebendige und plausible Personenregie, mit der Nicolas Brieger ein darstellerisch sehr engagiertes Ensemble zu führen weiß. Leider zeigt sich aber immer wieder, daß das Rund des Bühnenbildes mit seinem gewölbten Schalldeckel akustisch offenbar ungünstig ist: Je nach Positionierung dringen Stimmen nur gedämpft über den Orchestergraben. Ohne Übertitelanlage wäre manche Textpassage unverständlich geblieben.

Liebesspiel zur Ouvertüre: Nicola Beller Carbon (Marschallin in Rot) mit Silvia Hauer (Octavian)
Mitunter neigt die Regie zur Deutlichkeit. Schon zu Beginn ist auf offener Bühne das Liebesspiel zwischen der Marschallin und ihrem jugendlichen Liebhaber zu sehen, als ob die Musik es inklusive Koitus nicht schon überdeutlich genug ausmalte. Die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer verorten die Szene im frühen 20. Jahrhundert, zitieren aber in verfremdeter Form etwa bei Octavian das behauptete Rokoko des Librettos. Die Berliner Ausgangsidee wurde in Wiesbaden im ersten Aufzug mit Videoeinblendungen angereichert, welche zu Strauss‘ nostalgisch schwelgenden Walzerklängen eine KuK-Hofgesellschaft beim Tanz zeigen, die Damen in üppigen Roben, die Herren in Ausgehuniformen. Die Produktion nimmt damit Bezug auf die Entstehungszeit der Oper unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg und zeigt die Oberschicht der zum Untergang verdammten Donaumonarchie. Sie tanzen ihren Walzer am Abgrund, schlafwandeln im Drei-Viertel-Takt in die Katastrophe hinein. Schlagartig blitzt das kommende Unheil auf, zeigen die Videoprojektionen Weltkriegsszenen mit Schützengräben und Bombeneinschlägen. Vor diesem Hintergrund bekommt dann der Auftritt der Bittsteller vor der Marschallin eine ernste, bittere Note. Die Regie muß dazu gar nicht viel verändern. Wenn drei Waisen etwa den Soldatentod des Vaters beklagen, dann steht das genau so in Hoffmannsthals Textvorlage. Lediglich den italienischen Tenor, der auf eine Anstellung hofft, hat man hier in einen Kriegsversehrten umgedeutet. So muß Ioan Hotea das Kunststück vollbringen, die ohnehin unbequem hoch notierte Partie einbeinig und auf eine Krücke gestützt zu singen. Das gelingt ihm mit seiner saftigen Stimme erstaunlich gut.

Im Hintergrund: Baron Ochs mit Gefolge, vorne rechts: Silvia Hauer (Oktavian) im Palais Faninal
Im weiteren Verlauf wird auf diese ernste weltpolitische Brechung des Stoffes jedoch kaum noch Bezug genommen. Lediglich ein vergoldeter Weltkriegspanzer, der im zweiten Akt Faninals Stadtpalais zur Dekoration dient, macht deutlich, auf welche Weise dieser neureiche Emporkömmling wohl zu seinem Vermögen gekommen ist.
Die „Wienerische Maskerade“ im dritten Akt spielt statt im Beisl in einer Art gehobener Rotlichtbar, deren Wirt (Erik Biegel mit gewohnt kopfigem Spieltenor) eine Transe ist. Das tut aber nichts zur Sache. Das Produktionsteam brennt hier ein kleines Feuerwerk an Gags und Bühneneffekten ab, die dem Publikum hörbar großes Vergnügen bereiten.

Fleuranne Brockway (Annina), Erik Biegel (Wirt*in), Rouwen Huther (Valzacchi) und Benjamin Russel (Polizeikommissar) im Beisl
Kleine Details zeigen einen souveränen Umgang mit den Aufführungstraditionen. Die stumme Rolle des Dieners Mohammed ist hier mit einem kleinwüchsigen Schauspieler (Mick Morris Mehnert) besetzt, der mimisch und gestisch sehr präsent ist und zur Belebung vieler Szenen beiträgt. Eine augenzwinkernde Erinnerung daran, daß das Libretto für diese Rolle einen Farbigen, einen „Mohren“ vorgesehen hat, entdeckt man an einem Servierwagen, dessen Tablett von der Figur eines orientalisch bekleideten Mohren gehalten wird. Die Regie imprägniert sich hier gegen wohlfeile Rassismuskritik, ohne der Textvorlage untreu zu werden.
Im Übrigen entfaltet Nicolas Brieger unaufgeregt, aber eindringlich das Grundthema des Stückes: Zeit, Altern, Vergänglichkeit.

Nicola Beller Carbone als
Marschallin bietet mit einer Haltung nobler Melancholie das glaubhafte Porträt einer bereits gereiften Frau, die sich des Endes ihrer Jugend zunächst fassungslos bewußt wird, um schließlich den Gang der Zeit mit Würde anzunehmen. Sie überrascht dabei mit großer stimmlicher Zurückhaltung. Ihre gute Textgestaltung überzeugt, klanglich jedoch wirkt sie nahezu im gesamten ersten Aufzug so, als sänge sie gleichsam mit angezogener Handbremse. Da versucht eine Sängerin, ihr im hochdramatischen Fach erprobtes Material im Zaum zu halten.
Das funktioniert vor allem in den Konversationspassagen recht gut. Hier webt Beller Carbone ein recht feines Gespinst, welches für eine Sängerin verblüfft, die in Wiesbaden bereits als kraftvolle Färberin in Die Frau ohne Schatten aufgetreten ist. Ein wenig vermißt man die Fähigkeit zum blühenden, weite Bögen spannenden Ton großer Rollenvorgängerinnen. Das etwas herbere Timbre der Beller Carbone fügt sich indes mit ihrer darstellerischen Anlage der Figur gut zu einem stimmigen Gesamtbild.
Silvia Hauer ist dagegen ein Octavian wie aus dem Bilderbuch: Ein frischer Mezzosopran mit überschäumendem Temperament, glaubhaft als viriler jugendlicher Liebhaber, köstlich ungelenk in der Verkleidung als Kammerzofe. Sie und die fabelhafte Sophie der Aleksandra Olczyk, die mit ihrem glockenhellen Sopran überzeugt, geben ein großartiges Paar ab.
Karl-Heinz Lehner ist landauf landab der Ochs vom Dienst (Dortmund, Essen, Frankfurt, Leipzig). Der gebürtige Österreicher verfügt über die nötige Dialektfärbung – wobei man als Nicht-Österreicher ohnehin bereits das Austauschen von Vokalen für Wienerisch („Weanerisch“) hält. Musikalisch kann man ihn lediglich als eine solide Besetzung bezeichnen, vermißt man doch insbesondere eine sattere Tiefe und eine unangestrengtere Höhe.

Karl-Heinz Lehner als Ochs mit Gefolge
Das Orchester zeigt sich unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Patrick Lange in guter Form. Wie schon bei Langes Arabella-Dirigat klingt dieser Strauss eher bayerisch-deftig als wienerisch-parfümiert, was vor allem die Auftritte des Ochs und seiner Dienerschaft gut untermalt. Die Walzer tönen mit vollmundigem Streicherklang aus dem Orchestergraben und machen Laune. Aber auch für Momente des Innehaltens finden die Wiesbadener Musiker zu einer überzeugenden Musizierhaltung. Im wichtigen Zeitmonolog der Marschallin bricht der Spannungsbogen nicht ab. Sogar die heiklen Silber-Rosen-Klänge gelingen. Die Anerkennung des Publikums für diese Leistung im Schlußapplaus ist wohlverdient.
Insgesamt kann man den Rosenkavalier in Wiesbaden in einer reflektierten Inszenierung erleben, die im Detail gut ausgearbeitet ist und die von engagierten Darstellern getragen wird. Das musikalische Niveau ist gediegen. Diese repertoiretaugliche Produktion ist die ideale Plattform für wechselnde Besetzungen in den tragenden Partien. Schon in dieser Spielzeit wird die wunderbare Johanni van Oostrum für zwei Vorstellungen im April die Marschallin übernehmen. Im Rahmen der Maifestspiele soll dann die absagefreudige Anja Harteros in dieser Rolle zu erleben sein.
Michael Demel, 29.11.2019
© der Bilder: Karl und Monika Forster
CARMEN
Bericht von der Premiere am 14. September 2019
Solide Aktualisierung mit politisch korrekter Imprägnierung
Sie haben tatsächlich nach der Ouvertüre gebuht! Dabei gab es auf einer Leinwand vor der Bühne in Filmsequenzen zum Orchestervorspiel nur das zu sehen, was später der Torero Escamillo und eine begeisterte Menge besingen werden: In einer Arena wird ein Stier mit Spießen traktiert und blutig zu Tode gebracht. Was ist daran provokativ? Was so unpassend, daß man in einen Schlußakkord hineinbuhen muß? Ist es tatsächlich eine Zumutung, mit der Brutalität eines Stierkampfes konfrontiert zu werden? Wenn der Unmut der Widerwärtigkeit dieser Tierquälerei gegolten haben sollte, dann hat das Premierenpublikum ihn zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort geäußert. Wie heißt es später im Text des Librettos, der zu dem überpopulären Marsch „Auf in den Kampf, Torero“ schmissig und lustvoll gesungen wird: „Durch den Zwinger bricht heraus der Stier mit Allgewalt. Er stürzt vor, treibt in die Enge. Ein stolzes Ross - es fällt - begräbt den Picador. Wütend rennt der Stier im Kreise umher, Kopf hoch empor. Die wucht'gen Hörner wild er senket. Es fließet rings das Blut - er brüllet fürchterlich.“
Und zum Finale beschreibt die Menge singend den gerade stattfindenden Kampf: „Viva! Viva! ach, wie so herrlich! In dem blutgen Sand wie gefährlich, rennt der Stier dem Kämpfer entgegen. Seht da, wie Escamillo zieht seinen Degen - Wie das Tier gereizt auf ihn springt - Ob der Stoss ihm glücklich gelingt? Seht da, seht da, Victoria!"
Vielleicht hat dem Publikum das beim Betrachten der Texte dann doch gedämmert, vielleicht ist es aber auch nur von der ansonsten gefälligen Inszenierung versöhnt worden. Jedenfalls gibt es beim Schlußapplaus zum Auftritt des Inszenierungsteams keine Unmutsbekundungen mehr.

Lena Belkina (Carmen) und Sébastien Guèze (Don José)
Dieser Auftakt jedenfalls ist vielversprechend. Mit dem Ende der Ouvertüre wird die Leinwand transparent und gewährt einen ersten Blick auf das Bühnenbild: eine leere, etwas ramponierte Stierkampfarena. Einsam kniet in ihrer Mitte ein Mann. Es ist, wie sich später herausstellen wird, der männliche Protagonist Don José. In seinen Händen hält er in einer Trauergeste ein typisch spanisches Kleid im Flamenco-Stil. So wirft die Regie einen Blick auf den Schluß der Oper, in welchem Bizet den Stierkampf in der Arena mit der tödlich endenden Auseinandersetzung zwischen Carmen und ihrem enttäuschten Liebhaber davor in einer Parallelmontage ablaufen läßt. Das ist ein starkes, ein verheißungsvolles Bild.
In der Mitte der Arena befindet sich ein wandschrankartiges Bühnenelement, welches im Verlauf der Inszenierung durch Drehungen und Verschiebungen das Bühnenrund gliedert, für Gruppen- und Einzelauftritten in geschicktem Variantenreichtum genutzt wird, im Tavernen-Akt als Rückfront einer Bar dient und im Schmuggler-Akt, der ja im Gebirge spielt, auch erklettert werden kann. Auf seine Fläche ist die Parole gesprüht: „Toros si – corridas no“ – Stiere ja, Stierkämpfe nein. Das „no“ ist jedoch in anderer Farbe durchgestrichen und durch ein „si“ konterkariert worden. Ein Statement des Inszenierungsteams und ein Hinweis darauf, daß im Spanien der Gegenwart die Stierkampftradition kontrovers diskutiert wird. Und daß diese Carmen in der Gegenwart spielt, daran lassen die Kostüme keinen Zweifel, die auf pseudo-spanischen Folklorekitsch verzichten.

In dem so abgesteckten Rahmen erzählt Regisseur Laufenberg die Geschichte exakt am Libretto entlang. Nach der starken Exposition wirkt das alles sehr konventionell, so als habe der inszenierende Intendant insbesondere die Repertoire-Eignung der Produktion im Blick gehabt.
Einem Dilemma moderner Carmen-Inszenierungen entgeht aber auch Laufenberg nicht: Natürlich kann man heute nicht mehr die nachträglich von fremder Hand hinzugefügten Rezitative aufführen. Natürlich muß ein Regisseur, der dramaturgisch auf der Höhe der Zeit ist, den Charakter des Stückes als Opéra comique beachten, also die Ursprungsfassung mit gesprochenen Dialogen verwenden. Gerade diese löbliche musikhistorische Korrektheit führt zu einem doppelten Problem: Der französische Text wird nicht selten von nichtfrancophonen Sängern mehr schlecht als recht deklamiert und von einem deutschen Publikum nur verstanden, wenn es mit den Augen auf den Übertiteln klebt, statt dem Bühnengeschehen zu folgen. Ohne Musikuntermalung können sich diese Sprechszenen ziehen wie Kaugummi. Für das Elend der Dialoge findet die Wiesbadener Produktion keine erfrischende Lösung, und so nimmt man sie als notwendiges Übel hin.

Lena Belkina (Carmen)
Daß das Premierenpublikum sich am Ende zufrieden zeigt, liegt nicht zuletzt an der gediegenen musikalischen Qualität des Abends. Mit Lena Belkina hat man für die Titelpartie eine rollenerfahrene Sängerin engagiert, deren dunkel abgetönter Mezzosopran mit satter Tiefe, samtiger Mittellage und ungefährdeter Höhe punkten kann. Sie serviert die Wunschkonzertarien tadellos und übertreibt es mit der Beimischung von rollenadäquaten ordinären Untertönen nicht. Sébastien Guèze interpretiert den Don José mit einem eher hell timbrierten Tenor mit hohem Anteil der Kopfstimme. Beeindrucken kann er immer dann, wenn er druckvoll aussingen kann. Wenn er aber die Lautstärke zurücknimmt, klingt die Stimme ein wenig matt und glanzlos. Dann offenbart sich, daß insbesondere die Mittellage zu wenig im Körper verankert ist und zu stark auf die Kopfresonanz setzt. So wird er im ersten gemeinsamen Auftritt mit Sumi Hwang als Micaëla von dieser regelrecht an die Wand gesungen. Die zierliche Sängerin verfügt über eine jugendlich-frische Stimme, die sie wunderbar strömen lassen kann. Erstaunlich ist das Volumen, über das sie verfügt. Ohne schrill oder unangenehm zu werden, kann sie eine Lautstärke entwickeln, die weitaus größere Häuser mühelos füllen würde. Sie ist damit der gar nicht heimliche Star der Aufführung. Ihre Arie im dritten Akt erhält den einzigen enthusiastischen Szenenapplaus des Abends.

Sébastien Guèze (Don José) und Sumi Hwang als Micaëla
Einen schlechten Tag erwischt hat offenbar Christopher Bolduc, für den die Partie des Escamillo obendrein zu tief liegt. In seiner Auftrittsarie geht mancher Ton im Orchesterklang unter. Obwohl er sich im Verlaufe der Aufführung steigern kann, klingt die Stimme oft angestrengt. Wer den jungen Sänger in den zurückliegenden Spielzeiten in anderen Partien erlebt hat, weiß aber, daß er über einen attraktiven, jugendlich-kernigen Bariton verfügt.
Generalmusikdirektor Patrick Lange läßt sein Orchester vollmundig und kräftig musizieren. Das macht durchaus Eindruck. Ein wenig geht dabei aber das Parfüm dieser Partitur verloren. Den leiseren, lyrischen Passagen fehlt es an Duftigkeit und Atmosphäre. Der von Albert Horne gut präparierte Chor trumpft immer wieder klangmächtig auf.
Insgesamt kann man sagen, daß am Staatstheater Wiesbaden die Carmen nicht neu erfunden wurde. Die Produktion hat eine für den Repertoirealltag taugliche, modernisierte Version der Geschichte handwerklich solide erstellt und sie mit angemessener Kritik an der fragwürdigen Tradition des Stierkampfes politisch korrekt imprägniert, ohne sie agitatorisch zu überfrachten.
Michael Demel, 15. September 2019
© Bilder: Karl und Monika Forster
Mozart-Doppel im Rahmen der Maifestspiele
IDOMENEO / LA CLEMENZA DI TITO
(Premieren am 30. April und 1. Mai 2019)
Überzeugender Abschluß des Mozart-Zyklus'
Die Wiesbadener Maifestspiele sind zu Ende gegangen, und das Staatstheater Wiesbaden vermeldet eine Auslastung von 85 Prozent. Wie üblich hatte man ausverkaufte Vorstellungen bei Repertoire-Aufführungen von Wagner und Verdi, die man mit namhaften Gastsängern zu glanzvollen Galas aufgehübscht hatte. Daß man insbesondere bei den Meistersingern von Nürnberg mit Michael Volle, Johannes Martin Kränzle, Günther Groissböck und Daniel Behle nahezu die gesamte aktuelle Bayreuther Besetzung präsentieren konnte, war durchaus bemerkenswert.
Zu wenig Beachtung fand allerdings, daß die Festspiele durchaus ungewöhnlich und mutig begonnen hatten. Intendant Laufenberg hatte den Einfall, den vom Alte-Musik-Spezialisten Konrad Junghänel musikalisch betreuten Mozart-Zyklus mit einer Doppel-Inszenierung an aufeinander folgenden Abenden abzuschließen. Der frühe Idomeneo sollte neben dem späten Tito präsentiert werden. Beides sind selten gespielte Werke mit eher sperriger Dramaturgie, welche Regisseure vor besondere Herausforderungen stellen. Die Aufgabe nun war umso schwieriger, als es der ausdrückliche Anspruch des Produktionsteams war, beide Werke an aufeinander folgenden Tagen als zusammengehörendes Doppel zu präsentieren. Dieses Versprechen eines zwingenden Zusammenhangs wurde am Ende nicht vollständig eingelöst. Zu erleben waren aber zwei durchaus gediegene Regiearbeiten, die jeweils für sich stehen können und eher dezente Querbezüge über Bühnenelemente und Einspielfilme aufweisen.

Mirko Roschkowski (Tito) und Chor
Mozarts La Clemenza di Tito gehörte zu den großen Erfolgen der im Zorn beendeten Ära Laufenberg an der Oper Köln. Der inszenierende Intendant hatte seinerzeit das gewaltige Treppenhaus des Oberlandesgerichtes Köln schnörkellos mit sehr überzeugender Personenregie bespielen lassen und die besondere Aura des ungewöhnlichen Spielorts glücklich zur Entfaltung gebracht. Für seine erneute Beschäftigung mit Mozarts Spätwerk hat Laufenberg sich nun von seinem Bühnenbildner Rolf Glittenberg einen kühlen, in Marmoroptik ausgekleideten modernen Repräsentationsbau entwerfen lassen, in dessen Mittelpunkt wiederum ein gewaltiger Treppenaufgang steht. Der Regisseur kann so die Vorzüge der älteren Produktion runderneuert präsentieren, ohne die Nachteile des akustisch ungünstigen Oberlandesgerichts in Kauf nehmen zu müssen. So wie Mozarts Tito ein Werk der Reife ist, erweist sich auch Laufenbergs Inszenierung als gereifte Version einer überzeugenden Grundidee. Es ist intensives, plastisches Theater zu erleben, das sich auf ausgezeichnete Darsteller verlassen kann. Daß die Kostüme von Monika Glittenberg schlichte Businesskleidung zeigen, ist weniger ein Versuch von Aktualisierung als vielmehr ein Ausweis von Zeitlosigkeit.
Die titelgebende Milde des römischen Kaisers, der selbst denen, die ihm nach dem Leben trachten, vergibt und die Drahtzieherin eines gegen ihn gerichteten Attentats schließlich sogar zur Frau nimmt, hält Laufenberg für eine kaum erträgliche Zumutung. Diese übermenschliche, letztlich unmenschliche Milde zeigt er als Herrschaftsinstrument, welches den Herrscher innerlich zerreißt und seine Gegner als Empfänger unverdienter Gnade niederdrückt.

Olesya Golovneva (Vitellia) und Silvia Hauer (Sesto)
Die darstellerisch stark geforderten Sänger können allesamt auch musikalisch überzeugen. In der Titelrolle präsentiert Mirko Roschkowski einen klangschön abgerundeten Tenor mit samtigem Bronzeton und stabiler Höhe. Leider bereiten ihm die Koloraturen hörbare Mühe, sonst könnte man von einem nahezu idealen Mozart-Tenor sprechen. Eine herausragende Leistung ohne Abstriche bietet Silvia Hauer in der Hosenrolle des Sesto. Mit ihrem glutvollen Mezzo durchmißt sie alle Gefühlsschwankungen ihrer zerrissenen Figur. Olesya Golovneva zeichnet als Vitellia mit ihrem gereiften Sopran sehr überzeugend und mit hinreißender Leidenschaft das Bild einer ehrgeizigen und rachsüchtigen Frau. Schönstimmig und rollenadäquat brav geben Shira Patchornik und Lena Haselmann das Paar Servilia und Annio.
Die gute Idee, den musikalisch stark geforderten Soloklarinettisten auch szenisch auftreten zu lassen, hat Laufenberg aus seiner Kölner Inszenierung übernommen. Völlig zurecht präsentiert er so den vorzüglichen Adrian Krämer als den Sängern ebenbürtigen Protagonisten.

Das Orchester beweist seine unter Konrad Junghänel erworbene Kompetenz in Sachen historisch informierte Aufführungspraxis. Die Streicher spielen vibratoarm, artikulieren lebendig und beredt. Mit den schlank geführten Bläsern ergibt sich ein farbiges und jederzeit gut durchhörbares Klangbild.
Diese Qualität des Orchesters war bereits am ersten Abend des Doppels, bei Idomeneo zu erleben. Junghänels zupackender Ansatz ließ die genial-frühreife Partitur mit ihrer Überfülle an originellen Einfällen in bestem Licht erscheinen. Wie am zweiten Abend war die Titelpartie Mirko Roschkowski anvertraut worden. Schon hier war der Eindruck zwiespältig. Die Freude über das schöne Stimmmaterial und die musikalische Durchdringung der Figur wurde ein wenig eingetrübt durch das Bedauern über die nicht völlig souverän bewältigten Koloraturen. Die sängerische Krone des Abends gebührte Slávka Zámečníková als Ilia. Die Sängerin verstand es, mit ihrer zum niederknien schönen Stimme weite Bögen zu spannen und einen innigen Ton zu erzeugen, der immer wieder berührte. Die Kastratenpartie des Idamante war adäquat mit dem Countertenor Kangmin Justin Kim besetzt. Seit wir ihn in dieser Rolle am Stadttheater Gießen vor einigen Jahren zum ersten Mal gehört haben, ist die Stimme gereift, hat an Volumen gewonnen, aber etwas Schärfe in der Höhe entwickelt. Der Sänger präsentierte sich mit großer Emphase, die aber nicht nur einmal dazu führte, daß ihm im Eifer der Gefühle die Intonation nach Oben wegrutschte. Einen tadellosen Eindruck hinterließ Netta Or als leidenschaftliche Elettra.

Slávka Zámečníková (Ilia) und Kangmin Justin Kim (Idamante)
Das Bühnenbild verortete das Geschehen in einer Ruine. An den Oberlichtern des zerstörten Gebäudes konnte man in Kenntnis der nachfolgenden Tito-Inszenierung rückblickend erkennen, daß es sich um Titos Palast handeln mußte. Die Treppe war verschwunden, die Rückwand von einem riesigen Einschußloch durchbrochen. Das legte den Blick frei auf einen Strand mit dahinter liegendem Meer. Der Gott Neptun, der Idomeneo vor seiner Heimkehr aus Troja auf offener See zusetzte und der mit dem Versprechen eines Menschenopfers besänftigt werden mußte, war auf diese Weise als ungebändigte Naturgewalt präsent. Die Urgewalt des Meeres wurde dabei durch eindrucksvolle Videoprojektionen plastisch. Damit hatte sich Regisseur Laufenberg aber entschieden, den Aspekt der Religionskritik außen vor zu lassen, der in manch anderer Inszenierung einen naheliegenden Anknüpfungspunkt bietet. Stattdessen lenkte die Neuproduktion den Blick auf die inhärente Flüchtlingsthematik. Laut Libretto befinden sich auf der Insel Kreta trojanische Kriegsgefangene. Laufenberg und sein Ausstattungsteam deuten hier Bezüge zu aktuellen nahöstlichen Konflikten an, ohne allzu platt zu aktualisieren. Der Sinn des mit archaischen Gesten gezeigten Opferrituals bleibt vor diesem Hintergrund indes dunkel.

Mirko Roschkowski, nun als Idomeneo
In der Pause zum ersten Abend, dem Idomeneo, hatte uns der Intendant noch freudig zugerufen, man müsse sich unbedingt auch am nächsten Tag den Tito ansehen, denn beide Inszenierungen gehörten zusammen. Tatsächlich ist es reizvoll, den Doppelabend als chronologisch gleichsam von hinten erzählte Versuchsanordnungen über die Ausübung von Herrschaft zu betrachten. Dann erlebt man zunächst eine postapokalyptische Gesellschaft, die kriegstraumatisiert in Ruinen hausen muß und in der archaische Rituale als Erinnerungen an Zivilisationsreste hohl, roh und letztlich vergeblich zur Sinnstiftung herangezogen werden. Das Gegenbild einer streng durchorganisierten, technokratisch-aufgeklärten Gesellschaft, wie es im Tito präsentiert wird, erscheint mit seiner unmenschlichen Kühle dagegen auch nicht verlockender. Es ist ein pessimistischer Blick auf die Bedingungen menschlichen Zusammenlebens, den Laufenberg und sein Ausstattungsteam präsentieren.
Beide Inszenierungen sind trotzdem jeweils in sich geschlossen, so daß das Staatstheater Wiesbaden sie außerhalb der Maifestspiele nun auch je einzeln aufführt. Weitere Vorstellungen des Tito gibt es am 10., 22. und 27. Juni. Der Idomeneo wird noch am 6., 9. und 14. Juni gegeben.
Michael Demel, 2. Juni 2019
© Bilder: Karl und Monika Forster
Doppelabend
HERZOG BLAUBARTS BURG /
DIE SIEBEN TODSÜNDEN
Bericht von der Premiere am 1. März 2019
Gehaltvoller Hauptgang mit leichtem Dessert
Von Wieland Wagner ist der Ausspruch überliefert: „Was brauche ich einen Baum auf der Bühne, wenn ich eine Astrid Varnay habe!“ Unter den gegenwärtigen Sängerpersönlichkeiten kann man diesen Satz gut auf den Bariton Johannes Martin Kränzle ummünzen. Seine Bühnenpräsenz, seine Ausstrahlung und sein Einswerden mit der verkörperten Figur sind in jeder Inszenierung immer wieder aufs Neue beeindruckend. Auch allenfalls solide Produktionen wie etwa im vergangenen Jahr David Hermanns Sicht auf Janáčeks Totenhaus an der Oper Frankfurt werden durch Kränzle in den Rang des Außerordentlichen erhoben. Hinzu kommt die technisch perfekte Beherrschung des Stimmmaterials, die es Kränzle erlaubt, mit einer schier unendlichen Fülle von Farbnuancen das Dargestellte musikalisch zu beglaubigen und zu vertiefen. All das ist nun im Wiesbadener Staatstheater in der Wiederaufnahme von Herzog Blaubarts Burg zu erleben.

Szenen einer Ehe: Vesselina Kasarova (Judith) und Johannes Martin Kränzle (Blaubart)
Es wäre aber ungerecht gegenüber der Inszenierung, die Intendant Uwe Eric Laufenberg selbst besorgt hat, wenn man die Produktion auf die herausragende Leistung des Hauptdarstellers reduzieren würde. Laufenberg bereitet vielmehr den Boden für ein eindringliches Kammerspiel, in welchem Vesselina Kasarova als Judit auf Augenhöhe mit Kränzle agiert. Ihr Mezzosopran verfügt über Durchsetzungskraft, eine markante Höhe und ein bemerkenswert dunkel abgetöntes Brustregister.
Die intensiven Darsteller sind in einem zunächst realistisch gezeichneten Beziehungsdrama zu erleben, welches immer deutlicher ins Alptraumhaft-Magische umkippt. Das Bühnenbild von Matthias Schaller und Susanne Füller zeigt ein holzvertäfeltes modernes Apartment. Blaubart und seine neue Braut Judith kommen zu Beginn mit einem Fahrstuhl hier an. Judith erkundet den Raum und dringt dabei immer tiefer in die Psyche des ihr noch fremden neuen Gatten ein. Sehr genau orientiert sich die Inszenierung am Libretto und überträgt die Handlung dezent von einem mythischen Mittelalter in die Jetztzeit. Dabei wird dem Text keine Gewalt angetan. Wie in der Vorlage ist der Raum fensterlos. So wird eine klaustrophobische Wirkung erzielt, die sich noch dadurch steigert, daß die Schließung der Burgtore hier mittels zusammenfahrender Wände gezeigt wird, die den Ausgang verschwinden lassen. Das Öffnen der Türen in der Burg wird als Aufdeckung der schmutzigen Geschäfte des Herrn Blaubart übersetzt. Auf seinem Laptop entdeckt Judith ein Video der Folterkammer, welches zwar den Zuschauern verborgen bleibt, dessen Inhalt man aber an ihrer entsetzten Reaktion ablesen kann. Die Waffenkammer wird von Photographien repräsentiert, welche Judith im Aktenkoffer des Geschäftsmanns findet. So wird ihr klar, daß an den ihr sodann präsentierten Reichtümern, dem Schmuck, den ihr Blaubart anhängt, den Ländereien, die er ihr präsentiert, ja sogar an den Blumen, mit denen er sie überhäuft, im übertragenen Sinne Blut klebt. Auch daß Laufenberg das Drama am Ende mit den Zügen eines Horrorthrillers versieht, läßt sich schlüssig aus dem Originalplot ableiten.

Musikalisch wird das Ganze neben den starken Protagonisten von dem gut aufgelegten Orchester unter der Leitung des jungen Dirigenten Philipp Pointner getragen. Der Klang ist kräftig, dicht und angemessen aufgeraut. Insbesondere die stark geforderten Holzbläser und die Hornisten hinterlassen einen hervorragenden Eindruck. Das Publikum zeigt sich begeistert und feiert Musiker und Produktionsteam in gleicher Weise.
Nach diesem überzeugenden ersten Teil ist man gespannt, was jetzt noch folgen kann. Bei der ersten Präsentation von Blaubarts Burg hatte Laufenberg Bartoks Psychothriller noch Poulencs Voix humaine vorangestellt. Die Inszenierung war ganz auf den Besetzungscoup zugeschnitten, den der inszenierende Intendant mit dem Engagement des Weltstars Julia Migenes hatte landen können. Diese stand nun nicht mehr zur Verfügung. So mußte Ersatz her. Anstatt eine neue Sängerin in die Produktion einzupassen, entschied man sich für einen Austausch des Stückes. Die Wahl fiel auf Kurt Weills Sieben Todsünden. Das läßt sich gut mit der Ähnlichkeit der formalen Anlage beider Stücke begründen. So wie im Blaubart nacheinander sieben Türen geöffnet werden und das Stück damit in klar abgrenzbare Teile gegliedert wird, so handelt auch Weill die Sieben Todsünden in jeweils einer kurzen Szene ab. Es ist durchaus reizvoll, im unmittelbaren Vergleich zu erleben, wie unterschiedlich Bartok und Weill mit dieser formal ähnlichen Anlage umgehen. Nach dem intensiven Expressionismus des ersten Teils wirkt Weills coole Sachlichkeit mit ihrer ironischen Adaption von Unterhaltungsmusik wie ein erfrischendes Dessert nach einem gehaltvollen Hauptgang. Grundlage ist ein Text von Bertold Brecht, in welchem dieser sarkastisch sein antikapitalistisches Grundthema durchspielt. Wie in Der gute Mensch von Sezuan muß sich auch hier die Hauptfigur in zwei Personen aufspalten, um in der Welt des bösen, ausbeuterischen Kapitalismus bestehen zu können. Das Ursprungskonzept sieht vor, daß die Hauptfigur von einer Sängerin als Anna I und einer Tänzerin als Anna II verkörpert wird. In Wiesbaden hat sich Regisseurin Magdalena Weingut dazu entschieden, die gespaltene Persönlichkeit doch mit einer einzigen Darstellerin auf die Bühne zu bringen. Daß dies funktioniert, liegt an Nicola Beller Carbone. Auf sie trifft Wieland Wagners eingangs zitierter Ausspruch noch weitaus stärker zu als auf die Protagonisten des ersten Teils. Trotz der hübsch zynischen Gesangseinlagen eines ihre Familie repräsentierenden Männerquartetts (mit einem Baß als Mutter) erlebt man eine One-Woman-Show.

Multiple Persönlichkeit: Nicola Beller Carbone als Anna
Das Ausstattungsteam muß dazu gar nicht viel mehr bereitstellen, als einige abstrakte Bühnenelemente (wiederum entworfen von Matthias Schaller) und immer neue Kostüme (Katarzyna Szukszta). Den Rest erledigt Beller Carbone. Sie tanzt, chargiert und wirbelt über die Bühne. Bei ihren ersten Gesangstönen ist man überrascht. Zuletzt hatte man sie in Wiesbaden als Färberin in Richard Strauss‘ Frau ohne Schatten erlebt, in einer dem hochdramatischen Fach zugeordneten Partie. Nun erklingt eine helle, zickig-mädchenhafte, geradezu soubrettige Stimme. Dabei scheint es zunächst so, als suche die Sängerin nach der richtigen Klangfarbe und scheue sich davor, mit ihrer kräftigen Opernstimme voll auszusingen. Vielmehr orientiert sie sich an dem Diseusen-Ton großer Rollenvorgängerinnen wie Lotte Lenya oder Gisela May. Das ist dem Stück angemessen und gelingt über weite Teile recht überzeugend. Erstaunlicher Weise ist ihre Textverständlichkeit selbst in Passagen, in denen sie dem Sprechgesang nahe kommt, nicht immer optimal. Solche kleinen Einwände trüben aber kaum den Gesamteindruck einer hinreißenden Bühnenshow, in welcher den darstellerischen und tänzerischen Leistungen ein dem Gesang gleichberechtigter Anteil zukommt. Die Regie versucht erst gar nicht, dem Cabaret-Varieté-Tingeltangel noch Tiefgang beizumischen und beläßt es bei gelegentlichen Projektionen von Ausschnitten aus Brueghels Stichen zu den Sieben Todsünden. Das Orchester zeigt sich wandlungsfähig und präsentiert einen angemessen trocken-knackigen Dreißiger-Jahre-Sound. So rauschen die sieben Szenen unterhaltsam vorüber. Hätte man Die sieben Todsünden als Hauptwerk gegeben, würde man sich wohl noch etwas mehr Schärfe wünschen. Als leichtes Nachspiel nach dem gehaltvollen Hauptwerk im ersten Teil ist diese Art der Präsentation aber durchaus willkommen.
Michael Demel, 9. März 2019
© Bilder: Karl und Monika Forster
Trailer Blaubart
Trailer Todsünden
Weitere Vorstellungen gibt es am 14., 21. und 31. März.
Zum Zweiten:
SALOME
Salome der Kontroverse
17.02.2019
Als weitere Opern-Premiere präsentierte das Hessische Staatstheater eine umstrittene „Salome“ (Richard Strauss) des französischen Produktions-Teams Le Lab – Jean-Philippe Clarac – Olivier Deloeuil (Regie – Bühne – Kostüme). Man verlegte die Handlung in die Gegenwart, ein Gesellschaftsabend mit langweiliger Party auf dem Dach eines Hochhauses (?) ohne personellen Tiefgang. Der Hausherr ein Liebhaber der Astrologie, der Rest der Gäste keine besonderen Spezies, Jochanaan kein Prophet eher ein verirrter Fanatiker, lediglich die ausgezeichnet profilierten und kostümierten Juden gaben dem Ganzen ein spezifisches Gepräge. Zwei Videowände adaptierten den fokussierten Mond, Planeten- und Wüstenlandschaften, Personen, allerlei Unnötiges völlig kontrovers zum Geschehen sowie die minutiöse Hinrichtung auf den Seziertisch. Mit viel Contra und wenig Pro wurde das Team bedacht.

Dagegen ließen die erfreulichen musikalischen Komponenten das dubiose szenische Debakel schier vergessen. Absolute Stars der Aufführung blieben nach wie vor Richard Strauss sowie GMD Patrick Lange am Pult des bestens disponierten Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden. Vortrefflich ließ der einfühlsame Dirigent die grandiose Partitur erklingen, in prächtiger Dichte flossen überwältigende Passagen ineinander, feinsinnige Lyrismen, emotionale Momente von klangvoller Schönheit sowie konträre typische Klangkonstruktionen des Komponisten wurden prächtig ausgelotet. Lange trug seine Solisten zu flüssigen Tempi, besten Instrumental-Balancen der Orchestergruppen regelrecht auf musikalischen Händen. Lasziv, exotisch sich zur finalen symphonischen Ekstase steigernd erklang Der Tanz der sieben Schleier (welcher ohnedies nur akustisch stattfand).
Großartig gestaltete Thomas de Vries den religiösen Fanatiker Jochanaan. In bester Phrasierung und feinen Nuancen ließ der exzellente Bassbariton sein voluminöses klangschönes Material erstrahlen.

Fernab der gewohnten Charakterstudie des Herodes sang Frank van Aken mit schönem Timbre, intakten tenoralen Attributen einen noch jüngeren agilen Tetrarchen. Simon Bode gestaltete mit hell strahlender Tenorstimme den schwärmerischen Narraboth. Den warnenden Pagen verkörperte Silvia Hauer. Vorzüglich erklangen die Stimmen von Young Do Park, Daniel Carlson, Doheon Kim, Nicolas Ries, Maike Menningen (Nazarener, Soldaten, Capadocier, Sklave). Dem nervenden Gezeter der fünf Juden liehen Rouwen Huther, Erik Biegel, Christian Rathgeber, Ralf Rachbauer, Philipp Mayer die differenzierten Stimmlagen.
Regelrecht als unangenehm klingende Keife umriss Andrea Baker die Herodias. Sie ist in Wahrheit ihrer Mutter Kind – pflegte Herodes über seine Stieftochter zu bemerken, wahrlich!

Doch nein, sie übertraf sie in überreichem Maße. Attraktiv in eleganter Robe kam eine junge schöne Frau (Sera Gösch) daher, die Töne erzeugte, welche erschauern ließen. Ich kann mich während meiner bisherigen (41) Salome-Interpretinnen nicht erinnern, eine derart schrille farblose Sopranstimme erlebt zu haben. Sorry, das nenne ich eine Zumutung. Wo hatten die Verantwortlichen ihre Ohren? Nach welchen Kriterien engagiert man derart inkompetente, komplett überforderte Personen?
Leistungsgerecht verteilte Honneurs des Premieren-Auditoriums, besonders stark für de Vries und GMD Lange.
Gerhard Hoffmann 18.2.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Bilder (c) Forsters
Zum Ersten:
Salome
Premiere am 16. Februar 2019
Wo ist Salome?
Nach der sehr dürftigen Produktion des „Rigoletto“ im Januar, gab es bedauerlicherweise auch bei der Neuinszenierung der „Salome“ von Richard Strauss keinen großen Grund zur Freude. Bei dieser aktuellen szenischen Arbeit am Hessischen Staatstheater Wiesbaden entstand ein außergewöhnlich hoher Personalaufwand bei den Verantwortlichen der Produktion. Engagiert wurde die französische Theater Gruppe „Le Lab“:
Inszenierung, Bühne, Kostüme Le Lab – Jean-Philippe Clarac, Olivier Deloeuil
Licht Christophe Pitoiset, Oliver Porst
Video Jean-Baptiste Beïs
Künstlerische Mitarbeit Lodie Kardouss
Graphic Design Julien Roques
Dramaturgie Luc Bourrousse, Regine Palma

Die künstlerische Ausbeute dieser Akteure war beschämend. Zu sehen gab es lediglich ein szenisches Arrangement mit kaum vorhandener Personenführung. Der Bühnenraum ist durch einen Rundhorizont begrenzt, auf welchem zwei große Videowände angebracht sind, die bedauerlicherweise nicht in Blickhöhe der Zuschauer des dritten Ranges sind. Zu sehen sind darauf Filmeinspielungen des Mondes oder Innenaufnahmen des Containers, in welchem Jochanaan gefangen gehalten wird. Der Container befindet sich ebenso auf der Bühne wie allerlei Gartenmobiliar. Die Drehbühne lief dazu den ganzen Abend….
Die Verantwortlichen haben offenkundig ein sehr eigenes Textverständnis, wenn Salome mit Blick auf die Zisterne (= Container), die es hier nicht gibt, singt: „wie schwarz es da drunten ist!“
Einmal mehr ereilt einen schiere Fassungslosigkeit über derart viel ausgeprägten szenischen Leerlauf. So gibt es keinen „Tanz der sieben Schleier“, denn Herodes, sitzt unter einer großen Stoffbahn und starrt während des ganzen „Tanzes“ auf sein Tablet! Auf den Videowänden gibt es einen Film zu sehen, in welchem die Darstellerin der Salome darin glänzt, verschiedene Fratzen mit ihrem Gesicht zu schneiden. Das war es dann auch schon. Seltsam, dass das Herodes derart obsessiv in die Verzückung treiben soll….

Eine aus der Musik entwickelte, klar charakterisierende Personenführung gibt es in dieser Produktion nicht. Alles gleicht eher einer szenischen Anordnung. Nett anzuschauen, jedoch ohne Spannung, ohne inhaltliche Tiefe.
Verschenkt, völlig verschenkt die Personenzeichnung von Herodes, der hier sehr aufgeräumt, wie ein netter Nachbar von nebenan daher kommt. Keine Manie, kein Wahn, keine Lüsternheit….einfach nix. Ein gemütlicher Mensch, der Herodes.
Und auch Jochanaan wird als Figur sehr starr geführt. Die Wut, das Ungebändigte ist hier als Rollencharakter von der Regie völlig ignoriert worden.
Völlig misslungen auch die „szenische Gestaltung“ des Schlussgesanges. Jochanaan wird auf einen Seziertisch gelegt und mit einer silbernen Flüssigkeit am Kopf übergossen. In dieser Aufmachung wird er dann aus dem Container geschoben. Salome hat sich in der Zwischenzeit silbrig angepasst und einen silbern glänzenden Ganzkörperanzug angezogen. Dazu singt sie reichlich beziehungslos ihren endlos anmutenden Schlussgesang.
Welch deprimierendes, ärgerliches szenisches Resultat!

Auch musikalisch war dieser Abend alles andere als ein Ruhmesblatt für das Hessische Staatstheater. Herodes bekannter Ausruf: „Wo ist Salome?“ mag dem ein oder anderen Besucher durch den Kopf gegangen sein. Denn Salome, gesungen von Sera Gösch hatte ihre hörbare Not mit den Erfordernissen der Rolle. Die junge Sängerin warf sich mit darstellerischem Engagement in die fordernde Titelpartie. Stimmlich wirkte sie vielfach überfordert und mit ihrem dünnen, oft soubrettigen, lyrischen Sopran der Partie nicht wirklich gewachsen. Stimmlich geriet sie mit ihrer in der Höhe arg flackernden Stimme in zu deutliche Bedrängnis. Dem Stimmklang fehlte es an Volumen und vor allem an Leuchtkraft, um den Abend klanglich zu dominieren. In der Mittellage und Tiefe nahm sie zu oft Zuflucht zu entstellendem Sprechgesang. Auch litt ihre Textverständlichkeit erheblich. Nur wenige Worte waren gut zu verstehen. Somit lediglich eine gerade noch bewältigte Rollengestaltung, was entschieden zu wenig ist, insbesondere dann, wenn die Regie ein solcher Totalausfall ist.
Den Jochanaan interpretierte Thomas de Vries. Welche Autorität im Auftritt und im mühelosen Stimmklang! Der verdiente Sänger hat hier eine Traumrolle gefunden, die die Vorzüge seines noblen Baritons ausgezeichnet präsentiert. An diesem Abend stand ihm eine große dynamische Bandbreite zur Verfügung. So konnte er herrliche Legatobögen singen, dabei raumgreifend auftrumpfen oder wieder geheimnisvoll drosseln. Hinzu kommt seine vorzügliche Textarbeit, verständlich und intelligent in der Gestaltung. Eine herausragende Darbietung, für die er zurecht den stärksten Beifall des Abends erhielt.

Den Herodes sang Frank van Aken mit heroischem Klang. Es war erfreulich, diese Partie einmal wieder mit einer Heldentenorstimme zu hören. Somit konnte van Aken seiner Partie viel stimmliche Autorität verleihen. Klang er in Zeiten seines Frankfurter Engagements oftmals heiser, wirkte er hier stimmlich ausgezeichnet disponiert, ja geradezu neu geboren. Wie erfreulich! Auffallend und überzeugend auch seine sinnhaften Textakzente.
Als Herodias betonte Andrea Baker das Keifende ihrer Rolle, bot dennoch viel Stimmklang und szenische Präsenz.
Simon Bode war ein Narraboth mit blassen lyrischen Tenorklängen. Aus der Vielzahl der Nebenrollen ragte als 1. Nazarener Young Doo Park hervor. Eine Wohltat, mit welcher Stimmkultur er seine wichtigen Phrasen formulierte.

Ein herbe Enttäuschung war das Dirigat von GMD Patrick Lange am Pult des Hessischen Staatsorchesters. Er bevorzugte in seiner Interpretation einen sehr nüchternen Orchesterklang, der die Durchhörbarkeit der üppigen Partitur in den Vordergrund stellte. Sinnlichkeit und intensiver Farbklang traten massiv deutlich in den Hintergrund oder waren nicht vorhanden. Einmal mehr viel seine Neigung zu viel zu raschen Tempi ungünstig ins Gewicht. Als Interpret war Lange ein Ausfall, denn er sorgte lediglich für einen funktionierenden Ablauf. Die endlose Farbigkeit der Partitur wurde von ihm nicht hörbar empfunden und blieb komplett auf der Strecke. Dissonanzen ertönten geglättet, farbreiche Ausbrüche („Ich habe deinen Mund geküsst“) erklangen ausgebleicht, rhythmische Akzente erklangen selten und viel zu defensiv. Insgesamt bestimmte die Beiläufigkeit den Kern seiner Lesart.
Das Hessische Staatsorchester wurde von Lange hingegen hörbar gut einstudiert. Erfreulich aufmerksam erklang es da aus den einzelnen Orchestergruppen. Kultiviert im Klang, das Zusammenspiel klappte, die Balance zur Bühne stimmte, ebenso die dynamische Bandbreite.
Am Ende ein deutlich geteiltes Echo beim zahlreich erschienenen Publikum. GMD Lange erhielt Buhs und in deutlich größerer Stärke das Regie-Team, obgleich es hier auch etwas Zustimmung gab. Der Applaus endete rasch.
Dirk Schauß 18.2.2019
Bilder (c) Monika & Karl Forster
Zweite Kritik:
RIGOLETTO
Bericht von der Premiere am 19. Januar 2019
Mit den Clowns kamen die Tränen
Zu den klassischen Attributen eines Hofnarren gehört der Narrenstab. Wie ein Zepter wird er in der Hand gehalten. Typischerweise ist eine kleine Figur an seiner Spitze angebracht, die en miniatur den Narren verdoppelt. In traditionellen Aufführungen von Rigoletto, Verdis traurig-schauriger Geschichte um einen höfischen Spaßmacher, gehört der Narrenstab zur unverzichtbaren Ausstattung des Protagonisten. Uwe Eric Laufenberg nimmt diese Tradition in der Neuproduktion von Verdis Erfolgsstück am Staatstheater Wiesbaden auf und aktualisiert sie. Rigoletto spielt nun in der Gegenwart. Sein Titelheld führt an Stelle des Stabes eine Bauchrednerpuppe in Gestalt eines Clowns mit sich. Schon in der ersten Szene wird deutlich, wie symbiotisch der Titelheld mit diesem Alter Ego verbunden ist. Noch bevor Rigoletto ein Wort gesungen hat, plappert die Puppe an seiner Hand lippensynchron mit, was die anderen so sagen. Rigoletto lebt durch den Clown, und er lebt in ihm. Wenn er später als verzweifelter Vater nach seiner entführten Tochter suchen wird, verhöhnen ihn die Schergen des Herzogs auch dadurch, daß sie sich Clownspuppen um die Hüfte schnallen, die den Schein erwecken, als trügen die Figuren die Menschen auf ihren Rücken. Das optische Leitmotiv wird konsequent bis zum bitteren Ende geführt, wenn Rigoletto aus dem Leichensack seiner Tochter nicht diese, sondern eben eine Clownspuppe herauszieht: Mit dem Tod seines Kindes ist auch ein wesentlicher Teil seiner selbst abgestorben.
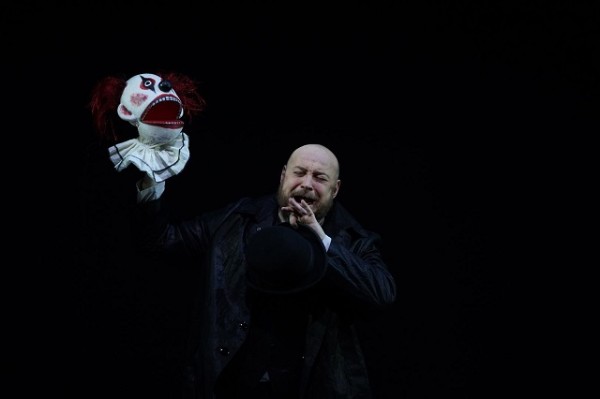
Rigoletto (Vladislav Sulimsky) mit Alter Ego
Ansonsten hält sich die Inszenierung mit Deutungen zurück und spielt recht plausibel durch, wie die alte Geschichte in modernen Kulissen ausschauen könnte. Der Hof des Herzogs von Mantua ist ein Edelbordell, in dem die Animierdamen in knappe Lackröckchen gekleidet sind. Das sieht ein wenig nach Altmännerphantasie aus. Die Kulissen dazu erinnern daran, daß die Ausstattung zur Uraufführung des Stücks seinerzeit insbesondere dadurch Aufmerksamkeit erregte, daß man anstelle von aufgemalten Kulissen zum ersten Mal mit räumlichen Bauten eine tiefengestaffelte, dreidimensionale Wirkung erzeugte. Bühnenbildner Gisbert Jäckel knüpft an diese Aufführungsgeschichte an. Von einem zentralen Salon aus wird der Blick immer wieder auf angrenzende Zimmer freigegeben, die Ausstattung ist mit viel Liebe zum Detail recht aufwendig ausgefallen. Ein weiterer Gruß an die Aufführungstradition ist der geradezu exzessive Einsatz von Blitzen in der Gewitterszene des dritten Aktes. Verdi selbst hatte auf derartige Effekte großen Wert gelegt. Von ihm ist die Anweisung überliefert: „Ich wünsche mir, daß die Blitze auf dem Bühnenhintergrund aufleuchten.“ Diesen Wunsch erfüllt die Wiesbadener Produktion und erweist sich dadurch in eigener Weise als werktreu. Daß dieser letzte Akt auf einem heruntergekommenen Campingplatz spielt und die Hütte des Auftragsmörders Sparafucile ein schäbiger Wohnwagen ist, mag Traditionalisten stören, ist aber beim gewählten Gegenwartsbezug nicht unpassend.

Young Doo Park (Sparafucile)
Wie üblich liefert Laufenberg überwiegend plausible Personenregie und arrangiert eben das, was die Handlung so hergibt. Dabei hat er es gerne deutlich, nicht selten auch überdeutlich. Daß etwa Gilda nach ihrer Entführung in den Palast des Herzogs dort ihre Unschuld verliert, weiß das Publikum ohnehin. Des Blutfleckes auf ihrem Unterrock im Bereich des Schoßes hätte es zur Illustration nicht bedurft. Zu dieser Deutlichkeit gehören auch Details wie eine mannsgroße Penisskulptur im Herzogspalast oder Schattenrisse von Sexstellungen, welche das Ziffernblatt einer Uhr dort bilden.

"Le roi s'amuse": Ioan Hotea (Herzog von Mantua - Bildmitte) und Ensemble
Lediglich an einer Stelle will die Regie dem Libretto nicht folgen, und zwar völlig zu Recht: Mit einem aus der Filmregie bekannten Kniff gelingt es ihr, die Absurdität der Vorlage zu umschiffen, daß am Ende die eigentlich bereits ermordete Gilda noch munter eine gar nicht so kurze Abschiedsarie vor sich hinträllert. Bei Laufenberg singt nicht mit letzter Kraft die erstochene und bereits minutenlang im Leichensack verstaute Tochter, da geht vielmehr ihre Seele - oder profaner: ihr Geist - singend in die Ewigkeit ein. So hatte sich bereits vor Kurzem Hendrik Müller in der Frankfurter Rigoletto-Inszenierung geschickt aus der Affäre gezogen. Die verklärte Gilda tritt langsam schreitend ab, während Rigoletto mit dem Leichensack in den Händen zurückbleibt. Dazu spendiert man ihr noch ein wenig Bühnennebel, damit auch der letzte Zuschauer merkt, daß Transzendentes gemeint ist.

Tod und Verklärung: Gilda (Christina Pasaroiu) läßt den verzweifelten Rigoletto zurück
Insgesamt präsentiert sich die szenische Umsetzung also gediegen und handwerklich sicher. Mit dem Clownsmotiv wird ein deutlicher roter Faden durch alle drei Akte gelegt, jedoch wirkt die Inszenierung nicht mit Deutungen überfrachtet. Gerade dadurch ist sie repertoiretauglich.
Hinsichtlich der musikalischen Umsetzung kann von einem weitgehend geglückten Abend berichtet werden. Mit Vladislav Sulimsky hat man einen ausgezeichneten Bariton für die Titelrolle gewinnen können. Seine in allen Lagen tadellos ansprechende Stimme läßt er gerne auftrumpfen. Den brutalen Zyniker des Beginns zeichnet er überzeugend. Die zärtlichen Töne gegenüber seiner Tochter könnten noch inniger sein. Sehr ergreifend gelingt ihm die Verzweiflung der Schlußszene. Als seine Tochter Gilda weiß auch die in Wiesbaden gerne engagierte Christina Pasaroiu mit mädchenhaft süßem Timbre zu gefallen. Ihre Stimme ist in den letzten Jahren gereift, was die Sopranistin dazu nutzt, ihrer Figur mit abgestuften Zwischentönen mehr Tiefe zu verleihen, als man es von anderen Darstellerinnen gewohnt ist. Die Kehrseite dieser Reife ist, daß Koloraturen nicht immer mit der nötigen Leichtigkeit gelingen. Wenig Zwischentöne dagegen läßt Ioan Hotea, der Wiesbadener Spintotenor vom Dienst, als Herzog von Mantua erklingen. Er schmettert seine Wunschkonzertarien im Dauerforte, daß einem mitunter die Ohren klingeln. Im übrigen läßt er kaum ein Klischee über Tenöre aus – von absurd lange gehaltenen Spitzentönen bis hin zu schluchzenden Tonverschleifungen. Nach dem Schlußapplaus zu urteilen, hat dem Publikum gerade das sehr gefallen. Young Doo Park, auch dieses Wiesbadener Ensemblemitglied darf in keiner Produktion fehlen, läßt seine sonore Stimme als Sparafucile in angemessener Schwärze ertönen. Daneben macht Thomas de Vries auf sich aufmerksam, der den für Rigoletto fatalen Fluch Monterones mit kalter Schärfe ausstößt und dieser kleinen Nebenrolle ein klares Profil verleiht.

Wenn Will Humburg dirigiert, ist gerade im italienischen Repertoire die Vorfreude groß. An diesem Abend kann das Orchester unter seiner Leitung nicht ganz die hohen Erwartungen erfüllen. Gleich bei den ersten Tönen der Ouvertüre schwächeln die Trompeten. Im weiteren Verlauf klingt einiges ungeschliffen, manches verhuscht, und insgesamt stellt sich der Eindruck ein, daß der im Zuschauerraum gut sichtbare Dirigent mitunter weit feuriger agiert als seine Orchestermusiker.
Der Premierenapplaus ist freundlich ohne Überschwang und bezieht ohne Mißfallensbekundungen auch das Regieteam in den wohltemperierten Beifall ein.
Michael Demel 4.2.2019
© Bilder: Karl und Monika Forster
RIGOLETTO
Besuchte Premiere 19. Januar 2019
Sinnbefreite Aktion mit Polonaise - für die Tonne...
Intendant Uwe Eric Laufenberg siedelt seine Inszenierung von Verdis Rigoletto in der Gegenwart an. Es ist eine düstere sexorientierte Männergesellschaft, die ihre Exzesse auslebt. Damit der Zuschauer das kapiert, gibt es im ersten Bild reichlich Gelegenheit, Latex und Lackstiefel bei diversen Damen zu sehen, die dann als fleischgewordenes Mobiliar, z.B. als Stuhl oder Tisch fungieren. Aha!
Rigoletto trägt wie alle Herren schwarz, kein Narrenkostüm und ist auch nicht (wie im Libretto formuliert) missgestaltet. Dafür darf er permanent eine Clownspuppe als zweites Ego mit sich herum tragen. In seinem Habitus und seiner Körpersprache wirkt dieser Rigoletto eher wie ein Mafiosi oder ein Preisboxer. Offenkundig weckt diese Clownspuppe bei den Höflingen den Wunsch, auch so etwas zu haben. Und siehe da im zweiten Akt geht dieser Wunsch in Erfüllung: jeder Höfling trägt einen Clownskopf vor dem eigenen Gemächt…. ach ja…!

Der Herzog ein etwas schmieriger Unsympath, reisst sich vor lauter Geilheit sein Hemd vom Leib und schmettert dann halbnackt seine Cabaletta, als er zuvor Gilda auf einer Bühne als Sexbeute präsentiert bekommen hat. Auch hier bekommt der Zuschauer „Interpretations - Nachhilfe“, so wird Gilda vor einer großen phallischen Skulptur bloß gestellt. Auf, auf zu Herzogs Schäferstündchen...au weiah!
Zwischen den Personen gibt es reichlich szenische Leerläufe. Immer wieder dürfen die Protagonisten Kleider, Blumen auf den Boden schmeißen oder Stühle umwerfen. Endlich also „Action“….aber das war es dann auch schon! Platte Äußerlichkeiten!
Auftragskiller Sparafucile haust in einem herunter gekommenen Wohnwagen nebst Müllhalde mit seiner Schwester Maddalena. Alles reichlich schäbig und „garniert“ durch einige spärlich bekleidete Stricherinnen, die neckisches Theater mit ihren Schirmen(!) aufführen, als der Herzog seinen Schlager „La donna e mobile“ anstimmt.
Gilda wird nach dem Mord in die Mülltonne gesteckt. Zu schwer schien sie aber nicht verletzt zu sein, da sie sich in der Tonne noch ausziehen konnte, um dann im hellen Unterkleid abzugehen. Was? Richtig, Gilda stirbt in dieser „Interpretation“ nicht…..sie geht einfach ab!

Es ist schon ein Trauerspiel, wie wenig Laufenberg zu diesem Werk zu sagen weiß und zudem außer einem Eintopf gängiger Regietheater-Mätzchen nichts Erhellendes auf die Bühne bringt!
Wieder also einmal ein szenisch überfrachtetes Pseudo-Bedeutungstheater mit abgestandenen Provokationsversuchen, das zu keinem Zeitpunkt den Zuschauer berührt. Ein Rigoletto für die Tonne!
Die hässliche, widersinnige Bühnengestaltung stammt von Gisbert Jäkel und die wenig anschaulichen Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer. Auch hier keinerlei Entsprechung zum vorgesehenen Bühnengeschehen, sonderen pure Tristesse.
Auch musikalisch war das Niveau eher durchwachsen. Ungewöhnlich oft gab es bei den drei Hauptpartien Probleme mit der Intonation. Als Gilda war Cristina Pasaroiu zu erleben und überzeugte mit einer recht guten Leistung, obwohl sie m.E. diesem Fach inzwischen entwachsen ist. Sicher bewältigt sie zwar die Höhen, wenngleich die Koloraturen nicht immer präzise wirkten oder auch Triller nicht klar realisiert wurden. Als Figur wirkte sie z.T. überdreht und dann wieder auch arg unterkühlt.
In der Titelpartie agierte Vladislav Sulimsky mit imponierend kernigem, raumgreifenden Bariton, der sich am wohlsten im Fortissimo fühlte. Ausdauernd in der fordernden Partie zog er alle stimmlichen Register, um seinem Rigoletto intensiven stimmlichen Raum zu geben. Sehr wütend und aufbrausend schmetterte er sein „Cortigiani“, als gäbe es kein Morgen mehr. Bedauerlich, dass die Zwischentöne viel zu deutlich in den Hintergrund traten. Auch irritierte sein zuweilen verwaschenes, von Konsonanten befreites Italienisch.

Als Herzog gefiel der frisch drauf los singende Ioan Hotea. Beeindruckend, wie leicht er die vielen Anforderungen seiner Partie weitgehend mühelos bewältigte. Immer wieder differenzierte er seinen Gesang aus. Nur in der Intonation gab es hin und wieder Probleme, auch müsste er nicht die hohen Töne forcieren.
Ein sehr gute Rolle für Young Doo Park ist der Sparafucile. Hier kann er die Vorzüge seines klangvollen Basses gut zur Geltung bringen. Ihm zu Seite sang Silvia Hauer zuverlässig eine etwas zu abgehärmt wirkende Maddalena. Eine Klasse für sich war wieder einmal der großartige Thomas de Vries, der als Monterone stimmliche Dominanz bestechend ausagieren konnte.
Chordirektor Albert Horne hat seinen Herrenchor exakt vorbereitet, so dass dieser durch seine klangliche Prägnanz und stimmliche Vollmundigkeit erfreute.
Am Pult des Hessischen Staatsorchester stand mit Will Humburg ein sehr erfahrener Dirigent des Verdi Repertoires am Pult. Sowohl er als auch das etwas unkonzentriert wirkende Orchester blieben unter ihren jeweiligen Möglichkeiten. Da klapperte es in den Bläsern, im ersten Bild kam es immer wieder zu deutlichen Wacklern zwischen Bühne und Graben. Recht schwerfällig mit wenig rhythmischer Prägnanz arbeitete sich Humburg durch die Partitur. Zu vieles klang hier eher weich gespült. Da hatten seine Vorgänger Kamioka und Piollet am Haus weit mehr musikalisches Kapital mit dem Hessischen Staatsorchester in ihren Rigoletto Interpretationen erarbeitet. Immerhin im Verlaufe des Abends gewann das Orchester an Sicherheit, die Balance stimmte dann schlussendlich, dennoch blieb ein ambivalenter Eindruck.
Am Ende gab es im ausverkauften Haus erstaunlich wenig Widerspruch bei Laufenbergs Erscheinen. Lediglich einzelne vehemente Buhs aus dem dritten Rang trafen erkennbar den Regisseur. Gedrosselte Begeisterung.
Dirk Schauss 22.12019
Fotos (c) Karl & Monika Forster
Zum Ersten
JENUFA
Bericht von der Premiere am 29. November 2018
Rundum geglückt
Das Staatstheater Wiesbaden baut seine Janáček-Kompetenz weiter aus. Nach der mustergültig gelungenen Katja Kabanova vor zwei Jahren ist nun mit Jenufa erneut eine szenisch stimmige und musikalisch beeindruckende Produktion zu erleben. Bereits die ersten Töne aus dem Orchestergraben lassen aufhorchen. Atmosphärisch dicht, zugleich aber locker und transparent und dabei rhythmisch präzise führt Generalmusikdirektor Patrick Lange sein bestens vorbereitetes Orchester durch die anspruchsvolle Partitur. Die vielen Anklänge an böhmische Volksmusik werden herzhaft und saftig herausgearbeitet, ohne daß der Klang dabei in platte Folklore umkippt. Die bei Janáček so wichtigen Holzbläser zeigen sich in guter Form, die Streicher spielen kernig und unsentimental auf, das Blech ist gut in den Gesamtklang eingebunden. Lange führt sein Orchester an der kurzen Leine und verlangt von ihm minutiöse Abstufungen bei Tempo, Dynamik und Klangfarben. Seine Musiker folgen ihm auf den Punkt.

Dazu kommt ein Sängerensemble ohne Schwachstellen. Wie schon in Katja Kabanova sind die beiden weiblichen Hauptrollen Sabina Cvilak (Jenufa) und Dalia Schaechter (Küsterin) anvertraut. Sabina Cvilak überzeugt erneut mit ihrer lyrisch grundierten, mitunter idiomatisch herben Stimme, die zu großer dramatischer Expansion fähig ist. Wie schon als Katja Kabanova zeigt sie eine große Bandbreite an Klangfarben, jugendlich frisch zu Beginn, im weiteren Verlauf aber mit einem Ton der Trauer, der nichts Larmoyantes hat. Szenisch wird sie von Dalia Schaechter noch übertroffen. Ihr Porträt der Küsterin ist von einer beinahe schmerzlichen Intensität. Noch bevor sie den ersten Ton singt, zieht sie mit ihrer Bühnenpräsenz alle Blicke auf sich. Man muß das Textbuch nicht gelesen haben, um zu erkennen, daß diese Frau in ihrem Dorf eine Autorität darstellt. Schnell wird sie zur zentralen Figur des Abends. Man fühlt mit ihr bei der Sorge um das Wohl der Stieftochter, erlebt ihre Zerrissenheit, ist entsetzt von ihrem Entschluß, den unehelichen Säugling als Quelle gesellschaftlicher Ächtung aus dem Weg zu räumen und muß schließlich mit ansehen, was der Säuglingsmord aus der Täterin macht. Schaechter zeichnet das Bild einer Frau, die von ihrer Schuld in den Wahnsinn getrieben wird. Wie eine Angeklagte steht sie auf der Bühne mit nach innen gewendetem, halb irrem Blick, mit Gesichtszügen, in denen sich blitzartig wechselnde Stimmungen spiegeln. Der rechte Arm zuckt unkontrolliert, die vormals streng geordnete Frisur löst sich auf. Daß dies nicht zur Karikatur gerät, sondern zu einem stimmigen, erschütternden Porträt, ist eine der herausragenden Leistungen des Abends. Zur Vielschichtigkeit und Zerrissenheit der Figur paßt auch, daß Schaechter völlig unterschiedliche Stimmregister nebeneinanderstellt. Zu Beginn hört man eine zurückgenommene, dunkel abgetönte Farbe. Dann blitzen immer wieder Töne eines reifen, hochdramatischen Mezzosoprans auf. Nur wenige Phrasen erinnern an die giftig keifende Schwiegermutter aus Katja Kabanowa. Es gibt bei ihr keinen Schöngesang, sondern genau auf den Text bezogene Expressivität.

Dalia Schaechter als Küsterin
Sehr gut kommen die beiden Tenöre mit ihren teilweise unbequem hoch liegenden Partien zurecht. Aaron Cawley als Steva präsentiert seinen kraftvoll jugendlichen Tenor in Bestform. Den leichtsinnigen Hallodri kauft man ihm ohne weiteres ab. Daniel Brenna hat die wichtige Rolle des Laca als Einspringer kurzfristig für den erkrankten Paul McNamara übernommen, läßt sich aber keine Unsicherheit anmerken. Er zeichnet das Gegenbild zum aufgekratzten Steva und gibt sich rollenadäquat zunächst steif und introvertiert. Seine Stimme aber klingt wunderbar unangestrengt und gut geführt. Anna Maria Dur zeigt in der Rolle der Großmutter Buryia, daß man eine alte Frau mit wohltuend frischer Stimme ohne musikalische Abstriche glaubhaft darstellen kann.
Gisbert Jäkel hat dazu ein schlichtes, aber stimmiges Bühnenbild ersonnen. Die Szenerie vor der Mühle zu Beginn wird mit schlichten Bretterwänden angedeutet. Der zweite Akt zeigt dann naturalistisch das Innere des Wohnhauses der Küsterin. Der dritte Akt spielt vor diesem Haus. Der Umbau im Übergang vom ersten zum zweiten Akt findet auf offener Bühne statt. Die Darsteller bleiben einfach stehen, die Stube wird langsam gedreht, bis ihre Außenseite erscheint.

Die Regie von Ingo Kerkhof ist ebenso schnörkellos. Sie konzentriert sich ohne Regietheatermätzchen auf das Erzählen des tragischen Stoffes. Dabei gelingt es dem Regisseur, ein eindringliches Kammerspiel von großer Dichte und sich immer weiter steigernder Intensität zu entwickeln. Dieser Regieansatz sollte gerade für solche Zuschauer hilfreich sein, die dem Stück zum ersten Mal begegnen.
Der Premierenapplaus ist für alle Beteiligten ungebrochen stark. Schaechter und Cliviak werden verdientermaßen gefeiert.
Weitere Vorstellungen gibt es am 6., 12., 15., 20. und 28. Dezember.
Michael Demel, 1. Dezember 2018
© der Bilder: Karl und Monika Forster
Zum Zweiten Premierenbericht
JENUFA
Kaum zu glauben: es mussten Jahrzehnte vergehen, bis das Staatstheater Wiesbaden sich entschloss, endlich einmal wieder Leos Janaceks Meisterwerk „Jenufa“ zu präsentieren! Gewählt wurde die Originalsprache und die sog. „Brünner Fassung“, die der Originalfassung entsprechen soll. Gerade bei Janacek, der so sehr vom gesprochenen Wort her seine Opern komponierte, wäre es eine bessere Entscheidung gewesen, wenn Wiesbaden sich für eine deutschsprachige Einstudierung entschieden hätte. Dies hätte dem Publikum das Stück wesentlich näher gebracht, zumal kein tschechischer Muttersprachler zum Ensemble zählte.
Regisseur Ingo Kerkhof erzählt stringent, plausibel und nachvollziehbar die Handlung. Dabei vermeidet er jegliche ländliche Koloristik, wenngleich das Geschehen erkennbar in einer vergangenen Zeit spielt. Zunächst gibt es ein Vorspiel vor Beginn der Oper. Zu folkloristischer Musik aus einem Grammophon formieren sich die verschiedenen Generationen der Familie Buryia, bis dann im Jahr 1900 die Oper beginnt. Das Bühnengeschehen wirkt stilisiert, zuweilen auch minimalistisch, ja tritt erkennbar deutlich hinter die Musik zurück. Jenufa wirkt durchweg ernst, was ihr viele Facetten nimmt. Ebenso ist Laca in der Rollenzeichnung erstaunlich blass. Nichts Getriebenes, kein Jähzorn ist zu erleben, so wirkte der Schnitt mit dem Messer an Jenufas Wange eher zufällig. Die Küsterin wird vor allem als leidenschaftliche Frau gezeichnet, die für das Glück ihrer Ziehtochter kämpft. Das sie das moralische Oberhaupt der Dorfgemeinde ist, lässt sich kaum erahnen. In der Führung des Chores im ersten Akt gibt es eine erstaunliche Zurückhaltung. Stevas Jubelgesang über seine Ausmusterung geriet hier eher nett als aus dem Ruder laufend. Auch der Bühnenraum von Gisbert Jäkel und die schlichten, z.T. ländlichen Kostüme von Sonja Albartus unterstützen diese zurückhaltend wirkende Interpretation.
Als Jenufa war Sabina Cvilak zu erleben. Ihre herbe Stimme passt gut zum Rollencharakter. Leider erklangen viele Töne in der Höhe eher kehlig. Kaum nutzte sie die Chance zur dynamischen Gestaltung. Zu oft suchte sie Zuflucht im Forte und stellte somit die lyrischen Anforderungen zu weit in den Hintergrund. Dominiert wurde der Abend von der überragenden Küsterin von Dalia Schaechter. Hier war keine alternde Dorfhexe zu erleben, sondern zu allererst eine liebende Ziehmutter, die im Affekt großes Unheil verursacht und darüber zerbricht. Schaechter sang und spielte das mit großer Wucht, fand aber auch die notwendigen Zwischennuancen, ebenso wie manch grellen Wahnsinnston. Dazu zeigte sie auch eine gute Durchdringung des Textes. Auch in der Darstellung, der Körpersprache und ihrer Mimik war sie ungemein überzeugend.
Als Laca war ursprünglich Paul McNamara vorgesehen. Krankheitsbedingt fiel er aus, so dass für ihn Daniel Brenna zu erleben war. Brenna hatte bereits den Laca an der MET gesungen und zeigte eine respektable Leistung. Darstellerisch präsent, vermochte er auch mit seinem raumgreifenden Gesang zu beeindrucken. Als Rollencharakter wirkte er jedoch viel zu blass, zu brav und war nicht der Aufbrausende, der zu oft am Rande stand und schließlich doch noch die Liebe findet.
Steva wurde in der stimmpotenten Gestalt von Aron Cawley deutlich aufgewertet. Mühelos kam er mit den unangenehmen hohen Intervallen seiner Partie zurecht. Darstellerisch war er ein glaubwürdiger Bruder Leichtfuß. Insgesamt seiner bisher beste Leistung in Wiesbaden.
Anna Maria Dur war als Alte Buryia sehr präsent und stimmlich sattelfest, wie auch der köstliche Richter von Hans-Otto Weiß und Annette Luig als dessen Frau. Auch die übrigen Partien waren gut besetzt. Verlässlich wie immer die gute Choreinstudierung von Albert Horne.
GMD Patrick Lange am Pult des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden entschied sich für eine sehr weiche Lesart der Partitur. Gut traf er den Puls der Musik, vermied jedoch notwendige Härten. Völlig verschenkt erklangen das Vorspiel zum 2. Akt und das gespenstische Finale dieses Aktes. In rekordverdächtiger Harmlosigkeit tönte es da vor sich hin. Insgesamt wirkte seine Interpretation sehr akademisch, zu deutlich auf Sicherheit bedacht. Das Orchester war gut präpariert und spielte kultiviert. In den so wichtigen Instrumentalsoli, wie z.B. im großen Violinsolo des zweiten Aktes fehlte hingegen der sehrende Seelenton, der bei Janacek so charakteristisch ist.
Die Premiere war leider schwach besucht. Davon abgesehen spendete das halbvolle Haus anerkennenden Beifall für alle Mitwirkenden.
Dirk Schauß 3.12.2018
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG
Bericht von der Premiere am 29. September 2018
Alles so schön bunt hier
Die Neuproduktion der „Meistersinger“ am Staatstheater Wiesbaden empfängt die Zuschauer mit einer auf den Zwischenvorhang gemalten Stadtansicht des spätmittelalterlichen Nürnbergs, umkränzt von den Wappen der Zünfte. Während Generalmusikdirektor Patrick Lange sein erst allmählich Tritt fassendes Orchester engagiert durch die Ouvertüre lotst, macht man sich so seine Gedanken, ob diese Reminiszenz an ungebrochene Aufführungstraditionen wohl ironisch gemeint sein und wie ätzend diese Ironie wohl ausfallen könnte. Schließlich hebt sich der Vorhang und gibt den Blick frei auf den Schankraum einer in die Jahre gekommenen Kneipe. Hier findet die Zusammenkunft der Meister statt: Ein Häuflein von gebrechlichen Tattergreisen, die Bühnen- und Kostümbildner Friedrich Eggert so stilecht mit abgetragener Altmänneralltagskleidung und Gesundheitsschuhen ausstaffiert hat, daß Teile des Publikums sich gemeint fühlen müssen. Hatte man diesen älteren Herrn dort auf der Bühne mit seinem vollgestopften Stoffbeutel nicht eben erst an der Garderobe gesehen? Regisseur Bernd Mottl individualisiert jeden der Meister milde karikierend mit je eigener Marotte. Die Lehrbuben entpuppen sich als Pflegekräfte, die ihre hinfälligen „Meister“ stützen müssen. Das ist sehr lebendig und kurzweilig geraten. Wenn Goldschmied Pogner schließlich zu seiner Rede über den Werteverfall „im weiten deutschen Reich“ unter dem grimmigen Nicken der Umsitzenden anhebt, wirkt diese kuriose Versammlung wie die Vorstandssitzung eines AfD-Ortsvereins, ein Eindruck, der dadurch noch unterstrichen wird, daß sich unter die Greise ein schneidiger junger Kerl in Springerstiefeln gemischt hat. Ein wenig abgedroschen ist die Idee, den „Ritter“ Walther von Stolzing in Motorradkluft auftreten zu lassen, um ihn von diesem reaktionären Rentnerclub abzuheben. Zu seinem Vorsingen kostümieren sich die Meister umständlich (man hat Rücken) mit altdeutschen Trachten, die wie Überbleibsel einer Wolfgang-Wagner-Inszenierung wirken. Sehr komisch das Ganze. Und so schön bunt. Hier, so hofft man, wird die Exposition einer ironischen Aktualisierung mit subtilem zeitkritischem Tiefgang angelegt – ein Versprechen, daß dann leider vom Produktionsteam nicht eingehalten wird.

Die verkleideten Meistersinger, am linken Rand: Thomas de Vries (Beckmesser), am rechten Rand: Marco Jentzsch (Stolzing)
Der zweite Aufzug offenbart den Namen der Kneipe: „Alt-Nürnberg“. Sie befindet sich als Enklave im Erdgeschoß eines Pflegeheims, dessen Außenfassade nun die gesamte Bühnenbreite einnimmt. In trostloser 70er-Jahre-Manier ist der Vorplatz gestaltet mit Betonbank und lieblos-klotzigem Blumenbeet, das immerhin mit jenem Flieder bepflanzt ist, den Hans Sachs besingen wird. Sein Schusterlied aber präsentiert er aus einem Fenster im ersten Stockwerk des Pflegeheims heraus, in das er sich dazu eigens begeben hat – warum auch immer. Für das hämmernde Vermerken der Fehler in Beckmessers Ständchen muß er dann umständlich wieder herunter kommen, was einige Zeit in Anspruch nimmt, während derer Beckmesser buchstäblich gegen die Wand redet. Vor der schwierig zu inszenierenden Prügelfuge am Ende des zweiten Aufzugs kapituliert das Inszenierungsteam. Es läßt die wie zu Halloween kostümierten Pflegekräfte eine Art Black-Gothik-Party mit allerlei Rumgehopse und drolligem Frau-Holle-Kissen-Schütteln aufführen. Daß es sich um einen Gewaltexzeß handelt, in dem die Menge vorgeblich braver Bürger zum pogrombereiten Mob wird, ist in Wiesbaden nicht zu sehen.

Hans Sachs (Oliver Zwarg) im Altenheim
Sehr anrührend gelingt dagegen der Beginn des dritten Aufzugs. Zu den melancholischen Klängen des Orchestervorspiels sieht man ein stilecht eingerichtetes Altenheimzimmer mit Pflegebett und wenigen Möbeln. Darin sitzt Hans Sachs und wirft mit einem Diaprojektor traurig Bilder vergangener Zeiten an die Wand. Zu sehen ist seine verstorbene Frau in ihrem Hochzeitskleid, Urlaubsbilder mit Familie, eine Ansicht seines Schusterladens, der – wie weitere Bilder zeigen – wohl vor Jahren schon aufgegeben wurde, um samt zugehörigem Häuserblock abgerissen zu werden. Die Trauer des alten Mannes überträgt sich auf das Publikum. Es ist der stärkste Moment des Abends. Danach geht es mit der Komödie weiter. Das elektrisch verstellbare Pflegebett und ein Bügelbrett bieten Gelegenheit zu ein wenig Slapstick. Die abschließende Festwiesenszene findet erwartungsgemäß wieder im Gastraum der Kneipe statt, auf dem man ein erhöhtes Podium errichtet hat, dessen Rückprospekt die Stadtansicht zeigt, die man vom Zwischenvorhang kennt. Der Aufzug des Volkes und der Zünfte wird unspektakulär arrangiert. Die kleine Wiesbadener Bühne ist schnell mit Menschen überfüllt. Walther von Stolzing hatte zuvor seine Motorradkluft gegen einen stilisierten Trachtenanzug eingetauscht und ist nun begehrtes Objekt für Selfies mit jugendlichen Fans. Das alles läuft ohne Überraschungen ab. Die hochproblematische, deutsch-nationale Schlußansprache von Hans Sachs bleibt szenisch unkommentiert. Die Veranstaltung wird zum heiter-harmlosen Volksfest, worüber sich die Meister in ihrer verstaubten Feierlichkeit irritiert zeigen. Und das war es dann auch schon. Nach der verheißungsvoll-ironischen Exposition im ersten Aufzug mit ihren plastisch gezeichneten Karikaturen hätte man eine konsequente Durchführung hin zu einem profilierten Ende erwartet. So aber schnurrt alles handwerklich solide mit mal hübschen, mal belanglosen episodischen Einfällen vorüber. Diese Inszenierung ist samt ihrer phantasievollen Ausstattung kurzweilig, aber ohne roten Faden, ohne Aussage und – das muß man ihr vorwerfen – ohne Haltung zu den politischen Fallstricken der Vorlage.

Auf der Festwiese
Musikalisch ist die Neuproduktion glücklich gelungen. Oliver Zwarg präsentiert sich mit geradezu idealer „Sachs“-Stimme. Sein Bariton ist gut fokussiert und kernig genug für die derben Schusterlieder. Zugleich verfügt er über eine elegante und unangestrengte Höhe, die sich in den lyrischen Passagen angenehm bemerkbar macht. Zudem hat er sich seine Kräfte so gut eingeteilt, daß auch die Schlußansprache noch kraft- und saftvoll gelingt. Wenn wir es recht sehen, ist dies sein Rollendebüt. Es ist zu erwarten, daß der Sänger nach dem gelungenen Einstand im Verlaufe des Aufführungszyklus seinem musikalisch tadellosen Rollenporträt noch ein wenig mehr Individualität und Tiefenschärfe verleihen wird. Er hat das Zeug dazu, einer der führenden Sänger dieser anspruchsvollen Partie zu werden.
Den „Beckmesser“ von Thomas de Vries, dem zweiten Rollendebütanten, kann man bereits jetzt in einem Atemzug mit den herausragenden Sängern dieser Partie nennen. Auf der Basis einer intakten Kavaliersbariton-Stimme gewinnt de Vries dem Notentext eine staunenswerte Fülle an Tonlagen und Zwischenstufen ab. Es gelingt ihm, vorbildlich textverständlich zu sein, ohne in das Konsonantenspucken des berüchtigten „Bayreuth barking“ zu verfallen. Er kann auf Linie singen, ohne die Konturen abzuschleifen, kann beißende Ironie und Mißgunst mit einer genau abgestimmten Palette von Stimmfarben zeichnen, hat Sinn für feinen wie für drastischen Humor und läßt seine Figur doch nie zur Karikatur verkommen. Darstellerisch spielt er alle übrigen Sänger locker an die Wand.
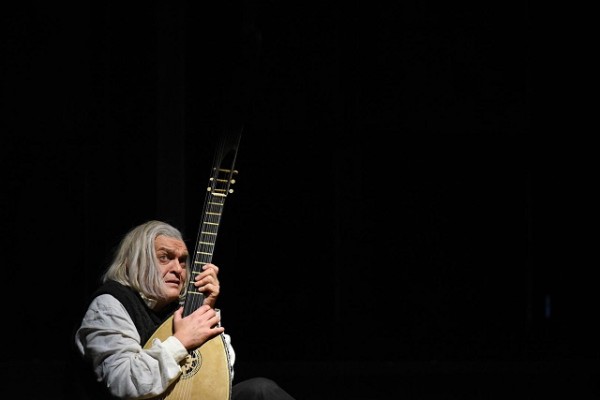
Thomas de Vries als Beckmesser
Marco Jentzsch verfügt bereits über Erfahrung in der Rolle des „Walther von Stolzing“. Das macht sich angenehm bemerkbar. Die akustischen Verhältnisse des Wiesbadener Hauses erlauben es ihm, nie zu forcieren und so die Vorzüge seiner lyrisch grundierten Stimme auszuspielen. Die in der Vergangenheit bei ihm im heldischen Fach mitunter zu verzeichnenden Höhenprobleme umgeht er geschickt durch den stärkeren Einsatz des Kopfregisters. Erik Biegel wahrt als „David“ mit maskigem Spieltenor den vom Rollenfach gebotenen stimmfarblichen Abstand zu Jentzsch, was dramaturgisch sinnvoll ist, musikalisch aber Wünsche offen läßt.
Mit wunderbar frischem Sopran präsentiert sich Betsy Horn als nicht nur stimmlich attraktive „Eva“. Margarete Joswig überrascht nach ihrem Einsatz als „Fricka“ im Wiesbadener Ring damit, daß sie die vom Produktionsteam gewollte Ausstaffierung als girlie-hafte „Magdalene“ auch musikalisch mit gut geführtem, jugendlich klingendem Mezzo beglaubigen kann. Wunderbar sonor präsentiert der junge Wiesbadener „Baß vom Dienst“ Young Doo Park sich als „Veit Pogner“ in seinem bislang besten Rollenporträt. Stimmlich sitzt ihm die Partie wie angegossen. Hatte er bei vergangenen Einsätzen im deutschen Fach noch gelegentlich mit der Sprache zu kämpfen, so ist davon nun nichts mehr bemerkbar. Er artikuliert gut verständlich, frei von Verfärbungen und macht das Zuhören zu einem ungetrübten Genuß. Ein wenig zu lyrisch-leicht ist der wunderbar samtige Bariton von Benjamin Russel für die Rolle des „Fritz Kothner“. Bei den übrigen Meistern gibt es keine Ausfälle.

Young Doo Park (Pogner, sitzend), dahinter Oliver Zwarg (Sachs, links) und Benjamin Russel (Kothner, rechts)
Neben dem vorzüglichen, homogen und füllig tönenden Chor (den wie stets Albert Horne gut präpariert hat), stechen noch die Sängerinnen und Sänger der „Lehrbuben“ hervor. In Wiesbaden haben sie dafür junge Nachwuchstalente gecastet, die nicht nur ausgezeichnet und herrlich frisch singen, sondern mit ungebremster Spiellaune viele Szenen zu beleben wissen.
Generalmusikdirektor Patrick Lange hält sein gut aufgelegtes Orchester zu transparentem Spiel an und verzichtet auf polterndes Dröhnen. Zu hören sind schöne Holzbläsersoli und ein seidiger Streicherklang. Das Orchester drängt sich nie in den Vordergrund und macht es den Sängern leicht, den Text im unangestrengten Parlando-Ton zu präsentieren.
Die Zustimmung im Schlußapplaus ist für alle Beteiligten groß und ungeteilt. Die angedeuteten Provokationen des Eingangsaktes hat das Publikum da längst schon vergessen.
Michael Demel, 1. Oktober 2018
© der Bilder: Karl und Monika Forster
DON GIOVANNI
Bericht von der Premiere am 17. Juni 2018
Trailer
Konsequent durchgearbeiteter Trash
Konrad Junghänels Mozart-Zyklus am Staatstheater Wiesbaden biegt allmählich in die Zielgerade ein. In der kommenden Saison wird er ihn noch mit einem Doppelschlag zu „Idomeneo“ und „La Clemenza di Tito“ vollenden. Nun hat er sich zum Abschluß der laufenden Spielzeit der „Oper aller Opern“ (laut E. T. A. Hoffmann) zugewandt. Eigentlich ist das ein „Chef-Stück“, also eines, welches sich üblicher Weise die Generalmusikdirektoren vorbehalten. Der Wiesbadener Orchesterchef Patrick Lange saß aber in der Premiere brav im Zuschauerraum und konnte sich anhören, wie sein Kollege das Wiesbadener Staatsorchester auf eine historisch informierte Spielweise eingeschworen hat, die kaum hinter dem Standard von Spezialensembles zurücksteht. Was zu Beginn der Intendanz von Uwe Eric Laufenberg bei „Cosi fan tutte“ noch experimentell angemutet hatte, dann in der wiederaufgenommenen „Nozze di Figaro“ gefestigt wurde und in einer großartigen „Zauberflöte“ einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte, wirkt nun geradezu selbstverständlich: vibratoarmer Streicherklang, unsentimentale, klar geführte Holzbläser und knackige Paukentöne mit harten Schlegeln, dabei zügige Tempi und eine sprechende Phrasierung. Diesen Klang hat der Dirigent für den „Don Giovanni“ noch angeschärft und eingedunkelt. Geradezu hart und unerbittlich läuft das Stück um einen unmoralischen Wüstling seinem Ende entgegen. Bei Mozarts „Dramma giocoso“ wird im Orchestergraben das „Dramma“ betont, während das Adjektiv „giocoso“ in den Hintergrund tritt.

Don Giovanni (Christopher Bolduc) und Leporello (Shavleg Armasi)
Das Bühnenbild von Raimund Bauer zeigt dazu in kaltes Licht getauchte Vorstadt-Einkaufszentrum-Architektur, deren Wände ganz aus scheußlichem, gelblich-grünem Kunststoff gefertigt sind. Von den beiden Stockwerken des Gebäudes ist der obere Teil fix, während das Erdgeschoß über die Drehbühne immer neue Raumeindrücke freigibt und so geschickt schnelle Szenenwechsel ermöglicht. Das Personal der Oper gehört dem Vorstadt-Prekariat hat. Es scheint ganz so, als hätte sich das Produktionsteam vorgenommen, einen besonders trashigen Ansatz lustvoll bis zur äußersten Konsequenz durchzuspielen. Regisseur Nicolas Brieger präsentiert dazu eine Fülle von Ideen, die man nicht alle mögen muß, die jedoch dafür sorgen, daß an diesem über drei Stunden langen Premierenabend keine Langeweile aufkommt. Brieger versteht sein Regiehandwerk und weiß ein spielfreudiges Ensemble überwiegend junger Sänger gut zu führen.
In der ersten Szene tritt Don Giovanni in der Maske des Komturs auf, welche er auch bei der angeblichen Vergewaltigung von dessen Tochter Donna Anna aufbehält. Zu sehen ist hier aber einvernehmlicher Sex, der durch die Maskierung als (gespielter) Inzest erscheint. Die anschließende Ermordung des Komturs erscheint mehr als ein Unfall: Bei einem Handgemenge mit einer Pistole löst sich versehentlich ein Schuß. Bei der berühmten Registerarie mit der Aufzählung von Don Giovannis weiblichen Eroberungen in allen europäischen Nationen präsentiert der Diener Leporello die auf seinem Körper dazu eintätowierten Frauennamen. Besonders zotig wirkt dabei, daß Leporello hinsichtlich der Anzahl der spanischen Liebschaften seines Meisters der entgeisterten Donna Elvira sein Gemächt vorzeigt (natürlich erst, nachdem er dem Publikum den Rücken zugedreht hat). Der Tätowierer muß die entsprechenden 1003 Namen („mille e tre“) dort wohl in Mikroschrift aufgebracht haben.

Katharina Konradi (Zerlina), Benjamin Russell (Masetto) und Ensemble
Als Zitat von Laufenbergs Kölner Inszenierung präsentiert Brieger eine Türkenhochzeit beim Paar Masetto-Zerlina, ohne dies allerdings mit der gleichen Konsequenz wie seinerzeit in Köln durchzuspielen. Drastisch wird die Schändung der Zerlina durch Don Giovanni als Entjungferung mit demonstrativ ausgestelltem Blutfleck im Schritt markiert. Leider wirkt das Setting des Maskenballs mit allzu edlen Rokokokostümen im Prekariatsmilieu deplatziert. Das läßt sich dann auch durch ein kollektives Sangria-Saufen mit langen Strohhalmen nicht wirklich umbiegen. Allerdings endet diese Szene mit einem Coup: Der als Verbrecher enttarnte Don Giovanni steckt zur Ermöglichung seiner Flucht das Gebäude mit einem Molotowcocktail in Brand.
Matt dagegen ist die Schlußpointe, die der Inszenierung nachträglich einen Deutungsrahmen geben soll. Statt zur Hölle zu fahren, reiht sich Don Giovanni in eine Schar von Tattergreisen mit Urinbeuteln und Gehstützen ein. Zusammen mit der im Laufe des Abends immer wieder auftauchenden Gesichtsmaske des Komturs soll das Stück so als vergeblicher Kampf gegen das Alter interpretiert werden. Einen verwandten Ansatz hat Christof Loy in seiner Inszenierung für die Oper Frankfurt wesentlich überzeugender durchgespielt. Bei Brieger in Wiesbaden wirkt dieses Ende seltsam aufgepfropft.

Gesungen und gespielt wird dabei ausgezeichnet. Die Besetzung profitiert von den vielen jungen Talenten, die Intendant Laufenberg an sein Haus gebunden hat. Christopher Bolduc zeigt in der Titelpartie seine bislang überzeugendste Leistung. Sein kerniger Bariton ist frisch und viril. Dabei verfügt er auch über eine ungefährdete Höhe, hat derbe Klangfarben im Umgang mit seinem Diener, Kälte und Zynismus für die verlassene Ehefrau. Er kann andererseits aber Zerlina sanft umschmeicheln (wunderbar im Duett „Là ci darem la mano“) und legt ein zartschmelzendes Ständchen hin. Eine ansprechende Leistung zeigt auch Shavleg Armasi als „Leporello“ mit kantigem, aber beweglichem Baß und diabolischer Spiellust. Katharina Konradi gelingt es mit ihrem angenehm schlackelosen Sopran bei perfekter Stimmführung die unterschätzte Rolle der „Zerlina“ deutlich aufzuwerten und erhält dafür am Ende verdienter Maßen großen Publikumszuspruch. Deutlich reifere, aber nicht unangemessene Töne sind von Netta Or als „Donna Anna“ zu hören. Als quirlig-resolutes Energiebündel erweist sich erneut die zierliche Heather Engebretson. Ihre helle und bewegliche Stimme erlaubt ihr eine mühelose Bewältigung der Koloraturen. Einzig für die tieferen Lagen fehlt es ihr an stimmlicher Substanz. Benjamin Russell überzeugt mit seinem schlanken und wohltönenden Bariton als „Masetto“, und Young Doo Park orgelt mit seinem bewährten schwarzen Baß einen überzeugenden „Komtur“. Ioan Hotea wirkt als "Don Ottavio" einmal mehr wie der kleine Bruder von Rolando Villazon (vor dessen Stimmkrise) mit saftigem Tenor und einer gewissen Neigung zu Überdruck und angeschluchzten Tönen.

Ioan Hotea (Don Ottavio) und Netta Or (Donna Anna)
Intelligent und stilsicher macht Tim Hawken am Hammerflügel auf sich aufmerksam. Er stützt nicht nur flexibel die Rezitative, sondern sorgt auch für kleine, anspielungsreiche Soloeinlagen, etwa wenn er das „Lacrimosa“ aus Mozarts Requiem anklingen läßt.
Das Publikum zeigt sich einhellig begeistert im Hinblick auf die musikalische Darbietung und gespalten mit teils deutlichen Unmutsbekundungen im Hinblick auf die Regie.
Weitere Vorstellungen gibt es am 27. und 29. Juni sowie gleich zu Beginn der kommenden Saison im September und Oktober.
Michael Demel, 23. Juni 2018
Copyright der Bilder: Karl und Monika Forster
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere: 30.04.2018
besuchter Vorstellung: 10.06.2018
Maskenball als düsterer Unterweltkrieg
Lieber Opernfreund-Freund,
Verdis Musikdrama „Un Ballo in Maschera“ ist derzeit in einer neuen Inszenierung am Staatstheater Wiesbaden zu erleben. Am gestrigen Sonntag bin ich für Sie in die hessische Landeshauptstadt gereist und habe mir die Produktion, die in der kommenden Spielzeit wiederaufgenommen wird, angesehen.

Die blutigen Gegebenheiten um den gewaltsamen Tod des Schwedenkönigs Gustav III. der 1792 auf einem Maskenball Opfer eines Attentats von Verschwörern wurde, weil er die Privilegien des Adels abschaffen wollte, hatte Eugene Scribe, vielbeschäftigter Schriftsteller und Librettist, zu einem Drama verarbeitet, in dem er dem König ein amouröses Verhältnis zu Amelia, der Frau seines besten Freundes, andichtete. Neben Daniel-François-Esprit Auber, der das Werk 1833 vertonte, diente die Dichtung dem Librettisten Antonio Somma als Vorlage für Giuseppe Verdis Oper „Un Ballo in Maschera“, die 1859 in Rom zur Uraufführung kam. Den Zugeständnissen an die seinerzeitige Zensur ist es zu verdanken, dass Verdis Werk nicht mehr in Schweden, sondern in Boston spielt, und auch die junge serbische Regisseurin Beka Savić, bis vergangenes Jahr Spielleiterin am Haus, belässt die Handlung in den USA, verlegt sie aber in die 1920er Jahre. Ganz und gar duster sind die Kulissen, Renato ist hier nicht mehr Gouverneur von Boston, sondern eine Unterweltgröße, die seiner Gefolgschaft ein sicheres Auskommen mittels dunkler Geschäfte wie Waffen- oder Alkoholschmuggel ermöglicht. Doch auch mit der Ganovenehre ist es nicht weit her und es regt sich Widerstand gegen den Mafiakönig. Der Galgenberg wird zum düsteren Hinterhofsetting, der Ball am Ende findet in herrlicher, vom Jugendstil inspirierter Kulisse statt (Luis Carvalho hat ein schwarzes Haus auf die Drehbühne gestellt). Selena Orb verpasst vor allem den Damen schillernde und phantasievolle Outfits, die Herren dürfen im Wesentlichen mit Al Capone-Hüten und Gamaschen Zeitkolorit zeigen. Lediglich das grobe Licht von Andreas Frank zerstört bisweilen das stimmige Bild. Gerade die Ulrica-Szene gehört dann doch in obskureres Licht getaucht, damit der wunderbar-mystische Gesang von Romina Boscolo, die mit Leidenschaft und herrlich-androgyner Tiefe die mysteriöse Wahrsagerin mimt, zur vollen Wirkung kommen kann. Denn die Italienierin ist geradezu eine Idealbesetzung für diese Rolle – genau so stellt man sich diese undurchsichtige Figur vor.

Ein ähnlicher Glücksgriff ist Heather Engebretson, dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht noch als umwerfende Violetta im Gedächtnis, die als Oscar für die erkrankte Gloria Rehm eingesprungen ist. Schon rein physisch gibt sie überzeugend den bemützten Laufburschen, zeigt dabei enorme Bühnenpräsenz, unglaubliche vokale Geläufigkeit und scheinbar mühelose Höhen. Adina Aarons Sopran ist reichlich nachgedunkelt, seit ich sie das letzte Mal habe hören dürfen, doch das passt gut zum düsteren Regieansatz und lässt ihre Amelia eher als energiegeladene Frau, denn als bloße Gefühlsgetriebene erscheinen. Und doch zieht die junge US-Amerikanerin im dritten Akt auch alle Piano-Register und rührt mit „Morro, ma prima in grazia“ zu Tränen. Vladsilav Sulimsky gibt voller Inbrunst und Verve den enttäuschten Freund und scheinbar betrogenen Gatten, der sein Recht mit allen Mitteln durchsetzen will und auf Rache sinnt. Sein Bariton bringt dafür die nötige Durchschlagskraft mit – und das zeigt der Russe auch gerne. Arnold Rutkowski demonstriert als Riccardo, was er kann, zeigt bombensichere Spitzentöne, metallisches Timbre und viel Gefühl, gerade wenn er die innigeren Momente mit Amelia darstellt. Zusammen mit dem präzise singenden und spielenden Chor, den Albert Horne betreut, präsentiert sich da gestern eine Besetzung, die keine Wünsche offenlässt.

GMD Patrick Lange geht Verdis Partitur mit viel Schwung an, schießt dabei allerdings bisweilen über das Ziel hinaus und übertüncht gerade im ersten Akt gerne einmal das Sängerpersonal. Im Laufe des Abends findet er zusammen mit den glänzend aufspielenden Musikerinnen und Musikern des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden jedoch die richtige Balance zwischen verdischer Wucht und sensibler Begleiterrolle. So wird’s ein rundum gelungener Abend, der dem Publikum merklich gefällt. Beka Savić hat da zwar kein neues Kapitel in der Rezeptionsgeschichte des Werkes aufgeschlagen, aber eine schlüssige, ideenreiche und lebendige Lesart des Dramas gefunden, die sich sicher lange im Repertoire wird halten können.

Ich verabschiede mich nun in die Sommerpause und freue mich schon darauf, Ihnen ab Herbst wieder von Opernabenden berichten zu können, die hoffentlich so kurzweilig sind, wie es dieser war.
Ihr
Jochen Rüth
10.06.2018
Dir Fotos stammen von Monika & Karl Forster.
ARABELLA
Zweiter Bericht von der Premiere am 11. März 2018
Solides Theaterhandwerk, durchwachsene musikalische Bilanz
Schon wieder eine Verschiebung der Handlung einer Strauss-Oper in die Entstehungszeit: Nach Brigitte Fassbaenders riskanter, aber überraschend geglückter Verlegung des „Capriccio“ vom späten 18. Jahrhundert in die 1940er Jahre an der Oper Frankfurt läßt nun auch die Wiesbadener Neuproduktion der „Arabella“ das Stück in den Anfängen der Nazizeit spielen, anstatt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Anders aber als in Fassbaenders Frankfurter Regie-Coup erhält das Stück dadurch keine zweite Ebene oder gar eine politische Umdeutung. Das hübsch anzusehende Bühnenbild von Gisbert Jäkel zeigt unverfremdet die geschmackvolle Inneneinrichtung eines gehobenen Hotels der 30er Jahre. Wenn nicht beim Fiakerball des zweiten Aktes ein paar dezente Hakenkreuz-Wimpel auf den Tischen stünden und der Offizier Matteo eine Wehrmachts- anstelle einer KuK-Uniform trüge, man hätte die Zeitverschiebung schnell vergessen, so dezent kommt sie daher, so folgenlos bleibt sie aber auch. Ansonsten nämlich sieht man eine typische Laufenberg-Inszenierung: Mit solidem Theaterhandwerk wird geradlinig die Geschichte erzählt. Die Personenregie ist flüssig und unauffällig. Das Lieblingsstilmittel des inszenierenden Intendanten kommt auch zu seinem Recht: Das Erscheinen von Figuren, die eigentlich nicht dran sind, von denen aber gerade die Rede ist. Dieses Mal ist es der Graf Elemer. In der Wiesbadener Ring-Inszenierung wirkte diese Form der Überdeutlichkeit auf die Dauer penetrant. In der Neuproduktion von Strauss‘ letztem großen Publikumserfolg bleibt die Dosis so sparsam, daß sie nicht weiter stört. Der Hang zum Expliziten beschert den Premierenbesuchern außerdem noch die bei Laufenberg ebenfalls unvermeidliche Filmeinspielung. Sie illustriert den Übergang zum letzten Akt und zeigt, was im Libretto von Hugo von Hofmannsthal nur subtil angedeutet wird: Den Liebesakt von Matteo mit Zdenka, die er für Arabella hält. Das hatte bislang noch jeder Opernbesucher auch ohne Bebilderung kapiert.
Die musikalische Bilanz des Abends ist gemischt. Das Orchester spielt unter dem neuen Generalmusikdirektor Patrick Lange eher bayerisch-herzhaft als wienerisch-subtil auf, präsentiert sich aber in ähnlich guter Form wie zuletzt im „Tannhäuser“. Das Klangbild ist ausgewogen und so gut durchhörbar, daß man viele Details der reichen Partitur plastisch wahrnehmen kann. Das Staatsorchester hat unter Lange sehr schnell ein so erfreuliches Niveau stabilisiert, daß einige Unkonzentriertheiten der Oboe am Premierenabend negativ herausstechen.
Bei der Besetzung der Hauptrollen machen die Herren gegenüber den Damen eindeutig den schwächeren Eindruck. Regelrecht fehlbesetzt ist Ryan McKinny als „Mandryka“ mit seinem stumpfen und glanzlosen Bariton. Lange nimmt auf sein begrenztes Volumen anders als bei den weiblichen Protagonisten keine Rücksicht und ertränkt ihn immer wieder schier im Klangrausch. Das ist vielleicht auch besser so. Thomas Blondelle beeindruckt als „Matteo“ erneut mit seinen mimischen Qualitäten, die allerdings wie üblich nicht frei von einer Neigung zum Chargieren sind. Die Mittellage sitzt gut und unterstützt seine plastische Artikulation. Die gefürchteten Spitzentöne der Partie jedoch werden mehr gestemmt als gesungen und fallen aus der Gesangslinie heraus. Das trübt den Gesamteindruck seiner Leistung gerade im Schlußakt erheblich.
Glänzend dagegen bewältigt Katharina Konradi die Partie der „Zdenka“ mit ihrer glockenreinen Stimme. Intonatorisch sicher und vorbildlich artikulierend gebührt ihr die sängerische Krone des Abends. Dabei kann auch Sabina Cvilak in der Titelpartie überzeugen. Das ist eine kleine Überraschung. Nach einer intensiven „Katia Kabanova“, einer leidenschaftlichen „Sieglinde“ und einer selbstbewußten Tannhäuser-Elisabeth hätte man sie eigentlich nicht im Strauss-Diven-Fach verortet. Ihrem Rollendebüt hatte man daher mit einiger Skepsis entgegengesehen. Aber die Cvilak zeigt sich erstaunlich wandlungsfähig, technisch versiert und hochdiszipliniert. Sie hält ihr dramatisches Stimmpotential im Zaum, bemüht sich erfolgreich um leise, mitunter auch fein schwebende Töne und gut gebaute Spannungsbögen. Lediglich einige scharfe Spitzentöne und eine zum Ende hin unterschwellig hervortretende Robustheit verraten, daß die Sängerin hier nicht im angestammten Stimmfach auftritt.
Wenn Koloraturen zu singen sind, kommt in Wiesbaden die quirlige Gloria Rehm zum Einsatz. Bei der „Fiakermilli“ ist sie in ihrem stimmakrobatischen Element. Wolf Matthias Friedrich gibt dieses Mal den Grafen Waldner. Er artikuliert den Text derart prägnant, daß er mitunter in den Sprechgesang verfällt. Romina Boscolo dagegen ist als seine Frau „Adelaide“ mit ihrem guttural verschatteten Alt nicht immer optimal zu verstehen.
Das Publikum applaudiert zufrieden, aber nicht überschwänglich. Ein vereinzelter, unangebrachter Buhruf trifft ausgerechnet den Dirigenten.
Weitere Vorstellungen gibt es am 17., 23. und 29. März, am 1. und 18. April sowie im Rahmen der Maifestspiele am 22. Mai (dann mit Maria Bengtsson in der Titelpartie).
Michael Demel, 14. März 2018
ARABELLA
Premiere am 11. März 2018
Aber der Richtige !

Etwas mehr als drei Jahrzehnte ist es her, dass „Arabella“ von Richard Strauss über die Bühne des Hessischen Staatstheaters ging. Der damalige Intendant und Regisseur dieser Produktion, Christof Groszer, zeigte seinerzeit gut umgesetzte Opernkonvention. Große Spuren zog damals die musikalische Realisierung, denn z.T. unterstützte die Arabella-Sängerin der Uraufführung, Viorica Ursuleac, die Einstudierung. Besonders die damalige Wiesbadener Arabella stimmlich raumgreifende Nadine Secunde profitierte hörbar davon. Neben ihr gab es mit Angela Maria Blasi als Zdenka und Hubert Delamboye als Matteo superb perfekte Traumbesetzungen.

Wer damals, wie ich, den Aufführungen beiwohnen konnte, musste intensiv daran denken. Denn natürlich ist die Neuproduktion durch Uwe Eric Laufenberg deutlich anders gelagert. Er verortet seine Inszenierung in der Entstehungszeit, d.h. also in den 1930er Jahren. Dies ergibt keinerlei Mehrwert an Erkenntnis. Im Grund genommen bietet Laufenberg eben auch nur eine konventionelle Inszenierung, die sich lediglich durch die Zeitverschiebung ein klein wenig „innovativ“ dekorieren möchte. Ein völlig unnötiger Effekt. Konsequenter wäre es gewesen, wenn Laufenberg in seiner Inszenierung die Zeitvorgabe der Handlung respektiert hätte. Sein Bühnenbildner Gisbert Jäkel baute dazu eine eher kühl anmutendes Bühnenambiente. Antje Sternberg entwarf die zeitgemäßen Kostüme. Ja, ja, d.h. natürlich auch Nazi-Soldaten-Kostüme. Sonst würde der Zuschauer ja kaum erkennen, dass er „Regie-Theater“ erlebt. Elemer wird hier zum Ober-Nazi und darf mit seinen Schergen Arabellas „Mein Herr Elemer“ dekorieren.

Komödie à la Laufenberg! Folglich spielt der 2. Akt in einer Art Berliner Nachtclub der 1930er Jahre. So., so…...Immerhin die so wichtige Treppe im 3. Akt gibt es, hier parallel zum Bühnenportal gebaut und nicht, wie sonst so oft, frontal. Mandryka trank jedoch viel zu früh das Wasser aus, so als habe er Durst. Dabei ist gerade dieser Effekt exakt musikalisch festgelegt, inkl. dem Zerschlagen des Glases. Der einzige ungewöhnliche Moment dieser sonst so faden Inszenierung ergibt sich zu Beginn des 3. Aktes. Hier sieht der Zuschauer einen Film, der zeigt, wie aus Zdenko Zdenka wird und diese dann Matteo im Bett erwartet. Hier wird dann heftig kopuliert, doch dann, wird diese Idee zur „Geschichtsstunde“ und wir erleben im weiteren Film die Weltwirtschaftskrise und die Machtergreifung Hitlers. Weniger wäre mehr gewesen.

Strauss wählte für seine Oper den Untertitel „Lyrische Komödie“. In seiner letzten Arbeit mit seinem genialen Libretisten Hugo von Hofmannstal schuf er ein Werk zum genauen Hinhören. Denn es ist eine eher leise Komödie voller Doppelzüngigkeit und Ironie. Es ist nicht wirklich eine Publikumsoper. Dazu sind die Effekte zu subtil und hintergründig. Und das zeigte auch der für eine Premiere sehr mäßige Besuch und die deutlichen Abgänge in der Pause.
Regisseur Laufenberg erzählt die Geschichte zwar schlüssig konform zur Vorlage. Dabei wirkt seine Lesart ernst und nicht wirklich komödiantisch. Schwach ausgeprägt ist jedoch die Charakterisierung der einzelnen Figuren. Oft schleppte sich der Abend sedierend dahin und die Protagonisten agierten zuweilen hilflos. Und von Mandryka ging so gar keine besondere Wirkung aus. Er könnte ebenso auch ein Oberkellner oder Bankbeamter sein.

Was besonders irritierte und bedenklich stimmte ist die durchgehende Oberflächlichkeit, mit der dieses Meisterwerk einstudiert wurde. Kein Sänger, bis auf Matteo und Waldner, zeigte eine deutliche am Text orientierte Rollengestaltung. Das kunstvolle Libretto von Hofmannstal wurde lediglich durchbuchstabiert. Darunter litten vor allem die Dialoge zwischen Mandryka und Waldner oder auch zwischen Arabella und Mandryka. Gerade bei einem Regisseur, der vom Schauspiel kommt, möchte ich eine Affinität zum Wort unterstellen. Hier war nichts davon zu merken! Die vielerlei Preziosen, wie „darf ich annehmen, dass da eine Absicht im Spiele war“ oder „so schüchtern war der Onkel nicht“, „sie wollen mich heiraten, sagt mein Vater“ und und…..alles verschenkt. Und GMD Patrick Lange scheint das offenkundig auch nicht gestört zu haben. Durch diese vielen fehlenden „Farbtupfer“ textlicher Art hing der Abend schnell durch.

Als Arabella war mit Sabina Cvilak eine für diese Rolle eher untypische Sopranistin besetzt. Die großen erfolgreichen Interpretinnen der Vergangenheit (Ursuleac, della Casa, te Kanawa) und der Gegenwart (Fleming, Harteros, Nylund) lassen sofort eine besondere Aura entstehen, durch einen meistens üppig und immer wohl tönenden Höhenstrahl. Das kann Sabina Cvilak nicht leisten.
Cvilaks Stimme fehlt aber gerade in der Höhe eben jene Weichheit und aufblühender Glanz. Statt dessen klingen die großen Bögen nach harter Arbeit, wobei die hohen Töne, vor allem im großen Duett des 2. Aktes nur markiert wurden, dann z.T. wegbrachen („….auf dem die Sonne blitzt“) und reichlich säuerlich gerieten. Dies ist umso mehr bedauerlich, da die Stimme in der Mittellage, wenn sie nicht forciert eingesetzt wurde, angenehm und sonor klang. Auch artikulierte sie im Laufe des Abends den Text znehmend undeutlich, was durch Vokalverfärbungen noch verstärkt wurde.

Katharina Konradi als Zdenka lief ihr hingegen da mit leichter silbriger Tongebung und wunderbar aufblühender Höhe völlig den Rang ab. Sehr sicher in den schwierigen Intervallen und klar in der Intonation wurde sie zurecht am meisten gefeiert. Einzig die eher gleichförmig klingende Textgestaltung könnte verbessert werden. Romina Boscolo war eine szenisch präsente, resolute Adelaide, von der ich gerne mehr Text verstanden hätte. Gloria Rehm als hinreißende Fiakermilli jodelte sich quirlig und staunenswert perfekt durch ihre halsbrecherichen Koloraturen. Schnell wurde sie zum Mittelpunkt, wann immer sie auf der Bühne agierte. Ein besonderes Erlebnis! Sehr brav geriet die Kartenaufschlägerin in der Gestaltung von Maria Rebekka Stöhr.
Der Mandryka einst eine Paraderolle für ein inzwischen verwaistes Stimmfach, dem sog. Kavaliersbariton, gilt unter Baritonen als gefürchtet. Die Partie ist umfangreich und verläuft über einen weiten Tonumfang. Immer wieder sind exponierte Höhen gefordert. Als Gast in Wiesbaden war Ryan McKinny zu erleben. Sein Bariton besitzt ein markantes, dunkles und kerniges Timbre. Stimmtechnisch bewältigte er diese Partie ordentlich und wurde auch den fordernden Schlussausbrüchen weithin gerecht. Allerdings erklangen die Höhen oft stumpf und z.T. mühsam erreicht. Auch war die stimmliche Durchschlagskraft eher begrenzt. Als Charakter blieb er hingegen äußerst blaß. Als Figur wirkte er im 1. Akt wie Prof. Higgins aus „My fair Lady! Weder durch Kleidung oder Gestus war die besondere Ausstrahlung, welche Arabella so fesselt, spürbar. Warum also das ganze Theater um ihn? Und leider erschließt sich ihm nicht der Text. Sehr bedauerlich. Denn er agierte sehr textverständlich, aber es klang sprachlich alles gleich. Mit einer wissenden Textgestaltung und mit viel mehr Mut zur erlebten Empfindung, könnte aus ihm ein guter Interpret für diese so schwer zu besetzende Partie werden.

Ambivalent die Leistung auch von Thomas Blondelle als Matteo. Natürlich hat dieser so kluge Gestalter viele Farben anzubieten und zeigte eine ausgezeichnete Charakterisierung. Jedoch glich der Premierenabend an zu vielen Stellen einem stimmlichen Überlebenskampf. Matteo muss stimmlich immer wieder in knallige Höhen hinauf, um durch das meist laute Orcheser zu kommen. Doch die Höhe ist ein Schwachpunkt bei Blondelle. Schade.
Szenisch kauzig und stimmsicher war Wolf Matthias Friedrich als Waldner zu erleben. Doch auch bei ihm blieb der Text in seiner Bedeutung zu wenig gewürdigt. Gerade Waldner hat doch so viele herrliche Pointen zu setzen. Aus der Reihe der Nebenrollen tönte Aaron Cawley als Graf Elemer, hier ein steifer Nazi-Offizier, hervor. Inzwischen und das war bereits kürzlich auch bei seinem Cassio der Fall, vernachlässigt er zu deutlich die Artikulation. Die kleineren Choraufgaben erfüllte der Chor des Staatstheaters in der Einstudierung von Albert Horne gut.

Bleibt das Hessische Staatsorchester mit seinem GMD Patrick Lange. Lange hat dieses Werk erst kürzlich an der Wiener Staatsoper dirigiert. Die Erfahrung mit diesem Werk ist spürbar. Lange wählte ausgewogene Tempi. Sehr durchhörbar und auf Transparenz war sein Dirigat ausgelegt. Lange hat das Orchester hörbar gut vorbereitet, wovon insbesondere die Streicher profitierten, die mit blühendem, warmen Ton für sich einnahmen.
Die viel geforderten Bläser zeigten sich konditionsstark und kamen gut durch das heikle blechintensive Vorspiel zum 3. Akt. Ein besonderes Lob an den viel beschäftigten Mann an der Pauke, Axel Weilerscheidt. Dieser durfte auch die von Strauss nachkomponierten Schlagzeugeffekte in Personalunion spielen, dies bedeutete drei Schlaginstrumente (Tamburin, Becken und große Trommel) gleichzeitig! Präzise auf den Punkt. Chapeau!
Ausgerechnet Lange und sein Orchester galten vernehmliche Buhs. Nicht verständlich und nicht gerechtfertigt.
Viel Applaus, jedoch kein Enthusiasmus, kein Widerspruch für die brave Regie.
Eben keine Publikumsoper.
Bilder (c) Monika und Karl Forster
Dirk Schauß 12.3.2018
JEPHTHA
Bericht von der Premiere am 04. Februar 2018
Statische Bebilderung mit magischem Ende
Am Ende schieben sich Gazevorhänge langsam aus dem Schnürboden vor die Kulisse, so daß die Bühne wie in dichtem Nebel zu versinken scheint. Die Schrift der Übertitel verlischt allmählich, das Orchester legt fahle Farben auf, der Klang wird leiser, dünner, scheint zu ersticken, bis er ganz erstirbt. In diesem Moment verharrt das Orchester und mit ihm das Publikum eine beklommene Ewigkeit lang. Niemand wagt es zu husten, kein unpassendes Klatschen zerstört diesen Moment magischer, unmittelbar erlebter Trostlosigkeit. Dann aber markiert ein Blackout das definitive Ende, und es bricht sich großer, ungeteilter Jubel Bahn. Es ist dieses Ende, welches den Eindruck des gesamten Abends dreht.
Was zuvor zu sehen war, entspricht in etwa dem, was man bei einer Inszenierung von Achim Freyer erwarten konnte. Der Theaterveteran, inzwischen jugendliche 83 Jahre alt, setzt in seinen Produktionen ganz auf die Kraft der ebenfalls von ihm gestalteten Ausstattung. Bühnenbilder und Kostüme zeigen wild und scheinbar willkürlich verteilte breite Farbstriche und Kleckse. Die Kostüme erinnern in den Formen an traditionelle südostasiatische Gewänder. Die Farbsprache ist dieses Mal klar und konzentriert: Auf weißem Grund gibt es schwarze und rote Aufträge. Das macht optisch, wie stets bei Freyer, einiges her.

Die wenigen Protagonisten und der stark geforderte Chor werden in diesem Kunstwerk abgestellt und agieren nur sehr sparsam mit genau abgezirkelten Gesten und Bewegungen. Diese Regie-Manier scheint gerade für eine Bebilderung eines Oratoriums adäquat zu sein und liegt durchaus im Trend der vergangenen Jahre. Peter Sellars etwa hat in der Berliner Philharmonie die großen Passionen von Johann Sebastian Bach szenisch eingerichtet und das Ganze eine „Ritualisierung“ genannt. Dieser Begriff trifft auch auf das zu, was nun in Wiesbaden bei Händel zu sehen ist. Zur Ouvertüre erscheinen die drei männlichen Hauptfiguren und stellen sich wie Säulenheilige einer nach dem anderen auf Podeste. Es sind janusköpfige Gestalten, denn zu den überdeutlich maskenhaft geschminkten Gesichtern sind an ihrem Hinterkopf jeweils ebenso gestaltete Masken angebracht. Mit Stäben vollführen sie zu ihren dann folgenden Auftrittsarien langsame, geheimnisvolle Bewegungen. Wo allerdings die „Ritualisierung“ bei Peter Sellars der Verdeutlichung dient, führt sie bei Freyer zur Verrätselung. Immerhin bekommt man den passenden Eindruck, daß hier Archaisches freigelegt werden soll. Schließlich geht es um nichts anderes als um ein Menschenopfer. Das Libretto von Thomas Morell nimmt die biblische Geschichte des israelitischen Heerführers Jephtha auf, der seinem Gott gelobt, im Falle eines militärischen Sieges das erste Wesen zu opfern, welches ihm nach erfolgreicher Schlacht begegnet. Es wird seine einzige Tochter sein. Das Motiv ist auch aus der griechischen Mythologie bekannt. Im Alten Testament ist es jedoch ein blutrünstiger Skandal, denn eigentlich hatte JAHWE nach der in letzter Sekunde abgewendeten Schlachtung des Isaak durch seinen Vater Abraham die Menschenopfer abgeschafft. Christliche Theologen haben sich daher mit dieser Bibelstelle immer sehr schwergetan. Händels Librettist löst das Problem zeittypisch, indem er durch das Eingreifen von Engeln entgegen der biblischen Tradition das Menschenopfer abwendet und das Oratorium zum beruhigenden lieto fine führt. Die Weisheit, mit der ein gerechter Gott die Welt gefügt hat, wird zuvor ausführlich gepriesen: „Whatever is, is right.“

Der Clou der neuen Wiesbadener Produktion besteht nun darin, dieses beruhigende Ende zu verweigern. Die Rettung bleibt aus. Das Ritual wird vollzogen. Dabei sieht man keine blutrünstige Schlachtung. Jephthas Tochter entschwebt vielmehr sanft ins Jenseits. Geopfert wurde sie gleichwohl. Und so wirkt der Gott, der ein solches Opfer akzeptiert, kalt und unbarmherzig. Die Welt, die er gefügt hat, wird von der Ritualisierung im Handeln der ihm unterworfenen Menschen erstickt. Daß diese Rituale in ihrer hilflosen Absurdität sogar komisch wirken können, hat Freyer im ersten Teil vor der Pause herausgearbeitet. Er kontrastiert dabei die lebhaften Koloraturausschweifungen des Komponisten mit zeitlupenhaften Bewegungen. Dabei stellen sich jedoch auch Längen ein. Der zweite Teil nach der Pause wirkt konzentrierter, wohl auch wegen beherzter Kürzungen, bevor er in den eindringlich-trostlosen Schluß mündet.
Die musikalische Seite gibt sich gediegen. Konrad Junghänel präsentiert mit dem gut aufgelegten Staatsorchester in adäquater Kammerbesetzung ein historisch informiertes Klangbild. Die Streicher spielen vibratolos, und auch die stark geforderten Holzbläser sind um einen prägnanten, unsentimentalen Ton bemüht. Diese Spielweise hat Junghänel dem Orchester in zahlreichen Mozart-Produktionen erfolgreich antrainiert, so daß die Musiker souverän einen klaren Barocksound ertönen lassen, wie man ihn sonst von Spezialensembles kennt. Allerdings hätte man sich eine größere Lockerheit und Ausdifferenzierung gewünscht. Der Klang bleibt gerade im ersten Teil über weite Strecken monochrom.
Der von Albert Horn gut vorbereitete Opernchor kann nicht verbergen, daß er eben das ist: ein Opernchor. Da wabert das Vibrato in zu großer Dosis. Die damit erzielte wohlklingende Fülle läßt letzte Wünsche an Transparenz offen. Zu Karl Richters Zeiten hätte man das wohl goutiert. Dem heutigen Standard an schlanker Stimmführung bei barocker Chormusik entspricht es nicht mehr.

Die Vokalsolisten kommen unterschiedlich gut damit zurecht, daß Junghändel sie ihre Koloraturen in mitunter zackigen Tempi bewältigen läßt. Tadellos gelingt das Terry Wey als „Hamor“ mit seinem saftigen Countertenor, weniger gut Wolf Matthias Friedrich als „Zebul“, der mit seinem kernigen Bariton die eine oder andere Phrase mehr markieren als aussingen muß. Ein solches Durchmogeln durch die Koloraturen ist zunächst auch bei Mirko Roschkowski in der Titelpartie bei seiner Auftrittsarie zu bemerken. Das mag aber der Premierennervosität geschuldet sein, denn im weiteren Verlauf zeigt er mit seinem schlankem, gut geführten Tenor ein musikalisch differenziertes und technisch unangreifbares Rollenporträt. Eine guten Eindruck macht auch der bronzen getönte und gut geführte Mezzosopran von Anna Alàs i Jové in der Rolle von Jephthas Frau „Storgè“. Als zu opfernde Tochter „Iphis“ erscheint das Ensemblemitglied Gloria Rehm nicht optimal besetzt. Mit ihrem soubrettigen Sopran sucht sie lange nach dem richtigen Ton. Überzeugend wirkt sie erst im zweiten Teil, wenn sie das schicksalsergebene Opfer mit mädchenhafter Schlichtheit anrührend zeichnet.

Das Publikum zeigte sich über weite Strecken sehr zurückhaltend, spendete selten und dann eher schütter Szenenapplaus. In den Pausengesprächen war eine gewisse Ratlosigkeit über die Absichten des Regisseurs allenthalben zu vernehmen. Der dichte zweite Teil jedoch und der beeindruckende Schluß sorgten dafür, daß am Ende dem gesamten Team ungeteilter Jubel entgegengebracht wurde.
Weitere Vorstellungen gibt es am 10., 13., 16. und 22. Februar, am 8. März sowie am 4. und 15. April.
Michael Demel, 07. Februar 2018
Bilder: Monika und Karl Forster
TANNHÄUSER zum Ersten
Bericht von der Premiere am 19. November 2017
Unspektakuläre Inszenierung mit musikalischen Glanzlichtern
Sind das tatsächlich Kastagnetten? Der Premierenbesucher reibt sich die Ohren. Er war ein wenig abgelenkt von dem Videofilm, der die Ouvertüre bebildert, aber jetzt wird er hellhörig. Das ist die „Pariser Fassung“! Schon sind wir mitten im Bacchanal gelandet. Pilger mit Rucksäcken haben sich gerade eben noch zu den vertrauten Tönen der Ouvertüre auf einer Leinwand einen Film vom segnenden Papst Franziskus auf dem Petersplatz angesehen. Damit steht gleich zu Beginn fest, daß die Handlung in der Gegenwart verortet ist. Wenn das Orchester dann lebhafter wird und die Musik sich von milder Frömmigkeit zu rauschhafter Schwärmerei wandelt, wandelt sich auch der Film. Das ist zunächst recht originell gemacht, indem das Brustkreuz des Papstes herangezoomt, darauf ein Motiv des „Guten Hirten“ mit Schafen sichtbar wird und diese Schafe plötzlich lebendig werden. Dazu entkleiden sich im Kinozuschauerraum die ersten Pilger und animieren andere, es ihnen gleichzutun. Fünf Nackedeis, drei männliche und zwei weibliche, arrangieren die Sitzmöbel um, beginnen, aneinander herumzufummeln, und schon ist man im Venusberg, der ausschaut wie der Konferenzsaal eines in die Jahre gekommenen Hotels.

Tannhäuser (Lance Ryan) langweilt sich im Venusberg
Man ahnt bereits, daß der mit dunklem Holz vertäfelte und mit Hirschgeweihen verzierte Raum dem Zuschauer wohl als Einheitsbühnenbild erhalten bleiben wird. Und richtig: Auch die nachfolgende Szene auf freiem Feld spielt hier, lediglich auf einem Rückprospekt ist ein Wald wie auf einer Phototapete zu sehen. In die Mitte der Bühne aber wurde eine Glasvitrine hereingefahren, in der die Heilige Elisabeth wie Schneewittchen in ihrem Glassarg vor sich hindöst. Am Ende des ersten Aktes, wenn Tannhäuser von Wolfram an Elisabeth als Motivation zur Rückkehr auf die Wartburg erinnert wird, erwacht die so Angesprochene und bäumt sich in ihrer Vitrine auf, was aber der bereits entschwindende Tannhäuser nicht mehr mitbekommt. Bereits mit diesem Aufbäumen zeigt sie mehr Aktivität, als die Sängerin der Venus im gesamten Akt davor. Jordanka Milkova bewältigt die heikle Partie der Liebesgöttin mit gut geführtem Mezzo zwar musikalisch tadellos, bleibt ihr jedoch vokal jede Leidenschaft schuldig, vernuschelt den Text und wirkt darstellerisch wie ein beweglicher Kleiderständer für gehobene Abendgarderobe. Tannhäuser ist offensichtlich aus purer Langeweile aus ihrem Reich entflohen.

Elisabeth (Sabina Cvilak)
Sabina Cvilak dagegen ist als Elisabeth das vokale und darstellerische Ereignis des Abends. Schon ihre Auftrittsarie „Dich, teure Halle, grüß‘ ich wieder“ ist fabelhaft gestaltet und zeigt unmißverständlich, wie individuell sie diese Rolle anlegt. Zu hören ist keine zurückgenommene, keusche Jungfrau, sondern eine selbstbewusste Fürstentochter. Die Cvilak knüpft an ihren starken Auftritt als „Sieglinde“ in der Wiesbadener „Walküre“ an und wirkt als Elisabeth sogar noch überzeugender. Mit ihrem klaren, jugendlich-dramatischen Sopran, gut durchgeformt in allen Lagen, getragen vom Willen und ausgestattet mit der Fähigkeit zur dynamischen und farblichen Differenzierung, ist sie geradezu eine Idealbesetzung.
Derart eingestimmt, erlebt das Publikum den zweiten Aufzug als ein einziges großes musikalisches Fest, das vom inszenierenden Intendanten bloß noch unauffällig arrangiert werden muß. Uwe Eric Laufenberg verzichtet hier völlig auf Regietheatermätzchen. Kostümbildnerin Marianne Glittenberg hat die Festgesellschaft auf der Wartburg in mittelalterlich-schlichte Kostüme gesteckt, die Minnesänger erscheinen im Ordensrittermantel, in denen sie, völlig unironisch, dem Fürsten zu den Klängen des Einzugsmarsches ihre Aufwartung machen. Der Kontrast zur ansonsten vorherrschenden Gegenwartskleidung soll wohl zeigen, daß ein Ritual aufgeführt wird, für das man sich kostümieren muß. Die Gesellschaft nimmt geordnet Platz. Wer gerade mit dem Singen dran ist, erhebt sich und tritt vor die Menge. Einzelnen Sängern gelingt mit wenigen dezenten Blicken und Gesten eine Individualisierung ihrer Figur. Thomas de Vries etwa gibt sich als „Biterolf“ ironisch-abgeklärt und erfreut wie immer mit seinem eleganten Bariton. Aaron Cawley markiert als „Walter von der Vogelweide“ den Heißsporn und versucht, den Sänger der Titelpartie auch als Heldentenor herauszufordern. Young Doo Park läßt als Landgraf seinen schwarzen Baß sonor erklingen und kämpft wie gewohnt ein wenig mit der deutschen Aussprache. Daß die Regie von ihm beim ritualisierten Sängerwettstreit bloß das Ausstrahlen unerschütterlicher Würde verlangt, kommt seiner darstellerischen Grundausstattung zupaß. Sehr überzeugend entwickelt der junge Bariton Benjamin Russell seinen „Wolfram von Eschenbach“ aus den Tugenden eines Liedsängers. Die Stimme ist hell, gut fokussiert und verbreitet ganz ohne Druck und bei klarer Diktion einen balsamischen Wohllaut. Der von Albert Horne präparierte Chor zeigt ein homogenes und fülliges Klangbild.

Chor und Ensemble
Patrick Lange am Pult des gut aufgelegten Orchesters führt sie alle souverän zusammen. Schon die ersten Töne der Ouvertüre waren vielversprechend, die rauschhafte Steigerung hin zum Bacchanal stellte ein Versprechen dar, daß nun im zweiten Akt einlöst wird. Der Klang ist farbig und gut ausdifferenziert. Die Trompeten schmettern präzise ihre Fanfaren in den Saal, die Streicher zeigen eine Homogenität, die man in den vergangenen Spielzeiten in Wiesbaden gelegentlich vermißt hatte, die Holzbläser überzeugen sowohl mit ihren Soli als auch mit den gut ausgehorchten Einsätzen im Tutti. Bei aller Fülle besitzt das Klangbild immer eine gute Durchhörbarkeit. Kurz: Es ist eine Freude, dem Orchester zuzuhören, mehr noch, das Klanggeschehen im Orchestergraben wird derart spannend dargeboten, daß man regelrecht dankbar ist, nach der Bilderflut zur Ouvertüre in den folgenden drei Akten von optischer Reizüberflutung verschont zu werden. Patrick Langes Einstand als neuer Generalmusikdirektor ist mit dem Tannhäuser fulminant gelungen. Man sieht ihn im Orchestergraben nicht nur dirigieren, sondern immer wieder mit einzelnen Orchestergruppen regelrecht flirten. Da haben sich zwei gefunden.
Dieser zweite Akt ist musikalisch derart überzeugend, daß man sogar bereit ist, über die stimmlichen Defizite des Hauptdarstellers hinwegzuhören. Wer Lance Ryan noch aus dem Frankfurter Tannhäuser vor wenigen Jahren in Erinnerung hatte, der ahnte für die Wiesbadener Premiere nichts Gutes. Die Charakteristika seiner Stimme – ein halsiger, kopfig-krähender Ansatz ohne Körperverankerung bei häßlicher Vokalverfärbung – machten seinerzeit das Zuhören zur Strapaze. Daher ist man nun zunächst angenehm überrascht, daß der Sänger hörbar an seiner Technik und auch am Rollenverständnis gearbeitet hat. Zu Beginn des ersten Aktes ist das Bemühen um besseren Stimmsitz, frei schwingende Höhen und dynamische Differenzierung erkennbar. Leider verflüchtigt sich dieser Eindruck bereits mit dem Austritt aus dem Venusberg: mehr und mehr werden hohe Töne wieder gestemmt und zerschneiden steif und scharf die Gesangslinie. Das setzt sich leider im zweiten Aufzug so fort. Leise und zurückgenommene Passagen gelingen kaum noch, wirken erschreckend brüchig, und obendrein leidet dann auch noch zunehmend die Intonation. In der Romerzählung des dritten Aktes versucht Ryan dann wieder, an die passable Leistung des Beginns anzuknüpfen, was ihm leidlich gelingt. Er rettet so den Gesamteindruck und bekommt zum Schlußapplaus überwiegend Zustimmung vom Publikum.

In diesem Schlußakt ist der Regisseur wieder etwas plakativer geworden. Bühnenbildner Rolf Glittenberg hat ein großes, weißes Kreuz in das Einheitsbühnenbild gelegt, vor dem Elisabeth beten und Tannhäuser sich am Ende gequält räkeln darf. Immerhin weiß man jetzt auch, woran die Heilige Elisabeth gestorben ist: Bei Laufenberg muß sie, nur mit einem dünnen Leibchen bekleidet, im Schnee auf ihren Heinrich warten und hat sich dabei wohl den Tod geholt.
Das Angenehme an Laufenbergs neuer Regiearbeit ist: Sie bietet keine „Deutung“, sondern eine Inszenierung, ein In-Szene-Setzen des Textbuches. Die historische Verortung spielt dabei keine entscheidende Rolle. Das ambitioniertere Feuilleton wird sich daran die Zähne ausbeißen. Es ist nichts „brennend aktuell“, es gibt keine „ungeahnten Blickwinkel“, man „lernt“ nichts, weder über die Gegenwart, noch über das Mittelalter, noch über Wagners 19. Jahrhundert, es wird nicht „aus der Perspektive von“ Wem-auch-immer erzählt. Es gibt bloß einen unverstellten Blick auf das Stück. Daß immer dann, wenn von der Liebesgöttin die Rede ist, die Nackten vom Venusberg aus den Kulissen springen, ist nicht provokativ, sondern im Gegenteil regelrecht werkadäquat. Laufenberg läßt sie im Programmzettel als „Grazien“ ausweisen und nimmt damit ausdrücklich auf Wagners Regieanweisung zum ersten Akt Bezug. Diese Inszenierung tut Wagner keine Gewalt an. Das Publikum scheint das ähnlich zu sehen, denn es spendet dem Produktionsteam freundlichen Schlußbeifall. Regelrecht gefeiert werden dagegen die Musiker. Besonders starken Applaus erhalten Benjamin Russell für seinen frischen Wolfram und Patrick Lange für seinen fulminanten Einstand als Generalmusikdirektor.
Bilder (c) Monika und Karl Forster
Michael Demel, 20. November 2017
---
Weitere Vorstellungen gibt es am 24. November, am 3. und 17. Dezember, 10. und 28. Januar, 30. März, 27. Mai sowie am 30. Juni.
TANNHÄUSER zum Zweiten
Premiere am 19. November 2017

Der „Tannhäuser“ beehrte das Hessische Staatstheater immer wieder in den letzten Jahrzehnten, dabei in sehr unterschiedlichen Deutungen. Anfang der 1980ziger Jahre inszenierte Intendant Christoph Groszer im Stile Wolfgang Wagners recht brav mit gigantischer „Liebesmuschel“, gefolgt von Dominik Neuner, der sich 2001 für eine sehr stilisierte Deutung in geometrischer Optik entschied. Wiesbadens aktueller Intendant Uwe Eric Laufenberg ging nun mit einer weiteren Eigeninszenierung an den Start, diesmal sekundiert von Rolf Glittenberg (Bühne) und dessen Frau Marianne (Kostüme). Hier ist vor allem die vorzügliche Akustik der Raumgestaltung zu loben. Sie ermöglicht, dass die Sänger in jeder Position bestens zu hören sind.
Nach seiner schwachen Ring-Inszenierung zeigte Laufenberg in seiner Inszenierung mehr Phantasie. Der Zuschauer kann sich an schönen Bühnenraumgestaltungen erfreuen, in welche diesmal (im Vergleich zur Ring-Inszenierung) der Hintergrund für Videoeinblendungen (Videos: Gérard Naziri), u.a. Naturstimmungen, gelungen genutzt wird. Lediglich in den ersten 20 Minuten nervt die Dauer-Videoberieselung, zumal diese die schwache Venusberggestaltung nicht überdecken kann. Tannhäuser ist bei Laufenberg der schwarz gekleidete Künstler, der zwischen den beiden Welten Wartburg/Hörselberg hin- und hergerissen ist. Im ersten Aufzug gibt es viel nackte Haut der viel beschäftigten Statisterie zu erleben.

Der Vorhang öffnet sich zum Pilgermotiv der Ouvertüre. Wir sehen die Pilger, die sich eine Videoübertragung mit Papst Franziskus ansehen. Unter ihnen Tannhäuser, dem das derart zusetzt. dass er eine Sauerstoffmaske benötigt. Doch was ist das? Einige Männer entkleiden sich, tanzen und springen um die Pilger herum. Küsse werden ausgetauscht...Die Pilger ergreifen die Flucht. Wir sind im Venusberg. Geraune im konservativen Wiesbadener Publikum. Sie sind völlig nackt! Männer und Frauen tanzen auf und um vielerlei Sofamöbel herum, welche sie immer wieder neu positionieren. Allerdings kaschiert das ständige Verrücken der Möbel nicht den szenischen Leerlauf, der hier überdeckt werden soll. Dazwischen Venus Champagner schlürfend. Das soll also die große andere Welt der Verführung sein? Nackerte und ein wenig Champagner? Schnell langweilt das Szenische, da Nacktheit allein eine kaum aussagestarke Personenführung zwischen Venus und Tannhäuser kaschieren kann. Da können noch so viele Videofilme den Zuschauer überfrachten. Es findet keine wirkliche Interaktion statt. Beim Szenenwechsel zeigt sich eine Waldlandschaft am Horizont, die linke Bühnenseite ist überreich mit Geweihen behängt. Ja, ja, die Jäger kommen! Doch halt, zu erst sind die Pilger an der Reihe, die, sauber und modern eingekleidet, an einem Glaskasten Halt machen. Darin ein blondes Schneewittchen…., doch nein, es ist Jungfrau Maria. Vor ihrem Glasgrab legen die Pilger Blumengebinde ab. Als am Ende des ersten Aufzuges Tannhäuser „zu ihr zu ihr“ singt, wacht die vermeintlich Leblose auf und wir erkennen, es ist Elisabeth! Von den Toten auferstanden…..Vorhang!

Im zweiten Aufzug bei ähnlich geschlossenem Bühnenraum mit überlangen Sofas nun also der sog. „Sängerkrieg“. Hier gelingen Laufenberg spannungsreiche Szenen. Elisabeth wirkt zunächst vergrämt in ihrem schwarzen Trauerornat. Wie schnell blüht sie auf, als Tannhäuser wieder da ist. Das ist bewegend und schlüssig in den Szenen entwickelt. Die Chorszenen und der Sängerkrieg sind gut choreographiert, so dass die Inszenierung hier erkennbar an Fahrt gewinnt. Allein den einzelnen Beiträgen der Sänger-Wettstreiter fehlt der szenische Biss, das wirkte dann doch wieder recht brav. Und dann sind sie wieder da! Die Nackten! Beim Sängerwettstreit! Skandal und Elisabeth kann bei so viel nacktem Fleisch nun nur noch eines tun: Beten!
Der dritte Aufzug schließlich zeigt eine Schneelandschaft mit kleinem Campingzelt und übergroßem liegendem Kreuz auf der Bühne. Hier gelingen Laufenberg anrührende und z.T. poetisch anmutende Bildwirkungen. Elisabeth verharrt reglos in der Schneelandschaft, während Wolfram im kleinen Zelt die Nachtwache hält. Die Pilger kehren heim, immer noch neu eingekleidet wirkend. Na ja, offenkundig war die Pilgerreise nach Rom nicht erkennbar anstrengend. Nach ihrem Gebet entledigt sich Elisabeth aller irdischer Zier, sie legt alle Kleider ab und schreitet völlig nackt durch den Schnee in die Nacht. Der gebrochen wirkende Tannhäuser lebt seine Romerzählung, z.T. rücklings liegend auf dem Kreuz aus. Venus betritt letztmalig mit ihrem nun bekleideten und ermüdetem Gefolge die Bühne. Dieser letzte Auftritt wirkt hier lediglich wie eine Pflichtübung. Keine wirkliche Gefahr für Tannhäuser! Am Ende schreitet auch er von der Bühne, während sich am Bühnenhorizont eine angedeutete Lichtpyramide eröffnet. Ein starkes Bild.

Spannend war diesmal die musikalische Seite. Sabine Cvilak als Elisabeth, vielbeschäftigte Sopranistin in Wiesbaden (sie wird noch Arabella und Katja Kabanowa singen), war eine sängerisch und darstellerisch überzeugende Gestalterin. Stimmlich war sie gegenüber ihr sehr grenzwertigen Sieglinde kaum wiederzuerkennen. Die Mittellage erklang warm und wohltönend. Die Höhe blieb diesmal im Körper verankert, spreizte sich nicht und war auch hier angenehm zu vernehmen. Ihre totale Identifikation mit der Rolle war jederzeit spürbar. Jordanka Milkova als Venus konnte weder szenisch noch stimmlich die notwendige Sinnlichkeit transportieren. Die junge, attraktive Sängerin verfügt über eine schöne Stimme, die jedoch recht eindimensional eingesetzt wurde. Gestalterisch war sie nicht in der Lage, zu differenzieren. Zu vieles klang pauschal und gedanklich nicht durchdrungen. Hinzu kamen Intonationstrübungen in der hohen Lage. Hier musste Milkova vor den hohen Tönen nach-atmen, um die notwendige Kraft bereitzustellen. Ab der Mittellage aufwärts war die Textverständlichkeit unzureichend. Eine nur tonale Bewältigung einer Partie formt keinen Charakter….

Ein schön gesungener Wolfram holt sich zumeist den größten Erfolg beim Publikum. So auch geschehen auch in Wiesbaden. Als Wolfram gab Benjamin Russell einen heftig bejubelten Partner an der Seite von Tannhäuser. Sängerisch betonte er mit seinem sehr hellen Bariton das Lyrische seiner Rolle, konnte aber auch den dramatischeren Anforderungen im dritten Aufzug genügen. Vorzüglich die Textverständlichkeit und die Linienführung seiner Phrasierung. Mit einer ähnlich hellen Baritonstimme war vor vielen Jahren Robert Dean Smith in Wiesbaden engagiert und wechselte dann später zum Tenor. Vielleicht geht Russell in der Zukunft einen ähnlichen Weg.
Young Doo Park war ein stimmlich vorzüglicher Landgraf, dessen herrlich timbrierter Bass in dieser Partie bestens zur Geltung kam. Unter den Minnesängern ragte der großartige Thomas de Vries als Biterolf heraus. Auch hier zeigte er, wie überzeugend charakteristisch er gestalten kann. Aron Crawley war ein heldisch auftrumpfender Walter, der jedoch zu nachlässig artikulierte. Verlässlich in den Ensembles sangen Joel Scott als Heinrich und Alexander Knight als Reinmar. Stella An war ein stimmfrischer Hirt.

Und Tannhäuser? Seine Leistung war für mich die große positive Überraschung des Abends! Mit Lance Ryan war ein sehr erfahrener Wagner-Tenor zu hören, der mit den fordernden stimmlichen Anforderungen keinerlei hörbare Probleme hatte. Natürlich sind seiner Stimme die vielen Wagner-Abende anzuhören. Sein Vibrato ist mitunter unstet oder kaum vorhanden. Viele Haltetöne geraten steif und manche Vokalverfärbung trübt den Höreindruck, Auch brach die Stimme im Piano. Aber der Tannhäuser benötigt gerade auch solche Farben! Sein von jeher polarisierendes Timbre kann Ryan überzeugen nutzen, um hier jedoch den Außenseiter erlebbar machen. So erinnerten manche kopfigen Pianofärbungen an seinen hiesigen sehr überzeugenden Peter Grimes. In seinem Ausdrucksspektrum zeigte er sehr viele Facetten, die bei seinen Wagner-Heroen so bisher nicht zu hören waren. Verblüffend großzügig geriet seine Phrasierung. So war Ryan in der Lage große Bögen mit endlos erscheinendem Atem zu singen. Gerade der Tannhäuser benötigt eine dramatische Deklamation, eine wissende Textgestaltung. Viele Nuancen sind notwendig, um die unendlichen Farbanforderungen von Flehen über Ironie bis zum Sarkasmus abzubilden. Davon brachte Ryan sehr viel in seine Interpretation ein. So konnten sich die Zuhörer natürlich dann auch über seine packende Romerzählung freuen. Einzig sein „Da ekelte mich der holde Sang“ wirkte zu angenehm im Klang, hier braucht es viel mehr Expressivität!

Albert Horne hat seine Chöre für die sehr schwierigen Anforderungen bestens vorbereitet. Sowohl in Ausdruck, als auch in der darstellerischen Beweglichkeit, waren Chor und Extra-Chor des Staatstheaters einmal mehr ausgezeichnet. Gelegentliche Intonationstrübungen bei den Pilgergesängen störten nicht maßgeblich.
Als neuer GMD stellte sich Patrick Lange vor. Erkennbar gut war das Hessische Staatsorchester präpariert. Lange bevorzugte sehr flotte Tempi und wahrte den gesamten Abend ausgezeichnet die Balance in den einzelnen Instrumentalgruppen. Manches geriet dann aber auch zu schnell wie etwa das Vorspiel zum 3. Aufzug oder Elisabeths Gebet „Allmächtge Jungfrau“. Hier wäre mehr Mut für kontemplative Momente wünschenswert. Sein Orchester musizierte transparent und farbenfroh. Wunderschön erklangen die Holzbläser gerade im 3. Aufzug und das viel geforderte Blech musizierte schlank und kultiviert. Interpretatorisch vermeidet Lange alles Lärmende. Wenn gefordert, so konnte er aber auch wunderbar üppig ausmusizieren. So geriet das Bacchanale in seiner Orgiastik mitreißend und der Chor der Gäste mit den außerordentlich schneidig aufspielenden Fanfaren erklang geradezu überrumpelnd in seiner Klangpracht. Im Bacchanale hatte dann auch das Schlagzeug in der Proszeniumloge seine besonderen Momente mit spielfreudiger Verve und Genauigkeit.

Großer Premierenjubel für alle. Kein Widerspruch!
---
Bilder (c) Monika und Karl Forster
Dirk Schauß 21.11.2017
Jules Massenet
MANON
Bericht von der Aufführung am 5. November 2017
(Premiere am 28. Oktober 2017)
Musikalisch beeindruckend, szenisch unverkrampft
In der Pause raunt der ältere Herr seinem jüngeren Begleiter zu, daß er die „Manon“ von Puccini bevorzuge. In der Version von Massenet fehle ihm das Italienische, das Süffige. Wir dagegen sind dem Staatstheater Wiesbaden dankbar dafür, daß es statt eines mittelmäßigen frühen Puccini einen reifen, ausdifferenzierten Massenet präsentiert. Zu erleben ist ein Abend, der musikalisch rund, mitunter sogar regelrecht beglückend ist, und der szenisch eine leicht ironische Distanz zu seinem Sujet hält, die dem Stück gut steht.
Das Orchester präsentiert sich in großer Form. Jochen Rieder als Gastdirigent scheint einen guten Zugang zu den Musikern gefunden und gründlich geprobt zu haben. Das Ergebnis ist ein farbiger, duftiger Klang mit französischem Esprit, der vom ersten Takt an Freude bereitet. Die Freude steigert sich noch beim ersten Auftritt der Hauptfigur: Christina Pasaroiu erweist sich als Idealbesetzung der Manon. Sie gestaltet die Partie sängerisch und schauspielerisch hinreißend. Dabei gelingt es ihr, die Entwicklung der Figur musikalisch restlos überzeugend zu gestalten: Mit mädchenhaft-naivem Ton zu Beginn, schwärmerisch im zweiten Akt und kapriziös im dritten Akt, wo sie souverän mit den Koloraturen der Partie spielt, schließlich abgeklärt am Ende.
Ihr zur Seite steht das Ensemblemitglied Ioan Hotea. Sein wie stets unter emotionalem Hochdruck stehender, draufgängerischer Tenor ist bei der Rolle des „Des Grieux“ viel besser aufgehoben als bei den Mozart-Partien vergangener Spielzeiten. Gelegentlich nimmt er es mit den Tonhöhen nicht so genau, überzeugt aber mit seiner Spielfreude und wagt es auch immer wieder, sich dynamisch zurückzunehmen. Die Stimme steht in vollem Saft. Seine Neigung, im Gefühlsüberschwang an exponierten Stellen einzelne Töne anzuseufzen, muß man wohl als Personalstil hinnehmen. Mit seinem kernigen Bariton kann auch Christopher Bolduc als „Lescaut“ überzeugen. Das Produktionsteam scheint sich über diese Figur ein wenig lustig zu machen, indem es ihn in Skinny-Jeans und auf Plateausohlen als Macho-Karikatur über die Bühne staksen läßt.
Bühnen- und Kostümbildner Friedrich Eggert hat die Szene in die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts verlegt, irgendwo zwischen die 50er und 60er Jahre. Die Farben der Kostüme sind dabei so bunt geraten, daß man sie als „neo-fauvistisch“ bezeichnen muß. Das Bühnenbild verleugnet seine Kulissenhaftigkeit nicht. Von den gezeigten Räumen wird mitunter nur genau der Ausschnitt gezeigt und in den Bühnenraum hereingeschoben, in dem auch Handlung stattfindet. Dabei wird dem Textbuch keine Gewalt angetan: Das Liebesnest im zweiten Aufzug ist stimmig als Dachgeschoßwohnung gezeichnet, der zum Priester geweihte Des Grieux wird im dritten Akt von Manon realistisch in einer Sakristei aufgesucht, der Spielsalon im vierten Akt ist ein Unterwelt-Hinterzimmer. Sehr geschickt und ganz im Sinne der Musik ist der Beginn des dritten Aktes gelöst: Wenn im Orchestergraben barocke Tänze erklingen, zeigt die Bühne barocke Kostüme. Die Musik kostümiert sich und zitiert eine vergangene Epoche, also tut es ihr die Ausstattung gleich.
Bernd Mottl weiß diese Spielwiese mit seiner abwechslungsreichen und lebendigen Regie gut zu nutzen. Seine Personenführung erweist sich als sehr musikalisch, indem sie den Rhythmus der Musik immer wieder regelrecht choreographisch aufnimmt. Aktionen, Gesten und Blicke sind durchweg musikalisch motiviert.
Der von Albert Horne einstudierte Chor gibt wie zuletzt in „Schönerland“ ein musikalisch überzeugendes Bild ab und hat sichtbar Spaß an den ihm von der Regie zugedachten kleinen Massenchoreographien. Zusammen mit den typgerecht aus dem Ensemble besetzten Nebenrollen ergibt sich ein stimmiges, rundes Bild einer sehens- und vor allem hörenswerten Produktion, deren Besuch man vorbehaltlos empfehlen kann.
Weitere Vorstellungen gibt es am 26. November sowie am 10. und 15. Dezember.
Michael Demel, 18. November 2017
Bilder siehe untere Besprechung!
Gehaltvoller Hauptgang mit leichtem Dessert