


www.staatstheater-darmstadt.de
Turandot als Fragment
Premiere: 31.08.2019
besuchte Vorstellung: 06.10.2019
Diffuse Deutung von Puccinis Schwanengesang
Lieber Opernfreund-Freund,
große Aufmerksamkeit ruft derzeit die Turandot-Produktion hervor, die seit ein paar Wochen am Staatstheater Darmstadt zu erleben ist, nicht etwa, weil diese Tatsache an sich so eine Sensation wäre, sondern weil Regisseur Valentin Schwarz 2020 für den nächsten Ring in Bayreuth verantwortlich zeichnen wird. Wie der junge, aus Österreich stammende Regisseur Puccinis Schwanengesang sieht habe ich mir am Wochenende für Sie angesehen.

Ein weiser Entschluss ist es sicherlich, Puccinis Turandot als Fragment zu belassen. Die Beweinung Liús als Schlusspunkt der Oper setzt einen anderen, viel tiefgründigeren Focus auf die Geschichte um die eisumgürtete chinesische Prinzessin, als es das Happyend zuließe. Schließlich hatte auch Puccini selbst mit der Wandlung von der unnahbaren Kaisertochter zur innig liebenden Frau aus Fleisch und Blut so seine Schwierigkeiten. Im März 1924 hatte er die Oper bis zu Liús Tod fertiggestellt, kam aber beim Schlussduett über ein paar Skizzen nicht hinaus, bis er am 29. November desselben Jahres starb. Doch gibt Valentin Schwarz dem Zuschauer wie die titelgebende Prinzessin Rätsel auf mit seiner tiefenpsychlogieschwangeren Deutung, will zu viel und erschließt dem Zuschauer gleichermaßen zu wenig. Prinz Calaf ist bei ihm ein Maler, der zu Beginn der Oper vor einem riesigen, verstörenden Gemälde seines eigenen Innenlebens steht (Bühne: Andrea Cozzi). Liú ist nicht etwa eine Sklavin, der er einmal im Palast zulächelte und die deshalb zur einzigen Stütze seines blinden Vaters wurde, sondern scheint vielmehr seine Freundin zu sein, die hilflos dabei zusehen muss, wie der Künstler im Laufe der Oper im Wahn versinkt und mehr und mehr der Figur Turandot verfällt, die nur in seinem Kopf existiert. Liú kann die Faszination nicht nachvollziehen, erkennt die Gefahr, scheint aber bisweilen seltsam gleichmütig – etwa, wenn sie sich, während Calaf im ersten Akt Turandot anhimmelt und um sie werben will, von Timur – bei Schwarz durchaus sehender und junger Freund und nicht Vater Calafs – befummeln lässt.

Turandot selbst dann erscheint in vor Symbolismen schier überquellender Kulisse, trägt – in Anspielung auf die persische Herkunft des Märchens, das später von Schiller und Gozzi nacherzählt wurde, Pfauenmotive auf dem blütenweißen Kleid mit elend langer Schleppe (herrliche Kostüme von Pascal Seibicke). Teile der Terracotta-Armee bilden die Staffage im zweiten Akt – und bleiben auch nur das, die an sich farbenfrohen, detailreich gezeichneten Kostüme aus den unterschiedlichsten asiatischen Gefilden bleiben im diffusen Licht im Dunkeln und es zeigt sich erst beim Schlussapplaus, wie schön sie sind. Turandot ist in Darmstadt hin und hergerissen und weiß selbst nicht, was sie sein will: männerhassende, verklärte Jungfrauengestalt oder aufreizende, die Männerwelt anheizende Femme fatal in schwarzen Lack-Overknee-Stiefeln, an eine Domina erinnernden Handschuhen und Make-up im Gothic-Stil. Valentin Schwarz verlangt dem Zuschauer ab, dass er sich mit dem Stück auseinandersetzt, dass er sich im Programmheft schlau liest, ehe er die zahlreichen Anspielungen vollends verstehen kann. Das ist gut gemeint und bietet dem versierten Turandot-Kenner sicher einen neuen Blickwinkel auf das Werk. Wer aber Puccinis letzte Oper gar nicht kennt, bleibt beim einen oder anderen Bild recht ratlos zurück. Wenig erhellend ist auch die Personenführung von Schwarz, besonders dann, wenn die Bühne wegen der herabgelassenen Gaze auf gefühlte 50 cm Tiefe zusammenschrumpft und die Inszenierung damit fast zur konzertanten Aufführung macht.

Gesungen wird in Darmstadt teils auf beachtlichem Niveau: Aldo di Toro ist ein von Beginn an glühender Calaf mit metallisch klingender, bombensicherer Höhe, der sich furchtlos und mit schier endlosem Atem in die Spitzentöne schmeißt und sich nicht den ganzen Abend für das Nessun dorma aufspart, das er vergleichsweise unprätentiös darbietet. Die aus Südkorea stammende Soojin Moon hat in der Titelrolle an ein, zwei Stellen mit unsicherer Intonation zu kämpfen. Die verzeihe ich ihr aber gerne, so überwältigend kalt und gleichermaßen leidenschaftlich verkörpert sie die chinesische Prinzessin, die sich selbst in einem der Rätsel als il gelo che da foco (Eis, das dich verbrennt) bezeichnet. Ping , Pang und Pong sind in Darmstadt drei eher traurige Gestalten: vom Regisseur zu Marionetten gemacht, bleiben Julian Orlishausen und David Lee auch gesanglich blass. Einzig der junge Amerikaner Michael Pegher besticht als Pong durch lebendige Rollenzeichnung, fantastische Mimik und klaren, farbenreichen Tenor. Lawrende Jordan ist ein recht altersschwach klingender Altoum, während ich mir auch vom Timur des koreanischen Basses Dong-Won Seo ein wenig mehr klangliche Wucht erhofft hätte. Ensemblemitglied Jana Baumeister hingegen legt die Liú recht kraftvoll an, ist bisweilen fordernd und energisch, dann jedoch wieder zutiefst verletzt, zart und verletzlich. So zeigt die werdende Mutter (ich wünsche schon jetzt alles Gute!) die Figur in zahlreichen, leuchtenden Facetten. Turandot wird auch als Puccinis einzige Choroper bezeichnet, so viel haben die Damen und Herren unter der Leitung von Sören Eckhoff hier zu tun – und sie meistern ihre umfangreiche Aufgabe bravourös. Im Graben schlägt Michael Nündel teils gemäßigte Tempi an und ermöglicht Puccinis Partitur so ihre volle Entfaltung. Der 1. Kapellmeister widmet sich den hymnischen, Pathos verströmenden Passagen ebenso intensiv wie den zarten, von wogenden Melodienbögen durchzogenen Teilen der Partitur und präsentiert eindreiviertel Stunden – die man in Darmstadt merkwürdigerweise vor den 25 Minuten des Rumpfaktes noch für eine Pause unterbricht – Puccini der Extraklasse. Das hört auch das zahlreich erschienene Publikum und bedankt sich bei allen Beteiligten mit begeistertem Applaus.
Ihr Jochen Rüth 08.10.2019
Die Fotos stammen von Nils Heck.
TURANDOT
Premiere 31.8.2019
Von Abspaltungen und Dämonen
VIDEO
Es gibt so viele vernünftige Menschen in diesem Märchen, Liu, Timur, Ping, Pang, Pong, Altoum, alle raten Turandot, es doch zu lassen mit ihren Rätseln und dem Töten der vielen vielen Prinzen, es sind schon 13 im Jahr des Tigers und das ist wirklich anstrengend. Es gibt das Volk in Peking, blutrünstig bis zum Umfallen und opportunistisch wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten. Und es gibt Calaf und Turandot, besessen der Eine und rachsüchtig die Andere, wie es nur ein Mensch sein kann.

Ein Mensch mit unterschiedlichen Facetten, das ist der Gedanke, den Valentin Schwarz zu seiner zweiten Regiearbeit in Darmstadt hat. Der Gedanke ist bestechend, umwerfend, grandios, Turandot als Abspaltung Calafs, eine Ausgeburt seiner Phantasie, sein zweites Ich? Oder eine durch seine Besessenheit gesteigerte Phantasievorstellung, die er sich mit jedem Rätsel immer mehr zu Eigen macht? Letztendlich bringt ihn Lius Tod zur Besinnung. Valentin Schwarz inszeniert gegen das Happy End, aber keinesfalls gegen die Musik.
Giacomo Puccini starb am 29. November 1924, bevor er seine Oper zu Ende komponieren konnte, seine Musik endet mit dem Tod von Liu. „Ich glaube, dass Turandot nie fertig wird. So kann man nicht arbeiten. Wenn das Fieber nachlässt, hört es bald ganz auf, und ohne Fieber gibt es keine künstlerische Produktion, denn die Kunst ist eine Art Krankheit, ein Ausnahmezustand der Seele, Überreizung einer jeden Faser, eines jeden Atoms, und so könnte man weitermachen ad aeternum“ schrieb Puccini an seinen Librettisten Giuseppe Adami am 10. November 1920.

Es fehlte noch das Schlussduett. Erst im September erhielt Puccini einen Text, der ihn zufriedenstellte. Sofort begann er mit den Entwürfen und Randbemerkungen. „Hier muss eine markante, schöne, ungewöhnliche Melodie her“ schrieb er zum Schlussduett, das der Höhepunkt der ganzen Oper werden sollte. Doch diese Melodie kam nie zustande.
Um in der Musik die fernöstliche Welt anklingen zu lassen, suchte Puccini Rat bei seinem Freund Baron Fassini, der sich in der chinesischen Kultur sehr gut auskannte. Später borgte er sich bei ihm auch eine Spieldose, chinesische Melodien wie die Kaiserhymne daraus zitiert Puccini in der Oper. Große und kleine Trommeln, Harfe, Celesta, Becken, Triangel, Tamtam, chinesisches Glockenspiel, Xylophon, Röhrenglocken kommen zum Einsatz. Aber nach Chinakitsch klingt beim Staatsorchester Darmstadt nichts. Dirigent Giuseppe Finzi sagt im Programmheft, dass Puccini mit seiner letzten Oper neue Wege beschreiten und sozusagen das Tor zur Moderne aufstoßen wollte.
 Die Turandot wurde nach Puccinis Tod von Franco Alfano nach den Skizzen und Aufzeichnungen Puccinis vollendet. Toscanini hielt das Finale Alfanos allerdings für zu eigenständig und zu lang und kürzte es um etwa ein Drittel. Tatsächlich hatte Alfano die Anweisung Puccinis, jeden Bombast zu vermeiden, nicht beachtet und einen gewaltigen, pompösen Schluss komponiert. Ein symphonisches Intermezzo, in dem Puccini den Kuss, der Turandot schließlich erweicht, nachzeichnen wollte, komponierte er nicht.
Die Turandot wurde nach Puccinis Tod von Franco Alfano nach den Skizzen und Aufzeichnungen Puccinis vollendet. Toscanini hielt das Finale Alfanos allerdings für zu eigenständig und zu lang und kürzte es um etwa ein Drittel. Tatsächlich hatte Alfano die Anweisung Puccinis, jeden Bombast zu vermeiden, nicht beachtet und einen gewaltigen, pompösen Schluss komponiert. Ein symphonisches Intermezzo, in dem Puccini den Kuss, der Turandot schließlich erweicht, nachzeichnen wollte, komponierte er nicht.
In Darmstadt wird die Fragment-Version der Turandot gezeigt, uraufgeführt unter Toscanini am 25. April 1926 in Mailand. Arturo Toscanini, mit Gespür für dramatische Effekte, dirigierte nur bis zum Puccini-Ende, legte den Taktstock hin und sagte: „Hier endet das Werk des Meisters. Danach starb er.“ Woraufhin ein ergriffenes Schweigen im Raum schwebte, bis eine Stimme aus den Rängen rief: „Viva Puccini!“ und ohrenbetäubender Jubel brach los. Erst ab der zweiten Vorstellung wurde der Schluss in der heute üblichen Form aufgeführt.
Der Musikwissenschaftler Jürgen Maehder entdeckte 1978 das vollständige Finale Alfanos, welches seit 1983 an verschiedenen Opernhäusern in der ganzen Welt aufgeführt wurde, so etwa an der New York City Opera (1983), am Theatro dell`Opera di Roma (1985) und am Opernhaus Bonn (1985), am Staatstheater Saarbrücken (1993), am Landestheater Salzburg (Großes Festspielhaus, 1994) und am Württembergischen Staatstheater Stuttgart (1997).
Mittlerweile existiert auch ein weiterer alternativer Schluss des italienischen Komponisten Luciano Berio aus dem Jahre 2002. Weil in Alfanos Schlussszene der alles verändernde Kuss kaum musikalische Ausgestaltung erfährt (gerade zu diesem entscheidenden Dreh- und Angelpunkt der Handlung existieren keine musikalischen Skizzen Puccinis), machte sich Berio an diese Aufgabe. Außerdem versetzt er dem Schluss ein musikalisches Fragezeichen, stellt das plötzlich eintretende Happy End somit in Frage.

Calaf und Turandot sind allein. Calaf wirft Turandot ihre Grausamkeit vor. Er reißt ihr den Schleier vom Kopf und küsst sie leidenschaftlich. Nun erst bricht ihr Widerstand. Sie erzählt ihm, dass sie ihn vom ersten Augenblick an gefürchtet, aber auch geliebt habe. Nun teilt Calaf ihr seinen Namen mit und begibt sich in ihre Hand. Turandot und Calaf erscheinen vor dem Kaiser Altoum. Turandot verkündet Calafs Namen: „Liebe“. Unter dem Jubel des Volkes sinken sich beide in die Arme und werden glücklich.
Puccini selbst war mit der Dramaturgie des Schlusses äußerst unzufrieden, fand bis zu seinem Tode keine Möglichkeit, ihn geeignet musikalisch zu gestalten, was das Fehlen der Skizzen zum Kuss untermauert.
Was sich dem Komponisten Puccini als Schluss verweigerte, verweigert der Regisseur uns. Es bleibt bei dem durch den Tod beendeten Fragment. Da liegt Liu tot in der Mitte und der Himmel öffnet sich, es regnet. Calaf, abgekühlt?, reingewaschen? bricht über ihr zusammen. Die Liebe geht über Leichen, aber sie siegt? Im Fragment hingegen scheitert sie auf ganzer Linie.
Während Alfanos Schlussmusik schreitet Turandot langsam durch die Reihen des Volkes die Tribüne hinauf. Dort verharrt sie am Ende einsam im Gegenlicht. So wie die Figur in der Collage der Angst, die Calaf zu Beginn gemalt hatte.

Im Bühnenbild, das Andrea Cozzi für diese Turandot geschaffen hat, sitzt das Volk von Peking, im Dämmerlicht zu erahnen, auf einer Tribüne. Etliche Figuren aus der legendären Terracotta-Armee übertragen ihre regungslose Würde auf die Choristen. Es gibt nicht die sonst bei Turandot üblichen öffentlichen Spektakel der Grausamkeiten. Hier werden zwar auch Menschen aufs Rad gebunden und es werden ihnen die Glieder zerschlagen. Aber das ahnt man nur hinter einem Riesenbild, einer Malerei, die Calaf der Selbsttherapie dient und die inneren Dämonen auf die Leinwand bannen soll. Mit der Arbeit an diesem Bild ist der Maler Calaf zu Beginn beschäftigt. Liu und sein Vater Timur versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber hier ringt ganz offensichtlich einer mit sich selbst, mit der dunklen Seite seiner Persönlichkeit. Dadurch wird alles zu einem Alptraum Calafs. Einer, der ihn in seine Phantasien hineinzieht. Und aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Turandot selbst ist eine Dämonin in dieser Phantasie, eine gefährliche Dämonin, wie überhaupt dem Maler sein Werk immer mehr entgleitet.
Überhaupt diese Turandot. Die Kaisertochter ist in dieser Inszenierung Teil des Alptraums, der Phantasie. Als Figur mehr Zombie mit irrem Blick hinter den Wimpern als Frau. Mehr gieriger Vampir als Prinzessin, sie wirft sich auf Calaf, als wolle sie ihm den berühmten Biss in den Hals verpassen, um ihn auszusaugen.
Mit schwarzem Lack und Leder unterm weißen Kleid geistert sie wie eine Magierin zwischen den Reihen herum, besessen davon, alle Männer, die sie begehren, zu vernichten. An den Rätseln sind alle gescheitert, niemand wird sie jemals besitzen. Sie wird recht behalten.

Warum nun kann Calaf diese Rätsel auf Leben und Tod lösen? Turandot ist Teil seiner Persönlichkeit, sie ist in ihm und somit sind auch die Antworten in ihm. Dann ist er es, der das Spiel weitertreibt. Er will sie nicht gegen ihren Willen, er will, dass sie sich ihm unterwirft. Mit seiner Forderung, sie soll ihm bis zum Morgengrauen seinen Namen nennen, beginnt die furchterregende Nacht des „niemand schlafe“, sie befiehlt dem Volk von Peking unter Androhung der Folter und des Todes, seinen Namen herauszufinden. Calaf wird siegen, das Opfer ist Liu.
Die Darmstädter Solistinnen und Solisten bewältigen das sehr gut, die drei Hauptpartien überzeugen mit schöner Stimmkultur. Soojin Moon als Turandot muss in dieser Inszenierung gestalterisch weit über die übliche Unberührbarkeit der Eisprinzessin hinausgehen. Aldo di Toro als Calaf singt tadellos und beeindruckt mit seinem verstört wirkenden Spiel. Jana Baumeister ist eine Liu, die in traditioneller Manier als Gegenentwurf zur eiskalten Turandot besetzt ist. Dass sie und Timur, gesungen von Dong-Won Seo zum Paar werden, nun, ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Die Ping-Pang-Pong-Szenen mit Julian Orlishausen, David Lee und Michael Pegher können als groteske Sequenzen ausgezeichnet für sich stehen. Die von Sören Eickhoff einstudierten Chöre (samt Kinderchor) konnten beim Schlussapplaus endlich auch die phantasievollen Kostüme von Pascal Seibicke für alle sichtbar vorführen.
Das Staatsorchester Darmstadt unter Leitung von Giuseppe Finzi spielte solide und ließ sich von der außergewöhnlichen Musik der Turandot zwischen vermeintlichem Chinakitsch und alpenländisch anmutenden Klängen nicht aufs Glatteis führen.
Für mich war diese Turandot ein überraschendes Highlight. Valentin Schwarz wird im kommenden Jahr den Ring in Bayreuth inszenieren, ich freue mich sehr darauf.
Fotos @ Nils Heck
Angelika Matthäus 7.9.2019
Übernahme unserer Freunden vom OPERNMAGAZIN
Zum Zweiten
RUSALKA
Besuchte Aufführung: 8.6.2019 (Premiere: 23.3.2019)
Emanzipation einer Nixe
Wenig bekannt ist, dass der Komponist Antonin Dvorak immerhin zehn Opern geschrieben hat. Von diesen hat sich indes lediglich die am 31.3.1901 in Prag aus der Taufe gehobene Rusalka durchsetzen können. Dieses lyrische Märchen, wie Dvorak sein Hauptwerk bezeichnete, erfuhr jetzt am Staatstheater Darmstadt eine durchaus beachtliche Neuinszenierung. Leider verzichtete man dabei auf die Tschechische Originalsprache und ließ die Sänger/innen in einer von Bettina Bartz und Werner Hintze geschaffenen deutschen Übertragung singen. Dieses Vorgehen mutete wenig glücklich an, da die in Rede stehende Übersetzung etliche unschöne Ecken und Kanten aufwies. Da ging es oft recht unelegant und wacklig her und teilweise litten sogar schöne musikalische Phrasen darunter. Da die Übertitel gut funktionierten, hätte man das Stück in seiner ursprünglichen Diktion belassen sollen.

Katharina Persicke (Rusalka), Thorsten Büttner (Prinz)
Das Staatstheater Darmstadt hat schon seit jeher eine eher traditionelle Ausrichtung. Moderne Produktionen sind an diesem Haus die Ausnahme. Demgemäß war auch die Inszenierung von Luise Kautz in dem Bühnenbild von Lani Tran-Duc und Hannah Barbara Bachmanns Kostümen eher konventioneller Natur. Der erste Akt wird von einer gebirgsartigen Moorlandschaft geprägt, in der ständig Nebel aufsteigt - ein ästhetisch schönes Bühnenbild, das zudem noch durch mannigfaltige Lichteffekte und gelungene Projektionen unterstützt wird. Hier haben wir es mit einer doch leicht gruseligen Welt zu tun, die das Zuhause von Rusalka, den anderen Nixen und dem Wassermann bildet. Auch surreale Effekte machen sich breit. Der zweite Akt spielt in einem Ballsaal. Beherrscht wird er von drei von der Decke herabhängenden Lüstern, die allmählich ein Eigenleben entwickeln und ständig auf und nieder schweben. Geschickt wird hier mit dem Medusen-Motiv operiert. Im dritten Akt sind sie dann zur Erde gestürzt und bilden gleichsam einen Kerker. Nachhaltig prallen hier die Menschen- und die Nixenwelt aufeinander, wobei letztere ebenfalls im Verfall begriffen ist. Wir haben es gleichsam mit einer Metapher für zwei zerstörte Welten zu tun, deren erfolgreiche Wiedererrichtung zumindest fraglich ist. Rusalkas Unglück hat sich klar ersichtlich auch auf ihre Heimat negativ ausgewirkt. Die Bewohner der Moorlandschaft sind nicht mehr dieselben wie im ersten Akt und wirken nun etwas ramponiert.

Katharina Persicke (Rusalka), Thorsten Büttner (Prinz)
Insgesamt betont Frau Kautz das Märchenhafte der Handlung. Indes inszeniert sie nicht nur brav am Libretto entlang, sondern wartet auch mit so mancher guten Idee auf. Sie deutet die Handlung als Emanzipationsprozess des Wasserwesens Rusalka. Die Titelfigur ist in dieser Deutung ein pubertierendes Mädchen, dessen Identität noch nicht ganz ausgereift ist und das sich in seiner Heimat nicht wohl fühlt. Sie drängt es weg. Für diesen Wunsch ist der Prinz das geeignete Vehikel. Dieser liebt sie indes nicht wirklich, sondern fühlt sich nur sexuell zu ihr hingezogen. Einmal vergewaltigt er Rusalka sogar. Hier lässt die Regisseurin geschickt einen gehörigen Schuss Psychologie einfließen. Rusalka projiziert ihre Wünsche und Sehnsüchte auf den Prinzen, der ihre Gefühle in keiner Weise erwidert und nur ihren Körper begehrt. Echte Gefühle spielen bei Luise Kautz keine Rolle. Sie setzt den Fokus gekonnt auf gegenseitige Projektionen und psychologische Aspekte, was der Inszenierung gut tut. Hier merkt man, dass sie sich über das Werk auch tiefer schürfende Gedanken gemacht hat, deren Umsetzung von der Personenregie her teilweise indes etwas dichter und geschlossener hätte ausfallen können. In der Personenführung stellten sich leider manchmal Leerläufe ein.

Johannes Seokhoon Moon (Wassermann), Rebekka Reister, Gundula Schulte, Maren Favela (Elfen)
Rusalka ist in dieser Lesart ein Wesen, das sich von Anfang an nach Liebe sehnt. Diese bleibt ihr aber verwehrt. Daraus resultiert ihr Wunsch, aus ihrer Umwelt auszubrechen und sich der nüchternen Menschenwelt zuzuwenden. Da es sich bei beiden Welten aber lediglich um Konstrukte handelt, muss ihr Unterfangen letztlich erfolglos bleiben. Auf der anderen Seite macht sie geistig eine nicht unerhebliche Entwicklung durch. Der Erkenntnisprozess, den sie durchläuft, wird seitens der Regie recht eindrucksvoll aufgezeigt. In der Wasserwelt bzw. der Moorlandschaft ist ihr Wesen noch nicht ganz ausgeprägt, weswegen die Realität ihr zu Beginn noch verschlossen bleibt. Erst ihr ausgeprägter Liebeskummer öffnet ihr in der Welt des Prinzen die Augen. Am Ende geht sie gestärkt und emanzipiert aus dem ganzen Geschehen hervor, während der überlebende Prinz überhaupt keine Entwicklung durchmacht. Im dritten Akt ist er durch das Verhalten der fremden Fürstin in eine ausgemachte Krise geraten und erhofft sich von Rusalka Erlösung. Diese bleibt ihm aber verwehrt. Am Ende sehen wir ihn ungereift wie bei seinem ersten Auftritt.

Katharina Persicke (Rusalka)
In der Titelpartie war Katharina Persicke zu erleben, die die Nöte der Rusalka nicht nur darstellerisch glaubhaft darstellte, sondern mit gut sitzendem, ausdrucksstarkem und in der Höhe schön aufblühendem, slawisch gefärbtem lyrischem Sopran auch ansprechend sang. Neben ihr bewährte sich als Prinz Thorsten Büttner. Hier haben wir es mit einem ungemein begabten Tenor zu tun, dessen prachtvolles, bestens italienisch geschultes und obertonreiches Stimmmaterial bei aller an den Tag gelegten lyrischen Noblesse bereits ins dramatische Fach tendiert. Das sollte er indes nicht überstürzen. Wunderbar war auch Johannes Seokhoon Moon, der einen in jeder Lage sauber ansprechenden, hervorragend fokussierten und markanten hellen Bass für den Wassermann mitbrachte. Mit beeindruckendem dramatischem Sopranmaterial und robustem Auftreten gab KS Katrin Gerstenberger eine überzeugende Fremde Fürstin. Mit sonorem Bariton sang David Pichlmaier den Wildhüter. Einen volltönenden Mezzosopran nannte Xiaoyi Xus Küchenjunge ihr Eigen. Die trefflich singenden Elfen von Rebekka Reister, Gundula Schulte und Maren Favela bildeten einen homogenen Gesamtklang. Der oftmals recht schrill intonierenden Hexe KS Elisabeth Hornungs fehlte es insbesondere in der Höhe an der notwendigen Körperverankerung ihrer Stimme. Auch Michael Pegher verfügte in der kleinen Rolle des Jägers nur über dünnes, kopfiges Tenormaterial. Solide entledigte sich der von Sören Eckhoff einstudierte Opernchor des Staatstheaters Darmstadt seiner Aufgabe.
Einen ausgezeichneten Eindruck hinterließen Dirigent Daniel Cohen und das bestens aufgelegte Staatsorchester Darmstadt. Dynamisch hervorragend abgestuft, differenziert und nuancenreich und dabei niemals überlaut ließen Dirigent und Musiker Dvoraks herrliche Musik sich entfalten. Der von ihnen erzeugte Klangteppich zeichnete sich zudem durch große Intensität aus. Die dramatischen Phrasen erklangen recht kompakt, die lyrischen zart und fein. Das war eine große Leistung!
Ludwig Steinbach, 9.6.2019
Die Bilder stammen von Hans Jörg Michel
Antonin Dvorak
RUSALKA
TRAILER
Besuchte Vorstellung am 04. April 2019
Märchenhaft
Nach langer Abwesenheit am Staatstheater gibt es wieder eine Gelegenheit, eine Neuproduktion von Antonin Dvoraks Opern Hauptwerk „Rusalka“ (1901) zu erleben. Gegeben wird eine neuere deutsche Übersetzung von Bettina Bartz und Werner Hintze.
Die Inszenierung von Luise Kautz versteht die Handlung als Emanzipationsprozess der Nixe Rusalka, die sich für die Menschwerdung entscheidet. Kautz erzählt die Handlung erkennbar am Libretto orientiert. Die Besonderheit dieser Produktion zeigt sich darin, dass sie der Musik vertraut und nicht das Märchenhafte ausspart. Somit gibt es vielerlei Bildwirkungen, die das Geheimnisvolle und Symbolhafte zeigen. Vielerlei gelungene Videoeffekte (Video: Simon Janssen) unterstreichen surreale Handlungselemente. Im ersten Akt gibt es eine beeindruckende Moorlandschaft (Bühne: Lani Tran-Duc) zu bestaunen. Von überall her wabert der Nebel herein, beeindruckende Lichteffekte runden das stimmungsvolle Bild ab. Das höfische Leben wird im zweiten Akt mit drei gigantischen Kronleuchtern betont, die sich zudem auf und nieder bewegen, was sie wie gigantische Quallen wirken lässt. Im dritten Akt liegen sie dann zerstört auf dem Bühnenboden und bilden ein Gefängnis. Nixenwelt und die einstmals höfische Welt treffen hier aufeinander, vom Verfall gekennzeichnet. Am Ende bleibt der Prinz allein, lebendig zurück, während Rusalka ihn verlässt. Die Personenführung wirkt natürlich, kann jedoch Leerläufe nicht immer vermeiden. Manche Übertreibungen, wie die derbe Vergewaltigung Rusalkas durch den Prinzen im zweiten Akt, wirken sinnlos. Aber von dieser Entgleisung abgesehen, ist es eine sehenswerte Produktion, die erfreulich gut Hand in Hand mit dem Werk geht.
In der Titelpartie war Katharina Persicke vorgesehen. Sie erkrankte, so dass sehr kurzfristig Angela Davis für sie einsprang. Und diese Umbesetzung erwies sich als Trumpf des Abends! Darstellerisch konnte Davis die Entwicklung der Rusalka sehr anrührend aufzeigen. Mit großer innerer Beteiligung und reger, sehr natürlicher Mimik vermochte sie ungemein zu berühren. Ihre äußerst angenehme Sopranstimme hatte keinerlei Probleme mit der langen und fordernden Partie. In der Höhe blühte die Stimme mächtig und obertonreich auf. Dazu sang sie differenziert, wandlungsfähig und intonierte blitzsauber mit ausgeprägter Musikalität. Dazu strahlte sie eine entwaffnende Ruhe und Selbstsicherheit aus, die selten zu erleben ist. Dies ist umso erstaunlicher, da Frau Davis am Aufführungstag erst um 14.00h im Theater ankam. Eine großartige Leistung einer fabelhaften Sängerin, die diese Partie auch jederzeit an großen Häusern singen könnte!
Als Prinz hatte Tenor Thorsten Büttner einen schweren Stand an ihrer Seite. Die Stimme hat ein angenehmes Timbre und wirkt recht kompakt in der Mittellage. In der Höhe geriet er mehrfach an klangliche Grenzen, da die Durchschlagskraft fehlte und die Stimme hier nicht im Körper verankert wirkte. Davon abgesehen war er aber immerhin in der Lage, alle Töne dieser schweren Partie, auch ein sehr sicheres hohes C im dritten Akt, zu singen. Als Rollencharakter wirkte er etwas zurückhaltend und machte den Eroberer nicht wirklich deutlich.
In der Rolle der fremden Fürstin zeigte Katrin Gerstenberger hochdramatische Stimmkraft und raumgreifenden Gestus. Eine gefährliche Gegenspielerin für Rusalka mit viel stimmlicher und szenischer Präsenz.
Zuvor ließ sich Rusalka von der Hexe Jezibaba verzaubern, um ein Menschenkind zu werden. Eine schöne Rolle für Elisabeth Hornung, die mit satter Altstimme ihre Rolle prägnant gestaltete, wenngleich sie sich in der Höhe merklich plagen musste.
Als Wassermann war Johannes Seokhoon Moon zu hören. Eher eine Baritonstimme und nicht der von Dvorak geforderte Bass. Moon sang kultiviert, war aber vom Stimmumfang zu schmal und wenig volltönend. Somit wirkte seine Stimmgestaltung zu wenig dominant. Auch darstellerisch wirkte er farblos und ohne Geheimnis.
Gute Leistungen in den vielen Nebenrollen. Sehr homogen das Trio der Nixen, interpretiert von Rebekka Reister, Gundula Schulte und Maren Favela.
Klares Profil zeigte der Jäger von Keith Bernhard Stonum.
Tadellos auch Julian Orlishausen als Wildhüter Xiaoyi Xu als Küchenjunge.
Eine Freude war der homogen tönende Opernchor, einstudiert von Sören Eckhoff.
Nach GMD Daniel Cohen übernahm Michael Nündel das Dirigat. Der Dirigent hat erkennbar genau in die Partitur gehört. Wunderbar abgetönt breitete er ein weites Farbpanorama mit dem sehr gut mitgehenden Staatsorchester Darmstadt aus. Die Streicher intonierten sauber, die Holzbläser agierten gefühlvoll in ihren Kantilenen, feierlich, niemals dröhnend das Blech und knackige, dynamisch gut abgestufte Akzente im Schlagzeug. Der Orchesterklang wirkte stets tadellos ausbalanciert und überzeugend. Nündel gab seinem Sängerensemble viel Raum für gestalterische Entfaltungen.
Anerkennender Beifall im gut besetzten Haus.
Dirk Schauß, 5.4.2019
Bilder siehe obige Zweitbesprechung
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
und die weisse Frau

Oper von Richard Wagner
besuchte Vorstellung am 21. September 2017
FREISCHÜTZ oder HOLLÄNDER ?
Regisseur Dietrich Hilsdorf zeigte ein weiteres Mal, seine bereits in Köln einstudierte Produktion von Wagners „fliegendem Holländer“. Ähnlich wie beim früheren Darmstädter Intendanten John Dew, so ist auch bei Hilsdorf festzustellen, dass er die szenische Kontroverse früherer Regie-Arbeiten zu Gunsten einer Ästhetik aufgab, die sich heute erkennbarer in einem historischen Kolorit bewegt. So gibt es also eine Interpretation zu erleben, die im 19. Jahrhundert als Schauergeschichte erzählt wird. Dieter Richter (Bühnenbild) baute akustisch günstige Räume, die dem Zuschauer die Orientierung leicht machen. Ansprechend die Kostüme von Renate Schmitzer.
Hilsdorf erzählt die Geschichte und kann sich dabei eine Eitelkeit nicht verkneifen: Samiel! Nein, wir sind nicht im falschen Stück! Aber weil, so Hilsdorf, es eine „Reminiszenz an den Freischütz“ geben soll, wird diese Figur als blondhaariges Zwitterwesen eingeführt. Und da es offenkundig noch immer Menschen gibt, die die Anatomie des menschlichen Körpers nicht kennen……, ja da darf Frau Samiel nackte Brüste und einen XL-Penis zur Schau tragen! Erhellend ist das zu keinem Zeitpunkt und somit völlig überflüssig!

Mit Astrid Weber stand eine erfahrene Senta auf der Bühne, die sehr gut die Vielschichtigkeit des Rollencharakters traf. Ihr jugendliches Stimmtimbre ist immer noch gut erkennbar, jedoch sind inzwischen sehr deutliche Schwierigkeiten festzustellen. Die Höhen wurden mit äußerster Anstrengung hart erarbeitet und gerieten häufig zu tief. Die Finali 2 und 3 klangen nach sängerischer Schwerstarbeit!
Deutlich aufgewertet wirkte Erik in der herausragenden Interpretation durch Marco Jentzsch. Szenisch sehr präsent und engagiert, verwöhnte er die Zuhörer mit schmelzenden Tenorklängen. Die schwierige Kavatine im 3. Aufzug gelang besonders mühelos. In der Traumerzählung setzte er gekonnte sprachliche Akzente. Hier stimmte alles! Eine großartige Leistung!
Es war ein Abend ohne tiefe Stimmen. Seokhoon Moon war ein recht gemütlicher Daland, der seinen Part ordentlich sang, jedoch nicht die Hintergründigkeit seiner Rolle vermittelte. Mit seiner Baritonstimme war er dennoch fehlbesetzt, weil er keinen farblichen Kontrast zum Holländer aufzeigen konnte.

Elisabeth Hornung zeigte als Mary ein starkes Rollenportrait und war weit mehr als nur eine Stichwortgeberin. David Lee als lyrischer Steuermann hatte keinerlei Probleme mit den Anforderungen seiner Partie und wirkte jedoch als Figur reichlich blass. Da ist Hildsdorf nicht viel eingefallen.
Bleibt der Holländer in der Gestaltung von Kzysztof Szumanski. Szenisch verkörperte er glaubwürdig den getrieben Suchenden. Sängerisch sehr problematisch klang zu viel nach musikalischer Bewältigungsarbeit. Der oft heisere Beiklang seiner Stimme kann als „Ausdrucksfarbe“ schön geredet werden, ist aber vielmehr Beleg dafür, dass stimmtechnische Schwächen zu konstatieren sind. Je länger der Abend voran schritt, um so schwerer gerieten die Höhen, nicht selten wurden Töne auf Tonhöhe gerufen und nicht gesungen. Schnell sang er sich immer wieder fest. Im Liebesduett kämpften sowohl er als auch Astrid Weber um das musikalische Überleben.
Die tiefen Töne waren nur erahnbar und dynamisch konnte er außer lauten Tönen nichts anbieten. Die Intonation war nicht selten vage und die Textverständlichkeit war mäßig. Sehr störend jedoch der fehlende Bezug zum Text.
Insgesamt darf einmal mehr an der fachlichen Kompetenz der Entscheider am Staatstheater Darmstadt gezweifelt werden, die Besetzungen verantworten, die zu selten den Anforderungen des jeweiligen Werkes entsprechen.
Eine Freude waren die Chorgesänge (Chor und Extrachor des Staatstheaters, Einstudierung: Thomas Eitler-de Lint), die schallkräftig und differenziert von der Bühne tönten.

Großartig einmal mehr auch das Dirigat von GMD Will Humburg, der das zu Beginn etwas unkonzentriert aufspielende Orchester des Staatstheaters immer wieder antrieb. Auch gab es im Eingangschor heftige Wackler zwischen Chor und Orchester. Dann stimmte die Balance durchweg, blitzsauber intonierten die heftig geforderten Hörner, sekundiert von der homogen musizierenden Gruppe der Holzbläser. Streicher, Blech und die viel geforderte Pauke erzeugten Sturm und Drang. Kleine Schmisse im Schlagzeug beim Geisterchor waren bedauerlich. Dennoch eine überzeugende Leistung.
Am Ende wenig Enthusiasmus im gut besuchten Haus.
Dirk Schauß 23.9.2017
Bilder (c) Staatstheater
TANNHÄUSER
15. Juni 2017
Flach und schwach...
Nach nur wenigen Vorstellungen ist die Neuproduktion von Regisseur Amir Reza Koohestani abgespielt. Welche Voraussetzungen muss ein Regisseur erfüllen, um sich den Herausforderungen an ein solches Werk zu stellen? Koohestani hat in seinem bisherigen Leben erst eine Oper gesehen, nie eine Oper inszeniert und spricht kein deutsch. Aber er kommt vom Schauspiel……! Nun ja, wer glaubte, dass sich dies in einer spannenden Personenführung kennzeichnen würde, sah sich getäuscht. Zudem wurde dann noch als „Co-Regisseur“ Dirk Schmeding angeheuert. Wer weiß, wie diese vergessenswerte Inszenierung sonst geraten wäre?
Koohestani erzählt letztlich eher flach die Geschichte. Dabei setzt er sehr viele Videoeffekte ein und verortet die Handlung in einer muslimischen Welt. Ein Zierat, mehr nicht. Der Leerlauf dieser Inszenierung ist sehr ausgeprägt.
Die Welt von Venus wird auf ein Himmelbett reduziert. Ein Paar streitet sich und bewirft sich mit Kissen. Aha! Sinnlichkeit, Erotik, Völlerei…..nichts davon! Warum also „zu viel, zu viel!“ Richtiger hätte Tannhäuser singen müssen „zu wenig!“
Ein derbe Pointe ist Tannhäusers Kleidung im 1. Aufzug: ein hässlicher gestreifter, unkleidsamer Morgenrock! Klar: „nach seiner Tracht ein Ritter!“ Oder die Romerzählung: Tannhäuser steht fidel an der Rampe und singt seine zehn Minuten konzertant. Wolfram darf indes abgehen!
Musikalisch war es ein guter Abend für das Staatstheater! Edith Haller war eine sehr engagierte, leuchtkräftige Elisabeth. Ihre innere Beteiligung und ihre Textverständlichkeit waren ausgezeichnet. Lediglich das „h“ am Ende der „Hallenarie“ geriet ihr etwas kehlig, angestrengt. Bedauerlich auch, dass sie, eine schlechte Tradition nahezu aller Elisabeth Sängerinnen, bei ihrem Einschreiten lediglich „ein“ und nicht „Haltet ein“ sang.
Katrin Gerstenberger war eine vollstimmige Venus, die vor allem im 1. Aufzug (gespielt wurde die Pariser Fassung) überzeugte. David Pichlmaier (Wolfram) stand im Zentrum der Gunst des Publikums. Sein heller, kultivierter Bariton erfreute durch Schattierungen im Ausdruck und war auch den Ausbrüchen im 3. Aufzug gut gewachsen. Martin Snell agierte als Landgraf mit hoher Stimmkultur und feiner Noblesse. Sein Textausdruck war beispielgebend. Auch die übrigen Minnesänger gefielen, wie z.B. Nicolas Legoux als grimmiger Biterolf oder Minseok Kim als lyrisch tönender Walther.
Bleibt Deniz Yilmaz als Tannhäuser. Kaum eine Tenorpartie Wagners ist derart schwer zu besetzen. Die ungewohnt hohe Tessitura erfordert einen ausdauernden Tenor mit belastbarer Höhe und mit ausgeprägter deklamatorischer Begabung. Einen idealen Interpreten gibt es heute nicht. Yilmaz sang die Titelpartie im Rahmen seiner Möglichkeiten hoch anständig. Bei ihm gab es keine stimmlichen Einbrüche. Selbst in den Ensembles sang er alles aus (auch die gerne nicht gesungenen „zu ihr!“-Rufe) und konnte in den „Erbarm dich mein“-Rufen gut bestehen. Allerdings ist die Stimme in ihrer Strahlkraft deutlich begrenzt. Schwerer wog jedoch die fehlende Textgestaltung. Lediglich bei Tannhäusers Reblik auf Biterolf blitzte ein Hauch von Textausdruck durch. Ansonsten blieb Yilmaz weitgehend ausdruckslos, so dass er nicht das notwendige Zentrum bildete.
Chordirektor Thomas Etler - de Lint sorgte für eine gelungene Choreinstudierung, so dass Chor- und Extrachor sich völlig zu Recht über viel Jubel freuen konnten.
Herausragend war für mich jedoch einmal mehr das überragende Dirigat durch GMD Will Humburg! Mit Feuereifer durchlebte er mit dem famos aufspielenden Staatsorchester alle Farben der Partitur. Hingebungsvoll waren die Ruhepunkte in den Holzbläsern. Perfekt die Balance zwischen Bühne und Graben. Und die drei Finali waren in der dynamischen Entwicklung derart überrumpelnd in ihrer Überwältigung, so dass spätestens am Ende des Werkes der musikalische Himmel erreicht war. Großartig!
Sehr langer, ausdauernder Jubel eines hoch konzentrierten Publikums.
Dirk Schauß 17.6.2017
Bilder siehe Premierenbesprechung weiter unten !
JENUFA
Dernière am 21. Mai 2017
Großes Glück

Janacek in Deutschland war und wird kein Kassenschlager für die Opernhäuser! So auch wieder einmal erlebt bei seinem Meisterwerk „Jenufa“ in einer hervorragenden Inszenierung von Dirk Schmeding am Staatstheater Darmstadt.
Sehr erfreulich, dass es endlich einmal Janacek in deutscher Übersetzung gab! Gerade bei ihm, der so sehr von der Sprache her arbeitet, ist der sprach-emotionale Textbezug außerordentlich bedeutsam. Erinnern wir uns an den großen Rafael Kubelik, der sich in seiner Wirkungszeit immer für Aufführungen von Janaceks Opern in der Landessprache einsetzte. Und das erscheint mir völlig richtig! Insbesondere, wenn ein Großteil der Besetzung deutsche Muttersprachler sind. Alle Sänger dieser Aufführung verschmolzen mit dem zu singenden deutschen Text auf außergewöhnliche Weise. Das waren keine bloßen Töne und Rhythmen, sondern gelebtes Leben mit jeder Silbe! Leider eine Seltenheit!

Das Glück wäre vollkommen gewesen, wäre das Publikum in den Genuss der sog. „Prager Fassung“ gekommen, die über die Jahrzehnte hinweg gespielt wurde. Die vielfach kritisierten Retuschen an der Instrumentierung werten m. E. Jedoch die Partitur außerordentlich farblich auf. Nun also die sog. „Originalfassung“, die „Brünner Fassung“, die recht graufarbig daherkommt und der Partitur viel an Wirkung nimmt.
Dirk Schmedings Inszenierung ist eine ungemein überzeugende Arbeit. Das Stück bleibt visuell in seiner ursprünglichen bäuerlichen Örtlichkeit verhaftet. Die Personenführung wirkt schlüssig und immer natürlich. Der Handlungssog baut sich kontinuierlich auf und nimmt die Zuschauer gefangen. Sehr genau hat Schmeding in die Musik hinein gehört. Nebenfiguren wie Jano oder der Altgesell werden deutlich aufgewertet. So feuert der Altgesell Stewas Feiergesellschaft gehörig an. Er ist es auch, der den toten Leichnam des Säuglings auf die Bühne bringt. Die Interaktion zwischen den handelnden Personen ist geradezu perfekt und lassen immer wieder an einen Filmablauf denken. Viele Details sind gelungen. Unvergesslich Jenufas Fassungslosigkeit, als sie erfährt, dass Stewa nun Karolka heiratet. Oder die irrlichternde, wahnsinnige Küsterin, die im 3. Akt auf dem Steg des Orchestergrabens lange auf und ab geht und damit dem Publikum extrem nahe kommt. Prägnant auch das Bild, als erst Laca und dann gemeinsam mit Jenufa das Grab für das tote Kind am Ende der Oper ausheben. Auch das Bühnenbild folgt dem Werk aus dem mährischen Bauersleben. So gibt es in der Bühnengestaltung durch Martina Segna vielerlei Heuballen zu sehen und farbige, ländliche Kostüme, die Frank Lichtenberg entwarf.

Katharina Persicke ist eine empfindsam, herbe Jenufa, die sehr gut die Entwicklung nachvollzieht. Ihr lyrischer Sopran bleibt meist auf Linie und wird nicht künstlich groß gemacht. Die totale Identifikation mit der Rolle war begeisternd, wie auch ihre hohe Textverständlichkeit. Als Küsterin war Kammersängerin Katrin Gerstenberger zu bestaunen. Denn derart vielschichtig und farbenreich habe ich diese Künstlerin bis dato noch nicht gehört. Die Küsterin lebt vor allem durch einen exponierten Wort-/Tonbezug, Schöngesang ist da eher störend. Somit warf sich Gerstenberger nahezu selbstvergessen in die hohen Anforderungen ihrer Partie. Eindringlich, erschütternd und bewegend sang und gestaltete sie ihre Rolle. Marco Jentzsch als Laca war eine gute Wahl. Darstellerisch sehr präsent und stimmlich mit heller Tenorstimme sicher, blieb er seiner Partie keine Nuance schuldig. Auf Augenhöhe agierte Mickael Spadaccini als Stewa. Er war eine formidable Besetzung für diesen Leichtfuß, darstellerisch total enthemmt und mit ungewöhnlich großer Spinto-Stimme, die auch die heiklen Höhenflüge mit Jenufa im Duett gut meisterte. Auch die mittleren und kleineren Rollen waren überzeugend besetzt, wie z.B. Elisbeth Hornung als pasthose Alte Burya oder Thomas Mehnert als sonorer Altgesell.

Der spielfreudige Chor in der Einstudierung von Thomas Eitler-de-Lint machte seine Sache vorzüglich.
GMD Will Humburg befeuerte seine Damen und Herren im Graben im Dauereinsatz! Und das Staatsorchester Darmstadt war in Geberlaune. Sehr ausbalanciert in den einzelnen Gruppen, hart und schlagkräftig in den Forte-Stellen, aber auch berückend intim in den lyrischen Stellen, wie z.B. im kantablen Violinsolo bei Jenufas großer Soloszene im 2. Akt.
Das halbvolle Haus feierte am Ende eine packende Aufführung von hoher Geschlossenheit. Bleibt zu hoffen, dass im angedachten Janacek-Zyklus des Staatstheaters auch die übrigen Werke auf Deutsch einstudiert werden. Und diese Jenufa sollte als Wiederaufnahme kommen. Ein der besten Aufführungen dieses Werkes!
Bilder (c) Staatstheater Darmstadt
Dirk Schauß 22.5.2017
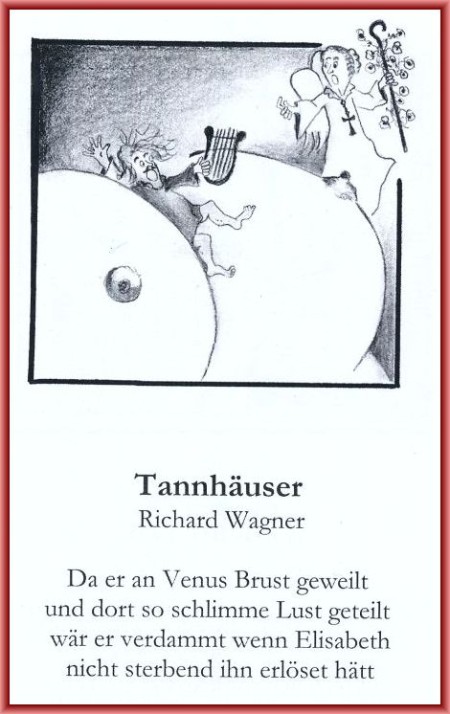
(c) Opernfreund / Peter Klier
Tannhäuser als Flüchtling
Premiere am 22. April 2017
und verschleierte Frauen auf der Wartburg

Wir antworten auf den letzten Satz der Pressestelle mit einem "Oder auch nicht!" denn Regisseur Amir Reza Koohestani liegt ziemlich daneben - "Thema verfehlt!". Er sieht Tannhäuser als Wanderer bzw. Flüchtling zwischen unterschiedlichen Welten und Kulturen. Zur Wartburg, seiner ursprünglichen (!) Heimat, die fataler Weise irgendwo im Orient in einem streng muslimischen Land liegt, kehrt er aus dem verruchten Westen, wo Frau Venus mit ihrem verderbten Gefolge lebt, zurück.

Diese Idee klingt beim ersten Lesen gar nicht so schlecht, doch reißt der Rote Faden schon im ersten Akt, wenn das solitäre Bühnenrequisit, ein überdimensioniertes, mittelalterlich anmutendes Gardinenbett, auf welchem es sich eine Gruppe junger, leichtbekleideter Menschen - anscheinend zum Gruppensex oder nach selbigem - gemütlich gemacht hat. Man räkelt sich schlafend.
„Naht Euch dem Lande, wo in den Armen glühender Liebe selig süß Erwarmen stillt eure Triebe.“ Wagner hier einmal frei ab 6 Jahren, denn nach richtiger Orgie (sprich: Rudelbumsen) sieht das Ganze eben nur auf den ersten Blick und von oben videografiert, aus. Zu züchtig und brav ist alles arrangiert. Von Tannhäuser oder Venus zumindest auf den ersten Blick noch keine Spur.

Zur Bacchanal Musik - man spielt die Pariser Fassung - gibt es nun wirre Projektionen von alten Filmen. Wir erkennen unter anderm Schwarz/Weiß-Streifen der „Kraft durch Freude“-Bewegung (Leni Riefenstahl, 1936) bis hin zum Wasserballett von Esther Williams („Die badende Venus“, 1944); alles optisch verschleiert und verfremdet (Videogestaltung von Philipp Widmann).
Mädels aus dem 30ern allüberall, und alles endet dann nach sieben Minuten in bunt-rotem Flimmern. Bildstörung? Nein, denn jetzt werden drei Harems-Tänzerinnen, die sich so kitschig klicheehaft bewegen, als seien sie gerade einem Walt Disney-Film entsprungen, als Schattenspielerei auf der Hinterbühne einmal rauf und runter gefahren. „Sinnlose Plage - Müh ohne Zweck.“ (O-Ton Wagner)

Über die läppische Präsentation von Venus, deren Optik und Ausstattung (Kostüme: Gabriele Rupprecht) einer spießigen Mutti aus dem Kohlenpott näher kommt als einem verführerisch erotischem Weib und dem Geplänkel mit Tannhäuser, der mich nicht nur optisch, sondern auch in der Beweglichkeit eher abkühlend an Demis Roussos im Streifenbademantel erinnert, möchte ich keine weiteren Worte verlieren, denn es ist alles von schrecklicher Optik. „Erbarm Dich mein.“ (abermals Wagner).
Immerhin erfrischende Lacher im Publikum, wenn Tannhäuser von seinen ehemaligen Kameraden in eben dieser unedlen Scheußlichkeit mit den Worten empfangen wird „Wer ist dort im brünstigen Gebet? - Ein Büßer wohl. - Nach seiner Tracht ein Ritter!“

Die hilflose Regie, ohne erkennbare Personenführung, offeriert schon am Anfang - am Ende wird es noch viel schlimmer! - langweiligen Rampengesang mit Opernsteinzeitgesten. Die Sänger scheinen auf sich allein gestellt. „So singe, Held!“ (Wagner). Keinerlei überzeugende Aktionen, die Sinn machen könnten; man steht rum, breitet die Arme aus, muß unglücklich agieren. Wenn die Regie nicht weiter weiß / dann nimmt man ordentlich Trockeneis. "Waberlohe" heisst es bei Wagner anderswo.
Immerhin hat die Entsorgung des Bettes am Ende des ersten Aktes durchaus unfreiwilligen humorigen Charakter, wenn die ankommenden Pilger nämlich selbiges zerlegen und sich auf ihm posierend, wie auf einer Art Schiffchen, von der Bühne schieben lassen.
Akt II: Die Wartburg quasi als Moschee geht nun gar nicht, und wenn dann auch noch überzeugte Moslemritter über die "hehre Liebe" singen, dann wird es ärgerlich. Bleiben wir mal aktuell: in einem muslimischen System, in dem Zwangsehen geschlossen und Minderjährige von den Eltern verkuppelt werden, geriert das Ganze zu übler Peinlichkeit und naiver Verharmlosung. Der Sieger des Wettbewerbs soll auch noch einen goldenen Krummsäbel bekommen.

Der Einmarsch der Gäste über die Seitentüren des Auditoriums - die heilige Halle ist natürlich das Opernhaus ! - verläuft nach dem Motto „Hallo,wir sind im Fernsehen!“, denn alle winken ins Publikum und werden dabei gefilmt. Leider winkt nur der Rezensent zurück, doch ich bin unglücklicherweise auf dem schlechten Videoausschnitt, der das Ganze auf die Hinterbühne projiziert, nicht zu sehen; vielleicht hätte ich aufstehen sollen.
Immerhin drapiert sich, trotz dieser Regietheater-Mätzchen aus den 90-ern, der passabel singende Chor (Leitung: Thomas Etler- de Lint) ordentlich in Dreierreihe und Glied sauber ausgerichtet am Orchestergrabenrand und singt...
...und winkt weiter aufgesetzt locker und heiter. Leider wirkt solch fröhliche Spontanität auf das Publikum keineswegs ebenso fröhlich. Wagnerianer haben halt begrenztes Humorpotential. Sprung: Immerhin werden im dritten Akt dann alle, die bei der Rom-Erzählung nicht eingeschlafen sind, mit einem schön arrangierten Finalbild (siehe unten) belohnt.

Kommen wir zur gesanglichen Würdigung. Da wären drei Sänger wirklich erwähnenswert: Edith Haller ist als Elisabeth (unten rechts) der große Star des Abends. Die einzige Wagnerstimme mit internationalem Format. Ihr gelingen die großen Bögen genauso, wie die leisen Passagen im Gebet - eine grandiose Besetzung. Hinzu kommt ihre bis ins kleinste feinsinnig ausgearbeitete Textverständlichkeit - was bei Wagner ja keine Selbstverständlichkeit ist. Brava!

Wobei ich dann gleich zur weiblichen Antipode komme, denn von Tuija Knihtiläs Venus war trotz ihres respektablen Organs und tragender, wenn auch rauher Stimmlage nicht ein Wort zu verstehen. Und selbst wer mitlas (dankenswerterweise Obertitel), fragte sich, was diese Künstlerin da überhaupt sang. Esperanto? Gibt es am Darmstädter Haus eigentlich keine Sprachtrainer?
Als zweites wäre der standfest und zuverlässig singende Landgraf Hermann von Martin Snell zu würdigen. Eine feste und sichere Burg in jeder Hinsicht, solch gute und sichere Stimme erfreut das Herz und die Wagnerseele des Publikums sowie des Kritikers gleichermaßen. Es hört sich an wie Wagner, klingt wie Wagner und ist ebenfalls durchaus Wagner-textverständlich präsentiert. Bravo! Snell weiß, was er singt und tut dies auf bewundernswerte Art und Weise.
Herausragend auch ein junges, erwähnenswertes Talent: David Pichlmaier als Wolfram - ist wahrlich einen goldenen Abendstern wert. Hier ist ein guter Sänger, den man aufbauen muß und sollte. Bitte merken Sie sich den Namen.

Zuletzt komme ich zur Hauptpartie: Tannhäuser – gesungen von Deniz Yilmaz.
Sie gehört wegen der ungeheuren Ansprüche und der ständigen Bühnenpräsenz zu den heikelsten, anstrengendsten und schwierigsten Tenor-Rollen, die es im Opernsektor überhaupt gibt. Die Tannhäuser-Partie ist der blanke Wahnsinn, daher werden für gestandenen Wagnersängern, welche diese Rolle gut beherrschen (und von denen es aktuell vielleicht 5-7 auf dem Weltmarkt gibt) horrende Honorare gezahlt, und diese Künstler sind oft auf Jahre ausgebucht. Also Geduld, liebe Opernfreunde, und Nachsehen mit einer vielleicht nicht so überzeugenden Interpretation. Wenn sich ein junger Sänger ohne riesige Wagner-Erfahrung in dieses eigentlich immer ruinöses Abenteuer stürzt, dann ist dies erst einmal bewundernswert und verdient Respekt. Dieser Repekt gebührt Herrn Yilmaz, der die Partie recht wacker durchstand. (Bild / Links: Yilmaz / rechts: Martin Snell)

Uneingeschränktes Lob geht an den GMD, Maestro Will Humburg, der mit dem routiniert und sicher aufspielenden souveränen Staatsorchester Darmstadt für die viele Unbill auf der Bühne entschädigte und auch die schwierige Koordination zwischen Bühnenmusik und Graben sauber im Griff hatte. So sollte Wagner klingen - so muß er klingen. Bravi!
Am Ende viele Buhs für das Regie-Team aber auch sehr begeisterte Darmstädter Wagnerianer, die ihren Lokalmatadoren doch vieles verziehen.
Peter Bilsing 23.4.2017
PS
Besonderen Respekt und Dank an den begnadeten Fotografen Wolfgang Runkel (c) für die schönen Szenenbilder, die hier viel beeindruckender wirken, als die teilweise habdunkle deprimierende Bühnenrealität am Premierenabend.
JENUFA
Premiere: 4.3.17
Besuchte Vorstellung: 9.4.17
Traditionell inszeniert und doch auf den Punkt gebracht
Lieber Opernfreund-Freund,
eigentlich wollte ich mir gestern Janáčeks „Jenůfa“ am Staatstheater Darmstadt ohne Rezensentenstift in der Hand oder im Kopf anschauen, gewissermaßen im Vorbeigehen zum reinen Privatvergnügen, bin aber von dem Nachmittag dermaßen bewegt, dass ich Ihnen schon wieder schreiben muss.
Die Crux bei vielen Inszenierungen von Opern, die im ländlichen Bauernmilieu angesiedelt sind, scheint heutzutage zu sein, dass man dem Publikum nicht mehr zutraut, eine Transferleistung zu vollbringen. Um jeden Preis will man Heimeligkeit vermeiden, damit nichts altbacken wirkt, und zudem muss man dem aus der Stadt stammenden Zuschauer ja plastisch vor Augen führen, dass Konflikte auf einem Bauernhof auch durchaus in Fabrikhallen des 21. Jahrhunderts stattfinden können. Da muss „La Wally“ vom „Alpenkitsch“ befreit werden, „Die verkaufte Braut“ nach Thailand oder „Cavalleria rusticana“ ins Raumschiff verlegt werden. Dass es auch anders geht und mehr als gelingen kann, zeigt derzeit der Regisseur Dirk Schmeding, der in Darmstadt in der Spielzeit 2014/15 schon für die Umsetzung von „Das schlaue Füchslein“ verantwortlich zeichnete.

Er belässt die Handlung der „Jenůfa“ eindeutig in der von Janéček angedachten Zeit in Mähren, setzt aber deutliche Akzente, indem er die tragische Figur der Küsterin von Anfang an als Außenseiterin zeigt. Dies zeigt sich schon in deren Kleidung, die in tristem Schwarz und Grau einen schmucklosen Kontrast zu den farbenfrohen volantbesetzten Röcken der übrigen Dorfbewohner darstellt, die Frank Lichtenberg mit viel Liebe zum Detail gefertigt hat. Als Störenfried der Gemeinschaft tritt sie auf mit ihrer strengen, bigotten Art, hatte sie doch einst selbst ein freudvolleres Leben, wie sie in ihrer Eingangserzählung andeutet. Eigentlich will niemand etwas mit ihr zu tun haben. Nicht einmal ihre Ziehtochter Jenůfa will ihren vermeintlichen Schutz. Dies zeigt sich schon in kleinen Gesten, wenn beispielsweise Jenůfa den wärmenden Mantel, den ihr die Küsterin im zweiten Akt beharrlich um die Schultern legen will, ein ums andere Mal abstreift, und findet seinen Höhepunkt im Schlussakt, als sich im wahrsten Wortsinne ein Graben zwischen der wahnsinnig gewordenen Küsterin, Jenůfa und der übrigen Gemeinschaft aufgetan hat.

Doch da ist Jenůfa schon längst der Küsterin ähnlich geworden, hat jegliche Lebensfreude abgelegt und fügt sich in ihr Schicksal, das sie wie die Küsterin als gottgewollte Quittung für ihr bisheriges Leben begreift. Dass sie dabei in schwarzem Kleid zum Altar will, einer Farbe die bislang für die Küsterin reserviert war, ist nur folgerichtig und der Zuschauer ahnt mit ihr, dass ihrer Zukunft mit Laca, mit dem sie zum Schlussduett das tote Kind begräbt, kein Glück beschieden sein wird. Stattfinden lässt Dirk Schmeding seine Erzählung auf einer kargen Bühne, auf der der Grundstock eines Hauses zu stehen scheint, dass niemals fertig geworden ist. Nur vereinzelt setzt er Strohballen als Kulisse ein, die Laken im zweiten Akt, sind gleichsam Bett- und Leichentuch, aber auch der Teppich, unter den alles gekehrt werden soll (Bühne: Martina Segna). Von Dorfidylle also keine Spur. Durch diese gelungene Gradwanderung zwischen traditioneller Lesart und anderem Focus vergehen die gut zwei Stunden wie im Flug, entsteht spannendes Musiktheater, ohne dass das Werk auf links gedreht werden müsste.

Das Produktionsteam kann sich aber auch auf eine extrem leistungsstarke Künstlerriege verlassen: Während der ersten Vorstellungen hatte noch die Französin Iris Vermillion für die erkrankte Katrin Gerstenberger die Gestaltung der Küsterin übernehmen müssen, so dass die Kammersängerin gestern erstmals als Küsterin zu erleben war. Während der ersten Phrasen erschien mir ihr kräftiger Mezzo doch recht hell und wenig brustlastig für die Gestaltung dieser vielschichtigen und auch abgründigen Figur. Bereits im zweiten Akt aber brillierte das langjährige Ensemblemitglied mit Verve und Leidenschaft, zeigt schneidende Höhen und Mut zur stimmlichen Hässlichkeit und wird spätestens in der Darstellung im Schlussakt dermaßen glaubwürdig, dass man denkt, sie würde sich in der Tat jeden Moment im Wahn von der Brüstung zum Orchestergaben, auf der sie in sich versunken hin und her balanciert, in den selbigen stürzen. Katharina Persicke gibt die Jenůfa mit berührendem Sopran voller Mitgefühl erzeugendem Timbre und reich an Farben. So gelingt ihr eine überzeugende und glaubhafte Darstellung der Figur, die alles erduldet und alles verzeiht – ihrem Mann ihre körperliche Entstellung und ihrer Stiefmutter den Mord am eigenen Kind. Auch Marco Jentzsch ist gestern schlicht brilliant, gefällt mir als Laca mit seinem klaren, hellen Tenor ausgesprochen gut. Scheinbar mühelos bewältigt er die Partie der Figur, der gegenüber ich selten Sympathie entwickeln kann. Sein Bruder Stewa wird von Bariton Mickael Spadaccini mit großer Leidenschaft verkörpert, der junge Belgier spielt den Womanizer zudem einfach grandios. Thomas Mehnert imponiert mir als Altgesell mit durchschlagkräftigem Bass in blutverschmierter Metzgerschürze, Anja Bildstein ist eine so würdige wie keifende alte Buryja, Jana Baumeister zeigt als lebenslustiger Jano ihren feinen Sopran und Joyce de Souza ist eine ansteckend quirlige Karolka. Auch der Rest des Ensembles gefällt in den zahlreichen übrigen Rollen.

Thomas Eitler-de Lint hat mit dem Opernchor hörbar intensiv gearbeitet. Die Damen und Herren sind bestens disponiert und leisten ganze Arbeit. Das tut auch Will Humburg am Pult. Sein Talent, komponierte Gefühle und Gemütszustände hörbar zu machen, zeigt sich bei diesem Janáček ganz besonders. Mit dem Staatsorchester Darmstadt breitet er den Künstlern auf der Bühne gewissermaßen den roten Klangteppich aus, so dass diese ihre „Jenůfa“ auf Deutsch bei ausgezeichneter Textverständlichkeit zum Besten geben können.
Das Staatstheater Darmstadt ist am gestrigen Nachmittag nur spärlich besucht. Das mag dem zeitgleich stattfindenden Stadtfest oder den sonnigen 25 Grad geschuldet sein, die eher in die Eisdiele denn ins Theater locken. Vielleicht haben sich aber das hohe Niveau und die künstlerische Qualität dieser bewegenden Produktion noch nicht genug herum gesprochen und ich freue mich, wenn ich das mit diesen Zeilen habe ändern können.
Ihr Jochen Rüth 10.04.17
Die Bilder stammen von Martin Sigmund.
DER FREISCHÜTZ
Aufführung: 7.11.2015
Premiere: 19.6.2015
Beziehungsdrama mit psychologischem Einschla
Von großer Eindringlichkeit war schon die Eingangsszene aus der bereits vergangenen Juni aus der Taufe gehobenen Neuproduktion von Webers „Freischütz“ am Staatstheater Darmstadt: Agathe packt ihre sieben Sachen, zieht ihr Brautkleid aus und verlässt die Bühne. Der am Rand stehende Max kann nichts dagegen machen. Das hier nicht glückliche Ende wird vorweggenommen. Das Folgende erzählt Eva Maria Höckmayr als Rückblende. Im Focus steht das Geschehen zwischen dem Polterabend des Paares und dem verhängnisvollen Probeschuss. Dabei folgen die Regisseurin und ihre Bühnen- und Kostümbildnerin Julia Rösler nicht etwa althergebrachten Aufführungskonventionen, sondern entwickeln eine ganz eigene Sichtweise auf das Werk.

Ensemble
Frau Höckmayr verortet die Handlung geschickt in der Gegenwart und macht aus dem Geschehen ein groß angelegtes Beziehungsdrama mit starkem psychologischem Einschlag. Sie hat eine eigene Textfassung erstellt, die die Dialoge und Szenenanweisungen von Librettist Friedrich Kind um Auszüge aus der zugrundeliegenden Novelle von Johann August Apel ergänzt. Die Vorlage Apels mit den Hauptpersonen Wilhelm und Kätchen wird als eigenständige Schauergeschichte in die Opernhandlung integriert und von der Dorfautorität, die im ersten und zweiten Aufzug mit dem schwarzen Jäger Samiel identifiziert wird, zum Besten gegeben. Immer wieder werden seine Augen auf den Hintergrund projiziert. Er ist allgegenwärtig. Den versöhnenden Ausgleich bewirkt zum Schluss wiederum die Autorität des Dorfes, dieses Mal aber in der Maske des Eremiten. Eine dritte Respektperson stellt der Ahnherr dar, der in der letzten Szene gleichsam aus seinem Bild heraustritt und zum Fürsten Ottokar mutiert. Diesem wurden am Ende einige gesungene Passagen weggenommen und dem alten Förster Kuno in den Mund gelegt.

Für die Zwischentexte hat
Martin Baumgartner, der auch für die Videos verantwortlich zeigte, eine stimmungsvolle Atmosphärenmusik komponiert. Dieses Vorgehen der Regisseurin macht durchaus Sinn, gegen das Stück wird trotz einiger von der Vorlage abweichenden Änderungen nicht verstoßen. Max ist in der Deutung von Eva-Maria Höckmayr ein Kriegsheimkehrer - womöglich aus Afghanistan -, der schon in der Vergangenheit schwere Schuld auf sich geladen hat. Worin diese besteht, erweist sich in der Wolfschlucht: Er hat einige unschuldige Soldaten erschossen. Diese Szene hat mit der traditionellen Schauerromantik nichts mehr gemeinsam, sondern entspringt voll und ganz dem Inneren Agathes. Ihr ist bereits zu Beginn, als man sich an der riesigen Familientafel trifft, klar, dass ihre Liebe zu Max gefährdet ist und versucht diese zu retten. Sie versteht seine Handlungsweise nicht und will dieser auf einer inneren Reise in die Wolfsschlucht auf den Grund gehen. Diese hat, wie gesagt, nichts Reales, sondern ist als Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche aufzufassen - eine treffliche, an Sigmund Freud angelehnte Deutung.
Agathe hat eine Ahnung, dass in ihrem Bräutigam etwas Schlimmes schlummert, will das aber nicht wahrhaben. Vielmehr bringt sie in einer Vision den hier durchaus nicht böse gezeichneten Kaspar damit in Verbindung. Wenn sie gleich darauf aber in einer traumhaften Sinnestäuschung beobachten kann, wie Max ganz allein die Freikugeln gießt, erkennt sie schlagartig, dass sie sich irrt. Es ist eine schreckliche Erkenntnis, die sie da gewinnt und die sie letztlich nicht bewältigen kann. Max erfährt hier eine negative Deutung, während Kaspar als Bösewicht rehabilitiert wird. Von Anfang an erscheint er eigentlich gar nicht unsympathisch. Er ist oft im Försterhaus anwesend und bei den Mädchen anscheinend nicht mal so ungern gesehen. Insbesondere Ännchen scheint Interesse an ihm zu haben. Das ist allerdings nicht mehr neu. Man hat es in Bettina Lells Pforzheimer Inszenierung von 2009 ähnlich gesehen.

Renatus Mészár (Kaspar), Mark Adler (Max), Chor
Am Ende erkennt Agathe, dass sie dem von der siebten Freikugel tödlich getroffenen Kaspar Unrecht getan hat und kümmert sich um den Sterbenden. Sie schenkt ihm sogar größere Aufmerksamkeit als Max, der die Kollision seiner früheren Untaten mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann und auf der ganzen Linie scheitert. Seine Aggressionen gegen seinen alten Kriegskameraden Kaspar wirken nicht berechtigt und entspringen augenscheinlich aus dessen Mitwisserschaft um Max’ Schuld. Nachhaltig projiziert dieser seine Ängste auf Kaspar, bleibt innerlich aber dennoch immer allein. Das letzte Bild zeigt das Liebespaar, wie es sich fragend anblickt. Das unglückliche Ende lässt sich erahnen. Unter diesen Voraussetzungen verwundert es nicht, dass Agathe ihren Verlobten verlässt. Das ist eine sehr interessante Neudeutung, mit der Frau Höckmayr hier aufwartet. Ihre Rechnung ist voll aufgegangen. Das häufige Kreisen der Drehbühne versinnbildlichte dabei das ganze emotionale Chaos der Protagonisten.

Insgesamt solide waren die gesanglichen Leistungen. Mark Adler hatte die regieliche Anlage des Max gut verinnerlicht und mit intensivem Spiel überzeugend umgesetzt. Gesanglich ließ sein nicht tief genug fokussierter Tenor indes Wünsche offen. Da war es um die Agathe von Susanne Serfling schon besser bestellt. Sie verfügt über einen Sopran, der zwar nicht allzu groß, aber gut verankert ist und in allen Lagen ansprechend geführt wird. Auch darstellerisch hat sie die Ängste und die Verzweiflung der Försterstochter trefflich umgesetzt. Ein frisch und herzhaft, dabei mit guter Stütze ihres ansprechenden Soprans singendes Ännchen war Jana Baumeister. Renatus Mészár vom Badischen Staatstheater Karlsruhe gab den Kaspar ganz im Einklang mit der Regie nicht als herkömmlichen Bösewicht, sondern als guten alten Kameraden von Max. Stimmlich zeigte er sich prägnant und ausdrucksstark. Thomas Mehnert sang den Kuno recht robust. Etwas mehr Stimmkraft hätte man sich von David Pichlmaiers Ottokar (Ahnherr) gewünscht. Dieser junge Bariton ist noch entwicklungsfähig. Nur über dünnes Tenormaterial verfügte der Kilian von Andreas Wagner. Als Eremit (zweite Autorität im Dorf) erbrachte Stephan Bootz eine ordentliche Leistung. In der Sprechrolle des Samiel (erste Autorität im Dorf) machte Andreas Wellano auf sich aufmerksam. Gut gefiel der von Thomas Eitler-de Lint einstudierte Opernchor des Staatstheaters Darmstadt.

Renatus Mészár (Kaspar), Jana Baumeister (Ännchen), Susanne Serfling (Agathe)
Eine solide Leistung ist Michael Nündel am Pult zu bescheinigen. Er hatte das sicher und versiert aufspielende Staatsorchester Darmstadt sicher im Griff und animierte es zu einem abwechslungsreichen, differenzierten und nuancenreichen Spiel, wobei das düstere Element überwog.
Ludwig Steinbach, 9.11.2015
Die Bilder stammen von Candy Welz
Für Kinder und Großeltern
HÄNSEL UND GRETEL
Vorstellung am 21.11.2014 (Premiere am 08.11.14)
Von der leeren Bühne bis zum Hexenklamauk: eine behutsame Entdeckungsreise für die Kinderfantasie
Für Stadtkämmerer und Finanzminister der Länder gibt es bezüglich der Oper wenig Hoffnung. Zumindest die Totalamputation dieser von ihnen vielfach nur als lästigen Kostenfaktor empfundenen Position wird immer wieder konterkariert durch den 1854 in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck. In dessen „Hänsel und Gretel“ (mit UA am Ende einer Zeit, in der immer noch neue Stadttheater gebaut wurden) werden von ihren älteren Geschwistern, Eltern oder Großeltern immer neue Generationen von Kindern zum ersten Opernerlebnis mitgenommen und schauen sich dort die Märchenoper an, die bei weitem meistgespielte Oper in den im deutschen Sprachraum. Immer neue Generationen von Operngängern lockt also dieses Meisterwerk von Engelbert Humperdinck in die Theater, und weil die noch lange weiterleben machen sie weitere Zuschüsse für den Spielbetrieb unabwendbar.
„Kinderstubenweihfestspiel“ hat Humperdinck sine Oper selbst-ironisch genannt. Er war 1882 Angestellter bei Wagners in Bayreuth, hatte aus bühnentechnischen Gründen eine Passage des „Bühnenweihfestspiels“ kompositorisch etwas gelängt und kannte sich also mit Weihspielen schon gut aus. 1893 wurde unter der Stabführung von Richard Strauß die Oper in der heutigen Fassung am damaligen Hoftheater in Weimar uraufgeführt. Da gibt es – zugegebenermaßen nur eine - ganz schwache und zudem nur gestrichelte - Verbindungslinie zu der Produktion in Darmstadt. Denn die hat Karsten Wiegand, der neue Intendant des Staatstheaters eben aus Weimar mitgebracht, wo er sie mit seinem Co-Regisseur Valentin Schwarz 2012 vorgestellt hatte. Für das Staatstheater wurde sie nun weiterentwickelt und von Sebastian Gühne neu einstudiert.

Kinderchor, Gretel (andere Sängerin), Ulrika Strömstedt (Hänsel)
Die Regisseure sehen sich heute jeweils einer Gratwanderung ausgesetzt, wenn sie Hänsel und Gretel inszenieren. Sollen sie versuchen, moderne soziopsychologische Zusammenhänge im Werk zu entdecken (wie jüngst in der verkopften Frankfurter Produktion; Regie Keith Warner) und ein Lehrstück für Erwachsene mit Sozialrealismus aufzuführen oder wollen sie die Kindern mit märchenhafter Bebilderung und vor allem mit dem notorischen Knusperhäuschen in den Bann ziehen. Die Musik bedient beide Fraktionen Da kann der Dirigent machen, was er will; der Ball liegt beim Regisseur. Wo die Eltern (Steuerzahler) abstimmen durften, war die Wahl jeweils klar: sozialrealistische Neudeutungen verschwinden schnell aus dem Repertoire der Häuser; die Märchen halten sich teilweise jahrzehntelang wie jüngst in Wiesbaden, wo sich der neue Intendant Laufenberg sogar einer Protestaktion durch eine „open petition“ ausgesetzt sah, als er die 31 Jahre alte Produktion von Hänsel und Gretel mit über 100 ausverkauften Vorstellungen noch vor seinem Amtsantritt aus dem Programm strich. Vorgeschobene Begründung: das sei Theater, welches er „so nicht aushalte“ (muss er ja auch nicht, denn Theater wird nicht für den Intendanten, sondern fürs Publikum gemacht) und das „keine Qualität“ habe (eine Aussage, die ein sechsstelliges Publikum diskreditiert.) Nun muss er für Wiesbaden erst einmal etwas Besseres finden und einstweilen sein Publikum nach Frankfurt oder Darmstadt schicken.

Gretel (andere Sängerin), Ulrika Strömstedt (Hänsel)
Dort wählte Karsten Wiegand einen mittleren Weg für seine Produktion. Er lässt die Bühne erst einmal ganz leer (Bühnenbild: Bärbl Hohmann) und entkommt so der Notwendigkeit, Hänsel und Gretel und deren soziales Umfeld räumlich zu belegen. Denn alle Kostüme von Alfred Mayerhofer sind aus einer Gegenwart geschöpft, in der es bekanntlich zwar noch Arme gibt, aber keine Besenbinder mehr. Ein Besen dient hier gerade noch als ein auf dem Hexenauftritt vorlaufender Hinweis. Aber zum zweiten Bild deutet er einen Zauberwald an, und im dritten kommt sogar eine Art Knusperhäuschen zum Vorschein. Dann kommt auch das ganze klassische Repertoire mit seinem Märchenspuk zum Tragen: der Ofen, der Schlot, der Hexenritt und die aus den Lebkuchen befreiten Kinder. Dazu auch Blitz und Donner, alles mit einem Schuss Parodie verfremdet.
Das eigentlich Charakteristische der Produktion ist aber, dass die Regie die mitwirkenden und zuschauenden Kinder einlädt, die Geschichte aus ihrer Fantasie entstehen zu lassen und nicht einfach nur schöne Bilder vorsetzt. Denn etwa 50 Kinder und Jugendliche (auch Kinderchor) nehmen schon während des Vorspiels neugierig und vorsichtig von der Bühne Besitz. Gut erzogen, lassen sie ihre Schuhe am Rand der Vorderbühne liegen. Auf die riesige leere Spielfläche wird ein schwarzer Puppenkasten gezogen. Aus diesem holen die Kinder zwei menschengroße Puppen heraus: es sind Hänsel und Gretel leblos in historischer Kleidung mit kurzer Hose bzw. Schürzenkleid und Schleife. Die zuschauenden Kinder können jetzt ihre eigene Fantasie spielen lassen und das kärgliche Bühnengeschehen vervollständigen, bei welchem die Kinder die Puppenkiste zu einem kleinen Puppenspieltheater ausbauen; die Geschichte kann losgehen.

Ulrika Strömstedt Hänsel), KS Katrin Gerstenberger (Hexe)
Das Besenbinderhaus ist die wiederum nackte Vorderbühne vor schwarzem ebenso nacktem Vorhang mit Tür. Bühnenrequisiten werden durch die suggestive Musik und die Darstellungen des Personals ersetzt. Der ziemlich unmotiviert von Gertrud fallen gelassene Milchtopf führt dazu, dass sie die Kinder durch die Tür nach hinten in den Wald zum Erdbeersuchen scheucht. Der Besenbinder tritt aus dem Saal auf; natürlich hat er auch sein „Fläschgen“, später packt er noch zwei handfestere Buddeln aus. Da ist er also doch, der Sozialrealismus! Aber es ist nicht Gertrud, die den Kindern nachstürzt, sondern der Trunkenbold. Die Szene des zweiten Bilds ist vorne und hinten von Vorhängen aus Glitterbändern wie im Revuetheater begrenzt, die den Märchenwald darstellen. Die Personen hinter dem ersten Vorhang sollten allerdings deutlicher sichtbar werden. Zur Nacht fliegt trotz Sandmännchen auch die Hexe schon den Wald. Aber die beiden Geschwister werden durch 14 kleine Engel im Schlaf beschützt, die sie (wo liegt hier der Sinn? - soll das den Kitsch konterkarieren?) mit weißen Lilien bedecken und ihnen eine Totenmaske aufsetzen.

Ulrika Strömstedt Hänsel), KS Katrin Gerstenberger (Hexe), Gretel (andere Sängerin)
Nett wird im Programm erklärt, dass die Kinder jetzt schlafen müssen, weshalb es eine Pause gibt. Nach der Pause zum dritten Bild wird hinter dem hinteren Vorhang erst schemenhaft, dann deutlicher das Knusperhäuschen sichtbar. Es ist ein Erdhaufen oder ein Iglu, mit Lebkuchen bedeckt. Die Drehbühne befördert es nach vorne; nun sieht es aus wie ein überdimensioniertes Biwakzelt, schön rot ausschlagen und vorne offen – wie ein Höllenschlund. Der Ofen ist angeheizt und raucht durch den Schlot. Als Stall wirft die Hexe Hänsel ein Netz über. Bei ihrem Hexenritt ist sie übermotiviert; vor lauter freudiger Erwartung verliert sie den Besen, der dann selbstständig durchs Bühnenbild fegt. Gretel gewinnt gegen die Hexe, der Zauber wird gebannt, und wie in klassischen Inszenierungen werden die entzauberten Kindern aus ihren Lebkuchen in Freiheit gesetzt. Damit sich Ring schließt, wird zum Schluss die große Puppenkiste wieder auf die Bühne geholt. Hierin befinden sich nun der Besenbinder und seine Frau, die ihre Kinder wiederbekommen. Mit viel Bewegung auf der Bühne, klarer Personenführung und einer Reihe von gelungenen Regieeinfällen kann man die Inszenierung als durchaus gelungen bezeichnen.

Kinderchor, Ulrika Strömstedt (Hänsel), Besenbinder (anderer Sänger), Elisabeth Hornung Gertrud), Gretel (andere Sängerin)
Gelungen war auch der musikalische Teil des Abends. Am Pult des Staatsorchesters Darmstadt stand Anna Skrylewa, seit der vergangenen Spielzeit Erste Kapellmeisterin am Staatstheater. Das Dirigat erschien zu Beginn des Vorspiels etwas pastös, aber man merkte bald, was gemeint war: eine leicht romantisierende Unschärfe. Skrylewa fand trotz des etwas schwach besetzten Streicherapparats ein gutes klangliches Gleichgewicht und produzierte mit dem gut aufgelegten Orchester vielfach ein leichtes, zartes Klangbild statt eines schweren spätromantischen Tonfalls. Das Kleinodische der Partitur erfuhr so eine besondere Wertung. Szenisch war der Kinderchor des Staatstheaters Darmstadt wie beschrieben aufgewertet; verstärkt war er noch durch Mitglieder der Darmstädter Singschule, von denen sich ein Mädchen traute, eine Strophe eines Kinderlieds von Gretel im solo zu übernehmen; brava! Ines Kaun und Christian Roß hatten die Chöre einstudiert.
Als Besenbinder Peter war KS Thomas de Vries (bis zur letzten Spielzeit im Ensemble Wiesbaden) eingesprungen, da die parallel besetzten Darmstädter Sänger Oleksandr Prytolyuk und David Pichlmaier beide erkrankt waren. An diesem Tag hatte sich allerdings auch de Vries nach der Vormittagsschulvorstellung als indisponiert ansagen lassen. Man merkte allerdings seinem kraftvollen Bariton, den er nicht zu schonen schien, bestenfalls bei den Spitzentönen eine leichte Schwäche an. Sein Weib Gertrud sang Elisabeth Hornung, die mit deutlich hörbaren Unterschieden in ihren Registern zu tun hatte: in der Bruststimme fast sprechend, in der hohen Lage schwankend, brachte sie nur die Mittelstimme geschmeidig und ausdrucksstark zur Geltung. Für die Rolle der Gretel war Katja Stuber besetzt und gefiel mit ihrem sehr jugendlichen wendigen und hellen Sopran, der in der Höhe schön aufblühte. Den Hänsel hatte Ulrika Strömstedt schon in Weimar 2012 gesungen (sogar schon in der aus Essen übernommenen Vorgängerproduktion von 2003 war sie besetzt). Sie zeigte feines, schön fokussiertes und klares Mezzo-Material und gab sich sehr spielfreudig. Die Darmstädter Grande Dame Kathrin Gerstenberger gestaltete die Hexe stimmlich und darstellerisch begeisternd. Sand- und Taumännchen Esther Dierkes hatte für diese Rollen eine etwas zu schwere und tremolierende Stimme.
Die Aufführung am späten Nachmittag war nur mäßig besucht; aber sie erhielt sehr viel Beifall. Weitere Aufführungen: 23. und 30. November; sowie am 9., 12., 21.,23. und 26. Dezember 2014.
Manfred Langer, 22.11.2014
Fotos: © Candy Welz (Auf den Fotos sind als Gretel Jana Baumeister und als Besenbinder David Pichlmeier aus der Parallelbesetzung zu sehen.)
Doppelt verstörend
MACBETH
Vorstellung am 12.11.2014 (Premiere 27.09.2014)
Ohne Krimi geht die Lady nie ins Bett – eine gescheiterte Ehe
Dass Verdi unter verschiedenen Stoffen für ein neues Opernprojekt am teatro de la pergola in Florenz 1846 gerade den Macbeth aussuchte, soll einen trivialen Grund gehabt haben: an diesem Theater gab es keinen für die klassische Opernliebhaber-Rolle geeigneten ersten Tenor. Diesem Umstand verdankt die Opernliteratur nun eines der ungewöhnlichsten Werke. Eheliche Liebe wird in der Oper nicht ohnehin sehr häufig thematisiert; aber dass die Liebe gar nicht vorkommt und somit auch keine Liebespaar und auch kein Finsterling, der das Zusammenfinden eines Paars hintertreibt, das war dem Publikum 1847 bei der Uraufführung doch neu. Die Oper wurde daher vom Publikum und noch mehr von der Musikkritik zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen. Sie beeindruckte aber allein durch den starken Stoff und setzte sich auch im Ausland bald durch. 1865 erstellte Verdi für die Pariser Opéra eine französische Fassung, die später ins Italienische zurückübertragen wurde und zur Grundlage der meisten heutigen Aufführungen wurde, auch für die in Darmstadt vorgestellte Fassung, allerdings ohne Ballett und mit dem düsteren Schluss der Urfassung.
Die finstere Handlung um Machtgier, Hass und Gewalt weicht völlig von dem ab, was man gegen Ende der Belcanto-Zeit von einer italienischen Oper erwartete. Verstörend wirkt der Stoff sogar bei historisierenden traditionellen Inszenierungen. Das schien aber Viestur Kairish, dem lettische Regisseur, den Ihr Kritiker bislang noch nicht auf seiner Liste hatte, nicht zu genügen, denn er sattelte da noch weitere verstörende (und wenig sinnstiftende) Bilder drauf und mischte das Ganze mit einer Reihe von mehr oder weniger stringenten Einfällen auf, ohne aber dem an sich validen Regieansatz eine klare Entwicklung zu geben. Da die Handlung des vieraktigen Werks sich über einige Monate hinzieht, ist eine Verstetigung der Bebilderung beim Macbeth umso wichtiger, damit das Werk nicht auseinanderfällt. Mit den vielen, teilweise unmotivierten Vorhängen vor allem im ersten Aufzug wird jedoch der Fluss von Handlung und Musik immer wieder aufgehalten (Dramaturgie: Mark Schachtsiek).

Kairish verlegt die Handlung in die Jetztzeit. Die grausamen Kriegshelden Macbeth und Banquo kommen mit Samsonite-Koffern aus einem modernen Krieg nach Hause. Sie gelangen nicht in ein finsteres von Hexen bewohntes schottisches Hochmoor und ein düsteres Burggemäuer, sondern in die moderne Zivilisation zurück. Dort kommen zuerst an einem Geschäft für Brautmoden vorbei. In einem Guckkasten unter den zweideutigen Lettern „TRAU DICH“ ist ein Dutzend hübscher Schaufensterpuppen im Brautkleid ausgestellt. Abrupter Beleuchtungswechsel (auch später arbeitet der Lichtregisseur Dieter Göckel wenig subtil mit plakativem Lichtwechsel) wandelt die Puppen in Hexen um, die mit ihren Prophezeiungen die eigentliche Handlung anschieben. Verwandlung: in den Guckkasten wird von der Seite das Schlafzimmer des Ehepaares MacBeth mit einem schönen Hochzeitsfoto aus glücklichen Zeiten über dem Bett hineingeschoben. Es wird die zweite Intention der Regie deutlich. Es geht um das Eheleben der Macbeths und ihre Kinderlosigkeit. Dieses Thema wird bei vielen Macbeth-Inszenierungen eher unterschwellig behandelt, gewissermaßen als aus der Shakespeare-Vorlage entnommenes Substrat. In der Kairish-Inszenierung wird es aber zum Superstrat und verdrängt mit eigenartigen, auch lächerlich-trivialen Bildern die Macbeth-Erzählung in die zweite Reihe. Was macht denn ein Ehepaar, wenn der Mann aus grausam geführtem Krieg nach Hause zurückkehrt? Nicht das, was man zunächst annehmen möchte: denn die Lady nimmt einen Schmöker mit ins Bett, nachdem sie zuvor mit der Nachttischlampe geschmust hat (Tiefpunkt der Inszenierung!) Kein Wunder, dass es keine Kinder gibt. Doch hier geht es um die zentrale Frage nach den Triebkräften des Ehepaars Macbeth: warum verfolgen die Banquo, Macduff und deren Sippschaft mit Schwert und Dolch, wo sie doch die Königsmacht mangels Masse sowieso nicht in einer eigenen Dynastie übergeben können. Aus Mordlust? Auf diese Frage gibt die Regie keine Antwort, sondern lässt immer wieder neue Kinder auf die Bühne kriechen oder laufen.

Lady Macbeth (andere Sängerin)
Das wandlungsfähige und später noch mehrfach verwandelte Bühnenbild hat Reinis Dzudzillo entworfen. Durch Hochziehen der Zwischenwand wird das kleine miefige Schlafzimmer der Macbeths in einen riesigen Saal verwandelt; das zentrale Ehebett bleibt das gleiche; der große Raum ist für den Empfang des Königs Duncan erforderlich. Vorher zieht noch eine Leichenprozession an der Rampe entlang. Man weiß nicht genau, ob hier der von Duncan besiegte und ermordete Kriegsgegner, der Than von Cawdor, mit verlogener Ehrenbezeigung zu Grabe getragen wird, ob es die Vision der Funeralien des noch zu ermordenden Königs oder gar die Ahnung von Macbeths eigenem Leichenbegängnis ist. Dann kriecht ein Kind auf der Bühne umher, dessen Aussehen zwischen Fötus und Tolkiens Hobbits liegt: im Gesicht gezeichnet wie Macbeth selbst. Der große Schlafzimmersaal dient jetzt als Szenerie für die Ermordung des Königs, aber auch als Park (parco) für die Verfolgung und Ermordung Banquos, eine Szene, der es durch steife Stilisierung völlig an Spannung gebricht). Auch für das große Fest bleibt man bei diesem Bühnenraum, in welchem das zentrale Ehebett, auf welchem erst der ermordete König, später Banquo liegt, mit dem die Lady noch eigene Art Totentanz aufführt, an den Bühnenrändern von gedeckten Tischen des festlichen Diners umgeben wird.

Maksim Aniskin (Macbeth), Katrin Gerstenberger (Lady), Vadim Kravets (Banquo)
Ist bislang durch das Bühnenbild eine gewisse Durchgängigkeit der Inszenierung gegeben, wird dieses Prinzip zur zweiten Hexenszene gebrochen. Nun befindet sich Macbeth im Guckkasten und die Hexen davor. Macbeth gräbt mit bloßen Händen die Erscheinungen aus der schottischen Erde: zuerst einen gefallenen Kriegskameraden und dann ... natürlich zwei Kinder. Das Volk (mit durch Halbmasken verzerrten Gesichtern) bejammert die Schreckensherrschaft des Ehepaars Macbeth auf der wieder groß geöffneten Bühne auf einem hochgefahrenen Heideboden. Aus Erdlöchern könnten jederzeit Tolkiensche Fantasiefiguren kriechen. Stattdessen kommen aber unten an der Rampe zwei wohldefinierte Figuren angekrochen: Macduff als halbnackter Halbmensch und - in einer adretten Uniform - Malcolm. Wald wächst hier nicht; aber das Volk bewaffnet sich mit kleinen Schaufeln und geht anscheinend daran, den Wald von Birnam erst einmal zu pflanzen. Die Erde des schottischen Bodens ist schließlich von der Seite auch ins Schlafzimmer der Macbeths eingedrungen. Dieses versinkt unter den Heideboden unter eine starke Betonplatte. Die Lady, die immer noch in ihrem Roman liest, befindet sich im Wahn; das Erlöschen der flackernden Nachttischlampe kündet von ihrem Ende. Macbeth, der sich an sich durch das neue Orakel in Sicherheit wiegen könnte, wartet in diesem Führerbunker auf sein Ende. Mit blutverschmierten Kinderfiguren das Publikum zu verstören, kann beim Macbeth, der schon verstörend genug ist, nicht die Aufgabe eines aufgeschlossenen Regisseurs sein. Und die Idee, dass MacBeth von einem dieser fötus-ähnlichen Kinder zum Schluss mit einer Spielzeugschaufel getötet wird, richtet nachträglich den gesamten Regieansatz mit dem an sich durchaus vorhanden Potential: Hier wir die fixe Idee des Regisseurs ganz einfach zum werkwidrigen Unsinn. Und alles zusammen wirkte das nicht einmal spannend, sondern nur ermüdend. – Ilse Welter hat das Bühnenpersonal bekleidet: da stehen neben der vornehmen zivilen Hofgesellschaft im Smoking die nicht integrierbaren Uniformierten in schicken olivgrünen Uniformen, der König mit viel Lametta.

Maksim Aniskin (Macbeth); Lady (andere Sängerin)
Musikalisch hatte der Abend wesentlich mehr zu bieten als diese verkorkste Regie. Bei aller Ähnlichkeit zwischen den frühen und mittleren Verdi-Opern haben die doch alle ihre eigene tinta, aber die MacBeth-Partitur outet sich als solche in ihrer Originalität immer schon nach wenigen Takten. Hier leistete der neue Darmstädter GMD Will Humburg mit dem Staatsorchester Darmstadt Vorbildliches und vor allem sehr Nachhaltiges. Humburg arbeitete ein breites nuanciertes ausdrucksstarkes Spektrum aus der Partitur heraus. Das beginnt mit den feinen Holzbläserfiguren der Ouvertüre, wird in Farbmischungen auch mit den Blechbläsern fortgesetzt und mit dem Kitt einer perfekten satten Streichergrundierung zusammengehalten. „Es muss auch mal richtig krachen“ sagt Humburg in einem Interview. Das tat es unter anderem auch, aber den größeren Eindruck hinterließ die in großen Bögen angelegte Dynamik, die für die Partitur typischen (damals modernen) Halbtonschritte und die vielen markanten schreitenden Rhythmen der Partitur. Das Orchester absolvierte die mit fast extremen dramatischen Kontrasten aufgedeckte Partitur durchweg mit Perfektion. Das gleiche konnte man von Chor und Extrachor des Staatstheaters nicht immer sagen. Klanggewalt und -schönheit waren doch einige Male von zu deutlichen Unschärfen durchzogen.

Maksim Aniskin, der Sänger der Titelrolle, war an diesem Abend erkältet angesagt. Man spürte dies vielleicht bei seinen etwas wackligen Höhen, aber vermutlich ist sein an sich sehr kultiviertes nobles Bariton-Material auch an normalen Tagen nicht mit der Durchschlagskraft versehen, die man in dieser Rolle gewöhnt ist. So konnte die Unausgewogenheit in der Kraftentfaltung bei den Duetten gerade mit der Lady auch als seine Unterordnung erklären. Die Lady sieht sich bei ihrer Kavatine einer gewaltigen Auftrittsarie gegenüber. Katrin Gerstenberger meisterte dieses zwar mit einem anfänglichen bei ihr ungewohnten Tremolo, kam aber sehr schnell in die Rolle und sang sie mit Glut und Kraft, nicht dreckig, wie Verdi das gefordert hat, aber mit Ungenauigkeiten bei der Intonation in fordernder Höhe. Der Banquo des Vadim Kravets überzeugte mit seinem sonoren, kraftvollen Bass. Felipe Rojas Velozo präsentierte neben seinem von der Regie erzwungenen jämmerlichen und für ihn unvorteilhaften Auftritt als Macduff kraftvolles bronzenes Tenormaterial. Christopher Kaplan hatte als Malcolm mit seinem helleren klaren glatten Tenor leider nur wenig zu singen, und mit Elisabeth Hornung war die weitere Nebenrolle der Kammerfrau ebenfalls luxuriös besetzt. Die Knabensoprane als Erscheinungen konnten ohnehin keine Wirkung erzielen.
Die Opernkritik, die sich (vielfach hinter vorgehaltener Hand) am Inszenierungsstil der Ära John Dew (vor allem natürlich an dessen eigenem) aufhielt, hat nun in Darmstadt einen „Neuanfang“ in „Anspruch und Qualität“ konstatiert. Das ist eine faire Aufmunterung an die Adresse der neuen, aber gleichzeitig eine unfaire Abwertung der alten Intendanz, die dem Darmstädter Musiktheater in Programmierung und Ausführung eine besondere Ästhetik verliehen hatte und dort für volles Haus gesorgt hatte. Davon war an diesem Abend weniger zu bemerken. In der Pause schnappte man vom Publikum, das das Haus nur mäßig gefüllt hatte, Gesprächsbrocken der Ratlosigkeit auf. Die Lücken in den Sitzreihen des Saals waren nach der Pause noch größer geworden; der Beifall am Ende kaum mehr als höflich. Da muss die Intendanz noch etliche Erziehungsarbeit leisten. Nur der GMD wurde zu Recht etwas euphorischer bedacht. Weitere Vorstellungen des Macbeth kommen am 22.11., 13. und 30.12. sowie am 06. und 20.02.
Manfred Langer, 13.11.2014 Fotos: Martin Sigmund
Luigi Nono / Claudio Monteverdi
ODYSSEE
Premiere am 25.09.2014
Funktioniert die Musik-Klammer über 350 Jahre rückwärts ?
Unter dem Titel ODYSSEE bringt das Staatstheater als erste Premiere der Spielzeit unter dem neuen Intendanten Karsten Wiegand eine Art Doppelabend auf die Bühne: Luigi Nonos „Non hay caminos, hay que caminar“ (Es gibt keine Wege, man muss nur gehen) zusammen mit „Il ritorno d’Ulisse in patria“ von Claudio Monteverdi. Nono als Prolog zu einem 350 Jahre älteren Werk. Was die beiden Komponisten verbindet, ist zunächst äußerlicher Natur: Monteverdi (1567-1643) hat die zweite Hälfte seiner Schaffenszeit als Kapellmeister an San Marco in Venedig verbracht, der Geburts- und Todesstadt von Luigi Nono (1924- 1990). Der räumlich inszenierte Klang von Musikaufführungen wie in einer Kathedrale soll den Werken beider Meister zu eigen sein. Dass aber, wie in der Einführungsveranstaltung vom Dirigenten George Petrou und dem neuen Darmstädter Operndirektor Berthold Schneider betont, sich an diesem Abend die Musik Monteverdis zwanglos aus der Nonos entwickelt, ist nur eine gewagte Behauptung.

George Petrou (Foto: Ilias Sakalak)
Nono und seine Musik haben einen konkreten historischen Bezug zu Darmstadt, da er zur ersten Generation junger Komponisten gehörte, die zu „Internationale Ferienkurse für Neue Musik“ dort gepilgert sind, in denen nach dem Krieg die Neuerer der Musik (auch Stockhausen und Boulez unter der Leitung namhafter Lehrer) die Stagnation der Musikentwicklung in der Nazi-Zeit überwinden wollten. So legendär und viel zitiert diese Aufbruchszeiten noch heute sind, so selten gespielt sind die Stücke der Protagonisten damals und heute, was zum Teil auch an rein technischen Schwierigkeiten liegt. Hier konnte nun das Staatstheater mit seinem räumlichen Arrangement des Doppelabends einen Beitrag zur Nono-Rezepzion leisten. „Non hay caminos, hay que caminar“, Nonos letztes Werk für großes Orchester ist für ein knapp 70-köpfiges Orchester geschrieben, das in sieben Gruppen um das Publikum herum aufgestellt ist. Die größte Einheit bildet eine Gruppe aus etwa dreißig Streichern, die restlichen sechs Gruppen bestehen jeweils aus Streichern mit Bläsern oder Schlagwerk. In einem „gemeinen“ Konzertsaal kann man das schlecht aufführen, schon eher in einer Kathedrale, wenn das Publikum z.B. im Vierungsraum sitzt und für die Musikergruppen die Emporen mitgenutzt werden. Aber, wie in Darmstadt gezeigt, geht es auch auf der Bühne eines großen Theaters, wenn man das Publikum dort in der Mitte Platz nehmen lässt, die Hauptgruppe der Streicher (mit dem Dirigenten) über den Graben setzt und die sechs weiteren Musikergruppen an den Bühnenrändern platziert. In der Mitte steht (und geht) dann das Publikum. Zwanzig Minuten dauert das Stück. Man wird sich schnell bewusst, dass man noch weniger als ruhig sitzen ruhig stehen kann; daher luden die Veranstalter das Publikum, das man durch funktionale Seitengänge auf die Bühne leitete (das war keine Odyssee!), auch auf der Bühne zum Herumgehen ein, caminar eben. Da konnte man mal zu der einen, mal zu der anderen Musikergruppe gehen und schauen. Manche Zuschauer taten das lautlos, andere – vor allem stöckelnde Damen – auch geräuschvoll und trugen somit nicht komponierte Schlagwerk-Laute zum Konzert bei. Eine Dame hatte sich auch die Hochhackigen ausgezogen. Hier wurde das Konzert zum „Event“, denn im Stehen und Gehen kann man den Zusammenhang der Musik nichtwahrnehmen.
Der Orchesterklang ist streichergetragen und spielt sich auf G in verschiedenen Oktaven ab; ein Ton, vom dem nach oben und unten nur in Kleinstintervallen bis hin zur Schwebung abgewichen wurde, teilweise überlagert von Flageolett-Tönen der Violinen, ab- und anschwellend von den Bläsern an verschiedenen Stellen der Peripherie aufgenommen und unterbrochen von teilweise sehr harten Schlägen der Perkussion, die in bewundernswerter Präzision kamen. Sieben Monitore standen den Musikern zur Beachtung des Dirigenten zur Verfügung.

Thomas Mehnert (Tempo)
Nono hat eine „Inszenierung“ seiner Instrumentalmusik per Vermächtnis untersagt: Dieses Verbot wurde nicht durchbrochen, da ja das Publikum inszeniert wurde. Aber schon während der Nono-Musik infiltrierten die Sänger des Monteverdi-Prologs die Bühne: Amore, Fortuna, Fragilità und Tempo gelangten in fast wörtlich zu nehmende Tuchfühlung zum immer noch caminierenden Publikum. Der Dirigent wechselte an den hinteren Bühnenrand zur zweitstärksten Musikergruppe, die sich inzwischen mit Barock- Spezialisten komplettiert hatte. Und los ging die Oper. Bis zur Mitte des ersten Akts traten die Sänger in ihren Kostümen der Menge von über 200 Zuschauern auf. Wie groß doch so eine Bühne ist; kaum kleiner als der Saal. Was sich die Solisten zu so einer Durchmischung gedacht haben, wird sich wohl keiner zu sagen getraut haben. Inszeniert wurde aber zu diesem frühen Teil der Oper nur wenig; die Allegorien wurden mit Zügen teilweise etwas angehoben; dem irdischen Personal öffnete das Publikum bereitwillig die vorgesehenen Schreitwege. Gesanglich konnten sich in dieser Setzung die Sänger auf ein für alle Teilnehmer höchst angenehmes Niveau zurückziehen: sanft, weich und zurückgenommen klangen Ariosi und Deklamationen zu dem wiederum sehr präzise intonierenden Ensemble des Staatsorchesters Darmstadt.

David Pichkmaier (Luisse); Thomas Mehnert (Antinoo); Rudolf Schasching (Iro)
In der Pause wurde umgeräumt. Das Publikum kehrte in der Mitte des ersten Akts, der deutlich eingekürzten Oper auf die Hinterbühne zurück, wo inzwischen Stuhlreihen und Ränge aufgebaut waren, von denen man das szenische Spiel auf der Vorderbühne betrachten konnte, auf der auch das Orchester Platz genommen hatte. Die Sicht auf Saal und Ränge des rot bestuhlten Theatersaals wurde durch Schließen des Eisernen Vorhangs genommen, und dann wurde erst einmal die vor einiger Zeit völlig erneuerte Bühnentechnik des Darmstädter Hauses inszeniert: Züge und Hebepodeste vollführten ein ebenso lautloses wie rasendes Spiel; am Ende stand das Bühnenbild von Philipp Bußmann: eine große nach hinten aufsteigende Treppe aus beige-gelbem Holz. Darauf ließ der Regisseur Jay Scheib nun das weitere Geschehen einfach und verständlich ablaufen. Meentje Nielsen hatte das Bühnenpersonal in überwiegend moderne, unaufregende Kostüme gesteckt; lediglich ein Teil der Allegorien trat antikisiert auf.

Oleksandr Prytolyuk (Anfinomo), Minseok Kim (Telemaco), Vasiliy Khoroshev (Pisandro), Katja Stuber Amor), Anja Bildstein Ericlea), Herrenchor
Die Tragödie, bei der 15 Figuren zu Tode kommen, ist wie viele spätere Barockopern auch von heiteren Elementen durchzogen; die liegen vor allem in der Figur des Vielfraßes Iro, bei dem keiner trauert, dass ihm durch das dramatische Geschehen im wahrsten Sinne des Worts die Nahrungsbasis entzogen wurde. Jay Scheib inszeniert einige weitere Figuren des Geschehens mit aus der Gegenwart gegriffenen menschlichen Schwächen oder „komischen“ Auftritten: der wie ein begossener Pudel an Land kommende Ulisse, der ungezogene Iro, die durchnässten Zigaretten: Menschliches, allzu Menschliches. Wo das Libretto jeweils nur drei Personen vorsieht (Phäaken, Freier) bot die Regie dazu noch einen elf-köpfigen Chor auf, was den entsprechenden Auftritten (die Phäaken in karnevalistisch angehauchten Matrosenkostümen, die Freier gigolomäßig in hellen Anzügen) mehr Nachdruck und Gestaltungsmöglichkeit verlieh. Warum Ulisse als Frau verkleidet wurde, war nicht klar. Seine Penelope trat in antik geschnittenem Schwarz mit Schulterspangen, aber auch in attraktivem, modernem Cocktail-Kleid auf. Telemaco und Eurimaco waren ununterscheidbar auf einen Sänger vereinigt. Alles in allem eine in den Abläufen handwerklich solide Regiearbeit, teilweise Antifiguren in Kleinszenen; es fehlt aber der tragende Überwurf.

Mary-Ellen Nesi (Penelope), David Pichlmaier (Ulisse)
Von den achtzehn Figuren der Oper waren Giove (nur dessen Adler wurde thematisiert) und Eumaios gestrichen; der Rest auf elf Solisten konzentriert, die ihre Sache durchweg gut machten. David Pichlmeier, dessen jugendlicher Erscheinung man die zweimal 10 Jahre des Titelhelden von Ilias und Odyssee nicht ansah, gefiel mit kultiviertem hellem Bariton. Mary-Ellen Nesi als Penelope konnte es sich leisten, im Badeanzug aufzutreten; schlank auch der Ausdruck ihres sauber geführten Mezzo-Soprans. Katja Stuber ließ ihren klaren Sopran in den Rollen von Minerva und Amor leuchten. Jana Baumeisters runder und weich anrechender Sopran überzeugte als Fortuna und Melanto. Mit Minseok Kim mit kraftvollem Tenor war der Telemaco (auch Eurimaco) besetzt; und Andreas Wagner verlieh dem Hirten Eumete seinen sanften Tenor. Rudolf Schasching als Gast brauchte als Vielfraß Iro keinen Bauch umgebunden zu bekommen. Sei enormes Spektrum bewies er in dieser Rolle mit kraftvollem baritonalem Tenor und überzeugendem Schmelz. Das Darmstädter Urgestein Thomas Mehnert war ohne Fehl und Tadel in den als Tempo, Nettuno und Antinoo bis in die sonoren Tiefen seiner gepflegt runden Bassstimme. Dem weiteren Freier Anfinomo verlieh Oleksandr Prytolyuk mit seiner kräftigen Baritonstimme ordentliches stimmliches Profil. Vasily Khoroshew als Pisando konnte sich manchmal nicht für das Register entscheiden und fiel Falsett ins natürliche tenor-Register und umgekehrt. Die beiden letztgenannten Sänger gaben auch die Rollen der Phäaken. Anja Bildstein rundete als Ericlea und l’humana fragilità mit feinem, schlanken Mezzosopran das positive Bild der Solisten ab.

Minseok Kim (Telemaco), Oleksandr Prytolyuk (Anfinomo), David Pichlmaier (Ulisses)
Mit George Petrou leitete ein ausgewiesener Barock-Spezialist (Schwerpunkt auch bei Giovanni Simone Mayr) das um Originalinstrumente ergänzte Ensemble des Staatsorchesters Darmstadt. Sauber und präzise wurde ein federnder Monteverdi mit schönen Klangmischungen von Streichern, Zupfinstrumenten und Holzbläsern musiziert. Beim Herrenchor (Einstudierung Joachim Enders) passte indes nicht immer alles zusammen.
Fazit: Karsten Weigand erlaubte sich zum Beginn seiner Spielzeit einen ebenso personal-aufwändigen wie ausstattungseinfachen Abend (nächste Vorstellungen am 28.09., 03., 09. & 10.10., dann noch sechs weitere Male bis zum 17.12.), dessen durchaus interessante Setzung mit Neigung zu Event und Theaterspaß künstlerisch von eher durchwachsenem Wert ist, weil in dieser Kombination an sich kein Mehrwert liegt. Die Vermischung von „Non hay caminos, hay que caminar“ mit dem Publikum bleibt akustisch grenzwertig, und der Zusammenhang mit Monteverdi bleibt auch deswegen unbewiesen, weil der größte Teil der Oper, wenn auch an ungewohntem Ort, aber letztlich konventionell aufgeführt wurde. Bei Doppelabenden werden ja heute alles (Un)Mögliche kombiniert; aber da wird thematisch und dramaturgisch zu recht zwischen den Stücken getrennt.
Manfred Langer, 26.09.2014 Fotos: Thomas Jauk
Glänzend bebildert
IL TRITTICO
Premiere am 01.06.2014
John Dews gefeierte Abschiedsinszenierung am Staatstheater in Darmstadt
In der Opernliteratur gab es schon vor Puccini berühmte Triptychen: das der drei Mozart-da-Ponte-Opern oder die drei romantischen Opern von Richard Wagner. Diese stehen jeweils in einem inhaltlich bzw. stilistisch engen Zusammenhang. Gerade das ist bei Puccinis Triptychon nicht der Fall. Ursprünglich wollte er das anders und hatte vor, aus den drei Teilen Dantes „divina commedia“, nämlich aus „inferno“, „purgatorio“ und „paradiso“ je einen Stoff zu nehmen und daraus einen dreiteiligen Opernabend zu machen. Es kam aber schließlich zu einer ganz anderen Zusammenstellung des dreiteiligen Abends: ein echter veristischer Einakter mit „Il tabarro“ (Der Mantel), dem Seelendrama „Suor Angelica“ (Schwester Angelika) und der Komödie „Gianni Schicchi“, letztere dann tatsächlich aus Dantes inferno übernommen. Nun, wenn man vorher wie vorgesehen zuerst den Mantel und die Schwester Angelika gesehen hat, dann fühlt man sich allerdings beim Gianni Schicchi wie in einer göttlich geistreichen Komödie und gar nicht wie in der Hölle. Dahin ist bekanntlich nur der Titelheld gekommen; aber davon später.
Puccini hat gewünscht, die drei Stücke an einem Abend zu spielen. Das wird auch - wie nun gerade in Darmstadt – hier und da gemacht, obwohl der Abend dann mit zwei adäquaten Pausen auf gut vier Stunden kommt. Daher kommt es heute viel häufiger vor, dass man das Trittico als Steinbruch benutzt und daraus eine Oper herausbricht, um sie mit einem anderen Einakter zu einem bequem abendfüllenden Programm zu kombinieren. Zu solchen Kombinationen eignen sich im Besonderen der Mantel und Gianni Schicchi; die Kombinationen, die da herauskommen, können ganz verwegen sein. Die verwegenste Kombination hat aber 2011 die Wiener Volksoper gebracht; sie hat einen Einakter des Trittico mit einem anderen daraus kombiniert (Il tabarro mit Gianni Schicchi) mit der fadenscheinigen Ausrede, man könne den Zuschauern die ganze Länge des Trittico nicht mehr zumuten. (Wenn man in Wien sieht, wie die Zuschauer nach den Opernaufführungen gleich aufspringen und zu ihrer Tram rennen, dann könnte man das fast glauben.) Natürlich ist es dann opportun, die Kitsch-verdächtige Schwester Angelika herauszunehmen.

Il tabarro: Anja Vincken (Giorgetta); Joel Montero (Luigi); Thomas Mehrnert (Talpa)
John Dew hat in seiner zehnjährigen Darmstädter Intendantenzeit fast die Hälfte aller Operninszenierungen im Großen Haus selbst gemacht (an 31 davon hat sich Ihr Kritiker delektieren können). Sie sind alle nach seinem neuen Credo als Regie-Paulus entstanden und haben ihm stets ein gut gefülltes Haus und trotz der eher konventionellen Regie-Handschrift mehr junges Publikum gebracht. Nun legte Dew mit dem Trittico seine Abschiedsinszenierung vor, und – das lässt sich nicht anders sagen – das Publikum lag ihm zu Füßen, obwohl er zum Schluss ganz unverblümt nach Kompliemneten gefischt hatte. Dew bringt einen ganz konventionellen „Mantel“, entgeht dann den Untiefen der „Suor Angelica“ durch eine stilisierte Darbietung von ganz besonderer Ästhetik und Bewegung und schließt mit einem originell-spritzigen Gianni Schicchi. Seine in Dutzenden gemeinsamer Opernarbeiten bewährten Kollegen Heinz Balthes (Bühnenbild) und José-Manuel Vázquez (Kostüme) sorgen für die Ausstattung.

Il tabarro: Anja Vincken (Giorgetta); Tito You (Michele)
Mit großem Realismus und mit Liebe zum Detail hat Balthes für IL TABARRO (Libretto von Giuseppe Adami nach „La Houppelande“ von Didier Gold) einen Lastkahn mit Kajüte, Steuerkabine und Ladeluken gebaut und hat ihn optisch sehr wirksam unter einem sich nach hinten senkenden Korbbogen einer Brücke vertäut. Auf dessen schönem Quadermauerwerk Mauerwerk wird das Spiel der Wellen der Seine reflektiert und der Übergang vom Spätnachmittag in die Nacht beleuchtet. Die Kostüme sind im Stil der Nachkriegszeit gehalten. In dieser Bebilderung lässt Dew das Geschehen der Oper etwas statuarisch ablaufen, wobei aber die Struktur des Werks gut herausgearbeitet ist. Alle Protagonisten der Oper sehnen sich aus ihrer derzeitigen Situation heraus; nur der Schiffseigner Michele als guter Chef nimmt seine Rolle an, wäre da nur nicht die erkaltete Liebe zu seiner Frau Giorgetta, die ihn in Melancholie einschließt. Der erste Teil der Oper ist ein Sozialtableau, aus dem sich im zweiten Teil die Dreiergeschichte heraushebt, welche zu dem grausigen Eifersuchtsmord führt. Mit Tito You als Michele war ein stimmstarker Bassbariton mit klarer Diktion und sauberer Stimmführung besetzt. Joel Montero ließ seinen bronzen fundierten Tenor als Luigi in der Höhe kraftvoll strahlen, und Anja Vincken gefiel mit ihrer Bühnenerscheinung und mit ihrem schön eingedunkelten, ausdrucksstarken Sopran als Giorgetta. Sehr gut besetzt auch die kleineren Rollen: Gundula Hintz als Frugola mit samtig-rundem Mezzo, Peter Koppelmanns frischer präsenter Tenor als Tinca und Thomas Mehnerts ruhig strömender Bass als Talpa.

SUOR ANGELICA (Libretto Giovacchino Forzano) spielt auf einer nackten schwarzen Bühne. Unter einem barocken Riesenmedaillon, das wohl die Verkündigung Mariens darstellt, tummeln sich die Schwestern in weißen Kostümen. Eine Glanztat von Dews Bebilderung ist, wie er den unbestreitbaren Anflug von Kitsch in dieser Oper durch eine überwältigende Ästhetik überspielt und die strahlend weiße Gruppe der Schwestern im schwarzen Raum wechselnd gruppiert und bewegt. Da sitzen die Schwestern einmal in belanglosem Geschnatter wie die Hühner auf der Stange und wogen dann als Gruppe über die Bühne. Die Verkündigungsszene durch zia principessa (die Äbtissin passt auf – den Rücken zu den beiden anderen gewandt) gelingt in eisiger Erstarrung – physisch und psychisch. Durch Kürzungen der Oper hat John Dew das Stück gerade auf diese entscheidende Szene fokussiert. Unter dem sich golden färbenden Medaillon nimmt sich die verzweifelte Schwester Angelika mit einem Gifttrunk das Leben. Wie Susanne Serfling diese Szene spielt und singt ist letztlich das nachhaltige Erlebnis des Abends. Seelisch gebrochen, verzweifelt und vereinsamt verinnerlicht sie diese Rolle und verleiht ihr stimmlich mit ihrem weich ansprechenden, ausdrucksstarken und leuchtkräftigen Sopran erschütternde Glaubwürdigkeit. Das ist Kunst, kein Kitsch. Yanyu Guo in modernen Pelz gekleidet mit erdigem, klaren Alt als eiskalte, herzlose Fürstin und Elisabeth Hornung als Äbtissin – streng wie ihr Alt – heben sich aus den ebenfalls gut besetzten kleineren Partien der „Nebenschwestern“ und dem gut einstudierten und zart intonierenden Frauenchor (André Weiss) ab.

Suor Angelica: Yanyu Guo (zia principessa); Susanne Serfling (suor Angelica)
In GIANNI SCHICCHI (Libretto Giovacchino Forzano) wird das Zeitrad weiter in die Renaissance zurückgedreht; aber nur augenzwinkernd. Das Himmelbett, in welchem gerade der Buoso Donati verstorben ist, steht in einem bis oben holzvertäfelten Bibliotheksraum, dessen Wände nach hinten zulaufen, aber eine breite Lücke lassen, die mit einem ganz modernen Vorhang geschlossen ist. Buosos vermeintliche Erbengemeinschaft ist in grellbunte verzerrte und sehr vielfältig gestaltete Renaissance-Kostüme gekleidet; ihr sind lang Pappnasen angeklebt: Lügner-Nasen. Turbulenz und Slapstick beherrschen die bunte Szene. Alle spielen schön und lebhaft mit. Nur Gianni Schicchi verbleibt in ruhiger Pose, wenn er die Szene regiert. Das kommt sicher dem schauspielerischen Naturell von Tito You entgegen, der aber stimmlich einen prächtigen dunklen Gianni Schicchi abgibt. Arturo Martín bewältigt bei allem schauspielerischen Einsatz die Tenorrolle des Rinuccio nur mit Mühe. Ganz anders als Aki Hashimoto, die für die mädchenhafte Lauretta die ideale Figur mitbringt und mit ihrem glockenhellen Sopran ein traumhaft jugendliches und zartes „O mio babbino caro“ gestaltet (Szenenapplaus).

Gianni Schicchi: Tito You (Gianni Schicchi); Ensemble
Wieder einmal war es in Darmstadt auch das konzentriert aufspielende Staatsorchester unter Martin Lukas Meister, das im Graben den Grund für einen erfolgreichen Abend bereitete. Bei allen drei Teilen des Abends traf es den richtigen Ton und mischte die richtigen Farben: den schwermütigen veristischen Duktus im Tabarro durchsetzt mit lautmalerischem Impressionismus, die kammermusikalisch feine Ausdeutung der Suor Angelica mit sehr modern wirkenden Passagen in der Partitur und die frech turbulente Musik für den Gianni Schicchi. Meister gestaltete sehr plastisch, dirigierte auch bei den klanglich üppigen Stellen stets sängerfreundlich und scheute sich nicht, bei Puccinis durchaus auf Effekt gesetzte Partitur den Intentionen des Komponisten zu folgen und die Emotion bis an die Grenze des Süßlichen zu bringen (Suor Angelica).

Gianni Schicchi: Oleksandr Prytolyuk (Marco), Aki Hashimoto (Lauretta), Arturo Martín (Rinuccio)
Zum Schluss des Gianni Schicchi wird der hintere Vorhang zur Seite gezogen, es werden die architektonischen Kostbarkeiten von Florenz und die berühmten Statuen (z.B. der Perseus von Benvenuto Cellini) sichtbar. Will sagen: Flozenz ist einelebenswerte Stadt; die heuchlerischen Erben des Buoso Donati können den Betrug nicht anzeigen, da sie sonst als Mittäter der Stadt verwiesen („addio Firenze!“) würden und dazu noch die rechte Hand abgehackt bekämen. Da kam zu den letzten Takten der scheidende Intendant auf die Bühne gelaufen und gebot dem Spiel ein Ende. Er, der John, möchte an dem Beifall teilhaben, den sein Namensvetter Gianni am Ende der Oper vor seinem Sturz in die Hölle (wegen Testamentsfälschung) noch mitnehmen will (wenn das Stück denn gefallen habe) und sprach - fast zu Tränen gerührt – kurz von den Höhen und (Höllen)tiefen seiner zehnjährigen Intendantenschaft in Darmstadt. Sicher geschah das nicht ohne Selbstgefälligkeit; aber etliche Umarmungen mit seinem Personal zeigten, dass die Rührung gegenseitig war. Zudem war es genau am Tage seines 70. Geburtstags, an welchem er sich mit dieser sehr gelungenen und zum Schluss auch viel bejubelten Premiere von seinem Darmstädter Publikum verabschiedete. Dazu gab es auch noch eine Torte. Das Trittico gibt es in Darmstadt in dieser Spielzeit noch sieben Mal bis zum 11. Juli; nächste Termine: 7. und 13.6.2014. John Dew wird woanders wieder inszenieren; zuerst La Cage aux folles am Theater Bonn. Die Katze lässt das Mausen nicht...
Manfred Langer, 04.06.2014 Fotos: Barbara Aumüller
Konsistent bebildert
PARSIFAL
Vorstellung am 13.04.2014 (Premiere am 10.02.2008)
Kunst anstelle von Religionslehre - ein anregendes Bilderbuch

Im Wagnerjahr plus eins kommt in Darmstadt nun der Parsifal in der Inszenierung von John Dew in der dritten Wiederaufnahme des seit der Premiere 2008. Legion ist schon inzwischen schon wieder die Zahl der seither vorgestellten Neu- und Umdeutungen, Veränderungen und Dekonstruktionen, die dieses sehr belastungsfähige Werk erfahren hat und gegen die sich Dew’s Parsifal-Bebilderung behauptet, die er mit viel Fantasie und schönen Einfällen einfach und verständlich erzählt und zwar ohne sie irgendwo zu verbiegen. Er setzt dabei das Bühnenweihspiel visuell in den Kontext zu dem, was Wagner in seinem Werk an Einflüssen verarbeitet hat. Als Zutaten hat John Dew, wie er im Programmheft schreibt, eigenes frühes Erleben des Werks berücksichtigt. Um es vorweg zu resümieren, das ist mit ansprechender Ästhetik angelegt, durchweg stimmig, erfrischend und nie verkopft.
John Dews zig-fach bewährtes Ausstatterteam (Kostüme: José-Manues Vásquez; Bühne: Heinz Balthes) unterstützte die Produktion mit einem zurückgenommenen Bühnenbild und eher schlichten Kostümen, die - wo sinnvoll - einen Bezug zur Entstehungszeit des Werks herstellen. Die klare Struktur der Oper findet man im Bühnenbild wieder. Also kein Einheitsbühnenbild (z. B. auf Müllhalden, Hinterhöfen oder Turnhallen), sondern etwas zurückgenommen, abstrakt und mit einiger Symbolik.

Das erste Bild des ersten Aufzugs spielt auf einer breiten, einfachen Bühne; vorne sind in jugendstilmäßig verschlungen Großbuchstaben die Namen von vier Kirchenlehrern Altar-ähnlich aufgebaut (Augustinus, Hieronymus, Gregorius und Ambrosius), dahinter eine große Schultafel, aufgeschlagen in Form eines Triptychons: der Gralsmythos ist dort mit bunten Kreidezeichnungen skizziert. Gurnemanz erteilt den Knappen und den Gralsrittern Unterricht in Religions- und Gralsgeschichte. Zur Verwandlung werden Altar und Tafel versenkt; ein großes Kruzifix senkt sich waagerecht über die Bühne, und ganz langsam wird von hinten die Gralsszene hereingefahren; 20 Speere mit leuchtenden Schaften und Spitzen kreisen das Heiligtum ein. Nach der Zeremonie fährt die heilige Stätte wieder nach hinten; Gurnemanz verabschiedet Parsifal auf der leeren Bühne, über welche der Gekreuzigte wacht.

Im zweiten Aufzug besteht der Altar der Kirchenlehrer nun aus den Namen berühmter Kirchen- und Religionskritiker: die Großbuchstaben für Voltaire, Nietzsche, Marx und Spinoza bilden eine Art Chorlettner. Dahinter befindet sich ein riesiges aufgeschlagenes Buch, wohl mit dem in Fraktur gesetzten Parzival-Epos. Statt des Gekreuzigten über der Bühne wird eine sich ums Kreuz ringelnde Monsterschlange mit weit aufgerissenem Maul sichtbar. Klingsor beschwört Kundry, die sich in einem Kleid aus dem Buch herausschält, auf welchem die gleiche Geschichte aufgedruckt ist wie auf dem Buch. Die Gestalt von Klingsor könnte dem jungen Nietzsche nachempfunden sein. In diesem Kontrastprogramm des zweiten Aufzugs geht es also nicht mehr um Kirche und Religion, sondern viel breiter um Philosophie. Aber der Lettner dient auch den neckischen Blumenmädchen (ebenfalls in wortreich bedruckter Kleidung) zu ihren Spielchen mit Parsifal. Zum großen Duett Parsifal-Kundry verschwindet alles andere in der Versenkung; die beiden bleiben mit ein par Kissen allein auf der Bühne, in der auch Klingsor versinkt, nachdem er seinen Speer vergeblich gen Parsifal geschleudert hat.

Der dritte Aufzug beginnt auf freiem, verschneitem Feld. Die Strahlen der Sonne spielen zur Karfreitagsmusik mit dem Wellenschlag des heiligen Quells und tauen zum höchsten Feiertag den Schnee auf. Sehr zurückgenommen sind die kultischen Handlungen zwischen Gurnemanz, Kundry und Parsifal. Kundry befreit Parsifal aus seiner schwarzen Rüstung; heraus kommt ein Mann in dunklem, einfachen Jetztzeitanzug: der neue König der Gralsritter ohne Pomp und Ornat. Die Verwandlung wird diesmal hinter geschlossenem Vorhang vorgenommen. Wie John Dew die Oper liest zeigt er nach der Gralszeremonie und den vollbrachten Erlösungen: "Da wo die Religion künstlich wird, ist es der Kunst vorbehalten, den Kern der Religion zu retten (Richard Wagner)" steht auf einem Vorhang, der vor die letzte Szene gezogen wird. Der Mann im einfachen dunklen Anzug, der neue Gralskönig ohne Pomp und Ornat, ist das der Künstler, die die Religion mit seiner Kunst rettet?

John Dews Inszenierung zeigt eine wohlstrukturierte Sicht auf Wagners „Parsifal“: zurückgenommen und vornehm in der Ästhetik, eine Bebilderung frei von allem Umdeutungsmüll. Auch die Personenführung ist zurückgenommen, teilweise statisch – passend zur “langsamsten Oper“ aller Zeiten. Die Bewegung der großen Chöre wirkt klassisch gemessen, aber nie oratorienhaft steif.
Martin Lukas Meister am Pult des Staatsorchesters Darmstadt wählte für das Vorspiel ein recht gemessenes Tempo mit prononcierten Generalpausen und blieb auch beim ersten Aufzug in im Tempo sehr verhalten, was manchmal zu Längen führte. Die Musik zum zweiten Akt wurde mit sehr intensiven Färbungen zwischen den Wallungen der Streicher und den Holzbläsern dargeboten. Im dritten Aufzug gefiel die weihevoll getragene Musik mit ihren langen Bögen und schön herausgearbeiteten Crescendi. Kleinere Ungenauigkeiten bleiben im Graben bei einem Werk von über vier Stunden reiner Spielzeit nicht aus; aber insgesamt konnte sich die konzentrierte Leistung des gut disponierten Darmstädter Orchesters durchaus Parsifal-würdig hören lassen. Auch beim Chor gab es zunächst ein paar Unschärfen; aber als sich die Nervosität gelegt hatte, brachten sich Chor und Extrachor (Einstudierung: Markus Baisch) sehr klangschön und präzise zu Gehör.

Unter den Solisten war Dimitry Ivashchenko als Gurnemanz die beherrschende Gestalt: einfach grandios die Bewältigung seiner Riesenrolle im ersten Aufzug; mit kaum zu übertreffender sprachlicher Klarheit und akzentfrei ließ er seinen Bass strömen; ein wirklicher Hörgenuss, zu welchem sich mit seiner schlanken, hochgewachsenen Gestalt auch noch der visuell optimale Eindruck gesellte. Überwältigend auch wieder Katrin Gerstenberger als Kundry mit ihrem samtig ansprechenden Mezzo, ihrer warmen Mittellage, differenzierter Farbgebung und den klaren Höhen ohne Schärfe sowie ihrer Innigkeit im Ausdruck, mit der sie noch deutlich mehr als mit ihrer Dramatik zu überzeugen wusste. Zurab Zurabishvili, wie Ivashchenko ehemaliges Ensemblemitglied am Darmstädter Haus, war als Parsifal im Rollendebut besetzt und sang ihn mit feinem, leicht eingedunkeltem Tenor von bronzenem Schmelz mit leuchtenden kräftigen Höhen; auch von seiner eher mediterranen Bühnenerscheinung der "etwas andere Parsifal"; etwas mehr Durchschlagskraft hätte man sich im Parlando gewünscht. Obwohl seine Tessitura etwas zu tief für den Amfortas liegt, gestaltete Ralf Lukas, der in Darmstadt schon mit vielen großen Wagner-Partien überzeugt hat, diese Rolle gesanglich ebenso kraftvoll wie geschmeidig, kultiviert und einfühlsam. Gut kontrastierte Gerd Vogel dazu als Klingsor mit seinem etwas raueren, dunklen Material. Hubert Bischof gab als Titurel verlässlich kurze Kostproben seines Könnens aus dem Off, teilweise verstärkt. Die Blumenmädchen Aki Hashimoto, Susanne Serfling, Maria Victoria Jorge Hernandíz, Catalina Bertucci, Anja Vincken und Erica Brookhyser fanden zu einem darstellerisch wie gesanglich bezaubernden Doppelterzett zusammen.

Großer Beifall zum Schluss der Oper aus dem gute besuchten Haus, dessen Publikum der Veranstaltung hochkonzentriert gefolgt war. Der scheidende Darmstädter Intendant unterbrach den Applaus und wandte sich an sein Publikum wandte. Bei den beiden Gäste des Abends Katrin Gerstenberg und Dimitry Ivashchenko, die früher einmal Mitglieder des Darmstädter Ensembles gewesen waren, bedankte er sich für deren Rückkehr ans Haus und überließ dann einem Vertreter der Landesregierung aus Wiesbaden die Stätte: Katrin Gerstenberger und Hubert Bischof wurde jeweils der Ehrentitel als Kammersänger des Landes Hessen verliehen, den es seit kurzem auch in diesem Bundesland gibt, für ihre gesanglichen Leistungen und ihre Verdienste ums Staatstheater. --- Die Derniere des Dewschen Parsifal findet am Karfreitag, 18.04.14. statt. Es gibt noch Karten. Mit Preisen zwischen 11,50 und 39,00 EUR für die mit Pausen knapp sechsstündige Veranstaltung ist das Staatstheater im Preisleistungsverhältnis in Deutschland ungeschlagen.
Manfred Langer, 14.04.2014
Die Bilder von der Premiere stammen von Barbara Aumüller
Susanne Serfling entschädigt
OTELLO
Premiere am 15.03.14
Wenig Neues aus Zypern – Otello ohne Salz und Pfeffer
„Vorrei e non vorrei“ singt Zerlina in Mozarts Don Giovanni. Das gleich mag sich Giuseppe Verdi gedacht haben, als er von seinem Verleger Ricordi nach seiner „letzten“ Oper Aida immer wieder gedrängt wurde, sich noch einmal eines Librettos zur Vertonung anzunehmen. Mit Arrigo Boito kam zudem ein neuer Librettist ins Spiel, dessen Anwürfe aus der scapigliatura gegen die italienische Musiktradition Verdi einst verletzt hatten. Auf Betreiben Ricordis wartete Boito für Verdi mit seiner vieraktigen Adaptation von Shakespeares Othello auf. „Soll ich, oder soll ich nicht?“, die Frage mag Verdi wohl schon für sich entschieden haben, denn aus Gefallen an dem Stoff kaufte er Boito schon einmal das Libretto ab. Aber dennoch: man versuchte sich erst an der gemeinsamen Überarbeitung von Verdis früher durchgefallenem Simone Boccanegra, der nun zu einem durchschlagenden Erfolg wurde, ehe Verdi in enger Kooperation mit dem Librettisten die Oper komponierte, die nach der UA an der Scala 1886 zu einem der Jahrhunderterfolge der Opernliteratur wurde. Verdi hätte es wohl nicht nötig gehabt, für die erste Aufführung an der opéra 1894 für eine „Pariser Fassung“ ein Ballett für den dritten Akt nachzukomponieren; so etwas hatte ein anderer 33 Jahre zuvor auch machen müssen: Geld regiert eben auch die (Kunst)Welt...

Joel Montero (Otello), Enrico Marrucci (Jago)
Gerhard Hess stellt nun am Staatstheater eine recht konventionelle Lesart des Werks zur Diskussion und konzentriert sich dabei auf die drei Hauptdarsteller. Da ist alles, wie man es nach Kenntnis des Librettos (oder zumindest der Zusammenfassung) erwartet. Man findet weder „Neudeutungs“ansätze noch werden Nebenaspekte hinzugefügt oder herausgehoben. Dabei bleibt vieles leider auch im Beliebigen. Die Handlung spielt irgendwo im Mittelmeerraum (vielleicht auch auf Zypern) nicht weit vor der Jetztzeit. Natürlich kann man einen Otello so machen. Matthias Nebel hat als Einheitsbühnenbild einen für die vier Akte nur jeweils sparsam möblierten Raum entworfen, in welchem Reihen großer Pfeiler, die keine Dach- oder Deckenkonstruktion mehr tragen, in diagonaler Reihe auf der Bühne stehen. Einer war schon umgefallen; zwei weitere erwischt es bei den ersten Takten („Ouvertüre“ genannt) der Oper, als sie in Gewitter und fernem Kanonendonner krachend umstürzen. Um die stehen gebliebenen und liegenden Konstruktionselemente baut der Regisseur seine unspektakuläre Personen- und Bewegungsregie auf, welche die letzte Überzeugungskraft meistens schuldig bleibt. Die Soldateska haben die Kostümbildner Matthias Nebel und Charlotte Pistorius in weiße Uniformen mit unterschiedlichen Rangabzeichen, schwarze Schaftstiefel und Gürtel mit Koppelschloss und Pistolentasche gekleidet; das weibliche Volk in volkstümliche pastoral anmutende lange Kleidung. Für Lodovico wird immerhin ein großer roter Teppich ausgerollt. Dieser Bühnenansatz missachtet leider eines der ganz wesentlichen szenischen Bauprinzipien der Oper, den sich über die vier Akte verengenden Raum bis zur finalen Todesszene: erst das weite Hafengelände mit Meer, dann der großen Burghof, weiters den Repräsentationssaal und schließlich das Schlafgemach. Diese geniale äußere Anlage der Oper von den Massenszenen zu Beginn bis zum erschütternden Ende des hohen Paares wird übrigens vielfach außer Acht gelassen.

Joel Montero (Otello), Susanne Serfling (Desdemona)
Auch die Musik ist in groben Zügen so angelegt: von Lärm und Getümmel im Großen wird sie immer mehr verinnerlicht, während Jago die Eifersucht in Otellos Inneres sät und mit kaum fassbarer Infamie bis zur Katastrophe nährt. Die Darstellung dieser Entwicklung gelingt in de Inszenierung gut. Ein heute zum Klischee gewordenes Inszenierungselement, nämlich die unterklassige Herkunft Otellos und sein daraus resultierender Minderwertigkeitskomplex (auch weil er farbig ist?) kommt nur ganz am Rande vor, nämlich im Text („presto in uggia verranno i foschi baci di quel selvaggio dalle gonfie labbra“ „bald überdrüssig wird sie sein der finsteren Küsse des schwarzen Wilden mit den wulstigen Lippen“ sagt Jago zu Rodrigo, um ihm die Hoffnung auf Desdemona zu lassen.) Otello wird vielmehr zunächst als rundlicher selbstgefälliger, eitler Latino gezeigt, dessen etwas dümmlicher Stolz leicht angreifbar ist. Dass er bis in die Handwurzeln und die Halskrause dunkel eingeschminkt ist, wirkt heute eher belustigend, zumal der ohnehin dunkle Teint des mexikanischen Darstellers Joel Montero den Farbansprüchen an einen Mauren durchaus genügt hätte. Desdemona als blondes opferwilliges Dummchen darzustellen, ist hingegen ein altes Klischee in Otello-Inszenierungen. Ihr Auftreten im zweiten Akt wie eine Heiligenfigur in einem Lichtkegel auf ansonsten dunkler Bühne wirkt unmotiviert, macht sie aus diesem „Engel“ doch keine unverletzliche abgehobene Person. Noch ein zweites Mal fällt die Lichtregie aus dem Rahmen, nämlich bei der gespenstisch wirkenden Beleuchtung der Chorszene im dritten Akt, als Desdemona und Otello vor den fratzenhaften Zuschauern herausgeleuchtet werden.
Während Wagners Opernszenen quasi in Echtzeit ablaufen, lassen Boito und Verdi die Oper zunächst im Zeitraffer abspielen. Nicht eine Minuten nach krachender Seeschlacht im Gewitter vor der Küste kommt Otello schon wie geleckt als strahlender Sieger die Treppe vom Schloss zum Hafen herunter. Wohl kaum jemand kann so schnell betrunken werden wie Cassio nach zwei gereichten Weinbechern (selbst ein Enzymdefekt könnte das nicht erklären!). Zum Schluss wird dieses Prinzip verlassen: Desdemona ist (definitiv?) erwürgt, kann aber doch wieder an der Konversation teilnehmen; sie ist also gar nicht tot. Otello ersticht sich librettokonform; hier hätte der Regisseur mit größerer Logik Otellos Pistole instrumentalisieren sollen. Aber auch so ist der Weg vom ruhmreich auftretenden Otello vom anfänglichen „esultate“ bis zum stillen traurigen Ende des am Boden liegenden Löwen von Venedig als unentrinnbar dargestellt.

Susanne Serfling (Desdemona), Joel Montero (Otello), Enrico Marrucci (Jago), Chor
„Die Dirigentin Anna Skryleva ist seit Beginn der Spielzeit 2013/14 1. Kapellmeisterin und Stellvertreterin des Generalmusikdirektors am Staatstheater Darmstadt. Ausschlaggebend für dieses Engagement war ein erfolgreiches „Salome“-Dirigat im Juni 2013.“ so schreibt sie selbst auf Ihrer Netz-Seite und bestritt nun ihre erste Premiere in Darmstadt. Mit äußerster schriller Wucht lässt sie die das Staatsorchester Darmstadt die einleitende Kampf- und Gewittermusik spielen; die Tempi sind zunächst ehrgeizig; Chor und Extrachor (Einstudierung: Markus Baisch) und Orchester kommen gerade eben zusammen. Auch weiterhin gefällt Skrylewa die dynamische Hervorhebung dissonanten Passagen vor allem in den beiden ersten Akten. Im Verlauf nahm sie die Gestaltung kraftstrotzender Effekte zugunsten zarterer Striche zurück und bewies mit feinem Sinn für das Melos, dass sie mit dem Staatsorchester auch die zunehmenden, der Desdemona zugeordneten Lyrismen eindringlich gestalten kann. Die motivisch dominierte Musik des vierten Akts zum Weide-Lied und zum Ave Maria mit ihren pastellfarbenen Holzbläseruntermalungen und den für Verdi ungewohnten harmonischen Rückungen lässt sie unter die Haut gehen, ebenso wie die dezenten Streicherlinien und höchsten Violintöne, mit denen das Ave Maria ausklingt. Eine makellose, konzentrierte Leistung des Staatsorchesters.

Susanne Serfling (Desdemona), Erica Brookhyser (Emilia)
Mit drei bis vier Hauptdarstellern ist das Personentableau dieser Oper fast beängstigend einfach. Die Besetzung des Otello mit Joel Montero konnte leider den Erwartungen an diese Rolle nicht gerecht werden. Schon beim esultate, einem zugegebenermaßen höchst fordernden Auftrittsgesang, war Montero hörbar am Anschlag. Den hohen Passagen fehlt es an Glanz und Kraft, den mittleren zuweilen an stimmlicher Festigkeit. Schauspielerisch war da zudem zu viel (italienische) Einheitsgestik zu beobachten. Im Liebesduett des ersten Akts sang und schaute er glatt an Desdemona vorbei. Aber immerhin konnte er mit der zunehmend sich cholerisch äußernden Eifersucht in etlichen Ausbrüchen punkten. Dem Jago des Gastbaritons Enrico Marrucci gelang die stimmliche Darstellung des Fieslings weniger durch die Schwärze seiner Stimme als durch sein Darstellungsvermögen: eine eher schmächtige Figur als trockener, unangenehmer Schleicher, teuflisch omnipräsent. Dazu eine unsympathisch wirkende kalte Schärfe seines ansonsten kräftigen, wendigen, geschmeidigen und bestens textverständlichen Baritons. Arturo Martín überzeugte mit hellem, kräftigem, schmelzigem, aber etwas eindimensionalen Tenor als schwächlich gezeichneter Cassio. (Dessen eine Epaulette im Zweikampf mit Montero schon abgerissen wurde, ehe e ganz degradiert wurde.) Erica Brookhyser als Emilia wieder einmal in Bestform mit ihrem warmen, runden Mezzo. Dem Lodovico des Kyung-Il Ko fehlten stimmlich Kraft und Glanz des herzoglichen Gesandten. Mehr als solide die bewährten Thomas Mehnert und Peter Koppelmann in den kleinen Rollen von Montano und Rodrigo.

Susanne Serfling (Desdemona), Joel Montero (Otello)
Das Glanzlicht des Abends aber setzte Susanne Serfling als Desdemona. Zeigte sie in den beiden ersten Akten, welche Fortschritte sie in gut dosierter Kraft und Ausdrucksvielfalt als Jugendlich-Dramatische macht (untadelige weiche Intonation, große leuchtende Aufschwünge), verzauberte sie ihr Publikum vollends in den lyrischen Passagen des Weide-Lieds und des Ave Maria. Ihr glockenreiner Sopran mit schlanken, fokussierten Höhen, ihre schön ausnuancierten Farbgebungen vom feinen Schimmern bis zur anrührenden Existenzfrage und ihre verinnerlichte Expressivität vermittelten den bleibenden, nachhaltigen Eindruck des Abends, den sie damit auch für solche Zuschauer rettete, die sich mehr Pfeffer und Salz in der Inszenierung gewünscht hätten, die alle moderneren Elemente von Otellos Rezeptionsgeschichte konsequent außer Acht lässt und erst im zweiten Teil an Eindrücklichkeit und Tiefe gewinnt.
Das Publikum im ausverkauften Haus feierte natürlich zu Recht vor allem die Darstellerin der Desdemona, begeisterte sich auch fürs Orchester und die Dirigentin, spendete auch allen anderen Mitwirkenden intensiven lang anhaltenden Beifall und applaudierte dem Regieteam. Vom 21.03. bis 03.07. gibt es noch acht Vorstellungen dieser Produktion.
Manfred Langer, 17.03.14 Fotos: Barbara Aumüller
Mit Aspekten eines Ausstattungsstücks
LA TRAVIATA
Besuchte Aufführung: 8. 3. 2014 (Premiere: 7. 12. 2013)
Erinnerung einer Kurtisane
Wirft man einen Blick auf das Programm der verschiedenen Opernhäuser sowohl des Inlands als auch des Auslands drängt sich einem der Eindruck auf, dass die „Traviata“ neben dem „Otello“ das derzeit meistgespielte Werk Verdis ist. Zu den zahlreichen Häusern, die diese Oper in der aktuellen Spielzeit neu herausgebracht haben, gehört auch das Staatstheater Darmstadt, dessen Hausherr John Dew persönlich am Regiepult Platz genommen hatte.

Violetta Valery und ihr Double
Er ließ das Stück ohne Pause mit einer Spieldauer von ca zwei Stunden durchspielen, was sich auf den dramatischen Fluss des Geschehens recht positiv auswirkte. Dew hat etliche gewohnte Striche aufgemacht, aber auch einige Sachen weggelassen. So fiel beispielsweise die Karnevalsmusik im dritten Akt dem Rotstift zum Oper. Das haben vor Dew schon andere Regisseure getan. Auf diese Einlage kann man tatsächlich verzichten. Gelungen war der Einfall, die Handlung als Erinnerung der in ihrer einfachen Pariser Dachmansarde dem Tod entgegensehenden Violetta ablaufen zu lassen. Das an der Wand hängende überdimensionale Bild, das die Protagonistin in ihrer besten Zeit als Kurtisane zeigt und das sie am Ende dem frisch gekürten Soldaten Alfredo vermacht, ist der Auslöser für ihren Weg zurück in die Vergangenheit, wobei Dew die Person der Traviata in überzeugender Art und Weise in eine Sängerin und eine Schauspielerin aufspaltet. Letztere beobachtet im weißen Nachthemd die Handlung, die mit einem etwas surreal anmutenden Treffen von Violetta und Alfredo im dunklen Raum ihren Anfang nimmt, über zwei Akte hinweg von ihrem erhöht liegenden Sterbezimmer aus. Erst im dritten Akt tritt die Sängerin an die Stelle der Schauspielerin. Die Gegenwart hat die sterbende Kurtisane wieder eingeholt.

Violetta Valery (Double), Violetta, Oleksandr Prytolyuk (Germont)
Im Übrigen bewegte sich Dews Deutung indes stark in traditionellen Bahnen. Zwar hat er den Zigeunerinnenchor im zweiten Akt kurzerhand in eine vergnügliche Variéteeinlage umgedeutet, aber eine Schwalbe macht ja bekanntlich noch keinen Sommer. Dew degradiert Verdis Oper größtenteils zum reinen Ausstattungsstück, woran auch der manchmal recht kammerspielartige Charakter seiner Personenführung nichts zu ändern vermag. Er lässt das Ganze in einem Fin- de-siècle-Ambiente spielen. Dementsprechend fast überbetont pompös muten die von José-Manuel Váquez geschaffenen Kostüme insbesondere der Damen an, die einer stringenten Führung des Chores wohl etwas im Wege standen. Hier wäre weniger mehr gewesen. Und die bieder wirkende Landschaftsidylle impressionistischer Prägung mit See und Wiesen, die im zweiten Akt den Hintergrund von Traviatas Landhaus dominiert, ist ein rechter Blickfänger, der etwas von den Personen ablenkt. Da war im Schlussakt der Paris zeigende Hintergrundprospekt schon stimmiger. Wenn dieser und das Naturbild des zweiten Aktes bei Violettas Tod gleichsam ineinanderfließen, wird der Spagat zwischen den diametral entgegengesetzten Lebenswelten Violettas als Prostituierte und als Landfrau noch einmal recht sinnfällig ausgedrückt. Obwohl Dews Inszenierung schon einige durchaus ansprechende Aspekte aufwies, klebte er insgesamt doch zu sehr am Libretto und verweigerte sich einer tiefer schürfenden Aktualisierung des Stoffes.
Eine solide Leistung ist Anna Skryleva am Pult zu bescheinigen. Sie hatte das beherzt aufspielende Staatsorchester Darmstadt gut im Griff und erzeugte zusammen mit den Musikern einen ausgewogenen, differenzierten Klangteppich, aus dem sich insbesondere die weich und emotional intonierenden Holzbläser hervortaten. Auf der anderen Seite drehte sie insbesondere die markanten Blechbläser manchmal auch ziemlich tüchtig auf. Indes nahm sie auf die Sänger immer die gebotene Rücksicht.

Anthoula Papadakis (Violetta-Double), Violetta
Deren Leistungen bewegten sich auf hohem Niveau. Allen voran glänzte in der Titelpartie Adréana Kraschewski. Ihre Traviata zeichnete sich durch einen hervorragenden Stimmsitz, einfühlsamen Linienführung, hohe Emotionalität und ein imposantes „Sempre libera“ mit sicheren Spitzentönen aus. In Anthoula Papadakis, die auch für die gelungene Choreografie verantwortlich zeigte, stand ihr ein eindrucksvoll agierendes stummes Alter Ego zur Seite. Roman Payer, den man noch aus Coburg in bester Erinnerung hat, hatte die Partie des Alfredo von Arturo Martin übernommen und vermochte dann auch in jeder Beziehung zu überzeugen. Mit seinem hervorragend italienisch focussierten, kräftigen und ausrucksstarken Tenor zog er jede Facette seiner dankbaren Rolle und überzeugte auch schauspielerisch. Ein noch recht jugendlicher Germont war Oleksandr Prytolyuk. Autoritär und rigide auftretend entsprach er seinem Part trefflich und vermochte mit gut sitzendem, substanzreichem Bariton auch gesanglich zu gefallen. Von dem sonor und klangschön singenden Dr. Grenvil Thomas Mehnerts hätte man gerne mehr gehört. Einen bestens verankerten Mezzosopran brachte Anja Bildstein für die Flora Bervoix mit. Die kleine Partie der Annina stellte für die mit einer profunden Altstimme aufwartenden Elisabeth Hornung kein Problem dar. Vokal ansprechend präsentierten sich Kyung-Il Ko und Werner Volker Meyer in den Rollen von Baron Douphol und Marquise d’ Obigny. Überhaupt nicht im Körper und ausgesprochen flach sang Lasse Penttinen den Gaston. Jaroslaw Kwasniewski (Giuseppe), Stanislav Kirov (Diener) und Malte Godglück (Kommissionär) rundeten das homogene Ensemble ab. Auch mit dem von Markus Baisch trefflich einstudierten Chor konnte man voll zufrieden sein.
Fazit: In szenischer Hinsicht kann die Aufführung nur konventionell eingestellten Gemütern empfohlen werden. Spannendes modernes Musiktheater stellt sie nicht dar. In gesanglicher Hinsicht hat sich die Fahrt nach Darmstadt aber wieder einmal voll gelohnt.
Ludwig Steinbach, 8. 3. 2014
Die Bilder stammen von Barbara Aumüller. Sie zeigen als Violetta die Sängerin der Premiere, Liana Aleksanyan. Weitere Bilder weiter unten bei der Premierenkritik.
Von Parodie zu Comedy
DIE GROSSHERZOGIN VON GEROSTEIN
Premiere im kleinen Haus am 07.03.2014 (Schauspielsparte)
Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Worte
Die Großherzogin, eines von Offenbachs bekanntesten und beliebtesten Werken, ist im Jahre der Weltausstellung 1867 uraufgeführt worden. Offenbachs Bouffes wurden von den herrschenden Schichten und deren Widersachern in Paris (jeweils aus anderen Motiven) immer recht bald nach dem Herausbringen besucht. So auch die Grande Duchesse: Von Napoleon III, der sich dafür interessierte, ob er wieder „etwas abbekommen“ hatte und von seinen Gegnern, die sich genau darauf diebisch freuten. Entsprechend unterschiedlich fielen auch die Reaktionen an. Napoleon kritisierte das Werk, weil er es dafür geeignet hielt, Verstimmungen bei ausländischen Staaten hervorzurufen; wohl nicht beim Großherzogtum Gerolstein, denn das gab es nicht – aber vielleicht bei einem der verbliebenen deutschen Operettenstaaten? Auch das nicht, denn Humor und Parodie zielen in die Mitte der damaligen Großmächte mit ihrem militärischen Gehabe, der Kabinettdiplomatie und dem Geprotze der Potentaten zur Entstehungszeit der Operette, und nicht in die Zeit, die das Libretto „vorschreibt“: um 1720. Aber 1867 – schon Spätzeit des zweiten französischen Kaiserreichs - war in Paris ein internationales Publikum anwesend, allein siebenundfünzig Staatsoberhäupter, der russische Zar mit Sohn sowie der König von Preußen samt Thronfolger mit Moltke und Bismarck, die nur wenige Jahre später den Kaiserspuk in Frankreich beenden sollten. Alle beeilten sich, Plätze für die Großherzogin zu bekommen.
Der politische und gesellschaftliche Hintergrund der Offenbachschen Bouffen, die für die damalige Gegenwart geschrieben wurden, erschließt sich dem heutigen Publikum nur noch am Rande, also muss ein neuer Text her (zumindest für die gesprochenen Passagen), und die Handlung kommt in ein Umfeld, das wir heute besser verstehen und mit dem man auch seine Witzchen machen kann. Da liegen dann meistens genau die Schwächen heutiger Operettenproduktionen und vor allem der Offenbachiaden. Denn wo sollen heute denn so viele geniale Texter herkommen, die diese Werke adaptieren, ohne in Plattheiten und Comedy zu verfallen? Die in Darmstadt vorgestellte Fassung stammt von Michael Quast und Rainer Dachselt, hatte vor 14 Jahren am Staatstheater Mainz Premiere und ist schon einige Male nachgespielt worden. Quast ist ein ausgewiesener Offenbach-Spezialist, der sich inzwischen auch als Produzent von Ein-Mann-Opern einen Namen gemacht hat. Den Kern des Originals hat er weitgehend bewahrt. Der Text – leider nicht durchgängig verständlich – ist dazu auch mit aktuellen Einwürfen angereichert, die beim Publikum umso mehr Lacher erzielen, je derber oder mundartlicher sie sind.

Thomas Dehler (General Bumm), István Vincze (Prinz Paul zu Schorf und Schwärenstein), Diana Wolf (Die Großherzogin), Stefan Schuster (Baron Pück)
Der Regisseur Axel Richter verlegt den fiktiven deutschen Duodez-Stadt, das Großherzogtum Gerolstein, in eine ganz konkrete Umgebung: die Plaza eines Einkaufszentrums mit Brunnen und Glastüren an einer Seite sowie aufgestapelter Ausverkaufsware (natürlich Schuhe, einem derzeit besonders beliebten Requisit der Regie) auf der anderen Seite. (Bühne und Kostüme fantasievoll: Klaus Noack). Ein etwa zwanzigköpfiger Chor in modern-verrückten Kostümen bevölkert die Szene: „Kunden und Beschäftigte der Shopping Mall“ sind das und natürlich gleichzeitig Statisten. Aus denen schälen sich zwei der Hauptdarsteller heraus: Wanda und Fritz, Reinigungskräfte. Mit einem kleinen Laufband werden Getränke und Snacks bereitgestellt. Das weitere Hauptpersonal der Operette wird nach und nach vorgestellt: zunächst General Bumm in dunklem Anzug, gefolgt von Baron Pück, dem ebenso dümmlichen wie wichtigtuerischen Politberater de Großherzogin. Die tritt erst als letzte auf – begleitet von eine pelztragenden Entourage – und mischt sich plötzlich in die Staatsgeschäfte ein. Den stieseligen Prinzen Paul mit seinem Brautwerber Baron Grog lässt sie links liegen. Denn sie verliebt sich in den dialekt-sprechenden Fritz, den sie im Rang sogar über den kommandierenden General Bumm erhebt und in irgendeinen Krieg schickt. Um gegen feindliche Einwirkungen gesichert zu sein, zieht man sich im Einkaufszentrum Schuss-sichere Westen an; das Lungervolk kommt nach der Pause in Camouflage-Anzugteilen in die Mall zurück, in die auch Fritz wieder siegreich einzieht. Seine Wanda will ihn aber nicht an die Großherzogin abtreten, was zu den letzten Verwicklungen führt.

Tom Wild (Fritz), Diana Wolf (Die Großherzogin), Chor/Statisten
Die Handlung verläuft in etwa so, wie von Meilhac, Halévy (Librettisten) und Offenbach vorgesehen. Aber was hat das alles mit einer Shopping Mall zu tun? Gegen wen wird da Krieg geführt? Gegen ein anderes Einkaufzentrum? Beute wird jedenfalls nicht vorgewiesen, als Fritz siegreich aus dem Krieg zurückkehrt. Er kriegt aber seine Wanda, und der „Adel“ kann dann so weiterzaubern wie bisher. Geht man davon aus, dass 1867 ein deutscher Duodez- oder Operettenstaat schon reine, ironische Fiktion war, dass das Geschehen also im Irrationalen angesiedelt sein sollte, dann ist das bei dem zu konkreten Bild eines Einkaufzentrums nicht unbedingt der Fall; die Satire geht teilweise ins Leere und Zweideutigkeiten werden plötzlich eindeutig: wie der blutbeschmierte Säbel der Vorfahren. Die Travestie, die Ironie und der Humor überleben das Handlungsende; es könnte irgendwo anders gleich weitergehen.

Diana Wolf (Die Großherzogin), Tom Wild (Fritz)
Wenn es schon textlich und szenisch nicht so richtig passen will – oder im Imaginären bleibt – dann kann doch eine geübte Regie immer noch einen bewegten, quirligen Bühnenzauber aufführen. Das gelingt auch hie recht gut, wenn auch unter Einbeziehung einiger Schablonen. So kommt das Publikum auf einen recht unterhaltsamen Abend, den man auch nicht nach tieferem Sinn hinterfrage sollte. Das könnte man lediglich bei einer Sondereinlage der Reinigungskraft Fritz tun. Der war wieder zum Schützen Arsch zurückbefördert worden und hatte zudem noch eine Abreibung erhalten, als er sich in einem hinterpfälzisch gesprochenen Monolog darüber ausließ, dass der Schauspieler Tom Wild (sein echter Name) eigentlich noch schlechter daran ist als die Reinigungskraft Fritz: gefeuert (vom Theater), nein, genauer gesagt: nicht verlängert. Es steht Intendantenwechsel am Staatstheater an. Da wird eben nicht „verlängert“ – und Kollegen auch abseits des künstlerischen Personals wissen noch nicht, was aus ihnen wird, obwohl keine der Stellen abgebaut wird – nur eben erstmal „nicht verlängert“. Dem der da sensibel ist, brachte die Einlage von Tom Wild so viel wie der ganze Abend. Er würde es dann mal als Fitnesszentrum-Fachwirt versuchen...

Isabell Dachsteiner (Wanda), Diana Wolf (Die Großherzogin), Tom Wild (Fritz), Chor/Statisterie
Der Abend im kleinen Haus wird von der Sparte Schauspiel veranstaltet. Da bleibt man naturgemäß der Pracht der Musiktheater etwas fern. Daher wird auch mit musikalisch viel einfacheren Mitteln gearbeitet. Das Orchester heißt in Darmstadt „Heeresmusikkorps Gerolstein“ und besteht aus sieben Instrumenten inkl. Klavier, von welchem aus der musikalische Leiter des Abends, Michael Erhard, den Abend dirigiert. Die Quast-Dachselt-Fassung sieht kein festes Instrumentenarrangement vor. Die Gruppe musiziert zwar präzise und inspiriert, aber die Zusammenstellung von Flöte, Trompete, Violine, Cello und Bass sowie Schlagzeug und Klavier lässt die richtige Farbgebung zum Offenbach-Elan nicht aufkommen. Die Instrumentalisten wurden außerhalb des Staatsorchesters rekrutiert. Woher der über zwanzigköpfige Chor zusammengestellt und wer ihn einstudiert hat, darüber gibt das Programmheft keine Auskunft. Dieser Truppe kann quirlige Bewegung, aber auch schlagkräftiger Gesang attestiert werden. Die Solisten wurden über Microport verstärkt und schlugen sich durchweg auch gesanglich recht gut, teilweise sehr gut, wobei Tom Wild (Fritz) und Isabell Dachsteiner (Wanda) als stimmlich beeinträchtigt gemeldet wurden. Diana Wolf trat als anmaßende und launische Großherzogin auf; den General Bumm spielte Thomas Dehler überzeugend auch mit potentem Stimmmaterial. Baron Pück war Stefan Schuster und Prinz Paul István Vincze. Die reine Sprechrolle als Baron Grog füllte Harald Schneider aus.
Das war Unterhaltungstheater auf ansprechendem Niveau. Das gut amüsierte Publikum aus dem fast voll besetzten Haus spendierte reichlich Beifall. Bis zum 27. Mai gibt es noch neun Vorstellungen der Großherzogin.
Manfred Langer, 09.03.2014 Fotos: Barbara Aumüller
THE TURN OF THE SCREW
Besuchte Aufführung: 7. 3. 2014 (Premiere: 15. 2. 2014) 2. Kritik
Biederes Kammerspiel: eher belanglos
Die bis auf wenige leere Plätze ausverkauften Kammerspiele des Staatstheaters Darmstadt zeugten von dem großen Interesse, das seitens des Publikums an der Neuproduktion von Benjamin Brittens - letztes Jahr beging die Musikwelt seinen hundertsten Geburtstag - auf einem Libretto von Myfanwy Piper beruhender Oper „The Turn of the Screw“, zu Deutsch „Die Drehung der Schraube“, bestand. Dieses Werk scheint z. Z. hoch im Kurs zu stehen. Zahlreiche Opernhäuser haben es auf ihren Spielplan gesetzt.
Erzählt wird in Anlehnung an Henry James’ gleichnamige, 1898 erstmals veröffentlichte Schauernovelle in sequenzartigen Abschnitten die Geschichte einer jungen Gouvernante auf dem englischen Landsitz Bly. Ihre Aufgabe ist es, sich dort um die beiden verwaisten Kinder Miles und Flora zu kümmern, wobei die Haushälterin Mrs. Grose ihre einzige Unterstützung ist. Den Auftrag dazu hat sie von dem Onkel und Vormund der Kinder bekommen, in den sie sich verliebt hat. Dieser stellte aber die ausdrückliche Bedingung, dass sie ihn niemals kontaktiert und alle eventuell auftretenden Probleme allein bewältigt. Davon gibt es reichlich. Denn mit den Geistern der ehemaligen Gouvernante Miss Jessel und des alten Dieners Quint ist nicht gut Kirschen zu essen. Vehement versuchen sie, die Kinder auf ihre Seite zu ziehen, was die Gouvernante mit allen Kräften zu verhindern trachtet. Letztlich kann sie die Katastrophe aber doch nicht verhindern.

Samantha Paul (Flora), Anja Vincken (Miss Jessel)
Das Kammertheater stellte rein von seinem Raumcharakter her für die Aufführung eine gute Wahl dar. Das am linken Rand des Raumes durch transparente grüne Wandsegmente vom übrigen Raum abgegrenzte, verborgen sitzende Orchester besteht nur aus dreizehn Musikern, woraus zeitweilig ein recht intimer Charakter der Musik resultiert. So z. B. gleich zu Beginn, wenn der Prolog nur von einem Klavier sekundiert wird und der Focus demgemäß vorerst noch auf dem narrativen Element liegt. Konträr dazu stellt sich im weiteren Verlauf des Werkes schon auch mal der Charakter eines riesigen Orchesterapparates ein. Ätherische Stimmungen wechseln mit herrlichen Traumbildern. Aber nicht nur dieser Aspekt lässt die Partitur so interessant und vielschichtig erscheinen. Britten hat seine Oper symmetrisch in zwei Teile zu je acht Bildern aufgespalten, die durch fünfzehn Variationen voneinander abgetrennt sind. Trotz der Tatsache, dass das Hauptmotiv aus zwölf Tönen besteht, liegt hier keine Dodekaphonie vor. Der Komponist setzt nicht auf Zwölftontechnik, sondern auf Tonalität. Das Schraubenthema ist klar gegliedert. Es wird von sechs aufsteigenden Quartensprüngen gebildet, die durch abfallende Terzen miteinander verknüpft werden. Entsprechend der Schraubendrehung schrauben sich diese Quarten über sämtliche zwölf Töne immer höher. Es findet gleichsam eine musikalische Drehung der Schraube statt, wobei diese ständig zwischen den Tonarten der Gouvernante (A-dur) und Quint (As-dur) hin und her pendelt. Diese Spiralbewegung der Musik hat eine große Spannung zur Folge, die sich durch das gesamte Stück unter oft asynchronen Rhythmen zieht. Bereits am Anfang lässt Britten auf diese Art und Weise die beiden Gegner Gouvernante und Quint zueinander auf Konfrontationskurs gehen.

Susanne Serfling (Gouvernante), Samantha Gaul (Flora)
Aus diesem Aneinanderreiben von zwei Tonarten ergibt sich eine bitonale Struktur, die zu den Hauptcharakteristiken der Oper gehört und mit Fortschreiten der Handlung immer spürbarer wird. Miss Jessel bewegt sich vorwiegend zwischen den Paralleltonarten f-moll und As-dur - das in erster Linie in ihrem Duett mit der Gouvernante, die hier ebenfalls durch f-moll charakterisiert wird. Insgesamt sind Britten die musikalischen Zeichnungen der Figuren trefflich gelungen. Der Beginn ist noch gänzlich unbeschwert. Die Gouvernante wandelt bei ihrer Ankunft in Bly zwischen C-dur und D-dur. Zu diesem Zeitpunkt ist noch alles in bester Ordnung. Aber bereits beim Eintreffen des Briefes aus Miles’ Schule entsteht mit dem Einsetzen von a-moll erstmals eine musikalische Trübung. Die insbesondere im zweiten Teil erscheinende, Nacht, Düsternis und Tod versinnbildlichende Tonart es-moll nimmt den tragischen Ausgang des Werkes bereits voraus. Am Ende schließt sich der Kreis. Mit dem in A-dur komponierten Tod von Miles hat Britten wieder seine Ausgangstonart erreicht. Auffällig ist, dass die von ihm verwendeten Tonarten im ersten Akt durchweg aus Tönen der weißen Klaviertasten bestehen. Im zweiten, von den Geistern dominierten Aufzug prägen dann die schwarzen Tasten die Tonarten. Noch im reinen As-dur beginnend schrauben sich diese immer weiter nach unten, wobei sie stets darauf bedacht sind, b-moll zu erreichen, das einen ausgesprochen bösen Charakter hat. Diese Eintrübung ist gut nachzuvollziehen, denn die beiden Gespenster, die sich hier im Gegensatz zu James’ Novelle auch artikulieren können und einiges zu singen haben, gewinnen zunehmend die Oberhand. Der Kampf zweier entgegengesetzter Welten wird offenkundig. Hell und Dunkel, Gut und Böse ziehen in den Krieg gegeneinander. Klangfarblich wird die Grenze zwischen den beiden Bereichen durch die Quint zugeordnete Celesta gezogen. Dieses Instrument symbolisiert das zauberhaft Lockende dieser Figur. Die musikalische Dramaturgie kann man mit derjenigen von Mahlers Sechsten Symphonie vergleichen. Brittens Klangsprache wirkt in ihrer Gesamtheit reichlich suggestiv und schwermütig und entspricht der tristen Handlung voll und ganz. Bei Michael Cook und dem reduzierten Staatsorchester Darmstadt war Brittens Oper in guten Händen. Da wechselten sich imposante Ausbrüche des gesamten Klangapparates mit einfühlsamen Soli ab, wobei stets eine ausgeprägte Intensität der Tongebung gewahrt wurde.
Ein Problem der Kammerspiele ist die wenig befriedigende Akustik, mit der die Instrumentalisten zwar leidlich zurecht kamen, die sich auf der vokalen Ebene aber nicht sonderlich vorteilhaft auswirkte. In dieser Hinsicht dürfte weiter auch der Fakt, dass bei den Kammerspielen die Zuschauertribüne nahtlos in den Bühnenraum übergeht, eine Rolle spielen. Die schon oft bewährte Susanne Serfling, die in den vergangenen Jahren eine gute stimmtechnische Entwicklung durchgemacht hat, beeindruckte als Gouvernante mit guter Fokussierung und geradliniger Führung ihres jugendlich-dramatischen Soprans sowie einfühlsam-beherztem Spiel. Allerdings wurde insbesondere bei den ausladenden vokalen Höhenflügen deutlich, dass ihre Stimme für die Kammerspiele schon etwas zu groß ist. In Nichts nach stand ihr Anja Vincken, die mit kräftigem, ebenfalls bestens sitzendem und ausdrucksstarkem Sopran die Miss Jessel recht unheimlich sang. Tiefsinniges, tadelloses Mezzomaterial brachte Elisabeth Auerbach für die Mrs. Grose mit. Schon von ihrer sehr kleinen, zierlichen Statur her war die äußerlich stark an die Schauspielerin Sabine Menne erinnernde Aki Hashimoto eine Idealbesetzung für den Miles. Auch vokal wurde sie mit ihrem vorbildlich italienisch fundierten Sopran ihrer Rolle voll gerecht. Neben ihr fiel die relativ dünn singende Flora von Samantha Gaul ab. Auch der stark im Hals intonierende Lasse Penttinen als Prolog und Quint täte gut daran, seinen Tenor in den Körper zu bekommen. Gesungen wurde in Darmstadt eine von Constanze Backes erstellte, nicht gerade gelungene neue deutsche Textfassung. Dass die Oper nicht in der englischen Originalsprache gegeben wurde, stellte in stilistischer Hinsicht ein erhebliches Manko dar. Ein derartiges Abweichen von der ursprünglichen Diktion des Werkes hatte sich bereits bei der Coburger Produktion des Stückes in der vergangenen Spielzeit negativ ausgewirkt. Auf der anderen Seite hat das Darmstädter Ensemble in den durchweg vorzüglichen Coburger Sängern/innen so im Notfall potentielle Einspringer/innen zur Verfügung.

Susannah Gaul (Flora), Aki Hashimoto (Miles)
Die Deutungsmöglichkeiten der Handlung sind mannigfaltiger Natur. Man kann das Ganze als reine Gespenstergeschichte interpretieren, aber auch als Psychose der Gouvernante oder als Stück über Kindermissbrauch. Die insgesamt einen zwiespältigen Eindruck hinterlassende Inszenierung von Lothar Krause, für die Nora Johanna Gromer das Bühnenbild und die Kostüme beisteuerte, gibt darauf keine eindeutige Antwort. Der im zweiten Akt oftmals düster aus dem Boden aufsteigende Nebel mag für die Geistervariante sprechen. Der Fakt, dass sich die zu Beginn streng und adrett auftretende Gouvernante im Lauf des Stücks in immer stärkerem Maße zu einer reichlich verwirrten Frau mit unordentlicher Frisur entwickelt, die die Aussprache von Miss Jessel und Quint am Anfang des zweiten Teils nur träumt, deutet auf die psychoanalytische Auslegung. Die pädophile Erklärung kommt hier dagegen kaum in Betracht. In dieser Beziehung ließ es Krause bei spärlichen Andeutungen bewenden. Er lässt Vorsicht walten, dabei hätte seine Regiearbeit zu diesem Thema einen ganz radikalen aktuellen Bezug schaffen können. Krause gehört eben zu den jungen Regisseuren, deren Regiesprache weniger krass und provokant als vielmehr etwas schlichter und behäbiger Natur ist. Er geht auf Nummer Sicher, was ihm auf Dauer den Weg an die großen Bühnen verbauen könnte. Dabei sind einige seiner Ideen durchaus diskutabel. Gegen den Einfall, der Handlung als Vorgeschichte eine große Katastrophe vorangehen zu lassen, die die nur noch durch ein altes Photo merkbare Familienidylle samt deren Wohnraum zerstört hat - davon zeugt insbesondere ein in die Brüche gegangener Flügel -, ist nichts zu sagen. Dass ein derartiges Unglück einen Menschen an Rollstuhl und Krücken fesseln kann, ist gar keine Frage. Im konkreten Fall der hier noch ziemlich jung vorgeführten und lehrerinnenhaft wirkenden Haushälterin Mrs. Grose ging der Schuss aber nach hinten los. Trefflich ist dem Regisseur indes die erotische Zeichnung der Geister gelungen. Quint stellt gerne seinen entblößten Oberkörper zur Schau und Miss Jessel scheint unter ihrem transparenten Kleid und einem eine Schwangerschaft assoziierenden Theaterbauch - dass sie mit einem Kind im Leib von Quint sitzengelassen wurde, stellt einen einleuchtenden Grund für ihren Selbstmord dar - unten herum unbekleidet zu sein. Die Symbolik des anhand von Floras Puppe vorgeführten Voodoo-Zaubers mit dem anschließend an der Wand herabfließendem Blut war insoweit nicht überzeugend, als sich dieser ja nur auf das einzige Todesopfer des Stücks, Miles, beziehen konnte. Aber Flora hat doch überhaupt keinen Grund, ihren geliebten Bruder zu töten. Zwar wartet Krause durchaus mit einer im Lauf des Abends sogar noch etwas ansteigenden szenischen Spannungskurve auf, die im zweiten Akt ihren Höhepunkt erreicht. Als imposantes, unter die Haut gehendes Musiktheater kann man seine Inszenierung indes nicht bezeichnen. Dazu ist seine Herangehensweise an die Oper um einiges zu bieder und zudem manchmal auch etwas zu plakativ.
Ludwig Steinbach, 8. 3. 2014
Die Bilder stammen von Barbara Aumüller. Weitere Fotos weiter unten bei der Erstbesprechung
Überzeugende musikalische Darbietung
TRISTAN & ISOLDE
Aufführung am 28.02.2014 (Premiere am 25.02.2014)
Beleuchtungswechsel zwischen Liebesnacht und ödem Tag
Vom Bayreuth-Kanon des sächsischen Komponisten fehlen in der Ägide des scheidenden Intendanten-Regisseurs John Dew nach seiner Tristan-Inszenierung in Darmstadt nur noch Tannhäuser und Lohengrin – die hat er aber anderen Orts inszeniert. In kürzlichen Interviews hat Dew mit dem modernen Regie-Theater, dessen „böser Bub“ er einst selber war, abgerechnet und erstaunlicherweise kundgetan, die Opern müssten so aufgeführt werden, wie sie in Libretto und Partitur von den Autoren vorgezeichnet sind. Ganz so hat er es nun mit dem neuen Tristan in Darmstadt doch nicht gemacht, aber viel Neues und/oder Erhellendes ist dabei nicht herausgekommen. Und dennoch wurde es (vor allem musikalisch) eine überzeugende Aufführung von Tristan und Isolde.
„Dem Wagner kann man ja viel zumuten“ fand Wolfgang Wagner auf seine alten Tage noch heraus; hinzugefügt sei: wenn nur die musikalische Seite stimmt. Viel falsch machen kann man auch beim Tristan nicht, es sei denn der Regisseur zerstört mutwillig. (Luk Percevals Stuttgarter Tristan oder der von Marthaler bei den Bayreuther Festspielen fallen Ihrem Kritiker hier zwanglos ein.) John Dew weist im Programmheft zu Recht darauf hin, dass Wagners Spezifizierung „Handlung in drei Aufzügen“ eine provokante Unwahrheit ist; denn eine Handlung findet eigentlich gar nicht statt, denn es geht gar nicht um „Vorgänge“, sondern viel mehr um „Zustände“. Diese szenisch zu vertiefen ist in der Tat keine einfache Aufgabe, vor allem deswegen weil das in dieser Oper schon die Musik ganz perfekt leistet. Um dieser auch den entsprechenden Rezeptionsraum zu lassen, lässt John Dew auf der Bühne in einer einfachen Szenographie eine recht reduziertes Spiel ablaufen, dessen wesentliche Elemente die auch wieder sehr einfache Lichtregie sowie (eher überflüssig) ein immer stärker werdendes Gewaber von Theaternebel ist.

Ralf Lukas (Kurwenal); Tristan; Ruth-Maria Nicolay (Isolde); Erica Brookhyser (Brangäne)
Für die Ausstattung zeichnete sein langjähriges Team aus José-Manuel Vázquez (Kostüme) und Heinz Balthes (Bühne) verantwortlich. Letzterer stellt für die Inszenierung ein Einheitsbühnenbild zur Verfügung: einen großen Salon, spärlich mit Sitzgruppen und einem Esstisch möbliert, im Hintergrund durch eine halbtransparenten metallisch glänzende Wand begrenzt. Im Wesentlichen wird nur das Hauptpersonal auf der Bühne sichtbar; Nebenrollen und Chor singen aus dem Off bzw. (Chor) von ganz oben aus dem Theaterraum. Ein Schiff vermag man im ersten Aufzug nicht festzustellen. Tristan und Kurwenal haben es sich auf einem kleinen Sofa bequem gemacht und schauen immerfort nach hinten; statt Kapitäns- und Offiziersuniformen tragen beide Cutaways, die laut Protokoll feierlichste Bekleidung morgens und nachmittags. Brangäne und Isolde an der anderen Seite des Salons in hübschen langen Gewändern. Ein funktional wesentliches Requisit fehlt nicht: es ist ein Überseekoffer, in welchem sich die diversen Getränke befinden, natürlich auch der strahlend rote Liebestrank. Die einzigen Änderungen, die zu den beiden Folgeaufzügen stattfinden: die Möbel werden umgestellt.
Die beiden Bewusstseinsebenen der Oper (der öde Tag und die erstrebenswerte Nacht) werden durch Lichteffekte dargestellt. Aus nachtblauem Licht (zu Isoldens nachtblauem Gewand im zweiten Aufzug: „oh sink hernieder, Nacht der Liebe“) steigt (senkrecht! als ob man am Äquator sei) erst rötlich, dann fahl und unangenehm hell die Morgensonne empor: „Der öde Tag zum letztenmal!“ Tristan hatte es sich inzwischen in einem einfachen Straßenanzug etwas bequemer gemacht. Der Salon (kein Bett!) mit der transparenten Hinterwand, durch welche man die zweiköpfige Jagdgesellschaft abziehen und zurückkommen sieht) passt hier am besten zum Schloss des König Marke. Auch der dritte Aufzug ist im gleichen Salon angesiedelt. In dem Maße, wie mehr und Nebel wabert, wird die Bühne dunkler, man erkennt nur noch die Titelpersonen; alle sind nun in einfach in Nachtschwarz gekleidet. Zum Abschlussapplaus erschienen sie wie nach einer konzertanten Oper, nach dem das tödliche Geschehen auf der bretonischen Burg Kareol durch den italienischen Vorhangzug bemäntelt wurde.

Durch die vielen verfügbaren Ton/Bildträger für Tristan&Isolde und der dadurch verwöhnten Publikumserfahrung ist das Risiko eines musikalischen Misserfolgs viel größer als das des szenischen. Hier kann man aber ganz zuvörderst dem Staatsorchester Darmstadt unter Leitung von Martin Lukas Meister ein Kompliment machen. Über knappe vier Stunden reine Spielzeit wurde bis auf vernachlässigbare Ungenauigkeiten konzentriert durchmusiziert. Meister wählte eher gemäßigte Tempi, ohne aber breit zu werden; er ließ (im Vorspiel am besten vorgezeichnet) einen spannungsreichen großen Bogen musizieren, den er mit kleinteiliger Dynamik noch anzureichern verstand. Besonders achtete er auf p- und pp-Kultur des Orchesters: wie spannungsgeladen kann ein pp-Tremolo in den Streichern wirken! Durchweg unproblematisch auch das Blech selbst bei zarter Intonation. Das Orchester verfügte über ein sattes Streicher-Fundament, aus dem die Holzbläser farbgebend, aber auch stimmführend herauskamen. Fast unnötig zu erwähnen, dass bei diesem meist fein ziselierenden Dirigat die Sänger zu keiner Zeit überfordert waren. Die kurzen Einwürfe des Herrenchors (Einstudierung: Markus Baisch) kamen präzise aus der Höhe des Zuschauerraums.

Als Tristan war Ian Storey besetzt, der diese Rolle bei der Eröffnung der Mailänder Scala 2007 gesungen hatte (Patrice Chéreau, Daniel Barenboim), aber damals ebenso nur teilweise überzeugen konnte wie an diesem Abend in Darmstadt. Mit seiner schlanken, großen und kräftigen Bühnenerscheinung gab er einen idealtypischen Helden. Aber neben den strahlend hervorgebrachten und sicheren Spitzentönen klang der baritonal timbrierte Tenor in der Tiefe und der deklamatorischen Mittellage teilweise müde, farblos und unstet. Zum dritten Aufzug bat das Theater um Verständnis dafür, dass sich der Gastsänger nach sechs Wochen Krankheit noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte fühlte. Aber er stand die mörderische Partie im dritten Akt kaum zurückgenommen ordentlich durch. Mit Ruth-Maria Nicolay kam als Isolde eine helle, deutlich artikulierende Sopranstimme zum Einsatz. Bei weitem noch keine Hochdramatische, gefiel sie aber mit guter Intonation, schönem Fokus der klaren Stimme ohne jede Schärfe bei und nuancenreichem Ausdruck. Um sie stimmlich nicht zu überfordern, ließ die Regie sie überwiegend im vorderen Bühnenbereich agieren.

Thomas Mehnert vom Darmstädter Ensemble wurde mit Erkältung gemeldet. Davon war indes nichts zu hören; er gestaltete den König Marke mit kräftigem, warm strömendem Bass, ohne sich zu schonen. Die Sängerin des Abends war zweifellos Erica Brookhyser als Brangäne. Sie setzte ihren kraftvollen Mezzo mit bester Textverständlichkeit ein und begeisterte das Publikum mit Fokus und weicher Intonation ihrer einschmeichelnden Stimme; makellos auch ihre Bühnenerscheinung. Schade, dass sie den Wachtgesang hinter der Szene singen musste und dabei offensichtlich noch „abgeregelt“ wurde. Eine weitere Spitzenbesetzung war Ralf Lukas als Kurwenal, einem in Darmstadt bestens bekannten Wagner-Interpreten von ebenso langer Erfahrung wie anscheinend nicht versiegender jugendliche Kraft: beste Voraussetzungen für den Kurwenal. Auf seinem soliden dunklen Fundament aufbauend gestaltete er ausdrucksstark und nuancenreich. Mit Peter Koppelmann war als Melot ein Tenor besetzt, der ihn mit bellender Schärfe unsympathisch gestaltete. Weich, melodisch und melancholisch erklang Minseok Kims gut grundierter Tenor als Stimme des jungen Seemanns aus dem Off; auch seine Vorstellung als Hirt brachte ihm viel Beifall ein.
Das Publikum im sehr gut besuchten Saal war’s zufrieden und bedankte sich mit großem, langanhaltender Beifall, der meiste deutlich für Erica Brookhyser und das Orchester und seinen Dirigenten. „Tristan und Isolde“ kommt noch viermal in dieser Spielzeit: am 9. und 29.3., am 11.5. und am 8.6.2014
Manfred Langer, 01.03.2014
Fotos: Barbara Aumüller (Als Tristan ist Andreas Schager von der Premiere zu sehen)
Hautnahes Kammertheater
THE TURN OF THE SCREW
In den Kammerspielen: zweite Aufführung am 19.02.2014 (Premiere am 15.02.14)
Zwischen Schauerromantik und Psycho-Thriller
Henry James (1843-1916) war ein amerikanischer Schriftsteller, dessen Erzählung „The Turn of the Screw“ 1898 als Fortsetzungsstücke erschien. Er liebte Gespenstergeschichten wie diese; eine Art verspäteter amerikanischer ETA Hoffmann, aber mit einer Weiterung in psychologische Räume, gewissermaßen in die Freudsche Welt von Bewusstseinsspaltungen und -verschiebungen mit verschiedenen Bewusstseinsebenen. Die Kritikerin und Schriftstellerin Myfanwy Piper (1911-1997) hat die letzten drei Opern Benjamin Brittens librettiert, so auch The Turn of the Screw und bleibt sehr nahe beim Kern der Handlung. Nach einem kurzen Prolog folgen komprimiert zwei Akte in jeweils acht Szenen. The Turn of the Screw ist in den letzten Jahren zu einer der meistgespielten Opern von Benjamin Britten avanciert. Die Uraufführung fand 1954 im Teatro la Fenice in Venedig statt; es spielte das Kammerensemble The English Opera Group unter der Leitung des Komponisten; die Partie des Quint sang Peter Pears.
Für sechs Sänger und dreizehn Instrumentalisten gesetzt, wird das Werk nicht zu unrecht als chamber opera bezeichnet. Meistens wird es aber in normalen Opernsälen gegeben. Am Staatstheater Darmstadt wurde es nun in den Kammerspielen inszeniert, in einem großen variablen Bühnenraum mit keinerlei Bühnentechnik und einer Tribüne von nur 120 Plätzen. Da das Orchester an der Seite halb verdeckt sitzt, kann man als Zuschauer das szenische Geschehen hautnah miterleben, was den besonderen Reiz von Kammerspielen ausmacht. Die vielfältigen deutschen Übersetzungen des Operntitels (Das Durchdrehen der Schraube, Die Drehung der Schraube, Schraubendrehungen, Bis zum Äußersten, Das Geheimnis von Bly; Die sündigen Engel; Die Besessenen) werden heute nicht mehr verwendet, obwohl sie jeweils Subtexte beinhalten. In Darmstadt wird die Oper in der neueren deutschen Übersetzung von Constanze Backes gegeben, aber unter Beibehaltung des englischen Originaltexts.

Die Gouvernante (Susanne Serfling) trifft ein - beäugt von Flora (Samantha Gaul)
Hausregisseur und Spielleiter Lothar Krause hat die Inszenierung übernommen und bis auf einige (unnötige) plakative Elemente und streckenweise einer gewissen „Biederkeit“ eine solide, stringente, teilweise sogar spannende Arbeit abgeliefert. Die der Oper inhärenten homoerotischen und heute vielfach inszenierten Andeutungen von Knabenmissbrauch lässt er bis auf eine zweideutige Szene außen vor und konzentriert sich auf die drei Hauptfiguren der Gouvernante, des Knaben Miles und des Untoten Quint. Krause gelingt bis in die achte Szene eine stete Steigerung des aufziehenden Unheils, das wie in einem Akt-Finale in der gespenstischen Nachtszene des achten Bilds kulminiert. Nach der Pause dominiert der Verfall der Gouvernante, die mit den Kindern nicht mehr fertig wird, der Haushälterin Mrs. Grose nicht mehr vertraut und offensichtlich halluziniert, weil sie die Untoten Quint und die ehemalige Haushälterin Miss Jessel sieht und hört, die den anderen nicht erscheinen.
Bei der Figurenzeichnung geht die Regie einigen neuen Einfällen nach. Um die Überforderung der Haushälterin Mrs. Grose zu beglaubigen, wird diese in einen Rollstuhl gesetzt, was aber platt wirkt und dramaturgisch unlogisch ist. Dazu verpassen ihr Maske und Kostümbildnerin (Bühne und Kostüme: Nora Johanna Gromer) mit strengem Mittelscheitel und Brille ein Aussehen, als ob sie die Gouvernante wäre. Mit der Darstellung der attraktiven Miss Jessel als schwangerer Frau wird ein Hinweis gegeben, warum sie wohl ins Wasser gegangen war, ehe sie als Untote wieder in ihre alte Wirkungsstätte Einzug nahm. Peter Quint, der frühere Hausdiener, der mit Miss Jessel verschwunden war, tritt als attraktive Gestalt mit roter Frackjacke über nacktem Oberkörper auf. Die ältere Schwester Flora scheint fast zu alt dazu, dass Sie immer mit einer großen Puppe auftritt, die sie mit Nadelstichen peinigt.

Gespenstische Nacht: Miss Jessel (Anja Vincken), Miles (Aki Hashimoto), Peter Quint (Lasse Penttinen), Flora (Samantha Gaul)
Da ist also etwas nicht in Ordnung in diesem Haushalt. Darauf verweist auch das Bühnenbild. In einem großen rechteckigen Raum, der von halbdurchsichtigen türkisenen Stellwandelementen begrenzt ist, steht auf einem Podest ein englischer Ohrensessel, davor ein Flügel, dessen Hinterbein weggebrochen ist. Das sieht anders aus als die heile Welt auf dem alten Familienfoto hinten, als Vater und Mutter noch lebten und die Kinder Flora und Miles umsorgen konnten. Die Wandelemente sind beweglich und werden gegen Enden zu einem immer engeren Raum um Podest und Flügel zusammen geschoben. In dem Flügelkasten verschwinden gegen Ende zeitweise Miles und Quint, der von Miles kurz danach als „Teufel“ apostrophiert wird. Eine einzige kalte und flache Szene für das Thema Pädophilie und Missbrauch, welches die ganze Oper durchzieht. Dass auf einigen der Wandelemente Blut herunter läuft, mit dem man trefflich herumschmieren kann, gehört zu den überflüssigen Zutaten der Regie.
Die Deutungsversuche und -möglichkeiten der Geschichte von Henry James sind vielschichtig und reichen von Gespensterromantik bis zu freudianischen Ausleuchtungen, die seit den 20er Jahren dominieren. Verletzt die Gouvernante in ihrem Ehrgeiz die Kinder, die renitent werden? Welche Rolle spielt eigentlich die Haushälterin Mrs. Grove? Sind in den Gespenstern nicht auch die sozial Unterdrückten der Vergangenheit zu sehen und in den Kindern der Überrest der „feinen“ dekadenten Gesellschaft, alleingelassen von dem Vormund, der sich freigekauft hat? Wer sieht und hört was? Spinnt die Gouvernante oder auch die Kinder? Myfanwy Pipewr und Benjamin Britten bieten keine Erklärungen an; auch die vorliegende Regie nicht. An sich sind in der Geschichte nur der Anfang und das Ende real: die wirkliche Ankunft der Gouvernante in Bly und die finale Szene, in der sie den toten Miles in ihren Armen hält. Dazwischen ist alles unklar, vielleicht halluziniert, vielleicht real. Die Regie lässt aber auch das Ende offen: die Kinder und Quint scheinen durch einen der halbtransparenten Raumteiler höhnisch auf die Gouvernante zu schauen. War das Ganze gar nur ein Albtraum der Gouvernante? Sie hatte sich im Laufe der 16 Szenen von der zwar etwas ängstlichen, aber zuversichtlichen und adrett gekleideten, ehrgeizigen und erfolgswilligen Gouvernante in eine völlig verstörte Person mit wirrem Haar gewandelt – und eine Szene ließ sie der Regisseur tatsächlich schlafend auf der Bühne durchstehen.

Gespenstisch: Miss Jessel (Anja Vincken)
Britten hat die Partitur für 13 Instrumentalisten gesetzt, die insgesamt mit einem breit aufgestellten Schlagwerk und einer größeren Zahl an Holz 28 Instrumente zu bedienen haben. Die Mitglieder des Staatsorchesters saßen halb verdeckt auf dem linken Bühnenteil und musizierten unter der Leitung von Michael Cook. Das Ensemble verstand, ein breites Spektrum von sehr differenzierten Soli bis zu dicht gesetzten Tutti abzudecken. Es erreichte einen präzise sezierten Klang einerseits, beeindruckte mit den kurzen Interludien und dem immer mehr zusetzenden programmatischen Schraubenthema. Die transzendierenden Töne der Celesta schienen die begleiteten Szenen auf der Bühne der Realität zu entheben, und flackernd erratischen Holzbläsersequenzen verliehen dem Gespenstischen besondere musikalische Farben.
In der nicht unproblematischen, sehr trockenen Akustik der Kammerspiele gelangte das Orchester mit seiner teilweisen Abdeckung zu einem recht runden Klang. Den Sängern kam die Akustik weniger entgegen. Außer dem Prolog/Quint sind alle Partien für Frauenstimmen gesetzt, die naturgemäß in den hohen Passagen der Ariosi keine gute Textverständlichkeit erreichen, wozu auch die deutsche Übersetzung beiträgt, deren Prosodie nicht so passgenau auf die Musik passt wie umgekehrt die Musik auf den Originaltext. So blieben leider in Abwesenheit von Übertiteln etliche Passagen textlich zu wenig verständlich.

Keine intakte Familie: Mrs. Grose, Haushälterin (Elisabeth Auerbach), Die Gouvernante (Susanne Serfling), Miles (Aki Hashimoto), Flora (Samantha Gaul)
Auf die Tenorpartie von Lasse Penttinen traf das nicht zu. Stimmlich überzeugte er vom Vortrag der Prolog-Rolle zur trockenen Klavierbegleitung bis zu seinen sehnsüchtig-verführerischen „Miles! Miles!“-Rufen als Peter Quint, dem er auch darstellerisch mit erotischer Ausstrahlung Profil verlieh. Susanne Serfling als Gouvernante kam zuerst mit der Raumakustik nicht zurecht und überzog in jugendlich-dramatischem Ansatz. Später fand sie über ein einschmeichelndes Parlando und zurückgenommene Ariosi viel besser in die Erfordernisse des Kammertheaters. Eine Idealbesetzung für Kinderrollen ist natürlich immer wieder die zierliche Aki Hashimoto, die das Publikum als Miles mit feinem, sauber geführtem Sopran und auch darstellerisch begeisterte. Es war sicher für ihre rührende Interpretation des Malo-Liedes, dass sie zum Schluss mit den meisten Beifall bekam. Auch mit Samantha Gaul stand als „große Schwester“ Flora eine zierliche Sopranistin für die zweite Kinderrolle zur Verfügung; auch sie konnte vokal mit Klarheit und Präzision überzeugen und setzte die Charakterisierungen der Regie gekonnt um. Letzteres tat auch Elisabeth Auerbach in der etwas seltsam gestalteten Rolle der Mrs. Grose, der sie ihren klaren, recht hellen Mezzo verlieh. Anja Vinckens warmer, leicht eingedunkelter Sopran passte bestens zur Rolle der Miss Jessel, die die kleine Flora umgarnte.
Es gab lang anhaltenden herzlichen Beifall für den Opernabend. Es verwundert aber, dass bei „The Turn of the Screw“, die an anderen Häusern große Opernsäle füllt, mit der so ansprechenden und direkt wirksamen Kammerspiel-Aufführung wie der in Darmstadt in dem kleinen Saal noch etwa 20 Plätze unbesetzt blieben. Das „normale“ Opernpublikum fühlt sich nicht angesprochen? Man hat noch vier Mal Gelegenheit die Produktion zu besuchen: am 7., 26. und 30.3 sowie am 23.5.14.
Manfred Langer, 21.02.2014 Fotos: Barbara Aumüller
In prächtigen Kostümen
LA TRAVIATA
Premiere am 07.12.2013
Rückblick aus dem Sterbezimmer auf Freud und Leid der Vergangenheit
Die Traviata gehört zu den drei beliebtesten Opern des Standard-Repertoires und damit zu den meistgespielten Werken der Opernliteratur. Während eine Vielzahl von Opernhäusern in Deutschland im Verdi-Jahr stärker dessen weniger gespielte frühere Opern aus seiner „Galeerenzeit“ berücksichtigen, nimmt sich das Staatstheater dessen meistgespielten Werks an und bringt damit eine von 23 Neuproduktionen weltweit in dieser Spielzeit (operabase); insgesamt steht La Traviata bei über 130 Häusern auf dem Spielplan. Was kann da einem Regisseur noch einfallen, wenn einem „nur“ ein „normales“ Theater zur Verfügung steht und nicht z.B. Zürich Hauptbahnhof als Szenerie (Adrian Marthaler 2008)?
Regisseur John Dew ist mit seiner vorletzten Inszenierung als Intendant des Hauses aber doch wieder etliches Neues eingefallen. Zunächst reibt man sich die Augen: La Traviata wird ohne Pause in einer Spielzeit von zwei Stunden gegeben. Gut für die, die am Samstagabend etwas früher nach Hause kommen wollen, schlecht für die Theater-Gastronomie. Das sind natürlich keine künstlerischen Kriterien. Aber auch diesbezüglich hat die Idee etwas für sich. John Dew präsentiert auf der großen Bühne ein intimes Kammerspiel (unterbrochen von den beiden großen Chorszenen) zwischen Violetta und Alfredo, zu denen sich noch die doppelte Vaterfigur des Giorgio Germont gesellt. Ohne szenische Unterbrechung fließen die Akte und Bilder ineinander, wobei kleine Möbelgruppen auf die Bühne gleiten, welche die Spielorte der vier Szenen glaubhaft machen. Kaum fallen die Generalpausen der Musik auf. Das ist sehr gut gelungen.

Liana Aleksanyan (Violetta Valéry), Peter Koppelmann (Gaston), Arturo Martín (Alfredo), Opernchor
Dazu lässt John Dew die beiden ersten Akte aus der Rückschau der Violetta im dritten Akt ablaufen. Der Bühnenbauer Dirk Hofacker hat eine einfache, aber reinliche Dachstube etwas nach hinten auf die Bühne gestellt: Bett, Frisiertisch/Sekretär, ein überdimensioniertes Bild der Violetta in im Prachtkostüm des ersten Akts und ein Oberlicht. Von hier aus sieht in weißem Nachtgewand eine doppelnde Violetta auf wichtige Elemente Ihres Lebens mit Alfredo zurück. Großartig, wie die Schauspielerin Anthoula Papadakis diese (natürlich) stumme Rolle der verfallenden Kurtisane fast eineinhalb Stunden gestaltet, die Szenen noch einmal miterlebt und erneut durchleidet. Folgerichtig wird die Stube zum dritten Akt ganz nach vorne gefahren, die Sängerin Violetta, jetzt in dem weißen Nachtgewand, spielt ihre Rolle zu Ende. Kleinere Streichungen und einige Hinzufügungen aus authentischem Archiv-Material verändern die Oper kaum merklich; die Karnevalsmusik aus dem letzten Akt ist gestrichen, der sich kammerspielartig auf die drei Hauptakteure konzentriert.

Anthoula Papadakis (Violetta), Liana Aleksanyan (Violetta Valéry)
In einem Beitrag fürs Programmheft betont John Dew die Tatsache, dass es sich bei der Traviata in der Mitte des letzten Jahrhunderts um einen zeitgenössischen, ja sogar historisch in der damaligen Zeit verankerten konkreten Stoff handelt. Nach dem Buckligen hatte somit Verdi zum zweiten Mal seine früheren historischen Stoffe, die thematisch noch in der Barock-seria fußen, verlassen und begibt sich die Halbwelt seiner eigenen Epoche. (Er lebte monatelang bei Paris in wilder Ehe). So etwas hatte seit Le nozze di Figaro nicht mehr zu einem durchschlagenden Erfolg geführt. Dass solche Halbwelt-Milieus mit ähnlichen persönlichen Konstellationen auch heute existieren, haben schon viele Inszenierungen der Traviata thematisiert. Dew interessiert das aber nur ganz am Rande, denn er verlegt die Handlung nur etwas nach vorne, etwa ans Ende des 19. Jhdts. Das beglaubigen in erster Linie die Kostüme von José-Manuel Vázquez. Die hat sich das Theater etwas kosten lassen: In verschwenderische Pracht des fin de siècle sind die Damen im ersten Akt eingekleidet. Die Herren tragen zum Fest Frack, ansonsten fast zeitlose Straßenkleidung.

Liana Aleksanyan (Violetta Valéry), Arturo Martín (Alfredo Germont), Anthoula Papadakis (Violetta)
Vor Violettas Krankenzimmer beginnt die Oper zur Ouvertüre mit einer kleinen Pantomime: Alfredo trifft Violetta vor einem großen völlig schwarzen Raum. Seitlich hereingefahren wird eine Polstermöbelgarnitur, von oben senkt sich ein riesiger Lüster: Salon im Hause Violettas; mehr braucht man nicht; das Spiel kann beginnen. Der Chor wird nicht zu heftig bewegt; man kann in den Kostümen schwelgen. Im zweiten Akt wird die Szene mit Gartenstühlen und einem Schreibtisch spärlich möbliert; im Bühnenprospekt erscheint eine impressionistisch anmutende bukolische Landschaft mit Teich, Wiesen und blühenden Sträuchern: Landhaus in der Nähe von Paris. Alfredo fühlt sich zunächst wohl – in einem weißen Dandy-Anzug. Die nächste Szene spielt wieder in einem schwarzen Raum, Sofa und Spieltisch: Floras Palast. Die unsägliche Zigeunerinnen-Szene ist durch eine Variété-Einlage des Frauenchors ersetzt. Zur letzten Szene öffnet sich zum Prospekt ein Blick über die Dächer von Paris mit Eiffelturm. Alfredo erscheint jetzt in Ausgehuniform; er hatte sich nach Duell mit Duphol und anschließender Flucht wohl anwerben lassen. Ungewollte (?) Ironie in der scena ultima: Prendi: quest'è l'immagine de' miei passati giorni (Nimm; das ist das Bild aus meinen vergangenen Tagen), sagt Violetta und zeigt auf das Gemälde im Zimmer; das ist etwa drei Meter hoch. Die Sterbeszene wird verklärt, in dem über das graue Paris Teile der bukolischen bunten Landschaft projiziert werden. Das hätte nicht sein müssen. Insgesamt ist es John Dew mit seiner immer nahe beim Libretto bleibenden Inszenierung mit seiner originellen Einrahmung gut gelungen, trotz der an sich konventionellen Bebilderung jeglichen déjà-vu-Effekt zu vermeiden.
Sehr kontrastreich ist die Musik der Traviata, deren Extreme Martin Lukas Meister am Pult des engagiert, konzentriert und präzise aufspielenden Darmstädter Staatsorchesters ausleuchtete. Zu den Massenszenen ließ er es scharf und prägnant aus dem Graben krachen, schonte aber fast immer die Sänger und modellierte zart die innigen Stellen der Partitur. Hier und da wirkte das holzschnittartig (so wie Verdi-Feinde das beschreiben), aber neben dem sehr konsistenten Blech hörte man feines Holz, schöne Oboen-Soli und absterbende Klarinettenklänge. Für das immer wieder einsetzende Hm-Tata kann ja der Dirigent nichts. Immer präzise und sehr präsent wirkte der von Markus Baisch einstudierte Opernchor.

Liana Aleksanyan (Violetta Valéry), Arturo Martín (Alfredo Germont), Oleksandr Prytolyuk (Giorgio Germont), Elisabeth Hornung (Annina), Thomas Mehnert (Doktor Grenvil), Anthoula Papadakis (Violetta)
Was die Solisten anbelangt, war es der Abend der Liana Aleksanyan in der Titelrolle. Sie überzeugte mit ihrem warm timbrierten Sopran und kam nach anfänglichen Unsicherheiten bestens in die Rolle. Sie zeigte glühende Höhen und gefiel ebenso mit ihrer innigen, expressiven Interpretation, die im dritten Akt im „Addio del passato“ kulminierte. Dazu gefiel sie mit ihrer Bühnenerscheinung. Es war indes nicht der Abend von Arturo Martín in der Rolle des Alfredo Germont. Er begann mit scharfen Höhen, fand einige Wörter nicht, hatte Aussetzer, produzierte Kiekser und wich bei Spitzentönen ins Falsett aus. Das war sicher auch auf Nervosität zurückzuführen, denn im dritten Akt zeigte er einige schöne Passagen, wenn auch immer noch mit einer gewissen Enge beim Forcieren. Oleksandr Prytolyuk, obwohl sehr jugendlich wirkend, brachte den Giorgio Germont als rigiden Charakter gut rüber und gestaltete ihn mit seinem kraftvollen Bariton überlegen. Unter den Nebenrollen gefiel Elisabeth Hornung als Annina mit ihrem weichen, gut verständlichen Alt. Chorsolistin Anja Bildstein gefiel mit ihrem samtigen Mezzo als Flora Bervoix; dem Dr. Grenville verlieh als Luxusbesetzung Thomas Mehnert mit rundem kultivierten Bass stimmlich prächtiges Profil.
Das Publikum im ausverkauften Haus zeigte sich mit lang anhaltendem herzlichen Beifall und vielen Bravi sehr zufrieden. Die nächsten beiden Vorstellungen sind als ausverkauft angezeigt; es gibt La Traviata aber noch insgesamt zwölf Mal bis zum 9. Mai 2014. Der Premierenabend wurde vom Hessischen Rundfunk direkt übertragen.
Manfred Langer, 08.12.13 Fotos: Barbara Aumüller
WOZZECK
Doppelabend: Manfred Gurlitt und Alban Berg 2. Kritik
Besuchte Vorstellung: 24. 11. 2013 (Premiere: 27. 10. 2013)
Zwei Opern - eine textliche Vorlage
Da ist das Staatstheater in Darmstadt schon ein Abenteuer eingegegangen: Es präsentierte den „Wozzeck“ gleich zweimal. Zu Beginn erklang die Oper von Manfred Gurlitt, nach der Pause folgte Alban Bergs Version. Beide Werke beruhen auf dem Stück „Woyzeck“ von Georg Büchner, den das Staatstheater Darmstadt zu dessen Gedenkjahr auf diese Weise in gleichem Maße ehrte wie die beiden Komponisten. Gurlitt hatte mit Büchners Schauspiel im Jahre 1913 in München erstmals Bekanntschaft gemacht, Berg lernte es 1914 in Wien kennen. Beide Tonsetzer waren derart begeistert von dem Werk, dass sie unabhängig voneinander beschlossen, daraus eine Oper zu machen. Bergs Komposition schaffte es am 14. 12. 1925 an der Berliner Staatsoper unter Erich Kleiber zuerst auf die Bühne, Manfred Gurlitts Vertonung des Stoffes wurde einige Monate später am 22. 4. 1926 in Bremen, wo der Komponist zu dieser Zeit das Amt des Generalmusikdirektors bekleidete, aus der Taufe gehoben. Es ist der Darmstädter Oper hoch anzurechnen, dass es diese beiden Stücke zusammen an einem Nachmittag präsentierte und damit einen unmittelbaren Vergleich beider Opern ermöglichte, was sich als sehr interessant erwies.

Gurlitt: David Pichlmaier (Wozzeck), Anja Vincken (Marie)
Gurlitts und Bergs Kompositionen unterscheiden sich grundlegend. Das beginnt schon beim äußeren Aufbau der Stücke. Gurlitts musikalische Tragödie besteht aus 18 Szenen und einem Epilog, Bergs Oper aus 15 Szenen. Vom einen vertonte Szenen fehlen beim anderen und umgekehrt. So vermisst man bei Gurlitt doch stark das dramaturgisch sehr wichtige erste Gespräch der Titelperson mit dem Doktor. Dafür hat er in sein Werk aber die Szene integriert, in der Wozzeck das spätere Mordmesser kauft und später seinem Freund Andres seine letzten Habseligkeiten schenkt. Der gesellschaftskritische Aspekt, dem Berg starkes Gewicht beimisst, ist bei Gurlitt zugunsten der Betonung der Leiden des Titelhelden fast gänzlich zurückgedrängt. In Bergs Oper hören am Ende der Doktor und der Hauptmann den Ertrinkenden, bei Gurlitt sind es zwei Bürger. Auch die Zuordnungen der Stimmen fallen teilweise verschieden aus. Wozzeck ist in beiden Opern ein Bariton, Andres ein Tenor. Der Doktor dagegen wird bei Berg von einem Bass, bei Gurlitt von einem Tenor gesungen. Bei Gurlitt sind der Tambourmajor und der Hauptmann Baritone, während sie bei Berg beide für Tenöre geschrieben sind. Maries Sopran hat bei Berg eine tiefere, fast mezzoartige Tessitura als bei Gurlitt, der diese Rolle etwas höher angesiedelt hat.

Gurlitt: David Pichlmaier (Wozzeck), Anja Vincken (Marie)
Rein musikalisch dominieren ebenfalls die Gegensätze. Beide Werke weisen ein großes Orchester auf, das sich indes nur bei Berg in voller Tutti-Wirksamkeit entfalten kann. Bei Gurlitt schälen sich immer wieder einzelne Instrumentengruppen aus dem riesigen Orchesterapparat heraus, während die anderen Musiker schweigen, was einen recht kammermusikalischen Charakter ergibt. Bei Berg nimmt das Ganze ein ausgesprochen symphonisches Gepräge an - der ganze zweite Akt stellt eine einzige Symphonie mit Gesang dar -, bei Gurlitt haben wir es eher mit einem Kammerspiel asketischer Art zu tun. Während Berg die durchkomponierte Form unter Verwendung der Leitmotivtechnik wählt, auf die sein Berufskollege verzichtet, und die einzelnen Bilder nahtlos ineinander übergehen lässt, reiht Gurlitt die einzelnen musikalisch in sich abgeschlossenen Szenen sequenzartig aneinander und reichert sie mit Formen der absoluten Musik an, wie beispielsweise Ostinato, Chaconne, Fuge und Fugato. Dabei stützt er sich auf eine der erweiterten Tonalität verpflichtete, romantisch angehauchte Klangsprache, während Berg ganz auf Dodekaphonie setzt und innerhalb der Abschnitte ebenfalls mit den verschiedensten musikalischen Formen aufwartet, so Suite, Sonate, Rondo, Fuge, Rhapsodie etc. In puncto spezifischer Klangfarben hat wiederum Gurlitt die Nase vorne. Gänzlich unterschiedlich gestaltet weisen beide Stücke mithin ein ganz eigenes musikalisches Gepräge auf, deren Gegenüberstellung einen großen Reiz ergibt.

Gurlitt: David Pichlmaier (Wozzeck)
Die beiden Werke werden vom Hausherrn John Dew gekonnt in Szene gesetzt. Er macht aus den Opern keine Ausstattungsstücke, sondern lässt das Ganze in äußerst spärlich eingerichteten Räumen spielen, für die Dirk Hofacker verantwortlich zeichnet. Gurlitts „Wozzeck“ wird von kargen Betonwänden dominiert, die mit Hilfe der Drehbühne gegenseitig verschoben werden und sich derart zu einem Raum zusammenfügen können und so die einzelnen Spielorte bilden. Bei Bergs Stück spielt sich die dramatische Handlung oftmals in einem total leeren Raum ab. Da fällt das aus dem Boden aufsteigende, reichhaltig eingerichtete Wissenschaftslabor des Doktors samt des als Kleiderständer benutzen Skelettes fast etwas aus dem Rahmen. In beiden Fällen weiß Dew die Stärke des Raumes hervorragend zu nutzen und mit eindrucksvollen, sehr ästhetischen Lichtstimmungen - ein Bravo für den Beleuchtungsmeister! - zu versehen. In diesem Ambiente lässt er das Geschehen jeweils mit einer ausgezeichneten, flüssigen und intensiven Personenregie geradlinig, schnörkellos und ohne jegliche Verfälschungen ablaufen, wobei er - darauf verweisen José-Manuel Vázquez’ gelungene Kostüme - Gurlitts „Wozzeck“ in der Biedermeierzeit ansiedelt, denjenigen von Berg dagegen in der Entstehungszeit des Werkes, der Weimarer Republik, spielen lässt. Das Auseinanderdriften des zeitlichen Rahmens bei jeweils gleicher Thematik unterstreicht dabei trefflich die Zeitlosigkeit des Stoffes. Die dargestellten Konflikte können in jeder Ära auftreten. Durch den fast leeren Raum erfahren diese eine treffliche Focussierung. Hier lenkt kein äußerer Prunk von den Nöten Wozzecks ab. Lediglich die Szene, in der bei Berg die Unterbühne zu den Wellen des Sees mutiert, in denen Wozzeck sein Leben aushaucht, mutete entbehrlich an. Das war aber nur eine Kleinigkeit. Ingesamt sind Dew zwei gute, in keinster Weise zueinander in Beziehung gesetzte bzw. aufeinander aufbauende Regiearbeiten gelungen. Schade nur, dass er dabei nur stets stark am jeweiligen Text entlang inszenierte, ohne dabei mit einem stringenten übergeordneten Konzept politik- oder gesellschaftskritischer Art aufzuwarten. Da hat dann doch leider etwas Wesentliches gefehlt.

Berg: Ralf Lukas (Wozzeck)
Hervorragend schnitt Martin Lukas Meister am Pult ab, der sich zusammen mit dem Staatsorchester Darmstadt mächtig ins Zeug legte und jeder der beiden Opern mit ungeheurer Brillanz und klanglicher Finesse zum Besten gab. Die Tongebung war über den ganzen Nachmittag hinweg überaus prägnant und wies jede Menge eindringlicher Akzente auf. Dramatischen Passagen wurde genauso viel Beachtung geschenkt wie den dynamisch fein abgestuften lyrischen Stellen der Partituren, die er sehr emotional ausdeutete. Wieder einmal wurde deutlich, dass Meister mit den Musikern in den letzten Jahren hervorragende Aufbauarbeit geleistet hat.

Berg: Ralf Lukas (Wozzeck)
Bei Gurlitt war David Pichlmaier ein mit wunderbarer italienischer Technik, klangschön und elegant singender Wozzeck. Einen guten Eindruck hinterließ in Bergs Oper auch Ralf Lukas, dessen Bariton in dieser Rolle besser focussiert klang, als man es sonst von ihm gewohnt ist. Darstellerisch wurden beide Sänger dem geschundenen Soldaten mit intensivem Spiel voll gerecht. Von den beiden Maries vermochte Yamina Maamar (Berg) mit vollem, rundem und recht dramatisch eingesetztem Sopran besser zu gefallen als Anja Vincken (Gurlitt), deren oftmalige spitze Höhen eine tiefere Stütze gut hätten vertragen können. Das gilt in jeder Beziehung auch für den sehr dünnen Tenor von Minseok Kim, der in beiden Werken den Andres sang, den zumindest schauspielerisch überzeugenden Hauptmann von dem aus Stuttgart herbeigeeilten Thorsten Hofmann (Berg), Lasse Penttinen (Doktor bei Gurlitt und zweiter Handwerksbursche bei Berg), Lawrence Jordans Narren (Berg) und den Juden von Juri Lavrentiev (Gurlitt). Einen prächtigen, gut gestützten Bariton brachte Oleksandr Prytolyuk für Gurlitts Tambourmajor mit, der seinen Part genauso einrucksvoll bewältigte wie sein mit bestens gestütztem, dunkel timbriertem und kräftigem Tenor singende Rollenkollege Joel Montero bei Berg. Mit sonorem, ausdrucksstarkem Bass gab Thomas Mehnert bei Gurlitt den Hauptmann und bei Berg den Doktor. Die Margaret bei Gurlitt bzw. Margret bei Berg war bei den fundiert intonierenden Mezzos Gundula Schulte und Anja Bildstein in guten Händen. Letztere gab bei Gurlitt auch die Altstimme, der sich die tiefgründig singende Aki Hashimoto als Sopranstimme anschloss. Stimmlich tadellos präsentierten sich Werner Volker Meyer als zweiter Bürger (Gurlitt) und Soldat (Berg) sowie Stephan Bootz (Erster Handwerksbursche). Als Kind bei Berg war der junge Marco Schreibweiss zu erleben. Einen gefälligen Eindruck machte der von Markus Baisch trefflich einstudierte Chor.
Ludwig Steinbach, 25. 11. 2013 Die Bilder stammen von Barbara Aumüller
Weitere Bilder unten bei der Premierenbesprechung

Die Gurlitt-Rarität gibt es als CD von Capriccio, C60052
Lesen Sie unsere CD-Besprechung
Sensationeller Doppelabend
WOZZECK im Doppelpack
Manfred Gurlitt | Alban Berg | Zwei Opern nach dem Dramenfragment Woyzeck von Georg Büchner
Premiere am 27.10.2013
Eine fulminante Doppelproduktion, bei der alles stimmt
Dass zwei Opern den gleichen Stoff behandeln, ist nicht selten. Dass mehrere Komponisten das gleiche Libretto vertonen, ist seit Metastasio unüblich geworden. Dass zwei Komponisten gleichzeitig und unabhängig voneinander von dem gleichen Dramenfragment fasziniert werden und darauf eine Oper komponieren, ist wohl im Falle des Wozzeck einmalig. Manfred Gurlitt hatte Büchners Werk bei einer Aufführung am Residenztheater in München 1913 kennengelernt, wo er für die Bühnenmusik selbst verantwortlich war; Alban Berg sah das Stück ein Jahr später in Wien. Beide beschlossen spontan, den Büchner-Text zu vertonen. Berg war zuerst fertig und sah sein Werk 1925 in Berlin durch Erich Kleiber uraufgeführt. Wenige Monate später kam Gurlitts Version in Bremen zur Uraufführung, wo er zu der Zeit Generalmusikdirektor war. Gurlitt, der als Kulturbolschewist und wegen einer angeblich jüdischen Großmutter ab 1933 in Deutschland nicht mehr aufgeführt werden durfte, emigrierte 1939 nach Japan. Selbst dort behinderte ihn der lange Arm Goebbels‘ bei seiner Berufsausübung als Komponist, Dirigent und Lehrer. Er kehrte nach dem Krieg nicht mehr nach Deutschland zurück, wo sich auch niemand mehr für seine Werke einsetzte. Immerhin erhielt er einen Orden der BRD, gehörte aber letztlich zu der Gruppe von früher erfolgreichen Komponisten wie Schreker, Korngold, Braunfels oder Zemlinsky, die 1933 aus den Konzertsälen und von den Spielplänen der Opernhäuser in Deutschland verbannt wurden und die nach dem Krieg zunächst durch Nichtbeachtung noch einmal bestraft wurden. Stilistisch hat seine Musik mit den vorgenannten Zeitgenossen allerdings wenig gemeinsam.

Gurlitt: Anja Vincken (Marie), David Pichlmaier (Wozzeck)
Es ist ein besonderes Verdienst des Darmstädter Hauses, dass es sich des Gurlitt-Werks überhaupt annimmt, das immer noch so gut wie unbekannt ist. Das ist dem Büchner-Jahr zu verdanken. Es muss auch als Wagnis angesehen werden, dem Publikum an einem Abend den Stoff gleich zweimal anzubieten, dessen unfrohe Handlung keine leicht verdauliche Kost darstellt, dessen Texte zu über 80% die gleichen sind und der eine Modernität des Musikstils bietet, der noch immer nicht den Hörgewohnheiten des traditionsverhafteten Publikums entspricht. Diese Modernität von Text und Musik für beide Werke ist auch heute noch ein Schlüsselerlebnis, obwohl der Text fast 200 Jahre und die Musik fast 100 Jahre alt ist. Gurlitts Oper ist mit 70 Minuten Spielzeit kein abendfüllendes Werk; Sie muss mit einer anderen Oper zu einem Doppelabend kombiniert werden. Dass die Darmstädter den Stoff „mit sich selbst“ kombiniert haben, wird sicher eine Ausnahme bleiben und ist der speziellen Situation 2013 in Darmstadt geschuldet. Gurlitts Oper verdient mehr Aufmerksamkeit, Möglichkeiten zur Kombination mit anderen kurzen, großorchestrierten Opern aus der ersten Hälfte des 19.Jhdts. gibt es genügend.

Gurlitt: Lasse Penttinen (Doktor), David Pichlmaier (Wozzeck), Thomas Mehnert (Hauptmann)
Der Intendant des Darmstädter Staatstheaters John Dew gibt in seiner letzten Spielzeit in Darmstadt natürlich auch auf der Schauspielseite Büchners Werken viel Raum. Bei den beiden Wozzeck-Opern hat er zudem selbst die Regie übernommen. Sein „altersweiser Regiestil“ zeichnet sich durch große Klarheit und eine abgehobene Ästhetik aus, die ihn weder in Konflikt mit den Adepten des modernen Regietheaters bringt noch die Anhänger konventioneller Theaterkultur vergrault. Wie aber würde er an einem gut dreistündigen Abend zweimal den gleichen Stoff gut voneinander abgesetzt in Szene setzen? Das ist ihm – das sei vorab bemerkt – glänzend gelungen.
Gurlitt verwendet 18 Szenen aus Büchners Werk und Text und fügt einen Epilog hinzu. Die erste Doktorszene fehlt, die Texte sind stärker eingekürzt; ohne Zwischenmusiken reihen sich die Bilder aneinander, wodurch die Oper ca. eine halbe Stunde kürzer ist als Bergs „Standardwerk“. Dirk Hofacker hat eine seelenlose gebrochene Betonklotzarchitektur auf die Drehbühne gestellt; durch Bühnendrehungen und Verschiebungen werden in rascher Folge wie bei Fernsehüberblendungen die Spielflächen der einzelnen glaubhaft Szenen variiert; hinzu kommen spärliche Requisiten. Zusammen mit einer ausdrucksvollen Lichtregie (das Programm nennt für die Beleuchtungsregie mit John Dew, Dieter Göckel, Dirk Hofacker und Heiko Steuernagel gleich vier Verantwortliche) wird in der losen Szenenfolge die Aufmerksamkeit jeweils auf die Handelnden konzentriert. Eine in Bezug auf Klarheit und Verständlichkeit gelungene Regiearbeit mit stringenter Personenführung.

Gurlitt: David Pichlmaier (Wozzeck), Anja Vincken (Marie), Oleksandr Prytolyuk (Tambourmajor), Opernchor
Gurlitt benötigt für seine Musik ein großes Orchester: einen Apparat von fast 40 Streichern, alle Bläser vierfach, dazu Harfe und Schlagwerk. Er setzt den Klangkörper aber nicht in opulenten Tutti ein, sondern löst zu jeder Szene eine kleine Gruppe kammermusikalischen Charakters aus dem Orchester, womit er jeweils zu sehr spezifischen Färbungen kommt. Die Orchestermusik ist teils rein grundierend, teilweise begleitend und teilweise in polyphonen Kontrast zu den Gesangslinien gesetzt. Dazu erklingen Chorkommentare sowie kurze Passagen einer Sopranistin und eine Altistin aus dem Off. Ein richtiger Chorauftritt begleitet nur die Volksfestszene, zu welcher Gurlitt einen trivialen Onestepp komponiert hat (Berg verwendet hier einen Walzer). GMD Martin Lukas Meister leitete das souverän aufspielende Staatsorchester Darmstadt; die ausdrucksstarke und teilweise programmmusikalische Partitur und deren lapidare Kompromisslosigkeit bleibt im tonalen Bereich und endet in einer länger ausgedehnten Trauermusik, zu der im Epilog Wozzeck auf dem Seziertisch des Doktors endet.

Berg: Marco Schreibweiss (Mariens Knabe), Yamina Maamar (Marie), Ralf Lukas (Wozzeck)
Alban Berg: Dew lässt die ersten Szenen auf der nackten Bühne spielen. Spärliches Mobiliar wie ein Friseursessel mit kleinem Konsoltischchen oder gerade nur ein Stuhl (für Maries Wohnung), werden mit dem Hebewerk auf die Bühnenfläche gebracht. Dafür hat der Zuschauer einen Blick auf die grandiosen Beleuchtungsbrücken, die eindrucksvoll bewegt werden. Dann kommt aber als Kontrastprogramm eine Arztpraxis mit einem bühnenbreiten Vitrinenschrank und allerhand Ausstellungsmaterial heraufgefahren: Der Doktor hängt, bevor er sich mit Wozzeck über Schöpsenfleisch und Bohnen unterhält, seinen Mantel an einem Skelett auf. Auch zur Volksfestszene wird ein opulentes Bühnenbild präsentiert; das geht ganz hinten auf der riesigen Bühne auf, wo auch die Bühnenmusik platziert ist. John Dew präsentiert in der vorletzten Szene seine gesamte luxuriöse Untermaschinerie, mit deren vielfach abgeteilten Hebebühnen die Wellen des Sees imaginiert werden, in welchem Wozzeck ertrinkt. In dieser zweiten Oper wiederholt die Regie keine einzige Szene, keine einzige Bewegung aus der ersten. Aber es gibt doch eine Verklammerung der beiden Stücken in den überaus gelungenen, aussagestarken funktionalen Kostümen von José-Manuel Vázquez, der die gleichen Rollen sehr ähnlich und farblich jeweils gleich einkleidet; für das Gurlitt-Stück in schlichtem Biedermeier-Stil, für die Berg-Oper in der Mode um 100 Jahre in die zwanziger Jahre verschoben. Abgesehen von den beiden Ausstattungsschmankerln führt auch bei der Berg-Oper die starke Reduktion der Bilder zu einer eindrücklichen Konzentration auf die beiden Hauptfiguren Wozzeck und Marie und die schlaglichtartige Beleuchtung ihres Umfelds. Eine starke Inszenierung!

Berg: Ralf Lukas (Wozzeck), Thomas Mehnert (Doktor)
Natürlich stand auch bei der Berg-Oper wieder Martin Lukas Meister am Pult des Orchesters, das er zu einer Meisterleistung führte. Gewaltige emotionale Eruptionen kontrastierten mit feinsten Lyrismen. Selten hört man die Partitur so scharf und prägnant differenziert und mit so überzeugender Dynamik. Seine Musiker folgten ihm dabei mit bester Präzision. Glänzend auch der kurze Auftritt des von Markus Baisch einstudierten Chors. Ein schöner Einfall war auch, die Militärmusik quadrophonisch so in den Zuschauerraum einzuspielen, dass der Eindruck eines vorbeiziehenden Heeresmusikkorps entstand. Dass Dirigent und Orchester am Ende ebenso gefeiert wurden wie die Darmstädter Lieblingssänger, war eine gerechte Belohnung für diesen großen Orchesterauftritt.

Berg: Mitte: Joel Montero (Tambourmajor), Ralf Lukas (Wozzeck), Opernchor
Achtzehn Sänger waren zur Aufführung der beiden Stücke aufgeboten. Es wäre sicher interessant zu erforschen, warum die beiden Komponisten den gleichen Figuren teilweise ganz unterschiedliche Stimmlagen zugeschrieben haben. Es kommt allein dadurch auch zu einer differenzierten Personencharakterisierung, die vor allem bei den Figuren Hauptmann und Doktor hervorsticht. In der Titelrolle hat Gurlitt einen Bariton vorgesehen. David Pichlmaier gab ihn mit sehr jugendlicher Gestalt, wendigem Spiel und edlem schlanken Bariton. Berg hat die Rolle für einen Bassbariton gesetzt; hier begeisterte Ralf Lukas das Publikum, ein häufiger und gern gesehener Gast am Staatstheater, der mit seiner sonoren kräftigen Stimme eine Idealbesetzung dieser Rolle darstellte. Anja Vincken gab die Gurlitt-Marie mit schön eingedunkelter, geschmeidiger Mittellage, in der Höhe aber nicht ohne Härte und nicht so gut textverständlich. Auch diese Rolle setzt Berg etwas tiefer für einen dramatischen Sopran; sie wurde vom Darmstädter Publikumsliebling Yamina Maamar mit warmer Grundierung und schön leuchtenden Höhen gegeben. Thomas Mehnert sang den Gurlitt-Hauptmann und den Berg-Doktor jeweils mit gut fundiertem, warm strömendem Bass, und Minseok Kim war in beiden Opern für die Tenorrolle des Andres besetzt und gab sie mit klarer, hell timbrierter Stimme, wobei ihm die Berg-Partie sichtlich besser lag. Lasse Penttinen sang die bei Gurlitt deutlich kleinere Rolle des Doktors mit einem satten baritonalen tiefen Register und den giftigen Höhen eines Charaktertenors. Zudem gab Penttinen den 2. Handwerksburschen bei Berg. Seine Entsprechung in der Berg-Partitur fand er in Peter Koppelmann als Hauptmann, der aus seinem sonoren baritonalen Parlando zu unnatürlichen, parodistischen Höhen aufsteigen muss, die er mit Kopfstimme und auch im Falsett gestaltete: eine skurrile Charakterstudie. Oleksandr Prytolyuk gab den Gurlitt-Tambourmajor, dessen kräftiger, runder Bariton nicht ganz zu der Rolle des eitlen Prahlers passen wollte, für den er die passende Bühnenerscheinung mitbrachte. Bei Berg ist diese Rolle für einen Tenor gesetzt; Joel Montero gab ihn mit tenoraler Kraft und schönem Schmelz.Marco Schreibweiss spielte die Rolle von Mariens Knaben rührend mit großer Hingabe. Auch die vielen kleinen Rollen waren gut besetzt, so dass der Abend eine geschlossen hohe musikalische Leistungsdicht zeigte, die sich zusammen mit den gekonnten originellen Inszenierung zu einem Abend der Spitzenklasse ergänzte, in der die fulminante Berg-Aufführung den beherrschenden, nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Berg: Ralf Lukas (Wozzeck), Yamina Maamar (Marie)
Publikumsbeschimpfung: In der Pause, noch vor dem stärkeren Teil des Abends hatten auf den besseren Plätzen im Parkett Dutzende von Premierenabonnenten vorgezogen, nach Hause oder in ein Restaurant zu gehen; es klafften große Lücken. Das spricht nicht gegen die Werke, sondern gegen das Kunstinteresse oder -verständnis dieses Teils des Publikums. John Dew hatte in seinem Beitrag zum Programmheft schon vorausschauend festgestellt, dass das deutsche Publikum bis heute Bergs Wozzeck gegenüber eine deutliche Reserve bewahrt hat. Aber in Frankfurt wäre niemand zur Pause gegangen...
Der Abend war gut besucht, aber auch nicht annähernd ausverkauft. Das Publikum feierte die Ausführenden anhaltend und mit Begeisterung. Empfehlung des Opernfreunds: Lassen Sie sich diesen grandiosen und interessanten Opernabend nicht entgehen. Der kommt wieder am 2. November und noch weitere vier Male bis zum 18. Januar.
Manfred Langer, 28.10.13
Unser besonderer Dank für die Überlassung der ausdrucksstarken Fotos gilt Barbara Aumüller
DAS LIEBESELIXIER
Premiere am 28.09.13
Dulcamara kommt mit dem Dampfer in eine gelangweilte und langweilige Spaßgesellschaft; Präferenz für oberflächliche Unterhaltung
Von den über siebzig Opern Donizettis, die er angeblich teilweise auf Reisen in der Postkutsche geschrieben hat, zählt „Das Liebeselixier“ (L’elisir d’amore) zu den zwei meistaufgeführten. Das Libretto von Felice Romani beruht auf „Le Philtre“, einem Opernbüchlein, das in der Schreibfabrik von Eugène Scribe für eine Oper von Auber entstanden war. Die Uraufführung 1832 in Mailand leitete, nachdem sich Rossini vom Opernschreiben zurückgezogen hatte und bevor Verdi bekannt wurde, die letzte Dekade des Belcantismus ein, deren dominierender Komponist Donizetti wurde, nachdem auch Bellini 1835 gestorben war. Die Einfachheit und dabei erstaunliche Logik der Geschichte mit den Figuren, die sich von der commedia dell’arte ableiten lassen, die Eingängigkeit der Melodien und die Überschaubarkeit der Begleitpartitur machen dieses spritzige Werk neben Rossinis barbiere zur beliebtesten Buffa der Belcantozeit. Schon 1841 kam die Oper nach Darmstadt.

Bild 3: Margaret Rose Koenn (Adina), Arturo Martín (Nemorino)
Das Stück hat eine Handlung mit der für die Oper typischen klassischen personellen Viererkonstellation mit Sopran, Tenor und zwei tiefen Männerstimmen. Hier ist es der naive Bauer Nemorino, seine angebetete Adina, die mit ihm spielt, der eitle Unteroffizier Belcore, der dem Nemorino die Adina wegschnappen will, und Der Quacksalber Dulcamara („Süßsauer“), der unabsichtlich die Handlung in die richtige Richtung zum lieto fine bringt. Wer kriegt da wohl wen? Diese Handlung lässt sich problemlos fast überall hin verlagern; umso besser, wenn da noch ein Zug Soldaten hinpasst. Michael Schulz, Intendant des „Musikththeaters im Revier“ (MiR) in Gelsenkirchen (In Gelsenkirchen kann man auch noch etwas anderes machen, als nur alle vierzehn Tage zum Fußball gehen.) hat das Stück für die Semperoper in Dresden inszeniert. Nun wurde die Produktion nach Darmstadt übernommen. Er verlegt die Handlung in einen heruntergekommen Tanzschuppen, in welchem nach dem Krieg in den 50er Jahren gerade die gröbsten Schäden beseitigt waren. Die Fenster sind noch verbrettert, die Decken heruntergebrochen. Die mit viel Liebe zum Detail gestaltete Bühne hat Dirk Becker entworfen. An einfachen Tischchen sitzt eine gelangweilte und langweilige Tanzteegesellschaft – einige starren nur dämlich vor sich hin, andere lesen Zeitung, zwei oder drei Paare schwofen lustlos. Die teuren Pflichtgetränke auf den Tischen werden nicht angerührt. Die bunt gemischten zeitentsprechenden Kostüme sind von Renée Listerdal. An der Seite befindet sich ein Stapel Matratzen. Adina liegt darauf und frönt ihrer Leseleidenschaft. Der dümmliche Nemorino streunt mit einem Stoffbeutel durch diese Gesellschaft, weil er in der Nähe Adinas sein will.

Kyung-Il Ko (Dulcamara), Lydia Ackermann (Giannetta)
So weit so gut, das könnte eine gute Ausgangskonstellation für das quirlige Geschehen sein. Ist es aber nicht. Der Parkettboden wölbt sich hoch, Belcore und seine acht Infanteristen kommen aus dem Keller hochgekrochen. Aus dem Kohlenkeller kommen sie wohl nicht, denn sie sind in weiße Overalls à la SpuSi gekleidet. Derer entledigen sie sich langatmig, und bis sie zu ihren schönen historischen Ausgehuniformen auch den Dreispitz und den Federbusch aufgesetzt haben – alles bestens synchronisiert mit den Vorgaben des Sergeanten - kommt schon der erste Gähner auf. Dass die Soldaten dann in etwa einem Dutzend weiterer Auftritte alles exakt chronometriert ihrem Vorgesetzten nachmachen, gerät dann zu lästig aufgesetzter Fantasielosigkeit. Der „Witz“ wird aber noch gesteigert, als diese Soldaten in einem schnell aufgeschlagenen Zweimannzelt verschwinden – und zwar alle Acht! Der Mann am Klavier auf der, der mit der Begleitung der secco-Rezitative nicht ausgelastet ist und nebenher ein Buch liest, tritt überdies etliche Male geistesabwesend mit einem Luftballon zur Bühnenmitte, den er durch das kaputte Dach aufsteigen lassen will. Erst beim fünften Versuch fällt der nicht mehr geplatzt zurück auf die Bühne. Das sollte wohl Situationskomik sein. Zur Feier der Verlobung zwischen Adina und Belcore kommt aus dem gleichen Deckenloch ein schöner Kronleuchter heruntergefahren. Daneben gibt es noch jede Menge weiterer Blödel- oder Nonsense-Gags auf RTL-Niveau, auf die nur einige wenige im Publikum ansprechen. Schulz hat das sicher gut gemeint, aber Gag heißt eben noch nicht Esprit, Witz oder gar Niveau. Dass sich Dulcamara die Reste des Festessens einfüllt, hat man auch schon gesehen. Nicht aber – und hier hat sogar der Nonsense etwas Niveau - dass er zuvor mit einem Schiff in die Szene gefahren kommt, statt wie sonst mit ape, Lieferwagen oder Pferdekutsche. Dass man sich am Meer mit Ozeananschluss befindet, wird zum Schluss noch einmal verdeutlicht: Nachdem sich alle liebhaben, werden die Bretter von den Fenstern gerissen: Ausblick auf die See. Aus nicht offensichtlichen Gründen sticht Dulcamaras Schiff ohne ihn wieder in See. Ein Renner wird diese Produktion auch in Darmstadt nicht werden.

Die musikalische Seite des Abends zeigte sich auch durchwachsen. Donizetti komponierte die Oper in knapp zwei Wochen, rezyklierte dabei sogar (eigenes) älteres Material und hatte natürlich nicht besonders viel Zeit, aus seinem überkommenen „stereotypen Formelkram“ (Uwe Schweikert) in Melodik, Begleitung und Harmonik herauszukommen. Aber dennoch lieben wir ja die beschwingte Musik, nehmen die einfach-klassischen harmonischen Wendungen an und erfreuen uns an der Leichtigkeit der Melodien. Elias Grandy gewann aber mit dem
Staatsorchester Darmstadt in kleiner Besetzung zunächst nicht recht den Zugang zur Partitur. Die Ouvertüre klang trocken, die kurzen kontrastierenden Passagen wurden nicht verbunden, durch Generalpausen fiel das eher auseinander. Auf das präzise aufspielende Orchester hingegen war Verlass. Im Verlauf kam
Margaret Rose Koenn (Adina), David Pichlmaier (Belcore)
mehr Inspiration in die Orchesterbegleitung, die aber dennoch immer wieder in den Stil einer Kurkapelle zurückfiel. Grandy bevorzugte streckenweise sehr ambitiöse Tempi und ließ bei den Stretten in bester Rossini-Manier so anziehen, dass das Bühnenpersonal Probleme hatte zu folgen. Diesbezüglich ist die Partitur nicht ohne Schwierigkeiten, denn auch der Chor muss da gut eingebunden sein. Dass es hier und da noch klapperte, wird sich sicher noch beheben lassen, zumal der klangschöne Chor von Markus Baisch gut einstudiert war. In immer bunteren Kleidern bewährte der sich auch in den bewegten Szenen und war schauspielerisch gefordert.

Margaret Rose Koenn (Adina), David Pichlmaier (Belcore), Opernchor und Statisterie
Die Darmstädter Produktion wurde auf Deutsch (ohne Übertitel) in der Übersetzung von Joachim Popelka gesungen. Das ist durchaus problematisch. Denn die sängerischen Zungenbrecher sind für die Solisten in der konsonantenreicheren deutschen Sprache noch schwerer zu bewältigen; da kann die Artikulation nicht dazugewinnen. Der Zuschauer ist vom Lesen der Übertitel befreit, aber die Textverständlichkeit bleibt doch auch bei allen Anstrengungen so begrenzt, dass größere Teile des Texts verloren gehen. Hier lag auch das Hauptmanko der sonst durchaus respektablen Besetzung. Für die Produktion sind in Darmstadt alle vier Hauptrollen doppelt besetzt. An diesem Premierenabend gab Margaret Rose Koenn die Adina mit adretter Bühnenerscheinung, beweglichem Spiel und ebenso beweglichem schönem Sopran mit einem erotischen leichten Vibrato in den hohen Passagen. Aber selbst bei einem Sopran könnte die Textverständlichkeit besser sein. Der Nemorino des Arturo Martín fiel dagegen ab. Sein heller Tenor verfügte über eine schöne Mittellage und brachte auch trotz Intonationsproblemen einige beachtliche Spitzentöne. Aber im Passagio hatte er Probleme, klang in hohen Lagen eng und musste einmal ins Falsett ausweichen. David Pichlmeier, von hochgewachsener Gestalt, brachte einen grundsoliden Belcore mit sehr guter Aussprache; die Regie hatte ihm aber ein recht hölzernes Spiel zugewiesen. Gemischt fiel der Eindruck von Kyung-Ol Ko als Dulcamara aus. Er sang mit schön fundiertem kultiviert-kräftigem Bariton, aber leider mit einer sehr starken koreanischen Einfärbung und Textverständlichkeit gegen null. Die Gianetta, mehr Chorführerin als Solistin, wurde von Lydia Ackermann gegeben.
Bei dem sehr gut besuchten, aber nicht ausverkauften Premierenabend zeigten sich in den Sitzreihen nach der Pause deutliche Lücken. Bei der Premiere eines Standardwerks ist es eher ungewöhnlich, dass Besucher nach Hause gehen. Der Beifall des Publikums war höflich und freundlich. Das Regieteam zeigte sich nicht. Anscheinend ist die Neueinstudierung der von der Semperoper in Dresden übernommenen Produktion in Darmstadt von der örtlichen Spielleitung geleistet worden. Nach dem ziemlich zähen Don Pasquale in der letzten Spielzeit, der vom Teatro la Fenice übernommen worden war, nun schon der zweite Donizetti, bei dem die Intendanz kein gutes Händchen gezeigt hat. Man kann sich das doch vorher ansehen und braucht nicht die Katze im Sack zu kaufen! Die Dresdner Kritiken waren auch nicht eben überschwänglich. Vom 5. Oktober bis zum 23. Januar wird der Liebestrank noch zehn Mal gegeben.
Manfred Langer, 29.09.13 Fotos: Barbara Aumüller
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich ohne Bilder auf der Seite Darmstadt des Archivs