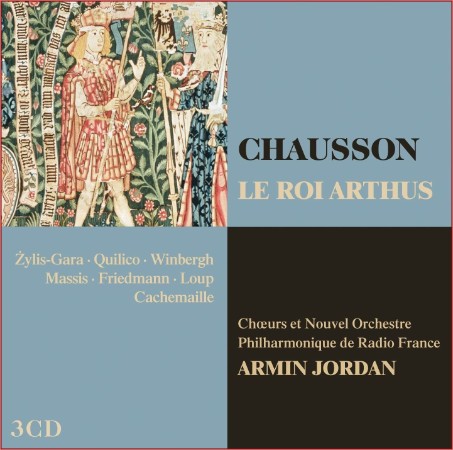Opéra Bastille


http://www.operadeparis.fr/
CENDRILLON
und Präsentation der Spielzeit 2022/23
Opéra National de Paris 29. 3. 2022
Erstaufführung

Cendrillon (Tara Erraught) schläft nicht im Kamin, sondern im Ofenrohr einer gigantischen Maschine, die rosa Ballkleider macht – die nicht für sie bestimmt sind.
Sie haben richtig gelesen: „Erstaufführung“! Und das bei einem der erfolgreichsten französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, der 35 Opern geschrieben hat, die beinahe alle in Paris uraufgeführt wurden. Aber die meisten in der Opéra Comique, weil Massenet dieses „genre“ mit gesprochenen Dialogen besonders liebte und sein Talent sich in dem kleineren Haus besonders gut entfalten konnte. Dort war er bis 1950 der meist gespielte Komponist (gleich nach Bizets „Carmen“), bis sein Stern erlosch und nun langsam an den großen Oper wieder zu strahlen beginnt (im Januar gab es nun auch eine erste „Cendrillon“ an der Met in New York, sei es in einer stark gekürzten englischen Fassung). Nachdem man an der Opéra de Paris im 21. Jahrhundert schon „Werther“ und „Manon“ mit Erfolg (wieder) spielt, holt der Intendant Alexander Neef nun „Cendrillon“ [Aschenbrödel] an das große Haus. Eine wunderbare Märchen- und Feen-Oper, en Meisterwerk – wenn man den richtigen Ton trifft. Dafür gibt es m. E. drei Bedingungen: man muss die Rolle des Prince Charmant mit einer Frau besetzen, einem „falcon“ (nach der Sängerin Marie Cornelie Falcon), ein Stimmtypus den Massenet besonders liebte und oft einsetzte. Denn leider wurde 1978 bei der allerersten Platteneinspielung („Welterstaufnahme“) die Rolle des Prinzen an Nicolai Gedda gegeben, was ein schwerwiegender Form- und Stilfehler ist – als ob man Cherubino oder Octavian mit einem Mann besetzen würde. Dann sollte man im Werk nicht so viel streichen, wie gerade in New York. Vor allem nicht die Ballette – sie gehören nun einmal zur französischen Oper des 19. Jahrhunderts und in diesem Fall zur musikalisch so wichtigen „höfischen Kultur“ des Werkes. Und natürlich einen Regisseur und Ausstatter engagieren, der Gespür hat für eine französische Hof-Märchen-Oper. Die beiden ersten Bedingungen wurden gut erfüllt, die dritte leider nur teilweise.

Eingekleidet für den Ball. Von rechts nach links: Lionel Lhote (Pandolphe), Daniela Barcellona (Madame de la Haltière), Charlotte Bonnet (Noémie), Marion Lebègue (Dorothée) und Tara Erraught (Cendrillon/Lucette) – in Küchenschürze.
Die Regisseurin Mariame Clément hat 2013 „Hänsel und Gretel“ an der Pariser Oper inszeniert (mit Anja Silja, die uns damals ein Merker-Interview gab) und schien deswegen eine logische Wahl. Aber Humperdinck ist nicht Massenet, ein Märchen von Grimm ganz anders als eines von Perrault – man braucht nur ihre beiden Fassungen von „Aschenbrödel“ zu vergleichen – und, mit Verlaub, französischer Esprit ist viel feiner als plumper deutscher Humor. Mariame Clément und ihre Ausstatterin Julia Hansen bauten ihre ganze Inszenierung auf einen „Gag“ auf: eine riesige Dampf-Maschine, die „Prinzessinnen machte“. Wenn man links eine Katze reinwarf und eine Menge schäbige Arbeiter an den richtigen Knöpfen gedreht hatten (eigentlich die auf Repräsentation gedrillten Hausangestellten von Mme de la Haltière), kam sie rechts im rosa Ballkleid wieder raus. Wegen dieser Maschine spielte die Handlung nicht hauptsächlich im vornehmen Palast der Haltières, sondern in einer trostlosen Fabrikhalle und starrten wir fast den ganzen Abend auf dieses 10 m breite und 9 m hohe Unding – genau wie auf die große, unnütze Hundehütte in ihrer letzten durch uns rezensierten Inszenierung („Barkouf“ von Offenbach, 2018 in Straßburg). Und so fand die zentrale Liebesszene nicht „unter einer Eiche im Feenwald“ statt, sondern in einem Keller zwischen vergammelten Wasserboilern (?) mit Tschernobyl-Look. Das ist besonders schade, denn dies alles geschah nur wegen diesem „Gag-Konzept“ und nicht – wie so oft – aus mangelndem Wissen oder Können. Denn an gewissen Details konnte man erkennen, dass beide Damen sich gut vorbereitet hatten: die Kostüme waren inspiriert durch damalige Stummfilme von Méliès (gute Idee!) und jeder Akt und jede Szene, die Massenet bezeichnenderweise „tableaux“ [Bilder] nannte, wurden eingeleitet durch eine Art „Scherenschnitt-Film“ von Etienne Guiol im Stile der damaligen „Projektionen“ des Chat-Noir (genau der richtige Ton: charmant!). Die Personenführung war präzise ausgearbeitet und für mich persönlich das Beste am Abend war die Chor-Choreographie im 2. Akt. Immer werden genau diese Ballette gestrichen, weil heute niemand mehr damit umzugehen weiß. Nun zeigt Mathieu Guilhaumon wie einfach es sein kann: unkomplizierte Polonäsen und Bewegungen, nicht zu viel, nicht zu wenig und immer der Musik folgend. Nachahmenswert! Dazu ein durchdachtes, aber dieses Mal stilvoll-dezentes Bühnenbild: der Prinz „einsam im Glashaus“ (das Palmenhaus des Wiener Burggartens) mit endlich mal atmosphärischer Beleuchtung von Ulrik Gad. Warum war nicht der ganze Abend so? Wäre das nicht genug gewesen?

Entspanntes Kennenlernen abseits des großen Hofballs: Der Prince Charmant [Traumprinz] (Anna Stéphany), der Cendrillon (Tara Erraught) aus ihrem Kleid geholfen hat und ihr seine Turnschuhe gibt. Im Hintergrund der König in Uniform (Philippe Rouillon) und der Chor der Opéra de Paris in der exzellenten Chor-Choreographie von Mathieu Guilhaumon.
Musikalisch war der Abend ähnlich durchwachsen. Carlo Rizzi dirigierte mit Können, aber das dünnbesetzte Orchester der Oper wirkte viel zu klein in dem riesigen Saal der Opéra Bastille. Es fehlte das Flimmern, das Schimmern und der „Silberschein“, den Massenet so liebevoll und oft sehr besonders – mit z.B. Kirchenglocken und Glasharmonika – für sein „contes de fées“ orchestriert hat (das einzige Mal, dass er diese Bezeichnung unter einen Operntitel schrieb). Und als der exzellent durch Ching-Lien Wu vorbereitete Chor der Opéra de Paris „à bouche fermée“ (mit geschlossenem Mund) sang, konnte man dies im Saal kaum hören. Alles verpuffte… Da hatten die Sänger keinen leichten Stand, da sie – außer im Palmenhaus – nicht durch das Bühnenbild unterstützt wurden. Tara Erraught und Anna Stéphany kamen als Cendrillon und Prince Charmant als Einzige gut über die Rampe. Sehr schade, dass dies nicht bei Daniela Barcellona der Fall war, eine erfahrene Sängerin, an die wir viele gute Erinnerungen haben. Denn die Stiefmutter Madame de la Haltière ist die eigentliche „Lokomotive“ der Handlung und ich habe noch nie die große Arie „Lorsqu’on a plus de vingt quartiers“ ohne Bühnenapplaus gehört. Kathleen Kim klang blass als gute Fee, so auch Lionel Lhote – doch das gehört bei ihm auch zur Rolle von Pandolphe [„Pantoffel“], der gutherzig-dumme Vater von Cendrillon. Die beiden „bösen Schwestern“ Charlotte Bonnet (Noémie) und Marion Lebègue (Dorothée) waren dieses Mal viel weniger „gemein“ als meist üblich und die sechs „Esprits“ (Gehilfen der Fee) wurden auch individuell charakterisiert (Corinne Talibart, So-Hee Lee, Stéphanie Loris, Anne-Sophie Ducret, Sophie Van de Woestyne und Blandine Folio Peres). Denn, wie erwähnt, die Personenführung und die Kostüme wurden präzise ausgearbeitet. Und so kann es sein, dass die Inszenierung viel besser im Kino wirken wird (mit Richtmikrofonen und „Close-Ups“). Am 7. April wird sie „live“ in den französischen Kinos ausgestrahlt und danach sicher auch als Stream – worüber wir uns sehr freuen. Denn das ist der Sinn der ganzen Sache: diese Werke wieder ins Repertoire der Pariser Oper aufzunehmen und einem größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen. Das einzig Positive für die Oper an der Pandemie ist vielleicht der enorme Publikums-Zuwachs per Internet und Streaming: nun 6,7 Millionen eingeschriebene Besucher auf der Homepage und über 1. Millionen Menschen die sich eine Oper zu Hause angucken mit der Plattform „L’Opéra chez soi“, die erst letztes Jahr entwickelt wurde.

Eine modernen Umsetzung der „Eiche im Feenwald“: die „gute Fee“ (Kathleen Kim) lässt in einem vergammelten Wasserboiler im Keller ein riesengroßes menschliches Herz schlagen – die zentrale Liebesszene und musikalischer Höhepunkt der Oper.
Präsentation der neuen Spielzeit 2022/23
Am Tag nach der besuchten Vorstellung gab der Intendant Alexander Neef seine erste Pressekonferenz „in live“ (letztes Jahr hatte es nur einen Stream geben können). Er empfing im berühmten Ballett-Probenraum unter der Kuppel des Palais Garnier, zusammen mit der Ballettdirektorin Aurélie Dupont. (Der verfrüht angetretene Musikchef Gustavo Dudamel ist noch nicht ganzjährig in Paris.) Neef zeigte sich bescheiden und als kluger Diplomat. Denn bevor man überhaupt etwas über die Pariser Oper sagen und schreiben kann, muss man sich vor Augen halten, unter welchen Bedingungen man seit zwei Jahren hier (nicht) arbeitet. Das ist eine vollkommen andere Situation als z. B. an der Wiener Staatsoper. Dort schrieben Dominique Meyer und Thomas W. Platzer am 12. Februar 2021 stolz im Geschäftsbericht, dass der „Eigendeckungsgrad“ 32 % betrug.
In Paris bekommt die Oper nur 43% ihres Budgets vom Staat. Sie muss also nicht 32 % sondern 57% selbst verdienen und das ist „gefühlt“ fast doppelt so viel. In den letzten zehn Jahren ist die staatliche Subvention dazu de facto um 13 % gesunken, was jede Spielzeit finanziell zu einem Drahtseilakt macht(e). Und irgendeine Not-Kasse für unvorhergesehene Fälle gab es natürlich schon lange nicht mehr. Diese traten nun mit einer Heftigkeit ein, die niemand sich hätte vorstellen können. Erst ab 2019 der längste Streik der Pariser Operngeschichte (für den der vorherige Intendant Stéphane Lissner objektiv nichts kann), dann die „Corona-Pandemie“, die für den gesamten französischen Kulturbetrieb viel schwerwiegendere Folgen hatte als in Deutschland und Österreich. Fazit: 175 Millionen € Einnahmeschwund (fast zwei ganze Jahresbudgets der Wiener Staatsoper!).
Die Opéra National de Paris wird also „noch mehrere Jahre brauchen“, um dieses Loch zu füllen und die Hauptaufgabe des Intendanten wird in den nächsten Jahren hauptsächlich darin bestehen, die „alte Dame“ (so wie man sie hier nennt) aus den roten Zahlen zu helfen.
Deswegen ist nicht zu denken an eine Fortsetzung des „Bieto-Ringes“, an dem geprobt wurde als die Pandemie ausbrach und mit dem Philippe Jordan sich aus Paris verabschieden wollte. Und für großspurige Neuinszenierungen ist schlicht und ergreifend kein Geld da. So wird die neue Spielzeit ab September hauptsächlich aus 11 Wiederaufnahmen bestehen des „klassischen Repertoires“ wie „Tosca“, „Carmen“, „La Bohème“ und „Tristan und Isolde“ (als einziger Wagner). Von den 6 Neu-Inszenierungen wurden die Hälfte an Regisseurinnen gegeben, wovon zwei mit Dirigentinnen arbeiten werden: Lydia Steier & Simone Young für „Salome“, Deborah Warner & Joana Mallwitz für „Peter Grimes“ und Valentina Carrasco & Gustavo Dudamel für „Nixon in China“. Ausruf im Saal: „Das gab es hier noch nie!“.
Der neue Schwerpunkt „selten oder nie an der Pariser Oper gespielten französische Opern“ wird nach Massenets „Cendrillon“ nächstes Jahr fortgesetzt mit „Hamlet“ von Ambroise Thomas (seit 1938 nicht mehr gespielt) und „Roméo et Juliette“ von Gounod (seit 1985). Frage: „Aber die wurden gerade vor wenigen Wochen an der Opéra Comique gegeben, könnten Sie sich nicht besser koordinieren?“. Antwort meinerseits: Man vergisst immer wieder, in welchen Bedingungen Alexander Neef angetreten ist. 3 von den 4 Opernintendanten in Paris haben während der Pandemie das Handtuch geschmissen, Langzeitplanung gab es generell hier nicht mehr – mit wem hätte er was koordinieren können? Wir wünschen dem Haus eine wieder normale Spielzeit 2022/23, indem alle 366 Vorstellungen (182 x Oper und 184 x Ballett – Konzerte, Opernstudio etc. nicht inbegriffen) wirklich stattfinden und die nun fast 400-jährige „alte Dame“ wieder in ruhiges und sicheres Fahrwasser kommt. Bonne chance !
Waldemar Kamer, 3.4.22
Foto: © Monika Rittershaus / Opéra National de Paris
PS
Live-Übertragung in den französischen Kinos am 7. April und danach auch als Stream
Informationen auf der Homepage der Opéra National de Paris: www.operadeparis.fr
„Turandot“
Opéra National de Paris 4. 12. 2021
Eine bejubelte Premiere in Paris: Einstand des neuen Chefdirigenten Gustavo Dudamel als Anfang der neuen Intendanz von Alexander Neef mit mutigen Plänen

Das Licht sagt alles aus: mit der Liebe, die wie ein weißer Strahl das Herz von Turandot (Elena Pankratova) trifft, wird die graue Welt plötzlich rot.
Es wirkte fast unwirklich, wie noch aus ante-Pandemia-Zeiten: eine rammelvolle, zu 100% ausgelastete Oper, Weihnachtsstimmung mit Glühwein auf dem geschmackvoll dekorierten Place de la Bastille (alsob Bob Wilson ihn extra für die Premiere in blau beleuchtet hätte), und drinnen Champagne vor der Aufführung. Denn mit einem Glas in der Hand braucht man in Frankreich keine Gesichtsmaske zu tragen – einer der Gründe, weswegen in Paris im Herbst 2021 mehr als doppelt so viel Champagne getrunken wurde als im ganzen Jahr 2020! Es gab auch viel zu feiern. Die große Oper, an der im Dezember 2019 der längste Streik ihrer Geschichte anfing, ist nach zwei Jahren nun endlich aus den negativen Schlagzeilen. Über was in dieser dunklen Zeit passiert ist, könnte man am besten eine Operette schreiben. Mit als Hauptfigur Madame de Pompadour, die im 18. Jahrhundert die französische Kulturpolitik aus ihrem Palais de l’Elysée leitete, und die sich wohl wundern würde, wie stümperhaft und taktlos ihre Nachfolger/innen, dies heute an ihrem eleganten Schreibtisch tun. Schwamm drüber. Nach zwei Jahren hat die Opéra de Paris endlich einen neuen Intendanten und einen neuen Musikdirektor, die unter schwierigsten Umständen (verfrüht) antreten mussten und es nun schaffen, den festgefahrenen Dampfer an der Bastille wieder in Fahrt zu setzen. Dafür erst einmal: alle Achtung!
Der Deutsche Alexander Neef, der das Haus von früher kennt und es erst aus Kanada per Internet leiten musste, setzte im September als erste Oper „Oedipe“ von Georges Enescu an, 1936 an der Pariser Oper uraufgeführt und seitdem hier nicht mehr gespielt. Er erklärte seine Wahl mit dem Motto „Traumaverarbeitung“. Das ist ihm gelungen, denn alle sind nun froh wieder da zu sein und der neue Chefdirigent wurde vor der Premiere mit einem Applaus im Graben empfangen, so wie ich ihn selten hier gehört habe. „Turandot“ passt zu ihm, denn Gustavo Dudamel hat 2017 hier schon „La Bohème“ dirigiert, wo das Orchester sich gut mit ihm verstand und ihn nun offensichtlich gerne wiedersieht. Die „Neuinszenierung“ – mit solchen Begriffen nimmt man es in Paris nicht so genau - kommt aus Madrid, wo 2018 eine schöne DVD-Aufnahme gemacht wurde (bei Belair). Wir brauchen also nicht lange auf sie einzugehen.

Eine Bühnenbild-Überraschung: in „Nessun dorma“ irrt Calaf (Gwyn Hughes Jones) durch einen abstrahierten „Wald von Gefühlen“.
Die Ästhetik von Bob Wilson ist bekannt, manchmal funktioniert sie mit den Werken, manchmal nicht (so wie bei seinem Pariser „Ring“). Von seinen zehn Inszenierungen an der Pariser Oper, gehören zwei zum gern gespielten Repertoire: „Pelléas“ und, vor allem, seine „Butterfly“, 1993 hier „uraufgeführt“, seitdem durch die ganze Welt gereist und 2020 noch immer an der Bastille gespielt. Doch „Turandot“ ist eine unvollendete Oper – bis Mitte des zweiten Akts, wo Giacomo Puccini wegen eines Operationsfehlers in einer Brüsseler Klinik plötzlich verstarb. Franco Alfano hat verdienstvoll das Werk nach einigen Skizzen zu Ende komponiert (Finale II und ganzen Akt III), doch wirklich befriedigend ist seine Nachkomposition nicht. Denn er hat dabei nur einen Teil der Particelle benutzt. Da fehlt vor allem das geplante „große Liebesduo wie bei Tristan und Isolde“ (so Puccini), mit dem aus der kalten, rachehungrigen chinesischen Prinzessin eine liebende, menschliche Frau aus Fleisch und Blut werden sollte. Wie würden wir heute Isolde empfinden, wenn Wagners Liebesduo und der „Liebestod“ fehlen? Sie wäre nur „eine halbe Frau“ – wie Turandot. Die einzige Figur, die ganz so geworden ist, wie Puccini sie sich vorstellte, ist Liù, aus der er – übrigens ganz gegen die Vorlage von Gozzi – ein berührendes armes Mädchen machte wie seine Mimi. Puccini starb kurz nachdem er Liùs Tod im zweiten Akt fertiggestellt hatte. Was folgt – immerhin die Hälfte der Oper! - bleibt eine Notlösung. (Die neue Fassung von Luciano Berio aus 2001, mit „Tristanakkord“ und Mahler-Reminiszenzen, ist meiner Meinung nach auch nicht befriedigend.)

Nichts bringt den „himmlischen Kaiser“ (Carlo Bosi, oben) aus der Ruhe, doch die Bonzen und Turandot (Elena Pankratova) werden unruhig, nachdem Calaf (Gwyn Hughes Jones) als Erster Antworten auf ihre schwierigen Fragen findet.
Wilsons „Turandot“ ist, wie immer, fantastisch beleuchtet und fein ausgearbeitet. Es gibt schöne Kostüme von Jacques Reynaud und eine Bühnenbild-Überraschung für „Nessun dorma“: Calaf irrt durch einen „Wald von Gefühlen“. Alles bleibt sehr abstrahiert, was manchmal poetisch gelingt. So der Tod von Liù: sie schließt ihre Augen und steht regungslos in einem blau erkaltenden Licht. Sehr poetisch! Bei der musikalischen Umsetzung haperte es leider etwas an diesem Premierenabend. Der Chor der Opéra de Paris verhedderte sich gleich bei seinem Auftritt mit Wilsons Hand- und Armbewegungen – obwohl dieser mit einer ganzen Riege von Assistenten angereist war, die Wochen lang geprobt hatten. Und auch exzellent vorbereitet durch seine neue Chefin Ching-Lien Wu, fiel er auseinander. Dudamel beschleunigte und drehte den Sound auf um Zusammenhalt wiederherzustellen – womit das Opernorchester, das ihm auf jeden Wink enthusiastisch folgte, kein Problem hatte. Doch bei den Sängern spürte man eine Panik, die ihnen weiterhin in den Knochen blieb, weil viele an diesem Abend in diesem riesigen Saal debütierten, der eine problematische Akustik hat. In „Signore ascolta!“ verpatzte Guanqun Yu ihren ersten hohen Ton. Sie fing sich aber bewundernswert und leistete als Liù die größte gesangliche Leistung des Abends, indem sie wunderbar phrasierte und als Einzige auch mal piano sang. Sie berührte alle bis auf den letzten Platz und beikam den größten Applaus während der Vorstellung. Elena Pankratova, die schon Turandot und Elektra an der Wiener Staatsoper gesungen hat und nun auch an der Bastille debütierte, konnte ihre Stimme nicht richtig im Saal platzieren. Die Rolle ist auch höllisch schwer: ohne jegliches Vorwärmen gleich anfangen mit „In questa Reggia“: die ganze Zeit laut und hoch. Für Birgit Nilson und Montserrat Caballé – beide unvergessene Turandots in Paris – kein Problem, aber bei Pankratova brachen die Register auseinander. Gwyn Hughes Jones hatte es als Calaf noch schwieriger. Er kennt das Haus als Camille de Rossillon in der „Fledermaus“ und wir waren gespannt auf sein Rollenportrait als Nicht-Italiener. Er brachte viele interessante Nuancen, aber in „Nessun dorma“ fehlte es ihm – in diesem Saal – an Durchschlagkraft: kein Applaus danach… Vitalij Kowaljow sang einen berührenden Timur (Vater von Calaf) und Carlo Bosi einen sonoren Kaiser Altoum. Alessio Arduini, Jinxu Xiahou und Matthew Newlin waren ein wunderbar spielfreudiges Trio Ping Pang Pong und Bogdan Talos ein guter Mandarino. Alles gute Sänger, aber an diesem Abend in diesem Saal gerade eine Nummer zu klein. Da muss sich die neue „Directrice du Casting“ vielleicht auch noch einhören.

Der berührenste Augenblick des Abends an dem auch Puccini starb: Liù (Guanqun Yu) schließt ihre Augen und stirbt regungslos in einem blau erkaltenden Licht. Neben ihr der alte Timur (Vitalij Kowaljow).
Beim Fallen des Vorhangs stand das Publikum schon im Dunkeln auf – das habe ich hier noch nie hier gesehen. Großer Jubel, vor allem für Gustavo Dudamel, das Orchester und den Chor, und kein einziges Buh - nicht einmal für den Regisseur, die hier quasi immer ausgebuht werden. Ein gelungener Start und nun geht es gleich in raschem Tempo weiter. Dudamel probt schon für eine Neu-Inszenierung der „Nozze di Figaro“ (Premiere am 23. Januar mit Peter Mattei, Ildebrando D’Arcangelo und Angelika Kirschschläger). Danach soll es 3 Premieren in nur 2 Wochen geben: WA „La Khovanchina“ (26. Januar), „Don Giovanni“ (1. Februar) und vier Tage später „Manon“ in der bildschönen Inszenierung von Vincent Huguet, deren Premiere im Februar 2020 dem Streik zum Opfer fiel, bevor kurz danach die ganze Oper wegen der Pandemie schließen musste. Alexander Neef hat mutig 20 Opern in dieser Spielzeit 2021/22 angesetzt, obwohl er keine Sicherheit vom französischen Staat bekommt, wie er das alles finanzieren soll. Denn im Gegensatz zur Wiener Staatsoper oder jeder normalen „Nationaloper“, finanziert der französische Staat nur die Hälfte des Etats. Die andere Hälfte muss die Opéra de Paris selbst verdienen. Und wenn es keine Vorstellungen gibt, gibt es natürlich keine Einnahmen und nach zwei Jahren Krise hat das Defizit der Opéra de Paris astronomische Zahlen erreicht. Deswegen alle Achtung mit welchem Elan der Dampfer nun wieder losfährt und mit welchem Eifer Gustavo Dudamel an seine neuen Aufgaben geht (zu sehen in seinem Interview auf der Homepage der Oper). Wir wünschen der Pariser Oper, dass weiterhin gute Feen über sie wachen –wie die „bonne fée“ der zauberhaften „Cendrillon“ von Massenet, die für März 2022 in einer Neuinszenierung angesetzt ist. Die bösen Geister und Kobolde werden hoffentlich weiterhin einen großen Bogen um die Opéra machen, denn in Frankreich sagt man, dass diese keinen Champagner mögen. Waldemar Kamer
Bis 30. Dezember an der Opéra National de Paris: www.operadeparis.fr
Waldemar Kamer, 8.12.2021
Alle Fotos: © Charles Duprat / Opéra National de Paris
DON CARLO(S)
an der Opéra National de Paris – 25 10 2019
Zum ersten Mal in Paris: die verschollene Fassung der Generalprobe der Uraufführung, auf Italienisch und wunderbar dirigiert durch Fabio Luisi
TRAILER
Es war vor zwei Jahren „die meist beachtete Opernpremiere des Jahres“ – so das Forum des Online-Merkers, in dem die Spielpläne der Opern in Wien, Paris, Mailand, New York etc miteinander verglichen wurden. In Paris gab es „Don Carlos“ zum ersten Mal in der verschollenen Fassung der Generalprobe der Uraufführung, mit einem Aufgebot an Sänger-Stars: Jonas Kaufmann, Sonia Yoncheva etc und dem vielbeachteten Eboli-Debüt von Elina Garanca. Nun wird Produktion mit ebenso exzellenten Sänger-Kollegen und einem ganz hervorragenden Dirigenten wieder aufgenommen und kann man sich ohne „Starttrubel“ über das beugen, was sie wirklich besonders macht: diese nie gespielte Fassung.

„Don Carlo(s)“ ist nicht nur die längste Oper von Giuseppe Verdi (länger als „Traviata“ und „Trovatore“ zusammen), sondern auch seine meist ehrgeizige, mit der er Meyerbeer in den Schatten stellen wollte, und an der er 20 Jahre lang immer weiter gearbeitet hat, so dass es zeitlebens mindestens acht Fassungen dieser Oper gab, wovon die kürzeste (Mailand, 1884) heute am meisten gespielt wird (wie z.B. gerade an der Wiener Staatsoper). Wir brauchen nicht auf die hochinteressante Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Opus Magnum einzugehen, denn man kann sie mühelos in den köstlichen Briefen Verdis nachlesen, u.a. an die verschiedenen Direktoren der Pariser Oper. Nur über was kurz vor und kurz nach der Uraufführung am 11. März 1867 an der Académie Impériale de Musique im Rahmen der Feierlichkeiten der Weltausstellung in Paris passierte, hüllen sich alle in ein dezentes Schweigen. Denn die Angelegenheit war höchst peinlich für alle Beteiligten. Bei über 300 Proben – selbst Wagner hat dies nie erreicht – scheint es keine Durchläufe gegeben zu haben und stellte mal erst an der Generalprobe fest, dass die Oper zu lang sei, damit ein Teil des Publikums die letzte Vorstadtzüge noch erreichen könnte. Verdi musste also am Tag vor der Premiere eine halbe Stunde streichen und strich am Tag nach der Premiere wieder eine halbe Stunde. Diese fehlenden Szenen wurden erst 1974-1980 durch Prof. Dr Ursula Günther (und Andrew Porter & Angelo Foletto) in den Pariser Archiven gefunden und bei Ricordi veröffentlicht, was Claudio Abbado dazu bewegte sie in seiner Referenz-Aufnahme der Pariser Fassung (Deutsche Grammophon, 1985) als „Anhang“ hinzu zu fügen. 1,5 Stunden unbekannte „Don Carlos“-Musik!

So wie man es auf der Einspielung hören kann, sind nicht alle gestrichenen Passagen musikalische Höchstleistungen. Am Schönsten ist vielleicht noch das Klagelied des Königs vor der Leiche des erschossenen Posa „Oui je l’aimais… Qui me rendra ce mort“ („Si, io l’amai… Chi rende a me quest’uom“), das Verdi mit quasi dem gleichen Text in sein Requiem übernahm (die gestrichene Arie wurde das „Lacrymosa“). Aber dramaturgisch sind sie hochinteressant und geben sie der Oper eine tiefere Dimension. So fing der erste Akt nicht an mit der Arie des Carlos alleine im Wald „Fontainebleau! Forêt immense et solitaire“ (und Jägerchor hinter der Bühne), sondern mit einer zehnminütigen Chorszene, in der Elisabeth mit ihrem Pagen auf das unter dem Krieg leidende Volk trifft, das singt: „L’hiver est long! La vie est dure! Le Pain est cher!“ („Der Winter ist lang! Das Leben ist hart! Das Brot ist teuer!“). Das klingt nicht nur ungefähr nach „Boris Godunow“, denn Verdi beschäftigt sie sich gerade mit dem Stoff (noch vor Mussorgski!). Elisabeth schenkt daraufhin einer Witwe, die beide Söhne im Krieg verloren hat, eine Goldkette, wofür diese sich mit dem ganzen „Holzfäller-Chor“ bedankt : „Edle Frau, gebe Gott Euch einen jugendlichen Gatten, eine Krone und dazu die Liebe eines glücklichen Volkes!“. Diese Szene gibt dem Treffen mit Don Carlos, ihrer ersten Liebesszene mit dem Medaillon (von dem sich Elisabeth nie mehr trennt) und dem „Entsagen“ ein ganz anderes Format. Die Figur der Elisabeth wird in vielen Szenen enorm aufgewertet - Sie singt u.a. in dem Autodafé mit den Flämischen Gesandten – sowie auch Eboli und Posa. Elisabeth gibt z.B. Eboli ihren Mantel und Mantilla vor der nächtlichen Gartenszene, um ihre „Rolle“ zu spielen. Kein Wunder also, dass Don Carlos der falschen Frau seine Liebe erklärt. Und so ist die Schleier-Arie der Eboli – heutzutage nur noch ein „Spanisches Intermezzo“ – in die Handlung eingebunden, als Vorahnung (oder Wunsch), was wenige Minuten später mit Don Carlos passiert und mit dem König offensichtlich schon passiert ist.

Alles hochinteressant, aber es lohnt sich nicht, dies hier alles nach zu erzählen, denn man kann es im brillanten Essay von Ursula Günther bei Ricordi und im Booklet der Abbado-CD nachlesen. Das aufwändig gestylte Programmheft der Pariser Oper kann man sich sparen, denn dort werden die oben genannten Informationen nicht einmal erwähnt, sowie im abgedruckten Libretto die „Holzfäller-Szene“ und viele andere interessanten Szenen einfach fehlen und in den 10 Seiten Werbung über alles, was man zur Zeit in der Opéra de Paris sehen kann, nicht darauf hingewiesen wird, dass am Tag vor der jetzigen Premiere im Palais Garnier eine Ausstellung eröffnet wurde über die Gattung „grand-opéra“, zu der „Don Carlos“ natürlich gehört (bis zum 2. Februar 2020). Da hat sich seit Verdis Zeiten, der sich mächtig über die waltende Inkompetenz an der „Grande Boutique“ aufregen konnte, offensichtlich nicht so viel geändert: „Ein großes Warenhaus oder Trödlerladen“.
Szenisch wurde auch recht schlampig mit den oben genannten wiedergefundenen Szenen umgegangen. Es ist heute leider üblich, dass man akribisch musikalisch arbeitet und dafür die besten Sänger und Dirigenten einlädt, und dazu einen Regisseur verpflichtet, der sich überhaupt nicht in den historischen Stoff vertieft, weil man von ihm verlangt, dass er das Werk „aktualisiert“. Krzystof Warlikowski ist kein unbegabter Regisseur – wir haben diesen Frühling sehr positiv über seine „Lady Macbeth von Mzensk“ berichtet (siehe Merker 5/2019) - aber mit dieser „grand-opéra“ konnte er offensichtlich wenig anfangen. Seine Ausstatterin Malgorzata Szczesniak schuf ein großes Einheitsbühnenbild, worin die großen Chöre genug Platz hatten, aber die intimen Szenen – trotz manchmal eingeschobener Elemente – verloren wirkten. Und in diesen leeren Räumen konnte Warlikowski kaum psychologisch mit seinen Sängern arbeiten, was ihm diesen Frühling noch so wunderbar mit Ausrinè Stundytè als rollenprägende Katerina Ismailowa gelungen ist. Der Regisseur saß während der Premiere in der Reihe vor mir, doch erschien (trotz mehrerer Aufforderungen) nicht beim Schlussapplaus – wahrscheinlich war er selbst nicht mit dem Resultat zufrieden und wollte nicht mehr ausgebuht werden (wie vor zwei Jahren).

Die musikalische Umsetzung war absolut hervorragend. Das liegt vor allem an dem wunderbaren Dirigat von Fabio Luisi. Er dirigierte Verdi wie man ihn selten hört: einerseits eine ganz klar durchdachte Architektur, wie die einer Kathedrale, andererseits immer wieder anderes Licht und Farben, das auf dieses große Gewölbe fällt. Dank sei ihm, wurde der lange Abend (4,5 Stunden mit zwei Pausen) nie langweilig. Er hatte einerseits das Orchester der Oper perfekt in der Hand (kein einziger Verrutschter mit der vielen Bühnenmusik), auch den riesigen Chor der Oper, perfekt durch José Luis Basso vorbereitet, der den Abend mit einen wunderbaren piano im Holzfäller-Chor eröffnete und im Autodafé forte sang, ohne schrill zu werden und die Solisten zu übertönen, die immer im Mittelpunkt blieben. Den Sängern gab er ganz klare Tempo-Angaben, ließ sie einerseits nicht aus der Hand, aber ließ sie dann wieder an anderen Momenten aussingen, sogar a cappella ohne Chor und Orchester, was manchmal berührend schön war. Schade, dass man ihn hier so selten hört (es ist sein 7. Dirigat an der Pariser Oper in 22 Jahren) und auch er nicht durchsetzen konnte, dass man den vollständigen „Don Carlos“ nun endlich mal spielt (einige Szenen und die Ballette wurden dann docgh gestrichen). Gesungen wurde auf Italienisch. Eigentlich eine Inkonsequenz, die mich jedoch nicht gestört hat. Denn „Don Carlo“ singt sich eben besser als „Don Carlos“, so wie es quasi alle Sänger sagen, diese Oper auf Französisch und auf Italienisch gesungen haben.

Roberto Alagna ist ein heroischer Don Carlo mit einer perfekten Technik, so wie man es auf den Videos sehen und hören kann, die jetzt bei jeder Premiere auf die Website der Oper gesetzt werden. Doch er war offensichtlich erkältet, auch wenn es deswegen keine Ansage gab: die Töne saßen, klangen jedoch etwas forciert und in seiner ersten Arie und dem Duett mit Elisabeth fehlte das Piano. In der ersten Pause warf er das Handtuch. Michael Fabiano ist als Zweitbesetzung vorgesehen, doch an diesem Abend sang er noch – offenbar sehr gut – in der „Manon“ der Met, die live im Kino ausgestrahlt wurde (siehe die Rezension im Online-Merker). So sprang Sergio Escobar ad hoc ein. Er tat dies sehr professionell, offenbar nicht ganz unvorbereitet (denn man sah ihn auch in der letzten Videosequenz), aber mit den verständlichen Schwierigkeiten in der höllisch schwierigen Arie des zweiten Aktes, womit er an der riesigen Opéra Bastille debütierte. Im Laufe des Abends fand er jedoch wieder das wunderbar warme Timbre seiner schönen Stimme. Aleksandra Kurzak brachte ganz unerwartet „Jugend“ in die Rolle der Elisabeth. Denn auch wenn Schiller und Verdi sich nur bedingt an die historischen Figuren gehalten haben, war Isabelle de Valois – in Spanien „Isabel de la Paz“ – nur 14 Jahre als sie den 32-jährigen und schon zweimal verwitweten Philipp II von Spanien heiratete (übrigens eine glückliche Ehe!). Bei Verdi ist es ein alter Mann, den René Pape überzeugend darstellte : wunderbar seine Mezzavoce in „Ella giammai m’amo“ bevor er seine mächtigen Bass in den Saal schleuderte. Ihm absolut ebenbürtig als Stimme war Sava Vemić in der wichtigen Rolle des Frate (Geist von Karl dem V.), den wir zum ersten Mal hier in einer größeren Rolle hörten und vor dem sogar der Großinquisitor von Vitalij Kowaljow verblasste. Étienne Dupuis war ein wunderbarer Rodrigo (Posa), obwohl er es mit dem erst erkrankten und dann einspringenden Don Carlo in seinen Duetten natürlich nicht einfach hätte und Ève-Maud Hubeaux ein ebenfalls in dieser Fassung stark aufgewerteter Page Tebaldo. Die Sensation des Abends war Anita Rachvelishvili als Eboli. Als sie vor zehn Jahren, noch an der Akademie der Scala, mit kaum 21 Jahren dort die sehr beachtete Stagione-Eröffnungs-„Carmen“ sang und gleich eine Weltkarriere startete, befürchtete ich, dass schon wieder ein junges Talent verheizt wird. Mit Nichten.

Jedes Mal wenn sie in Paris wieder auftritt, ist ihre Stimme weiter gereift und zeigt nicht das mindeste Anzeichen von Müdigkeit. Im Gegenteil, seit Dolora Zajick vor 20 Jahren, hat keine Eboli mit einer solchen Wucht den großen Saal der Bastille bis zum letzten Stuhl in Erregung gesetzt. Phänomenal ihr „O don fatale“ und zugleich in jeder Note absolut musikalisch – auch wegen dem Dirigenten - verinnerlicht und erlebt (wovon das Video nur einen blassen Schimmer gibt). Das Premieren-Publikum tobte und bei dem Schlussapplaus gab es (nur) für sie quasi eine Standing Ovation.
Ein musikalisch wunderbarer Abend, an dem viel Bekanntes in einem breiteren Kontext plötzlich neu klang. Nur schade, dass wir nicht einmal wirklich das ganze Werk ohne Schnitte erleben konnten, mit u. a. dem berühmten Perlen-Ballett (das Cornelius Meister nun zeitgleich im „Don Carlos“ in Stuttgart dirigiert). Und hoffentlich setzt sich die fünf-Akten Fassung nun endlich durch, auf Italienisch. Verdi war enttäuscht von der Uraufführung in Paris, die er als „senza sangue e agghiaciata“ empfand („frostig und ohne Saft und Kraft). Worauf der Theaterdirektor Nestor Roqueplan ihm riet: „Bleiben Sie bei den italienischen Makkaroni und lassen Sie das französische Sauerkraut“ – was er auch nie mehr essen wollte!
Waldemar Kamer, 28.10.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
Fotos C: Vincent Pontet
Dimitri Schostakowitsch
LADY MACBETH VON MZENSK
6.4.2019
Erst zum dritten Mal in Paris! Nun psychologisch seziert durch Krzystof Warlikowski und Ingo Metzmacher.
Erstaunlich, wie manche Werke immer wieder um ihre Anerkennung kämpfen müssen. „Lady Macbeth des Mzensker Landkreises“ war bei ihrer Uraufführung 1934 in Leningrad ein großer Erfolg für den gerade 28-jährigen Komponisten und wurde in weniger als zwei Jahren an die 200-mal in der Sowjetunion gespielt, sogar auch – was kaum bekannt ist – 1935 in Cleveland in den USA. Doch 1936 sah Stalin sich eine Vorstellung an und war so empört, dass das „obszöne Werk“ verboten wurde und Schostakowitsch danach keine Opern mehr komponieren durfte. Er musste seine „Lady“ lang und mühselig überarbeiten bis sie 1963 endlich in einer gesäuberten Fassung als „Katerina Ismailowa“ in Moskau aufgeführt werden durfte. 1978 nahm Mstilaw Rostropowitsch bei seiner Flucht in den Westen eine Partitur mit und dirigierte die erste Platteneinspielung mit Galina Wischneswskaja und Nicolai Gedda. Sobald wie möglich gab es schon 1980 eine erste Inszenierung in Wuppertal, worauf viele andere im deutschsprachigen Gebiet folgten (oft auf Deutsch). In Frankreich ist die Werkrezeption viel langsamer: Nancy erst 1989 und Toulouse 1991. Eigentlich sollte „Lady Macbeth von Mzensk“ 1989 die Bastille-Oper eröffnen, als Zeichen dafür, dass man in dem neuen Haus hauptsächlich Werke des 20. und 21. Jahrhunderts spielen wolle. Doch aus politischen Gründen wurde es eine französische Oper, „Les Troyens“ von Berlioz. Die Erstaufführung von „Lady Macbeth“ an der Pariser Oper fand deswegen erst 1992 statt, was im Nachhinein eine große Chance war, denn es war die erste einwandfrei gelungene Produktion der Bastille – eben die erste die unter normalen Bedingungen vorbereitet und geprobt worden war.

Die tonangebende Zeitung „Le Monde“ lobte das endlich einmal gut spielende Orchester (damals in einem desolaten Zustand) und die endlich einmal richtig funktionierende Bühnenmaschinerie – die als „die beste auf der ganzen Welt“ angekündigt worden war und drei Jahre lang nur durch Pannen auffiel. Doch das war nur ein Drittel des Artikels, zwei Drittel wurden der Frage gewidmet, ob dieses Werk nun diese ganze Mühe wert sei. Es sei weder Fisch noch Fleisch, „weder ein schlüssiges psychologisches Drama noch ein gelungenes ideologisches Plädoyer“ (so „Le Monde“). Und damit verschwand die „Lady“ wieder von den französischen Opernspielplänen. Als Gerard Mortier 2006 sie wieder ansetzen wollte, war die wunderbare Produktion von Regisseur André Engel und Bühnenbildner Nicky Riety schon verschrottet, auch weil man sich inzwischen darauf besonnen hatte, dass solch riesige Bühnenbilder total ungeeignet waren für ein Haus, das 365 Vorstellungen im Jahr geben sollte. Mortier übernahm also eine Produktion aus Amsterdam von Martin Kusej, der das Werk völlig anders anging. Bei André Engel war das überkuppelnde Thema „Russland“ gewesen: weite Landschaften, in der die einsame Katerina Ismailowa verloren umherirrte, sowie die Arbeiter in der riesigen Kolchose und die Polizisten in ihrer überdimensionierten Kaserne. Kusej baute einen Eisen- und Glaskäfig, indem die Protagonisten meist in billiger Unterwäsche wie Labormäuse durch Polizisten mit Hunden eingesperrt wurden. Nun ist Krzystof Warlikowski an der Reihe, mit seiner üblichen Vorliebe für gekachelte Waschräume.

Doch was er darin inszeniert, ist vollkommen anders als seine Vorgänger. Warlikowski, der in Paris und Frankreich zur Zeit als einer der tonangebenden Regisseure gilt – ihm wurde auch vor anderthalb Jahren der große „Don Carlos“ mit Jonas Kaufmann und Elina Garanca anvertraut – hat als (Theater-)Regisseur eine Faszination für gespaltene Charaktere und hysterische Frauen. Wir waren wenig überzeugt von seinen ersten Opernarbeiten – er debütierte als Opernregisseur in Paris – doch seine „Voix humaine“ an der Pariser Oper mit Barbara Hannigan war wirklich phänomenal. Zugegeben, Barbara Hannigan ist eine Ausnahmekünstlerin, aber so haben wir bis dato nur einmal eine Sängerin eine Rolle verkörpern sehen (siehe Merker 12/2016). Dies ist Warlikowski nun wieder mit der litauischen Sopranistin Ausrinè Stundytè gelungen, die die Rolle schon in Lyon mit Dimitri Tcherniakov und in Antwerpen mit Calixto Bieito erarbeitet hat. Sie spielt und singt nicht Katerina Ismailowa, sie verkörpert sie mit einer solchen Intensität, dass man auch noch in Reihe 20 des Parketts in einem Saal mit 2700 Zuschauern das Gefühl bekommt, dass man ihre Gedanken lesen kann. Phänomenal! Das ganze Werk scheint sich in ihrem Kopf abzuspielen, den man immer wieder riesengroß auf Videoschirmen sieht, auch in Unterwasseraufnahmen – denn die Oper beginnt mit einem Traum Katerinas und endet mit ihrem Ertrinken.
Die schon beinahe sprichwörtlich weiß gekachelten kalten Räume von Ausstatterin Malgorzata Szczesniak sind dieses Mal ein großes Schlachthaus mit vielen Fleischhaken, an denen tote Schweine und auch die Leiche des durch Katarina und Sergei ermordeten Sinowi Ismailow baumeln. Aus den Landarbeitern wurden Schlachter mit blutbefleckten Messern und Schürzen – was der Vergewaltigungs-Szene von Katerinas Freundin (eigentlich Köchin) Aksinja noch eine zusätzliche Dimension gibt. Das überkuppelnde Thema ist bei Warlikowski die sexuelle Not aller Protagonisten, die wir noch nie in einer solchen Eindeutigkeit in diesem Werk inszeniert gesehen haben. Darüber lässt sich diskutieren. In der überaus lesenswerten Novelle von Nikolai Leskow (1865) wird Sexualität nur im letzten Kapitel thematisiert, in dem die Sträflinge auf dem langen Marsch nach Sibirien ihre Würde verlieren. Nur nicht Katharina, die bis zuletzt eine vornehme Kaufmannsfrau bleibt, auch wenn sie ihren Mann, Schwiegervater und kleinen Neffen umgebracht hat und das Kind, das sie mit Sergei bekommen hat, bei der Geburt weggegeben hat. Das Libretto erwähnt „rohe und handgreifliche Späße“ und keine Massenvergewaltigung von Aksinja und „Träume“ des 80-jährigen Boris Ismailow, aber keinen Besuch bei einer Prostituierten etc. Doch in der Musik sind die sexuellen Handlungen zwischen Katharina und Sergei unüberhörbar genau beschrieben. Das ist eine Interpretation von Schostakowitsch – genau, was der äußerst prüde Stalin ihm vorgeworfen hat - und er weicht dabei genauso viel von seiner Romanvorlage ab wie Bergs „Wozzeck“ von dem (fragmentarischen) „Woyzeck“ von Büchner.

Wie dem auch sei, das Regiekonzept überzeugt in den ersten beiden und vierten Akt, aber nicht im dritten. Denn Warlikowski und Szczesniak haben das siebte Bild, in dem der alte Landstreicher die Leiche des ermordeten Gatten findet, das achte, in dem sich die Polizisten in ihrer Kaserne langweilen und das neunte, die Hochzeitsgesellschaft, bei der Katharina und Sergei verhaftet werden, zu einer Art Kabarettnummer zusammengeschweißt, in der alles auf einmal passiert und auch noch Akrobaten auftauchen mit einer schwarzen Polizistin, die einen Josephine-Baker-Striptease vollführt. Das gelang weder szenisch noch musikalisch – es gab anscheinend einige Striche - und brachte den Abend aus dem Lot. Doch vor dem vierten und letzten Akt – vor dem es meistens eine Pause gibt – spielte das Orchester eine durch Rudolf Barshai orchestrierte Fassung des Achten Quartetts von Schostakowitsch. Das war eine neue und auch musikalisch vertretbare „Wanderung nach Sibirien“, die mit dem wunderbaren Gesang des alten Zwangsarbeiters beginnt, mit dem die Oper auch ausklingt.
Es wurde nicht nur auf sehr hohem Niveau gespielt – beinahe alle Darsteller verkörperten ihre Rollen – sondern auch musiziert. Ein großes Lob für das ganze Team und die 20 Solisten. Ausrinè Stundytè war eine epochale, rollenprägende Katerina Ismailowa, vielleicht an diesem Premierenabend etwas mehr durch ihr intensives Spiel als durch ihren Gesang. Wir hatten uns manche Passagen vielleicht noch etwas lyrischer gewünscht, mit etwas mehr Projektion ihrer schönen Stimme in den großen Saal. Aber es könnte gut sein, dass der Regisseur und Dirigent dies gerade nicht wollten und man kann dies sowieso einer Sängerin nicht anlasten, die an der akustisch schwierigen Bastille debütiert (so etwas korrigiert sich oft im Laufe der Vorstellungen). Sofija Petrovic hatte in der sehr aufgewerteten Rolle von Katerinas Freundin und Double Aksinja überhaupt kein Problem mit dem Saal, den sie inzwischen schon gut kennt. Denn sie war 2016-2018 ein „rising star“ des Opernstudios („Atelier Lyrique“) und steht mit ihrem warm timbrierten Sopran am Anfang einer großen Karriere. Pavel Cernoch wirkte etwas eindimensional als Sergei neben der faszinierend komplizierteren Katerina Ismailowa von Ausrinè Stundytè. Aber das lag auch an dem Regiekonzept, das die vielschichtige Figur reduzierte zu einem einfältigen „Beau“ mit einem knackigen Hintern, den wir vielleicht ein bisschen zu oft – mit und ohne Unterhose – zu sehen bekamen. Dmitry Ulyanow war ein wohltönender Boris Ismailow, dem John Daszak als Sohn Sinowi Ismailow genauso wohltönend antworten konnte. Wolfgang Ablinger-Sperhackes Arie als alter Landstreicher ging leider etwas unter im Tohuwabohu des dritten Aktes, aber Oksana Volkova brillierte im vierten Akt als Sonjetka, die letzte Bettgefährtin Sergeis. Der Abend klang aus mit dem Gesang des alten Zwangsarbeiters, ganz wunderbar gesungen von Alexander Tsymbalyuk (purer Luxus, denn oft wird die kleine Rolle durch Boris Ismailow gesungen). Last but not least ein großes Lob für den Sprachcoach Liuba Orfenova, denn alle sangen ein perfektes Russisch, auch der Chor der Oper, und das macht wirklich etwas aus!

Dass man dies alles so genau hören, miterleben und mitfühlen konnte, ist der Verdienst von Ingo Metzmacher, den man als herausragenden Dirigenten der Opern des 20. und 21. Jhds nicht mehr vorzustellen braucht (er dirigierte die „Lady“ vor zwei Jahren an der Wiener Staatsoper und auch unlängst die Uraufführung der „Weiden“). Selten bis nie haben wir das Orchester der Oper so glasklar spielen gehört, auch die Blechbläser aus dem Saal (sowie in der Partitur vorgegeben), die öfters die Achilles-Ferse dieses Opernorchesters sind. Im Einklang mit der Regie spannte Metzmacher keine lyrischen, romantischen Bögen („russische Seele und Landschaft“), sondern sezierte messerscharf die Partitur, die wir noch nie so transparent gehört haben. Dass der dritte Akt im Gegensatz dazu abdriftete, lag nicht nur an der Regie und einigen Strichen (?), sondern auch an der Partitur selbst, da Schostakowitsch diesen Akt als ein „Scherzo“ umschrieb, während die Handlung überhaupt nicht scherzhaft ist. Alles in Allem ein sehr gelungener Abend und ein einstimmiger Premieren-Applaus - an der Pariser Oper eine Seltenheit! Nun sind wir gespannt, wie der nächste Regisseur und Dirigent in Paris diese vielschichtige Oper interpretieren werden. Dass sie nun einen festen Platz in den Spielplänen der Pariser Oper haben wird, ist nun endlich über jeden Zweifel erhaben. Waldemar Kamer
Waldemar Kamer 9.4.2019
Bilder (c) Bernd Ulig
Hector Berlioz
LES TROYENS
Premiere am 25. Januar 2019
Zum Abschluss des problematischen Berlioz-Zyklus eine ausgebuhte Premiere...
In Paris gibt es viel zu feiern: 350 Jahre Pariser Oper, 30 Jahre Opéra Bastille und 150 Jahre Berlioz (1869 in Paris gestorben). Als „Höhepunkt“ dieser Feierlichkeiten und als Abschluss des in 2015 begonnenen Berlioz-Zyklus der Pariser Oper gab es nun als sehr beachtete Premiere „Les Troyens“. Da das „kolossale, gewaltige, unermessliche und beispiellose Werk“ (so Direktor Dominique Meyer im „Prolog“ der Wiener Staatsoper) im Oktober/November in Wien gespielt und in „Merker“ sehr ausführlich rezensiert wurde, brauchen wir nicht auf die Handlung und die komplexe Entstehungs- und Aufführungs-Geschichte einzugehen, sondern können gleich berichten, wie anders man in Paris mit diesem Werk umgeht als in Wien.

Im Gegensatz zu Wien, werden „Les Troyens“ nicht häufig, aber doch regelmäßig in Paris und Frankreich gespielt, denn sie gelten als die größte, meist verrückte oder genialste Französische Oper des 19. Jahrhunderts. Deswegen war „Les Troyens“ die erste Oper die man an der Opéra Bastille gespielt hat (erst im März 1990, da das neue Haus wegen großer technischer Probleme im offiziellen Eröffnungsjahr gar nicht bespielbar war) und 2006 wurde die Produktion aus Salzburg (2000) wiederaufgenommen. Zwischenzeitlich gab es noch 2003 im Châtelet eine musikalisch epochale Produktion, die jedoch szenisch auch nicht sehr befriedigend war. Dreimal hatte man Regisseure berufen, die ursprünglich Bühnenbildner waren (Pier Luigi Pizzi, Herbert-Wernicke und Yannis Kokkos), die große und bei Pizzi wirklich beeindruckende „tableaux“ (Bilder) entwarfen, in denen die Sänger ewig an der Rampe standen, wobei wir uns teilweise richtig gelangweilt haben. So setzte der jetzige Intendant Stéphane Lissner alle Karten auf eine neuartige Regie, wie er es schon für „La damnation de Faust“ (2015) und „Benvenuto Cellini” (April 2018) getan hatte - „Béatrice et Bénédict“ wurde nur konzertant gespielt. In einem Promotionsvideo (das man auch auf dem Merker Online sehen kann) erklärt Lissner, dass er mit jungen Regisseuren junge Leute in die Oper locken will. Der russische Regisseur erzählt sehr ich-bezogen, dass er „schwierige Herausforderungen“ liebt. Kaum ein Wort zu Berlioz und kein Statement des Dirigenten/Musikdirektors – das sagt im Vorfeld eigentlich schon alles aus.

Regisseur Dmitri Tcherniakov gilt in Frankreich als ein „enfant terrible“, das immer für viel Medienwirbel sorgt und deshalb auch häufig eingeladen wird. Manchmal sind wir schwer empört, wie z.B. über seine Verhunzung von Rimski-Korsakows „Schneeflöckchen“ (durch ihn eigenmächtig in „Snegourotchka“ umgetauft, siehe Merker 5/2017), doch in diesem Fall ist sein mit Tatiana Vereschagina erarbeitetes Regie-Konzept wirklich interessant. Statt eines antiken Dramas mit Halbgöttern, sehen wir eine moderne Herrscherfamilie, in der es hinter der schönen Fassade - sie stellt sich vor Anfang des Abends für einen offiziellen Fototermin auf - ordentlich knistert: König Priam (er sieht aus wie ein lateinamerikanischer Diktator) holt für das Foto seine Lieblinge in die Mitte und verstößt die in Ungnade gefallenen an den Rand. Mit Hilfe von Video-Projektionen, die mit Untertiteln verdeutlicht werden, wird aus dieser Familienkonstellation die Oper erzählt. Und das hilft auch über einige szenische Durststrecken der „Troyens à Carthage“ (die ersten beiden Akte) hinweg. Beim ersten Ballett, „Le combat de ceste, le pas des lutteurs“ wird nicht getanzt, sondern stehen alle Beteiligten still vor Hectors Grab und sehen wir auf den Videos, was die einzelnen Personen denken. Enée hasst seinem Schwiegervater, weil er Hectors kleinen Sohn Astyanax als Thronfolger einsetzt und nicht Enées Sohn Ascagne - was ihn auf den Gedanken bringt, die Griechen in die Stadt zu schleusen um Priam zu stürzen. Dieses bringt Polyxène in einen tragischen Konflikt zwischen Vater und Mann und sie ringt mit Selbstmordgedanken. Cassandra ist die „ungeliebte“ jüngste Tochter, die als Mädchen durch ihren übermächtigen Vater anscheinend sexuell missbraucht wurde und seitdem als verrückt gilt, damit ihr niemand diese Geschichte glaubt. Dieser „Subtext“ gab den vielen Kampfszenen und Freudenchören eine ganz ungewöhnliche dramaturgische Dichte (es ist nicht mehr die List der Griechen mit dem Pferd, sondern der Verrat von Aeneas der Troja zu Fall bringt) und gleichzeitig wurde die äußere Handlung auch mal ohne Pferd kraftvoll inszeniert, mit eindrucksvollen Kampfszenen von Stuntman Ran Arthur Braun, in denen ein brennender Mann über die Bühne läuft (der Geist Hectors?), in einem spektakulären Bühnenbild: ein zerbombtes Beirut. Alles interessant interpretiert und gut inszeniert.

Doch bei „Les Troyens à Carthage“ (die letzten drei Akte) führte das Regiekonzept in eine Sackgasse. Aus Karthago wurde ein „Centre de psycho-traumatologie pour victimes de guerre“, ein betont hässliches Krankenhaus für Kriegsgeschädigte, in dem wirkliche Kriegsopfer (junge Männer ohne Arme und Beine, die als Statisten engagiert waren) herum humpelten. Dido ist nun eine Patientin, die ihrem im Krieg gefallenen Ehemann Sychée nachtrauert, und meint ihn in dem neuen Patienten Enée wieder zu finden, der nach der Flucht aus Troja durch seinen Sohn Ascagne eingeliefert wird. In großen „Gruppentherapien“ (fast alle Sänger und Statisten sind beinahe die ganze Zeit auf der Bühne), darf sie nun mit Pappkrone und Karnevalskostüm die Königin spielen, ohne den traumatisierten Enée jedoch zu erreichen, der ja immer nur „Stimmen hört“. Wie sollen Darsteller und Publikum an eine Geschichte glauben, wenn sie nicht „verkörpert“ wird, sondern nur mit viel ironischer Distanz auf die Bühne gestellt wird? Und wie soll man einer Handlung folgen können, wenn man sich vor lauter Trubel auf der Bühne gar nicht mehr auf die Sänger konzentrieren kann? Dido und Enée sehen sich in ihrer großen Liebeszene „Nuit d’extase“ nicht einmal an und Anna und Narbal spielen in ihrem Duo Ping-Pong. Der Ansatz war vielleicht interessant, aber die Inszenierung meist nur störend und – bis auf zwei Arien – total unmusikalisch und stümperhaft. Auch die besten Sänger/Darsteller hätten diese Regie nicht retten können.

So war der musikalische Aspekt des Abends nur streckenweise etwas besser als der szenische. Brandon Jovanovitch, der schon in Wien die Rolle des Enée gesungen hat, sprang nun in Paris für Bryan Hymel ein, der zum zweiten Mal in dieser Spielzeit hier eine große Rolle absagte. Ein schöner Heldentenor, der gut durch die Rolle kam, dabei aber für unsere Ohren erhebliche Berlioz-Stilfehler machte – Hat ihm niemand erklärt, dass diese Rolle für eine „voix mixte“ geschrieben wurde? Stépahnie d’Oustrac debütierte als Cassandre. Sie ist eine wunderbare Sängerin, die eine beachtliche Karriere macht: 2003 sang sie noch Ascagne, letzten Sommer war sie Carmen in Aix-en-Provence (auch mit Tcherniakov). Doch für Cassandre braucht man eine geborene „tragédienne“ – Anna Caterina Antonacci galt viele Jahre in Paris als die unangefochtene „Rollenträgerin“ der Cassandre (schade, dass sie in Wien indisponiert war!). D’Oustracs Stimme ist einfach zu klein für die große Opera Bastille. Vor 29 Jahren kam Grace Bumbry mühelos über das damals viel lauter spielende Orchester und hat in einer von uns besuchten Vorstellung in letzter Minute auch noch souverän ihre indisponierte Kollegin ersetzt – unseres Wissens das erste Mal, dass eine Sängerin in einer Vorstellung Cassandre und Didon gesungen hat.
Was ist aus den großen Stimmen von damals geworden? Elina Garanca hätte wahrscheinlich eine solche Stimme bei ihrem angekündigten Didon-Debüt gehabt, doch sie zog sich nach Anfang der Proben zurück (laut Gerüchteküche, weil sie schnell begriffen hatte, was aus dieser Produktion werden würde und dann auch nicht im Schatten von Joyce DiDonato stehen wollte, die zur Zeit als beste Didon gilt). Ekaterina Semenchuk, die die Didon schon vor zwei Jahren in Sankt Petersburg gesungen hat, war ein dürftiger Ersatz. Ihr fehlte völlig die „noblesse“ der verlassenen Königin. Das lag aber auch an der Regie: sie sah aus wie eine pummelige Putzfrau. Der Rest der Besetzung war durchwachsen: Paata Burchuladze hatte als Priam überhaupt keine Stimme mehr, während Stépahne Degout einen klangschönen Chorèbe gab (aber nicht so eindrucksvoll wie auf der Einspielung in Straßburg 2017 mit John Nelson). Die von uns öfters gelobte Michèle Loisier ging leider auch als Ascagne im allgemeinen Trubel unter. Cyrille Dubois durfte zum Glück als Iopas seine Romanze „O blonde Cérès“ beinahe alleine auf der Bühne singen (dort sehr schön begleitet durch den 1. Harfenisten der Oper David Lootvoet). Didons Schwester Anna wurde ganz wunderbar gesungen von Aude Extrémo (im Oktober eine fantastische Périchole in Bordeaux, siehe Merker 11/2018), mit dem nun hier an der Oper debütierenden Christian Van Horn als ebenbürtigen Narbal - es ist eine wirkliche Zumutung, dass man solche Sänger in ihrem wunderschönen Duo hinten auf der Bühne Ping-Pong spielen lässt! Und was soll man zum durch José Luis Basso offensichtlich ungenügend einstudierten Chor der Oper sagen, wenn er seinen wilden Auftritt und das große Finale verpatzt? Der Chor der Amsterdamer Oper bleibt auch noch in einer wilden Tcherniakov-Inszenierung lupenrein...
Philippe Jordan war leider bei dieser schwierigen Premiere als Dirigent nicht in Höchstform. Sein Bestreben war nach dem verpatzten Chor-Einsatz - bei der Generalprobe scheint es auch noch viele verpatzte Orchester-Einsätze gegeben zu haben – seine drei Chöre und Orchester coûte que coûte zusammenzuhalten. So hatte er das gute Orchester der Oper immer gut im Griff, aber es fehlten dann die vielen Temposchwankungen, die dieser Partitur erst wirkliches Relief geben. Doch in den wenigen Momenten, in denen die wilde Bühne der Musik mal etwas Raum gab, konnte man hören, was für einen romantischen, verfeinerten Berlioz er ursprünglich einstudiert hatte: er begleitete den großen Chor „Dieu protecteur de notre cité éternelle“ mit vielen Nuancen, die Bläserensembles (oft ein Problem in „Les Troyens“) waren nie zu laut, bei dem Septett und dem Oktett konnte man jeden Sänger hören und die großen Arien des 5. Akts hat er hingebungsvoll und äußerst sängerfreundlich begleitet. Dafür bekamen er, das Orchester, der Chor und alle Sänger viel Applaus - bis ein zehnminütiger Buh-Orkan folgte als das Regieteam auf die Bühne kam.
Die große Ablehnung des Publikums und einstimmig auch der Presse hat nicht nur mit der provokativen und teilweise völlig misslungenen Regie zu tun, sondern ganz allgemein, wie man an der Opéra de Paris mit Berlioz umgeht. An der Staatsoper wurden „Les Troyens“ bis auf eine Ballett-Reprise vollständig gespielt und scheint Dominique Meyer David McViar gebeten zu haben einige Striche aus San Francisco wieder zu öffnen. In Paris wurden nicht nur Ballett-, Chor- und Arien-Reprisen gekürzt, sondern ganze Szenen der „Troyens à Carthage“, alle Ballette des 4. und 5. Akt, viele Rezitative – insgesamt 40 Minuten! Und das teilweise auf eine so brutale Weise, dass schon während der Vorstellung ein älterer Herr vom Balkon seufzte: „encore des coupures!“ (schon wieder Striche). Würde man es in deutschen Landen akzeptieren, dass ein russischer Regisseur 40 Minuten in der „Götterdämmerung“ streicht, weil diese nicht in sein Kriegstrauma-Spital-Regiekonzept passen? Intendant Stéphane Lissner hat „keine besondere Affinität zu Berlioz“, wie er es uns schon vor 30 Jahren in einem Interview gesagt hat. Doch was kann der Sinn eines Berlioz-Zyklus an der Pariser Oper sein, wenn man jedes Werk an einen provokativen Regisseur gibt, bei dem die Musik völlig untergeht? Nach jeder Berlioz-Premiere gab es an der Opéra Bastille einen Buh-Orkan – an der Staatsoper im Oktober 20-minütigen Applaus. Denn „Les Troyens“ können ganz wunderbar sein, wenn man sie wirklich so spielt wie sie komponiert wurden: eigentlich eine Tragédie Lyrique wie Gluck und Rameau und keine Grand Opéra wie Wagner oder Verdi (Philippe Jordan und viele Andere auch irren sich meines Erachtens wenn sie Enée mit Tristan vergleichen). 2003 schloss John Eliot Gardiner einen inzwischen legendären Berlioz-Zyklus am Théâtre du Châtelet ab, zum ersten Mal auf historischen Instrumenten. Nach einem sehr gründlichen Studium des „Klangbilds das Berlioz vorgeschwebt hat“ hat Gardiner sogar für „Les Troyens“ eine ganze Serie von Blasinstrumenten nachbauen lassen. Das Resultat war verblüffend: so haben wir „Les Troyens“ nur dieses eine Mal gehört! Eine Schande, dass diese legendäre Produktion damals nicht aufgezeichnet wurde, doch die einstimmig hymnischen Rezensionen kann man heute noch im Internet nachlesen. Das müsste doch zum Nachdenken anregen. Die Opern von Berlioz wurden zu seinen Lebzeiten nicht an der Pariser Oper gespielt und jetzt nur noch in verstümmelter Form (in allen Produktionen der „Troyens“ an der Opéra Bastille wurde stark gekürzt). Hoffentlich wird das eines Tages anders werden – denn das hat Berlioz nach 150 schlechten Jahren an der Pariser Oper irgendwann doch mal verdient!
Waldemar Kamer 30.1.2019
Fotos (c) Vincent Pontet
Video ina.fr aus den Nachrichten
Giacomo Meyerbeer
LES HUGUENOTS
Premiere am 28.9.2018
Auftakt mit Paukenschlag einer großartigen 350 Jahre-Jubiläumsspielzeit
Am 28. Juni 1669 unterschrieb König Ludwig der XIV. das Gründungs-Manifest der „Académie royale d’opéra“. Deshalb kann sich die Pariser Oper „das älteste permanente Opernhaus der Welt“ nennen. Über die Bezeichnung lässt sich jedoch diskutieren, denn die königliche Oper in Kopenhagen ist noch ein paar Jahrhunderte älter, aber sie beruft sich lediglich auf eine königliche Hofkapelle, die alles andere als Opernmusik spielte. In Wien wurden zu besonderen Anlässen schon 1625 Opern in der Hofburg gespielt – das heutige Opernensemble wurde jedoch erst 1810 gegründet. Doch es ist über jeden Zweifel erhaben, dass Ludwig der XIVe die älteste noch bestehende Künstler-Krankenkasse und den ältesten Künstler-Pensionsfonds gegründet hat. Denn er war selbst ein quasi professioneller Tänzer, der alle Schwierigkeiten des Künstlerlebens all zu gut einschätzen konnte.

Sich auf Ludwig den XIVen berufend, hat Stéphane Lissner nun eine wirklich königliche Jubiläumssaison organisiert, in der der 350e Geburtstag der Pariser Oper prunkvoll auch außerhalb des Opernhauses gefeiert wird. Zusammen mit der Nationalbibliothek werden zwei große Ausstellungen über die reiche Geschichte der Opéra de Paris organisiert, das Musée d’Orsay zeigt „Edgar Degas und die Oper“ und das Centre Pompidou in Metz entwirft eine große Ausstellung über den Einfluss der Oper auf die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Akademie der Oper reist mit ihren beachtenswerten Produktionen durch ganz Frankreich und in Paris werden an beiden Häusern in der nun beginnenden Spielzeit ganze 421 Vorstellungen gegeben, mit 15 Neuproduktionen (Ballett inbegriffen). Allein schon dieses Eröffnungs-Wochenende bricht alle Rekorde: vier Premieren an nur zwei Abenden – davon drei Neu-Produktionen! Das hat es seit der Eröffnung der Opéra Bastille 1989 noch nie gegeben. Denn dank von extra Subventionen wird die immer noch „unfertige“ Bastille-Oper nun endlich wirklich zu Ende gebaut und soll der dritte Saal, die von Pierre Boulez so heiß ersehnte „Salle modulable“, nun 2022 eröffnet werden.

Die Jubiläumsspielzeit beginnt prachtvoll mit Giacomo Meyerbeer, dem Erfinder der „grand opéra“ und dem meist einflussreichen Komponisten in Paris zu Wagners Zeiten (weshalb dieser so böse auf ihn war). „Les Huguenots“, 1836 an der Opéra de Paris uraufgeführt, war einer der größten Erfolge der ganzen Operngeschichte und das erste Werk, das 1903 die bis dann unerreichte Zahl von Tausend Vorstellungen an der Pariser Oper erreichte. Doch nach den großen Vorstellungen 1936 zu ihrem hundertsten Jubiläum, wurden „Die Hugenotten“ in Paris nie mehr gehört oder gesehen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg galt Meyerbeer – wie so viele andere Komponisten – in Paris als völlig „passé“. Es ist der Meyerbeer-Neuausgabe und den Berliner Opern zu danken, dass er seit zwanzig Jahren nun wieder langsam auf die Spielpläne kommt, mit u.a. einer recht gut gelungenen Vorstellung der „Huguenots“ 2011 in Brüssel.
Die jetzige Produktion ist viel grösser und wird in jeder Hinsicht der wahren Dimension einer „grand opéra“ gerecht. Michele Mariotti dirigiert zugleich souverän und mit Finesse den riesigen Chor der Opéra de Paris (sehr gut einstudiert durch José Luis Basso) und das Orchester der Oper in großer Besetzung. Der ehemalige Direktor des Wiener Burgtheaters Andreas Kriegenburg, der nun in Paris debütiert, inszeniert klassisch und ohne viel Firlefanz die komplizierte Geschichte. Wir sind der dreistöckigen Kasten-Bühne von Harald B. Thor in der letzten Zeit etwas oft begegnet, sie hat jedoch den Vorteil, dass man die Sänger über den riesigen Chor stellen kann, alle quasi von der Rampe singen können und das Ganze akustisch gut funktioniert.

Die Kostüme von Tanja Hoffmann sind auch nicht besonders originell, aber man versteht in den großen „Tableaus“ wer Katholik (bunt) und wer Protestant (schwarz) ist, und wer zum Chor und zu den zahlreichen Solisten gehört. Diese werden angeführt durch Lisette Oropesa (statt der ursprünglich angesagten Diana Damrau) als exzellente Marguerite de Valois. Ihre berüchtigt schwierige Arie „O beau pays de la Touraine“, mit wunderbaren aber sehr sehr langen Koloraturen, war der Höhepunkt des Abends. Yosep Kang konnte da als Raoul de Nangis nicht mithalten. Aber er war erst zur Generalprobe für den plötzlich erkrankten Bryan Hymel eingesprungen – das wird sich sicherlich in den nächsten Vorstellungen noch geben. Der zweite Star des Abends war Ermonela Jaho als Valentine, eine fast Mezzo-Rolle mit hohen Koloraturen, die sie glänzend gemeistert hat. Ihr folgte Karine Deshayes als Page Urbain. Schade, dass man ihre zweite Arie gestrichen hat, so wie die Ballette und noch einiges mehr – aber mehr als 5 Stunden Meyerbeer scheint man dem heutigen Pariser Publikum nicht mehr zumuten zu können. (Letztes Jahr wurden bei der Urfassung von Verdis „Don Carlos“ auch die Ballette gestrichen.) Das Premierenpublikum dankte mit einen in Paris ganz unüblichen Riesenapplaus ohne jeglichen Buhruf.
Die Uraufführung eines neuen Auftragswerks der Pariser Oper, „Bérénice“ (nach Racine) von Michael Jarrel, und die Wiederaufnahmen der bewährten „Traviata“ und der spektakulären Inszenierung von „Tristan und Isolde“. Das nennt man eine Spielzeiteröffnung „mit einem königlichen Paukenschlag“.
Waldemar Kamer 30.9.2018
Fotos (c) Agathe Poupeney
PARSIFAL
Erste Reprise der Neuinszenierung am 16.05.2018
Eines kann man Richard Jones, dem Regisseur des neuen Pariser „Parsifal“ an der Opéra de Paris Bastille nicht vorwerfen, auch wenn sonst einiges „ungewohnt“ erscheint: Wenn es ernst wird, hält er sich offenbar ganz genau an Richard Wagners Text. Wenn Parsifal nämlich zu seinem großen Monolog im 2. Aufzug ansetzt, … „bricht er“, „wie um einen zerreißenden Schmerz zu bewältigen“ aus: „Amfortas! – – Die Wunde! – Die Wunde! – Die Wunde! – Sie brennt in meinem Herzen. – …“ muss man dabei sofort an das Blutbad denken, welches der „reine Tor“ im 1. Aufzug nach Amfortas‘ Gralserhebung erleben musste. Der traurige Gralskönig bricht nach der Zeremonie kraftlos zusammen, fällt gar vom Tisch, auf den er steigen und die goldene, allerdings leere Schale wie die New Yorker Freiheitsstatue ihre Fackel in die Höhe recken musste. Er bleibt in einer Blutlache liegen, die wie eine Quelle aus seiner Wunde im wahrsten Sinne des Wortes „fließt“. Auch dieses steht so bei Wagner! So wird Parsifals schmerzerfüllter und hochemotionaler Ausbruch nur zu erklärlich und nachvollziehbar. Peter Mattei, den ich in der Rolle schon vor Jahren in Lyoner „Parsifal“ hören konnte, welcher dann ja an die Met ging, ist ein exzellenter Amfortas mit einem herrlich kantablen Heldenbariton und einer unglaublich intensiven und zutiefst leidenden Darstellung, die er mittlerweile total verinnerlicht hat. Mattei war einer der Besten des Abends.

Richard Jones konfrontiert uns in den Bühnenbildern und mit den nicht ganz geschmacksicheren Kostümen von Ultz und dem nicht immer optimal changierenden Lichtdesign von Mimi Jordan Sherin mit einer Sekte, deren höchstes und wahrscheinlich auf Ewigkeit zu tradierendes Gut die Dogmen in einem dicken blauen Buch zu sein scheinen. Die mehrsprachigen Bände füllen lückenlos die Bücherregale in der modern möblierten und mit einer völlig entbehrlichen Zentrifuge ausgestatteten Gralsküche neben den Rucksäcken eines jeden Gralsritters. Über dem Herd, auf dem riesige dampfende Kochtöpfe stehen, – man denkt sofort an die bald zu servierende Gemeinschaftssuppe, aber es kommt viel schlimmer – prangt ein schlechtes Ölgemälde des offenbar verstorbenen Sektenführers. Bezeichnend für den Machtanspruch der Sekte hat er eine Hand auf der Weltkugel. Von ihm sehen wir auch noch eine goldene Büste im Breker-Design auf Podest mit Wasserbecken links von der Gralsküche. (Titurel ist es aber nicht, denn der liegt im Nebenzimmer über jenem von Amfortas reglos in seinem Bett, betreut von einem Pfleger). Um diese Büste sitzen bereits während des Vorspiels die Knappen züchtig und regungslos in ihren Büchern lesend herum. Erst als Gurnemanz kommt, dürfen sie sich rühren. Günther Groissböck singt die Riesenpartie mit seinem wundervollen, eher hellen Bassbariton bei bester Diktion und Top-Höhen. Hier ist bereits überdeutlich der Wotan zu hören… Ein begnadeter Sänger mit hoher Intelligenz, der deshalb auch die Rolle bestens zu spielen weiß. Gianluca Zampieri, der immerhin in Erl den Siegfried und Tristan singt, sowie Luke Stoker sind zwei gute Gralsritter, die sich in ihrem olivgrünen Ornat rangmäßig von den weiß gekleideten Knappen abheben.

Ganz offenbar herrschen in dieser Sekte „Zucht und Ordnung“. Gurnemanz kommt aus dem Hinterzimmer und mahnt zur Wachsamkeit. Dabei tun doch eh‘ alle, was hier angesagt ist: Nach gnadenlosen Dogmen leben, die ganz offenbar jedes Fünkchen Mitgefühl mit dem Schicksal anderer im Keim ersticken bzw. gar nicht erst entstehen lassen. Denn nur so ist die grausam anmutende Gleichgültigkeit aller während der Gralserhebungszeremonie zu erklären, die eben mit der Beinahe-Verblutung des Amfortas und dem routineartigen Eintauchen seiner blutigen Bettwäsche in die statt mit Suppe mit kochendem Wasser gefüllten Töpfe zur Reinigung für das nächste Mal endet… Reinigungspersonal, freilich durchaus post-stereotypisch banal wirkend, wischt unterdessen mit einigen Tüchern das Blut vom Boden auf, als wäre eine Blumenvase umgekippt… Titurel tritt fordernd als ein steinalter Mann auf, der meist getragen werden muss und nach der Gralserhebung gerade einmal vier Schritte schafft. Reinhard Hagen singt ihn klangvoll aus dem Off. Daniela Entcheva schließt mit ihrem vollen Mezzo aus der Höhe den 1. Aufzug ab, nach dem übrigens in Paris aufs Heftigste geklatscht wird.
Beim ersten Mal, – nach dem Erklingen ganz natürlicher Glasglocken aus der Ferne – lässt sich Amfortas ja noch den königlichen Hermelinmantel aus seiner Garderobe überziehen. Den wirft er dann aber frustriert von sich, als es in seinem großen ersten Monolog so weit ist. Im 3. Aufzug sieht das alles schon ganz anders aus. Die Gralsgemeinschaft ist ganz den Worten den Gurnemanz entsprechend „führerlos“. Die Knappen, die schon längst nicht mehr alle ihre Bücher haben und ohnehin kaum noch darin lesen, schlagen sich frustriert unter der Büste des Sektenführers. Die Bücherregale sind leer, fast alle Rucksäcke weg. Alle, gerade auch Gurnemanz, haben nun lange Haare. Offenbar hat sich mit Amfortas‘ Weigerung, den Gral noch einmal zu erheben, auch der Hausfriseur davon gemacht, wie einst Gawan. Umso mehr wundert einen nun das schicke Outfit von Gurnemanz, der im 1. Aufzug noch in eher bedürftig wirkender Kleidung auftrat. Immerhin hat er noch seine Bibel. Wie gesagt, die Kostüme sorgten für manche Überraschung, zumal jenes von Parsifal, der sogar noch im 2. Aufzug mit einem roten Pullover und Shorts herum läuft… Banaler ging es nicht mehr – damit würde man nicht einmal als Zuschauer auf einem Golfplatz zugelassen. Dafür zeigt Jones die völlige Verzweiflung des Amfortas wie kaum ein anderer zuvor. Wir sehen ihn unter den führungslosen Gralsrittern im blutbefleckten Trainings-Anzug herumlaufen. Wenn sie ihn entdecken, will er immer wieder ausbrechen und flüchten. Sie lassen ihn aber nicht. Mit der Sturheit unglaublicher Herzlosig- und Grausamkeit zwingen sie den sich gegen sein Schicksal Stemmenden wieder an den Opfertisch – bis endlich Parsifal kommt. Die von José Luis Basso einstudierten Chöre singen stimmstark und sind bestens choreografiert (Lucy Burge). Allein bei den Damen aus dem Off gibt es einige Probleme beim Erreichen aller erforderlichen Töne.

Dazwischen geht Parsifals Verwandlung von statten, denn dass hier wahrlich, wie von Wagner gewünscht, nur noch Mitleid helfen kann, das hat Jones mit seiner dicken Zeichnung der Verrohung des Grals-Kultes offenbar gemacht. Hierin liegt einer der Verdienste der Inszenierung, obwohl an diesem Abend doch wieder klar wurde, dass es ganz ohne Mystik in Wagners „Parsifal“ nicht geht. Und davon wollte der Regisseur offensichtlich gar nichts wissen. Klingsor klont sexbesessene Jungfrauen, die er aus Maiskolbenblüten heranzüchtet – eine schwimmt gerade halbentwickelt in einer Art Aquarium, noch an der Nabelschnur. Bald wird sie wie die anderen in Maiskolbendolden mit übertrieben gestalteten äußeren Geschlechtsmerkmalen herum zappeln, um Parsifal einzufangen.
Bis dahin braucht es aber lange, denn Klingsor muss auf seinem Maiskolbenbeet ständig für künstliche Befruchtung sorgen. Er wirkt in seinem rosa Trainingsanzug mit Ornat eher wie ein verkommener Dandy denn als gefährlicher Zauberer. Evgeny Nikitin bleibt, was sein heldenbaritonales Potenzial angeht, etwas hinter meinen Erwartungen zurück, spielt die ihm zugewiesene Rolle aber eindringlich. Der Stimme mangelt es bei guter Höhe doch an Volumen und auch Resonanz. Anja Kampe kommt als Kundry zunächst als Barbie-Puppe daher, lässt aber bald das rosa Kleidchen zugunsten eines schwarzen Negligés fallen. Kampe besticht mit einer äußerst intensiven Darstellung der so komplexen Facetten der Rolle und ihrem in der Mittellage etwas dunkel timbrierten Sopran, den sie perfekt führt und intoniert. Ihr „und lach-te!“ ging mit der Höhe und der direkt nachfolgenden Tiefe wahrlich unter die Haut. Auch die so schwierigen „Irre! Irre!“-Rufe kamen perfekt. Sie dürfte eine der besten Kundrys unserer Zeit werden. Andreas Schager schafft es, Kampe auf Augenhöhe zu begegnen, denn er spielt den Mitleid gewinnenden „Helden“ trotz seines banalen Outfits in überzeugender Weise. Auch stimmlich ist der Österreicher dieser und anderen Wagner-Partien gewachsen. Allein, er singt fast immer nur im Forte und einfach zu oft zu laut. Es wäre schade, wenn dieser schönen heldentenoralen Stimme wegen ständiger Überforderung durch zu hohen Kraftaufwand ein allzu kurzes Leben beschieden wäre. Anna Siminska, Katharina Melnikova, Samantha Gossard sowie Tamara Banjesevic, Anna Palimina und Marie-Luise Dressen singen klangschön und engagiert die Zaubermädchen.
Eindrucksvoll und eschatologisch dann der Untergang von Klingsors Zaubergarten: Nachdem Parsifal ihm kraft seines Widerstands gegen die Versuchung den Speer aus der Hand genommen und ihn mit einer Art Machete tödlich aufgeschlitzt hat, kommt der Zaubergarten als Ansammlung verkohlter Skelette auf verwelkten Blüten – „ich sah sie welken…“ – aus dem Dunkel nach vorn – ein starker Einfall!
Der bald in Wien antretende Pariser Musikdirektor Philippe Jordan leitete das Orchestre de l‘Opéra national de Paris und fand wohl nicht zuletzt nach seiner Erfahrung mit diesem Werk in Bayreuth zu einem dezenten, äußerst transparenten und eher lyrischen, ja bisweilen fast kammermusikalischen „Parsifal“-Klang. Hier merkte man viel Liebe zum Detail, was sich allerdings auch etwas auf die Tempi auswirkte. Schon das Vorspiel zum 1. Aufzug wurde von Jordan nahezu zelebriert. In einem Aufsatz im Programmheft legt er dar, dass Wagner mit dem „Parsifal“ kein Drama mehr komponiert habe, sondern eine „musique d‘office“. Ja, er ortet sogar aufgrund der christlichen Symbole wie Gral und Glasglocken eine „silence solenel digne d‘une église“. Es spricht nichts dagegen, den „Parsifal“ so zu musizieren. Aber in diesem Fall waren Expressivität und Aktionismus auf der Bühne so intensiv, dass sie durchaus eine kräftigere musikalische Herangehensweise vertragen hätten, ja diese sogar angebracht gewesen wäre. So kam es bisweilen zu einer sonderbaren Dichotomie zwischen dem, was man auf der Bühne sah und aus dem Graben hörte. Gleichwohl wurden Jordan und sein Orchester vor dem 2. und 3. Aufzug mit großem Auftrittsapplaus bedacht, wie sich auch alle SängerInnen mit leichten Abstrichen bei Nikitin über große Publikumszustimmung freuen konnten.
Spannend ist immer, was dem jeweiligen Regisseur zum Finale des „Parsifal“ einfällt. Parsifal heilt hier die Wunde des Amfortas mit dem Speer. Dieser küsst daraufhin Kundry ein letztes Mal mit größter Begierde, worauf er – wohl entsühnt – stirbt. Da Parsifal keine Anstalten macht, in sein Amt einzutreten, erscheinen die Ritter wieder führungslos. Er zieht stattdessen mit Kundry von dannen, die Ritter alle hinterher. Das scheint Parsifal jedoch nicht mehr zu interessieren. Eines ist jedenfalls klar, wie einst bei Christine Mielitz in Wien: Der Gral hat ausgedient. Wohl auch gut so…
Copyright: Emilie Brouchon
Klaus Billand 20.5.2018
BENVENUTO CELLINI
7.4.2018
Eine sehr selten gespielte Oper: nun zum dritten Mal seit der Uraufführung 1838 in einer überbordenden Bebilderung von „Monty Python“
In dem oft etwas bizarren Werkverzeichnis von Hector Berlioz gibt es nur vier „Opern“: „Les Troyens“, „La damnation de Faust“, „Béatrice et Bénédict“ und „Benvenuto Cellini”, wovon die beiden Letzteren beinahe nie aufgeführt werden. Dafür gibt es gute Gründe: „Béatrice et Bénédict“ ist eine problematische Opéra comique nach einer Komödie von Shakespeare, „Benvenuto Cellini“ eine dreimal überarbeitete Erstlingsoper nach den fantasievollen Memoiren des gleichnamigen Bildhauers, in Wien voral wegen eines Salzfasses bekannt. Sie wurde seit der Uraufführung 1838 nur drei Mal an der Pariser Oper gespielt, 1993 zum letzten Mal im Rahmen des Berlioz-Zyklus, mit dem man die neue Opéra Bastille 1990 eröffnet hatte. Doch die Vorstellungen stießen auf so viel Ablehnung, dass der Zyklus nicht weitergeführt wurde. 25 Jahre später versucht man es nun wieder mit einer ganz anderen Art von Inszenierung.
Niemand ist Prophet im eigenen Lande, doch die Probleme die Berlioz bis heute an der Opéra de Paris hat wurden schon bei der Uraufführung 1838 durch ihn selbst vorprogrammiert. Der geniale Komponist rieb sich immer wieder mit den offiziellen Musikinstanzen, indem er Werke komponierte, die als nicht spielbar oder nicht aufführbar galten. Wie so oft bei ihm, klafft eine richtige Kluft zwischen der hochkarätigen literarischen Vorlage, einem eher mittelmäßigen Libretto und einer überbordenden Musik, in der ungefähr alle möglichen Genres zusammengewürfelt wurden. Es war eine geniale Idee, um aus den damals in Frankreich völlig unbekannten Memoiren Benvenuto Cellinis eine Oper machen zu wollen.

Niemand weniger als Johann Wolfgang von Goethe hatte als einer der ersten den historischen und literarischen Wert dieser Memoiren aus 1558 erkannt – anscheinend die allerersten ausgeschriebenen Künstler-Memoiren überhaupt -, die erst 1728 verlegt wurden und die Goethe 1796 mit seiner Übersetzung einer breiteren Leserschaft zugänglich machte. Ein wunderbarer Stoff, der bis heute viele Künstler fasziniert und inspiriert. Berlioz, der 1832 dem Karneval in Rom beigewohnt hatte, wollte ursprünglich aus Cellinis „Vita“ eine Komödie machen. Doch als die Opéra Comique das Werk verweigerte, bat er seine Librettisten Léon de Wailly und Auguste Barbier das Werk in eine Tragödie umzuändern, die dann an der Opéra de Paris uraufgeführt werden sollte. In seinen Memoiren beschreibt Berlioz wie schrecklich die drei Monate Proben an der Pariser Oper waren und vergisst dabei zu erwähnen, dass es in Wirklichkeit mehr als sechs Monate Proben waren, über die man einen ganzen Roman schreiben könnte.
So wie Wagner kurz nach ihm, verstand Berlioz sich überhaupt nicht mit dem Haus-Dirigenten und reagierte wenig flexibel auf jede Bitte der Direktion. Wie seine Kollegen musste er kurz vor der Premiere widerwillig noch zusätzliche Arien für rebellierende Sänger komponieren, die ihm gar nicht gefielen - und die heute als die besten Momente der ganzen Oper gelten. Die Uraufführung 1838 war ein völliges Fiasko: nach drei Vorstellungen warf der Tenor das Handtuch, und die lange Oper wurde kurzerhand durch die Direktion der Opéra de Paris zu einem Akt zusammengeschnitten (der dann an einem Abend zusammen mit einem Ballett gegeben wurde).

Daraufhin zog Berlioz sein Werk mit einem solchen Eklat zurück, dass er danach nie wieder an der Pariser Oper zugelassen wurde. Schließlich war es der gütige Franz Liszt, der Berlioz anbot, den „Benvenuto Cellini“ in Weimar aufzuführen -1852 in einer dritten Fassung, die durch Liszt und seinem Schwiegersohn Hans von Bülow erstellt wurde (aus zwei, später einem Akt in Paris wurden nun drei Akte in Weimar). Weimar führte zu einer Einladung nach London, wo Berlioz zum ersten und einzigen Mal „Benvenuto Cellini“ selbst dirigieren durfte, dazu noch in Anwesenheit der Queen Victoria. Doch auch London wurde ein Fiasko, wonach der Komponist nichts mehr mit seinem Erstlingswerk zu tun haben wollte, das auch134 Jahre nicht mehr an der Pariser Oper gespielt wurde.
Diese verwickelte Entstehungsgeschichte erklärt alle bis heute andauernden Schwierigkeiten mit „Benvenuto Cellini“: Nach einer langen Ouvertüre (die Berlioz später zum „Carneval Romain“ umarbeitete) folgt ein wildes Karnevalstreiben, in der sich eine opernübliche Dreiecksgeschichte abspielt: der verkannte Künstler Cellini (Tenor) verliebt sich in ein junges Mädchen, Teresa (Sopran), doch ihr geldgieriger Vater, Balducci (Bass), möchte sie an einen erfolgreicheren Bildhauer, Fieramosca (Bariton), verheiraten. Cellini will daraufhin Teresa im wilden Karnevalstreiben entführen - als Mönch verkleidet.

Doch im besagten Moment reichen zwei Mönche Teresa die Hand, da Fieramosca ihr Gespräch belauscht hat und nun auch als heiratswilliger Mönch erschienen ist. Es folgt ein heilloses Durcheinander, das mit einem tödlichen Duell endet. Doch im zweiten Akt erscheint der Papst höchstpersönlich im Atelier Cellinis und vergibt dem Rebellen alle seine Sünden, denn für hochbegabte Künstler gelten eben andere Gesetze als für den Normalbürger. Terry Gilliam, einer der Mitbegründer der berühmt-berüchtigten „Monty Pythons“ in den 1960/70er Jahren, stieß auf diesem Stoff, als er 2011 sein Debüt als Opernregisseur mit „La damnation de Faust“ an der English National Opera gab. Und 2014 erarbeitete er zusammen mit seiner Koregisseurin und Choreographin Leah Hausman diese Inszenierung von „Benvenuto Cellini“, die seitdem auch in Amsterdam, Barcelona und Rom gespielt wurde. Wer die Monty Python-Filme kennt, weiß also worauf man sich jetzt gefasst machen kann.
Schon während der Ouvertüre fing das wilde Treiben an, mit Akrobaten auf der Bühne, einem ekstatischen Karnevalszug der durch das Parkett zog und einem riesigen Regen von bunten Konfetti, so wie wir es noch nie in einem Opernhaus erlebt haben. Wir waren zugleich amüsiert und irritiert, denn dabei ging die Musik der Ouvertüre – die Berlioz als das Beste vom ganzen Werk bezeichnete - vollkommen unter. Das war auch global unser Eindruck des ersten Aktes: vor lauter Karnevalstrubel, war an ein konzentriertes Zuhören kaum zu denken. Doch im zweiten handlungsärmeren Akt gab es weniger Trubel und kam die Musik viel mehr zu Geltung, vor allem in den drei Arien, die Berlioz noch kurz vor der Premiere komponiert hatte (es wurde eine Mischfassung mit vielen Strichen gespielt, die „nur“ drei Stunden dauerte.) Szenisch verlief der Abend wie ein „Musical“, mit akrobatischen Pantomimen und Tanzeinlagen, wofür entsprechende Seiltänzer und Zirkus-Künstler engagiert worden waren. Auch das Bühnenbild von Aaron Marsden und die Kostüme von Katrina Linsday waren explizit – für Opernaugen etwas „billig“ - in der Musicalwelt angesiedelt.

Aber in mitten dieses bunten Treibens wurde durchgehend auf hohem Niveau gesungen. Die Besetzung der Hauptrollen war noch die aus London und wurde angeführt von John Osborn in der höllisch schwierigen Partie des Cellini. Wir erinnern uns noch genau an den jungen Sänger, der 1996 den Operalia-Wettbewerb gewann und dem wir damals eine große Karriere prophezeiten. John Osborn hat sich klug seine Rollen ausgesucht, blieb mehr als zehn Jahre im Belcanto-Fach, bevor er sich langsam aber sicher als einer der international gefragtesten Interpreten der französischen Grand Opéra (Meyerbeer, Halévy etc) profilierte. Osborn beherrscht den Stil perfekt und verfügt über eine exzellente Technik, die es ihm erlaubt mit einer „voix mixte“ perfekt fokussiert über das große Orchester zu kommen (in der riesigen Opéra Bastille für viele Sänger ein Problem). Sein Gegenspieler, der norwegische Bariton Audun Iversen, der nun an der Pariser Oper debütierte, konnte ihm als Fieramosca szenisch und musikalisch mühelos das Wasser reichen. Das kann man nur begrenzt von der Teresa von Pretty Yende behaupten, die als vollbusige Südafrikanerin szenisch in der Rolle des jungen schüchternen Mädchens nicht glaubwürdig war und die kein einwandfreies Französisch sang. Aber ihr glockenheller Sopran harmonierte wunderbar mit dem von Michèle Loisier im Gebet des zweiten Aktes „Sainte Vierge Marie, étoile du matin“. Loisier trat auf als Ascanio, eigentlich nur eine Nebenrolle als Assistent Cellinis.

Doch sie wurde bei der Uraufführung 1838 durch Rosina Stolz gesungen, der Hosenrollen-Star vieler Opern Meyerbeers, was es ihr ermöglichte, kurz vor der Premiere (auch) eine eigene Arie einzufordern. So komponierte Berlioz das dramaturgisch vollkommen unwichtige Lied „ Tra la la la la, Mais qu’ai-je donc? Tout me pèse et m’ennuie ! “, das seit der Uraufführung als musikalischer Höhepunkt der ganzen Oper gilt (und die einzige Arie aus „Benvenuto Cellini“ ist, die man gelegentlich auch im Konzertsaal hört). Michèle Loisier sang es lupenrein, mit perfektem Stilgefühl und bekam dafür den größten Applaus des Abends. Maurizio Muraro und Marco Spotti verfügten mit soliden Bässen über die nötige Autorität als Vater Balducci und als Papst Clemens VII. Bei den Comprimari erkannten wir mit Vergnügen zwei frühere Sänger des Atelier Lyrique: Vincent Delhoume als Francesco und Rodolphe Briand als Pompeo. Der durch José Luis Basso einstudierte Chor meisterte die rhythmisch oft höllisch schwierigen Karnevalsszenen, doch verlor jedoch dabei öfters die Intonation und den Kontakt zum Orchester . Das lag auch an den sehr zügigen Tempi von
Philippe Jordan, dem wohl nichts anderes übrigblieb als dem sehr hohen Tempo auf der Bühne mit seinen Musikern hinterherzulaufen - so gut sie es halt konnten.
Die Reaktionen auf diese neue Inszenierung sind in Paris sehr gespalten. Während sie in London und Amsterdam – so die Pressesprecher – anscheinend unter dem Motto „so bringt mein Junge Leute in die Oper“ bejubelt wurde, waren die Pariser Premieren-Kritiken vollkommen vernichtend. Die Tageszeitung „Le Monde“ brachte eine ganze Seite mit der Überschrift „Enttäuschend“ und meinte, dass man einen Tag später den Goldregen schon wieder vergessen hätte (zum Finale gab es goldfarbenes Konfetti). Das stimmt, doch in diesem Fall muss ich ausnahmsweise den Intendanten und den Regisseur vor den ewig nörgelnden Pariser Kritikern in Schutz nehmen. Was wäre die Alternative gewesen? Noch eine klassische Inszenierung, nachdem „Benvenuto Cellini” nur zweimal im ganzen 20. Jahrhundert szenisch an der Opéra de Paris gegeben wurde? – 1972 und 1993, beide Male ohne Erfolg (wir erinnern uns nur noch vage an einen langweiligen Abend). Wieder unverständliches Regie-Theater wie zum Auftakt des jetzigen Berlioz-Zyklus, an dem „La damnation de Faust“ in der unsäglich schlechten Inszenierung von Alvis Hermanis trotz Starbesetzung (Jonas Kaufmann, Bryn Terfel etc) einstimmig ausgebuht wurde (siehe Merker XII 2015)? Deswegen wurde „Béatrice et Bénédict“ in der letzten Spielzeit nur noch konzertant gegeben - was in einem Opernhaus nun wirklich keine Lösung ist. Also dann lieber szenisch! Und auch wenn uns persönlich diese Inszenierung nicht überzeugt hat, haben wir uns gefreut über die vielen jungen Leute die im Parkett saßen, da sie an der Abendkasse die vielen unverkauften Plätze für nur 20 statt 240 € ergattern konnten. Und sie sind unser Publikum von morgen. Nächste Spielzeit wird der Pariser Berlioz-Zyklus abgerundet mit „Les Troyens“. Wir sind schon gespannt!
Waldemar Kamer 10.4.2018
Bilder (c) Agathe Poupeney
LA TRAVIATA
am 28. Februar 2018
Verhaltenes Paris-Debüt von Marina Rebeka mit einem „sehr alten“ Placido Domingo
Verdis „Traviata“ spielt in Paris, doch die Pariser Oper – wo das Werk eigentlich besonders gut hinpassen müsste – scheint kein Glück mit ihr zu haben. Da sich die Inszenierung von Franco Zeffirelli aus 1986 nicht halten konnte, beauftragte Hugues Gall Jonathan Miller 1997 mit einer neuen Produktion. Millers wunderschöne „Bohème“ wurde zwanzig Jahre lang gespielt, doch seine „Traviata“ war kein Erfolg. So bestellte Gerard Mortier 2007 eine andere bei Christoph Marthaler, die von einer seltenen Hässlichkeit war. 2014 wurde Benoît Jacquot gerufen, ein erfolgreicher Filmemacher, der 2010 sein Debüt als Opernregisseur mit einem wunderschönen „Werther“ in London gegeben hatte. Doch die „Kammeroper“ von Massenet – die er auch filmte – scheint ein Glücksfall gewesen zu sein, denn bei der „Traviata“ lieferte er nicht mehr als repertoiretaugliches Rampentheater (siehe unsere Premieren-Rezension im Merker VII/2014) – und er hat seitdem keine Oper mehr inszeniert.

Die Produktion hat jedoch zwei Qualitäten: sie sieht schön aus - Eleganz ist für das Pariser Stammpublikum ein Muss - und man kann mühelos große Sänger für ein paar Vorstellungen kommen lassen, denn viele Proben sind hier nicht nötig. So haben seit 2014 schon eine ansehnliche Reihe großer Sängerinnen an der Opéra de Paris eine „Traviata“ gesungen, beginnend mit Diana Damrau bis zu Sonya Yoncheva. Nun war Anna Netrebko an der Reihe, doch sie sagte krankheitsbedingt ihre drei Vorstellungen ab und wurde ersetzt durch Marina Rebeka (die schon die ersten fünf Vorstellungen dieser Serie gesungen hatte). So wie Marina Rebeka im November dem Merker Peter Dusek im Interview erzählte, ist die „Traviata“ ihre „Schicksalsoper“, mit der sie vor zehn Jahren in Erfurt ihr Bühnendebüt gegeben hat und sie seitdem schon in 14 Produktionen gesungen hat: u.a. an der Met, in Covent Garden, in München und letzten Herbst mit viel Erfolg an der Wiener Staatsoper. Wir waren also gespannt. Im ersten Akt sang sie „E strano“ sehr nuanciert, musikalisch und – mit Hilfe des Dirigenten - auffallend leise. Aber warum auch nicht? Es handelt sich ja um ein Selbstgespräch von Violetta in ihrem Boudoir, in das sie sich nach einem Hustenanfall zurückgezogen hat. Doch bei der leidenschaftlichen Trennung von Alfredo im zweiten Akt muss sie über das gesamte Orchester „Amami Alfredo quant io t’amo, Addio“ singen – und da verlor ihre Stimme ihr schönes Timbre und wurde schrill. In dem großen Saal der Opéra Bastille braucht man halt eine große Stimme...

Und wenn man die nicht hat, dann zumindest ein großes inneres Feuer. Mit diesem kam Placido Domingo im zweiten Akt auf die Bühne. Er war offensichtlich sehr glücklich da zu sein und spielte mit viel Überzeugung einen fast boshaften alten, aufgeregten, achtzigjährigen Giorgio Germont (was ja auch ungefähr sein eigenes Alter ist). So konnte er auch mit viel métier alle seine leider nun auftretenden stimmlichen Probleme überspielen. Seine kleine Arietta „Pura siccome un angelo“ verlief ganz problemlos, doch in dem „Wiegenlied“ für seinen Sohn versagte seine Stimme. Wir haben Domingo schon öfters als Giorgio Germont gehört, auch in dieser Inszenierung, aber noch nie wie an diesem Abend. Schon im ersten Satz, „Di provenza il mar, il sol, chi dal cor ti cancello“, musste er drei mal atmen (statt kein mal). Er brachte damit den Dirigenten in Schwierigkeiten (den er keines Blickes würdigte). Und als er beim letzten Satz angelangt war, „Ma se alfin ti trovo ancor“, bekam er das hohe G nicht (hoch für jeden Bariton), wiederholte es nicht (was viele andere auch nicht tun) und atmete vier mal – womit jedes Legato verloren ging und der Schluss verpuffte. Das Pariser Publikum klatschte laut und lang – doch der Beifall galt mehr dem einstigen Publikumsliebling als dem jetzigen Sänger, dem man nur raten kann, diese Rolle – die er noch einmal in Wien singen wird – so bald wie möglich abzulegen. Er kann doch noch so viel Anderes !

Neben einer uns nicht überzeugenden Violetta und einem uns sehr enttäuschenden Giorgio Germont, war Charles Castronovo als Alfredo der beste Sänger des Abends. Seine Stimme klang dunkler als sonst, was anscheinend an einer Erkältung lag (kein Wunder bei der „sibirischen Kälte“), doch auch er besaß so viel métier um all dem gewachsen zu sein. Der Rest der Besetzung war gut ohne wirklich hervorragend zu sein. Die Amerikanerin Virginie Verrez debütierte als Flora, Isabelle Druet sang Annina und wir freuten uns, einige Sänger des Atelier Lyrique und des Chors nun als Solisten auf der großen Bühne zu sehen, so wie Tiago Matos als Marquese d’Obigny und Pierpaolo Palloni als Comissionario. Dass der Abend nicht mehr Glanz bekam, lag neben der langweiligen Inszenierung auch an dem nicht sonderlich inspirierenden Dirigat von Dan Ettinger. Er fing fein und leise an und unterstützte die Sänger wo und wie er konnte. Doch dabei verzettelte er sich mehr und mehr und am Ende fehlten der große Bogen und die Dramatik. Eine undramatische „Traviata“ in Paris... die Opéra de Paris hat einfach kein Glück mit diesem Werk.
Bilder (c) Emilie Brouchon
Waldemar Kamer 3.3.18
AUS EINEM TOTENHAUS
am 2.12.2017
Nach zehn Jahren Abschied von der faszinierenden Inszenierung des großen Patrice Chéreau
Gute Arbeit bleibt faszinierend, auch wenn der Regisseur inzwischen verstorben ist. Intendant Stéphane Lissner, der im Programmheft seine langjährige Zusammenarbeit mit Patrice Chéreau beschreibt als „le plus beau compagnonnage de ma carrière“ (die schönste Zusammenarbeit meiner Laufbahn/ Gesellengesellenbruderschaft), hat die epochale Inszenierung von Chéreau nun zum letzten Mal wiederaufgenommen. Sie entstand 2007 in den damals von Lissner (zusammen mit Luc Bondy) geleiteten Wiener Festwochen und wurde seitdem im Holland Festival in Amsterdam, den Festspielen von Aix-en-Provence, der Metropolitan Opera in New York und der Mailander Scala wiederaufgenommen. Chéreau hat selbst noch vor seinem Tode 2013 die Besetzung dieser letzten Wiederaufnahme mitbestimmt, die ausschließlich aus Sängern besteht, mit denen er in genau diesen Rollen gearbeitet hat.

Da diese Produktion schon öfters im Neuen Merker besprochen wurde, brauchen wir jetzt nicht mehr auf jede Einzelheit einzugehen. „Aus einem Totenhaus“ gehört zu den eher selten gespielten Werken Janaceks, weil es - ähnlich wie Bergs „Lulu“ – unvollendet blieb und nach seinem Tode durch seine Mitarbeiter vervollständigt wurde. Es ist keine „Oper“ im herkömmlichen Sinne, weil die deutlich fixierten Hauptgestalten als Träger der Handlung fehlen. Als Vorlage dienten Dostojewskijs „Aufzeichnungen aus einem toten Hause“, in dem der Schriftsteller protokollartig seine eigenen Erfahrungen aus einem Gefangenlager in Sibirien verarbeitet hat und gnadenlos den eintönigen Lageralltag, das zwanghafte Miteinander der Insassen und u.a. das grausame Quälen eines gefangenen, verwundeten Adlers beschrieben hat. Doch für Janacek war das „Literatur! In jeder Kreatur ein Funken Gottes“ (schrieb er 1928 auf seine ersten Kompositionsskizzen).

In den wenigen Inszenierungen in Paris und Brüssel, die ich von diesem Werk gesehen habe, versuchten die Regisseure diese Schwierigkeiten zu überbrücken mit einem grandiosen Bühnenbild – „Sibirien“ – in dem die Gefangenen nur noch kleine Punkte in einer weitläufigen Landschaft waren. Chéreau bat dagegen seinen langjährigen Bühnenbildner Richard Peduzzi um einen eiskalten Gefangenenhof, in dem wir jede noch so kleine Regung/Bewegung genau verfolgen können. Und er fügte den 19 Sängern (und einer Sängerin) noch 16 Schauspieler hinzu, mit denen er Wochenlang als fantastischer Schauspielregisseur geprobt hat - mit dem Ziel dass man Sänger und Schauspieler nicht mehr voneinander unterscheiden könne. Dieses Konzept wurde entscheidend mitgetragen durch Chéreaus künstlerischen Mitarbeiter und Lebensgefährten Thierry Thieû Niang, der als Tänzer und Choreograph viele Jahre mit geistig und körperlich Behinderten gearbeitet hat. Ich habe Niangs eindrucksvolle Anfänge vor 25 Jahren verfolgt, aber damals leider nicht rezensieren können, da sie so weit vom gängigen Theater- und Opernbetrieb lagen. Zur Zeit kann man auf ARTE-Stream einen diesen Herbst herausgekommenen Film sehen „Une jeune fille de 90 ans“, in dem man sieht, wie Thierry Thieû Niang in einem Altersheim mit Alzheimerpatienten arbeitet. Da begreift man sofort, wie wichtig sein Beitrag in dieser einzigartigen Regiearbeit war. (Da Niang ein in Theaterkreisen unüblich stiller und bescheidener Mensch ist, muss man es an dieser Stelle ausnahmsweise mal laut und deutlich sagen.)

Chéreaus Assistenten Peter Mc Clintock und Vincent Huguet haben diese Wiederaufnahme mit äußerster Akribie erarbeitet und die Sänger spielten mit einer Genauigkeit, bei der sich einige an diesem gleichen Wochenende durch mich rezensierten Regisseure und Bühnendarsteller eine Menge abgucken könnten. Leider können wir nicht alle 36 Darsteller namentlich nennen, aber sie verdienen alle ein uneingeschränktes, großes Lob! Besonders aufgefallen sind uns Eric Stoklossa (der junge Tartar Aljeja), Ales Jenis (ein Sträfling in den Rollen Don Juans und des Brahminen) und Susannah Harberfeld (Elvira, in dieser Fassung „eine Hure“), die schon 2007 in Wien dabei waren und nun an der Pariser Oper debütierten. Jiri Sulzenko hat als Lagerkommandant nichts von seiner Grausamkeit eingebüsst, die Willard White (der neue Häftling Alexander Petrowitsch Goriantschikow) mit einer schon fast aristokratischen Ruhe ertrug. Der größte Applaus ging verständlicherweise an Peter Mattei als Chikov. Unglaublich wie sehr seine Stimme seit seinem Don Giovanni 1998 in Aix gereift ist: er singt die einzige längere Arie des Abends mit einem fast weltentrückten Bass.

Bei der Erstaufführung in Wien dirigierte der inzwischen verstorbene Pierre Boulez. Chéreau hatte anscheinend Affinitäten zu Esa-Pekka Salonen, der nun mit Können das Orchestre de l’Opéra de Paris
leitet. Aber sein Dirigat machte weniger Eindruck (auf uns). Lag es an der großen Opéra Bastille, an unserer Erinnerung (die bekanntlich vieles verklärt) oder ganz einfach daran, dass Boulez und Chéreau eben „Jahrhundertkünstler“ waren? So wie sich Chéreau vor 24 Jahren mit einer seltenen künstlerischen Integrität querstellte, als man in Paris seinen Bayreuther „Ring“ wiederaufnehmen wollte, hat er auch verboten, dass seine Inszenierungen nach seinem Tode weitergespielt werden (außer die schon durch ihn bewilligten Wiederaufnahmen). Zum Glück bleiben viele Dokumente und einige gute Fernsehaufzeichnungen erhalten, die man nun in einer Ausstellung im Palais Garnier sehen kann: „Patrice Chéreau, mettre en scène l’opéra“ (bis zum 3. März 2018). So leben er und seine Arbeit weiter!
Waldemar Kamer 6.12.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online Wien
Bilder (c) Elisa Haberer / Opera de Paris
P.S.
Pierre Boulez und Patrice Chéreau während den Proben 2007 in Wien
(eines der vielen Fotos in der jetzigen Ausstellung im Palais Garnier) Foto:Ros Ribas


Premiere am 1.12.2017
Bohème im Weltall!?
Umstrittene Inszenierung mit wunderbarem Dirigat und Gesang
Zu Weihnachten in Paris gehört eine „Bohème“ und seit Menschengedenken ist das an der Opéra de Paris die Produktion von Jonathan Miller, die in den letzten zwanzig Jahren zehn Mal wiederaufgenommen wurde – stets zur allgemeinen Zufriedenheit. Doch nun wollte Intendant Stéphane Lissner eine radikale Neu-Inszenierung, die für viel Wirbel sorgt. Claus Guth – in Frankreich eher wenig bekannt – inszenierte die Oper dort, wo Puccini und Henri Murger (im Programmheft fälschlicher Weise „Henry Mürger“ geschrieben) es sich wahrscheinlich nie erträumt hätten: im Weltall. Der Abend beginnt in einem Raumschiff, wo ein Kosmonaut namens Rodolfo, den wir mit Schwierigkeiten atmen hören, per Computer folgende Zeilen schreibt: „Day 126 – 40°45’53“N 74 – Expedition in danger – engines inoperative – life-support resources almost exhausted – time is running out – water is rationed – (...) – last remants of humour – using our imagination – to evoke times long past.“ Und während die Kosmonauten ihre letzte Luft aushauchen laufen die Figuren aus ihrer Erinnerung über die Bühne, erscheint Mimi barfuss in einem roten Kleid, mit einer Kerze in der Hand und fängt die eigentliche Oper an. Ganz so umwerfend neuartig ist diese Interpretation also nicht, denn so kann man jede Oper inszenieren: als Traum oder – wir hier – als verblasste Erinnerung. Nur dann kommt unweigerlich der Punkt, an dem sich das Werk – und manchmal auch das Publikum – gegen das Regiekonzept sträubt. Und dann wird es kniffelig. Zum Glück strandeten das Raumschiff und das Regiekonzept erst im dritten Bild und wurde so wunderbar gesungen und musiziert, dass man geruht die Augen schließen konnte.

Gustavo Dudamel – bis dato in Frankreich nur mit dem venezolanischen Jugendorchester Simon Bolivar und den Jugendlichen des El Sistema aufgetreten - debütierte an der Pariser Oper. Sein Dirigat war eine der beiden Überraschungen des Abends. Dudamel brachte wirklich alles mit, was man sich von einem Bohème-Dirigenten wünschen kann. Zu Anfang zeigte er sich jung, keck, sogar humorvoll und im Verlauf des Abends wurde er immer elegischer und ließ der Musik, der anschwellenden Emotion und den Sängern allen nur möglichen Raum. Er dirigierte recht hoch, mit einer makellosen Technik und hielt so stets einen hundertprozentigen Kontakt zur Bühne, was ihm ermöglichte den Sängern zu folgen und sie zu Höchstleistungen anzuspornen. Es wurde gebremst wenn nötig und hohe Töne wurden so lang wie möglich ausgehalten, ohne dass die Gesangslinie verloren ging oder es je vulgär wurde.

So spielfreudig haben wir das Orchestre de l’Opéra de Paris seit langem nicht mehr gehört. Denn als Philippe Jordan vor acht Jahren die Zügel in die Hand nahm, hatte das Orchester während der ganzen Mortier-Zeit keinen Chefdirigenten gehabt und war in einem dementsprechend desolaten Zustand. Jordan hat beachtliche Wiederaufbauarbeit geleistet, doch er dirigiert in Paris oft wie eine Schweizer Uhr: vor allem darauf bedacht, alles gut zusammen „in Tempo“ zu halten. Dudamel nahm dagegen vieles viel entspannter und so auch musikalischer (er hat die „Bohème“ inzwischen schon in Berlin und Mailand dirigiert). Die Musiker liebten ihn und begrüßten ihn nach der Pause mit stürmischem Fußgetrommel – das haben wir in der Opéra Bastille noch nie gehört. Laut Insider-Berichten steht Dudamel nun auf der Wunschliste des Orchesters um die Nachfolge von Jordan anzutreten, wenn dieser 2020 an die Wiener Staatsoper wechselt.

Die andere große Überraschung des Abends war der Rodolfo des brasilianischen Tenors Atalla Ayan, der an diesem Abend auch an der Pariser Oper debütierte. Er sang seine erste Arie „Che gelida manina“ so wunderbar, so makellos, so zeitlos schön, dass das sehr unruhige Premierenpublikum (das schon angefangen hatte lautstark die Inszenierung zu kommentieren) mäuschenstill wurde und ein riesiger Applaus folgte (der in gewisser Weise den Abend rettete). Ayan, der 2010 im Lindemann Young Artists Development Program der Metropolitan Opera debütierte, hat den Rodolfo inzwischen schon an vielen Häusern gesungen, aber eben noch nicht an der riesigen Bastille Oper. Er forcierte nicht, er nahm sich Zeit, er phrasierte wunderbar – ein ganz erstaunliches Debüt von einem Sänger, der ohne Zweifel am Anfang einer großen Karriere steht. Das haben wir auch vor zehn Jahren über die damals völlig unbekannte Sonya Yoncheva geschrieben. Unglaublich wie sehr sich ihre Stimme entwickelt hat. Sie sang damals nur Barockmusik und gehört inzwischen zu der sehr kleinen Liga von Sängerinnen, die die große Opéra Bastille stimmlich mühelos füllen können.

Die Rolle der Mimi, die sie schon an der Scala und der Met gesungen hat, bereitete ihr keine Mühe, aber ergriffen hat sie uns nicht. Das lag/liegt wahrscheinlich an der Elisabeth im „Don Carlos“, die sie vor wenigen Wochen noch im gleichen Haus gesungen hat und die anscheinend ihre Stimme und Intonation etwas aus dem Lot gebracht hat (aber das lag vielleicht auch an der schwierigen Premiere und ist sowieso nur Klagen auf hohem Niveau). Die Stimme der Aida Garifullina hat es in der Opéra Bastille nicht leicht (so wie wir es schon bei ihrem hiesigen Debüt diesen Frühling als „Schneeflöckchen“ schrieben). Wahrscheinlich deshalb schuf der Bühnenbildner Etienne Pluss für die Arie der Musetta eine kleine Mini-Bühne in einem Silo, das ihren Gesang wunderbar verstärkte. Dort musste die arme Sängerin aber während ihrer einzigen Arie eine Art Table-Dance-Striptease vollziehen. Dies tat sie jedoch mit einer solchen Eleganz (im Französischen würde man „classe“ sagen), dass die Szene nicht ins peinlich Vulgäre abglitt. Der Rest der Besetzung war ohne Abstriche exzellent: Artur Rucinski konnte als Marcello dem fulminanten Rodolfo das Wasser reichen, Alessio Arduni war ein warm-timbrierter Schaunard und Roberto Tagliavini (den wir noch als Ramfis und Escamillo erinnern) ein tieftönender Colline. Die „comprimari“ kamen alle aus den exzellent durch José Luis Basso vorbereiteten Chor der Oper, der im „Café Momus“ angeführt wurde von einer lustigen Truppe Zirkuskünstler und einem „Zeremonienmeister“ Guérassim Dichliev, ein ehemaliger Assistent des Mimen Marcel Marceau - dessen zeitlose Poesie in dem gestrandeten Raumschiff mehr als willkommen war.

Musikalisch war es ein hervorragender Abend, trotz des sich schon nach wenigen Minuten ankündigenden Proteststurms. Denn das sogenannte „Regietheater“ ist in Paris viel weniger akzeptiert als in deutschsprachigen Ländern und das Pariser Publikum ist gefürchtet für seine bissigen und manchmal auch sehr geistreichen Bemerkungen, die mit einer Lachsalve jede Vorstellung aus der Bahn werfen können. Davon gab es nun den ganzen Abend mehr als ein dickes Dutzend - alle ausschließlich auf die Regie gerichtet. Der Regisseur gab schon am Vortag in einer Pressemeldung bekannt, dass er „mit heftigen Reaktionen auf seine radikale Neuinszenierung rechne“. Heftig war der Buhorkan, den man sogar noch außerhalb des Opernhauses hören konnte, auf jeden Fall; „Radikal“ war diese „Neuinszenierung“ keineswegs - sie verpuffte wie ein Schuss ins All.
Bilder (c) Bernd Uhlig
Waldemar Kamer 4.12.2017
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online Paris
----
Bis zum 31. Dezember in der Opéra Bastille (in wechselnden Besetzungen): www.operadeparis.fr
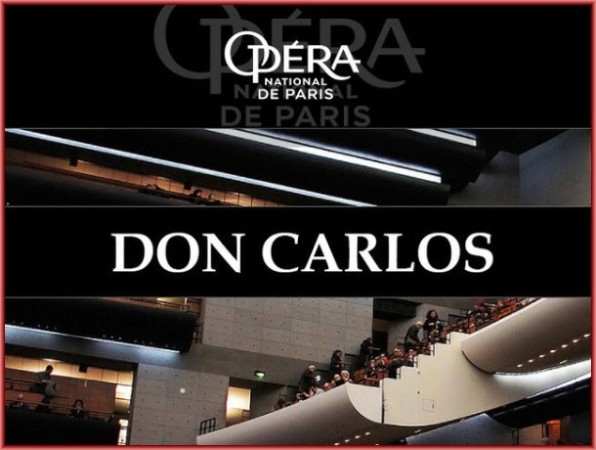
Premiere am 10.10.2017
ELINA GARANCA: SENSATIONELLES EBOLI-DEBÜT
TRAILER Garanca

Große Operngala in Paris: ein neuer „Don Carlos“ von Giuseppe Verdi in der französischen Originalfassung aus dem Jahr 1867 mit einem hochkarätigen Ensemble unter der Leitung des zukünftigen Wiener Chefdirigenten Philippe Jordan: Jonas Kaufmann in der Titelrolle, Sonya Yoncheva – die neue bulgarische Diva – als Elisabetta, Ludovic Tézier als Posa und: zum ersten Mal in der anspruchsvollen Partie der Eboli die lettische Mezzo-Sopranistin Elina Garanca. Spätesten beim Mega-Jubel nach der großen Arie im 4. Akt war klar: ihr Rollendebüt war eine Sensation. Die Stimme der Garanca ist größer geworden, aber die Höhen strahlen wie „gleißendes Gold“. Mit der Tiefe kommt sie gut zurande, aber ihre Stärke ist ihr Timbre, ihre Musikalität und ihr Spieltalent. Jedenfalls kann ich mich an keine andere Rollen-Vorgängerin erinnern, die so erotisch und berechnend die Fäden am Hofe von Philipp II. – ausgezeichnet der russische Bass Ildar Abdrazakow – zieht. Elina Garanca hat sich vor zwei Jahren zum Wechsel ins dramatische Fach entschlossen (in zwei Jahren kommt die erste Amneris). Die erste „Bewährungsprobe“ hat sie glänzend bestanden. Nun folgt in Wien die Dalilah!
TRAILER Kaufmann

So umjubelt übrigens die musikalische Seite dieser Don Carlos-Premiere war, die Regie von Krzysztof Warlikowski (Ausstattung Malgorzata Szczesniak) polarisierte und wurde von einem großen Teil des Publikums wütend ausgebuht. Man fühlte sich also an die Wiener Neudeutung der Urfassung von Konwitschny erinnert. Der polnische Regisseur siedelt den Don Carlos im Niemandsland zwischen Entstehung unter Verdi und der Filmwelt der 50er Jahre an und erinnert zwischendurch an den historischen „Infant von Spanien“ (so der Schiller-Original-Unter-Titel): der war hässlich, sadistisch und von epileptischen Anfällen geplagt. Jedenfalls erinnert nun Elisabetta an Liz Taylor. Eboli ist – wenn sie nicht wie beim Auftritt als Fecht-Lehrerin agiert – eine Schwester von Marylin Monroe. Und der Groß-Inquisitor (sehr stark Dmitry Belosselskiy) ist ein Mittelding zwischen Katholischer Kirche und KGB.
TRAILER Garanca 2

Übrigens spielt man die vollständige Urfassung, lässt aber die beiden großen Ballette gänzlich weg. Es dauert dennoch fast 5 Stunden! Eine Frage stellt sich relativ rasch: wozu holt man ausgerechnet Jonas Kaufmann für dieses Dekadenz-Konzept. Der Inbegriff eines strahlenden Helden – er ist stimmlich in Höchstform -müht sich redlich ab, um den hinfallenden Charakter, die Nähe zum Wahnsinn (die Ermordung von Posa erlebt er aus der „Gummi-Zelle“!) und die Folgen der Habsburger-Inzucht zu erspielen. Aber sein vokaler Glanz passt nicht ganz zu diesem Regiekonzept, das im Übrigen niemals der Musik „zuwiderläuft“. Sonya Yoncheva beweist einmal mehr, dass sie mit Recht zu den größten Sopran-Talenten gehört (und demnächst an der MET eine Tosca-Premiere erhalten wird). Aber auch bei Elisabetta gab es mehrmals Stellen, wo sie an ihre Grenzen gerät. In der großen Arie (hier im 5.Akt) hat sie mit den Forte-Spitzentönen ebenso Mühe wie mit dem Piano-Teil („France“). Alles in allem – eine mit Recht bejubelte Leistung. Untadelig in Punkto Stimme und Legato-Vortrag der Franzose Ludovic Tézier – ihm fehlt nur ein unverwechselbares Timbre. Aber das hat man oder eben nicht. Sehr eindringlich der Mönch – Krzysztof Baczyk und vielversprechend Eve-Maud Hubeaux als Thibault.
Last but not least: Philippe Jordan motiviert das Orchester (und auch den Chor) der Pariser Oper zu Höchstleistungen, findet die Balance zwischen kammermusikalischer Intimität und den Szenen der „Grand Opera“. Man kann sich über seine Berufung nach Wien freuen. Und man sollte sich die TV- und Kino-Übertragung (Lugner-City) dieser Produktion am 19.10.2017 nicht entgehen lassen!
Peter Dusek 12.10.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
Nikolai Rimski-Korsakow

SCHNEEFLÖCKCHEN
20.4.2017
Erstaufführung dieser sehr selten gespielten Märchenoper
Dmitri Tcherniakov ist einer der zur Zeit meist beachteten Opernregisseure in Europa und kann sich inzwischen die Werke auswählen. Nachdem er sich in Paris, Lyon, Madrid, Brüssel, Berlin und München einen Namen gemacht hat mit sehr eigenwilligen – und meist auch sehr interessanten – Neudeutungen bekannter Werke, startete er einen großen Zyklus russischer Opern, über den im Merker schon öfters berichtet wurde. So waren wir im März in Amsterdam für seine viel beachtete Inszenierung von „Fürst Igor“ von Alexander Borodin, die vor zwei Jahren in New York in Premiere ging (und damals auch in Wien im Kino zu sehen war). In Amsterdam hatte er schon „Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und der Jungfrau Fewronia“ von Nikolai Rimski-Korsakow inszeniert. Nun wird der Zyklus in Paris fortgesetzt mit dem ebenso selten gespielten „Schneeflöckchen“.

„Schneeflöckchen“ (1882) ist eine Märchenoper wie „Mainacht“ (1880), „Die Nacht vor Weihnachten“ (1895), „Das Märchen vom Zaren Saltan“ (1900) und „Der goldene Hahn“ (1909), die letzte und meist gespielte Oper von Nikolai Rimski-Korsakow. Alle seine fünfzehn Opern greifen ganz bewusst zurück auf die russische Folklore, denn die „Gruppe der Fünf“ (auch „das mächtige Häuflein“ genannt), bestehend aus den „Novatoren“ Mili Balakirew, Alexander Borodin, Cesar Cui, Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow, wollte als Gegen-Ansatz zum „westlich dekadenten Tschaikowski“ russische Nationalopern mit Rückgriff auf die russische Geschichte schreiben. So könnte man „Vater Frost“, den Vater der Titelfigur „Schneeflöckchen“, mit unserem westlichen „Weihnachtsmann“ vergleichen, der sich in „Frau Frühling“ verliebt und mit ihr ein kleines Töchterchen bekommt: so zart und rein wie unser „Schneewittchen“...

Doch der 1970 in Moskau geborene Tcherniakov liebt es die Russische Geschichte mit dem heutigen Russland zu verflechten und so inszenierte er auch diese Märchenoper mit Bier trinkenden Proleten, Sex und viel Gewalt. Das Konzept geht nicht auf und es stellte sich etwas ein, was wir bei Tcherniakov noch nie erlebt haben: Langeweile. Erst im vierten Akt, in der Szene als Schneeflöckchen alleine mit ihrer Mutter durch den Zauberwald läuft, gab es „Bühnenzauber“. Doch da hatte schon ein beträchtlicher Teil des nicht besonders disziplinierten Pariser Publikums seufzend den Saal verlassen. Dass der Abend so furchtbar lang wirkte (es waren „nur“ vier Stunden, so wie viele Russische Opern), lag auch am Dirigenten. Die Gestik von Mikhail Tatarnikov war elegisch, aber offensichtlich zu „märchenhaft“ um durch das Orchester und den Chor der Opéra de Paris gut verstanden zu werden. So drosselten die Musiker eigenwillig das Tempo und einiges ging daneben. Nur in seltenen Momenten – in langen Arien oder als der Chor ganz alleine sang – klappte alles und konnte man ungestört die teilweise wunderschöne Musik genießen.

Unter diesen Bedingungen hatten die Sänger, die sich in den meist sehr hässlichen Kostümen von Elena Zaytseva sicher nicht wohl fühlten, keinen leichten Stand. Aida Garifullina, Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper seit 2013, muss man im Merker nicht mehr vorstellen. Aber in Paris ist sie so gut wie unbekannt. Von der Erscheinung her klein und zierlich mit einer fast metallisch reinen Stimme, scheint sie eine Idealbesetzung als Schneeflöckchen. Doch im großen Saal der Opéra Bastille, zwischen einem zu laut spielenden Orchester und einem manchmal brüllenden Chor, wirkte ihre Stimme leider farblos und eindimensional. Auch Martina Serafin, in Paris als überzeugende Tosca und Sieglinde bekannt, hatte als Koupova keinen leichten Stand. Die große Überraschung war Yuriy Mynenko als Lel. Die Rolle des schönen Hirten, in den sich alle verlieben, wird meist durch Mezzosporanos gesungen. Doch der Regisseur bestand auf einen Mann und fand in dem ukrainischen Counter-Tenor einen unerwartet guten Interpreten. Erst war man etwas erstaunt, als dieser bärtige Muskelprotz mit seinem hohen Stimmchen kam. Doch irgendwie passte es zur Affektiertheit (fast Weiblichkeit) der Figur und Mynenko zeigte sich als mannhafter Sänger (seine Stimme kam problemlos durch den großen Saal) und als reifer Interpret. Seine beiden Arien, die wir aus den Konzerten seiner weiblichen Kollegen kennen, waren der musikalische Höhepunkt des Abends.

Der Rest der Besetzung hinkte wörtlich etwas hinterher (was hauptsächlich am Regisseur und Dirigenten lag). Der Ukrainer Maxim Peter sprang in letzter Minute als Zar Berendei für den erkrankten Ramon Vargas ein und Thomas Johannes Mayer – den wir schon besser gehört haben – war ein farbloser Mizguir. Nur Elena Manistina und Vladimir Ognovenko konnten als Frau Frühling und Vater Frost von der Rampe vollkommen mühelos über das Orchester „kommen“. Der Einzige, dem das auch gelang, war der Heerrufer Pierpaolo Palloni. Denn der Regisseur hatte ihm ein riesiges Sprachrohr gegeben, mit dem der spielfreudige Chorist seine warme Bariton-Stimme mit Wonne in den großen Saal schleuderte.
Wir freuen uns sehr, dass „Schneeflöckchen“ nun zum ersten Mal an der Opéra de Paris aufgeführt wurde. Doch wenn Dmitri Tcherniakov wirklich will, dass diese selten gespielten Russischen Opern nun „international genau so bekannte Werke werden wie „Don Giovanni“ oder „La Traviata“ “ – so wie er es großspurig im Programmheft verkündet -, dann wird er diese Märchenopern doch anders inszenieren müssen. Denn nach diesem langweiligen Abend kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderes Haus diese Produktion übernimmt oder dass sie irgendwann noch einmal an der Opéra de Paris wieder aufgenommen wird. Schade, denn die Musik ist wirklich wunderbar!
Bilder (c) Elisa Haberer / OnP
Waldemar Kamer, Paris 24.4.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
OPERNFREUND PLATTEN TIPP

CARMEN

10. März 2017
Carmen hat in Paris kein Glück: wieder eine verpatzte Premiere...
Was hat die arme Carmen bloß angestellt, dass die Pariser ihr immer wieder das Leben so schwer machen? Die Uraufführung an der Opéra Comique am 3. März 1875 ging vollkommen schief ab dem dritten Akt und im vierten Akt verließ schon ein Teil des Publikums den Saal. Die Kritiken waren vernichtend. Le Siècle beschrieb „ein Delirium an Kastagnetten“ und Le Figaro beklagte „inkohärente Lumpen von Akkorden, unzusammenhängende Rhythmen und abgerissene Melodien“.

Der Komponist war so bestürzt, dass man sein „Meisterwerk“ nicht begriff, sodass er schwer krank wurde und drei Monate später - gerade 36 Jahre alt - schon verstarb. Georges Bizet erlebte es leider nicht mehr wie „Carmen“ noch im gleichen Jahr in Wien gespielt wurde (in einer neuen Fassung mit Rezitativen von Ernest Guiraud) und danach eine der beliebtesten Opern der Welt wurde. Aber nicht an der Opéra de Paris, wo das Werk bis heute einen schwierigen Stand hat. Für die Opéra Comique geschrieben – wo sie eigentlich auch hingehört – wurde „Carmen“ erst 1959 im Palais Garnier gespielt. Sie sollte das „Bugschiff“ des großen neuen (zweiten) Saals der Oper werden, der 1989 eröffneten Opéra Bastille. Doch bis jetzt sind dort alle neuen „Carmens“ kläglich gestrandet – was meist an den riesigen, pompösen und akustisch schwierigen Bühnenbildern lag.

So war es also eine logische Entscheidung für diese „Neu-Inszenierung“ die fast zwanzig Jahre alte Produktion von Calixto Bieto einzuladen, die schon überall auf der Welt, von Amsterdam bis San Francisco und von Barcelona bis Oslo, erfolgreich gespielt wurde. Die sehr bekannte Inszenierung – wir brauchen sie nicht noch einmal zu rezensieren – gehört sicher zu den besseren Arbeiten von Bieto und besticht durch ihre Einfachheit. Ursprünglich 1999 im Festival von Peralada unter freien Himmel aufgeführt, begnügt sich der Bühnenbildner Alfons Flores mit einem Fahnenmast, einer vergammelten Telefonzelle (in der Carmen vor ihrer Auftrittsarie schon temperamentvoll telefoniert), ein paar Zigeunerautos und einem riesigen Holz-Stier, so wie man ihn entlang der andalusischen Autobahnen sieht. Damit beweist er – so wie Peter Brook es schon 1981 in seiner unvergessenen Inszenierung getan hat – dass „Carmen“ sich ohne Bühnenbild viel freier bewegen kann. Eine andere markante Idee von Bieto war es, die ellenlangen gesprochenen Dialoge maximal zu kürzen. Das rafft die Handlung ganz erheblich: die Aufführung war fast eine Stunde kürzer als angekündigt.

Solch einfache Produktion lässt sich auch öfters spielen und so wurde eine für Paris ganz ungewöhnlich lange Serie angesetzt: 25 Vorstellungen vom 10. März bis zum 16. Juli (die für Jugendliche zugänglichen „Vorpremieren“ nicht mitgezählt). Dafür wurden zwei Dirigenten und fünf verschiedene Besetzungen engagiert. Es ist schön, dass man in diesem Rahmen auch junge Künstler engagiert. Doch wenn man sie damit überfordert und sie dem immensen Druck einer solchen Premiere nicht standhalten können, schadet man allen - vor allen den besagten Künstlern selbst, denen man danach oft keine zweite Chance mehr gibt. Das passierte nun dem kaum dreißig jährigen Dirigenten aus Nizza Lionel Bringuier, der kurz vor der Premiere das Handtuch warf , „aus persönlichen Gründen“, die ganz offensichtlich künstlerischer Natur waren. Er wurde in letzter Minute ersetzt durch Bertrand de Billy, ein alter Routinier, der „Carmen“ wahrscheinlich auch noch schlafend dirigieren kann.

So ungefähr klang der Abend aber auch: selten haben wir ein so uninspiriertes „Carmen“-Dirigat gehört. Das Orchester der Pariser Oper hatte sich auf den „automatischen Piloten“ eingestellt und blickte mehr zum Konzertmeister als zum Dirigenten, der mit seinen Gedanken offensichtlich anderswo war. Alle rhythmisch kniffeligen Momente – und davon gibt es einige – gingen ausnahmslos daneben. Der in Paris so hoch gelobte Chor der Oper war bei fast jedem Einsatz eine gute Sekunde zu spät und die interne Koordination zwischen den Stimmen war katastrophal schlecht. Da haben wir das gleiche Orchester und den gleichen Chor - auch in „Carmen“ - schon viel besser gehört.
Die Besetzung ist hochkarätig – zumindest auf dem Papier. Im Juni singt Anita Rachvelishvili, die erste Carmen von Lissners erster Spielzeit an der Scala 2009 und letzten Oktober eine ganz phantastische Dalila in Paris (siehe Merker XI/2016). Am 16. Juli folgt Elina Garanca und im April debütiert die junge Varduhi Abrahamyan. Für die Premiere hatte man verständlicher Weise eine junge Französin engagiert.

Clémentine Margaine hat eine überaus schöne Stimme, Talent, aber leider nicht genug Nerven. So wie man keine Sekunde glauben konnte, dass Elina Garanca im November auf dieser gleichen Bühne in einer neuen Rollen debütierte (siehe Merker XII/2016), konnte man jetzt einfach nicht glauben, dass Margaine Carmen schon überall auf der Welt gesungen haben soll, von München bis Sidney und von Rom bis Washington. Sie spielte überzeugend, aber ihr Gesang war genau so uninspiriert wie der Dirigent der vor ihr stand. Roberto Alagna kannte diese Produktion schon, denn er hat Don José seit fast dreißig Jahren schon überall auf der Welt gesungen – aber noch nie an der Opéra de Paris. Und gerade vor dieser für ihn so wichtigen Premiere wurde er krank. Als die Ansage kam, ging ein Kichern durch den Saal, weil viele Zuschauer irgendein „Tenormätzchen“ vermuteten. Doch nach den ersten gesprochenen Dialogen konnten alle hören, dass Alagna wirklich krank war und große Mühe hatte, um durch die Vorstellung zu kommen. Das gelang ihm dank seiner hervorragenden Technik. Er war einer der wenigen Sänger bei dem man wirklich jedes Wort verstand (singt man heute keine Konsonanten mehr?). Und auch „ohne Stimme“ wurde die fast gehauchte Schlussszene erstaunlich berührend. Dass Alagna so ergreifend spielte lag auch daran, dass er sich so überaus gut mit der Micaela von Aleksandra Kurzak verstand. Sie war vielleicht nicht die größte Stimme des Abends, aber – für unsere Ohren - die beste Musikerin. Sie hatte Stil und Feinfühligkeit, die dem gut aussehenden Escamillo von Roberto Tagliavini leider völlig fehlten.

Die Nebenrollen waren exzellent besetzt. Vannina Santoni und Antoinette Dennefeld waren als Frasquita und Mercédès überaus spielfreudig und sangen lupenrein (auch wenn der Chor hinter ihnen falsch sang). Das kann man auch von den ebenso sympathischen Boris Grappe und François Rougier berichten, die als Le Dancaïre und Le Remendado ein famoses Ganoven-Duo waren. François Lis ist in der Rolle des Zuniga gar nicht mehr weg zu denken, doch er scheint ihr nach so vielen Jahren immer noch neue Aspekte abzugewinnen, so wie der genauso überzeugende Jean-Luc Ballestra als Moralès. Als Gastwirt Lillas Pastia gab es in dieser Inszenierung einen alten Schauspieler aus Haiti, Alain Azérot, der schon während der Ouvertüre ein rotes Taschentuch aus seinen Ärmeln hervorzauberte. Die Inszenierung war besonders, aber eine gelungene Premiere war es bei weitem nicht (der Applaus war mäßig und der Dirigent & Regisseur wurden ausgebuht). Doch das kann sich – mit drei anderen Dirigenten – bis zum 16. Juli noch ändern. Und irgendwann wird es doch auch an der Pariser Oper einmal eine gelungene „Carmen“ geben. Wir sind gespannt!
Waldermar Kamer 11.3.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online
Bis zum 16. Juli an der Opéra de Paris (in wechselnden Besetzungen): www.operadeparis.fr
LOHENGRIN
27. Januar 2017
„Come back“ von Jonas Kaufmann mit einer sehr besonderen Rollengestaltung
„Viel Lärm um nichts“ kann man nach diesem „Lohengrin“ nur sagen über was seit September alles über die angebliche „Stimmkrise“ von Jonas Kaufmann in den (französischen) Medien geschrieben wurde. Da würde man gerne einigen Beteiligten eine gelbe oder rote Karte geben. Auch an die Pariser Oper, die in diesem „Medienrummel“ kräftig mitgemischt hat, nachdem sie sich selbst in eine dumme Situation gebracht hatte. Denn in dieser Spielzeit gab es zum ersten Mal 30% verteurerte Plätze für Vorstellungen mit Jonas Kaufmann – ein Preisunterschied der nach seiner Absage im Oktober für „Les contes d’Hoffmann“ nicht zurückerstattet wurde. Das führte zu Protesten, Annullierungen und – sicher auch aus anderen Gründen – zu einem Einnahmeschwund von aktuell 25%.

Und zu berechtigten Ängsten, was nun im Januar mit „Lohengrin“ passieren würde, wo man für einen Parkettplatz mit der ersten Besetzung stolze 252 Euro zu zahlen hatte (anstatt 210 Euro für die „Zweitbesetzung“). Was sind dies für unwürdige Milchmädchenrechnungen in der „größten Oper der Welt“! Ist „Lohengrin“ eine Zirkusnummer, die man teurer verkaufen kann je mehr hohe Töne ein Tenor singt, oder ein Gesamtkunstwerk und eine Gesamtleistung von einem Team von hunderten Künstlern? Wie dem auch sei, die viel bekritisierte neue Tarif-Politik wird in der nächsten Spielzeit nicht fortgesetzt, wo Jonas Kaufmann unter normalen Bedingungen Don Carlos singen wird, in der französischen Urfassung, in der Elina Garanca ihr Debüt als Eboli geben wird.

Dieser Medienrummel sorgte auch für einige erstaunliche Kommentare über Kaufmanns Stimme von Rezensenten, von denen man erwarten könnte, dass sie sich etwas besser informieren bevor sie unüberprüfte Behauptungen in die Welt schicken. Denn Kaufmann singt den Lohengrin schon seit der „Ratteninszenierung“ 2010 in Bayreuth, die überall im Fernsehen zu sehen war. Auch die jetzige Inszenierung kann man noch im Internet ansehen, denn sie eröffnete im Dezember 2012 das Verdi-Wagner Jahr an der Scala, mit Daniel Barenboim und einer viel bekommentierten Inszenierung von Claus Guth (siehe Merker 1/2013). Diese Inszenierung wird nun in Paris wieder aufgenommen, mit größtenteils derselben Besetzung, in der Kaufmann genau so singt wie vor vier Jahren – nur dass seine Rollengestaltung um Einiges gereift ist. Zugegeben: es ist eine sehr unübliche Rollengestaltung. Lohengrin erscheint hier nicht als kühner Ritter, in glänzender Rüstung, in einem goldenen Nachen, der durch einen Schwan gezogen wird. Mal nicht so wie König Ludwig es in Neuschwanenstein nachbauen ließ, nicht mit dem blauen Licht, das Thomas Mann so liebte, und ganz ohne den Schwan, den Theodor Adorno so ausführlich kommentierte.
 In dieser Inszenierung liegt Lohengrin plötzlich als ein wimmernder Knabe auf der Erde, barfüssig, schutzsuchend und singt seinen ersten Satz, „Nun sei bedankt, mein lieber Schwan“, mit dem Rücken zum Publikum. Ein Weltfremder spielt mit einer Schwanenfeder und merkt nicht, dass Andere ihm zuhören. Der Ausgangspunkt von Guths Regiekonzept ist, dass Richard Wagner den Weltfremden Kaspar Hauser anscheinend 1833 auf dem Weg von Würzburg nach Bamberg gesehen hat und durch sein Schicksal berührt wurde.
In dieser Inszenierung liegt Lohengrin plötzlich als ein wimmernder Knabe auf der Erde, barfüssig, schutzsuchend und singt seinen ersten Satz, „Nun sei bedankt, mein lieber Schwan“, mit dem Rücken zum Publikum. Ein Weltfremder spielt mit einer Schwanenfeder und merkt nicht, dass Andere ihm zuhören. Der Ausgangspunkt von Guths Regiekonzept ist, dass Richard Wagner den Weltfremden Kaspar Hauser anscheinend 1833 auf dem Weg von Würzburg nach Bamberg gesehen hat und durch sein Schicksal berührt wurde.
Wir sind nicht immer überzeugt von Guths manchmal sehr eigenwilligen Interpretationen, doch dieses Konzept ist intelligent, gut durchdacht und geht auf. Der hehre Held mutiert zum verlorenen Künstler, zum (noch) unerkannten Komponisten Richard Wagner, der sich deutlich mit dieser Figur identifizierte. Und so wird Lohengrin ein Vorbote des späteren Parsifal (in dieser Oper noch sein Ritter-Vater auf der Gralsburg in Montsalvat). Dieses sehr eigene Regiekonzept wurde kongenial umgesetzt durch Jonas Kaufmann. Statt mit dem gewohnten, hellen, heldischen Timbre (von zum Beispiel Klaus-Florian Vogt), singt er in den ersten beiden Akten mit einer dunklen, melancholischen Stimme. Elsa kann so in ihm ihren umgebrachten/wiedergefundenen Bruder erkennen und sie entschwinden beide in eine „andere Welt“, symbolisiert durch ein Klavier aus der Wagnerzeit und durch eine ungebändigte Natur, die plötzlich mitten in eine bürgerliche Architektur einbricht (Ausstattung: Christian Schmidt). So haben wir Lohengrin noch nie gesehen und noch nie gehört. Jonas Kaufmann schafft es mit einer Gralserzählung von einer seltenen Intensität, das in der Ouvertüre noch laut hustende Pariser Publikum zum absolutem Schweigen zu bringen. Er beginnt „In fernem Land“ mit einem gewagt langsamen Tempo (ohne die geringsten Atemprobleme) und bleibt beinahe die ganze Zeit in einem technisch perfektem piano und Mezza Voce. So muss man ihm wirklich lauschen und reist mit ihm ins ferne Land, was er am Ende mit strahlender Sonne in der Stimme besingt. Eine wirklich großartige sängerische und künstlerische Leistung.

An der Scala sang Anja Harteros eine genau so berührende, weltentrückte Elsa. In Paris sollte es Martina Serafin sein, die jedoch bald nach der Premiere ihre Rolle an die Zweitbesetzung abgeben musste. Edith Haller hat Elsa schon an vielen großen Häusern gesungen, auch in Wien und Bayreuth, und tut es jetzt mit großem Einsatz. Komplimente für die fein ausgearbeitete Personenregie, aber zwischen den Bühnentieren Kaufmann und Herlitzius wirkt ihre Elsa leider blass und eindimensional. Evelyn Herlitzius, schon an der Scala dabei, beherrscht ab dem ersten Akt darstellerisch die Bühne – auch wenn sie noch kein einziges Wort gesagt und noch keinen Ton gesungen hat. Obwohl ihre Stimme einige Schärfen zeigt und zurzeit vielleicht besser geeignet ist für ihre phänomenale Elektra, präsentiert sie eine Ortrud von großem Format (und bekam mit Jonas Kaufmann den größten Applaus). René Pape ist ebenfalls ein König Heinrich der Vogler von Format, mit dem stimmlich passenden Egils Silins als Heerrufer.
 Der in Wien nicht unbekannte Tomasz Konieczny sprang für den erkrankten Wolfgang Koch ein. Sein Telramund war im ersten Akt noch etwas blass – er steht ja auch unter der Scheffel der dominanten Ortrud. Doch im Duo des zweiten Aktes konnte er seiner bösen Frau das Gift reichen, das im Orchester mit dunklen, braunen Tönen gebraut wurde.
Der in Wien nicht unbekannte Tomasz Konieczny sprang für den erkrankten Wolfgang Koch ein. Sein Telramund war im ersten Akt noch etwas blass – er steht ja auch unter der Scheffel der dominanten Ortrud. Doch im Duo des zweiten Aktes konnte er seiner bösen Frau das Gift reichen, das im Orchester mit dunklen, braunen Tönen gebraut wurde.
Philippe Jordan dirigierte mit großem Können. An diesem „Lohengrin“ hört man, was er in den letzten Jahren alles mit dem ursprünglich eher Wagner-unkundigem Chor und Orchester erreicht hat. Er nahm die Ouvertüre sehr langsam, so wie die Gralserzählung (mit der Wagner bekanntlich die Komposition begonnen hat), mit herrlich transparenten Orchesterfarben. Beim Vorspiel zum dritten Akt ließ er es mächtig krachen und drehte den Sound auf, damit alle hören konnten, was die Bläsermannschaft in den letzten Jahren gelernt hat. Beeindruckend - doch tief berührt hat seine Interpretation uns nicht. Wie soll er auch, wenn er zur Zeit jeden Abend ein anderes Werk dirigiert und innerhalb einer Woche zwei Premieren von zwei aufwendigen Neuproduktionen geleitet hat. An den sehr besonderen Lohengrin von Jonas Kaufmann werden wir uns dagegen noch lange erinnern.
Bilder (c) Opéra de Paris / E. Bauer / Monika Rittershaus
Waldemar Kamer, Merker-Paris 31.1.2017
Besonderer Dank an unseren Koopertionspartner Merker-online
SAMSON ET DALILA
Premiere am 27.10.2016
Eröffnung der zweiten Spielzeit Lissners mit einer der zwölf Opern von Camille Saint-Saëns
Vor einem Jahr wurde die erste Spielzeit des neuen Intendanten Stéphane Lissner eingeläutet mit einem wortgewaltigen „Moses und Aron“. Darauf folgte eine „Damnation de Faust“ mit Starbesetzung, womit der Musikdirektor Philippe Jordan einen großen Berlioz-Zyklus starten wollte. Doch die Reaktionen waren anders als erwartet (siehe Merker XI 2016 und I 2017) und einige Führungsmitglieder des Hauses warfen das Handtuch. Zum ersten Mal seit mehr als zwanzig Jahren veröffentlichte die Pariser Oper keine Auslastungsstatistiken, denn die Anzahl der leeren Stühle stieg/steigt bedenklich. Im Vorwort der Broschüre zu seiner zweiten Spielzeit beklagt sich der Intendant, dass die Beziehung des Publikums zu seinem Theater so irrational und auch oft so enttäuschend sei. So gibt es in dieser Spielzeit keine weitere Oper von Berlioz (nur „Béatrice et Bénédict“ wird im März an einem einzigen Abend konzertant gegeben), aber dafür nun „Samson et Dalila“, seit 25 Jahren (!) nicht mehr auf dem Spielplan der Pariser Oper.
 Camille Saint-Saëns war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten der Belle Epoque – weit vor Gounod, Massenet und Bizet - aber die Opéra de Paris hatte schon von der ersten Minute an Schwierigkeiten mit „Samson et Dalila“. Das lag an dem biblischen Sujet, an der sinnlichen Dalila und auch an den Wagner-Klängen im ersten und zweiten Akt. Ursprünglich 1859 als ein Oratorium geplant, blieb die Komposition im ersten Akt stecken, denn alle waren „schockiert“ über die sinnliche Musik. Erst 15 Jahre später schaffte es Pauline Viardot, der die Rolle der Dalila gewidmet war, den zweiten Akt in Paris auf zu führen. Doch der deutsch-französische Krieg von 1870 war schon im Kommen, womit das Wagner- und somit „deutschfreundliche“ Werk in der Pariser Oper unspielbar wurde. Zum Glück gab es Menschen und Künstler, die vollkommen über solchen Vorurteilen standen und es war „nur, nur, nur Franz Liszt zu verdanken“ (so wie es Saint-Saëns mehrmals schrieb), dass „Samson et Dalila“ zuende komponiert und 1877 in Weimar uraufgeführt wurde - auf Deutsch! Der Erfolg stellte sich bald in ganz Europa ein, auch in einigen französischen Provinzopern, und 1892 war die Opéra de Paris mehr oder weniger gezwungen, „Samson et Dalila“ in ihr Repertoire auf zu nehmen. Während andere Opern von Saint-Saëns, so wie die großen historischen Schinken „Henri VIII“ und „Ascanio“, aufwendige Ausstattungen bekamen, wurde „Samson et Dalila“ halbherzig aufgeführt in einem alten Bühnenbild von Massenets „Roi de Lahore“. Doch auch wenn die gemalten Tempelsäulen im letzten Bild nicht spektakulär einstürzten, wurde „Samson“ ein riesiger Erfolg, der während der Belle Epoque über achthundert Mal an der Pariser Oper wiederholt wurde.
Camille Saint-Saëns war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten der Belle Epoque – weit vor Gounod, Massenet und Bizet - aber die Opéra de Paris hatte schon von der ersten Minute an Schwierigkeiten mit „Samson et Dalila“. Das lag an dem biblischen Sujet, an der sinnlichen Dalila und auch an den Wagner-Klängen im ersten und zweiten Akt. Ursprünglich 1859 als ein Oratorium geplant, blieb die Komposition im ersten Akt stecken, denn alle waren „schockiert“ über die sinnliche Musik. Erst 15 Jahre später schaffte es Pauline Viardot, der die Rolle der Dalila gewidmet war, den zweiten Akt in Paris auf zu führen. Doch der deutsch-französische Krieg von 1870 war schon im Kommen, womit das Wagner- und somit „deutschfreundliche“ Werk in der Pariser Oper unspielbar wurde. Zum Glück gab es Menschen und Künstler, die vollkommen über solchen Vorurteilen standen und es war „nur, nur, nur Franz Liszt zu verdanken“ (so wie es Saint-Saëns mehrmals schrieb), dass „Samson et Dalila“ zuende komponiert und 1877 in Weimar uraufgeführt wurde - auf Deutsch! Der Erfolg stellte sich bald in ganz Europa ein, auch in einigen französischen Provinzopern, und 1892 war die Opéra de Paris mehr oder weniger gezwungen, „Samson et Dalila“ in ihr Repertoire auf zu nehmen. Während andere Opern von Saint-Saëns, so wie die großen historischen Schinken „Henri VIII“ und „Ascanio“, aufwendige Ausstattungen bekamen, wurde „Samson et Dalila“ halbherzig aufgeführt in einem alten Bühnenbild von Massenets „Roi de Lahore“. Doch auch wenn die gemalten Tempelsäulen im letzten Bild nicht spektakulär einstürzten, wurde „Samson“ ein riesiger Erfolg, der während der Belle Epoque über achthundert Mal an der Pariser Oper wiederholt wurde.
Für ein heutiges Publikum ist „Samson et Dalila“ jedoch kein einfaches Werk – weshalb meistens nur die großen Arien und das berühmte Liebesduo in Konzerten gegeben werden. Nach der letzten Aufführung 1991 an der Opéra de Paris, schrieben wir, dass die riesige, monumentale Ausstattung von Pier Luigi Pizzi so überflüssig wirkte, dass man die Oper besser konzertant hätte geben können. So erklärt sich die Entscheidung, nun einen einfallsreichen Theaterregisseur heranzuholen, der die biblische Geschichte nicht nur auf die Bühne setzt, sondern auch wirklich inszeniert. Damiano Michieletto, in den letzten Jahren schon drei Mal in Salzburg und regelmäßig im Theater an der Wien zu Gast, gelang eine interessante und intelligente Regie. Über die Ausstattung von Paolo Fantin und Carla Testi lässt sich streiten: Genau wie bei der „Armide“ in der Staatsoper gibt es erst einmal einen großen Stahlkasten und viel Soldaten mit Maschinengewehren.

Das ist vielleicht unvermeidlich, wenn die Handlung in Kriegszeiten in Gaza spielt. Wieder gibt es einen Geschlechtertausch: bei „Armide“ ziehen die Soldaten Frauenkleider an (um die gegnerischen Soldaten zu verführen), hier erscheint der Frauenchor in „Voici le printemps“ – das französischen Pendant zu den Blumenmädchen in „Parsifal“ – in Anzug und Krawatte. Aus den Blumen pflückenden Mädchen werden Herren auf Geschäftsreise, die eine Prostituierte in ihr Hotelzimmer bitten. Das ist ein sehr gewagter Einfall, denn etliche Regisseure haben sich in unseren Augen diskreditiert, indem sie Dalila als Hure darstellten (was sie in gewissen Bibelauslegungen wohl war). Denn bei Saint-Saëns lehnt Dalila jede Bezahlung ab, weil sie Samson „nur aus Rache“ umbringen will. Rache wofür? Das ist die Kernfrage, die sich jeder gute Regisseur stellen muss, und Damiano Michieletto fand darauf einige interessante Antworten. Seine Dalila ist keine dicke Hure aus Babylon, die auf dem Sofa liegend wunderschöne Arien in den Saal orgelt – Liszt meinte, Saint-Saëns sei vor allem „der weltbeste Organist“ – sondern ein durch Krieg, Religion, Leidenschaft und Wollust gespaltener Charakter.
 Dieses differenzierte Rollenporträt wäre niemals aufgegangen ohne die Mitwirkung des Dirigenten, des Orchesters und einer wirklich exzeptionellen Sängerin. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen, die wir als Dalila in Erinnerung haben, ist Anita Rachvelishvili erstaunlich jung. Sie sang 2009, gerade erst 25 Jahre alt, die „Eröffungs-Carmen“ von Lissners erster Spielzeit an der Scala. Ihre Jugend und ihre Technik ermöglichen es ihr, Dalilas erste Arie, „Printemps qui commence“, als junges Mädchen mit einem hellen Sopran zu singen, um danach im großen Liebesduo „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ Samson mit einer samtenen Mezzo-Bruststimme zu betören. Am Ende des Abends wird sie zur Furie – eine Frau die nichts mehr vom Leben erwartet und so auch nichts mehr zu verlieren hat. Das ist nicht nur alles wunderbar gesungen, sondern auch so gut gespielt, dass man den ganzen Abend im Banne Dalilas bleibt. Da kann Aleksandrs Antonenko als Samson leider nur beschränkt mithalten. Er ist auch jung – nur zehn Jahre älter als Rachvelishvili -, sieht aus der Ferne aus wie José Cura und ist ein wirklicher „lirico spinto Tenor“ (Otello in Salzburg und an der Met). Doch er hat auch noch in den letzten Vorstellungen ein offensichtliches Problem mit der französischen Technik und Aussprache. Ein französischer „ténor héroïque“ singt „dans le masque“, also mit hoch angesetzter Stimme. Dann passiert es auch mal einem so perfekten Techniker wie Roberto Alagna, dass man streckenweise etwas zu hoch singt. Doch Antonenko sang fast den ganzen Abend durchgehend einen viertel bis halben Ton zu hoch (außer im Liebesduo). Dazu hatte er einen derart slawisch/russischen Akzent, dass man in seinen Szenen mit dem ebenfalls aus Riga stammenden Egil Silins den Eindruck bekam, die kriegerische Handlung sei von Gaza in die Ukraine verlegt. Solche Sprachfehler waren früher an der Opéra de Paris völlig undenkbar und sorgten beim Publikum für berechtigten Unmut. Sie waren umso unverständlicher, weil Nicolas Testé und Nicolas Cavallier ihre wesentlich kleineren Rollen sprachlich und technisch absolut perfekt sangen und man nicht versteht, warum sie nicht in der so wichtigen Rolle des Hohepriesters besetzt wurden, in der Alain Fondary 1991 so unvergesslich war. Für den Opernchor in seiner großen Besetzung von fast hundert Mann (unter Leitung von José Luis Basso) haben wir nur Lob. Hier wurde wirklich subtil und transparent gesungen, mit Piano und Ritardando. Dieses für die Musik von Camille Saint-Saëns so wichtige „raffinement“ kam auch aus dem Orchestergraben, in dem sich das Orchester der Pariser Oper von seiner besten Seite zeigte.
Dieses differenzierte Rollenporträt wäre niemals aufgegangen ohne die Mitwirkung des Dirigenten, des Orchesters und einer wirklich exzeptionellen Sängerin. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen, die wir als Dalila in Erinnerung haben, ist Anita Rachvelishvili erstaunlich jung. Sie sang 2009, gerade erst 25 Jahre alt, die „Eröffungs-Carmen“ von Lissners erster Spielzeit an der Scala. Ihre Jugend und ihre Technik ermöglichen es ihr, Dalilas erste Arie, „Printemps qui commence“, als junges Mädchen mit einem hellen Sopran zu singen, um danach im großen Liebesduo „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ Samson mit einer samtenen Mezzo-Bruststimme zu betören. Am Ende des Abends wird sie zur Furie – eine Frau die nichts mehr vom Leben erwartet und so auch nichts mehr zu verlieren hat. Das ist nicht nur alles wunderbar gesungen, sondern auch so gut gespielt, dass man den ganzen Abend im Banne Dalilas bleibt. Da kann Aleksandrs Antonenko als Samson leider nur beschränkt mithalten. Er ist auch jung – nur zehn Jahre älter als Rachvelishvili -, sieht aus der Ferne aus wie José Cura und ist ein wirklicher „lirico spinto Tenor“ (Otello in Salzburg und an der Met). Doch er hat auch noch in den letzten Vorstellungen ein offensichtliches Problem mit der französischen Technik und Aussprache. Ein französischer „ténor héroïque“ singt „dans le masque“, also mit hoch angesetzter Stimme. Dann passiert es auch mal einem so perfekten Techniker wie Roberto Alagna, dass man streckenweise etwas zu hoch singt. Doch Antonenko sang fast den ganzen Abend durchgehend einen viertel bis halben Ton zu hoch (außer im Liebesduo). Dazu hatte er einen derart slawisch/russischen Akzent, dass man in seinen Szenen mit dem ebenfalls aus Riga stammenden Egil Silins den Eindruck bekam, die kriegerische Handlung sei von Gaza in die Ukraine verlegt. Solche Sprachfehler waren früher an der Opéra de Paris völlig undenkbar und sorgten beim Publikum für berechtigten Unmut. Sie waren umso unverständlicher, weil Nicolas Testé und Nicolas Cavallier ihre wesentlich kleineren Rollen sprachlich und technisch absolut perfekt sangen und man nicht versteht, warum sie nicht in der so wichtigen Rolle des Hohepriesters besetzt wurden, in der Alain Fondary 1991 so unvergesslich war. Für den Opernchor in seiner großen Besetzung von fast hundert Mann (unter Leitung von José Luis Basso) haben wir nur Lob. Hier wurde wirklich subtil und transparent gesungen, mit Piano und Ritardando. Dieses für die Musik von Camille Saint-Saëns so wichtige „raffinement“ kam auch aus dem Orchestergraben, in dem sich das Orchester der Pariser Oper von seiner besten Seite zeigte.
Es war schon in der Ouvertüre hörbar, dass der Musikdirektor Philippe Jordan für die Wahl von „Samson et Dalila“ verantwortlich war - eine Musik, zu der er deutlich viel Affinität hat und in der er großes Können zeigt. Abgesehen von zwei Sängern, war es eine musikalisch mustergültige Aufführung, über die sich Saint-Saëns sicher sehr gefreut hätte. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, um die anderen zwölf (!!) Opern von Saint-Saëns wieder zu spielen, die inzwischen völlig aus den Spielplänen verschwunden sind – in den meisten Opernführern wird bei Saint-Saëns nur noch „Samson“ erwähnt. Das Palazzetto Bru Zane, das sich so bewundernswert für die vergessene französische Musik des neunzehnten Jahrhunderts einsetzt, hat letztes Jahr eine Aufführung der großen historischen Oper „Les Barbares“ in Saint Etienne mitfinanziert, die man nun auf Platte in ihren schön gestalteten und immer interessanten „Buch-CD’s“ hören und kennenlernen kann (es werden gleichzeitig zahlreiche Dokumente veröffentlicht). Nächstes Jahr wird unter Mitwirkung des Palazzettos in der wiedereröffneten Opéra Comique die seit hundert Jahren nicht mehr gespielte Oper „Le timbre d’argent“ aufgeführt werden. Wir werden im Juni 2017 sicher darüber berichten – denn Franz Liszt hatte Recht: „jede Oper von Camille Saint-Saëns lohnt die Mühe“!
Waldemar Kamer 3.11.16
Bilder (c) Vincent Pontet
Besonderer Dank an unseren Kooperationpartner Merker-online (Paris)
DER ROSENKAVALIER
am 9. Mai 2016
Wiederaufnahme der Salzburger Wernicke-Inszenierung aus dem Jahr 1995
Eigentlich berichten wir nicht über Wiederaufnahmen, denn wir schaffen es schon kaum, alle interessanten Neu-Inszenierungen, Erst- und Uraufführungen in Paris und Frankreich zu rezensieren. Doch manche Produktionen gehören sozusagen zum Haus und prägen eine Generation. So dieser „Rosenkavalier“, der 1995 bei den Salzburger Festspielen Premiere hatte und seit 1997 regelmäßig in Paris gespielt wird.

Es dauerte eben, bis der „Rosenkavalier“ in das Repertoire der Pariser Oper aufgenommen wurde – die erste Aufführung war erst 1927, 16 Jahre nach der Uraufführung in Dresden, doch ab dann wurde er häufig gespielt und immer sehr sorgfältig besetzt. Richard Strauss kam selbst nach Paris, um seine Oper zu dirigieren, und als Feldmarschallin traten die größten Sängerinnen auf: Lotte Lehmann, Germaine Lubin, Régine Crespin, Elisabeth Schwarzkopf und Christa Ludwig, die 1976 in Paris vom Octavian zu Marschallin wechselte. 1997 sangen Renée Fleming, Susan Graham als Octavian und Barbara Bonney als Sophie – ein wirklich erlesenes Trio. 2006 debütierte (quasi) ein junger Dirigent, den man in Paris kaum kannte: Philippe Jordan, damals erst 32 Jahre alt. Er wurde in den Ankündigungen durch die Presse mit seinem Vater Armin Jordan verglichen, der nicht lange davor einen wunderschönen „Rosenkavalier“ am Théâtre du Châtelet dirigiert hatte (mit Felicity Lott). Doch sein Dirigat war so besonders, dass man ab dem Zeitpunkt Philippe Jordan einen ganz anderen Stellenwert in Paris gab, und er 2007 zum neuen Musikdirektor der Pariser Oper ernannt wurde (ab 2009). Das war ganz deutlich ein Wunsch des Orchesters, das in der Mortier-Ära keinen Musikdirektor hatte und sich damals mit seinem „ersten Dirigenten“ Sylvain Cambreling hörbar schlecht verstand. So dirigierte Philippe Jordan im Dezember 2006 einen „Rosenkavalier“, an den wir uns bis heute erinnern: so viel Farben, Nuancen und Pianissimi hatten wir schon lange nicht mehr im Orchestergraben gehört!

Zehn Jahre später verstehen sich das Orchester und der Dirigent noch immer so gut und ist es eine Freude zu hören, wie sich beide entwickelt haben. Die Interpretation ist im Vergleich zu 2006 etwas weniger nostalgisch, dafür kräftiger, kantiger – beinahe möchte man sagen „maskuliner“ – geworden, doch die Farben, Nuancen und Pianissimi gingen dabei nicht verloren, und die Sänger werden wirklich liebevoll begleitet. Die Inszenierung (und Ausstattung) von Herbert Wernicke ist erstaunlicherweise nicht gealtert. Wie skeptisch waren wir 1995 angesichts dieses „kalten Rosenkavaliers“, voller Spiegel, den viele Rezensenten „zu intellektuell“ fanden. Das würde man heute sicher nicht mehr sagen – denn da haben wir inzwischen ganz andere Sachen auf Opernbühnen gesehen, die man sich damals gar nicht vorstellen konnte. Auffallend positiv ist vor allem die wirklich perfekte Personenführung: ein ganz großes Lob für den „Revival Director“ Alejandro Stadler, der 14 Jahre nach dem frühen Tode Wernickes diese Wiederaufnahme leitet. Das nächste Lob geht an den „Casting Director“ der Oper, der die riesige Besetzung homogen und wirklich rollengerecht ausgesucht hat. Im Gegensatz zu anderen Wiederaufnahmen „alter Produktionen“, passte hier jeder Sänger körperlich und stimmlich voll und ganz zu seiner Rolle, hatte man offensichtlich viel und gut miteinander geprobt und wurde auch richtig miteinander gespielt. Natürlich erinnern wir uns an andere Besetzungen, die einen größeren Eindruck auf uns gemacht haben, aber das ist Klagen auf hohem Niveau – für Merkerohren in der nicht unproblematischen Akustik der Opéra Bastille (2.700 Plätze).

In dieser Besetzung triumphierte Daniela Sindram als Octavian, den sie viele Jahre an der Bayrischen Staatsoper in München gesungen hat und seit 2006 überall in der Welt singt (auch an der Wiener Staatsoper). Sie war der Publikumsliebling zusammen mit Peter Rose als Baron Ochs. Der britische Bass donnerte seine tiefen Töne mit Freude in den großen Saal und hatte einen echt Wienerischen Akzent – Kompliment! (Er wird den Ochs nächste Spielzeit auch wieder an der Wiener Staatsoper singen.) Diese eher ungewöhnliche Sänger-Konstellation sorgte dafür, dass die oft langatmige Wirtshausszene zwischen Ochs und „Mariandel“ im dritten Akt der szenisch stärkste Moment des Abends wurde. Die „Nebenrollen“ waren ausgezeichnet besetzt, mit dem Münchner Kammersänger Martin Gantner als Herr von Faninal, Irmgard Vilsmaier, die Brünnhilde der Wiener Volksoper (in einer Ring-Kurzfassung von Loriot) als Marianne Leitmetzerin, der Österreicher Dietmar Kerschbaum als Valzacchi, mit Eve-Maud Hubeaux als Annina, die uns schon zu Ostern sehr positiv aufgefallen war als Ursule in „Béatrice et Bénédict“ in Brüssel.

Francesco Demuro war eine Luxusbesetzung als „italienischer Sänger“ (immer noch mit Pavarotti-Taschentuch). Das kann man leider nicht von der Sophie von Erin Morley behaupten. Die junge Amerikanerin debütierte im Herbst 2014 an der Pariser Oper als eine problematische Konstanze. Gleich danach sang sie eine Gilda an der Wiener Staatsoper, von der nicht alle begeistert waren. Die Rolle der Sophie ist viel einfacher als die beiden vorigen, aber auch hier blühte ihre Stimme nicht auf. Als Marschallin war Anja Harteros angesagt, die die Premiere und die ersten vier Vorstellungen singen sollte. Doch sie sagte ab (was leider in der letzten Zeit immer öfters passiert) und die Zweitbesetzung Michaela Kaune übernahm die Premiere. Die Hamburgerin kennt die Rolle seit langem, sang sie souverän und zum Teil auch berührend schön, so wie „die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“. Doch an anderen Momenten klafften die Register auseinander und es fehlte der „Silberglanz“, den wir in dieser Rolle so lieben. Genau wie Morley konnten viele Zuschauer sie schon in der achten Reihe nicht mehr hören, und diesmal lag es nicht an Dirigent und Orchester, die wirklich pianissimo spielten (was sonst nicht immer der Fall ist).

Doch wenn man bedenkt, was sich zurzeit alles in den Kulissen der französischen Opernhäuser abspielt, relativiert sich jede Sänger-Kritik. Denn am Morgen der Premiere ließ die Pariser Oper wissen, dass die Vorstellung am Abend „höchstwahrscheinlich“ wegen eines der vielen Streiks ausfallen würde. Nachmittags meinte man, dass es „vielleicht eine konzertante Aufführung werden könnte“, und erst zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn kam die Nachricht, dass die Premiere „doch nicht abgesagt“ wurde. Letzten Sonntag war es in Strassburg bis zur letzten Minute auch nicht sicher, ob die Premiere von Wagners „Liebesverbot“ wirklich stattfinden würde und über der morgigen „Tristan“-Premiere im Théâtre des Champs-Elysées in Paris hängt auch eine Streikwarnung. In Frankreich wird in diesem Frühling überall gestreikt und demonstriert – kein Wunder, dass Sänger unter solchen Umständen absagen und den Silberglanz ihrer Stimme verlieren. Hoffen wir, dass bei der nächsten Wiederaufnahme alles wieder etwas ruhiger sein wird…
Waldemar Kamer 20.5.16
Besonderer Dank an Merker-Online-Paris
Bilder (c) Opera de Paris / Emilie Brouchon
MOSES UND ARON

Opera de Bastille
Premiere 20.Oktober 2015
Eröffnung der Intendantenära Lissner
„O Wort, du Wort, das mir fehlt“ ruft Moses verzweifelt am Ende der Oper aus. Doch das gilt nicht für Stéphane Lissner, der seine neue Ära als Intendant mit einer Weltumfassenden, nicht enden wollenden Wortflut einläutet. Solch apokalyptische Worte hallten schon öfters durch Marmorgänge der Opéra de Paris: nach der überaus erfolgreichen Intendanz von Hugues Gall (1995-2004) kam Gérard Mortier, der großspurig erklärte, dass nun alles Anders werden müsste. Neben Oper und Ballett wurde eine dritte Kunstform erfunden, „frontière“, mit Abenden auf der „Grenze von verschiedenen Kunstformen“.
Das monatliche Opernmagazin (vergleichbar mit dem „Prolog“ der Wiener Staatsoper) wurde umgetauft in „Ligne 8“, die U-Bahnlinie auf der sich die beiden Häuser „Garnier“ und „Bastille“ befinden. Denn Mortier wollte fortan „die Jugend und die U-Bahnfahrer“ in die Oper locken – was ihm im Grossen Ganzen nicht gelang. Sein Nachfolger Nicolas Joel (2009-2015) brauchte mehrere Spielzeiten, um die verschreckten Abonnenten zurück zu gewinnen und das Haus aus den negativen Schlagzeilen zu holen.
Jetzt wird wieder alles umgeworfen, bis mindestens 2021. Nicht ganz ohne Grund, denn Stéphane Lissner erklärte diesen Frühling in seiner Antrittspressekonferenz, dass das Durchschnittsalter des jetzigen Publikums bei ungefähr sechzig Jahren liegt und „ein Generationswechsel bevorsteht“. Und wenn die alte Oper die junge Generation „ansprechen“ will, muss sie – so Lissner – „ihre Sprache sprechen“.
So wird ab dieser Spielzeit fast gänzlich auf gedruckte Kommunikation verzichtet: das Opernmagazin wurde abgeschafft und Lissner und sein Team bauten zwei Jahre an einer „dritten Bühne“ („3e scène“), die jeder von uns jederzeit besuchen kann – denn sie befindet sich komplett im Internet. Dort findet man viele kleine kunstvoll gestaltete Filme, von Künstlern die sich „über das Prisma der neuen Medien“ der Pariser Oper nähern. Bei Matthew Clark sieht man wie aus einem Kristall eine Tänzerin wird und bei Xavier Veilhan wie eine Meute wilder Jagdhunde aus dem Wald direkt ins Palais Garnier läuft. In anderen Filmen sehen wir die jungen Tänzer Bier auf dem Dach des Palais Garnier trinken oder wie Feuerwehrmänner nachts durch den legendenumwobenen See unter dem Opernhaus schwimmen. Viele, viele kleine „Ufos zwischen Dokumentarfilm und Videokunst“, die man leicht auf seine Facebook-Seite stellen oder an seine Freunde schicken kann. Sie handeln beinahe ausschließlich vom Ballett, denn der neue Ballettdirektor (der selbst auch einen Film drehte) ist jung und sexy und mit einer bei Jugendlichen sehr bekannten Hollywood-Schauspielerin verheiratet. Das Ballett soll fortan unter der Leitung des neuen Direktors Benjamin Millepied mehr in die Musik- und Opernabende eingebunden werden, mit zum Beispiel einer originellen Kombination von „Iolanta“ und „Nussknacker“, zwei Werke von Tschaikowski am gleichen Abend.
Auch das „Opernstudio“ ändert (wieder) seinen Namen. Aus dem Atelier Lyrique – seit vielen Jahren hervorragend geleitet durch Christian Schirm – wird jetzt eine breiter angelegte Académie, in der auch andere Künstler als (nur) Sänger aufgenommen werden. Die Hauptaufgabe der Académie wird fortan darin bestehen, um im ganzen Land an Schulen und Universitäten Jugendliche für die Oper zu gewinnen.
Nicolas Joel eröffnete 2009 seine erste Spielzeit mit „Mireille“ von Gounod, als Zeichen dafür, dass er die vernachlässigten Werke des französischen Repertoires wieder auf die Bühne bringen wollte. Das hat er auch getan, bis zum „Cid“ von Massenet und dem „Roi Arthus“ diesen Frühling. Lissner will dagegen in den nächsten sechs Jahren den Schwerpunkt auf Werke des XXe und XXIe Jahrhunderts setzen – ohne das gängige Repertoire ganz auszublenden. So kündigt er, zusammen mit dem Musikdirektor Philippe Jordan, einen Schönbergzyklus für diese Spielzeit an und einen großen Berlioz-Zyklus, der im Dezember anfangen wird mit „La damnation de Faust“ (mit Jonas Kaufmann, Bryn Terfel und Sophie Koch). Der Anfang dieses „neuen Programms“ wird gesetzt mit Schönbergs „Moses und Aron“, Lissner will „ein Signal“ setzen mit Werken, die einen „deutlichen Bezug zu heutigen politischen Aktualität haben“ und Opern vermeiden die „nur pure Zerstreuung bieten“. Er meinte im März, dass die Migranten aus Syrien „eines der größten gesellschaftlichen Themen der nächsten Jahre“ werden würden und zeigte damit ein gutes politisches Gespür, denn im Herbst schliefen sie schon in Zelten nicht weit von der Oper. In der neuen, aufwendigen, durch moderne Künstler gestalteten Saisonbrochüre werden die wenigen Zeilen zu „Moses und Aron“ eingeleitet mit einem Zitat von Schönberg: „Ich habe es endlich gelernt und werde es nie vergessen: ich bin kein Deutscher, kein Europäer und vielleicht kaum ein Mensch, aber ein Jude“. Das schrieb er, nachdem er 1921 in dem österreichischem Dörfchen Mattsee mit seiner Familie Zeuge (und Opfer) von antisemitischen Handlungen wurde. Dieses traumatische Erlebnis führte dazu, dass Schönberg – offiziell ein Protestant –zurück zum Glauben seiner Vorväter konvertierte und bei seiner Emigration 1933 ein Jude wurde. Dieses ist sicher keine unwichtige Information in der komplexen Entstehungsgeschichte des Werkes, aber sind Antisemitismus und syrische Migranten wirklich die besten Schlagworte um „Moses und Aron“ vorzustellen? Und war es wirklich nötig, um wenige Minuten vor der Première auf dem Fernsehen mit dramatischer Geste zu verkünden, dass dieses Werk Schönbergs Stellungsnahme sei zu Themen wie „Exodus“ (man lese heutig „Vertreibung aus Syrien“), „Kapitalismus“ (man lese „heutige Weltwirtschaftskrise“) und des islamitischen Attentaten gegen die Zeitung Charly Hebdo (Lissner: „dasselbe Verbot der Abbildung“)?
Der Regisseur Romeo Castellucci hat die intellektuelle Integrität, um sich nicht durch seinen wortgewaltigen und marketinggeilen Intendanten beeinflussen zu lassen und präsentierte eine sehr ästhetische, stark abstrahierte Inszenierung, in der er auf jede billige politische Aktualisierung verzichtete.
Castellucci ist ein in Paris überaus bekannter Theaterregisseur, der schon letztes Jahr im Festival d’automne mit seiner Kompagnie Societas Raffaello Sanzio eine eigene Interpretation zu der Moses-Figur lieferte: „Go down, Moses“ (sie war im Mai auf den Wiener Festwochen zu sehen). Diesen Herbst touren in Paris auch noch seine Inszenierung von Hölderlins „Ödipus der Tyrann“ mit der Schaubühne aus Berlin und seine zwanzig Jahr alte Produktion der „Orestie“ von Aischylos aus Rom. Daneben noch drei andere Theaterproduktionen auf Französisch – also gleichzeitig sechs Castellucci-Inszenierungen in Paris! Oper ist (noch) Neuland für ihn: nach „Parsifal“ (Brüssel, 2011) und „Orfeo ed Euridice“ (Brüssel/Wiener Festwochen, 2013) ist „Moses und Aron“ erst seine dritte Operninszenierung. Sie ist sehr anders als sein in Wien heftig kritisierter „Orfeo“ und Castellucci hat deutlich länger und gründlicher an „Moses und Aron“ gearbeitet als so Manches was wir in den letzten Jahren von ihm gesehen haben.

Wer die Inszenierung von Peter Stein 1995/96 in Amsterdam/Salzburg in Erinnerung hat, weiß wie schwierig dieses Werk zu inszenieren ist: es sollte ursprünglich eine Kantate oder ein Oratorium werden und wurde dann eine unfertige Oper, da Schönberg nicht mehr zu seinem Libretto stand, in dem Moses im nie komponierten dritten Akt Aron zu Tode verurteilt. „Moses und Aron“ wurde erst nach dem Tode Schönbergs zum ersten Mal gespielt: 1951 konzertant in Hamburg und 1954 szenisch in Zürich. Ähnlich wie in den „Gurre-Liedern“, die erst vor einem Jahr in Amsterdam szenisch uraufgeführt wurden, stellt das Werk jedes Haus und jedes künstlerisches Team vor gewaltige Aufgaben: riesige Chormassen, keine wirklich Operntaugliche Handlung und eine Musik, vor dem jedes Opernorchester und jeder Opernchor erst einmal zurückschrecken. (In Schönbergs Zwölfton-Musik darf eine Note erst wiederholt werden, wenn alle anderen Noten gespielt wurden; der erste Akt zählt genau tausend Takte – von dem berühmt berüchtigten „Sprechgesang“ ganz zu schweigen.) Wenn man das Werk „eins zu eins“ inszeniert, wie Peter Stein es versucht hat, entsteht auch mit dem besten Dirigenten (wie damals Pierre Boulez) gähnende Langweile auf der Bühne: Moses steht den ganzen ersten Akt endlos vor dem Chor mit seinem Wanderstab, den er nie benutzt. Im zweiten Akt folgt auf Arons Anweisung der berühmte „Tanz um das goldene Kalb“ (das einzige Stück das wohl zu Lebzeiten Schönbergs gespielt wurde). Doch meistens erleben wir dann nur banale Peinlichkeit – da die Musik, trotz Jazz-Anleihen, auch in dieser „erotischen Szene“ vollkommen unsinnlich bleibt.

Es war also eine interessante Idee, um für dieses Werk einen Regisseur zu wählen, der sich als „bildender Künstler“ definiert (er schuf die ganze Ausstattung) und sich vehement gegen das „Geschichten-Erzählen“ auf der Bühne auflehnt. Denn das zentrale Thema dieses Werkes ist ja gerade die Verweigerung des Wortes, des Bildes, des Gesanges: Moses darf mit dem Volk nur sprechen, Aron kann es mit seinem Gesang bezaubern. Bei ihrer ersten Begegnung sagt Moses: „reinige dein Denken, löse es von Wertlosem, weihe es Wahrem“ und deswegen führt Moses – bei Schönberg – sein Volk in die Wüste. Er prophezeit: „In der Wüste wird Euch die Reinheit des Denkens nähren, erhalten und entwickeln“. Castellucci und seine beiden Dramaturgen haben diese Wortverweigerung auf der Bühne umgesetzt in eine Bildverweigerung. Der größte Teil des Abends spielt vor einem Tüllvorhang, vor dem man oft nur vage erkennen kann was im Hintergrund abläuft. In den ersten Szenen bleibt die weite, weiße Bühne leer und singt der Chor aus dem Off. Moses liegt alleine auf der Vorderbühne unter einem alten Projektionsgerät, auf dem alte Filmrollen abgespult werden, die wie schwarze Wollfäden auf ihn hinab gleiten. Im weißen Hintergrund bewegen sich schemenhaft die Sanddünen der Wüste, bis wir langsam erkennen, dass es sich um die Choristen handelt, die ihn große weiße Wattewolken eingehüllt wurden. Der ganze erste Akt ist wunderbar beleuchtet – die Inszenierung hätte von Bob Wilson sein können. Doch im zweiten Akt verliert Castellucci seine Abstraktionsgabe und wird er plötzlich peinlich konkret. Wir sind ihm dankbar, dass er beim „Tanz der Schlächter“ auf die im Libretto beschriebenen „hereingaloppierenden Stammesfürsten“ verzichtet, vor denen das Volk „aufgeregt auseinanderstiebt“ – denn mit Pferden wurden in der letzten Zeit auf den Pariser Opernbühnen keine guten Erfahrungen gemacht.

Bei der „Orgie der Trunkenheit und des Tanzes“ und der „Orgie der Vernichtung und des Selbstmordes“, verzichtet Castellucci auf das inzwischen schon fast obligate Nackedei. Sogar in der „Erotischen Orgie“ behalten die „nackten Jungfrauen“ und die „nackten Jünglinge“ sowie „Einige andere Nackte“ ihre weißen Kostüme an. Doch was er uns dafür bot war eher befremdend: in dem riesigen weißen Bühnenprospekt öffnete sich eine Art Klimt-Fries mit hunderten nackten Statisten. Sie lagen regungslos da – von Sinnlichkeit keine Spur, es hatte beinahe etwas von Leichen in einer Gaskammer. (Letztes Jahr inszenierte Castellucci Strawinskys „Sacre du Printemps“ an der Ruhrtriennale mit Knochenstaub statt Tänzern.) Als „goldenes Kalb“ watschelte ein dicker Stier über die Bühne, der in einer trostlosen Tollpatschigkeit einen Kreis um eine nackte Statistin drehen musste und dabei wie ein altes Nashorn oder ein zahnloser Wasserbüffel wirkte (die fünftausend Euro Abendgage die er und sein Trainer pro Vorstellung bekommen hätte man sich wirklich sparen können). In Wien sorgte vor zwei Jahren bei „Orfeo ed Euridice“ die Einbeziehung einer Koma-Patientin in die Inszenierung für heftige Kritik. Jetzt ließ Castellucci geistig und körperlich behinderte Menschen in Rollstühlen über die Bühne fahren, ohne dass wir im mindesten verstanden warum. Das hätte er ihnen ersparen können – und uns auch.

Die Hauptfigur dieser Oper ist ausnahmsweise der Chor. Der Chor der Pariser Oper wurde mit einigen Extra-Chören aufgestockt und es scheint, dass er unter der sehr kompetenten Leitung von José Luis Basso und Alessandro Di Stefano ein ganzes Jahr geprobt hat. Sie können Stolz auf ihre Leistung sein und stolz darauf, dass die meisten der zwanzig Nebenrollen mit Mitgliedern des Chores besetzt wurden, die alle ein perfektes Deutsch sangen. Der Chor der Komischen Oper in Berlin wurde vor wenigen Wochen in der Zeitschrift „Opernwelt“ zum „Chor des Jahres“ gewählt, wegen seines „virtuosen Körperseinsatzes, musikantischen Esprit und seiner klanglichen Plastizität“, die ihn – so Opernwelt – zum „atemraubend pochenden Herzen der „Moses und Aron“-Produktion“ machten. Das konnte der Pariser Chor in dieser Inszenierung nicht werden, da die vielen, im Libretto so genau beschriebenen Rollen, nie individualisiert wurden und der Chor nur als schemenhafte Masse auftauchte. Der auch als Wotan bekannte Thomas Johannes Mayer sprach/sang einen beeindruckenden Moses, mit einem wirklichen, eigenen Rollenprofil. Über Lissners Wahl des John Graham-Hall als Aron kann man sich nur wundern. Der Tenor war vor einigen Jahren noch ein überzeugender Perelà (von Dusapin) und ein wunderbarer Aschenbach (von Britten) an der von Lissner geleiteten Scala, aber als Aron – der das Volk verführt – wirkte er neben dem kräftigen Moses von Mayer stimmlich zu schmal und szenisch zu alt (eben ein perfekter Aschenbach). Philippe Jordan dirigierte mit großem Einsatz und wirklichem Engagement diese Musik über die er offensichtlich viel nachgedacht hat – das öffnet neue Perspektiven für die kommenden Spielzeiten.

Das Orchester spielte deutlich motiviert, doch nach einiger Zeit schien es an Präzision zu verlieren in dieser, zugegeben, höllisch schwierigen Partitur. Oder wurde unser Konzentrationsvermögen zu sehr geschwächt durch die Bühne? Denn beinahe den ganzen Abend lang wurden Worte auf den Tüllvorhang projiziert. Erst wenige Worte wie „Bruder, Erde, Volk, Idee“ – offenbar als Kommentar auf das Bühnengeschehen. Doch dann fing der Projektionsapparat an immer schneller zu laufen, es folgten ganze Wortserien zu Flüssen, Wüsten, Krankheiten bis es mehrer Worte pro Sekunde wurden, die nichts mehr mit dem Stück zu tun hatten, wie „Kühlschrank, Känguru, Tango, Schokolade, Golf, Fernsehen, Hobby“ etc. Nicht Dutzende Worte, sondern eine wirkliche Publikumsbeschießung mit tausenden Worten, denen man nicht entweichen konnte (sie standen metergroß auf der Bühne) und die unser Hirn mit Unsinn vollmüllten. Als Moses den Abend beschloss mit „O Wort, du Wort, das mir fehlt“ ging ein Lachen durch den Saal. Denn diese Inszenierung kann in das Guinness Book of Records aufgenommen werden als die mit den meisten Worten. „Words, words, words“ – wie Shakespeare es schon sagte…
Waldemar Kamer 24.10.15
Besonderer Dank an MERKER-Online (Wien)
Fotos: Opéra National / Bernd Uhlig
Ernest Chausson
LE ROI ARTHUS
11.6.2015 - Erstaufführung an der Pariser Oper!
Die französischen Opern-Ritter kehren zurück

Die edelmütigen, eleganten französischen Ritter des Mittelalters setzen an, um mit ihren schillernden Rüstungen und glimmenden Schwertern den Platz zurück zu erobern, den sie einst auf unseren Operbühnen fest in Händen hielten....
Die edelmütigen, eleganten französischen Ritter des Mittelalters setzen an, um mit ihren schillernden Rüstungen und glimmenden Schwertern den Platz zurück zu erobern, den sie einst auf unseren Opernbühnen fest in Händen hielten. Nachdem die deutsche Erstaufführung von „Sigurd“ von Ernest Reyer im Januar in Erfurt durch die internationale Presse als ein großes Ereignis gefeiert wurde, folgte im April die erste Aufführung seit 1919 von Massenets „Le Cid“ an der Pariser Oper, über die wir auch ausführlich berichtet haben. Und gleich danach stürmte schon eine dritte Ritterschar auf die Bühne: „Le Roi Arthus“ mit seiner legendenumwobenen „Tafelrunde“. Auch wenn die Schar durch Lancelot angeführt wird (und nicht durch Tristan oder Parzival), hat die einzige Oper von Chausson inhaltlich und musikalisch eine große Nähe zu Wagners „Tristan und Isolde“.

„Le Roi Arthus“ ist eine freie Nacherzählung der Legende von Tristan und Isolde in einem betont wagnerisch anmutenden Musikidiom, in dem Chausson die Konstellation der Personen geändert und den Schwerpunkt von der verbotenen Liebe auf die Vergänglichkeit des menschlichen Strebens verlagert hatte. Chausson verwendet oft nur kurze Tonfolgen aus Wagners Werken, vermischt diese dann mit impressionistischen Klängen à la Debussy und instrumentiert es wie César Franck. Daraus entsteht dann Chaussons „eigener“ Klang. Aber wie er z.B. nahtlos Übergänge von der „Götterdämmerung“ zu „Parsifal“ herstellen kann, davon kann heute noch der geniale Stefan Mickisch etwas lernen.
 Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
Doch nach dem ersten Weltkrieg wollte das Publikum auch in Brüssel etwas Anderes hören und sehen als Krieger und Soldaten die mit erhobenem Schwert in die Schlacht ziehen, und so verschwand „Le Roi Arthus“ von den Spielplänen. Erst 1996 erschien er wieder und dann auch gleich drei Mal: in Dortmund, in Montpellier und in Bregenz. Es folgten Brüssel (2003) und Straßburg (2014). Leider nicht immer mit überzeugenden Aufführungen. Die Presse war so einstimmig negativ über den „Arthus“ in Strasbourg (siehe Merker 4/2014), dass nicht nur der Regisseur, Dirigent und die Besetzung, sondern auch das Werk selbst heftig kritisiert wurden. Die Pariser Oper scheint sich diese Kritik zu Herzen genommen zu haben und hat ihren „Arthus“ nun wirklich hochkarätig besetzt.

Roberto Alagna sang die ersten sieben Vorstellungen mit dem gleichen „Aplomb“ wie kurz zuvor den „Cid“ (siehe Merker 5/2015) und man kann dem Sänger, der sich seine Auftritte auswählen kann, nicht genug dankbar sein, dass er so kurz nacheinander zwei schwierige Rollen gelernt hat, die er wahrscheinlich nicht mehr oft singen wird. Denn Alagna besitzt genau diese „clarté“, dieses helle Metall in der Höhe, die den Typus des „französischen Heldentenors“ charakterisiert. Und dieser ist stimmlich viel „jugendlicher“ als ein Tristan, schon fast ein Pelléas mit Schwert und Rüstung. Man kann es der Pariser Oper jedoch nicht hoch genug anrechnen, dass sie es geschafft hat auch für die Zweitbesetzung eine mehr als nur beachtliche Lösung gefunden zu haben. In der Vorstellung am 11. Juni sang Zoran Todorovich den Lancelot. Seine Stimme besitzt zwar nicht die Geschmeidigkeit und Schönheit eines Alagna, aber die Stimme sitzt gut, verfügt über genügend Stahlkraft, und auch die Höhen wurden mühelos gemeistert.
 Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.
Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.

Ein musikalisches Ereignis, dem leider ein szenisches Desaster den Weg zum uneingeschränkten Triumph versperrte. Der Regisseur Graham Vick hat die Geschichte auf ein banales Dreiecksdrama im Wohnzimmer-Milieu reduziert. Ein kleines Fertigteilhäuschen, das zu Beginn zusammengesetzt wird, in einer knallgrünen Hügellandschaft mit einem mittelalterlichen Turm im Hintergrund, ein scheußliches grellrotes Kunstledersofa (das im Laufe des Abends abgefackelt wird), ein kleinbürgerlicher Vorgarten (nur die Gartenzwerge fehlen noch). In diesem Ambiente lässt der Bühnenbildner Paul Brown die Ritter der Tafelrunde ihren Sieg über die Sachsen feiern. Mit nur wenigen Veränderungen bleibt das Bühnenbild fast den ganzen Abend lang gleich. Die Kostüme (ebenfalls von Paul Brown), größtenteils dem Schlabberlook der Gegenwart frönend, waren von einer ausgesprochenen Hässlichkeit. Nachdem die Jungs von heute nicht wissen, was man mit so riesigen Schwertern anfangen soll, die sie anfangs mit sich herumschleppen, stoßen sie die Schwerter rund um das Haus in den Boden und sparen sich damit einen Zaun zu errichten. Der Zauberer Merlin (Peter Sidhom) sollte eigentlich König Arthus in einem Apfelbaum erscheinen. Hier sitzt Merlin von Beginn des Aktes an zusammengekauert neben dem Herd und fängt irgendwann zu singen an. Banaler geht’s ja wohl nicht mehr. Jedes weitere Wort über diese „Inszenierung“ verlieren zu wollen wäre nur Verschwendung.

Szenische Verhunzungen sind wir ja leider schon gewöhnt, aber gerade bei einem Werk, das wahrscheinlich mehr als 99% der Besucher noch nie zuvor gesehen haben, könnte man von einem Regisseur schon so etwas wie Werktreue verlangen. Das Resultat war, dass in den beiden Pausen ein wahrer Exodus von großen Teilen des Publikums zu registrieren war. Und wahrscheinlich halten jetzt viele vorzeitig Geflüchtete das Werk von Chausson für schwach. Das ist nun einzig und allein auf das unverantwortliche Verhalten des Regisseurs zurückzuführen. So konnte sich dieses Meisterwerk leider einem Großteil des Publikums nicht erschließen. Dieses Werk hätte bei der Pariser Erstaufführung wahrlich eine bessere szenische Umsetzung verdient.
1965 wurde ein kleines schwarzes Notizbuch entdeckt, in dem Ernest Chausson seine zukünftigen Opernpläne notierte. Zehn Werke der Weltliteratur standen auf der Liste, darunter Shakespeares „Macbeth“ und eine „Turandot“-Oper (lange vor den berühmten Vertonungen von Puccini und Busoni). Man darf gar nicht daran denken, welche Werke uns Ernest Chausson vielleicht noch hätte schenken können, wäre er nicht 1899 im Alter von nur 44 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls gestorben.
Nachdem nun „Le Roi Artus“ wieder die Bühne erobert hat, hoffen wir, dass wir die anderen Opern-Ritter in seinem Gefolge auch bald kennen lernen werden. Da gäbe es zum Beispiel den legendären „Fervaal“ von Vincent d’Indy, „Le Roi d’Ys“ von Lalo oder „La Légende de Tristan“ von Tournemire.
Waldemar Kamer und Walter Nowotny
Bilder (c) OdP
OPERNFREUND PLATTEN TIPP
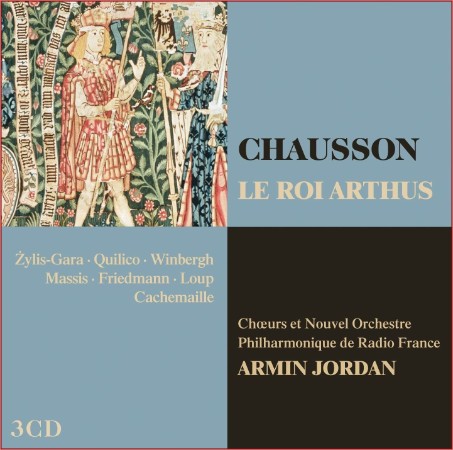
Führungswechsel an der Opéra national de Paris um ein Jahr vorgezogen
Nicolas Joel, der als Directeur der Opéra 2009 Gérard Mortier nachgefolgt war, gibt ein Jahr früher als geplant sein Amt ab und übergibt es schon am 1. August 2014 an seinen Nachfolger Stéphane Lissner, der wiederum ein Jahr früher aus seinem Amt als Leiter der Mailänder Scala frei wird, weil Alexander Pereira, der die Position in Mailand übernehmen wird, ohne Probleme rechtzeitig seine Funktion als künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele beenden kann, was nicht erstaunt, wenn man seine Abrechnung (unter den Worten: „Blutiger Kleinkrieg) mit der Festspielpräsidentin gelesen hat: faz.net-aktuell
Nun müsste bloß Gérard Mortier wieder nach Salzburg zurückkehren, dessen Abgänge jeweils von Publikum und Fachpresse bedauert wurden. Ist er schonwieder frei? Denn für ihn, derzeit noch Intendant am Teatro Real in Madrid und dort bis 2016 unter Vertrag wurde gerade schon de Nachfolger ausgerufen: Joan Matabosch, Leiter des Liceu in Barcelona. Mit den Intendanten ziehen dann ganze Karawanen (von Abhängigen) weiter, wie die FAZ in ihrer Ausgabe vom 11.09.13 vermeint und dazu feststellt, dass an jedem Haus dann „ein noch teureres, noch unleserlicheres Layout für die Theaterzeitung“ ausgedacht wird. Ihr Berichterstatter weiß es aber noch sic herer: zu allererst wird der Internetauftritt der Häuser so umgekrempelt, dass man sich darin erst einmal nicht mehr zurechtfindet. Und dann sieht man sich auch einem neuen Pressesprecher „aus der Karawane“ gegenüber; aber den kennt man wenigstens schon…
Nicolas Joel, 60 Jahre, der aus Toulouse gekommen war, war eine gewisse Provinzialität nachgesagt worden. Nach seinen ersten etwas belächelten Produktionen war in der Presse zu lesen, dass die künstlerisch führende Position unter den französischen Opernhäusern wohl auf das moderner ausgerichtete Haus in Lyon übergehen würde. Er hat sich als Intendant der Opéra aber insofern gut geschlagen, dass die Auslastung der beiden Häuser der Nationaloper zuletzt bei immerhin 96% gelegen hat – oder ist das Publikum in Paris auch Opern-provinziell? Joel, der sich seit einem Schlaganfall 2008 ohnehin schonen musste, ist wohl auch der Stress mit seiner Vorarbeiterin, Madame la ministre de la Culture et de la Communication, seit dem französischen Machtwechsel Frau Aurélie Filipetti, zu viel geworden. Dorthin sollen die Beziehungen recht unterkühlt gewesen sein, nicht nur wegen der Budgetkürzungen im französischen Kulturhaushalt und den ihm auferlegten Sparmaßnahmen. Nicolas Joel wird nach seinem Rückzug von der Opéra noch weiterhin Opern inszenieren.
Das Communiqué des Kultusministeriums („Nicolas Joel, Direktor der Opéra National de Paris, wird zum Sommer 2014 seine Funktionen ein Jahr als früher als ursprünglich vorgesehen niederlegen, damit der reibungslose Übergang der Führungsfunktionen im Hause in Übereinstimmung mit der Ministerin für Kultur und Kommunikation sichergestellt werde“) klingt ebenso unterkühlt wie die sehr knappe Würdigung seiner Intendantentätigkeit in der gleichen Vernehmlassung, die ganz ohne Danksagung auskommt.
Die Handschrift von Stéphane Lissner als Intendant wird also - wie ursprünglich vorgesehen - erst in der Spielzeit 2014/15 sichtbar werden. Immerhin hat er angekündigt, mit der Pariser Opéra ein Opernhaus des 21. Jhdts. entwickeln zu wollen. Hat er in Mailand dafür schon ab 2006 dreizehn Jahre lang Zeichen gesetzt? Man erinnere sich, welche Intendanten die Pariser Oper erst einmal ins 20. Jhdt. geführt haben und wann: Liebermann und Mortier erst in der zweiten Jahrhunderthälfte. Letzterer hätte sicher gern noch weitergemacht, ist aber über 65 Jahre alt und durfte daher in Frankreich nicht mehr.
Am Programm der kommenden Spielzeit 2013/2014 ändert sich naturgemäß nichts. Neuproduktionen und Wiederaufnahmen an der Opéra Bastille und im Palais Gernier unter unter
Manfred Langer 16.09.13









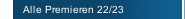




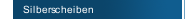
















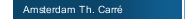













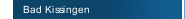




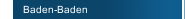





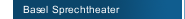




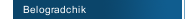

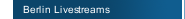





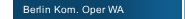



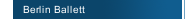





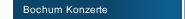



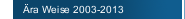





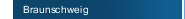

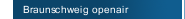




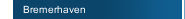




















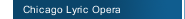


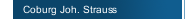





















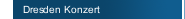



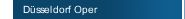



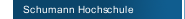









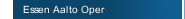




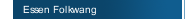










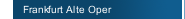
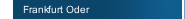





















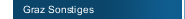








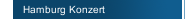
















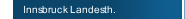

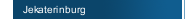

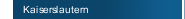











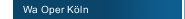


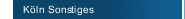
















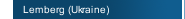





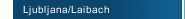





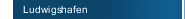























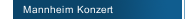













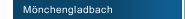





















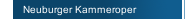
















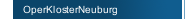


























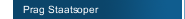
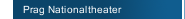

















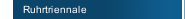

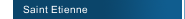







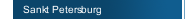



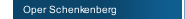
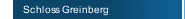














































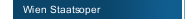

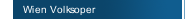

















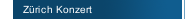
















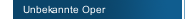




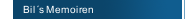











































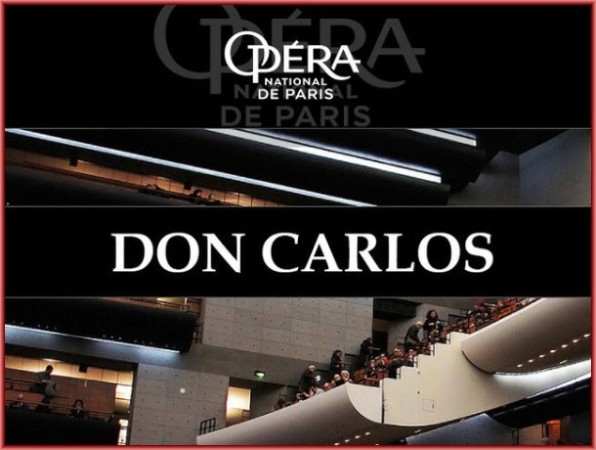


















 In dieser Inszenierung liegt Lohengrin plötzlich als ein wimmernder Knabe auf der Erde, barfüssig, schutzsuchend und singt seinen ersten Satz, „Nun sei bedankt, mein lieber Schwan“, mit dem Rücken zum Publikum. Ein Weltfremder spielt mit einer Schwanenfeder und merkt nicht, dass Andere ihm zuhören. Der Ausgangspunkt von Guths Regiekonzept ist, dass Richard Wagner den Weltfremden Kaspar Hauser anscheinend 1833 auf dem Weg von Würzburg nach Bamberg gesehen hat und durch sein Schicksal berührt wurde.
In dieser Inszenierung liegt Lohengrin plötzlich als ein wimmernder Knabe auf der Erde, barfüssig, schutzsuchend und singt seinen ersten Satz, „Nun sei bedankt, mein lieber Schwan“, mit dem Rücken zum Publikum. Ein Weltfremder spielt mit einer Schwanenfeder und merkt nicht, dass Andere ihm zuhören. Der Ausgangspunkt von Guths Regiekonzept ist, dass Richard Wagner den Weltfremden Kaspar Hauser anscheinend 1833 auf dem Weg von Würzburg nach Bamberg gesehen hat und durch sein Schicksal berührt wurde.
 Der in Wien nicht unbekannte Tomasz Konieczny sprang für den erkrankten Wolfgang Koch ein. Sein Telramund war im ersten Akt noch etwas blass – er steht ja auch unter der Scheffel der dominanten Ortrud. Doch im Duo des zweiten Aktes konnte er seiner bösen Frau das Gift reichen, das im Orchester mit dunklen, braunen Tönen gebraut wurde.
Der in Wien nicht unbekannte Tomasz Konieczny sprang für den erkrankten Wolfgang Koch ein. Sein Telramund war im ersten Akt noch etwas blass – er steht ja auch unter der Scheffel der dominanten Ortrud. Doch im Duo des zweiten Aktes konnte er seiner bösen Frau das Gift reichen, das im Orchester mit dunklen, braunen Tönen gebraut wurde. Camille Saint-Saëns war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten der Belle Epoque – weit vor Gounod, Massenet und Bizet - aber die Opéra de Paris hatte schon von der ersten Minute an Schwierigkeiten mit „Samson et Dalila“. Das lag an dem biblischen Sujet, an der sinnlichen Dalila und auch an den Wagner-Klängen im ersten und zweiten Akt. Ursprünglich 1859 als ein Oratorium geplant, blieb die Komposition im ersten Akt stecken, denn alle waren „schockiert“ über die sinnliche Musik. Erst 15 Jahre später schaffte es Pauline Viardot, der die Rolle der Dalila gewidmet war, den zweiten Akt in Paris auf zu führen. Doch der deutsch-französische Krieg von 1870 war schon im Kommen, womit das Wagner- und somit „deutschfreundliche“ Werk in der Pariser Oper unspielbar wurde. Zum Glück gab es Menschen und Künstler, die vollkommen über solchen Vorurteilen standen und es war „nur, nur, nur Franz Liszt zu verdanken“ (so wie es Saint-Saëns mehrmals schrieb), dass „Samson et Dalila“ zuende komponiert und 1877 in Weimar uraufgeführt wurde - auf Deutsch! Der Erfolg stellte sich bald in ganz Europa ein, auch in einigen französischen Provinzopern, und 1892 war die Opéra de Paris mehr oder weniger gezwungen, „Samson et Dalila“ in ihr Repertoire auf zu nehmen. Während andere Opern von Saint-Saëns, so wie die großen historischen Schinken „Henri VIII“ und „Ascanio“, aufwendige Ausstattungen bekamen, wurde „Samson et Dalila“ halbherzig aufgeführt in einem alten Bühnenbild von Massenets „Roi de Lahore“. Doch auch wenn die gemalten Tempelsäulen im letzten Bild nicht spektakulär einstürzten, wurde „Samson“ ein riesiger Erfolg, der während der Belle Epoque über achthundert Mal an der Pariser Oper wiederholt wurde.
Camille Saint-Saëns war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten der Belle Epoque – weit vor Gounod, Massenet und Bizet - aber die Opéra de Paris hatte schon von der ersten Minute an Schwierigkeiten mit „Samson et Dalila“. Das lag an dem biblischen Sujet, an der sinnlichen Dalila und auch an den Wagner-Klängen im ersten und zweiten Akt. Ursprünglich 1859 als ein Oratorium geplant, blieb die Komposition im ersten Akt stecken, denn alle waren „schockiert“ über die sinnliche Musik. Erst 15 Jahre später schaffte es Pauline Viardot, der die Rolle der Dalila gewidmet war, den zweiten Akt in Paris auf zu führen. Doch der deutsch-französische Krieg von 1870 war schon im Kommen, womit das Wagner- und somit „deutschfreundliche“ Werk in der Pariser Oper unspielbar wurde. Zum Glück gab es Menschen und Künstler, die vollkommen über solchen Vorurteilen standen und es war „nur, nur, nur Franz Liszt zu verdanken“ (so wie es Saint-Saëns mehrmals schrieb), dass „Samson et Dalila“ zuende komponiert und 1877 in Weimar uraufgeführt wurde - auf Deutsch! Der Erfolg stellte sich bald in ganz Europa ein, auch in einigen französischen Provinzopern, und 1892 war die Opéra de Paris mehr oder weniger gezwungen, „Samson et Dalila“ in ihr Repertoire auf zu nehmen. Während andere Opern von Saint-Saëns, so wie die großen historischen Schinken „Henri VIII“ und „Ascanio“, aufwendige Ausstattungen bekamen, wurde „Samson et Dalila“ halbherzig aufgeführt in einem alten Bühnenbild von Massenets „Roi de Lahore“. Doch auch wenn die gemalten Tempelsäulen im letzten Bild nicht spektakulär einstürzten, wurde „Samson“ ein riesiger Erfolg, der während der Belle Epoque über achthundert Mal an der Pariser Oper wiederholt wurde.
 Dieses differenzierte Rollenporträt wäre niemals aufgegangen ohne die Mitwirkung des Dirigenten, des Orchesters und einer wirklich exzeptionellen Sängerin. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen, die wir als Dalila in Erinnerung haben, ist Anita Rachvelishvili erstaunlich jung. Sie sang 2009, gerade erst 25 Jahre alt, die „Eröffungs-Carmen“ von Lissners erster Spielzeit an der Scala. Ihre Jugend und ihre Technik ermöglichen es ihr, Dalilas erste Arie, „Printemps qui commence“, als junges Mädchen mit einem hellen Sopran zu singen, um danach im großen Liebesduo „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ Samson mit einer samtenen Mezzo-Bruststimme zu betören. Am Ende des Abends wird sie zur Furie – eine Frau die nichts mehr vom Leben erwartet und so auch nichts mehr zu verlieren hat. Das ist nicht nur alles wunderbar gesungen, sondern auch so gut gespielt, dass man den ganzen Abend im Banne Dalilas bleibt. Da kann Aleksandrs Antonenko als Samson leider nur beschränkt mithalten. Er ist auch jung – nur zehn Jahre älter als Rachvelishvili -, sieht aus der Ferne aus wie José Cura und ist ein wirklicher „lirico spinto Tenor“ (Otello in Salzburg und an der Met). Doch er hat auch noch in den letzten Vorstellungen ein offensichtliches Problem mit der französischen Technik und Aussprache. Ein französischer „ténor héroïque“ singt „dans le masque“, also mit hoch angesetzter Stimme. Dann passiert es auch mal einem so perfekten Techniker wie Roberto Alagna, dass man streckenweise etwas zu hoch singt. Doch Antonenko sang fast den ganzen Abend durchgehend einen viertel bis halben Ton zu hoch (außer im Liebesduo). Dazu hatte er einen derart slawisch/russischen Akzent, dass man in seinen Szenen mit dem ebenfalls aus Riga stammenden Egil Silins den Eindruck bekam, die kriegerische Handlung sei von Gaza in die Ukraine verlegt. Solche Sprachfehler waren früher an der Opéra de Paris völlig undenkbar und sorgten beim Publikum für berechtigten Unmut. Sie waren umso unverständlicher, weil Nicolas Testé und Nicolas Cavallier ihre wesentlich kleineren Rollen sprachlich und technisch absolut perfekt sangen und man nicht versteht, warum sie nicht in der so wichtigen Rolle des Hohepriesters besetzt wurden, in der Alain Fondary 1991 so unvergesslich war. Für den Opernchor in seiner großen Besetzung von fast hundert Mann (unter Leitung von José Luis Basso) haben wir nur Lob. Hier wurde wirklich subtil und transparent gesungen, mit Piano und Ritardando. Dieses für die Musik von Camille Saint-Saëns so wichtige „raffinement“ kam auch aus dem Orchestergraben, in dem sich das Orchester der Pariser Oper von seiner besten Seite zeigte.
Dieses differenzierte Rollenporträt wäre niemals aufgegangen ohne die Mitwirkung des Dirigenten, des Orchesters und einer wirklich exzeptionellen Sängerin. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen, die wir als Dalila in Erinnerung haben, ist Anita Rachvelishvili erstaunlich jung. Sie sang 2009, gerade erst 25 Jahre alt, die „Eröffungs-Carmen“ von Lissners erster Spielzeit an der Scala. Ihre Jugend und ihre Technik ermöglichen es ihr, Dalilas erste Arie, „Printemps qui commence“, als junges Mädchen mit einem hellen Sopran zu singen, um danach im großen Liebesduo „Mon coeur s’ouvre à ta voix“ Samson mit einer samtenen Mezzo-Bruststimme zu betören. Am Ende des Abends wird sie zur Furie – eine Frau die nichts mehr vom Leben erwartet und so auch nichts mehr zu verlieren hat. Das ist nicht nur alles wunderbar gesungen, sondern auch so gut gespielt, dass man den ganzen Abend im Banne Dalilas bleibt. Da kann Aleksandrs Antonenko als Samson leider nur beschränkt mithalten. Er ist auch jung – nur zehn Jahre älter als Rachvelishvili -, sieht aus der Ferne aus wie José Cura und ist ein wirklicher „lirico spinto Tenor“ (Otello in Salzburg und an der Met). Doch er hat auch noch in den letzten Vorstellungen ein offensichtliches Problem mit der französischen Technik und Aussprache. Ein französischer „ténor héroïque“ singt „dans le masque“, also mit hoch angesetzter Stimme. Dann passiert es auch mal einem so perfekten Techniker wie Roberto Alagna, dass man streckenweise etwas zu hoch singt. Doch Antonenko sang fast den ganzen Abend durchgehend einen viertel bis halben Ton zu hoch (außer im Liebesduo). Dazu hatte er einen derart slawisch/russischen Akzent, dass man in seinen Szenen mit dem ebenfalls aus Riga stammenden Egil Silins den Eindruck bekam, die kriegerische Handlung sei von Gaza in die Ukraine verlegt. Solche Sprachfehler waren früher an der Opéra de Paris völlig undenkbar und sorgten beim Publikum für berechtigten Unmut. Sie waren umso unverständlicher, weil Nicolas Testé und Nicolas Cavallier ihre wesentlich kleineren Rollen sprachlich und technisch absolut perfekt sangen und man nicht versteht, warum sie nicht in der so wichtigen Rolle des Hohepriesters besetzt wurden, in der Alain Fondary 1991 so unvergesslich war. Für den Opernchor in seiner großen Besetzung von fast hundert Mann (unter Leitung von José Luis Basso) haben wir nur Lob. Hier wurde wirklich subtil und transparent gesungen, mit Piano und Ritardando. Dieses für die Musik von Camille Saint-Saëns so wichtige „raffinement“ kam auch aus dem Orchestergraben, in dem sich das Orchester der Pariser Oper von seiner besten Seite zeigte.












 Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
 Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.
Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.