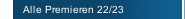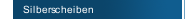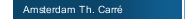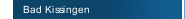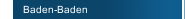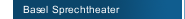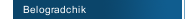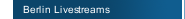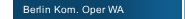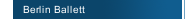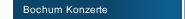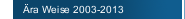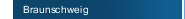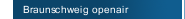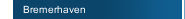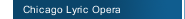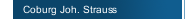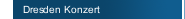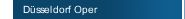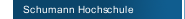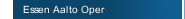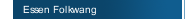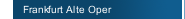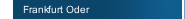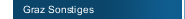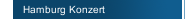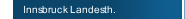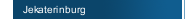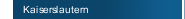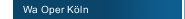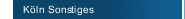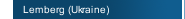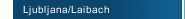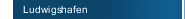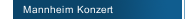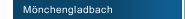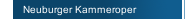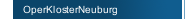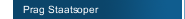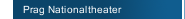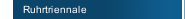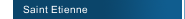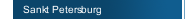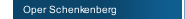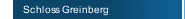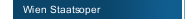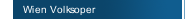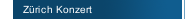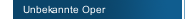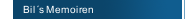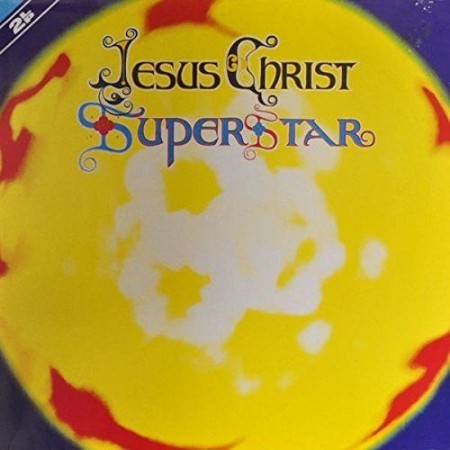http://www.wuppertaler-buehnen.de/
Richard Wagner
Tannhäuser
Premiere: 27. März 2022
In den Nullerjahren standen Corby Welch und Norbert Ernst regelmäßig als lyrischer und Spieltenor gemeinsam auf den Bühnen der Düsseldorf-Duisburger Deutschen Oper am Rhein. Mittlerweile sind beide Sänger ins Heldentenorfach vorgestoßen und singen in direkter Nachbarschaft: Corby Welch ist der Parsifal in Hagen, Norbert Ernst der Tannhäuser im 20 km westlich gelegenen Wuppertal. Dort hatte jetzt im dritten Anlauf die Inszenierung von Nuran David Calis Premiere.
Mit Calis Debüt als Opernregisseur ist dem Wuppertaler Intendanten Berthold Schneider ein beachtlicher Coup geglückt, hat Calis doch in seinen Verfilmungen gezeigt, wie man Stoffe wie „Frühlings Erwachen“ oder „Woyzek“ zeitgemäß aktualisieren kann. Bei seinem Wuppertaler „Tannhäuser“ hat er nun ein interessantes Konzept, kann dies aber nicht schlüssig umsetzen, weil ihn die Vielzahl der Ideen vor einer klaren Linie abbringt.
„Tannhäuser“ ist hier im Multikulti-Milieu der Kölner Keupstraße angesiedelt. Hier verübten 2004 die Rechtsterroristen vom NSU einen Nagelbombenanschlag, direkt um die Ecke findet man auch das Kölner Schauspiel und Pro 7 mit „Schlag den Star“. Mehr als das Multikulti interessiert sich Calis aber für die türkische Community, denn Landgraf Hermann und die Minnesänger sind hier alles Türken, die im 2. Akt bei einem Straßenfest um die Wette singen.
Tannhäuser war im 1. Akt aber im Puff der koksenden Prostituierten Venus, die sich wohl in ihn verliebt hat. Das erzürnt die engstirnige Türkengemeinde, was dazu führt, dass die brav gekleidete Elisabeth schockiert ist, und Tannhäuser zur Entsühnung zum Papst nach Rom oder vielleicht nach Mekka geschickt wird.
Logisch inszeniert Calls das alles nicht, denn bereits im 1. Akt sind die Pilgerchöre durch den Venus-Puff marschiert, wo dann auch der Iman Herman mit seiner Truppe Tannhäuser getroffen hat. Zudem fragt man sich, ob es rassistisch oder eher realistisch ist, wenn Deutschtürken so reaktionär gezeigt werden, dass ihre Sexualmoral mit der der Wartburggesellschaft des Jahres 1210 übereinstimmt? Innerhalb von Calis Konzept wäre es logischer gewesen, dass Tannhäuser eine Liebschaft mit Beate Zschäpe vom NSU angefangen hätte.
Bei großen Straßenfest des 2. Aktes werden Plakate gegen Neonazis und für „Love“ und „Freedom“ hochgehalten, die dann vom Hermann aber wegetreten werden. Der Organisator des Festes scheint von den eigenen Grundsätzen nichts zu halten! Angesicht der Blackfacing-Debatte auf deutschen Theatern („Jonny spielt auf“ am Gärtnerplatztheater) müssten politisch korrekte Aktivisten auch kritisieren, dass hier Longbearding und Blackhairing betrieben wird. Wenn Afroamerikaner auf deutschen Bühnen nicht von deutschen Sängern gespielt werden dürfen, darf eine blonde Kalifornierin dann mit schwarzer Perücke eine türkische Elisabeth singen? Und darf ein Bass aus dem niederrheinischen Geldern mit angeklebtem Bart und Gebetsmütze einen Iman spielen?
Am Premierenabend gibt es eine Vielzahl Debüts: Patrick Hahn steht als GMD erstmal im Graben der Wuppertaler Oper: In den Orchestervorspielen und in den dramatischen Höhepunkten setzt er auf einen großen sinfonischen Überwältigungsklang. Gleichzeitig gibt er den Sängerinnen und Sängern aber genügend Raum. Besonders packend dirigiert Hahn die Auseinandersetzung zwischen Elisabeth und Tannhäuser mit der Keupstraßengesellschaft im 2. Akt. Probleme gibt es manchmal, wenn die Streicher im Turbotempo ins Stolpern geraten.
Ein beachtliches, aber nicht perfektes Tannhäuser-Debüt gibt Norbert Ernst. Der Tenor konnte in den letzten Jahren besonders als Loge große Erfolge feiern und hat mittlerweile auch den Lohengrin gesungen. Die Dialogszenen und Erzählungen gestaltet Ernst sehr genau aus Text und Musik heraus. Aufhorchen lassen seine „Erbarm Dich mein“-Rufe im 2. Akt. In den Preisliedern auf Venus versucht er stimmlich aufzutrumpfen, muss dabei aber forcieren, was dazu führt, dass die Stimme gegen Ende der Oper einige Ermüdungserscheinungen zeigt. Ein Stolzing oder Parsifal würde der Stimme von Norbert Ernst wahrscheinlich besser liegen.
Über eine große raumfüllende Stimme verfügt Sopranistin Julie Adams als Elisabeth. Sehr einfühlsam und eindringlich gelingen ihr die lyrischen Szenen im 2. Akt und das Gebet im 3. Akt. Manchmal steigert sie sich aber in ein Forte, das sie in Wuppertal gar nicht benötigt, was zu einigen Schärfen in der Stimme führt. Allison Cook als Venus verfügt über eine unsinnliche Stimme, bei der die Registerbrüche unangenehm auffallen. Simon Stricker singt den Wolfram mit geschmeidigen und wohlklingendem Bariton. Guido Jentjens gefällt mit kräftigem Bass als Iman Herman.
Opernbesucher, die sich nicht mit Corona infizieren möchten, sollten einen Besuch der Wuppertaler Oper überdenken. Anfang des Jahres hat man sich hier sehr sicher gefühlt, denn zu dreifacher Impfung, Maskenpflicht und Abstandsregeln musste man sogar einen tagesaktuellen Test vorweisen. In der Altersgruppe zwischen 35 und 59 gibt es am Premierentag eine Inzidenz von 1445, aber jetzt nimmt man in Wuppertal Corona auf die leichte Schulter: Am Sitzplatz im vollbesetzten Opernhaus darf jeder Besucher die Maske abnehmen, was gut 90 % der Zuschauer auch machen. So sieht die Eigenverantwortung und der Schutz der anderen Opernbesucher in Wuppertal aus.
Rudolf Hermes, 1.3.22
Arthur Sullivan
Die Piraten von Penzance
Premiere: 9. Januar 2022
Wer die Wuppertaler Premiere von „Die Piraten von Penzance“ besuchen wollte, musste hohe Corona-Auflagen erfüllen: Eine vollständige Impfung und ein tagesaktueller Negativ-Test reichen hier nicht aus, man muss auch noch geboostert sein. Die weiteren Sicherheitsmaßnahmen sind bekannt: Die Platzierung des Publikums im Schachbrettmuster sowie Maskenpflicht auch während der Vorstellung. – Als Lohn für all die Mühen bekommt man gute Unterhaltung geboten.

Die englischen Operetten des Erfolgsduos William Gilbert und Arthur Sullivan fristen in Deutschland eher ein Schattendasein, dabei ist die Musik schwungvoll, pfiffig und abwechslungsreich. Die Geschichten sind abgedreht bis absurd. In „Die Piraten“ musste Waisenkind Frederic eine Freibeuter-Ausbildung absolvieren, weil sein Kindermädchen die „Piraten“ mit den „Privaten“ verwechselte. Die Gruppe um den Piratenkönig gehört aber zu den mildtätigen Seelen, werden Waisenkinder doch grundsätzlich verschont, weshalb sich alle ihre Opfer als solche ausgeben. Für weitere Verwirrung sorgt, dass Frederics Ausbildung bis zu seinem 21. Geburtstag dauern soll, er aber an einem 29. Februar geboren wurde.
Die Wuppertaler Oper übernimmt hier eine Produktion der Musikalischen Komödie Leipzig, die dort im Oktober 2016 Premiere hatte und von Cursch Jung inszeniert wurde. Der hat das Gespür für das richtige Tempo und den Witz dieses Stückes. Ausstatterin Beate Zoff hat ein großes drehbares Zifferblatt einer Sonnenuhr als Spielfläche entworfen, die sowohl Strand als auch Friedhof sein kann. Ihre Kostüme haben nostalgisches britisches Flair und bedienen opulent die Klischees von Piraten und Seebadmode.

Dirigent Johannes Witt entlockt der Musik viel Schwung, zeigt am Pult des Sinfonieorchesters Wuppertal aber auch, wie viel vielseitig Arthur Sullivan komponiert hat, der auch den Stil der großen Oper oder feierliche Kirchenmusik beherrscht. In seiner Musik steckt zudem viel Ironie.
Großes Lob verdient die Tatsache, dass das Ensemble, das hier durchweg aus Opernsängern besteht, nie in Stimmprotzereien verfällt, sondern durchweg auf eine maximale Textverständlichkeit abzielt. Unterstützung bekommt das Ensemble von der Tonabteilung, denn alle Akteure sind dezent per Mikroport verstärkt. Die Tontechnik gibt immer nur so viel Verstärkung dazu, dass man im Idealfall jedes Wort versteht.
Als Liebespaar Mabel und Frederic glänzen Ralitsa Ralinova und Sangmin Jeon. Beide können nicht verleugnen, dass sie im Hauptberuf auf der Opernbühne stehen, zeigen sich aber auch als spielfreudige Akteure, die zu ihren schön gefärbten Stimmen über darstellerischen Witz verfügen und wissen was sie singen. Als kauzige und klischeehafte Typen werden die anderen Figuren gezeigt: Sebastian Campione ist ein rauschbärtiger Piratenkönig, bei dem man jedes Wort versteht. Rasant singt sich Simon Stricker durch die Tongirlanden des Major General Stanley. Mit leichter Stimme singt Joslyn Rechter das Kindermädchen Ruth.

Sehr komödiantisch gelingt der Auftritt von Yisae Choi als Polizeisergeant, der tänzerische Unterstützung vom Extraballett erhält. Janet Calvert hat der flotten Bobby-Truppe eine tolle Choreografie auf den Leib geschneidert und auch die Chöre überzeugen nicht nur mit stimmlichen Einsatz, sondern auch ihrem synchronen Bewegungen in den turbulenten Tanznummern.
Schön, dass diese Produktion, die eigentlich für den Dezember 2020 geplant war, nun endlich in Wuppertal zu sehen ist. Bis Juni 2022 befinden sich „Die Piraten“ im Repertoire der Wuppertaler Bühnen.
Rudolf Hermes, 14.1.2022
Fotos: © Jens Großmann
Salvatore Sciarrino
Il Canto S´Attrista, Perché?
Premiere: 23. Oktober 2021
Besuchte Vorstellung: 24. Oktober 2021
Eigentlich ist diese „Deutsche Erstaufführung“ der neuen Oper von Salvatore Sciarrino sogar ihre Uraufführung, denn die Klagenfurter Premiere dieser Koproduktion fand am 4. Februar 2021 nur vor Pressevertretern statt. In Leverkusen wird das Stück nun erstmals vor Publikum gespielt. Erzählt wird die Geschichte der Heimkehr des Agamemnon aus dem trojanischen Krieg, die in seiner Ermordung durch seine Ehefrau Klytämnestra mündet. Haben andere Episoden aus der Atriden-Geschichte durch Christoph Willibald Glucks „Iphigenie in Aulis“ oder „Elektra“ von Richard Strauss Eingang ins Opernrepertoire gefunden, so ist diese Thematik bisher nur von Sergej Tanejew in seiner „Orestie“ (1895) und Vittorio Gnecchi in seiner „Cassandra“ (1905) auf die Bühne gebracht worden.
Die Wuppertaler Bühnen können eine beachtliche Sciarrino-Tradition vorweisen. Bereits „Luci mie traditrici“ (2002), „Infinito nero“ (2004) und „Macbetto“ (2006) wurden hier gezeigt. „La porta delle legge“ (2009) erlebte in Wuppertal sogar seine Uraufführung. Nun sollte „Il Canto S´Attrista, Perché?“ (Warum wird mein Gesang traurig?) seine deutsche Erstaufführung an der Wupper haben, aber aufgrund des Hochwassers vom Juli, ist das Opernhaus nicht bespielbar, sodass die Wuppertaler Bühnen in das mehr als 40 km entfernte liegende Leverkusen wechselten. Salvatore Sciarrino, der sich das Libretto zu seiner gut 80-minütigen Oper selbst geschrieben hat, konzentriert sich auf die Klytämnestra, Kassandra und Agamemnon. Als Nebenfiguren erleben wir noch einen Turmwächter, der auf das Signal wartet, welches das Ende des Trojanischen Krieges anzeigt, sowie einen Herold, der die Ankunft des Agamemnon ankündigt. Meist erleben wir die Figuren in großen Solo-Szenen, bei denen sie gelegentlich vom hervorragenden Wuppertaler Opernchor sekundiert werden, der auf dem Rang hinter dem Publikum platziert ist.
Der Komponist Sciarrino ist seinem Stil treu geblieben. Der Gesang besteht aus dem Wechsel von schnellen Tonrepetitionen und langgehaltenen Einzeltönen. Da sich das Ganze meist im Piano bewegt, erlebt man einen geheimnisvoll geflüsterten Gesang. Die Orchesterbegleitung besteht aus schemenhaft dahinschwirrenden Bewegungen, die oft an die Geräuschkulissen von Helmut Lachenmann erinnern. Dirigent Johannes Witt leitet die Aufführung mit feinem Gespür für Sciarrinos Klangkulisse und führt die Solisten sicher durch das Werk.
Einzelne Momente werden durch besondere Klangfarben hervorgehoben: So verkündet ein Flötentriller das Aufflammen des vom Wächters ersehnten Feuerscheins und wenn Agamemnon den Palast betritt, wird das drohende Unheil durch einen grellen Blechbläserakkord angekündigt. In großen Theatern könnte diese Flüsterstil verpuffen, im Leverkusener Erholungshaus, wird Sciarrinos Musik aber zu einer nervösen flirrenden Fieberkurve, die den Hörer an der Stuhlkannte gefangen hält.
Die Inszenierung von Nigel Lowery ist so schattenhaft wie die Musik: Der Regisseur, der auch sein eigener Ausstatter ist, lässt die Geschichte im Dämmerlicht auf schwarze Bühne vor einem schwarzen Haus spielen, das sich immer wieder dreht. Zudem sind die Figuren schwarz gekleidet und vor der Bühne befindet sich ein Portalschleier, der oft mit schattenhaften Baumprojektionen beleuchtet wird. Die grellgeschminkten Solisten werden gezielt beleuchtet, das Drumherum bleibt aber meist im nebulösen Halbdunkeln, was eine permanente Gruselatmosphäre schafft. Die Figuren verbleiben meist in Posen stehen. Eine Geste, die uns immer wieder begegnet ist eine vor Angst zitternde Hand, welche dann mit der anderen Hand des Solisten beruhigt wird.
Für diese Produktion bieten die Wuppertaler Bühnen ein beachtliches Ensemble auf, das den Eindruck vermittelt, dass Sciarrino-Partituren zum normalen Sängeralltag gehören. Mit Leichtigkeit lässt Countertenor Tobias Hechler als Wächter seine Stimme über die Töne hüpfen. Wenn Iris Marie Sojer als Klytämnestra und Simon Stricker als Agamemnon in ihren Gesangsrollen aufgehen, hat man das Gefühl das Sciarrinio seine Musik punktgenau für diese Stimmen komponiert habe. Die expressivsten Ausbrüche hat Nina Koufochchristou als Kassandra zu bewältigen. Aber auch sie meistert die anspruchsvolle Rolle mit scheinbarer Mühelosigkeit.
Dieses spannende Stück neuen Musiktheaters sollte man sich nicht entgehen lassen. Am 4. und 5. Dezember finden zwei weitere Aufführungen in Leverkusen statt.
Rudolf Hermes 16.10.21
bilderlos, leider.
LOOK BACK: 10 Jahre Umbau / Renovierung des Opernhauses
Wieder recyclter Artikel von 2011
Große Opernfreunde fehl am Platz
Über das Leiden im Allgemeinen…
Über das Leiden im Wuppertaler Opernhaus im Besonderen
Und auf dem Weg zum eigenen Licht, Komm sag, was wünschst du mir.
Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden. Und eine Hand die deine hält.
Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden. Und dass dir nie die Hoffnung fehlt.
Und dass dir deine Träume bleiben (…) Dubidubididuh… (Udo Jürgens)
Ein Opernhaus ist etwas Wunderbares. Üblicherweise bereitet es den Bürgern Freude. Soll es ja auch. Sie können stolz sein, wenn sich ihre Stadt heutzutage noch solchen Luxus leisten kann. Immerhin wird jeder Platz mit durchschnittlich mindestens 150 Euro Steuergeldern bezuschußt. Das ist erheblich mehr als das Städtische Hallenbad benötig oder alle Museen zusammen. Viele kulturinteressierte Bürger leiden darunter, daß ihre Stadt eben kein Opernhaus hat. Dieses Leiden ist jedoch nicht vergleichbar dem Leiden der Bürger in der Nachbarstadt, die zwar ein Opernhaus haben, aber nicht hingehen, weil man dort alles so schrecklich modernisiert und man die guten alten Opern einfach nicht wieder erkennt. Merke: Auch Opernverhunzung fördert Leiden. Seelisches Leiden.
Nichts von alledem in der wunderbaren Stadt Wuppertal, denn man hat ein schönes altes Opernhaus. Auch werden hier im Allgemeinen keine Opern verhunzt. Und hier wird vom artigen Publikum selbst eine mißglückte, langweilige und stellenweise wirklich dilettantische Regiearbeit (wie aktuell beim „Fliegenden Holländer“) noch lauthals, dankbar und stolz bejubelt. Auch dem bei der Holländer-Premiere wirklich indiskutabel schlecht vorbereiteten Orchester, welches klang, als habe man kaum geprobt, wird vom zahlenden Volk applaudiert. Motto: Wenn wir die Melodien noch erkennen können, kann es so schlecht nicht gewesen sein! Selbst ein einzelner Trompeter (ich konnte es prima sehen aus dem ersten Rang!) fand alles so grausig, daß er sich im dritten Akt klammheimlich für gut zwanzig Minuten aus dem Orchestergraben entfernte; wahrscheinlich hatte er in dieser Zeit auch nichts zu spielen, sonst hätte es wohl Ärger mit dem Dirigenten gegeben…
Doch zurück zum körperlichen Leiden. Hier sei mir ein kurzer Exkurs über die Baulichkeit des Wuppertaler Opernhauses erlaubt. Das gute alte traditionelle Haus, ehemals das Stadttheater Barmen, war ein Jugendstil-Prachtbau, denn damals, vor dem Zusammenschluß 1929 mit Elberfeld hatte die Stadt Barmen Wuppertal noch Geld bzw. edle und freigiebige Sponsoren - alles lief über eine Stadttheater-Aktiengesellschaft. Dieser schöne Bau wurde im Krieg 1943 leider zerstört. Die Erbauer hatten wohl die Vorstellung, daß der Mensch (Anno 1905) durchschnittlich 1,75 Meter groß und im Rücken stets preußisch steif ist. So gehörte es sich, Ausnahmen waren nicht vorgesehen. Also baute man schmale Sitze mit steilen Rücklehnen und gerade mal genug Raum für kurze Beine. 50 Jahre später, beim Wiederaufbau nach dem Krieg, würden die Planer, so durfte man annehmen, diesen Fehler erkannt haben. Aber nein. Der Neubau (1955 eröffnet) machte schon von außen wenig her und brachte von Anbeginn eine völlig mißglückte, weil Klaustrophobie erzeugende Sitzgestaltung mit. Bei der Neugestaltung 2009, also gut weitere 50 Jahre danach (in deren Rahmen mit viel Trara für teuer Geld „Sitzpatenschaften“ an zahlungswillige Spender verkauft wurden) waren wir Großgewachsenen sicher, daß man der kräftig angestiegenen Durchschnittsgröße der Menschen, also auch der Theaterbesucher Rechnung tragen würde. Selten hörte man mehr Selbstlob als bei der Neueröffnung des Wuppertaler Opernhauses. Und tatsächlich: Nach zwei Jahren erstrahlte das auf riesigen Plakaten gefeierte Gestühl - in neuen Farben. Aber auch nur in neuen Farben!
Bei näheren Hinsehen und Probesitzen kam das böse Erwachen... Denn o Graus! Statt man, wie in der Düsseldorfer Oper 2-3 Reihen entfernt hätte, um den Sitz- und Bein-Komfort der Parkettbesucher zu verbessern, hatte man sogar die letzte einigermaßen „humane“ Reihe (bisher einziges Refugium für Langbeiner – aber auch das nur auf den Außenplätzen) auf Zwergenmaß angepaßt – verschlimmbessert! Die Rücklehnen hingegen waren so steil wie eh - hatte man sie evtl. nur neu bezogen? -, die Sitze hatten das Maß für die maximale Gesäßgröße 38 behalten und die Armlehnen zwischen den Sitzen hatte man praktischerweise auf die Größe einer Zigarettenschachtel verkleinert. Vorbild Bayreuth? Von der nach einigen Wochen bereits abblätternden Farbe des Foyers und den sich in Windeseile zerlegenden Sisal-Teppichen im Eingangsbereich wollen wir liebe schweigen. Es sind ja nur Steuergelder verschwendet worden…
Was sind das bitte nur für Ignoranten, die für ein Heidengeld solchen Mist planen, genehmigen, realisieren und abnehmen? Ich vermute, daß diese gestalterischen Genies niemals selbst ein Opernhaus oder eine Kulturstätte besuchen, geschweige denn die Absicht haben, in solchen Sitzen eine Wagner-Oper anzuhören.
Da man nun im Wuppertaler Opernhaus als 2-Meter-Mensch außer auf zwei Plätzen (die ich natürlich nicht verraten werde, weil ich da selber sitze!) nirgends in körperlichem Wohlbefinden die Oper genießen kann, sollte man an der Kasse ein Schild mit folgendem Inhalt aufstellen:
Achtung! Wegen der falsch konstruierten Sitze, besonders auf dem Rang (die Lehnen dort drücken den Oberkörper nach vorne, anstatt ein entspanntes Zurücklehnen zuzulassen), und des mangelhaften Fußfreiraums zwischen den Reihen, können wir leider nur Karten an Personen verkaufen, die nicht größer als 175 Zentimeter sind. Wir bitten um Verständnis und müssen uns dahingehend vor Schadenersatzforderungen schützen. Wenn Sie sich darüber ärgern, dann verprügeln Sie bitte den Bauherrn, den Architekten, den Designer, der für diesen baulichen Unsinn verantwortlich ist bzw. die Stadtverordneten, die verantwortlichen Ignoranten im Bauamt und den Intendanten, der so etwas genehmigt hat. (Letzterer hat sich übrigens unmittelbar nach der Tat der Bestrafung durch die Pensionierung entzogen.)
Im Wuppertaler Opernhaus werden großgewachsene Menschen ständig diskriminiert und mißhandelt. Oder wie würden Sie zweieinhalb Stunden Sitzfolter nennen? Für mich ein Fall für die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wuppertal.
Nebenbei: so lockt man keine Besucher aus anderen Städten an und so vertreibt man lokale Opernfreunde nach Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen oder Dortmund (wobei auch dort nur das Parkett genießbar ist). Unter uns: Wenn also der Rezensent geschlagene zweieinhalb Stunden dermaßen leiden muß, konzentriert darauf seinen Schmerz nicht zu artikulieren, was soll da noch für eine Kritik rauskommen? Deswegen schreibe ich jetzt auch nichts mehr über diese grausige Produktion.
Peter Bilsing 3.3.2021 / 2011
PS
Leidenschaft für Oper - so ist unser Leitmotiv. Mit Leiden an sich, hat das aber nicht direkt zu tun. Doch täglich werden wir eines besseren belehrt. Auch in Coronazeiten vor dem TV beim Betrachten mancher Streams. Immerhin sitzen wir aber dabei zuhause gemütlich im Ohrensessel. Da ist Vieles erträglicher...
DIE ZAUBERFLÖTE
15.09.20
Glänzende Spielzeiteröffnung der Oper Wuppertal
Ob die Met in New York in der kommenden Spielzeit überhaupt mal spielt, ist bisher völlig unklar. Die Oper Wuppertal dagegen eröffnete die neue Spielzeit am Sonntag glanzvoll. Immer wieder erstaunt es, wie nach mehr als 200 Jahren die „Zauberflöte“ mit ihren Unwahrscheinlichkeiten und Späßen noch und wieder fasziniert. Und die Aktualität dieses märchenhaften und verwirrenden Streits zwischen Gut und Böse mit dem aufklärerisch-freimaurerischen Zweifel an diesen bleibt ungebrochen.

Die Burger Queen der Nacht - Nina Koufochristou
Wie jeder Intendant immer auf der Suche nach guten Stücken, konnte Emanuel Schikaneder für sein bekanntes Volkstheater auf der Wieden in Wien Mozart für eine Oper über das Märchen von der Zauberflöte leicht gewinnen.
Die Handlung in Kürze: Die wunderschöne Pamina (Ralitsa Ralinova) wurde auf Befehl der Götter von Sarastro (Sebastian Campione) entführt, um sie vor schlimmen Einflüssen ihrer Mutter, der Königin der Nacht (Nina Koufochristou), zu bewahren. Prinz Tamino (Sangmin Jeon), orientierungslos verirrt, wird gerade noch von drei Damen (Palesa Malieloa / Elena Puszta, Iris Marie Sojer, Joslyn Rechter) auf Veranlassung der Königin gerettet. Sie beauftragt den Prinzen, ihr die Tochter wiederzubringen, stattet ihn mit goldener Zauberflöte und seinen Begleiter Papageno mit silbernem Zauberglockenspiel aus. Der Prinz, durch die Macht ihres Bildes Liebe fühlend und sängerisch hoch motiviert, findet sie, geleitet von drei Genien (Knabensolisten der Wuppertaler Kurrende), im Palast des Entführers und Sonnenpriesters Sarastro, wo sie der schreckliche Monostatos (Mark Bowman-Hester) bewacht und ihr nachstellt. Als Papageno, der spielerisch wie sängerisch glänzende Simon Stricker, in seinem Federkleid vor ihm auftaucht, hält Monostatos ihn für den Leibhaftigen persönlich und sucht das Weite. Von Papageno (Simon Stricker) erfährt Pamina, daß und wie sehr Tamino sie liebt. Der irrt aber erst mal zwischen den Tempeln der Natur, Vernunft und Weisheit umher, bis er, Zauber flötend, Papageno und Pamina endlich findet. Sarastro verzeiht alles, prüft aber den Ehekandidaten doch auf Tauglichkeit. Partnerwahl ist immer schwierig. Tamino schreckt erwartungsgemäß vor nichts zurück und läßt sich, standhaft, duldsam und verschwiegen, von den drei inzwischen intrigant gewordenen Damen auch nicht durcheinanderbringen. Alles kommt trotz rachsüchtiger Königin der Nacht und ihrer Arie und trotz des geilen Monostatos zu einem glücklichen Ende. Selbst Papageno und Papagena (Anne Martha Schuitemaker) finden sich.

Sarastro (Sebastian Campione)
Was macht Regisseur Bernd Mottl aus diesem Zaubermärchen des 18. Jahrhunderts. Wegen der Epidemie muß im Barmer Opernhaus die große Revue, kaum gekürzt, jedoch mit halbiertem Ensemble (nur 40 statt 80 Mitwirkende auf der Bühne) und auch verkleinertem Orchester aufgeführt werden, wobei bei der Uraufführung 1791 auch nur 35 Musiker im Orchestergraben saßen. Diese „Zauberflöte“ findet nicht in märchenhaftem Zauberwald statt. Noch vor der Ouvertüre desinfizieren zwei Putzfrauen mit großen Schrubbern die leere Bühne. Während der Ouvertüre taucht aus der Tiefe eine große blaue Erdkugel auf, wächst und wächst, bis endlich mit Google Earth auf Europa, auf Deutschland, im Endeffekt auf die Barmer Oper gezoomt wird. Aus deren Eingang stürzen die drei munteren Damen, das Gefolge der Königin der Nacht, finden einen Imbißwagen, schieben ihn vors Rathaus - und die Ouvertüre ist vorbei. Tamino verirrt sich unter der Schwebebahn, die zwar aktuell mal wieder (fast) nicht fährt, aber als Theaterkulisse immerhin zu gebrauchen ist. Die Königin der Nacht erscheint überraschend mit kleinem Blitz und Donner in abgeschabtem Allerweltskostüm, sitzt als Burger Queen an einem Giftfaß, trinkt, raucht und singt blitzsauber wie brillant. Seit Wochen hat Jörn Hartmann, Filmemacher aus Berlin, mit den Sängern und Sängerinnen kleine Filme gedreht. Diese Filme projiziert Friedrich Eggert groß auf das gesamte Bühnenportal und kombiniert sie mit Kostümen und Zitaten aus Schinkels berühmtem Bühnenbild von 1816 mit ägyptischen Säulen. Die riesigen Projektionen, die dagegen nahezu puppenspielerisch kleinen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und deren noch kleinere Schatten auf dem Gaze-Vorhang bieten der Handlung verschiedene aufregende Ebenen. So werden Bundesbahndirektion, Hauptbahnhof und Landgericht mit ihren ehrwürdigen Fassaden zu Tempeln der Weisheit und Vernunft. Filmemacher und Bühnenbildner arbeiten nicht zum ersten Mal mit dem Regisseur zusammen.

„Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ - Die drei Damen vom Grill ( Elena Puszta, Joslyn Rechter, Iris Marie Sojer) und Tamino (Sangmin Jeon)
Und die Musik? „Ohne Musik wäre alles nichts“ meinte schon Mozart. Alles was Oper ausmacht, wird hier geboten: einfache Lieder im Volkston, ergreifende Lyrik bei Pamina und Tamino, große Fuge, ernster Adagio-Choral, Priesterchöre, höchste Dramatik (Koloratur-Arie der Königin der Nacht), und anderes mehr. George Petrou, erfahren in Alter Musik, gastierte an den großen Opernhäusern Europas wie z.B. Leipzig oder Lyon oder bei den Salzburger Festspielen und musiziert mit dem Wuppertaler Sinfonieorchester und dem Opernchor den ganzen Abend konzentriert, agil, elastisch, temperament- und schwungvoll, wobei die Chöre, Corona geschuldet, teilweise vom Rang und elektronisch verstärkt aus dem Off der Bühne singen. Sarastro, der sich zähneputzend im Bad seiner Wuppertaler Wohnung auf die Arbeit in der Oper vorbereitet, und Monostatos profitieren stimmlich von dem kleinen Orchester, an dessen zarten Klang (ohne Posaune!) man sich bald gewöhnt. Nicht nur die Stadt, auch das ganze Opernhaus wird dank der Filme in die Handlung mit einbezogen. Wie im Thriller sucht Pamina im Heizungskeller und Treppenhäusern ihre Mutter, die Königin der Nacht, die, endlich auf dem Imbißwagen stehend, ihre berühmte Arie so makellos wie virtuos abliefert. Immer wieder brandet Sonderapplaus auf, vor allem für Papageno, der auf buntem Fahrrad durch die Stadt und über die Bühne radelt oder seinen köstlichen Phantasie-Tukan auf dem Arm liebkost. Sonderapplaus vor allem auch für Paminas ergreifende Arie („Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden“), in der sie ihre Enttäuschung über den sie scheinbar verschmähenden Tamino zu bewältigen versucht. Ein musikalischer Höhepunkt. Wunderbar singen die drei Knabensolisten aus der Wuppertaler Kurrende. Immerhin retten sie Leben, wo sie nur können. Endlich bestehen Pamina, inzwischen in Straßenkleidung, und Tamino im Maul eines riesigen fantastischen Ungeheuers ihre Prüfungen, begleitet von Flöte und leiser Pauke, das Ganze in einem der wenigen echten Adagios der Oper. Zuletzt kommt Papageno mit der auch stimmlich sehr ansprechenden Papagena zusammen. Das Gefolge der Königin der Nacht versinkt unter Theaterdonner in ewiger Nacht. Starker Applaus, Bravi und Bravissimi, zahlreiche Vorhänge für das gesamte Ensemble vom begeisterten, maskierten Publikum im unter Coronabedingungen ausverkauften Haus. Tatsächlich bietet diese frische Zauberflöte in Wuppertal bei geistvoller und witziger Inszenierung Vernunft in schwierigen Zeiten, Tugend, Liebe, Gerechtigkeit und vor allem riesiges Vergnügen.

„In diesen heiligen Hallen“
Die Oper Wuppertal lädt auch Besucher ein, die sie nicht regelmäßig besuchen. „Share Your Opera: Das andere Opernerlebnis. The enhanced experience. La nuova esperienza lirica. Operaya Yeni Bir Bakış“. Ab 26.09. 2020 kann „Die Zauberflöte“ auch anders erlebt werden: Bei „Share Your Opera‹ – Das andere Opernerlebnis“, führen App und Smartphone durch die Oper, erläutern die Handlung, erleichtern das Verständnis des Werkes und in der Pause gibt es sogar ein Freigetränk. Nix wie hin!.
Johannes Vesper, 15.9.2020
Fotos © Jens Grossmann
Besonderer Dank an unsere Freunde von den Musenblättern Wuppertal

„Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ - Ein Höllenquartett mit Elena Puszta, Joslyn Rechter, Iris Marie Sojer und der Königin der Nacht (Nina Koufochristou) am hellen Tage vor dem Finanzamt Wuppertal-Barmen - Foto © Jörn Hartmann
credits
Musikalische Leitung: George Petrou – Inszenierung: Bernd Mottl - Bühne und Kostüme: Friedrich Eggert – Video: Jörn Hartmann – Dramaturgie: Sina Dotzert – Choreinstudierung: Markus Baisch – Studienleitung: Michael Cook - Musikalische Einstudierung: Koji Ishizaka, William Shaw – Regieassistenz: Lucy Martens, Lotte Zuther – Abendspielleitung: Karin Kotzbauer-Bode, Lotte Zuther - Produktionsleitung, Kostüme und Bühne: Luisa Pahlke – Inspizienz: Lauren Schubbe – Licht: Henning Priemer - Leitung Ton & Video: Thomas Dickmeis - Leitung Maske: Markus Moser.
Besetzung: Sarastro: Sebastian Campione (Baß) – Tamino: Sangmin Jeon (Tenor) - Sprecher / 2. Priester / 2. Geharnischter: Timothy Edlin*/ Philipp Kranjc* (Baß) - 1. Priester / 1. Geharnischter: Adam Temple-Smith* (Tenor) - Königin Der Nacht: Nina Koufochristou (Sopran) – Pamina: Ralitsa Ralinova (Sopran) - 1. Dame Palesa Malieloa* / Elena Puszta (Sopran) - 2. Dame Iris Marie Sojer (Mezzospran) - 3. Dame Joslyn Rechter (Mezzosopran) – Papageno: Simon Stricker (Bariton) – Papagena: Anne Martha Schuitemaker (Sopran) – Monostatos: Mark Bowman-Hester (Tenor) - 3 Knaben: Tim Bielfeldt, Hugo Kley, Julian Brandt, Bavo Oliver, Ilias Beckerhoff, Pablo Salti, Maxem Kowalke, David Matthes**
(*Mitglied des Opernstudio NRW - **Knabensolisten der Wuppertaler Kurrende - Opernchor der Wuppertaler Bühnen, Statisterie der Wuppertaler Bühnen, Sinfonieorchester Wuppertal
DER LIEBESTRANK
ROSA ELEFANTEN, VERFÜHRUNG UND EIN LIEBESTRANK
Bericht der Premiere 22.2.2020
Gaetano Donizettis Oper L’elisir d’amore hatte am 22. Februar seine Premiere in Wuppertal. Wer eine klassisch inszenierte Opera buffa erwartet, der wird zunächst irritiert sein. Die Besucher erleben eine farbenfrohe, moderne Überraschung mit viel Lokalkolorit. Stephan Prattes (zuständig für Regie und Bühnenbild), der hier sein Debüt als Opernregisseur gibt, hat sich durch Originale, berühmte Personen, Begebenheiten und Sehenswürdigkeiten aus Wuppertal inspirieren lassen und so eine frische, moderne Inszenierung auf die Bühne gebracht. Der Schwerpunkt wird auf die Verführung gelegt, was ja vielfältig ausgelegt werden kann und wird. SEDUZIONE (die Verführung) steht dann auch in großen Lettern über der Handlung. Bereits während der Ouvertüre wird der Begriff Seduzione mit einer Erklärung seiner Bedeutung via Laufband auf den eisernen Vorhang projiziert. Verführung gibt es überall, in der heutigen Zeit wird Mensch verführt und dadurch manipuliert durch Medien, so spielt auch das Handy hier eine große Rolle. Nemorino hantiert während der gesamten Oper immer wieder damit herum, liest begierig das, was er dort findet, nimmt sogar die Anleitung, wie der Liebestrank anzuwenden ist, in einem Video auf.

Die Geschichte ist die des einfachen, mittellosen, jungen Mannes Nemorino, der unsterblich verliebt ist in die reiche und gebildete Adina, die nichts von ihm wissen will. Sie liest den anwesenden Dorfbewohnern die Geschichte von Tristan und Isolde vor, in der Tristan durch einen Liebestrank Isolde ewig lieben soll. Als der sehr von sich überzeugte Sergeant Belcore auftaucht, der Adina ebenfalls heiraten will, bittet sie sich jedoch Bedenkzeit aus. Nemorino verzweifelt und gibt sein letztes Geld dem soeben eingetroffenen Quacksalber und Scharlatan Dulcamara um einen Liebestrank bei ihm zu kaufen. Dulcamara verspricht jedem alles und verkauft in erster Linie Illusionen. Der Placeboeffekt ist sein Erfolgsrezept. Da sich die Ereignisse überschlagen und der Trank nicht schnell genug wirkt, verdingt er sich beim Militär um von dem Handgeld eine weitere Flasche des Wunderelixiers zu kaufen. Adina kauft ihn frei und bittet ihn zu bleiben. Inzwischen wissen alle, außer Nemorino selbst, daß er er geerbt hat und nun ein reicher Mann ist. Wie es in einer komischen Oper eben so ist, es wird sich geziert, es wird getrotzt, aber am Schluß kriegen alle, was sie wollen, so auch Nemorino seine Adina, die nun doch erkennt, dass sie ihn liebt.
Der Chor verkörpert einerseits die Gruppe Mensch als Gesamtheit, andererseits aber auch, dass sich diese Gruppe aus sehr verschiedenen Charakteren, Religionen und Diversitäten zusammensetzt. So findet sich ein Reigen, der sich vom Biedermeier bis zur Jetztzeit zieht. Beispielweise steht neben Friedrich Engels so ganz normal der Arbeiter von Vorwerk mit seinem Staubsauger, die Muslima neben der Nonne, Else Lasker-Schüler neben einer flippigen Frau aus dem Heute. (Kostüme: Heike Seidler)
Die Wandlung und Reifung der Figuren Adina und Nemorino zeigt sich auch in der Kleidung. Beide sind zu Beginn eher kindlich gekleidet, er in kurzen Hosen, sie in einem Kleidchen, welches zwar elegant schwarz, aber doch sehr kindhaft wirkt. Im Verlauf der Handlung wandelt sich das und beide erscheinen als modern gekleidete, junge, sich liebende Menschen. Ralitsa Ralinova hier einmal von einer nicht so temperamentvollen, sondern mehr gefühlvollen Seite, Sangmin Jeon als unglücklich Verliebter, ein wunderbar harmonierendes Duo, sowohl gesanglich, als auch darstellerisch.

Der „Liebestrank“, den Dulcamara verkauft, ist nichts anderes als eine Flasche Rotwein, hier nimmt Dulcamara für eine Münze diese Flasche einem Obdachlosen ab, der am Rand sitzt und gibt sie als Wundermittel an Nemorino weiter. Dulcamaras Erscheinen wird angekündigt durch etwas, was von oben wie ein Ufo herabschwebt, sich dann als eine Reihe Handys entpuppt. Im Hintergrund der ansonsten grünen Bühne ist nun ein überdimensionales Handy zu sehen, auf welchem Dulcamara werbewirksam gezeigt wird. So tritt er auch auf als eine Person, die an eine Mischung aus Astroshow und einem bekannten Modeschöpfer eines TV-Verkaufskanals erinnert. Er tänzelt affektiert und von sich selbst überzeugt über die Bühne, Sebastian Campione kann hier wieder einmal nicht nur gesanglich punkten.
Simon Stricker, ein fabelhaft besetzter Belcore, ist wie Dulcamara ein selbstgefälliger Mann, er erwartet, daß Adina seine Avancen sofort akzeptiert. Er schenkt ihr einen rosa Plüschelefanten. Auch hier wieder eine Assoziation zu Wuppertal, Tuffi dürfte über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sein. Im Zusammenhang mit seinen Soldaten wirkt das Militär wie eine Mischung aus Pappkameraden, ( es kamen tatsächlich etliche Schiessbudenfiguren von oben herab) etwas Disziplin und viel Trottelhaftigkeit. Die Uniformen im Prilblümchenlook taten ein übriges diese Instanz nicht ernst nehmen zu können. Wäre es doch im realen Leben auch so.
Giannetta, die Vertraute und Freundin Adinas, entspricht dem typischen Sekretärinnenklischee: Brille, enges Kostüm, Heels… Wendy Krikken, die dem Opernstudio NRW angehört, ist die Einzige, die nicht zum festen Ensemble gehört. Schön, wenn junge Menschen die Chance bekommen, hier Erfahrungen zu sammeln und ihr Können vor großem Publikum zu präsentieren.

Der rosa Elefant zieht sich denn auch durch den ganzen Abend, vom Plüschtier und einem überdimensionalen, aufblasbaren Elefant, bis zu einer Patrouille von rosa Elefanten., (War die Assoziation Dschungelbuch hier Absicht?) Die Farbe rosa steht ja für eine vernebelte Sichtweise = durch die rosa Brille sehen. Hier vernebeln rosa Elefanten den Blick, Kitsch und Niedlichkeit dominieren.
Warum nun die Kunde vom dem Erbe, welches Nemorino gemacht hat, sich ausgerechnet in einem Yogastudio wie ein Lauffeuer verbreitet, erschließt sich nicht wirklich, war aber witzig. Vielleicht, weil in früheren Filmen ja immer der Friseursalon der Ort war, wo sich solche Nachrichten verbreiteten. Yoga ist in und auch in Wuppertal gibt es etliche Studios. Einen Chor auf der Matte sieht man jedenfalls nicht jeden Tag.
Ob nun das Una furtiva lagrima von Sangmin Jeon, das Io son ricco et tu sei bella von Raltisa Ralinova und Sebastian Campione, es wäre nicht fair, eine Einzelleistung hervorzuheben, denn ausnahmslos alle Mitwirkenden boten einen Ohrenschmaus und wurden begeistert beklatscht.
Auch der Opernchor (Markus Baisch, Chorleitung), die Statisterie der Oper und das Sinfonieorchester Wuppertal erfüllten wieder einmal alle Erwartungen. Der musikalische Leiter des Abends, Johannes Pell, führte seine Musiker*innen und die auf der Bühne agierenden Künstler*innen mit gewohnt viel Engagement und Empathie durch Donizettis melodienreiche Partitur.
Es war ein großartiger Abend, der, neben Bravos, verdient viel und langanhaltenden Applaus bekam. Unverständlich und schade, dass einige wenige die Vorstellung bereits in der Pause verliessen. Ebenso bedauerlich, dass es keine ausverkaufte Vorstellung war, die Leistung hätte es mehr als verdient.
P.S.
Bedanken möchte ich mich dafür, dass es vor Beginn der Vorstellung eine Ansprache gab mit der Bitte, den Opfern von Hanau in einer Schweigeminute zu gedenken. Nirgendwo ist die Vielfalt so groß wie am Theater, es finden sich auf kleinem Raum so viele Nationalitäten, Hautfarben, Religionen und Geschlechter zusammen und alle leben und arbeiten miteinander. Ein schönes Beispiel und Vorbild für uns Alle.
Rene Isaak Laube, 29.2.2020
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
Fotos @ Björn Hickmann
CHAOSMOS
08.02.2020
Logistik-Oper von Marc Sinan (Komposition), Tobias Rausch (Idee und Texte) und Konrad Kästner (Video)
TRAILER

Gabelstapleroper. Work in Progress. Aleatorische Musik. Es braucht nur ein paar Schlüsselbegriffe, und schon hat keiner mehr Lust hinzufahren. Und so fiehl mir, als relativer Redaktionsneuling, die ehrenvolle Aufgabe zu, einen Bericht über eine Aufführung zu schreiben, die sonst keiner sehen wollte.
Terminlich passte nur die 3. und letzte Aufführung. Aber da die Musik zu jeder Aufführung unter tätiger Mitarbeit des Publikums neu zusammen gewürfelt wird, kann man es auch als C-Premiere bezeichnen. Wer als Rezensent über eine Folgeveranstaltung berichtet, kann im Vorfeld schon einmal einen Blick darauf werfen, mit welchen Eindrücken die Kollegen das Stück und die Aufführung wahrgenommen haben. Und so fanden sich denn auch im Internet einige Kritiken, die den Handlungsablauf des Abends und die Inhalte der drei thematischen Exkursionen sehr akribisch und dezidiert beschreiben. Als Leitfaden zum Verständnis dieses NOpera-Projektes sicherlich hilfreich, fällt bei allen Texten jedoch das Fehlen von Wertungen auf, die den emotionalen Gesamteindruck des die Oper verlassenden Besuchers beschreibt. Man hat sich wohl nicht getraut?

Daher bin ich sehr glücklich, selbst als Kritiker einer C-Premiere, noch etwas Neues zur Rezeption dieses Stückes beitragen zu können: Der Abend ist wirklich grossartig!
Gerne hätte ich zur Verdeutlichung der dahinter stehenden emotionalen Kraft den letzten Satz in Dauergrossbuchstaben geschrieben. Aber die Verwendung von DAUERGROSSBUCHSTABEN ist - sofern nicht wichtige Gründe dafür vorliegen - in meiner Redaktion nicht erlaubt. Nur deswegen habe ich es gelassen. Sonst hätte ich es getan!
Die Einhaltung von Regeln ist wichtig. Ordnung ist das halbe Leben. CHAOSMOS wird im klassischen Format „Theater hinter dem Vorhang“ auf der Bühne gespielt, wobei die Zuschauer auf U-förmig angeordneten Stuhlreihen ebenfalls im Bühnenraum sitzen. Aus dem Foyer werden die Zuschauer durch die Brandschutzschleuse zwischen Vorder- und Bühnenhaus auf die Bühne geführt. Ein Ehepaar, das altersmäßig nach dem Abi 1968 in der Provinz zum Studium nach Berlin in eine linksintellektuelle Kommume gezogen sein könnte, wird wegen eines Glases Wein und einer Brezel, die jeder der Beiden mit sich führt, nicht auf die Bühne durchgelassen.

Das ginge ja nun gar nicht. Speisen und Getränke dürften keinesfalls mit auf die Bühne gebracht werden. „Hier fängt das Chaos ja schon an!“, schimpfte der Herr erbost. Ein experimentelles Opernprojekt hatte er sich offensichtlich anders vorgestellt. Und seinerzeit hatten sie sich in Berlin sicherlich noch ganz andere Freiheiten heraus genommen. Aber die 68-er sind vorbei. Wir haben 2020 in Deutschland. In Wuppertal, um genau zu sein. Aber es könnte auch an jedem anderen Ort in Deutschland sein. Halle oder Bremen, beispielsweise. Und außerdem irrte der Herr. Mit Betreten der Bühne fing nicht das Chaos an, sondern es beginnt die Ordnung.
Wir befinden uns in einem Logistikzentrum. Jedem Zuschauer war beim Betreten ein- oder mehrere Mappen mit Notenmaterial in die Hände gedrückt worden, die er - so war die Handlungsanweisung zur A-Premiere - irgendwo in den in der Bühnenmitte stehenden Regalen einordnen sollte. Das war der aleatorische Teil des Publikums, das damit dem Verlauf des Abends und seiner musikalischen Gestaltung eine eigene Prägung gab. Dieses ursprünglich gewählte Verfahren hätten sich jedoch als undurchführbar erwiesen, erfuhren wir in der Einführungsveranstaltung, da man nicht jedem Musiker jede Art von Noten habe vorlegen können. Wenn der Pianist auch in der Lage gewesen sei, den Part der Flöte zu übernehmen, sei die Flöte natürlich mit den Klaviernoten völlig überfordert gewesen. Work in Progress. Deswegen musste das Publikum nun streng darauf achten, dass die Noten für die verschiedenen Instrumentengruppen auch in die Fächer für die entsprechenden Instrumentengruppen einsortiert wurden. Dazu mussten Buchstabengruppen auf den Mappenrückseiten mit den Buchstabengruppen der Regalfächer in Einklang gebracht werden. Logistik ist mühselig.

Ein Chor von als Robotern gekleideten Sängern übernimmt die Aufgabe, Blatt für Blatt zu sortieren. Ein Gitarrist spielt schon einmal irgend etwas. Die Roboter singen schon einmal irgend etwas. Eine unangenehme Länge im Handlungsverlauf des Abends macht sich breit.
Die über Rutschen eintreffenden Pakete werden vom „Stower“ in die Regale eingeräumt. Der Stower scannt den Artikel und das Regalfach ein. Das IT-System erkennt dann, wo der Artikel zu finden ist. Ein "Picker" ist der Mitarbeiter, der die eingehenden Bestellungen einsammeln. Dabei ist er der Erfüllungsgehilfen seines Scanners: Dieser zeigt ihm das Regalfach an, das er als nächstes ansteuern muss.
Die beiden Sprechrollen von Jay und Joe stellen Menschen da, die abwechselnd als Picker und Stower arbeiten. Sie scheinen das Logistikzentrum schon lange nicht mehr verlassen zu haben. Vielleicht waren sie ja überhaupt noch nie draußen. Picken und Stowen. Stowen und Picken als Lebensinhalt.
Wir erfahren sehr viel über Ordnungsprinzipien. Löffel zu Löffel, Gabel zu Gabel. Aber wir erfahren besonders etwas über neue, moderne Ordnungsprinzipien. Die „Chaotische Lagerung“ ist ein Verfahren, wie es z.B. von Amazon genutzt wird. Der Stower stellt die Kartons irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Einzig darauf hat er zu achten, dass kein Zweites der gleichen Art im selben Fach liegt. Die Einzigartigkeit des Objektes im Fach sorgt dafür, dass der Picker in der Lage ist, fehlerfrei und zügig das Bestellte zu finden. Der Begriff der „Einzigartigkeit“ scheint in diametralem Gegensatz zu unseren bisher erworbenen Ordnungsvorstellungen zu stehen. Wir horchen auf. Picken und Stowen. Ein Gabelstabler transportiert weitere Kisten. Doch das reibungslos funktionierende System weist Schwächen auf. Dreimal erleben wir, dass Kisten vom Stapler stürzen.

Die aus den Kartons herausquellenden Inhalte erzählt uns verschiedene Geschichten. Da geht es einmal um Carl von Linné, der sich als Erfinder einer binären Natur-Systematik große Verdienste erworben hat. Klasse, Ordnung, Art, Gattung und Varietät sind wichtige Schlüsselbegriffe des Systems, wie es auch die Zuordnung zu einem männlichen oder weiblichen Geschlecht braucht, die Dinge zu scheiden und die Fortpflanzung zu erklären. Animierte Projektionen und Texteinblendungen veranschaulichen die vorgetragenen Inhalte eindrücklich. Die Regeln werden erklärt, doch immer wieder stören Ausnahmeerscheinungen das doch so klar erscheinende Ordnungsschema: Autosexualität, Homosexualität, Intersexualität, Transsexualität und Non-Binarität. Es scheint fast mehr Ausnahmen als Regelmäßigkeiten zu geben. Eine sehr junge Zuschauerin starrt mit roten Ohren auf die eingespielten Filmsequenzen. Wurde hier mal über eine Altersfreigabe nachgedacht?
Eine zweite Geschichte führt uns in die Kolonialzeit, in der Versuche unternommen wurden, den den Europäern unbekannte Kontinent Afrika zu ordnen und den europäischen Herrschaftsräumen einzuverleiben. Die Unmöglichkeit eines solchen Projektes in einem Kontinent, in dem ein Großteil der Bevölkerung nomadisch lebt, beschriebene Bergketten gar nicht existieren und sich Quellen und Flussverläufe täglich ändern können, führte dazu, dass bis heute die Grenzen der ehemaligen Kolonien unlogisch verlaufen und immer noch oft der Grund für ethnische Konflikte sind.
Der dritte Exkurs beschäftigt sich mit einer Erfindung, die die Ära der Globalisierung und weltweiten Logistik erst möglich gemacht hat: Der Seecontainer. Weltumspannende Ereignisse werden am Beispiel eines individuellen Schicksals erlebbar gemacht.

Die Abläufe des Logistikzentrums zerfallen zunehmend chaotisch. Pakete überfluten die Rutschen und die Bühne. Der Gabelstapler gerät außer Kontrolle. Während Joe versucht, alte Ordnungen wieder herzustellen, ist Jay bereits auf der Suche nach höheren Ordnungen: Ihm ist auf seinen regelwidrigen Ausflügen aufgefallen, dass er den Warenausgang nicht finden kann. Und einen Wareneingang auch nicht. Wird hier gar nichts verschickt? Picken und stowen die Beiden immer nur eine unüberschaubar große Zahl an Paketen, die sich alle in einem ewigen Kreislauf des Systems befinden? Wenn aber nichts reinkommt und auch nichts rauskommt: Wo ist denn dann der Sinn des ganzen Systems? Die Frage eines sinnstiftenden Gottes als Hüter des Systems „Welt“ wird hier nicht angesprochen, ist jedoch assoziativ zum Greifen nahe. Die Oper mit den vielen Kartons wagt sich an die ganz großen Fragen. Jay ist auf der Suche nach dem Masterplan, von dem der Sinn dieser ganzen Strukturen abzuleiten ist. Die Handlung, die zu Beginn noch etwas langsam in Bewegung gekommen ist, nimmt immer mehr an Tempo auf und überschüttet den Zuschauer mit Bildern und Assoziationen. Ein Feuerwerk emotionsweckender Aussagen wirkt auf den Betrachter.
Über den Bruch mit den Regeln finden Joe und Jay ihren Weg.
Übrigens gibt es dieses „Dänemark“ doch! Ich bin sogar schon dort gewesen.
Aber diese Sätze verstehen jetzt nur diejenigen, die das Stück gesehen haben. In Wuppertal sind keine weiteren Aufführungen geplant, aber in Halle und Bremen wird das Stück in den kommenden Spielzeiten wieder aufgeführt. Also: GEHT HIN! DER ABEND IST WIRKLICH GROSSARTIG!
Bilder (c) Jens Großmann
Ingo Hamacher 9-2-2020

Premiere Uraufführung am 11. Januar 2020
Eine Logistikoper
Mit der Uraufführung Chaosmos startet der erste Teil einer Programmreihe, die in Form einer Kooperation durch den Fonds Experimentelles Musiktheater (feXm) gefördert wird. Hierbei werden in gemeinsamer Trägerschaft von NRW KULTURsekretariat und Kunststiftung NRW die Oper Wuppertal, die Oper Halle und das Theater Bremen jeweils ein Werk entwickeln, welches in einer ortsspezifisch weiter erarbeiteten Form auch an den beiden anderen Häusern gezeigt werden wird. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auf drei Spielzeiten Bei diesem Projekt werden Teams und nicht einzelne Komponisten gefördert, wodurch man eine Tür für vollkommen unbekanntes und so noch nicht erlebtes Musiktheater öffnen möchte. Die Auswahl der Projekte erfolgt über ein Ausschreibungs- und Auswahlverfahren durch eine Fachjury.
Wie eine Logistikoper es erahnen läßt, spielt Chaosmos in einem Logistikcenter, man fühlt sich versetzt in das Hochlager eines bekannten Internethandels oder die Regalgänge eines schwedischen Möbelhauses. Das Publikum sitzt auf der Bestuhlung eines Stadions an drei Seiten mit auf der Bühne. Auf der vierten Seite ist eine Leinwand und die wenigen Musiker*innen sind auf verschiedenen Ebenen untergebracht. Eine kalte, grelle, laute, unmenschliche Atmosphäre, unterstrichen durch Androiden im Blaumann. Bevor die Besucher*innen ihre Plätze einnehmen, werden sie interaktiv in die Gestaltung des Abends eingebunden, sie erhalten beim betreten eine Mappe mit Noten, die sie in ein Regal sortieren müssen. So entsteht jeden Abend eine neue Ordnung/Unordnung, es werden Arien, Geschichten, Szenen und Videoeinspielungen ständig neu kombiniert. Sichergestellt ist lediglich die Zuordnung zu den jeweiligen Instrumentengruppen.
Thematisch geht es um das Zusammenspiel von Ordnung und Unordnung, nichts kann ohne das andere sein, der Mensch hat eine eigene Vorstellung von Ordnung und den Zwang eine bestehende Ordnung zu zerstören. Hier vertreten durch Jay und Joe, die unermüdlich mit einem Gabelstapler Kisten hin und her fahren. Es gibt somit eine*n Picker*in zum abholen der Waren und ein*n Stower*in, zum bestücken der Regale. Als das System nicht mehr funktioniert und alles unkontrollierbar wird, versuchen die Beiden sich dagegen aufzubäumen, wobei sie auch den Kampf mit einer fleischfressenden Riesenpflanze und einem Androiden nicht scheuen.
Zum guten Schluß, als das gesamte Logistikcenter in Trümmern lag, endete der Abend mit einer Überraschung. Die Musiker*innen spielten ein Stück von Bach, der sich mit seinen strukturierten Kompositionen an Mathematik und Logik orientiert, womit eine Ordnung wieder hergestellt schien.
Das Prinzip der binären Ordnung ( die Natur ist demnach männlich und weiblich) des Naturforschers Carl von Linné, trifft auf den Vietnamkrieg und das damit verbundene Chaos, sowie auch auf die Anfänge der Hochseecontainerschiffe. In den Videoeinspielungen wurden bei Linné alte Tintenzeichnungen zu „Zeichentrickfilmchen“ verändert, die zum Teil erotischer Natur waren und vielleicht nicht unbedingt als kindertauglich betrachtet werden können.
Auch die Vermessung der Welt und die Kolonialisierung ist ein Teil dieser Oper. Wer ohne Kenntnis von geografischen Gegebenheiten und der sich dadurch als notwendig erwiesenen Lebensgewohnheiten der Bewohner, Grenzen zieht, andere ohne Rücksicht auf Verluste unterjocht, kann letztendlich nur Chaos hinterlassen.
Der Vietnamkrieg war der Beginn der Containerschiffahrt, nur so konnten die Truppen mit den notwendigen Dingen versorgt werden, die vorher im Hafen lagerten und verdarben. Hier wird die Unordnung zur Ordnung. Auf dem Rückweg wurden dann in Japan Konsumgüter für die USA geladen. Das auf diese Weise auch illegale Einwanderer in den Containern zu Tode kamen, blieb nicht unerwähnt.
Wer sich nun fragt, wo bitte sind denn die Sänger*innen bei dem Werk, der sollte sich auf die Androiden konzentrieren. Wenn sie nicht gerade dazu beitragen das Kartonchaos aus dem Weg zu räumen, stehen sie hinter ihren Stapeln und singen. Teils leider sehr unverständlich, da es einfach zu laut war. Teile des Textes wurden auf die Leinwand projiziert, was das akustisch nicht zu verstehende dann verständlicher machte.
Die Oper kommt ohne Dirigent aus, alle Beteiligten sind vollkommen gleichberechtigt, die Koordination wird durch eine DJ-Software organisiert.
Dadurch, dass das Publikum auf der Bühne sitzt, ist die Anzahl der Besucher*innen auf 150 begrenzt. Leider gibt es auch beim optischen Erleben Abstriche, denn von vielen Sitzen aus konnte man etliches nicht sehen, weshalb einige auch zwischendurch kurz aufstanden um sich ein Bild machen zu können.
Marc Sinan ist Gitarrist und Komponist und ist bekannt für seine zeitgenössischen Projekte, die im transkulturellen und – medialen Kontext stehen. Hier ist ihm ein technisch anmutendes, anspruchsvolles Werk gelungen.
Tobias Rausch ist ein Grenzgänger des Theaters, der zunehmend eine Art Recheretheater macht, der geschichtliche Geschehnisse nicht nur historisch aufarbeitet, sondern den Dingen auch naturwissenschaftlich oder anthropologisch auf den Grund geht.
Konrad Kästner, der dritte im Bunde ist freier Regisseur und Videokünstler. Er führte bereits in zahlreichen Theatern (u.a. Halle, Kiel, Berlin) Videoregie.
Gesanglich ist Chaosmos‘ Musik durch die ungewöhnlich technischen, abgehackten und harten Klänge anspruchsvoll, die Sänger*innen waren gefordert, enttäuschten aber absolut nicht. Dies gilt auch für die instrumentale Seite, wurde aber, wie von den Wuppertaler Sinfonikern nicht anders zu erwarten, glanzvoll gemeistert.
Fazit: Wenn vielleicht auch technische Kleinigkeiten nachgebessert werden könnten, es waren 90 spannende Minuten einer Oper der anderen Art, einer Oper, die eben keine ist, eben NOpera! Eine Oper, die vielleicht auch zum Nachdenken anregt, daß es nicht immer gut ist, Dinge und Menschen nur aus dem einen, gewohnten Blickwinkel zu sehen, sondern auch Hintergründe zu hinterfragen, warum soll es unbedingt so sein, kann es nicht auch sein, daß die eigene Denke zu klein ist? Die Natur ist nicht binär, sie ist divers, die eigene starre Ordnung kann Zerstörung und damit Unglück bringen, andererseits sich aus dem Chaos etwas wunderbares neues entwickeln kann, wenn man es lässt. Diversität ist wunderbar.
Das Publikum schien zwiespältig, was sich auch im Applaus zeigte. Der Pegel schwankte zwischen höflich und echt begeistert. Besonders die beteiligten Mitglieder des Orchesters wurden sehr beklatscht. Spannend wäre es sicher, das Werk nun auch an den anderen Häusern zu sehen, die Entwicklung zu beobachten.
Rene Isaak Laube, 14.1.2019
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
credits
Joe: Rike Schuberty/Marie Bretschneider
Jay: Annemie Twardawa
Das System:
Sopran Wendy Krikken
Mezzosopran Iris Marie Sojer
Tenor Adam Temple-Smith
Bariton Imothy Edlin
Sprecher Videos_
Linné: Ulrike Langenbein, Papertown: Thomas Wehling, Container: Georg Böhm
Statisterie der Wuppertaler Bühnen
Sinfoníeorchester Wuppertaler
Musikalische Leitung: Johannes Pell, Marc Sinan
Regie und Video: Konrad Kästner
Bühne und Kostüme: Eylien König
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Premiere am 20. Dezember in Wuppertal
Übernahme einer Produktion des Theaters Oldenburg
Rockstar statt Erlöser
Mit seiner Rockoper ›Jesus Christ Superstar‹ gelang Andrew Lloyd Webber zusammen mit dem Librettisten Tim Rice der Durchbruch zum erfolgreichsten Musical-Team aller Zeiten. Die Verfilmung des Stücks von 1973 wurde zunächst teilweise als blasphemisch abgelehnt, was aber der Popularität des mittlerweile zum Klassiker gewordenen Werks keinen Abbruch tut.
Der biblische Inhalt dürfte allgemein bekannt sein, in der Inszenierung von Erik Petersen wird das Hauptaugenmerk allerdings auf die Thematik Starkult, Vermarktung, Beeinflussung von und durch Massenbewegungen gelenkt. Das ursprüngliche, biblische Thema zieht sich hier wie ein roter Faden von Anfang an durch das Geschehen und endet quasi als geballtes, dickes Knäuel am Ende in der Kreuzigung. Erik Petersen ist als freischaffender Regisseur auf vielen Bühnen zuhause. So inszenierte er in Dortmund u.a. La Cenerentola und Hänsel und Gretel, in Oldenburg, wie auch hier seine Fassung von Jesus Christ Superstar, am Staatstheater Darmstadt Evita, um nur einige seiner bisherigen bemerkenswerten Stationen zu nennen.

Im ersten Akt sieht Judas den Hype um Jesus kritisch und warnt ihn, dass der Jubel in Hass umschlagen kann, wenn man nicht mehr so „funktioniert“ und die Erwartungen/ Ziele erfüllt, wie es erwartet wird. Jesus als ausgebrannter Star, der die Massen bedient und begeistert, dessen Tod aber von eben diesen Massen schlussendlich auch bejubelt wird, als sie sich von ihm abgewandt haben und einem neuen Idol nachlaufen werden. Simon, als treuer Unterstützer, versucht Jesus wieder zu stärken, doch dieser fühlt seine Kräfte schwinden. Maria Magdalena gelingt es, Jesus zu beruhigen, sie selbst ist überrascht und verunsichert von den Gefühlen, die sie für ihn entwickelt.
Der Oberpriester Kaiphas bespricht sich mit den anderen Priestern, sieht in Jesus eine Gefahr und sie beschließen ihn auszuschalten. Judas wird von ihnen bestochen und er verrät Jesus, gegen sein Gewissen. Herodes sieht in einem Alptraum wie der Mob über einen Menschen herfällt und ihn tötet, die Schuld aber ihm, Herodes gibt. Jesus versucht dem allgemeinen Tumult ein Ende zu setzen, sieht sich aber von den Forderungen und Erwartungen der Masse vollkommen überfordert.
Im zweiten Akt feiert Jesus das Abendmahl mit seinen Freunden, erkennt, dass sein Weg ein anderer ist als das, was von ihm erwartet wird und das er vielleicht sogar verraten und allein da stehen wird.

Als er dann kurz danach den verräterischen Judaskuss erhält, erkennt er, dass seine Befürchtungen Wahrheit geworden sind und er verraten wurde. Er wird verhöhnt, verleugnet, zwischen Pilatus und Herodes hin und her geschoben. Herodes verhöhnt ihn, tut aber nichts weiter, sodass Herodes unter dem Druck der Masse, die Jesus am Kreuz sehen will, am Ende das Todesurteil spricht. Judas bereut seinen Verrat und erschiesst sich.
Petersen hat die Rockoper in rasantem Tempo inszeniert, schnelle Abfolgen, blitzartige Lichtwechsel ergänzen sich und sorgen für 2 Stunden Spannung und Spektakel. Das Bühnenbild von Sam Madwar zeigt sich als eine Mischung aus Variete-Theater und Steampunk, mit viel Metall, Nebel und eindrucksvollem Lichtspiel. Die Kostüme von Verena Polkowski sind von Alltagskleidung bis Glitzerdress sehr verschieden entworfen. So tritt Jesus komplett in schwarz auf, Herodes hingegen in einem glitzernden Showsakko.
Wieder einmal hatten die beiden zum Wuppertaler Ensemble gehörenden Mark Bowman-Hester als Herodes mit einer glanzvollen Shownummer (Herod’s Song) und Simon Stricker als Pilatus und Annas die Gelegenheit mit ihren Stimmen für Begeisterung zu sorgen.

Ganz stark Rupert Markthaler als Judas Ischariot und Maureen Mac Gillavry als Maria Magdalena. Oedo Kuipers als Jesus von Nazareth war darstellerisch von Anfang bis Ende sehr überzeugend. Sehr eindringlich in Darstellung und Gesang insbesondere seine große „Gethsemane“-Szene (I Only Want To Say…). Neben den Hauptdarstellern sei hier auch noch das gesamte weitere Ensemble lobend erwähnt, die natürlich alle am Erfolg des Abends maßgeblich beteiligt waren.
Dem Opernchor Wuppertal gebührt auch heute wieder ein riesengroßes Dankeschön für seine Leistung. Ebenso dem Sinfonieorchester Wuppertal, was mit der Rockband verschmolz und auch bei den eher ungewohnt rockigen Töne einfühlsam und nachdrücklich unter der Führung von Jürgen Grimm als Musical erfahrenem Leiter mit gewohnter Qualität überzeugte.
Der Abend endete mit langanhaltendem Beifall, das Publikum stand vom ersten bis zum letzten Klatschen und war begeistert.
Bilder (c) Bettina Stöß
Rene Isaak Laube, 26.12.2019
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
OPERNFREUND - MUST HAVE ! - PLATTENTIPP
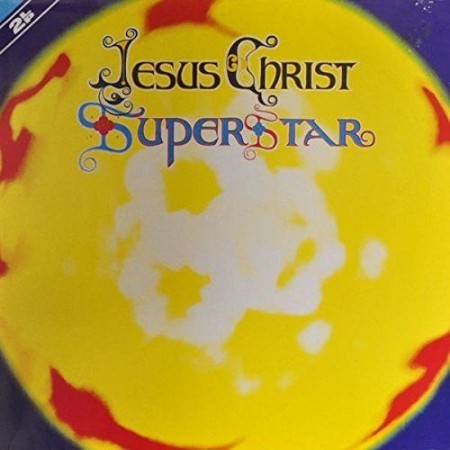
Leider ist diese Urversion mit der unfassbaren Yvonne Ellimann und Ian Gillan von 1970 aktuell nur noch als Venylplatte erhältlich.
HOCHZEIT DES FIGARO
13.10.2019
TRAILER
Nachdem unter der Intendanz von Berthold Schneider die Opernszene des Wuppertaler Opernhauses mit einigen, in dieser Region ungewöhnlichen, innovativen Produktionen und durchaus streitbaren Regisseuren aufgemischt wurde, freut sich nun das Publikum aller Altersklassen – wie das gut gefüllte Opernhaus zeigte– über eine der Mozart-Opern, die ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen, „Die Hochzeit des Figaro“von Wolfgang Amadeus Mozartin italienischer Sprache (mit deutschen Übertiteln) in einer Koproduktion mit der English National Opera, London (Pr.: 4.4.2019).

Das vonJoe Hill-Gibbins entwickelte Regiekonzept sieht zwei, entsprechend der Handlung angehobene oder abgesenkte Ebenen vor, was Bewegung in das Bühnengeschehen bringt. Er kommt darin ganz ohne Requisiten aus und führt die Personen zum Teil marionettenartig und stark abstrahiert, bis zur Momentaufnahme, die wie in einem plötzlich angehaltenen Film stehenbleibt. Es beginnt mit einem schmalen Gang an der Rampe mit vier Türen, vor, hinter und zwischen denen sich so einiges abspielt. Sie werden unentwegt geöffnet und geschlossen, die Akteure der Handlung, einschließlich Chor gehen, eilen, quellen heraus. Dahinter sind schlaglichtartig Neugierige, erotische Szenen usw. zu sehen, bis sich ein auch in die räumliche Tiefe gehendes Bühnenbild in besagten zwei Ebene entwickelt (Bühnenbild: Johannes Schütz).
Darüber kann man geteilter Meinung sein, denn das ist alles nicht wirklich neu. Schon seit Jahrzehnten gibt es diesen schmalen Gang mit oder ohne Türen, die abstrahierte Personenführung, die Momentaufnahmen und dergleichen. Die ganz in hellen Tönen gehaltene Bühne kann alle Farben aufnehmen.

Da kommt es darauf an, welche optischen Effekte die Kostüme bringen, die hier allerdings nicht gerade originell wirken, kaum dem Charakter der betreffenden Operngestalt entsprechen und die Akteurinnen oft nicht gerade vorteilhaft erscheinen lassen (Kostüme: Astrid Klein). Sie sind wenig attraktiv und kein „Hingucker“, ausgenommen die Brautkleider. Dass aber auch noch der Chor als viele kleine, mitunter recht nett anzusehende Bräute (und auch einige „vollschlanke“) ausstaffiert wurde, ließ kaum einen Bezug zur Handlung erkennen, außer, dass vielleicht in allen Köpfen die Hochzeit herumspukt.
Die Gräfin ist so gekleidet, dass man verstehen konnte, warum sich der Graf, der schlichter gekleidet ist als sein Diener Figaro (nun ja, der hat ja auch Hochzeit), um eine andere bemüht, die auch nicht wie eine schmucke kleine Zofe ausstaffieret ist. Unverständlich erscheint auch, warum Cherubino ausgerechnet als Pimpf erscheinen muss – in einer Zeit, in der die Problematik dieser Oper wohl kaum noch eine Rolle gespielt hat. Etwas Aktualisierung? – warum nicht, aber es sollte doch Sinn machen und nicht alles, was gerade modern ist, in eine Operninszenierung hineingepackt werden.

Musikalisch wurde die Oper wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und Mozarts Meisterwerk seine Bedeutung zurückgegeben. Johannes Pell verstand es, das Orchester zur Höchstform zu führen und die Sängerinnen und Sänger zu inspirieren. Jessica Muirhead rührte als Gräfin mit ihrer perfekt gesungenen Arie „Dove sono“die Herzen der Besucher, wenn ihre Stimme auch in der Höhe etwas hart klang, aber mit guter Technik konnte sie durchaus überzeugen. RalitsaRalinova hatte als Susanna nach ihrer ebenfalls perfekt und mit klangschöner Stimme gesungenen Arie „Giunsealfinilmomentio“, mit der sie ihre liebevollen Gefühle für Figaro zum Ausdruck brachte, erst recht die Sympathien des Publikums auf ihrer Seite.
Sebastian Campione zeigte seinerseits als Figaro jedoch wenig musikalisches Gespür (Rhythmus?) und auch wenig Profil. Simon Stricker verstand es, mit schauspielerischem Geschick, manche Klippe seiner nicht leichten Partie des Grafen Almaviva ohne Aufsehen zu „umschiffen“. Etwas blass erschienen hingegen Iris Marie Sojer als Cherubino und Wendy Krikken als Barbarina.

Das Intriganten- und spätere zweite Brautpaar Marzelline (Joslyn Rechter) und Dr. Bartolo (Matthias Henneberg) überzeugte auf seine Art. Mit charaktervoller, ansprechender Stimme gestaltete Timothy Edlin in Personalunion die Rolle des Basilio und Dr. Curzio. Marcel van Dieren war ein sehr junger Gärtner Antonio. Die Damen und Herren des Opernchores der Wuppertaler Bühnen waren szenisch stark integriert und erfüllten ihre Aufgaben auch gesanglich gut. Vor allem musikalisch war es eine sehr ansprechende Aufführung, bei der die wichtigsten Impulse aus dem Orchestergraben kamen.
(c) Bettina Stöß
Ingrid Gerk, 15.10.2019
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online

DIE TOTE STADT
Pr 15.6.2019
Making-Of Videos
Pathologie-Alltag statt morbid historischem Grusel

Die Original-Geschichte sei kurz vorweg genommen: Paul lebt in einem Panoptikum der Reliquien seiner verstorbenen Frau Marie, fast in einem Geisterhaus. Er hat sich in die Tänzerin Marietta verliebt, die seiner Gattin sehr ähnlich sieht. Für ihn wird sie kurzzeitig zur Reinkarnation dieser Toten. Er versucht ein Verhältnis mit ihr zu beginnen. Die Künstlerin Marie lässt sich oberflächlich auf die Beziehung ein, ist aber nicht bereit, in die Rolle der Verstorbenen zu schlüpfen. Als Paul ihr einen Zopf der Toten, den er in einem Schrein aufbewahrt, um den Hals legt, verliert er plötzlich die Beherrschung und erdrosselt Marietta.
Im Roman ist das ein reales Handlungselement - in der Opernversion nur eine Vision. Die Ermordung findet nicht wirklich statt, sondern löst - ein Traum der Fantasie - nur eine seelische Wandlung aus. Paul erkennt am Ende der Oper, dass er in diesem alten morbiden Brügge, das sinnbildlich als Stadt genauso tot ist wie seine Frau, nicht länger leben kann, und verlässt mit seinem Freund Frank eben diese Tote Stadt.

Regisseur Immo Karamann misstraut natürlich als moderner Musiktheater-Regisseur der Vorlage des Originals und verschenkt mit seiner Inszenierung sowohl Stimmung als auch jegliche Spannung und Atmosphäre dieser wunderbaren Oper. Wenn man sich vom Roman Georges Rodenbachs bzw. der Korngoldschen Libretto-Adaption löst, geht eigentlich alles Wichtige verloren; vor allem auch die fast Hitchcock-artige Spannung und das Gänsehautfeeling, welches die skurrile Handlung dieser Oper - zumindest in den meisten bisherigen Produktionen - ausmachte. Das heutige Brügge ist eben nicht jenes Bruge-la-Morte, sondern diese Karaman-Geschichte könnte zeitlos auch in Wuppertal, Delmenhost oder Düsseldorf spielen.

Das meist sterile, langweilige und leere Einheitsbühnenbild spielt überwiegend in der Leichenhalle eines Krankenhauses. Und auch wenn sich die Wände später öffnen - wir sehen einen spektakulär arrangierten Autounfall, und zum Glück, das mir verblieb mimt auch noch - überflüssiger Weise - eine zeitgenössische Popband mit Disko-Beleuchtung. So ist die Geschichte wenig ergreifend. Am Ende erklärt Paul noch mal eben zwischen Tür und Angel der Krankenhausempfangshalle, daß er es doch noch einmal versuchen werde. Vermutlich geht er danach ins Büro - nicht in den Freitod. Das Rätsel für den Zuschauer, ob er vielleicht dem Schicksal seiner Ehefrau folgen wird, stellt sich nicht ansatzweise. Figuren, die in das Konzept nicht reinpassen singen aus dem Off. Schlechter, frustrierter und uninspirierter wurde man selten aus einer Toten-Stadt-Inszenierung entlassen. Eine eigentlich tolle Geschichte wurde mal wieder auf dem Altar modernen Regietheaters auch noch im Einerlei zeitgenössischer Requisiten geopfert. Nach dem 25. Mal nerven besonders die Brechtschen Gardinen, mit denen anfänglich selbst kleinste Raumveränderungen auf der Guckkastenbühne kaschiert werden.

Ärgerlich für die hervorragend singende Susanne Serfling sind die unvorteilhaften Kostüme von Fabian Posca, der auch für die Choreografie verantwortlich zeichnet. Überhaupt ist das Frauenbild - Heilige Ehefrau oder laszive Hure- recht simpel gestrickt. Zuviel der vermeintlichen Plattitüden eines Ehedramas heutiger Tage oder jammervoller Soap-Operas. Warum eigentlich dieses Umbiegen der Handlung und diese Gegenwarts-Simplifizierung, wo doch das Original so facettenreich ist und gruselig unter die Haut geht.
Jason Wickson ist ein famoser Sänger für die geradezu teuflisch schwere Partie des Paul - darstellerisch wirkt er regiegezwungen, trotz seiner schon ans Akrobatische grenzenden Fall-Artistik, auf mich aber eher eindimensional. Da ist nichts Mitreißendes oder Ergreifendes, wie z.B. bei James King in der legendären Berliner Korngold-Revival-Inszenierung vom 1983 (Götz Friedrich), welche nach vielen Jahrzehnten der Ignoranz gegenüber diesem Meisterwerk und dem schon vergessenen Komponisten, uns verdientermaßen Korngolds tolle Werke überhaupt erst wieder nahe gebracht hat. So gehört Das Wunder der Heliane zum Beispiel schon fast wieder zum Repertoire-Alltag an guten Bühnen. Gott sei Dank gibt es die alte Fernseh-Aufzeichnung endlich als DVD. Allen Premieren-Jublern sei dieser Meilenstein (Siehe unser Plattentipp am Ende) ans Herz gelegt.

So endet die Geschichte, die anfängt wie Bernsteins A Quiet Place, genauso, wie sie angefangen hat, man kennt das altbekannte Schema. Es schließt einen Bilderbogen, der zwar handwerklich solide gemacht ist - immerhin ist Karamann ja ein ausgebildeter Opernregisseur - aber zumindest beim Rezensenten keinen nachhaltigen Eindruck hinterließ. Überzeugende Werktreue und psychologische Durchleuchtung der Charaktere fanden nicht statt. Wer die Oper zum ersten Mal sieht wird begeistert sein, aber der Korngold Kenner und Freund wird enttäuscht, denn das musiktheatralische Gruselgefühl, welches auch ein wesentlicher Teil dieser Oper ist, kam leider nicht auf.
Die spätromantische Musik Korngolds hatte Dirigent Johannes Pell mit dem sicher aufspielenden Sinfonieorchester Wuppertal passabel und hochengagiert im Griff. Pell ist ein Ausnahmetalent, der sich vorbildlich einbringt, stets mit den Sängern atmet und auch durch gelegentliche Höchstschwierigkeiten der Korngoldschen Musik seine Musiker sicher und souverän leitet; berechtigte Bravi für ihn und die Solisten. Wie gesagt leider regiemäßig kein großer Wurf, auch wenn das jubilierende Hauspersonal und das Premierenpublikum anderer Meinung waren.
Fazit: für Korngold-Fans ignorabel. Für Erstseher sicherlich ausreichend empfehlenswert. Fürs Repertoire immer eine Bereicherung.
Peter Bilsing, 18.6.2019
Bilder (c) Wil van Irsel
Credits
MARKUS BAISCH Chorleitung
DAVID GREINER Dramaturgie
JASON WICKSON Paul
ANNE MARTHA SCHUITEMAKER Juliette
SUSANNE SERFLING Marietta
IRIS MARIE SOJER Lucienne
SIMON STRICKER Frank / Fritz
SANGMIN JEON Victorin / Gaston (Sänger)
ARIANA LUCAS Brigitta
MARK BOWMAN-HESTER Graf Albert
OPERNFREUND-DVD-TIPP

Mit dieser Inszenierungt wurde 1983 von Götz Friedrich die Korngold-Renaissance eingeläutet. Durch die TV-Übertragung brachte man das Werk einem Millionenpublikum endlich wieder nahe. Die in den Archiven des ZDF zu verrotten drohende Aufnahme wurde jetzt Gott-sei-Dank technisch auf DVD Format überarbeitet wieder zugänglich gemacht. Eine Meisterhand-Inszenierung. P.B.
OPERNFREUND-CD-TIPP

Die Audio-Aufnahme ist das Maß der Dinge. Kollo war damals auf der absoluten Höhe seines Fachwechsels ins große Fach - es war auch die Zeit seiner begnadeten Lohengrins. Und über die anderen braucht man eigentlich keine Worte zu verlieren. Erich Leinsdorf zaubert mit dem damals besten Deutschen Orchester einen Fabel-Korngold, wie es ihn später nie wieder - nicht ansatzweise - gab. Eine Traumaufnahme, die jeder echte Korngold-Fan sein Eigen nennen muß. P.B.
Le Nozze di Figaro

Premiere: 14.4.2019
Kühle Optik, erhitztes Spiel
Gleich in medias res: in Wuppertal erlebt man eine musikalisch ungemein inspirierte und szenisch entzückende, intelligente Aufführung von Mozarts „Figaro“. Dabei stellt sich beim anfänglichen Sehen des Bühnenbildes (wegen des offenen Vorhanges ausgiebig in Augenschein zu nehmen) erst einmal Skepsis ein. Johannes Schütz, der renommierter Ausstatter, bietet eine nicht sehr tiefe, rampenparallele Spielfläche mit bühnenhoher Rückwand, in welche vier Türen eingelassen sind. Der möbellose Raum ist total weiß, seine Nüchternheit wird von Neonlicht unterstrichen, welches aus einer vorderen, vergitterten Vertiefung hochstrahlt.

Die Türen werden dann ausgiebig in Aktion gesetzt. Zu jedem Orchesterschlag öffnen bzw. schließen sie sich. Das gesamte Opernpersonal: rein und raus, raus und rein. Ach, du lieber Gott, denkt man bei dieser berserkerischen Aktionslust zunächst, die tatsächlich etwas zu viel des Guten tut. Aber bei Mozarts Oper handelt es sich nun einmal um einen „folle journée“. Im übrigen beruhigt sich die Inszenierung von Joe Hill-Gibbins (sie wird von der English National Opera übernommen) nach dieser Introduktion entschieden, und das Öffnen der Türen verdichtet sich immer stärker zu Chiffren für Hintergründiges, Tiefenpsychologisches. Fast denkt man an Bartóks „Blaubart“.

Obwohl der Regisseur die Handlung absolut triftig erzählt, deckt er vor allem Emotionen und seelische Vorgänge auf, welche in anderen Inszenierungen zwar nicht übergangen werden, aber doch häufig an der Oberfläche verharren. Der brillianten Ideen von Joe Hill-Gibbins sind zu viele, als daß sie alle beschrieben werden könnten. Einige Beispiele nur. Bei ihrem „Dove sono“ ist die Gräfin auf der Bühne nicht alleine, ihre Worte sind an den zeitweilig ebenfalls vorhandenen Gatten gerichtet und imaginieren die Zeit einer glücklichen Vergangenheit. Beim Briefduett umgarnt sie ihn zusammen mit ihrer Zofe. Der Mann weiß erkennbar nicht, was auf ihn zukommt. Bei ihrer Rosenarie nimmt Susanna die Kopfbedeckung ab, welche sie als Gräfin erscheinen ließ. Hinter der Maske erscheint also ihre wahre Identität. Man versteht jetzt wirklich, an wen die liebenden Worte gerichtet sind. Hill-Gibbins besticht weiterhin mit dem Herausarbeiten unterschwelliger Empfindungen. So nähert sich die Gräfin Cherubino mit durchaus eindeutig erotischen Gesten. Im dritten Akt stößt sie ihn aber wütend beiseite stößt, als der Page mit Barbarina im Zug der Hochzeitspaare auftaucht.

Das „Voi che sapete“ mündet in ein kokettes Tänzchen à trois. Immer wieder bietet der Regisseur solche Momente von Situationskomik, welche das szenische Geschehen gewissermaßen entpsychologisieren. Andererseits läßt die Gräfin starke Verzweiflung spüren, als sie die (von ihr gewollte) Annäherung Susannas an den Grafen innerlich miterlebt. Das Zimmer ist jetzt übrigens (wie auch bei anderer Gelegenheit) hochgefahren und gibt die ebenerdige Bühne als zweite Spielfläche frei.
Brillianter Höhepunkt der Inszenierung ist der vierte Akt, das Gartenbild also. Die Bühne ist jetzt in den Hintergrund gefahren, der vordere Raum bleibt leer. Keine Büsche, hinter denen man sich verstecken könnte, was sonst ja oft neckisch übertrieben wird. Bei dieser szenischen Lösung gewinnen auch Rampenpostierungen einen tieferen Sinn. Sie wirken wie aus der Handlung gefallen und geben dem Zuschauer Gelegenheit zum Nachsinnen. Dieser von Dekorativem befreite „Figaro“ ist ein szenisches Ereignis und wurde in der Premiere vom Publikum begeistert gefeiert.

Julia Jones läßt Mozarts Oper mit Feuer und Flamme musizieren. Handfest Dramatisches überdeckt aber nicht die vielen subtilen Wirkungen. Das Sinfonieorchester Wuppertal orientiert sich an der historischen Aufführungspraxis. Ein eigens angeschafftes Hammerklavier begleitet die Rezitative mit Buffa-Eleganz und gibt gelegentlich sogar witzige Kommentare (wie beim stotternden Don Curzio).
Die Wuppertaler Aufführung beglückt auch wegen der Sänger nachdrücklich. An erster Stelle muß Anna Princeva genannt werden, welche u.a. durch viele Bonner Auftritte bekannt ist. Ihre Contessa ist (unterstützt von Astrid Kleins Robe) eine attraktiv schlanke Erscheinung mit starkem erotischen Appeal, und sie singt geradezu seraphisch. Etwas erdverhafteter wirkt die Susanna der spielfreudigen Ralitsa Ralinova, aber auch sie ist eine Mozart-Interpretin von erster Güte. Simon Stricker gibt einen heißblütigen, emotional brodelnden, mitunter fast cholerischen Conte, ohne vokal hysterisch zu werden. Auf das Erscheinungsbild von Sebastian Campiones Figaro gilt es sich ein wenig einzustellen. Einen Glatzkopf mit seltsamer Gesichtsschminke denkt man sich nicht gerade als Liebhaber-Typ (das Coverfoto des Programmheftes zeigt den Sänger übrigens noch mit Perücke). Aber er erspielt sich dann doch ein überzeugendes Rollenprofil, auch wenn Mozart-Eleganz seiner Stimme ein wenig abgeht.

Iris Marie Sojer ist eine junge, aufsteigende Mezzosopranistin und als Cherubino zum Anbeißen. Als Marcellina kehrt Joslyn Rechter nach Wuppertal zurück, wo sie lange Jahre fest engagiert war. Ihre Darstellung gibt viel Anlaß zum Schmunzeln; gesanglich ist sie top. Den Bartolo porträtiert Nicolai Karnolsky baßmarkant als vitalen Draufgänger, Mark Bowman-Hester erfreut mit seinen skurrilen Porträts von Basilio und Curzio. Trotz ihrer nur kurzen Barbarina-Arie macht Anne Martha Schuitemaker nachhaltig auf sich aufmerksam; irgendwann dürfte sie eine überzeugende Susanna sein. Als Papa Antonio poltert Marcel van Dieren angemessen. Nicht zu erwähnen vergessen sei der proper singende und spielfreudige Chor, einstudiert von Markus Baisch.
Eas dürftig ist nur das Programmheft ausgefallen. Besetzung, Inhaltsangabe samt Vorgeschichte, Zeichnungen eines Comic-Wettbewerbs für Schüler und Fotos von der ersten Hauptprobe – das ist schon alles.
Christoph Zimmermann 15.4.2019
Bilder (c) Theater Wuppertal
John Cage
Play * Europeras 1 & 2
Premiere am 2.2.2019
Spannend, unterhaltsam, herausfordernd!
Play* Europeras 1&2 ist im eigentlichen Sinne keine Oper, sondern eine Anti-Oper, die John Cage als Auftragsarbeit für Heinz-Klaus Metzger und Reiner Riehn schrieb. Die Uraufführung war 1987 in der Frankfurter Oper unter Gary Bertini. Cage zeichnet sich durch einen typischen, experimentellen Stil aus und war entscheidend an der Entwicklung des Happenings als Kunstform beteiligt. Er war Mitbegründer der Fluxusbewegung und stand gewissermassen mit allen für diese Zeit bedeutenden Künstler*innen in Kontakt. Cage komponierte nicht eine einzige Note selbst und sagte: „200 Jahre haben uns die Europäer ihre Opern geschickt, nun schicke ich sie alle zurück.“

Es gibt keine Handlung, sondern nur eine Zusammenfassung im dadaistischen Stil, die aus diversen Opernlibretti zusammengestellt wurde. Daniel Wetzel, der Regisseur bildet unter dem Label Rimini-Protokoll seit 2000 ein Autoren-Regie-Team zusammen mit Helgard Haug und Stefan Kaegi. Zu der heutigen Inszenierung sagt er selbst sinngemäß: es ist eigentlich keine Aufführung für einen Opernfan, eher für diejenigen, die sich für den Sound begeistern können. Er zeigt Dinge und Menschen, die man sonst nicht sieht, Statisten, die für gewöhnlich nur zu Beleuchtungsproben etc eingesetzt werden. An diesem Abend sind sie aktiv ins Geschehen eingebunden, tragen Schilder, agieren mit Scheinwerfern, schieben Bühnenteile… Nachfolgend „Lichtstatisten“
Alles an diesem Werk ist zufällig und wird basierend auf dem I-Ging ausgelost, bzw gewürfelt. Fest steht nur die Bühne, die aus einem 64 Felder zählenden Schachbrett besteht in dem die unterschiedlichen Aktionen stattfinden. Ob nun Bizet, Wagner, Mozart oder oder zu erkennen ist liegt auch daran, worauf sich der Besucher konzentriert, denn es ist unmöglich den Gesamteindruck in sich aufzunehmen. Die Orchestermusiker spielen ebenfalls nur Bruchstücke, die wiederum auch nichts mit dem auf der Bühne dargestellten zu tun haben. Wer wo, was, wie lange tut, welches Requisit dazu eingesetzt wird, wer welches Kostüm trägt und welche Aktion dazu ausgeführt wird, nichts, wirklich nichts passt zusammen. Auch welche Arie, oder auch nur Sequenz einer Arie, gesungen wird, ist dem Prinzip des Auswürfelns überlassen. Der Dirigent wird durch eine Uhr ersetzt, die alles vorgibt und so dauert auch Teil 1 exakt 90 Minuten und Teil 2 dann 45 Minuten. Was daraus entstand, ist gewöhnungsbedürftig und wer vollkommen unvorbereitet diesen Abend besucht, der dürfte auch gänzlich überfordert sein.

Der erste Eindruck hat etwas von Anarchie, jeder macht, was er will, keiner was er soll, aber alle machen mit. Tatsächlich trügt dieser Eindruck, denn so ein gigantisches Machwerk funktioniert nur durch ein perfektes Ineinandergreifen aller beteiligten Rädchen einer Maschinerie. Bei einem so unkonventionellen Gesamtwerk ist es dann auch kein Wunder, dass einige Musiker im Zuschauerraum verteilt waren, dass das Publikum zur Interaktion aufgefordert wurde mittels Karten, die unter den Sitzen lagen damit man „seine“ zugeordnete Aktion zum richtigen Zeitpunkt ausführt. Noch skurriler wurde es dadurch, das Teil 2 vor Teil 1 gespielt wurde. Zum Ende von Teil 2 wurde dann auch auf von den Lichtstatisten getragenen Schildern eine Erklärung zum Abend und eine Einleitung zu Teil 1 projiziert. Teil 2 lebte nur durch Videos auf Leinwänden und bis auf die instrumentale Begleitung kam lediglich Gesang aus der Konserve. An darstellenden Personen gab es in diesem Teil lediglich einen Violinisten auf der Bühne und Lucia Lucas, die in verschiedenen Kostümen auf der Bühne agierte, dies jedoch lediglich optisch und ohne Ton. Die Videos wurden in verschiedenen europäischen Städten aufgenommen und unterschiedliche Künstler*innen sangen dort mitten im ganz normalen Alltagsleben.
Der rote Faden des Abends waren auf Schildern projizierte, auf Wände geschriebene, auf Leinwänden gemalte Gedanken zur Zukunft Europas, die von den oben erwähnten „Lichtstatisten“ vorher stellvertretend für Europas Bevölkerung, ausgedrückt, wie alles ausgewürfelt und dann in die Inszenierung eingebunden wurden. Es spiegelte die Sorgen, Ängste und Wünsche der Menschen wieder. Will man den Abend beschreiben, so kann lässt sich das wohl am besten so tun: Ein wirklich monumentales, technisches Meisterwerk, aber ein gefühlskaltes Konstrukt, was der heutigen Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Jeder für sich in seinem Hamsterrad. Der Abend hatte in diesem Sinne mehr therapeutischen Wert, als sich als Kunstgenuss darzustellen.

Die künstlerische Leistung, die wirklich alle, die auf der Bühne und im Orchestergraben agierten geleistet haben, kann man hingegen nicht deutlich genug herausheben. Es erfordert eine ungeheure Disziplin und enormes Können, so etwas fragmentarisches ausdrucksstark und qualitativ so hochkarätig zu leisten. Chapeau auch für das gesamte technische Personal, was so ein komplexer Abend an Logistik für Bühnenarbeit, Beleuchtung, Requisite und Kostüm erfordert kann man wohl nur nachempfinden, wenn man selbst die Seite hinter dem Vorhang kennt.
Fazit: es war spannend, unterhaltsam, anstrengend und das nicht wenige den Saal schon ab der 14. Minute verlassen haben und dies fortlaufend bis zur Pause, war einerseits ein wenig nachvollziehbar, andererseits jedoch sehr schade. Denn es war eine Erfahrung, die einen über den Tellerrand schauen ließ und das kann nur den Horizont erweitern. Diejenigen, die bis zum Ende der Vorstellung blieben, sparten denn auch nicht mit Applaus und Bravorufen. Man muss sich einlassen können, dann ist diese Inszenierung eine Bereicherung für jeden Einzelnen, denn wohl jeder kann daraus etwas mitnehmen, egal, was, auch das ist eine Sache dessen, auf was man sich selbst an diesem Abend fokussiert.
Fotos @ Jens_Grossmann
Rene Isaak Laube 5.2.2019
Übernahme von unseren Freunden DAS OPERNMAGAZIN
https://opernmagazin.de/play-europera-12-im-theater-wuppertal-spannend-unterhaltsam-herausfordernd/
Giuseppe Verdi
LUISA MILLER
Premiere: 8.12.2018
Zweitvorstellung: 14.12.2018
Luisa Killer statt Luisa Miller

Nach Magdalena Fuchsberger beim Hagener „Simon Boccanegra“ und Tatjana Gürbaca beim Essener „Freischütz“ erlebt man in Wuppertal neuerlich eine Inszenatorin, welche sich mit anarchischer Wollust auf eine Repertoireoper stürzt und sie berserkerisch zerfleischt. Die Dame hört auf den Namen Barbora Horáková Joly und hat in jungen Jahren ein Gesangsstudium genossen, eigentlich keine üble Basis für Regiearbeit im Bereich des Musiktheaters. In Wuppertal erlebt man freilich weniger Basis als Übel: Luisa Killer statt Luisa Miller.
Als erstes erblickt man kahle, weiße Wände (Bühne: Andrew Liebermann). Rückwärtig wird ein schwarzer, in den Umrissen kirchenähnlicher Raum hinzu addiert. Diese unglaubliche Farbsymbolik haut einen schon mal mächtig um. Und dann trippeln zwei artige Kinderlein auf die Szene (die Youngsters Luisa und Rodolfo) und verewigen seitlich die Worte „Amore“ und „Intrigo“. Nun weiß wohl jedermann, was da laufen wird. Auch sonst läßt Frau Horáková Joly so gut wie nichts an Bedeutungsschwere aus. Luisas Geburtstag feiert beispielsweise eine Chormeute, welche wie eine Mixtur aus Karnevalisten und Dämonen ausschaut. Abrupte, sinnentleerte Bewegungen bestimmen nicht nur diese Introduktion.

In der Folge werden Tänzer aufgeboten, die somnambul über die Bühne irren. Einige von ihnen steigen in Blechbehälter und werden mit schwarzer Farbe übergossen, die sie später an den doch ach so schönen weißen Wänden körperrollend abstreifen. Die Bedeutungsschwere dieser Vorgänge ist horrend. Zu einem erotischen Zweikampf artet die Begegnung von Rodolfo und Federica aus. Graf Walter ist ein miesepetriger Autoritätsklotz; Sebastian Campione demonstriert das angemessen verabscheuungswürdig. Vater Miller wirkt als netter Herr Papa etwas eindimensional, aber vokal überzeugt der bulgarische Bariton Anton Keremidtchiev nachhaltig.
Die genialen Einfälle von Frau Horáková Joly wären noch bis ins Unendliche hinein zu ergänzen, aber das würde Schreibüberwindung kosten. In sicherer Erwartung weiterer Fatalitäten verließ der Rezensent ohnehin die zweite Vorstellung der Verdi-Oper in der Pause. Irgendwann reißt halt der Geduldsfaden. Das gilt überdies für eine zufällig aufgegriffene Premierenkritik. „Auch wenn sich die Regieeinfälle dem Betrachter nicht immer erschließen – eines kann man Horáková Joly nicht vorwerfen: statische Personenführung und Langeweile. Die Frage, ob dies schlüssig und schön anzuschauen ist, ist ähnlich müßig wie die Diskussion um das Regietheater.“ Tiefschürfende Äußerung zu einem bedeutsamen, heiklen Thema.

Immerhin ist dem musikalischen Bereich der Wuppertaler Aufführung hohes Lob auszusprechen. Julia Jones läßt mit jedem Forteschlag, jedem Accelerando, jedem melodischen Aufschwung dem Dramatiker Verdi Gerechtigkeit widerfahren (ausgezeichnet Chor und Orchester). Das Liebespaar der Oper ist stimmig und sympathisch besetzt. Izabela Matula, am Theater Krefeld/Mönchengladbach immer wieder vorteilhaft erlebt, gibt die Luisa sängerisch untadelig. Ein wenig mag es ihrem Porträt an Jugendfrische fehlen. Die ist dafür bei Rodrigo Porras Garulos Rodolfo hinreichend vorhanden. Seine Stimme strömt lyrisch und besitzt doch einen festen Kern. Der in jeder Hinsicht attraktiven georgischen Mezzosopranistin Nana Dzidziguri (Federica) möchte man baldmöglichst wiederbegegnen. Von der Wurm-Partie des Michael Tews war aufgrund der Pausenflucht des Rezensenten nur ein beiläufiger Eindruck zu gewinnen. Aber Erinnerungen an den Sänger aus früheren Jahren lassen an eine bis zuletzt überzeugende Darbietung glauben.

Christoph Zimmermann (15.12.2018)
Bilder (c) Wuppertaler Bühnen / Jens Großmann
Das Land des Lächelns
Premiere: 14.10.2017, besuchte dritte Aufführung: 13.1.2018
Viel Lärm um nichts
TRAILER statt Bilder
Eine Produktion erst einen Monat nach der Premiere zu rezensieren, erfordert eine Bitte um Nachsicht. Daß die gesehene Vorstellung aber erst die dritte war, verweist entschuldigend auf die etwas ungünstig weit gestreuten Wiederholungstermine. Ist die späte Kritik über das Wuppertaler „Land des Lächelns“ überhaupt lohnend? Daß diese Operette fast nur aus vokalen Hits besteht, hat sie populär gemacht. Die sentimentale Story um die schnell zerbrechende Liebe zwischen einer Wienerin und einem Chinesen ist mit ihren emotionalen Klischees und ihrer rührseligen Machart mittlerweile freilich kaum noch goutierbar. Gravierende dramaturgische Überlegungen hierzu finden sich in dem nach wie vor gültigen „Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst“ von Volker Klotz.
„Land des Lächelns“ auf der Bühne heute: das ist wie das Aufschlagen eines Gartenlauben-Buches aus längst vergangenen Zeiten. Dabei legt die Uraufführung des Werkes gar nicht einmal so sehr lange zurück (1929). Was nun hat die Wuppertaler Oper bewogen, diese Operetten-Schmonzette in den Spielplan aufzunehmen? Zu vermuten stehen vor allem pekuniär günstige Umstände. Die Inszenierung von Guy Montavon ist eine Koproduktion von Erfurt (dort wirkt er als Intendant) mit der Oper von Hongkong (jüngst war das Haus mit dem „Holländer“ in Shanghai zu Gast). Die wirklich schicke und opulente Ausstattung von Hsiu-Chin Tsai und Hank Irwin Kittel brauchte nur angekauft zu werden. Montavon überwachte in Wuppertal die letzten Proben, doch offenbar ohne Eingriffe in sein mediokres Konzept.
Das ganze Unternehmen war vom Wuppertaler Intendanten Berthold Schneider vermutlich auch als kulinarisches Häppchen für ein Publikum gedacht, welches von ihm sonst mitunter stark in die intellektuelle Pflicht genommen wird. Bei „Land des Lächelns“ darf man aber die Arme baumeln lassen, den Geist in Ruhestellung verabschieden und ganz der reißerischen Melodienseligkeit Lehárs vertrauen.
Darüber wäre also nicht à tout prix zu berichten. Aber Montavons höchst bescheidene Inszenierung wurde von einem einflußreichen Kritiker als „eine Form von rassistischem Klamauk (bezeichnet), den wir eigentlich überwunden haben.“ Der Intendant stellte sich den Vorwürfen in einem TV-Streitgespräch, ohne daß man sich einigte. Der hier zeichnende Rezensent kann die Anschuldigungen seinerseits nur als überzogen bezeichnen. Zu sehen ist in der Aufführung: ein chinesischer Diener muß im zweiten Akt viermal (wenn richtig gezählt wurde) kastratenhaft bellen, und einmal laufen Männer der Leibgarde dümmlich über die Bühne. Aber das ist schon alles. Dümmliche Regieeinfälle, nicht mehr. Die Wogen haben sich inzwischen vermutlich wieder geglättet. In der gesehenen Vorstellung zeigte sich das Publikum (welches das Auditorium bestenfalls zu zwei Dritteln füllte) angetan, doch ohne die von der Premiere berichteten Euphorien.
Montavons Regie gibt sich auf ziemlich einfallslose Weise konservativ, befiehlt den Darstellern vor allem Herumstehen, dekoratives Sitzen und dem Chor eine Habt-Acht-Choreografie. Mit der von Berthold Schneider hervorgehobenen Ironisierung der Wiener Hofgesellschaft ist es so weit auch nicht her. „Man traut sich „Land des Lächelns“ mit allen Klischees auf die Bühne zu bringen und trifft damit die richtige Entscheidung“, resümiert eine Rezension. Ganz so einfach ist es aber wohl doch nicht.
Auch wenn Lehárs Operette mit der „Entführung“ trotz geografischer Exotik letztlich nicht vergleichbar ist, sei doch auf die Mozart-Produktion an der Oper von Lyon hingewiesen, welche durch die Ausstrahlung auf 3sat am 8. September (weiterhin aufrufbar) vermutlich einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Dem operndebütierenden Regisseur Wajdi Mouawad gelang (jedenfalls in den Augen des Rezensenten) nämlich etwas Geniales. Er schrieb neue Dialoge und erfand ein Vorspiel hinzu: Belmontes Vater feiert die Rückkehr seines Sohnes. Das Fest artet zu einer vulgären, antitürkischen Veranstaltung aus. Konstanze und Blonde wissen jedoch auch von tiefer Menschlichkeit in den für Europa fremden Kulturen zu berichten. Belmonte und Pedrillo müssen ihre von Vorurteilen durchzogenen Gedanken neu ordnen. Nochmal: ein geniales Konzept. Daß Ähnliches bei „Land des Lächelns“ gelingen könnte, ist schwerlich vorstellbar, aber vielleicht harrt ja irgendwo ein Szenen-Messias. Guy Montavon ist es sicherlich nicht.
Das gute musikalische Niveau der Wuppertaler Aufführung sollte bei alledem nicht verkleinert werden. Ralitsa Ralinova (bereits mit ihrer Gilda nachhaltig aufgefallen) gibt die Lisa mit strahlender Sopran-Emphase (einmal sogar ein perfektes hohes D), eine Leuchtstimme erster Güte. Auch die Mi von Nina Koufochristou gefällt mit quickem Gesang und dem lebendigem Spiel (trotz der ihr aufoktroyierten Albernheiten). Der Gustl von Mark Bowman-Hester wirkt in seiner Leichtstimmigkeit etwas anonym. Hinreißend hingegen der Koreaner Sangmin Jeon. Sein zwar etwas schmaler, aber bei Bedarf steigerungsfähiger Tenor besitzt ein angenehmes Timbre und vermag elegant zu phrasieren. Unter Johannes Pell setzt das Sinfonieorchester Wuppertal Lehárs Musik wirkungsvoll und klangschön um.
Christoph Zimmermann (14.1.2018)
Vorwort des Hrg. zu JULIETTA
DER OPERNFRFEUND hat ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: Wir bringen durchaus zwei bis drei Kritiken, wenn es sich um ein interessantes, rares Werk handelt (das ist "Julietta" auf jeden Fall !) und vor allem, wenn unsere Kritiker gänzlich unterschiedlicher Meinung sind. Nach Verleihung unseres absoluten NEGATIVPREISES - der OPERNFREUND SCHNUPPE - nun die zweite Kritik vom Kollegen Zimmermann, der die ganze Geschichte völlig anders sieht, als der Herausgeber. Etiam altera pars audiatur ;-) Ihr Peter Bilsing
JULIETTA von Bohuslav Martinu
Premiere am 05.03.2018

Copyright: Wuppertaler Bühnen/ Jens Großmann
Eine fraglos nicht leicht zugängliche Oper, diese „Julietta“ von Bohuslav Martinu. Wenn im Programmheft der aktuellen Wuppertaler Produktion vom „international repertoirebeständigsten Bühnenwerk“ des tschechischen Komponisten gesprochen wird, regen sich erhebliche Zweifel. Eher möchte man diese Formulierung auf die „Griechische Passion“ anwenden, selbst wenn dieses Werk seinerseits eine Rarität bleibt. Wuppertal hat sich ihr vor einigen Jahren gewidmet. Nun also die Premiere von „Julietta“ vor einem das Auditorium nicht zu Gänze füllenden Publikum. Die finale Begeisterung wirkte zwar ein wenig angestachelt, war aber verdient und bewirkt hoffentlich in eine erfolgreiche Mundpropaganda für kommende Aufführungen.
Martinu war ein Freund von irrealen, traumgebundenen Sujets. In dem Drama „Juliette ou la clé des songes“ von Georges Neveux fand er einen für ihn optimalen Stoff. Die Opernversion (eigener Text, Personalverknappung) entsprach voll und ganz den Intentionen des Dramatikers, welcher am Misserfolg seines Schauspiels sehr gelitten hatte. Über die von Martinu stark komprimierten Rollen hinaus bietet die Wuppertaler Aufführung diverse Mehrfachbesetzungen, welche angehen – mit einer Ausnahme allerdings. RALITSA RALINOVA muss neben der Titelfigur auch den episodalen Auftritt der „alten Dame“ übernehmen, ohne dabei ihre ausufernde Frisur abzulegen. Das bringt die Rollenpsychologie etwas durcheinander. Aber ein „Durcheinander“ ist bereits werkbedingt. Es soll also erst gar nicht versucht werden, die vielen irrealen Begebenheiten zu referieren und aufeinander zu beziehen. Sie sind nun mal sprunghaft gereiht und werden auch durch die Übertitel nicht unbedingt verständlicher. Irgendwann lässt das Auge auch von ihnen ab, um sich lieber der fantasievollen Inszenierung INGA LEVANTs zu widmen.
So viel immerhin an inhaltlichen Hinweisen. Der Buchhändler Michel hat sich vor Jahren in Julietta verliebt, welche ihn mit betörendem Gesang becircte. Nun ist er unablässig auf der Suche nach der von ihm idealisierten Frau, ähnlich wie Fritz in Schrekers „Der ferne Klang“ oder Paul in Korngolds „Die tote Stadt“. Dabei begegnet Michel Menschen, die ihr Gedächtnis eingebüßt haben und in Traumwelten leben. Obwohl durch persönliche Erlebnisse nachdrücklich gewarnt ist Michel gewillt, für ein erotisches Phantom seine bisherige Bodenständigkeit aufzugeben. Die realitätsvage Geschichte könnte von Neuem beginnen.
Martinus Tonsprache ist deklamatorisch geprägt, die Musik wird sogar immer wieder von Sprechdialogen zäsiert. Erkennbar sind Einflüsse der mährischen Folklore, ein Impressionismus der nach-Debussy-Ära sowie Prinzipien der neoklassizistischen Ästhetik, wie sie von der Pariser „Group de Six“ vertreten wurde. Martinu wagt zwar die eine oder andere harmonische Schwelgerei, vorherrschend ist bei ihm allerdings ein leicht sprunghaftes, leicht skurriles Idiom, welches die Bühnenvorgänge stimmig illustriert. Diese Farbpalette kostet JOHANNES PELL mit dem SINFONIEORCHESTER WUPPERTAL effektvoll und differenziert aus.
Inga Levants Regie zeichnet sich durch fantasievolle Bildideen aus, für die man freilich nicht immer gleich eine Begründung zu finden imstande ist. Aber der Zuschauer lässt sich, so jedenfalls der Premiereneindruck, von dem schizophrenen Geschehen gerne vereinnahmen, erfreut sich auch an vielfältigen, teilweise witzigen Details, an den Masken, den Kostümen (PETRA KORINK) und der Szenerie (JAN FREESE zusammen mit Petra Korink). Sie zeigt ein weitläufig bespielbares Arreal, umgeben von nüchternen Wohnzellen. Ein künstlicher Baum bietet nicht zuletzt Coleur locale für den zweiten Akt (Waldfest), aus einem einsamen Grammophontrichter die seine vielen stimmungsprägenden Echos zu kommen. Es steht noch ein ausgiebig benutztes Klavier auf der Bühne, ein Rondell dient für Julietta als Hubpodium. Dem Auge wird während er dreistündigen Aufführung also viel geboten, wahrscheinlich sogar zu viel, um beim ersten sehen in Gänze wahrgenommen werden zu können.
Der vielseitigen, vor allem als Gilda bestens erinnerlichen Ralitsa Ralinova ist die Titelrolle anvertraut. Der Sängerin gelingt es überzeugend, mit ihrem jugendfrischem Sopran zwischen Traum und Realität zu navigieren, psychische Geheimnisse spürbar werden zu lassen. SANGMIN JEON ist als Michael mit seinen etwas schmalen und erotisch sicher nicht eben vibrierenden Tenor ein interessanter vokaler Kontrast: Bodenständigkeit kontra irreal geprägte Sehnsucht. Wie er mit weltfremder Naivität durch das eigentümliche Geschehen „stolpert“, macht sein Rollenporträt, darstellerisch bestens gestützt, außerordentlich sympathisch. Bei CATRIONA MORISON, SIMON STRICKER, SEBASTIAN CAMPIONE und CHRISTIAN STURM ist starke Bühnenpräsenz zu erleben, auch wenn ihre Mehrfachrollen für besondere Profile nur bedingt Gelegenheit bieten.
Christoph Zimmermann 8.3.2018
Hänsel und Gretel
Premiere: 9.12.2017 Besuchte Aufführung: 23.12.2017
Alle Jahre wieder
Die Konjunktur von „Hänsel und Gretel“ in der Weihnachtszeit ist nicht unbedingt logisch, hat aber nun einmal Tradition. Natürlich wäre es mutiger, etwa Menottis „Amahl“ zu spielen (wie jüngst in Graz) oder die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens, vor kurzem als Musical in Oberhausen, wo vor langer Zeit auch eine Oper mit diesem Stoff aufgeführt wurde. Wie auch immer: im auslaufenden Jahr 2017 wird die Humperdinck-Oper u.a. an drei Bühnen gespielt, wo namentlich prominente Regisseure das Sagen hatten. Brigitte Fassbaender modernisierte in Braunschweig, Achim Freyer machte an der Berliner Staatsoper aus dem Werk einen „traumhaften Elfenzirkus“, wie in einer maßgeblichen Rezension zu lesen war. Auch die nur halbfertig gewordene Stuttgarter Arbeit von Kirill Serebrennikow machte Schlagzeilen.
Das dürfte im Falle der Wuppertaler Arbeit von Denis Krief wohl nicht passieren, ungeachtet bemerkenswerter Arbeiten von ihm, beginnend mit dem „Benvenuto Cellini“ von Berlioz 1993 an der Pariser Opéra Bastille. Doch fand die Aufführung auch noch am Tag vor Heilig Abend (Ausweichtermin für den durch Winterwetter torpedierten Premierenbesuch) beim Publikum großen Anklang. Es gab sogar Bravorufe, wie sie in einer Repertoireaufführung eher selten vorkommen. Der besuchte Abend besaß auch einen besonderen Erinnerungswert, denn exakt an diesem Tag wurde 1893 am Hoftheater Weimar unter der Leitung von Richard Strauss das Werk aus der Taufe gehoben.
In Wuppertal steht Julia Jones am Pult des städtischen Sinfonieorchesters, als neue Generalmusikdirektorin im Konzertbereich dem Vernehmen nach erfolgreich, beliebt und ideenreich. Ihr Umgang mit der Humperdinck-Partitur ist denkbar Wagner-fern. Gewisse pompöse Klangentladungen lässt auch sie zwar zu, aber immer gibt sie der Musik flüssige Kontur und entschlackt sie alleine durch vorwärts treibende Tempi. Beim Hexenritt und anderen diabolischen Stellen spart sie freilich nicht mit drastischen Effekten. Vor allem die Tuba schiebt sich oft dämonisch ins Klangbild hinein
Beim Hören dieser Aufführung beweist sich wieder einmal, dass die Musik von “Hänsel und Gretel“ von einer besonderen Herzenswärme geprägt ist. Abendsegen und Traumpantomime mit ihrem fast schon spirituellen Charakter können zu Tränen rühren. Dennoch sei ein besonderes Loblied auf die „Königskinder“ angestimmt, die vielleicht noch bessere oder anders gesagt: anspruchsvollere Oper. Erfreulicherweise wird sie inzwischen immer wieder mal gespielt. Eine „Kinder“oper ist sie freilich nicht. Also weiterhin Weihnachten mit „Hänsel und Gretel“.
Denis Krief ist Regisseur, Ausstatter und Lichtdesigner in einer Person. „Ich möchte, dass Kinder in die fantasievolle Welt des Märchens durch den Zauber des Theaters eintauchen.“ Ob ihm das wirklich gelungen ist, müsste man schon aus Kindermund erfahren. Aber auch als Erwachsener kann man sich mit der Inszenierung einverstanden erklären. Es herrscht unverkrampfte Munterkeit und Betriebsamkeit, der Handlung wird kein intellektuelles Konzept aufoktroyiert. Zu den besonders glücklichen Regieideen gehört das herzliche Verhältnis von Besenbinder Peter und seiner Frau Gertrud, bei dem sogar noch eine leichte Alterserotik festzustellen ist. Große „Neuigkeiten“ vermittelt die Inszenierung freilich nicht. Dass die 14 Engel von einer übermütigen Kinderschar dargestellt werden, ist allerdings neu - und nur bedingt überzeugend.
Einwände sind vor allem gegen die Ausstattung zu erheben. Die holzverschalte Besenbinderhütte ist reichlich groß für eine arme Familie, allerdings eignen sich die Wände so für die rauschhaften Projektionen bei Peters Schilderung der Hexe. Projektionen sind überhaupt integraler Bestandteil beim Dekor, vor allem mit unterschiedlichen Visualisierungen von Waldatmosphäre. Die in der Bühnenmitte platzierten nüchternen, gazebespannten Stellwände (auch für Projektionen tauglich) sind freilich eine optische Zumutung, sie entromantisieren die angestrebte Atmosphäre fast völlig. In der gesehenen Aufführung wertete das (von vielen Kindern) durchsetzte Publikum dies aber nicht als Sünde.
Die sängerische Besetzung ist in Wuppertal ganz und gar großartig. In der Rollenabfolge des Programmheftes … Simon Stricker gestaltet Peters Auftritt fast schon wie eine Verdi-Arie, mit warmem Timbre und ausgesprochen kantilenenschön. Dass der Figur dadurch ein wenig Rustikalität entzogen wird, nimmt man gerne hin. Bei der Gertrud wartet Belinda Williams (Gast aus London) zwar mit einem in der Höhe etwas scharfen Sopran auf, aber das passt zu der Figur, die auch darstellerisch sehr gerundet wirkt. Catriona Morison (Hänsel) war kürzlich Gewinnerin beim Wettbewerb „BBC Cardiff Singer oft he World“. Ihr Mezzo leuchtet und strahlt. Von dieser Octavian-flammenden Stimme dürfte man in Zukunft noch viel hören. Launiges Spiel wie bei ihr ist auch bei Ralitsa Ralinova zu finden. Die schon als Gilda so überzeugende Sopranistin macht aus der Gretel eine mädchenhaft charmante Figur und singt bilderbuchhaft und höhensicher. Die stimmlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten von Mark Bowman-Hester möchte man nach den Hexen-Bizarrerien nicht festlegen. Vokale Krassheiten sind als Rollenfarbe hier ja durchaus zu akzeptieren. Auf nette Weise präsentiert Nina Koufochristou das pierrothaft gekleidete Sand- und Taumännchen.
Christoph Zimmermann (24.12.2017)
Keine Bilder.
PINA BAUSCH: 1980
Premiere: 18.5. 1980
Wiederaufnahme: 10.11.2017
Naja... Manches ist irgendwie bekloppt
„Manchmal können wir etwas nur dadurch klären, dass wir uns dem stellen, was wir nicht wissen. Und manchmal bringen uns die Fragen, die wir haben, zu Erfahrungen, die viel älter sind...“ Großartig, denkt der Kritiker, der noch nie eine Arbeit Pina Bauchs, nur vielsagende Ausschnitte gesehen hat. Er ist neugierig auf eine Expedition in ein Gebiet des Tanztheaters, das er noch nie in dreieinhalbstündiger Länge erkundet hat. Denn, so lesen wir es ja in der Broschüre zur Spielzeit 2017-2018 des „Tanztheater Wuppertal – Pina Bausch“, die „Geisteshaltung Pina Bauschs“ verlange nach „Expedition, Entgrenzung und Wissbegier auf das, was Menschen bewegt“ - soweit die wunderbare Theorie.
Also hinein in die Wiederaufnahme von „1980 – Ein Stück von Pina Bausch“.
Der Titel ist doppelsinnig: ein „Stück“ der Choreographin. Bausch konzipierte „1980“ kurz nach dem Tod ihres Lebensgefährten. Wir (kein Pluralis majestatis, bitteschön, sondern der Tanztheaterrezensent mit seinen Wuppertaler Freunden) erfahren: das Stück ist auch ein Stück Trauerarbeit, das sich Bausch, so nehmen wir an, aus dem Herzen riss. Aber macht man mit dem Herzen schon gute Arbeit? Kunststück: zur Tanztheaterarbeit gehört auch Hand- und Fußwerk. Was wir an diesem Abend – natürlich nur einem von vielen Bausch-Abenden, insofern kaum repräsentativ, wenn auch in vielen Details, Mustern, Bewegungsabläufen und Eigenzitaten vermutlich typisch -, was wir also an diesem langen, langen, langen Abend sehen, ist alles Möglich: doch kaum das, was oben draufsteht: TANZtheater.
Dass am Ende eine hübsche fünf Minuten lange Showeinlage in Form eines Gruppentanzes und zwischendurch eine einsame Frau immer wieder sich streckt und räkelt, dass die Truppe immer wieder zu einer schwungvollen Swingmusik der 30er-Jahre in den Saal hinein- und heraustanzt, macht den Abend noch nicht zu einem Tanzabend. Was wir an diesem langen, langen, langen Abend wahrnehmen, ist ein Schauspiel mit Musik (u.a. von Debussy - „Clair de lune“ -, Benny Goodman, Francis Lai und John Wilson). Es ergreift immer dann – für ein paar sehr wenige, sehr wenige, sehr wenige Minuten -, wenn die Musik mit dem Gestus konform geht. Ich weiß: Es gibt NULL Kriterien für Übereinstimmungen zwischen Musik und Bild, aber ich, als unberufener Bausch-Laie, habe in gerade einmal 15 bis 16 Minuten so etwas wie eine unabdingbare theatralische Logik, so etwas wie Poesie, so etwas wie einen Sinn verspürt, der mich von den allzu billigen Grundaussagen Pina Bauschs weg- und in eine interessante Welt eigenen Rechts hineingeführt hätte.

Denn im Grunde hatten wir den Eindruck, immer wieder quälend lange Minuten in einem Irrenhaus zu sitzen. Gut, wir kapieren, denn wir sind ja nicht doof: Das Leben ist nicht logisch, es ist nicht „normal“, es ist oft hektisch, oft würden wir am liebsten schreien – aber das sog. Leben sollte nicht mit dem sog. Theater verwechselt werden. Wo, es mag nur scheinbar sein, denn es wird ja geprobt, wo also unkonturiert herumgebrüllt wird, wo immer wieder Wiederholungen den Rhythmus bestimmen, wo Dilettantismen zur Kultur erhoben werden, ein Mann am Harmonium ein schlichtestes Kinderlied anstimmt, zu Brahms herrlichem, doch grässlich verkitschtem Guten Abend-Lied eine Frau einem in ihrem Schoß liegenden Mann den Hintern tätschelt, wo eine hysterische Frau mit ellenlangen englischen Monologen über ihre Klamotten etc. den Zuschauer, der geistig nicht unterfordert werden will, schlicht und einfach nervt, wo die Compagnie gruppeninfantil auf Tellern herumkratzt und ein Kerl immer wieder mit dem Leitmotiv einer Suppenterrine die Bühne entert, mag das alles einen zutiefst humanistischen Sinn haben.
Der Kritiker – und der gemeine Wuppertaler Zuschauer, der neben den vielen angereisten Jublern sitzt – findet das alles, pardon, nur bekloppt, mag auch der zweite Teil des Abends ein wenig spaßiger sein und ein wenig mehr Problematik aufweisen, die auch von Leuten verstanden werden kann, die nicht in Pina Bauschs und der Haut der einstigen Tänzer von 1980 steckten. Wenn ein autoritär brüllender Mann im Hintergrund des Zuschauersaals die Tänzer zur Minna macht, indem er sie einem öffentlichen Wettbewerb aussetzt, in dem es um Beine und Ängste geht, kapiert man, was das sog. Theater mit dem sog. Leben zu tun hat. Wenn die Tänzer ihre Operationen und Narbe aufzählen, glaubt man zu verstehen, dass das alles wichtig ist, aber es bleiben kleine Inseln der Bedeutung in einem Meer der Bedeutungshuberei.

Auch diese Sequenz ist, meint der Rezensent, zu lang, um rhythmisch zu funktionieren, oder anders: um ihn insgesamt zu packen. Funken von Rührung und vom Wissen, dass sich die Expedition in irgendein seelisches Gebiet lohnen könnte, bleiben für ihn auf zwei Sequenzen des ersten Teils beschränkt: Wenn ein Vater eine Tochter umkleidet und in einer Abschiedszeremonie sich die einzelnen Tänzer von einer Protagonistin mit den bekannten Abschiedsformeln der bürgerlichen Konventionen verabschieden, bevor die letzte Frau (übrigens erwartungsgemäß) sich mit einer schnellen innigen Umarmung und nicht mit allzu bekannten Worten verabschiedet, gewinnt der Abend plötzlich einen Sog, der verstehbar macht, was die Bühne mit uns zu tun hat. Es liegt natürlich auch an der Musik – denn ein langsamer Satz aus einer Cellosonate von Beethoven und ein Song von John Dowland ist schon so expressiv, dass man darüber noch anderen Käse inszenieren könnte, der auf seine Weise – kraft der Klänge - „funktionieren“ könnte.

Das war es dann schon auch. 90 Prozent des Abends sind dem Rezensenten und den gemeinen Wuppertalern, die sich – das hat offensichtlich Gründe, die man nicht leichtfertig vom Dramaturgentisch schieben sollte – im Grunde wenig für Pina Bauschs Theater interessieren und den Welterfolg der Arbeiten seltsam finden, ein Beweis dafür, dass ein Stück von 1980 ein historisches ist. Mit kollektivem Geschrei (geschmackvoller- und wohl ideologiektritischerweise auf die berühmte und leider leider leider musikalisch hinreissende Nummer aus Elgars „Pomp and Circumstances“ gelegt), mit ridikülen Witzchen, die zu Szenen ausgebreitet werden, ja sogar mit den Kunststücken eines Profizauberers, der immerhin für ein paar Minuten der Spannung sorgen, zeigt „1980“ eine Welt der Willkür. Pina Bausch hat eine lockere Revue entworfen, in die ein paar schöne Entdeckungen hineintropfen.
Für einen surrealen Satz wie „Diese Wiese ist sechs Küsse breit“ muss man ja schon dankbar sein. Selbst die Schauspielerin Silja Bächli, die die Sprechrolle übernommen hat, rettet die Chose nicht – zumindest nicht für den Zuschauer, der ein wenig mehr Konsistenz, ein wenig mehr Spannung, ein wenig mehr Zusammenhang und vor allem: TANZ erwartet. Der ist an diesem Abend so gut wie nicht. „Das sind Tänzer“? Mag sein – aber warum tanzen sie nicht? Warum ziehen sie sich nur aus, schlüpfen immer wieder immer wieder unter Decken, lüften ihre Hintern (war das 1980 wirklich modern??), verrenken sich auf der grünen Wiese und lassen das Rehkitz Rehkitz sein? Eine ironische Rede an einen Stuhl aber ersetzt nicht das TANZtheater. Sie zeigt nur, dass es Pina Bausch auf etwas Anderes ankam. So, wie sie ihre selbsttherapeutischen Bemühungen gezeigt hat, mag es das zum Jubeln aufgelegte Publikum schon zehn Sekunden nach dem Schluss zu Standing Ovations hinreißen, die genauso bekloppt sind wie vieles, was wir an diesem Abend gesehen haben.
Infantil und spannungslos: so haben wir, der Freund des TANZtheaters und ein paar langjährige Wuppertaler Theater- und Musikfreunde und -kenner, über drei Stunden des dreieinhalbstündigen Abends empfunden. Die wenigen Momente, wo ein Sinn, gepaart mit Sinnlichkeit aufschien, erschienen uns nicht genug, um die restliche Zeit dieses Musiktheaterabends zu legitimieren, in dem so viel gezeigt wurde, was unsere Wissbegier partout nicht zu animieren vermochte. Das Stichwort hat übrigens eine der Tänzerinnen gegeben: „Ich will nach Hause.“
Danke, der Rezensent hat begriffen.
Frank Piontek, 12.11. 2017
Fotos © Laszlo Szito, Jochen Viehoff, Oliver Look