THEATER FREIBURG


http://www.theater.freiburg.de/
Giovanni Battista Pergolesi
STABAT MATER
Arvo Pärt
TRISAGONE, FRATRES
Premiere: 26. September 2020
Besucht Vorstellung: 3. Oktober 2020
“WIE MUSS MAN LEBEN UM AUS DEM TOD KLUG ZU WERDEN“? (Elias Canetti)

Kurzversion meines Berichts: “Eine berührende, hervorragende Arbeit des Teams unter der Leitung von Fabrice Bollon (Musik) und Andriy Zholdak (Regie). Dazu fällt wieder die hervorragende Arbeit am Text der Dramaturgin Annika Herwig auf“.
Die Textauswahl aus Elias Cannetti’s posthum erschienen Werk ‘DAS BUCH GEGEN DEN TOD’ kann nur als herausragend bezeichnet werden. Der Monolog, auf der Bühne, gesprochen und gespielt von Michael Witte, ist in dieser Art etwas vom Besten was ich in den letzten Jahren gesehen und gehört habe. Wittes Körpersprache, Mimik und Gestik unterstreichen den hervorragend interpretierten Text des Autors. Seine Mitspieler auf der Bühne verstärken den Eindruck seiner Arbeit auf optimale Weise ohne aufdringlich, störend zu wirken. Und hier muss auch die hervorragende Personenführung des Regisseurs Andriy Zholdak erwähnt werden. Seine Regie lässt den ganzen Abend keine Sekunde unnötige Längen zu. Und dies ohne die oft unnötigen, störenden Aktionen auf der Bühne. Seine Spielleitung unterwirft sich, unterstützt die Musik der Komponisten, die Wirkung des Textes von Elias Canetti.

Die Visualisierung von “TRISAGONE“ ‘ von Arvo Pärt, der Abend wurde mit diesem Stück eröffnet, kann nur als genial bezeichnet werden. Begleitet von Pärts Clustern erscheint auf der Bühne ein jugendlicher Engel, dargestellt von Benjamin Gay, und als sein Antagonist Mephisto, gespielt von Michael Witte. Die Regie schafft es, Musik aus dem Graben und das Spiel auf der Bühne als Einheit darzustellen. Dies ist gar nicht so einfach. Pärts Musik ist sehr meditativ und könnte langweilig daherkommen. Die Aktion auf der Bühne muss also und tut dies auf hervorragende Art, diese Meditation zu unterstützen, ohne durch zu hektische Aktivität die Musik zu stören. Dasselbe gilt auf ebenso unaufdringliche, aber eindrückliche Art für “FRATRES“ von Arvo Pärt. Nach dem Monolog wird hier der Monolog schauspielerisch nachgestellt und unterstützt, wird unterstützt, durch die Komposition Pärts. Auch hier brilliert der Schauspieler Michael Witte und seine Mitspieler. (Benjamin Bay und Antonio Denscheilmann)

Das “STABAT MATER“ von Giovanni Battista Pergolesi, das Hauptwerk des Abends, wird gesungen von der Freiburger Sopranistin Katharina Ruckgaber und dem Ensemblemitglied des Theater Freiburg, der Mezzosopranistin Anja Jung. Die Intonation und Diktion der beiden Solistinnen war perfekt, ihre Körpersprache innerhalb der dramatischen Möglichkeiten des Werkes ausgezeichnet. Ihre Arbeit bei der Unterstützung von Fratres darf als sehr gut bezeichnet werden, wenn auch alle Aktionen der Antagonisten von Witte dem Thema entsprechend unspektakulär sind.
Das Philharmonische Orchester Freiburg, geleitet von Fabrice Bollon interpretierte die so unterschiedlichen Kompositionen mit viel Empathie und Gefühl für das Geschehen auf der Bühne und den Text. Eigentlich gibt es über die vorzügliche Produktion des Theater Freiburg noch vielmehr zu berichten, leider greifen Worte zu kurz und sind nicht zielführen. Hingehen, selber sich ein Bild machen ist das einzige was dazu noch zu schreiben ist.
Das Covid-19 Sicherheitskonzept in Freiburg ist hervorragend, einem Besuch steht auch in dieser Hinsicht nichts im Weg.
Peter Heuberger, 4.10.2020
(c) Paul Leclaire
MARIA STUART
Trauerspiel von Friedrich Schiller
Premiere: 16. Januar 2020
Besuchte Vorstellung: 2. Februar 2020
Stefan Zweig 1935: Unwillkürlich fragte ich mich: Wie war das eigentlich mit Maria Stuart? Und schon war der Schriftsteller am Schreiben eines Buches über Maria Stuart.
Die Frage, wie das mit Maria Stuart war, müssen sich auch heute Regisseurinnen und Regisseure stellen, welche Schillers Klassiker auf die Bühne bringen.
Martin Kindervater: Wie lässt sich ein Politthriller des 16. Jahrhunderts, in einer Sprache und Struktur des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts spannend und eindrücklich erzählen?

Kindervater inszeniert auf offener Bühne. Seine Handlungsorte sind für alle Protagonistinnen und Protagonisten einsehbar. Er verzichtet auf die örtliche Trennung, wie dies Schiller in seinen Anweisungen für jeden Akt vorgesehen hat. Das Bühnenbild, entworfen von Anne Manss, umfasst die ganze Bühnentiefe und Bühnenbreite. Die aktiven Spielorte werden nur mit Licht (Lichtdesign: Mario Bubic) sichtbar gemacht, die Nebenschauplätze verharren in einem Zeitstillstand, wohl zu sehen, aber fast unbeweglich. “MARIA STUART“ lebt, wie alle Werke Schillers, durch die Sprache und mit der Sprache. Für die ZuschauerInnen entsteht so die Möglichkeit, sich eigene Bilder zu schaffen, wie das der Fall ist, wenn man/frau ein packendes Buch liest. Die Frage “Wie war das“ stellt sich so auch für das ganze Publikum! Die Personenführung des Regisseurs ist klar strukturiert, so wie es der Text Schillers verlangt. Seine Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist klar zu sehen und hören, geht bis ins kleinste Detail. Körpersprache, Mimik und Gestik gehen einher mit dem Text, unterstreichen und verstärken die Aussagen, machen die Emotionen der Künstler auf der Bühne sichtbar und helfen die Handlung voran zu treiben.

Kindervater hält sich an die aus dem antiken griechischen Theater bekannte Anweisung nach der Einheit der Handlung, des Ortes und der Zeit. Dies ist auch von Schiller vorgesehen. Die klare Struktur hilft dem Verständnis für das Werk aus dem 18. Jahrhundert, ist aber im Zeitalter der elektronischen schnellen Medien gewöhnungsbedürftig.
Elisabeth Kopp in der Rolle von Maria Stuart, Königin von Schottland präsentiert mit ihrem Spiel eine Stuart, welche einerseits weiss, dass sie zu Tode verurteilt werden wird, dies aber andererseits zu verhindern sucht.
Ihrer Gegenspielerin, politische Gegnerin Elisabeth, Königin von England, glaubhaft gespielt von Anja Schweizer, ist klar, dass Maria Stuart sterben muss. Nicht wegen ihrer Verbrechen, wie zum Beispiel der Ermordung ihres zweiten Gatten, Nein! Sie muss aus politischen Gründen hingerichtet werden. Sie bedroht die Macht Elisabeths, der jungfräulichen Königin Englands ohne legitimen Erben.
Eigentlich ist Maria Stuart ein Zwei-Personen Stück. Alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler sind bloss Zuträger für die Protagonistin Maria Stuart und ihre Antagonistin Elisabeth. Es braucht allerdings diese Zuträgerinnen und Zuträger weil sonst das Schauspiel auf einige lange Monologe Marias und Elisabeths sowie einige Dialoge reduziert würde.

Das Spiel der beiden Hauptpersonen kann nicht genug bewundert werden. Ihre Leistung als Schauspielerinnen ist hervorragend. Beide verkörpern glaubhaft, ja sie leben die darzustellenden Persönlichkeiten.
Dies gilt für das ganze Bühnenteam ohne jede Einschränkung.
Victor Calero gibt den Graf von Leicester, Thiess Bramer spielt den Grafen von Shrewsbury und in der Rolle des Barons von Burleigh erleben wir Martin Hohner. Holger Kunkel brilliert als Amias Paulet, der Hüter Marias und Lukas Hupfeld steht als Mortimer, Paulets Neffe auf der Bühne. Als Marias Kammerfrau Hanna Kennedy ist Janna Horstmann eine würdige Mitspielerin von Elisabeth Kopp.
Die ausgezeichnete Dramaturgie, welche Schillers Intentionen sicherlich optimal übernimmt besorgte Tamina Theiss. Der Entwurf der Kostüme stammt von Anna van Leen.
Das an diesem Abend sehr junge Publikum (ist Schiller Pflicht in der Schule?) belohnte die sehr gelungene Aufführung mit dem verdienten Applaus.
Peter Heuberger, Basel
© Birgit Hupfeld
Erich Wolfgang Korngold
DER RING DES POLYKRATES
Vor der Oper, sozusagen als Einstieg in den Kosmos Korngold, präsentierte Fabrice Bollon mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg einige Kompositionen des Komponisten, einen Querschnitt durch das Werk Erich Wolfgang Korngolds (1897-1957). Bollon beginnt mit "THEME AND VARIATIONS Op. 42" aus dem Jahr 1953. Seine Interpretation ist geprägt von ausgezeichneter Dynamik und hoher Präzision, gepaart mit einem Einfühlungsvermögen in die Intentionen des Komponisten. Dies zeichnet grosse Dirigenten aus.
Aus dem Jahr 1916 stammen die "SECHS EINFACHE LIEDER, Op.9". Irina Jae-Eun Park interpretiert zusammen mit dem Philharmonischen Orchester vier dieser Lieder:
SCHNEEGLÖCKCHEN (Nr.1), STÄNDCHEN (Nr.2), LIEBESBRIEFCHEN (Nr.4) und SOMMER (Nr.6)

Ihre Intonation, ihre Musikalität lässt erahnen, was der junge Korngold ausdrücken wollte. Das Melos ist nicht so eingängig wie bei Josef Eichendorff Vertonungen aus dem 19. Jahrhundert von Hugo Wolf oder Robert Schumann. Die Komposition ist eindeutig dem 20. Jahrhundert zuzuordnen.
"DER STURM", die Vertonung des Gedichtes von Heinrich Heine entstand 1913. Gesungen wurde dieses Werk vom Opern- und Extrachor des Theater Freiburg. Einstudiert hat die Komposition der Chorleiter Norbert Kleinschmidt.
Als Abschluss des ersten Teils präsentierte der Opern- und Extrachor des Theater Freiburg Korngolds einziges religiöses Werk: PASSOVER-PSALM Op. 30 aus dem Jahr 1941. Begleitet wurden die Chorwerke wiederum vom Philharmonischen Orchester, dirigiert von Fabrice Bollon.
Dieser erste Teil vor der Pause wurde vom Publikum frenetisch applaudiert. Für mich ein Hinweis darauf, dass auch die Musik des 20. Jahrhunderts ein grosses Publikum hat.
Nach der Pause dann die kurze, kurzweilige Oper, basierend auf einem Lustspiel aus dem Jahre 1888, geschrieben von Heinrich Teweles.

Die Handlung:
>An einem Herbstnachmittag des Jahres 1797 in der Stube im Stil des ausgehenden 18. Jahrhunderts in einer kleinen sächsischen Residenz versichern einander Florian und Lieschen ihres gegenseitigen Heiratswunsches. Wilhelm und Laura, zwei glückliche Eheleute, freuen sich über die Beförderung von Wilhelm zum Hofkapellmeister. Wilhelms Freund Peter Vogel, dem auf der Reise Papiere und Geld gestohlen wurden, kündigt in einem Brief seinen Besuch an und bittet, ihn auf einer Poststation auszulösen.
Vogel trifft ein und betrachtet zunächst allein die Behaglichkeit der Wohnung von Wilhelm. Das folgende Gespräch mit Wilhelm hat Vogels Pech und Wilhelms Glück zum Gegenstand. Vogel beruft sich auf die Ballade Der Ring des Polykrates von Friedrich Schiller, um Wilhelm zur Besänftigung der Götter ein selbst vor dessen Eheglück nicht haltmachendes Opfer abzuringen.
Wilhelm sucht daraufhin Streit mit Laura, fragt nach ihrer Treue und macht ihr Vorwürfe, sodass Laura ihre Ruhe nicht länger bewahren kann.
Nun stellt auch Florian sein Lieschen auf die Probe, indem er mit allen Mitteln versucht, seinen Herrn zu imitieren, was Lieschen für die Wunderlichkeiten eines Betrunkenen hält. Wilhelm und Laura werden Zeugen dieser Nachahmung, wodurch ihnen ihr gegenseitiges Missverständnis bewusst wird. Florian und Lieschen erhalten im Zuge der glücklichen Aufklärung dieses Missverständnisses die Heiratserlaubnis, während Vogel als Störenfried des Glücks unsanft vor die Tür gesetzt wird<. (© Wikipedia) Im Prinzip ist es nichts anderes als eine Verwechslungsgeschichte ohne explizite Verwechslung.
Die relativ unbekannte Kurzoper des jungen Korngold wurde 1916 im Hoftheater München uraufgeführt und wurde ein grosser Erfolg. Es dirigierte Bruno Walter!

Die Regie von Teresa Rotemberg lässt Text und die stimmige Musik sprechen und reduziert die Handlung und die Requisiten auf ein Minimum. Dies kommt der eingängigen Musik und den amüsanten Dialogen zugute. Die Regie begnügt sich mit einer fast konzertanten Inszenierung. Trotz dieser Reduzierung auf ein Minimum erleben Zuschauerinnen und Zuschauer eine Komödie im besten Sinn des Wortes.
Das Philharmonische Orchester Freiburg mit seinem Chefdirigenten, Fabrice Bollon, spielt die zum Teil sehr moderne Komposition Korngolds mit viel Einfühlungsvermögen. Man spürt dass sich Bollon mit seinem Orchester eingehend mit der Musiksprache des Komponisten beschäftigen.
Als Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne:
Jeff Gwaltney als Hofkapellmeister Arndt, Arminia Friebe als sein Gattin Laura, Roberto Gionfriddo als Paukenist Florian Döblinger mit seiner Verlobten Lieschen, gesungen von Irina Jae-Eun Park und als Advocatus Diaboli und Freund Arndts hören wir Peter Vogel.
Das ganze Team auf der Bühne singt mit herausragender Intonation und ausgezeichneter Diktion. Dazu kommt die komödiantische Begabung der fünf Bühnenkünstler, welche die Geschichte mit überzeugender Mimik, Gestik und Körpersprache erzählen.
Das zahlreich erschienene Nachmittagspublikum (Premierenbeginn 15.00 Uhr) belohnte die Arbeit auf der Bühne und im Orchestergraben mit langanhaltendem Applaus.
Peter Heuberger, Basel
© Britt Schilling
THE TURN OF THE SCREW
Premiere: 9. November 2019
Henry James schrieb die Erzählung im Jahre 1898. Veröffentlicht wurde die Geschichte als Fortsetzungsroman in zwölf Fortsetzungen von der Zeitschrift "COLLIER'S WEEKLY". Das Libretto für die Kammeroper von Benjamin Britten erarbeitete Myfanwy Piper, die Uraufführung der Komposition fand am 14. September 1954 im Theater "La Fenice" in Venedig statt. Dazu ist anzumerken, dass einige Werke von James in Venedig spielen.
Zu Freiburger Inszenierung schreiben Peter Carp als Spielleiter und Heiko Voss als verantwortlicher Dramaturg im Programmheft:
>Wir entschieden uns für eine größere Anzahl kürzerer Szenen, durch musikalische Zwi-schensätze verbunden, die in demselben Maße ein Bestandteil der Handlung und ebenso unentbehrlich für ihre Weiterentwicklung zu sein hatten wie die reflexiven Kapitel des Buches. Die Oper hat zwei Akte und einen Prolog. Jeder Akt acht Szenen, jede Szene eine kleine Episode, die nicht nur die Handlung um einen Schritt weiterträgt, sondern auch typisch dafür ist, wie sich das Leben der vier Menschen in Bly abspielt typisch auch für die Art und Weise, wie die verschiedenen Beziehungen zu den Gespenstern Quint und Miss Jessel beeinflusst werden.
 Die offensichtlichen dramaturgischen Probleme, die sich aus einer Aneinanderreihung zahlreicher kurzer Szenen ergeben, sind erstens Kontinuität ständig auf einen Nenner zu bringen und zweitens Klarheit. Diese suchten wir dadurch zu wahren, dass jede Szene nur ein wichtiges Ereignis enthielt oder nur einen Aspekt des Problems umriss. Jene, die Kontinuität, hat Britten dadurch gesichert, dass er jedes einzelne musikalische Zwischenspiel als Variation auf das zu Beginn des ersten Aktes aufgestellte Thema komponierte. Je nach der Stimmung des Zwischenspiels (das immer die der folgenden Szene vorwegnimmt), sei es in hellen Farben, sei es in tragischem Dunkel gehalten, bleiben die düsteren Töne des Themas und damit die Erscheinungen, die sich spukhaft durch die ganze Handlung hinziehen, dem Bewusstsein immerwährend gegenwärtig<. (© Theater Freiburg)
Die offensichtlichen dramaturgischen Probleme, die sich aus einer Aneinanderreihung zahlreicher kurzer Szenen ergeben, sind erstens Kontinuität ständig auf einen Nenner zu bringen und zweitens Klarheit. Diese suchten wir dadurch zu wahren, dass jede Szene nur ein wichtiges Ereignis enthielt oder nur einen Aspekt des Problems umriss. Jene, die Kontinuität, hat Britten dadurch gesichert, dass er jedes einzelne musikalische Zwischenspiel als Variation auf das zu Beginn des ersten Aktes aufgestellte Thema komponierte. Je nach der Stimmung des Zwischenspiels (das immer die der folgenden Szene vorwegnimmt), sei es in hellen Farben, sei es in tragischem Dunkel gehalten, bleiben die düsteren Töne des Themas und damit die Erscheinungen, die sich spukhaft durch die ganze Handlung hinziehen, dem Bewusstsein immerwährend gegenwärtig<. (© Theater Freiburg)
Der Besucher dieser Oper muss sich im Klaren sein, dass es am Ende keine Erklärung für die Geschehnisse in Bly gibt, es findet kein Happy End statt, die Geschichte endet mit vielen offenen Fragen, Möglichkeiten für Unterschiedliche Gesichtspunkte: Was? Warum? Wie? Wer?
Ein Kenner von Henry James hat mir gegenüber ausgedrückt, dass sich "THE TURN OF THE SCREW" anhört, wie wenn man ein Bild von M. C. Escher anschaut. Je nach Blickpunkt, Standpunkt ändert sich die Perspektive, das Empfinden, alles ist relativ, subjektiv!

Die Inszenierung des Werkes ist Peter Carp hervorragend gelungen. Ich frage mich immer noch: War es ein Schauspiel mit gesungenem Text, war es eine Oper mit faszinierend spielenden und singenden Sängerinnen und Sängern? Für mich war es Beides: Eine Oper und ein Schauspiel, bravourös in Szene gesetzt.. Die Personenführung Carps ist zielführend, die dramaturgische Umsetzung der Erzählung durch Voss klar strukturiert und die Fortsetzung der Handlung zwingend gewährleistet. In keinem Moment kommt Langeweile auf. Dies ist auch der schauspielerischen Leistung des gesamten Teams auf der Bühne zu verdanken.
Jede der einzelnen Szenen fand in einem unterschiedlichen Dekor statt. Die Drehbühne in Freiburg leistete Schwerarbeit. Das Bühnenbild von Kaspar Zwimpfer unterstützte die relativ düstere Geschichte, unterstützt durch die Lichtführung von Dorothee Hoff und die Kostüme von Gabriele Rupprecht. Die Farben der Kleider wiederspiegeln die jeweiligen Emotionen, die Psyche der Protagonisten und Protagonistinnen in beispielhafter Weise.
Unter der Stabführung von Gerhard Markson interpretierte das Philharmonische Orchester Freiburg die nicht einfache Musik Brittens mit fühlbarer Empathie und präziser Rhythmik und gelungener Dynamik.
Eine grossartige Leistung war die Arbeit der beiden Kinder Flora und Miles. Katharina Bierweiler singt und gespielt Flora glaubwürdig mit sauberer Diktion und makelloser Intonation. Dasselbe kann für den Darsteller/Sänger von Miles, Thomas Heinen, gesagt werden. Die beiden Jugendlichen Bühnenkünstler sind Mitglieder des "Cantus Juvenum Karlsruhe". Ich kann nur schreiben: BRAVI!

Joshua Kohl singt den Prolog und interpretiert Peter Quint. Sein strahlender Tenor ist auch in leisen Stellen immer verständlich, sein Intonation und Diktion makellos, seine schauspielerische Leistung überzeugt.
Solen Mainguené interpretiert die unerfahrene Gouvernante auf eine Art, welche aufhorchen lässt, welche aufsehend erregend ist: Das Wechselspiel ihrer Gefühle drückt sie mit perfekter Mimik, hervorragender Körpersprache und klarer Gestik aus. Ihr Gesang vom leisesten Ton bis zum hysterischen Aufschrei ist geprägt von einer Musikalität, welche ihresgleichen sucht. Gepaart ist diese Leistung mit einer sicheren Intonation und einer klaren Diktion und dies ist in einem Werk aus literarischen Erbe von Henry James unerlässlich.
Als Haushälterin auf der Bühne Judith Braun, eine wichtige Antagonistin zur Gouvernante. Was ich von Mainguené geschrieben habe, gilt auch für Braun. Ihre Rolle ist allerdings nicht ganz so emotionell, so spektakulär angelegt. Sie bleibt eher im Hintergrund.
Inga Schäfer als Miss Jessel, zusammen mit Kohl als Gespenster bleiben im Hintergrund. Ihre Auftritte sind selten, aber wichtig für den Ablauf der Geschichte und auch für das Nichtverständnis des Geschehens, für das Ende ohne Abschluss. Diese beiden Figuren sind es, welche nicht greifbar sind, welche nicht erklären und zeigen was ihre Geschichte ist. Schäfer singt und spielt mit gewohnter Präzision, klarer Diktion und sauberer Intonation.

Das Premierenpublikum belohnte die hervorragende Leistung des gesamten Teams mit stürmischem Applaus und zahlreichen Bravi-Rufen. Besonderen Applaus erhielten die beiden jugendlichen KünstlerInnen des Cantus Juvenum Karlsruhe.
Peter Heuberger, Basel
© Paul Leclaire
Giuseppe Verdi
FALSTAFF
Premiere: 28. September 2019
Besuchte Vorstellung: 16. Oktober 2019
Die letzte Oper des Vielschreibers Giuseppe Verdi, er komponierte 28 Werke, ist wegweisend für die Entwicklung der komischen Oper in Italien. Es vergingen nach Gaetano Donizettis " DON PASQUALE" (UA 1843) annähernd 50 Jahre, bis mit "FALSTAFF" wieder eine komische Oper in italienischer Sprache von hohem Rang entstand. In Italien fehlte die Tradition der Wiener oder Pariser Operette. Verdi hat die italienische komische Oper gleichsam neu erfunden. Ähnlich wie bei Richard Wagners Meistersinger als das komische Gegenstück zu Tannhäuser betrachtet werden könnten, ist bei Giuseppe Verdi und Arrigo Boito Falstaff der komische Antagonist zu Othello. Verdis Falstaff hat, deutlicher als Wagners Meistersinger, eine Wiederbelebung der musikalischen Komödie um die Jahrhundertwende eingeleitet. So war zum Beispiel Richard Strauss war ein glühender Bewunderer der Partitur Verdis.
 Unter der Spielleitung von Anna-Sophie Mahler entstand im Theater Freiburg eine recht moderne Interpretation dieses Werks. Ohne Moralin nimmt die Regisseurin Forderungen der "MeToo" Bewegung auf und interpretiert das Recht, den Anspruch der Frauen auf Rache bei Anmache auf ihre sehr originelle Weise. Dies ohne die dramaturgische Kraft des Librettos (Arrigo Boito), basierend auf Shakespeares Werken, zu verfälschen. Sie erzählt die Geschichte dieser Verwirrungen und Intrigen sehr verständlich, auch für unvorbereitete Zuschauer. Dies ist auch der ausgezeichneten dramaturgischen Begleitung durch Heiko Voss zu verdanken. Mahlers Personenführung ist klar durchdacht, neigt allerdings in einigen wenigen Szenen zum Rampensingen. Die Ausnützung der drei Ebenen des Bühnenbildes, entworfen vom Schweizer Bühnenbildner Duri Bischoff, unterstützt die Aktionen in diesem turbulenten Intrigenspiel. Die Regie legt grossen Wert auf die Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Ebenso achtet die Regisseurin auf gute Diktion, Verständlichkeit der Sprache. Dies ist etwas, auf welches einige Regisseurinnen und Regisseure, speziell aus nicht westlichen Sprachräumen des Öfteren vernachlässigen. Der französische Theaterleiter und Regisseur Olivier Py hat dies in einem Interview einmal so ausgedrückt: >Sans parole il y a pas de musique< (Ohne Worte gibt es keine Musik).
Unter der Spielleitung von Anna-Sophie Mahler entstand im Theater Freiburg eine recht moderne Interpretation dieses Werks. Ohne Moralin nimmt die Regisseurin Forderungen der "MeToo" Bewegung auf und interpretiert das Recht, den Anspruch der Frauen auf Rache bei Anmache auf ihre sehr originelle Weise. Dies ohne die dramaturgische Kraft des Librettos (Arrigo Boito), basierend auf Shakespeares Werken, zu verfälschen. Sie erzählt die Geschichte dieser Verwirrungen und Intrigen sehr verständlich, auch für unvorbereitete Zuschauer. Dies ist auch der ausgezeichneten dramaturgischen Begleitung durch Heiko Voss zu verdanken. Mahlers Personenführung ist klar durchdacht, neigt allerdings in einigen wenigen Szenen zum Rampensingen. Die Ausnützung der drei Ebenen des Bühnenbildes, entworfen vom Schweizer Bühnenbildner Duri Bischoff, unterstützt die Aktionen in diesem turbulenten Intrigenspiel. Die Regie legt grossen Wert auf die Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Ebenso achtet die Regisseurin auf gute Diktion, Verständlichkeit der Sprache. Dies ist etwas, auf welches einige Regisseurinnen und Regisseure, speziell aus nicht westlichen Sprachräumen des Öfteren vernachlässigen. Der französische Theaterleiter und Regisseur Olivier Py hat dies in einem Interview einmal so ausgedrückt: >Sans parole il y a pas de musique< (Ohne Worte gibt es keine Musik).

Das Philharmonische Orchester Freiburg interpretierte unter der Stabführung von Fabrice Bollon Verdis Werk makellos mit hoher Präzision, gekonnter Dynamik und viel Einfühlvermögen in Verdis musikalische Intentionen.
Juan Orozco brillierte als Sir John Falstaff. Seine klare Stimmführung mit hervorragender Diktion, einer ausgezeichneten Intonation gepaart mit einer körperlichen Agilität erfreuten die gut gelaunten Zuschauerinnen und Zuschauer. Sein Bariton wechselte nahtlos von schneidender Aggression zur selbstverliebten Intimität, vom Zynismus zum Sarkasmus.
Joshua Kohl interpretierte Fenton mit seiner klaren Stimme und spielte überzeugend den in Nannetta verliebten jungen Mann. Sein strahlender Tenor gefiel. Dasselbe muss auch für die junge Sopranistin Samantha Gaul, (Nannetta) gelten. Ihre saubere Intonation ohne jegliches verfälschende Vibrato, zusammen mit einer Diktion, welche man selten zu hören bekommt, sind Vorbedingungen für eine noch internationalere Karriere, sofern die junge Sängerin zu ihrem Kapital, ihrer Stimme Sorge trägt und nur die Zinsen verbraucht. Ihre Rolle in Diodati unendlich von Wertmüller war sehr gut gesungen, aber für eine junge Stimme ein Kraftakt.
Irina Jae-Eun Park spielte und sang die Alice, Fords Frau. Ihre Intonation war, trotz sehr oft präsentem Vibrato sauber. Ihr Diktion liess in allen Lagen zu wünschen übrig. Dazu kommt, dass sie sich, in gewissen Szenen, zu stark in den Vordergrund sang.

Als eifersüchtigen Ford zu hören und sehen war Martin Berner. Sein Bariton ist eher weich und stimmlich ein ausgezeichneter Gegensatz zu Sir John. Diktion und Intonation waren gut, mittlere und höhere Lagen sind eher Berner Sache als die tiefen Partien seiner Rolle.
Roberto Gionfriddo überzeugte als unbeholfener, verlachter Doktor Cajus mit seinem kräftigen und makellosen Tenor. Seine komödiantische Leistung kam in dieser Rolle voll zum Tragen.
Inga Schäfer als Meg Page liess weder gesanglich noch schauspielerisch Wünsche offen. Kein unbeholfenes, unangebrachtes Vibrato, keine unsaubere Diktion störte ihre Leistung auf der Bühne.
Anja Jung als Quickly war wie immer ein spezielles Erlebnis. Ihre Rolleninterpretation war überzeugend, ihr Mezzosopran erfreulich anzuhören.
Auf der Bühne als Bardolfo und Pistola, Sir Johns Bedienstete: Junbum Lee und Rossen Krastev.

Der Opernchor des Theater Freiburg, (Chorleitung Norbert Kleinschmidt) meisterte seine Auftritte gekonnt und in professioneller Qualität.
Das zahlreich erschienene Freiburger Publikum bedankte die reife Leistung des gesamten Ensembles vor und hinter der Bühne sowie im Orchestergraben mit dem verdienten, langanhaltenden (standing) Applaus.
Peter Heuberger, Basel
Fotos © Paul Leclaire
Claude Debussy
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Claude Debussy, April 1902: Warum ich Pelléas geschrieben habe?
>Nach einigen Jahren leidenschaftlicher Pilgerfahrten nach Bayreuth begann ich, an der Lösung Wagners zu zweifeln, oder vielmehr, es schien mir, dass sie nur für den Spezialfall des Wagnerschen Genies tauglich sei. Wagner war ein großer Sammler musikalischer Formeln, er fasste sie zu einer Gesamtformel zusammen die als ursprüngliche Errungenschaft erschien weil man sich in der Musik schlecht auskannte. Und ohne sein Genie leugnen zu wollen, lässt sich doch sagen, dass er für die Musik unserer Zeit den Schlussstein bildet, ähnlich wie Victor Hugo, der die gesamte frühere Dichtung in seinem Schaffen einschmolz. Folglich sollte man seine Erkundungen jenseits von Wagner treiben und nicht in seinem Schlepptau.<

Claude Debussy, Dezember 1910: >Ich revolutioniere nichts, ich demoliere nichts. Ich gehe ruhig meinen Weg und mache, anders als die Revolutionäre, keinerlei Propaganda für meine Ideen. Ich bin auch kein Wagner-Gegner. Wagner ist ein Genie, doch auch ein Genie kann sich irren. Wagner verkündet das Gesetz der Harmonie, ich bin für die Freiheit. Die wahre Freiheit kommt von der Natur. Alle Geräusche, die Sie um sich herum hören, lassen sich in Töne fassen. Man kann musikalisch alles ausdrücken, was ein feines Ohr im Rhythmus der Welt wahrnimmt, die es umgibt. Gewisse Leute wollen sich zuallererst nach Regeln richten. Ich für meinen Teil will nur das wiedergeben, was ich höre. Es gibt keine Debussy-Schule. Ich habe keine Schüler. Ich bin ich.<(© Programmheft Theater Freiburg)
Diese Aussagen Debussys zu seiner Oper sind für das Verständnis des Werkes wesentlich, da sie für die musikalische Auffassung wesentliche Anmerkungen enthalten. Er suchte seinen eigenen Weg, welcher von Richard Wagner, von der Grande Opera a la Meyerbeer wegführte.

Die zwei von mir besuchten Produktionen in Basel und Freiburg unterscheiden sich in der musikalischen Auffassung in wesentlichen Punkten:
Das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Erik Nielsen interpretierte die Musik Debussys im eher feinen impressionistischen Stil, ohne aber ins Süssliche zu verfallen.
Das Dirigat von Francis Bollon mit seinem Philharmonischen Orchester Freiburg setzt die musikalischen Akzente expressionistisch, dramatisch ein. Beide Auffassungen müssen als gelungen bezeichnet werden und beide Dirigenten haben die Intentionen Debussys bravourös umgesetzt.
Die Sängerinnen und Sänger in Freiburg haben die Anmerkungen des Komponisten über den Gesangsstil verinnerlicht und hervorragend auf die Bühne gebracht:
>Die Gestalter dieses Dramas wollen natürlich singen – und nicht in einer willkürlichen Ausdrucksweise, die aus überlebten Traditionen stammt. Ich wollte, dass die Handlung nie stillsteht, sondern ununterbrochen weitergeht! <
Debussy verzichtet also auf Koloraturen, verzichtet auf Stimmakrobatik. Im Gegensatz zur klassischen Oper begleiten die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne das Orchester und nicht umgekehrt.
Der dem Rezitativ ähnliche Gesang erlaubt es dem Orchester, dem Dirigenten das volle Melos der Partitur auszuspielen, die Handlung musikalisch vorwärts zu treiben. Diese Zusammenarbeit zwischen Bühne und Graben hat in Freiburg auf eine Art geklappt, welch aufhorchen lässt.

Dafür verantwortlich ist auch die Regie von Dominique Mentha. Seine Personenführung ist makellos. Seine Arbeit vermeidet die in vielen Produktionen überbordende hektische Aktivität auf der Bühne, welche dramaturgisch meist unnötig ist und entsprechend von der zu erzählenden Geschichte ablenkt. Dazu kommt, dass die französische Diktion der Sängerinnen und Sänger sehr gut ist, man jedes Wort verstehen kann. Es ist festzustellen, dass der Regisseur aus einem zweisprachigen Schweizer Kanton, Bern, stammt und in einer effektiv zweisprachigen Stadt, Biel, Wohnsitz hat.
Das Bühnenbild, entworfen von Ingrid Erb und Sylvan Müller ist stimmig und erlaubt ohne Pausen die notwendigen Umbauten. Der Lichtdesigner Michael Philipp unterstützt dies auf unaufdringliche Weise.
Ein spezielles Kränzchen sei hier auch dem Dramaturgen Heiko Voss gewunden: Seine Arbeit zeugt von einem tiefen Verständnis des literarischen Werkes von Maurice Maeterlink und die musikalische Umsetzung durch Claude Debussy. Sein Essay im Programmheft
> DIE, HAND, DAS HAAR UND DIE BLUMEN DER STILLE< ist sehr lesenswert.

Pelléas wird gespielt und gesungen von John Carpenter. Seine Körpersprache, seine Mimik und Gestik unterstrichen den eher scheuen Charakter der darzustellenden Rolle. Auch sang er mit hervorragender Intonation.
Ein Kapitel für sich war wieder einmal Katharina Ruckgaber: In den Szenen mit Golaud spielte und sang sie, dank perfekter Personenführung, absolut überzeugend die unterdrückte Prinzessin. Ihre Körpersprache, ihre Mimik und Gestik unterstützen diesen Eindruck. Ganz anders in den Auftritten mit Pelléas: Hier überzeugte die Sängerin mit glänzender schauspielerischer Leistung und hervorragendem Gesang, perfekter Diktion und sauberer Intonation.
Georg Festl als Golaud mimte nur teilweise den starken Mann. Seine Zerrissenheit, seine gespaltene Persönlichkeit fand Ausdruck im Gesang und auch im Spiel.
Jin Seok Lee als Grossvater Arkel sang seine Rolle mit klarer Stimme, für meinen Geschmack an der kräftigen Grenze. Anja Jung als Geneviève überzeugte wie immer.
In weiteren Rollen waren zu sehen und zu hören: Seonghwan Koo als Hirte, Jongsoo Yang als Arzt und als Yniold Katharina Bierweiler. Das Mitglied des Cantus Juvenum Karlsruhe meisterte die nicht einfache Rolle mit Bravour.

Das zahlreich erschienene Premierenpublikum belohnte die Leistung des Freiburger Ensembles, des Philharmonischen Orchesters und seines Dirigenten mit dem wohlverdienten, langanhaltenden Applaus.
Peter Heuberger, 54.6.2019
© Rainer Muranyi
Neuproduktionen Theater Freiburg unter der Intendanz von Peter Carp Spielzeit 2019/2020
FALSTAFF Giuseppe Verdi
Regie: Anna-Sophie Mahler Musikalische Leitung: Fabrice Bollon
Premiere: 28.09.2019
THE TURN OF THE SCREW Benjamin Britten
Regie: Peter Carp
Premiere: 09.11.2019
DER RING DES POLYKRATES und andere Werke
KOSMOS KORNGOLD
Oper konzertant Musikalische: Leitung Fabrice Bollon
Premiere: 19.01.2020
DIE HOCHZEIT DES FIGARO
Regie Joan Anton Rechi Premiere am 08.02.2020
DER FREISCHÜTZ
Regie: Showcase Beat Le Mot
Premiere: 3.04.2020
THE LAST HOTEL Donnacha Dennehy
Regie Enda Walsh Deutsche Erstaufführung
Premiere: 15.05.2020
MADAMA BUTTERFLY
Musikalische Leitung: Fabrice Bollon
Premiere: 14.06.2020
Die musikalische Leitung einiger Produktionen ist noch nicht bestimmt, da Daniel Carter, der erste Kapellmeister nach Berlin wechselt.
Peter Heuberger, Basel
© Theater Freiburg
DON GIOVANNI
Premiere: 12. April 2019
Regie: Katarzyna Borkowska - Bühnenbildnerin von Beruf
Ich möchte die Charaktere in einer Weise beleben, die sie wiedererkennbar und lesbar machen, damit man sich mit ihren Absichten, Zuständen und Handlungen identifizieren kann. Das ist für mich one hin ein zentrales Thema im Theater, dass man in der gezeigten Welt etwas erlebt, durchlebt und dass man sich in Etwas wiedererkennt. (Katarzyna Borkoswska)
Ob sie dieses Ziel erreicht hat, muss jede Besucherin, jeder Besucher für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil kann mich mit einem Vergewaltiger Giovanni, mit einem schwachen Ottavio, einem Zyniker und Intriganten Leporello nicht identifizieren. Als Mann kann ich dies für Frauen nur aus der politischen Warte beurteilen. Subtile Andeutungen, langsames heran tasten an die Charaktere ihrer Protagonistinnen und Protagonisten sind nicht Sache der polnischen Bühnenbildnerin.

Direkt und grobschlächtig wird die Sexualität der aristokratischen und auch ländlichen, bürgerlichen Gesellschaft in Mozarts Don Giovanni dargestellt.
Alle Damen werden als Edelprostituierte dargestellt, huldigen der Promiskuität. All dies ist in Da Pontes Libretto nicht vorgesehen, auch nicht angetönt. Für mich heisst dies, das Werk wurde, zumindest handlungsmässig arg verfälscht. Die Kostüme, entworfen von der Regisseurin, sind auch heute noch in Kabaretts der zwielichtigen Art Standard Uniform für die Anmache.
In dieser Bekleidung, zum Teil eher nicht-Bekleidung, treten die Sängerinnen auf die Bühne. Dazu für jede und jeden der HauptdarstellerInnen mindesten zwei Alter Egos, welche die Bühne beleben. Die Kostüme von Leporello, Don Ottavio und Don Giovanni sind moderne Alltagskleider.

Ich empfinde diese Art von Kostümierung, der krasse Unterschied zwischen Damen und Herren, als Diskriminierung der Frau, dies unter der Regie einer Frau, welche für Licht, Regie und Kostüm verantwortlich zeichnet. Dies ist unakzeptabel und einer Theaterinstitution absolut unwürdig. Politische Korrektheit muss zwingend auch auf der Bühne, einem öffentlichen Ort, vorgelebt werden.
Das Libretto beschreibt eigentlich die Personen wie folgt: Donna Anna ist eine Aristokratin, mit Don Ottavio verlobt. Donna Elvira wird im Libretto als vornehme Dame aus Burgos beschrieben. Zerlina, eine einfache Bäuerin, ist mit dem einfachen Bauern Masetto verlobt. Die Statisten sind, sollten sein, Bauern, Bäuerinnen, Musikanten und Diener.

Promiskuität ist in der Originaldramaturgie ausschliesslich Don Giovanni, einem sexsüchtigen jungen Edelmann zugeschrieben. Er ist der Mann, der dem libertinären Sex huldigt und zu diesem Zweck unzählige Frauen verführt.
Die Personenführung der Regisseurin für die HauptdarstellerInnen ist relativ statisch, oft aber auch irreührend und der Musik und dem Text wiedersprechend. So singt im zweiten Akt Sarah Traubel (Donny Anna) ihre Arie Or sai chi l’onore statisch ohne Bewegung, jedoch mit hervorragender Intonation und superber Diktion ohne Vibrato. Für mich fehlen jedoch die Emotionen.
Dafür geilt sich die unschuldige Zerlina bei ihrer Arie Batti, batti, o bel Masetto an einem Stuhl auf. Absolut unlogische, unsensible Personenführung! Zerlina wird gesungen und hervorragend gespielt von Katharina Ruckgaber.

Don Giovanni wird ansprechend interpretiert durch den Bariton Michael Borth. Seine Körpersprache wirkt echt, sein Mimik und Gestik ebenfalls. Sein Intonation und Diktion gefallen. Sein schauspielerisches Können wurde von der Regie nicht voll ausgenutzt, genauso wie dies bei Frau Ruckgaber der Fall ist. Die darstellerische Leistung würde unter einem Regisseur wie zum Beispiel Frank Hilbrich oder Elmar Goerden wesentlich prägnanter ausfallen und diese Aussage gilt für das gesamte sängerische Team.
In weiteren Rollen singen und spielen innerhalb der von der Regie gesetzten Grenzen mit guter bzw. hervorragernder Leistung: Matteo Macchioni (Don Ottavio), Inga Schäfer (Donna Elvira), Juan Orozco (Leporello), Zerlina Katharina Ruckgaber, Jongsoo Yang (Masetto) und Jin Seok Lee (Komtur).

Das Philharmonische Orchester Freiburg wurde geleitet von Daniel Carter.
Das Bühnenbild, entworfen von der Regisseurin, erinnerte stark an Bühnenbilder aus Tannhäuser, Pariser Fassung 1. Akt. Dasselbe gilt für die Choreographie von Tomasz Wygoda, welcher die Doubles der ProtagonistInnen unverständlich - eurythmisch? - gestikulieren liess. Dazu war intensives Kriechen am Boden angesagt. Die ganzen Doubles waren dauernd auf der Bühne zu sehen und lenkten vom musikalischen Geschehen ab. Es herrscht ein aktives, störendes Kommen und Gehen auf der Bühne.
Meiner Meinung nach hat Frau Borkowska eine Oper inszeniert, welche nur musikalisch mit Mozarts und Da Pontes Don Giovanni etwas zu tun hat. Ich bin kein Gegner von Neuinterpretationen, ganz im Gegenteil. Aber ich habe selten erlebt, dass eine Regie-Interpretation auch die geringsten Anforderungen an Werktreue nicht ansatzweise erfüllt.

Das zahlreich erschienene Publikum belohnte die Leistung der Sänger und Sängerinnen, des Chores und der Doubles, ebenso wie des Orchesters mit seinem Dirigenten mit dem verdienten Applaus. Bei der Regie fiel dieser Applaus doch sehr viel dünner aus.
Peter Heuberger 14.4.2019
Bilder (c) Paul Leclaire
César Franck
HULDA
Deutsche Erstaufführung: 16.02.2019
Lieber Opernfreund-Freund,
der in Belgien geborene Komponist César Franck (1822-1890) ist heutzutage vor allem wegen seiner Orgelwerke bekannt. Aber auch seine Messen (aus der für drei Stimmen stammt das berühmte Panis angelicus), die Béatitudes und seine Sinfonie d-moll sind Klassikfreunden nach wie vor ein Begriff. Sein Opernschaffen hingegen ist – zumindest hierzulande – weitestgehend unbekannt. Das möchte das Theater Freiburg ändern und gönnt seinem letzten vollendeten Bühnenwerk Hulda mehr als 130 Jahre nach dessen Entstehung die deutsche Erstaufführung.

Insgesamt vier Bühnenwerke aus der Feder César Francks sind überliefert, doch von keinem erlebte der Belgier, der im Teenageralter mit seinen Eltern von Lüttich nach Paris gekommen war, eine Aufführung. Als seine beiden Frühwerke Stradella und Le Valet de ferme entstanden, war Franck noch völlig unbekannt, Ghiselle konnte er nicht mehr vollenden. Und auch Hulda, an der er insgesamt sechs Jahre gearbeitet und die er 1885 fertig gestellt hatte, gelangte zu Francks Lebzeiten nicht zur Uraufführung. Die fand erst posthum im Jahr 1894 und zudem stark gekürzt an der Opéra Monte Carlo statt, es folgten Aufführungen in Den Haag und Toulouse 1895, ehe Hulda in der Versenkung verschwand. 1960 widmete sich die italienische RAI dem Werk, Orietta Moscucci singt in der mittlerweile auch auf youtube verfügbaren Einspielung in italienischer Sprache unter der Leitung von Vittorio Gui die Titelrolle. Das Theater hat das gesamte Werk nun für die deutsche Erstaufführung mittels des Originalautographen aus der Bibiothèque national in Paris rekonstruiert. Die klangliche Archaik orientiert sich dabei stark am Inhalt der Oper, der auf einem Drama von Björnsterne Björnson fußt, Frankcs Komposition besticht durch Verspieltheit, Orientalik und klangliche Wucht.
Die ist im Norwegen des 11. Jahrhunderts angesiedelt und handelt von Hulda Hustawick, die im Zuge grausamer Stammesfehden geschändet und, nachdem man ihre gesamte Familie umgebracht hat, mit Gutleik, dem ältesten Sohn von Sippenoperhaupt Aslak zwangsverheiratet wird. Fortan ist der Gedanke an blutige Rache ihr einziger Lebensinhalt. Ihr Geliebter Eiolf, ein Edelmann aus des Königs Gefolge, tötet ihren verhassten Ehemann im Rahmen eines Schaukampfs, ihr Schwiegervater ersticht seinen zweitältester Sohn Arne, in dem Glauben, es handle sich um Eiolf. Als sich Eiolf wieder seiner ehemaligen Geliebten Swanhilde zuwendet, trifft auch ihn Huldas Hass: Sie stiftet Gutleiks Brüder zum Mord an Eiolf an und stürzt sich von einer Klippe in den Tod.

Eine misshandelte Frau muss sich ihren Peinigern anschließen, um zu überleben, wird ausgebeutet und gedemütigt und ist deshalb vom Wunsch nach Vergeltung beherrscht. Diese Rachetragödie verlegt Tilman Knabe in den Kongo unserer Tage, in der noch heute Stammeskämpfe mit brutalsten Methoden ausgefochten werden. Davon Zeugnis gibt unter anderem das Cahier Africain, ein Schulheft in dem 300 Opfer die Gewalt und sexuellen Ausbeutung durch kongolesische Söldner schildern und das Knabe ins Zentrum seiner Interpretation stellt. An sich ein so schlüssiges wie hehres Vorhaben, würde der Regisseur sich am gestrigen Abend nicht dauernd selbst zitieren. Vor genau 10 Jahren war er mit der szenischen Umsetzung von Samson und Dalilah in Köln betraut und die Regiearbeit machte damals durch die offene und ungeschönte Darstellung sexueller und körperlicher Gewalt von sich reden. Leider ist ihm zur Visualisierung des Grauens seither nicht viel Neues eingefallen: Auch bei dieser Hulda dominieren Massenvergewaltigungsszenen, Schläge, literweise Theaterblut und allenthalben über Lautsprecher eingespielte Maschinengewehrsalven das Szenario, ertränkt in unablässig versprühten Nebelschwaden. Jede Frau muss grundsätzlich an ihren Haaren durchs Bild geschleift und mit blutverschmierten Oberschenkeln gezeigt werden, jeder Mann artikuliert sich bei jedem breitbeinigen Auftritt immer derb gröhlend und frauenverachtend. „Aber so ist nun einmal die Gewalt“ mögen Sie erwidern, lieber Opernfreund-Freund, und damit haben Sie auch recht. Ich habe auch nichts gegen diese Lesart, finde allenfalls die akustischen Beeinträchtigungen der doch immerhin zum ersten Mal in Deutschland gespielten Partitur mitunter zuviel. Eiolf als Blauhelmsoldaten zu zeigen, ist eine geniale Idee und auch die Mixtur aus afrikanischer Kriegerin und geschundener Frau, als die er Hulda interpretiert, ist schlüssig.

Allerdings treten Schwächen zutage, wenn der szenische Bombast einmal weggelassen wird – wie hier im zweiten Akt, den meine Augen und Ohren als Insel der Wohltat willkommen heißen. Den siedelt Knabe in einer Art afrikanisch-folkloristischen Rückzugsort Huldas an, in dem sie einmal nicht Rachegöttin spielen muss. Hier hört man kein Stöhnen und Ächzen von Statisten, keine Maschinengewehre, sieht keine Kämpfe und Vergewaltigungen und vergleichsweise wenig Blut – und übrig bleibt ein wenig Rampengestehe. Doch auch das sei geschenkt, hätte Knabe sich auf einen thematischen Focus beschränkt. Aber darüber hinaus muss partout noch die moderne Kolonialisierung in Form von Ausbeutung der Bodenschätze – in Freiburg durch chinesische Investoren – thematisiert werden. Und damit nicht genug: ich steige spätestens beim ausufernden imperialismuskritischen Essay aus, der während des Vorspiels zum dritten Akt doch bitte genau mitzulesen ist; das ist dann doch ein wenig viel moralischer Zeigefinger. Vielleicht hatte Tilman Knabe mich aber auch schon bei der gefühlt hundertsten Vergewaltigung, nach der die Frau noch ein paar saftige Ohrfeigen mitbekommt, verloren.
Uneingeschränkt gelungen ist die Ausstattung in Freiburg. Kaspar Zwimpfers Bühnenaufbau visualisiert ein Township in Afrika mit all seiner Trostlosigkeit, die Drehbühne ermöglicht zudem rasche Umbauten zum zerschossenen Hotel Leopold II samt Terrasse oder Huldas bereits erwähnter Kammer. Die Kostüme von Eva Mareike Uhlig sind von außerordentlicher Güte, mannigfaltig, farbenfroh, detailreich, überzeugend. Das Licht von Dorothee Hoff wird geschickt eingesetzt, um Stimmungswechsel zu unterstreichen. Doch würde alles nicht funktionieren, könnte man sich nicht auf so eine herausragende Sängerriege verlassen.

Wo viel gestorben wird, werden die Partien oft recht kurz. So ist es ein Jammer, dass uns Anja Jungs süchtig machender, voluminöser Mezzo nur während des Prologes und mit einem innig vorgetragenen Gebet gegönnt wird. Auch Ensemblemitglied Juan Orozco, stimmlich und darstellerisch mit beeindruckendem Bariton präsent, haucht allzu früh sein Bühnenleben als Gutleik aus. Jim Soek Lee als sein Bühnenvater Aslan verfügt über einen imposanten Bass, der ihn für die Rolle des Stammesoberhauptes prädestiniert, als dessen Gattin Gudrun glänzt Katerina Hebelková. Katharina Ruckgaber gefällt mir als Thordis mit geschmeidigem Sopran, während die Stimme von Irina Jae Eun Park, die eine überwältigende Swanhilde gibt, mich mit ihrer Klarheit und Brillanz berührt. Die Koreanerin, seit dieser Spielzeit neu am Haus, macht Lust auf mehr. Für die Figur des Eiolf bringt das junge Ensemblemitglied Joshua Kohl die nötige Kraft, Versiertheit und einen großen Farbenreichtum mit. Er fügt über einen baritonal gefärbten Tenor, der im Gedächtnis bleibt, und sein Duett mit Swanhilde wäre sicher mein Höhepunkt des Abends, wäre da nicht sie: Morenike Fadayomi ist mit der Verkörperung der Hulda betraut und das nimmt das jahrelange Ensemblemitglied der Rheinoper in Düsseldorf/Duisburg wörtlich. Ab der ersten Sekunde wird die in London geborene und zeitweise in Nigeria aufgewachsene Sopranistin zur Inkarnation ihrer Figur. Zwar spricht die Mittellage nicht immer unmittelbar an und auch die Registerwechsel geraten mitunter ein wenig grob. Was die Vollblutkünstlerin allerdings mit betörenden Pianobögen in der lupenreinen Höhe macht, verschafft mir eine ebensolche Gänsehaut wie ihr intensives, präzises und durch die Bank überzeugendes Spiel. Eine wahre Charakterstudie dieser vielschichtigen Frauenfigur, die Morenike Fadayomi da im Rahmen einer gesanglichen Mörderpartie abliefert. Von den zahlreichen kleineren Rollen bleibt mir vor allem Arne in Erinnerung, den der junge Südkoreaner Jongsoo Yang mit Bravour meistert.
Im Graben zaubert GMD Fabrice Bollon einen Klangteppich, präsentiert César Francks Partitur als eine Mischung aus schwelgerischem Massenet und farbenreich-orientalistischem Bizet, gewürzt mit einer Prise Wagner’scher Tiefe. Das Philharmonische Orchester Freiburg ist in Bestform und spielt mit großer Freude auf. Der Chor, von Norbert Kleinschmidt betreut, leistet Großes und Großartiges und macht den Abend so musikalisch rund.

Als sich der Vorhang senkt, ist das voll besetzte Haus innerhalb von Sekunden aus dem Häuschen, bejubelt alle Mitwirkenden, allen voran Irina Jae Eun Park, Joshua Kohl, Morenike Fadayomi und Fabrice Bollon mit langanhaltendem und nicht enden wollenden Applaus und Bravorufen. Als sich die Regie zeigt, ist dann doch etwas anders, als vor zehn Jahren in Köln. Seinerzeit gab es noch einen handfesten Skandal, Chorstreik und Umbesetzung der weiblichen Hauptrolle inklusive, und einen Buhorkan schon zur Pause. Heutzutage regt die radikale Lesart und das permanente Zeigen von Gewalt niemanden mehr auf, zwar ertrinkt Tilman Knabe samt Produktionsteam nicht in Vivat-Rufen, doch zumindest wohlwollender Applaus ist ihm gegönnt.
Ist das nun ein Erfolg? Ist das Publikum 2019 eher bereit, sich mit Knabes roher Bildsprache auseinander zu setzen als 2009? Ist man als Zuschauer abgestumpfter? Unempfindlicher geworden durch die Bilder aus Nachrichten und Fernsehen? Oder durch ähnliche Bilder auf ähnlichen Opernbühnen?
Machen Sie sich selbst ein Bild, lieber Opernfreund-Freund. Gönnen Sie sich dieses Werk unbedingt! Wenn nicht bei einer der Vorstellungen in Freiburg, dann auf DVD, die zeitnah von dieser Produktion erscheinen wird.
Ihr Jochen Rüth 17.02.2019
Die Fotos stammen von Tanja Dorendorf
P.S.
Dank Youtube hier eine Aufnahme von 1960 aus Mailand zum Reinhören
OPERNFREUND Plattentipp

Leider nur noch als Venyl Box erhältlich
DIE BARTHOLOMÄUSNACHT
Uraufführung/Premiere: 25. Januar 2019
Text von Jan Czaplinski und Michael Billenkamp,
Regie: Ewlina Marciniak

Die Dramatisierung des Romans, Bartholomäusnacht von Alexandre Dumas (1802 – 1870) verspricht einen interessanten Theaterabend. Das Premierenpublikum in Freiburg war gespannt auf diese Uraufführung und erschien zahlreich.
Im Gegensatz zum Roman von Dumas wurde in Freiburg grossen Wert auf die politisch-religiöse Vorgeschichte gelegt. Dies ist aus historischer Sicht ein richtiger Ansatz, da das Massaker nur das tragische Resultat einer Machtpolitik war und zugleich den Anfang des vierten Religionskrieges in Frankreich bildete. Dieser dauerte bis 1573. Dieser Ansatz erlaubte es den Autoren auch, im Text zwingend auf Gegenwartsprobleme in sozio-ökonomischer und religiös-politischer Hinsicht hinzuweisen.
Das Team polnischen Regisseurin Ewlina Marciniak: Kostümentwurf Konrad Parol, Musik Janek Duszynski, Bühnenbild Anna Krolikiewicz, Choreografie Izabela Chlewinska. Das ganze Regieteam stammt aus Polen. Die Ausnahme davon sind der Freiburger Dramaturg Michael Billenkamp und der für die Lichtführung verantwortliche Lothar Baumgarte.

Die Regisseurin nützte in der Spielanlage die grosse Bühne in Breite und Tiefe hervorragend aus. Die Künstler bewegten sich auf der Bühne dramaturgisch sinnvoll, um die Handlung voranzutreiben. Das grosse Haus und die Bühnentiefe jedoch bedingten den Einsatz von Mikrophonen.
Die schauspielerische Leistung der Protagonistinnen und Protagonisten auf der Bühne war exzellent und entsprach den wie immer hohen Ansprüchen des zahlreich erschienen Freiburger Publikums. Der Text der Autoren war interessant und zielführend.
Die Margarete von Valois spielte Rosa Thormeyer. Ihre Mimik, ihre Körpersprache entsprach der darzustellenden Figur. Vielleicht kamen ihre Temperamentausbrüche ein bisschen zu heftig, nicht royal daher. Eine überzeugende Katharina von Medici spielte Anja Schweizer. Der politische Zynismus, Ihr Machtanspruch war hervorragend gespielt.

Nicht überzeugt hat mich die Personenführung bei den beiden Söhne Katharinas, Heinrich von Anjou (Lukas Hupfeld) und König Karl IX., (Martin Hohner). Zu Pubertär, zu primitiv war ihre Darstellung. Sie spielten, was die Regie verlangte, und dies taten sie ausgezeichnet.
Erfreulich dagegen war die Inszenierung der Bartholomäusnacht selber: Diese Szenen hätten es in sich gehabt, sehr blutig daherzukommen. Die Regie verzichtete auf diesen Horror und liess es bei Andeutungen, sehr deutlichen zwar, aber durchaus erträglich, bewenden.
Relativ unpräzise herausgearbeitet waren die unterschiedlichen Beziehungen unter den dargestellten Personen. Die Geschichte war sehr schwierig nachzuvollziehen und ohne vertiefte Kenntnis in der französischen Geschichte, der französischen Religionskriege nicht leicht verständlich. Aber! Was die Regie von den Schauspielerinnen und Schauspielern verlangte, zeigten die Freiburger KünstlerInnen auf der Bühne mit hoher Professionalität und viel Einsatz.

Den Einsatz von Individualmikrophonen beurteile ich jedoch eher negativ. Die Verstärkung erlaubt ein höheres Sprachtempo, da nicht mehr laut gesprochen werden muss. Dies geht zu Lasten der optimalen Diktion, im Klartext, zu Lasten der Sprachverständlichkeit. Und dies bei einer Produktion, welche in hohem Masse von genau dieser Sprachverständlichkeit lebt, leben muss. Es geht aber auch anders: Die Ansprache von Hartmut Stanke (Henrich II. und Admiral de Coligny) am Hochzeitsessen von Margarete von Valois. Dank seiner klaren Diktion, seinem angepassten Sprachduktus war, ohne übertrieben Lautstärke, jedes Wort zu verstehen. Bravo! Falls Mikrophone verwendet werden müssen, ist es wesentlich, dass die KünstlerInnen auf der Bühne mit dieser neuen Technik vertraut sind und die Regie, genau wie im Musiktheater auf optimale Diktion und richtiges Sprachtempo achtet. Der Regisseur Olivier Py hat anlässlich eines Interviews gesagt:> Ohne Worte(Verständlichkeit (keine Musik<, und dies gilt auch für das Sprechtheater, wo die Sprachkunst, die Verständlichkeit das Transportmedium für die zu erzählende Geschichte ist, sein muss.
Das Premierenpublikum belohnte die Arbeit des gesamten Teams mit langanhaltendem, hochverdientem Applaus.
© Fotos Birgit Hupfeld
Peter Heuberger 29.1.2019
Credits
Katharina von Medici: Anja Schweizer,
König Karl XI.: Martin Hohner, Heinrich von Anjou: Lukas Hupfeld, Margarete von Valois: Rosa Thormeyer, Claudia: Stefanie Mrachacz, Heinrich II. Admiral de Coligny: Hartmut Stanke, Heinrich de Guise: Henry Meyer, Johanna von Navavarra, Nostradamus: Janna Horstmann, Heinrich von Bourbon: Thiess Brammer, Carolina: Angela Falkenhan, La Mole: Tim Al-Windawe.
WEISSES RAUSCHEN
Text: Bruce McKenzie nach dem Roman von Don de Lillo
Regie: Daniel Fish
Premiere: 5. Januar 2019

Eine grosse weisse Wand, in dieser Wand ein schwarzes Loch, so sieht das grosse Haus in Freiburg beim Eintritt aus. Intendant Peter Carp gibt einen Hinweis: Konzentriert euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen nicht zu stark auf den englischen Text, das Verstehen der einzelnen Wörter ist nicht so wichtig wie der Gesamteindruck: Text und Video!
Danke! Am Schluss, nach kurz gefühlten 80 Minuten wird mir klar dass dieser Hinweis für das Verständnis des Schauspiels/der Installation wesentlich ist. Der Roman WEISSES RAUSCHEN von Don DeLillo, entstanden 1986 analysiert die vom Konsumzwang beherrscht Pseudoelite Amerikas. Auch 33 Jahr nach dieser Analyse ist von hoher Aktualität, dies nicht nur in Amerika, nein auch hier in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt.

Wir besitzen unsere Erde nicht, wir haben sie nur bestmöglich für unsere Kinder zu verwalten! Mantra artig wirft uns der Schauspieler Bruce McKenzie, im schwarzen Loch sitzend, Begriffe aus unserer Konsumwelt, aus unserem verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und Umwelt entgegen:
Decken Stiefel, und Schuhe, Stifte und Bücher, Clever, brutal, verrückt nach Kino und Trivialwissen, ein verbarrikadierter Raum, Maschinengewehrsalven, Megaphone und Kampfanzüge,
Der ganze Text kann im Programmheft weisses Rauschen nachgelesen werden. Untermalt, begleitet, verstärkt wird dieser Text von Videos mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Dieses Video von Jim Findlay ist ein Meisterwerk in sich. Dazu kommt stimmige Lichtdesign und eine subtile Tonuntermalung der gesamten Aufführung.

Das Theater Freiburg hat diese Produktion zusammen mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen ermöglicht. Das werk wird 2019 in New York wieder auf der Bühne zu sehen sein.
Das Premierenpublikum belohnte die Arbeit des Teams mit grossem, langanhaltendem Applaus.
Peter Heuberger 20.1.2019
Fotos von Marc Doradzillo
DIE FLEDERMAUS
Premiere 19.11.2018
2. Aufführung vom 17.11.2018

Eigentlich hätte man diese Aufführung absagen müssen: Gleich mit drei kurzfristigen Krankheitsfällen musste das Theater fertigwerden, und das ausgerechnet bei den drei Hauptrollen. Wie es das Freiburger Theater geschafft hat, so schnell Ersatz zu finden, bleibt sein Geheimnis. Ein Wunder auch, wie dieser chaotische Abend doch noch irgendwie über die Bühne ging. Allein dafür gebührt Respekt, denn offensichtlich blieb keine Zeit, um Bewegungen, Gesten und Dialoge richtig einzustudieren.
Schon im ersten Akt stehen sich also mit Eisenstein (Peter Bording für den erkrankten Roberto Gionfriddo), Rosalinde (Katharina Persicke für die erkrankte Solen Mainguené) und Adele (Katharina Ruckgaber für die erkrankte Samantha Gaul) drei Personen gegenüber, die so nicht geplant waren (immerhin spielen aber die beiden Damen ihre Rollen gerade in Darmstadt). Katharina Ruckgaber meistert ihre Rolle am besten, ihr sieht und hört man das Einspringen nicht an, Peter Bording macht seine Sache ganz gut, Katharina Persicke übertreibt es mit ihren dramatischen Gesten etwas, vermutlich der Darmstädter Inszenierung geschuldet. Für beinahe Stehgreif-Theater agieren und singen diese drei aber ausgezeichnet.

Was mehr Sorgen machen sollte, ist die Tatsache, dass sich das Miteinander der „Stammspieler“ in ihrem Chaos nicht wesentlich von den „Einwechselspielern“ unterscheidet. So ist Joshua Kohl als Alfred zwar gut bei Stimme, weiss aber oft nicht, wo er stehen und gehen soll und nervt durch sein ständig lasziv kreisendes Becken. Junbum Lee als Advokat Blind hat extreme Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Dirigenten und steht grundsätzlich am falschen Ort. Juan Orozco als Gefängnisdirektor Frank fühlt sich im komischen Fach offensichtlich unwohl. Michael Borth als Dr. Falke bleibt trotz schöner Stimme blass.Die arme Angela Falkenhan als Fröschin muss – die Gedanken sind frei pfeifend – mit umgeschnalltem Bauch durch die Bühnendekoration stolpern, dass man vom Zusehen schon ganz blau anläuft.

Nichts gegen weibliche Frösche – aber lustig ist anders. Juliane Stolzenbach Ramos muss sich als Ida einen Penisschutz umbinden lassen. Und der androgyne Prinz Orlowsky alias Inga Schäfer muss in High Heels zu Technobeats abtanzen. Das völlig verunglückte Bühnenbild (Michel Schaltenbrand) tut Übriges: Das biedere Wohnzimmer der Eisensteins wird nur halb weggedreht, sodass man eigentlich nur eine Wand von Orlowskys Schloss sieht, dementsprechend ärmlich sieht es auf dem prunkvollen Ball aus. Die Groteskheit der Kostüme (Gwendolyn Jenkins), irgendwo zwischen Variété-Groteske und 80ern, stehen im krassen Gegensatz zu der gähnenden Langweile, die sich auf dieser Party ausbreitet. So hölzern wie Beate Baron inszeniert hat der Prinz wahrlich nichts zu lachen.
Dem fast klinischen Dirigat von Gerhard Marksonist sämtlicher Wiener Charme abhandengekommen, zugegebenermassen hatte er an dem Abend aber genügend damit zu tun, einigermassen die Übersicht zu behalten.

Die Fledermaus mit ihren eingängigen Schlagerarien, dem herrlichen Text, der komödiantischen Leichtigkeit, verleitet dazu, sie nicht ganz ernstzunehmen. Eine Krankheit übrigens, an der die meisten Operetteninszenierungen leiden. Dass hier ziemlich komplexe Musik mit schwierigen Tempowechseln vorliegt, dass hier jeder Satz, jede Geste und jeder Stolperer sitzen muss, verlangt aber von den Protagonisten mehr ab, als gar manche Oper. Hier wurde die Komplexität völlig unterschätzt. Ausserdem spürt man bei jedem Ton die Furcht der Regisseurin ins Schenkelklopferische, Derbe, Urkomische abzugleiten. Herauskam ein langweiliges, träges und zum Teil völlig wirres Nebeneinander.
Der Regisseurin (Beate Baron) soll doch bitte jemand eine Karte für den 31.12. in der Staatsoper spendieren….
Alice Matheson 23.11.2018
© T+T Fotografie 2018
Das Nibelungenlied
UA am 20.10.2018
Die Nibelungen als Gruppentherapie

Jeder, wirklich jeder meint, das Nibelungenlied zu kennen - insbesondere den Wagnerianern gilt es so viel wie die Bibel - aber nur wenige haben das um 1200 von einem unbekannten Autor verfasste aber auf wesentlich frühere Schriften zurückgehende Werk tatsächlich gelesen. Erschwerend kommt dazu, dass die Geschichte in zahlreichen verschiedenen, zum Teil fragmentarischen Handschriften überliefert ist, von denen v.a. die im 18. Jahrhundert wiederentdeckte St. Galler Handschrift heute als richtungsweisend gilt. Vergessen wird dabei oft, dass die Story paneuropäisch ist - tatsächlich ist Siegfried ein Niederländer - erst seit Wagner gilt der Stoff als deutsches Nationalepos.
Tatsächlich stützte sich Wagner - und auch z.B. Thomas Mann - auch stark auf einen anderen Text, nämlich die isländische Völsunga Saga, welche die Lücken des Nibelungenliedes zu füllen vermag.

Die 39 Aventüren des Nibelungenliedes nachzuspielen, würde natürlich ewig dauern, deshalb konzentriert sich die Truppe auf die Episoden von der Werbung Siegfrieds um Kriemhild über Gunthers Betrug an Brünnhilde und den Streit der Frauen bis zur blutigen Rache der Kriemhild, die zum Tode Siegfrieds und der Vernichtung der Burgunder durch die Hunnen um 436 führt.
Eigentlich ist Jernej Lorenci dabei nicht der alleinige Regisseur, wurde doch der Text von den Schauspielern selbst als Hausaufgaben erarbeitet. Die Proben wurden da zum kollektiven Kreativprozess, während dessen das Endprodukt erst entwickelt wurde. Zurückgreifen konnte Lorenci ausserdem auf sein altbewährtes Team aus slowenischen Landsleuten wie Branko Hojnik (Bühne), Branko Rozman (Musik) und Gregor Lustek (Choreographie), sowie Belinda Radulovic (Kostüme). Die Schauspieler - oder eben Co-Autoren - sind allesamt glänzend, es agieren Tim Al-Windawe, Victor Calero, Martin Hohner, Janna Horstmann, Lukas Hupfeld, Holger Kunkel, Henry Meyer, Laura Angelina Palacios und Michael Witte.

Zwar hat man permanent das Gefühl, eine Gymnasialklasse bei der Semesterlektüre oder eine Therapiesitzung der Anonymen Alkoholiker zu belauschen und das ganze vier Stunden lang. Es ist aber durchaus reizvoll, die Story aus den verschiedensten Perspektiven der Protagonisten nacherzählt zu hören, vor allem da eine durchaus alltagstaugliche Sprache verwendet wird. Dabei agieren die Schauspieler weniger miteinander als mit dem Publikum, erläutern eben ihre Sicht der Dinge in Erzählmanier und bringen dabei so einige Details ans Licht. Das ist so inspirierend, dass gar mancher im Publikum sich den alten Stoff nach diesem Abend noch einmal vornehmen wird, was in unserer lesefaulen Welt durchaus als Erfolg zu verbuchen ist.
© Marc Doradzillo
Alice Matheson 24.10.2018
EUGEN ONEGIN
Premiere am 28.9.2018
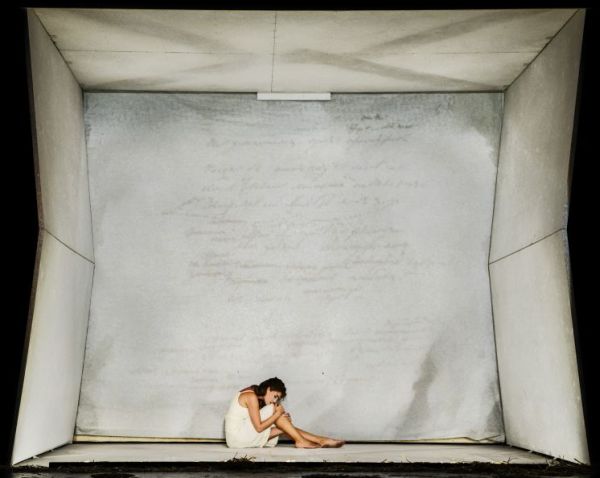
Puschkins Versnovelle gilt - zu Recht - als Glanzstück der russischen Literatur, und in der 1879 uraufgeführte Oper kann selbst der des Russischen Unkundige die Schönheit der Sprache erahnen, Tschaikowsky sei Dank, der sich gleich selbst um die Texttreue des Librettos bemühte. Die Musik ist grandios, die Handlung ebenso einfach wie mitreissend, und der Rollen gibt es dankbar wenige. Ideale Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Produktion.
Der neue Intendant des Freiburger Stadttheaters, Peter Carp, inszeniert hier gleich selbst. Das allerdings mit mässigem Erfolg. Zwar ist das Bühnenbild (Kaspar Zwimpfer) des sich faltenden Briefes nicht unbeeindruckend, aber dem fleissigen Theatergänger sind überdimensionierte, z.T. als Video auf die Rückwand geworfene Briefe durchaus geläufig (z.B. aus der Linzer Produktion dieses Jahres).

Der Gutshof der doch durchaus vermögenden Larina wurde zu einer verfallenen Scheune im Western-Stil degradiert (in der praktischerweise auch die Duell-Szene stattfindet). Die Petersburger High Society bei einer Vernissage in einer Kunstgalerie auflaufen zu lassen, ist eine ganz nette Idee, besonders da es sich bei den Kunstobjekten um Fotos der früheren Scheune handelt. Auch Tatjanas intellektuelle Eröffnungsrede im Gegensatz zu Onegins Herzschmerz ist ein intelligenter Kunstgriff. Dass sich aber Tatjana später heimlich zurück in die Galerie schleichen soll, ist doch eher abwegig, macht doch Puschkin deutlich, wie sehr Onegin Tatjana verfolgt (und nicht umgekehrt). Überhaupt bewegen sich die Protagonisten etwas hölzern, insbesondere Lenski und Onegin wissen nichts mit sich anzufangen, und wirken in der Duellszene eher verloren.
Glücklicherweise landet Freiburg aber mit der Besetzung der Tatjana durch die junge Französin Solen Mainguiné einen Volltreffer. Endlich einmal eine Tatjana, der man das junge, unschuldige Mädchen abnimmt! Ihre Stimme ist melodiös und zart, manchmal fehlt noch etwas Fülle, aber hier wächst eine fantastische Sängerin heran, die auch noch umwerfend aussieht.

Michael Borth singt einen soliden, wenn auch nicht grandiosen Onegin, auch hier dürfte es sich lohnen, der jungen Stimme noch etwas Zeit zu geben. Optisch wirkt Onegin etwas blass, nicht zuletzt wegen der zurückhaltenden und die Standesunterschiede ignorierenden Kostüme (Gabriele Rupprecht): Wohin ist der weltmännische Dandy verschwunden? Wirklich ausgezeichnet macht sich der Amerikaner Joshua Kohl als Lenski, seine Tenorstimme ist schön und berührend, sein Spiel überzeugend. Ein grosser Erfolg ist der Abend auch für Jin Seok Lee als Prinz Gremin sowie Inga Schäfer als Olga, und Roberto Gionfriddo hat als clownhafter Triquet die Lacher auf seiner Seite. Satik Tumyan als Larina und Anja Jung als Filipjewna runden das Ensemble ab. Fabrice Bollon bringt das Philharmonische Orchester dazu, Tschaikowsky völlig ohne schwüles Pathos zu spielen, was gar nicht so einfach ist, aber ein aufregendes Ergebnis liefert.

Onegin ist eine alltägliche kleine Geschichte um verpasste Chancen und schlechtes Timing, zeitlos und unbestimmt, und trifft uns deshalb stets mitten ins Herz. Wer wünschte sich nicht, sich irgendwann anders entschieden zu haben? Die Tränen im Publikum flossen an dem Abend jedenfalls zu Recht reichlich.
Dank für die aussagekräftigen Bilder an (c) Tanja Dorendorf
Alice Matheson 2.10.2018
CORALINE
Fantasy-Oper von Mark-Anthony Turnage
Premiere am 15.6.2018

Die 2002 erschienene Novelle des britischen Autors Neil Gaiman wurde bereits 2009 von Henry Selick als preisgekrönter Animationsfilm verfilmt. Meine Kinder haben heute noch Alpträume von dem Film. Denn Neil Gaiman schrieb nicht einfach eine Horrorstory. Jedes Kind kann sich mit der elfjährigen Coraline (die Umdrehung der Vokale des gebräuchlicheren "Caroline" kommt nicht von ungefähr) identifizieren, die sich von ihren Eltern unverstanden fühlt, einsam und gelangweilt ist. Gerade umgezogen, ist sie begierig darauf, ihre neue Umgebung zu erforschen, alleine, schliesslich ist sie ein Einzelkind, die Eltern sind gestresst und haben nie Zeit und Freunde hat sie keine. Promt findet Coraline eine Geheimtür und landet in einer Parallelwelt im eigenen Heim, in der eine "Andermutter" ganz viel Zeit für sie hat, der Vater sie verwöhnt, stets ihre Lieblingsspeisen auf dem Tisch stehen und auch die anderen ziemlich skurrilen Hausbewohner (ein Mäuseorchesterdirigent und ehemalige Schauspielerinnen) plötzlich netter und erfolgreicher sind.
Nur einen Makel haben die Bewohner der Parallelwelt: Ihre Augen bestehen aus schwarzen Knöpfen. Und bald schwant Coraline, dass ihre ach so liebe Andermutter, die unbedingt möchte, dass das Mädchen für immer bei ihr bleibt, nicht so harmlos ist, wie sie scheint. Als die Andermutter dann auch noch Coralines Eltern kidnappt, steckt man plötzlich mittendrin in der Horrorstory. Doch Coraline hat einen Plan…

Die nunmehr vierte Oper des britischen Komponisten Mark-Anthony Turnage - die nur wenige Wochen vor der Freiburger Premiere an der Royal Opera in London uraufgeführt worden war - weicht auch mal ab von der Buchvorlage, so ist zum Beispiel Coralines Vater nicht mehr Schriftsteller sondern ein verrückter Erfinder und die sprechende Katze wurde gar gestrichen. Die Musik des klassisch ausgebildeten Komponisten lässt sich in keine Schublade stecken (jazzige Pop-Klassik?), von Tango und Walzer bis zu schrägen Dissonanzen (vor allem wenn die Andermutter ihr wahres Gesicht zeigt) ist da so ziemlich alles vorhanden. Fabrice Bollon leitet das Philharmonische Orchester Freiburg sicher durch die gar nicht einfache Partitur. Die Welt der kleinen Coraline ist farbenfroh und einfallsreich gestaltet, genial die sich drehende Bühne (Giles Cadle), deren Rückwand die Parallelwelt darstellt, wo alles gleich aber durch die gespiegelte Anordnung des Interieurs doch irgendwie anders ist. Die phantasievollen Kostüme (Gabrielle Dalton) verdienen einen Oscar, schon allein für ihre Knopfaugenlösung.
Eine absolute Idealbesetzung ist Samantha Gaul als Coraline, die trotz des Altersunterschieds die Elfjährige absolut überzeugend und mit viel Lust am Kindsein spielt und singt. Die transzendente Musik kommt ihrem kristallenen Sopran sehr entgegen. Insbesondere Inga Schäfer als Mutter aber vor allem als Andermutter sorgt für die nötige Portion Grauen. Aber auch John Carpenter als Vater/Andervater, Roberto Gionfriddo als die beiden Mr. Bobo und Geisterkind 2, Amelie Petrich als die beiden Miss Spink und Geisterkind 1, Anja Jung als die beiden Miss Forcible und Daeho Kim als Geisterkind 3 machen ihre Sache ausgezeichnet.

Wenn man der britischen Regisseurin Aletta Collins einen Vorwurf machen kann, dann dass die Oper lange nicht so gruselig ist wie Buch und Film. Dadurch wird das Stück aber absolut kindertauglich, und Kinder sind ja schliesslich - wie bei Alice im Wunderland - das Zielpublikum, und hierbei gelingt eine Punktlandung: Ohne Ausnahme jedes Kind wird sich hier wiedererkennen, und das Motto der Geschichte wird sich tief in die Kinderseele brennen: Mutig ist nicht der, der keine Angst hat. Mutig ist, wer Angst hat und es trotzdem tut. Volle Punktzahl.
Alice Matheson 26.6.2018
© Birgit Hupfeld
Stef Lernous
The Black Forest Chainsaw Opera
(UA 5.5.) – Vorstellung vom 17.5.2018
Wenn die Zuschauer massenweise angeekelt fliegen...
Um es für einmal vorweg zu nehmen: Das war das Schrecklichste, das ich je auf einer Bühne gesehen habe. Die zahlreichen Zuschauer, die während der Aufführung (und das war nicht einmal die Premiere, sie waren also gewarnt) den Saal verliessen, waren der gleichen Meinung. Allerdings – auch gleich vorweg: Genau diese Reaktion war beabsichtigt. Schliesslich ist der für Konzept, Regie und Kostüme verantwortliche belgische Theaterschaffende Stef Lernous ein glühender Fan des für diese Produktion als Vorbild dienenden Trash-Horrorfilms „The Texas Chain Saw Massacre“ von Tobe Hopper aus dem Jahre 1974 (2003 gab es ein Remake von Michael Bay, übrigens 1990 auch eine deutsche Version von Christoph Schlingensief). Auch dieser Film spaltet seine Zuschauer in Abschalter (resp. aufs Klo rennende) und glühende Verehrer.
Die Story des Films ist relativ einfach und wurde inspiriert vom Fall des Serienmörders Ed Gein: Eine Gruppe von fünf jungen Leuten fällt in Texas einer kannibalistischen Familie ehemaliger Schlachter in die Hände, nur eine junge Frau entkommt.
Stef Lernous, der dieses Stück in Koproduktion mit seiner für verstörende Aufführungen bekannten belgischen Theatergruppe „Abbatoir Fermé“ (was passenderweise so viel wie „geschlossenes Schlachthaus“ heisst) einstudiert hat, versetzt die Szenerie in ein abgelegenes heruntergekommenes Blockhaus im Schwarzwald mitsamt Hirschgeweih und Kuckucksuhr (Bühne: Sven Van Kuijk), und setzt auch inhaltlich eigene Akzente. So handelt sich bei den Eindringlingen um ein Produktionsteam von Horrorfilmen oder der Sohn beginnt eine stürmische Affäre mit einer leicht durchgedrehten Dame, bevor er diese zerstückelt. Effektvoll auch, wie die Kinder die Schädel vergangener Opfer vor sich halten und im Wiegeschritt fast anklagend diese repräsentieren. Natürlich dürfen die beinahe sehnsüchtig erwarteten Horrorutensilien wie Fleischerschürze, Kettensäge und Hammer (mit dem einem Opfer auch mal bühnenwirksam der Schädel eingeschlagen wird) nicht fehlen.
Da es sich um eine Oper handelt, wird auch gesungen. Grosses Lob für das einzige Orchestermitglied, den am Bühnenrand spielenden Pianisten Mihai Grigoriu, der nicht nur das Hauptthema komponiert hat, sondern auch in das Geschehen mit einbezogen wird, zum Beispiel ebenfalls zur Zigarette greift, wenn es alle anderen tun. Die Arien sind ein bunter Mix aus Geklautem: Schwedische Volkslieder, Abba, „In Dreams“ von Roy Orbison (gesungen von einem Schwarzwaldmädel, bevor es unter grausamen Schreien in ein Bodenloch gezogen wird), Lieder von Brahms, Dvořák und Purcell, im krassen Gegensatz natürlich zum Optischen.
Die Schauspieler von Abbatoir Fermé (Inga Schäfer, Chiel van Berkel, Tine Van den Wyngaert, Kirsten Pieters) und des Theaters Freiburg (mit herausragender Stimme: Roberto Gionfriddo, daneben Janna Horstmann, Lukas Hupfeld, Holger Kunkel) geben wirklich ihr Bestes, dennoch wirkt die Oper wie eine Anreihung eindrücklicher Horrorszenen, ohne dass ein wirklicher Ablauf zu erkennen ist: Eine Schauspielerin erscheint als Äffin mit voller Körperbehaarung, ein nacktes Paar wird zur Beobachtung in einen Glaskäfig gesperrt (passend zur Musik der „zwei Königskinder“), eine Schönheitskönigin wird mit roten Trauben so vollständig eingerieben, dass es scheint, als würde man ihr die Gedärme herausreissen, usw. Eindrückliche, schreckliche Bilder ohne Handlungsstrang, lose inspiriert von amerikanischen Horrorfilmen, die das Prädikat „absolut sinn- und wertlos“ geradezu herausfordern.
Ich verliess das Theater mit dem gleichen flauen Gefühl im Magen wie beim kürzlichen Besuch der Comic-Con mit meinen Teenagern: Den Freaks wird’s gefallen.
Alice Matheson 31.5.2018
Bilder*
Die Redaktion verzichtet aus Rücksicht auf unsere Leser, die sich zu 99 Prozent wahrscheinlich nicht aus Perversen zusammensetzt (jedenfalls hoftt das die Redaktion ;-) - und aus Jugendschutzgründen - auf Bilder dieses Machwerks.
P.S.
Bitte lesen Sie dazu auch den Tageskommentar des Herausgebers.
Musiktheater Saison 2018 / 2019
Peter Carp hat, mit seinem künstlerischen Team, für die zweite Spielzeit als Intendant von Freiburg ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

© Britt Schilling
Dies ist meine zweite Spielzeit als Intendant des Theater Freiburg und ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam die Antennen wieder auf Empfang zu stellen und den eingeschlagenen Weg der Internationalisierung unseres Hauses weiterzugehen. Nur in der Auseinandersetzung mit Neuem, manchmal Ungewohntem oder Fremdem eröffnen sich auch neue Perspektiven, Ideen und Inspiration.
Ich glaube, es ist wichtig, auf eine Zeit, in der wieder mehr und mehr Grenzen gezogen und Unterschiede betont werden, mit Vertrauen, Mut und Offenheit zu reagieren. Ich freue mich auf die neue Spielzeit mit Ihnen in Ihrem Theater Freiburg.
Bleiben Sie neugierig. Ihr Peter Carp
Peter Iljitsch Tschaikowsky
EUGEN ONEGIN
Musikalische Leitung Fabrice Bollon
Regie Peter Carp
Freitag 28.09.2018 // Großes Haus
Anno Schreier
WUNDERLAND
Regie Jörg Behr
Sonntag 04.11.2018 // Kleines Haus
Johann Strauss
DIE FLEDERMAUS
Musikalische Leitung Gerhard Markson
Regie Beate Baron
Samstag 10.11.2018 // Großes Haus
Deutsche Erstaufführung
César Franck
HULDA
Musikalische Leitung Fabrice Bollon
Regie Tilman Knabe
Samstag 16.02.2019 // Großes Haus
Wolfgang Amadeus Mozart
DON GIOVANNI
Musikalische Leitung Daniel Carter
Regie Katarzyna Borkowska
Co-Regie Tatjana Beyer
Freitag 12.04.2019 // Großes Haus
Claude Debussy
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Musikalische Leitung Fabrice Bollon
Regie Dominique Mentha
Samstag 25.05.2019 // Großes Haus
Uraufführung
Céline Steiner, Ruslan Khazipov und Georg Friedrich Händel
SCHAU MICH AN (AT*)
Künstlerische Leitung Alexander Schulin,
Brice Pauset, Neil Beardmore, Tatjana Beyer
Kooperation mit der Hochschule für Musik Freiburg
Samstag 15.06.2019 // Kleines Haus
LA BOHÈME
Premiere: 21. April 2018
Eine Produktion von Frank Hilbrich der Extraklasse

Harold Meers / Solen Mainguenè
Der deutsche Regisseur Frank Hilbrich ist am Theater Freiburg nicht unbekannt. Er hat hier einige erfolgreiche Produktionen gezeigt: „DER RING DES NIBELUNGEN“, „LOHENGRIN“, „PARSIFAL“, „KASPAR HAUSER“, „DIE CSARDASFÜRSTIN“. Alle diese Produktionen wurden vom Freiburger Publikum sehr gut aufgenommen. Am 21. April 2018 fand die Premiere seiner ersten Puccini-Produktion statt. „LA BOHÈME“.
Um es vorweg zu nehmen: Selten habe ich Regie-Arbeiten gesehen und gehört, welche den Standard von Hilbrichs Arbeit mit seinem gesamten Team erreichen. Seine ausserordentliche schauspiele-risch/musikalische Personenführung, seine Akribie, mit welcher Hilbrich auf die Diktion achtet, sein Einfluss auf Kostüme, Lichtdesign und Bühne erstaunen mich immer wieder. Hilfreich dabei ist natürlich, dass er immer wieder mit den gleichen Künstlern (Thiele, Rupprecht und Philipp) in diesen Bereichen arbeitet. Dazu kann ich als Rezensent nur sagen: Einige Regisseure/Regisseurinnen könnten sehr viel von der Arbeit Hilbrich lernen und profitieren.
 Frank Hilbrich hat seine Bohème im 21. Jahrhundert angesiedelt. Fernsehkamera, Laptop sind allgegen-wärtig. Die Geschichte, welche erzählt wird, ist bekannt. Die Story ist sehr einfach und die Handlung eher statisch. Wesentlich wichtiger ist die Interaktion zwischen den einzelnen KünstlerInnen auf der Bühne, dies sowohl emotional als auch musikalisch. Und hier wächst Hilbrichs Regie über sich hinaus: Die musikalisch/emotionale Personenführung in jedem der vier Bilder ist zwingend und sehr eindringlich. So eindringlich, dass der sonst übliche Zwischen-Applause fast immer wegfällt, sehr zu meiner Freude.
Frank Hilbrich hat seine Bohème im 21. Jahrhundert angesiedelt. Fernsehkamera, Laptop sind allgegen-wärtig. Die Geschichte, welche erzählt wird, ist bekannt. Die Story ist sehr einfach und die Handlung eher statisch. Wesentlich wichtiger ist die Interaktion zwischen den einzelnen KünstlerInnen auf der Bühne, dies sowohl emotional als auch musikalisch. Und hier wächst Hilbrichs Regie über sich hinaus: Die musikalisch/emotionale Personenführung in jedem der vier Bilder ist zwingend und sehr eindringlich. So eindringlich, dass der sonst übliche Zwischen-Applause fast immer wegfällt, sehr zu meiner Freude.
Seine Interpretation des ersten Bildes ist stringent. Gerade dieses erste Bild verführt zum statischen Rampensingen und dieser Gefahr ist Hilbrich genial ausgewichen. Mit einer Fernsehkamera (im normalen Leben ein Handy) stellen sich die die vier Protagonisten Rodolfo (Harold Meers), Marcello (Michael Borth), Schaunard (John Carpenter) und Colline (Jin Seok Lee) im heutigen Selfie-Stil immer wieder neu auf der Leinwand dar. Diese erste Bild schliesst mit der Schlüsselszene, in welcher sich Rodolfo und Mimi (Solen Mainguené) das erste Mal begegnen.

Jin Seok Lee, Harold Meers, Solen Mainguenè, Michael Borth, Katharina Ruckgaber
Leichter zu inszenieren scheint das zweite Bild zu sein. Musetta (Katharina Ruckgaber) erscheint mit ihrem derzeitigen Geldgeber Alcindoro (Juan Orozco). Interessant ist hier die Arbeit der Kostümentwer-ferin: Sie stellt den farbefrohen Kinderchor den schwarzgekleideten (Trauer) Eltern gegenüber. Dies nimmt ist eine subtile Anspielung auf das tragische Ende Mimis (memento mori).
Einen Höhepunkt im dritten Bild ist Quartett, eigentlich zwei Duette: Eifersüchtig Marcello/Musetta, verliebt Rodolfo/Mimi. Hier wird die Qualität, der Professionalismus des philharmonischen Orchesters und seines Dirigenten so richtig gefordert: Die Partitur zeigt gegenläufige, ineinander verlaufende Melodielinien und die SängerInnen auf der Bühne müssen/sollen musikalisch gleichwertig dargestellt werden. Auch dies natürlich eine Herausforderung für die Regie. Die Emotionen können gefühlt, die unterschiedlichen Melodien gehört, der Text sehr gut verstanden werden.

Der amerikanische Tenor Harold Meers interpretiert den Rodolfo mit perfekter Diktion, mit einer Melodieführung, welch ihresgleichen sucht und einer Körpersprache, welche jeden Ton, jede Silbe unterstreicht, bestätigt und verstärkt. Seine Arie im ersten Akt („Che gelida manina“) gibt dem Publikum schon früh einen Vorgeschmack auf das Können von Meers. Ein Vergleich mit Luciano Pavarotti ist sei gewagt: Meers kann sehr wohl bestehen!
Solen Mainguené interpretiert Mimi einerseits als starke Persönlichkeit, welche andererseits unter ihrer fragilen Gesundheit leidet. Ihr Diktion, welche ich schon in ihrer Antonia (HOFFMANNS ERZÄHLUN-GEN) bewundert habe, ist auch hier wieder perfekt. Was ich bei Rodolfo betreffend Körpersprache erwähnt habe gilt für Mainguenè in noch stärkerem Mass. Dabei ist sie fähig ihre Emotionen mir ihrem Gesang perfekt auszudrücken. Ihre Stimmbeherrschung, ohne falsches Vibrato, ist so gekonnt, dass sie niemals Partnerinnen oder Partner auf der Bühne „an die Wand singt“. Dies spricht für ihre künstlerische Integrität und ihre Bühnensicherheit. Ihre Arie („Mi chiamo Mimi“) im ersten Akt sowie das Duett mit Rodolfo („O soave fanciulla“) zeugen von ihrem Können. Die gesungenen Emotionen der Beiden werden glaubwürdig und subtil ausgedrückt.

Der Bariton Michael Borth gibt seinen Marcello in hervorragender Weise und einer grossen Spielfreu-digkeit. Als Musetta stand Katharina Ruckgaber auf der Bühne. Ihre Performance war geprägt von einem schauspielerischen Talent und einer klaren Stimme mit hervorragender Diktion. Im Duett mit Marcello ebenso wie im Quartett mit Mimi, Rodolfo und Marcello war ihre stimmliche Präsenz zwingend und ihre Emotionen (Eifersucht) klar erkennbar. Dieses Quartett („Addio dolce svegliare all mattina“) hat es in sich, was Anpassungsfähigkeit an die Bühnenpartner betrifft: Alle Stimmen sind gleichwertig und dies erfordert optimale Zusammenarbeit/Zuhören unter den ProtagonistInnen. Dies war in Freiburg der Fall.
Für das Bühnenbild inklusive Video verantwortlich ist Volker Thiele. Die Kostüme wurden von Gabriele Rupprecht entworfen. Das Lichtdesign trägt die Handschrift von Michel Philipp.
Das Philharmonischen Orchester Freiburg mit seinem Dirigenten Daniel Carter, dem vom Chorleiter Norbert Kleinschmidt geleiteten Opern-Extra und Kinderchor Theater Freiburg überzeugt von Anfang bis Ende ohne Einschränkung. Die Subtilität, mit welcher Carter die Sänger begleitet und unterstützt, ist bewundernswert und zeugt von einer hohen Sensibilität für das Geschehen auf der Bühne.

Das vierte Bild, das Ende der Oper, gipfelt im Tode Mimis, optisch wunderbar unterstrichen mit einer toten Mimi im Vordergrund und dem sich entwickelnden Videobild im Hintergrund und mit leisen, traurigen Tönen Rodolfo: ‚Mimi Mimi‘! Kurzes Schweigen im Saal! So eindrücklich war dieses Schlussbild!
Das zahlreich erschienene Premieren Publikum belohnte die Arbeit des gesamten Teams mit lautstarkem und lang anhaltendem Applaus.
Peter Heuberger 24.4.2018
Bilder © Rainer Muranyi
LOVE LIFE
Vaudeville von Kurt Weill und Alan Jay Lerner
Premiere (deutsche EA) 9.12.2017
Grosses Kino in Freiburg
TRAILER

Gar mancher Musical- und Kurt Weill-Fan ist schockiert, noch nie etwas von diesem Stück gehört zu haben. Das hat aber seinen guten Grund: Hier in Freiburg feiert das Stück seine deutsche Erstaufführung! Dabei wurde es schon 1948 am Broadway uraufgeführt, immerhin unter der Regie von Elia Kazan (Kurt Weill war ja schon in den 30ern in die USA emigriert). Wer nun aber Weill erwartet, weil Weill draufsteht, wird enttäuscht: So gut integrierte sich der jüdische Flüchtling in den amerikanischen Lebensstil, dass seine Musik fast nichts mehr mit den in Deutschland komponierten bekannten Stücken gemein hat, zu stark saugte er die Einflüsse des Jazz, Blues, Ragtime, etc. in sich auf. Dass einzelne Musikstücke vertraut vorkommen, liegt nur daran, dass Weill die amerikanische Musicalszene wegweisend geprägt und etliche spätere Musicals stark beeinflusst hat. So imitierten die Musicals Cabaret und Chicago die Vaudeville-mässige Rahmenerzählung in Form von angekündigten Shownummern. Und der Song I remember it well wurde später im Film „Gigi“ benutzt.

Das Ehepaar Sam (mit toller Musical-Stimme: David Arnsperger) und Susan Cooper (vor allem darstellerisch überzeugend: Rebecca Jo Loeb) reflektiert über sein Leben, resp. stellvertretend über den Wandel in den Beziehungen zwischen Mann und Frau der letzten 150 Jahre (also ab ca. 1800). Es gab da eine Zeit, als das Ehepaar in eine amerikanische Kleinstadt im Wilden Westen zog, wo alles noch in Ordnung war, der Mann ein Mann und die Frau eine Frau war. Dann kommt die Eisenbahn: Die Ehemänner sind dauernd unterwegs. Unaufhörlich geht der Fortschritt in Form der industriellen Revolution weiter: Bald arbeiten alle Männer in der Fabrik, sind todmüde, wenn sie heimkommen. Der Siegeszug des Kapitalismus beendet jede Romanze im Keim, (das „das ist zwar ökonomisch“-Lied der vier Frankensteins ist zum Schiessen). Bald wollen die Frauen Mitspracherecht, Wahlrecht, Unabhängigkeit, die Liebe bleibt auf der Strecke. Und das dritte Kind, das sich Susan so sehr wünscht, sowieso.

Joan Anton Rechi inszeniert das wegweisende Musical mit vielen guten Regieeinfällen im von Weill bevorzugten Varietéstil, woran die immer wiederkehrende Theaterbühne auf der Bühne erinnert. Dabei bedient er sich genüsslich so gut wie aller Klischees, die Hollywood so zu bieten hat: Genial zum Beispiel, in der Illusion Minstrel Show die Illusion eines Märchenprinzen von der Disney-Figur Schneewittchen (beste Stimme des Abends: Samantha Gaul) singen zu lassen. Jeweils zeitlich passend flackern Filmausschnitte von „Vom Winde verweht“, „Modern Times“ und passend zur Scheidung die Abschiedsszene aus „Casablanca“ über die Leinwand. Manchmal schiesst Rechi aber auch über das Ziel hinaus: Alle Figuren aus „der Zauberer von Oz“ auflaufen zu lassen (der Kostümbildnerin Mercè Paloma gebührt allerdings ein Oscar), bringt zwar Leben auf die Bühne, die Verbindungen zwischen Zauberer von Oz und Varieté-Moderator oder einer Kleinstadt im Westen und Dorothys Kansas sind dann doch etwas an den Haaren herbeigezogen. Der arme Freiburger Chor war schliesslich mit den vielen Tanzszenen (Choreographie: Emma Louise Jordan) doch etwas überfordert. Eigentlich sollte das Stück vom englischen Weill-Spezialisten James Holmes dirigiert werden, als der indisponiert war, sprang kurzerhand Daniel Carter ein, der ein beeindruckendes Ergebnis ablieferte. Fantastisch, wie das Freiburger Orchester auch mal im Stil einer Big Band spielen konnte.

Erschreckend, wie sehr aber auch wie wenig sich die Beziehungen zwischen Mann und Frau in den letzten Jahrzehnten geändert haben. Weill lässt uns jedoch mit einem Hoffnungsschimmer zurück: Nach der bitteren Scheidung finden Sam und Susan wieder zusammen. Ohne Happy End geht es in Hollywood eben doch nicht.
Fazit: Weill-Fans sollten sich wappnen. Wer aber Disneyworld, Musicals und Hollywood-Filme mag, für den ist diese Produktion ein Muss.
Bilder (c) Birgit Hupfeld / Theater Freiburg
Alice Matheson 12.12.2017
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
LES CONTES D’HOFFMANN
Vorstellung vom 24. November 2017
Nach der sehenswerten Premiere von Offenbachs Meisterwerk, „HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN“, war ich bei meinem zweiten Besuch gespannt, wie sich die Produktion (Regie: Le Lab, Frankreich) entwickelt hat. Dabei musste ich als Erstes feststellen, dass die eingefügten Texte erst beim zweiten Besuch voll zur Geltung kommen, verstanden werden.

Der musikalisch/optische Impact dieser Freiburger Produktion ist zu stark, um zusätzliche Informationen/Eindrücke voll aufzunehmen. Hoffmann wurde an diesem Abend von Rolf Romei gesungen. Romei sang und spielte, obschon stimmlich angeschlagen, einen Hoffmann der in seiner Unsicherheit, seiner Zerbrechlichkeit neue Wege der Interpretation dieser Figur aufzeigt. Romei war als Sänger am heutigen Abend sicher nicht in Topform. Gerade aber die Zerbrechlichkeit seine Stimme, zusammen mit seinem herausragenden schauspielerischen Können brachte einen Hoffmann auf die Bühne, der als Persönlichkeit voll überzeugte. Für mich wieder einmal ein Beweis, dass nur gutes Singen im modernen Musiktheaterbetrieb einfach nicht mehr reicht. Festhalten muss ich aber auch noch folgendes: Die Leistung Romeis wurde nur durch die relativ offene Regieführung von Le Lab und der dazu gehörenden Dramaturgie von Tatjana Beyer und Luc Bourousse möglich. Unterstützt wurde die Darstellung des Protagonisten Hoffmann durch die starke Persönlichkeit seines Gegenspielers, Stadtrat Lindorf, Coppelius, Miracle und Dapertutto gesungen und gespielt von Juan Orozco. Dazu kommt, dass Hoffmann im 1. Akt (Prolog) von Andreas, (Roberto Gionfriddo) erschossen wird, das ganze spielt in der sehr kurzen Zeit zwischen Leben und Sterben, als Flashback auf einen alternativen Lebensentwurf E.T.A. Hoffmanns, einen Wunschtraum!

Im zweiten Akt, Olympia, prachtvoll gesungen von Katharina Ruckgaber, spielt/singt Romei den adoleszenten Möchtegern-Liebhaber von Olympia, dies trotz den Hinweisen von Niklaus, (Inga Schäfer), dass es sich um eine Puppe handelt.
Im dritten Akt, Antonia, (Solen Mainguené), sahen wir einen reifen Hoffmann, welcher, durch Antonias lebensbedrohende Krankheit verunsichert, nicht mehr weiter weiss: Bürgerliches Leben oder Bühnenkar-riere unter Lebensgefahr für seine Geliebte. Antonia entscheidet sich im wunderbaren Terzett mit ihrer Mutter, Anja Jung und Miracle (Orocko). Mainguené singt Antonia mit einer Kraft und einer Sicherheit, welche ihresgleichen sucht.
Im Akt vier, Giulietta (Juanita Lascarro) erleben wir Romei als hedonistischen Lebemann, zynisch, jedoch immer noch unsicher. Erst die Herausforderung Giuliettas, ihre von Habsucht getriebene, gespielte Liebe zu Hoffmann weckt in ihm eine gewisse Sicherheit, welche durch den Mord an Schlehmil unverzüglich wieder zerstört wird. Im Epilog stirbt Hoffmann endgültig, nachdem er noch eine letzte Strophe von Kleinzack gesungen hat.

Das Publikum belohnte die Leistung des gesamten Teams auf und hinter der Bühne mit dem verdienten Applaus. Ob wohl die Darstellung Romeis als Hoffmann bei allen so angekommen ist wie bei mir? Ich weiss es nicht.
Bilder (c) Tanja Dorendorf / T & T Fotografie
Peter Heuberger 5.12.2017
HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN
Premiere: 22. Oktober 2017
Kräftigt entstaubt und entromantisiert
Hervorragende Solisten, spannende Inszenierung, präzises und sauber spielendes Orchester, stimmiges Bühnenbild, gut geleiteter Theaterchor, ein Musiktheater- publikum, welches bereit ist sich auf Neues einzulassen: Dies sind die Ingredienzien, welche es für einen perfekten Opernabend braucht. Und all dies war am Premierenabend von „LES CONTES D’HOFFMANN“ in Freiburg vereint. Das ist mein Schlussfazit, war aber auch mein Eingangsgedanke.
Peter Carp, der neue Intendant, tritt ans Mikrophon: „Eine solche Ansage möchte er nur selten machen: Der Solist Rolf Romei ist erkrankt. Wir haben aber vor zwei Tagen einen Ersatz gefunden: Einen französischen Sänger aus Lyon: Sébastien Guèze, er wird nicht nur singen sondern auch spielen.“ Einige Takte Musik dann eine Videoeinspielung: „Die Jury hat Ernst Theodor Amadeus Hoffmann den Literaturpreis zuerkannt!“ Was soll das ein Opernabend und nicht Dialoge oder Monologe! O doch, es entspricht den Intentionen Offenbachs und dies hat schon Walter Felsenstein in seiner bahnbrechenden Inszenierung 1954 an der Komischen Oper Berlin erkannt.
Offenbach hat das Werk zumindest für die Uraufführung als Opéra comique, das heißt als Nummernoper mit gesprochenen Dialogen, konzipiert. Die Opera comique ist das Pendant zum deutschen Singspiel
Die Freiburger Regie hat diesen Hinweis aufgegriffen, ist weiter gegangen und hat gesprochene Originaltexte von E.T.A. Hoffmann eingestreut, als Verbindungen verwendet.
Auftritt Hoffmann: Ein Tenor mit einer Stimme kraftvoll und doch zerbrechlich, hervorragend intonierend, mit einer Diktion, welche selten zu finden ist. Eine Körperbeherrschung par excellence, Gestik und Mimik in jedem Moment der langen sehr langen Bühnenpräsenz. Mit der Interpretation in jedem der fünf Akte, Prologe, drei Akte und Epilog unterschiedlich der Situation angepasst. Sébastien Guèze ist Hoffmann, er spielt die Geschichte, welche erzählt wird glaubwürdig und zwingend: Makellos! Dazu kommt, dass er trotz seiner unglaublichen Bühnenpräsenz seine Mitspielerinnen und Mitspieler nicht an die Wand spielt, künstlerisch erdrückt, ganz nach dem Motto: Nur wenn die anderen gut sind, bin auch ich gut!
Konstantin Stanislawski: In der Schauspielvorstellung geht es um das Zusammenwirken von Körper und Seele. Das Grundkonzept besteht darin, dass der Mensch seine inneren Gefühle, Emotionen und Gemütsbewegungen durch sein Äußeres mittels der Haltung, dem Auftreten, dem Gehabe, sowie der Mimik und Gestik äußerlich sichtbar machen kann. Diese Idee hat Guèze verinnerlicht und lebt sie auf der Bühne glaubhaft aus. Es führt zu nichts, jeden der Auftritte zu beschreiben, es bleiben Worte. Einen Künstler wie Sébastien kann man nur erleben, sehen hören, ja mit ihm auf der Bühne stehen und leiden, sich freuen!
Als ausgezeichneten Lindorf hören und sehen wir Juan Orozco. Der Bariton aus Mexico, Ensemblemit-glied am Theater Freiburg, spielt und singt, wie in Hoffmann’s Erzählungen üblich, auch Coppelius, Miracle und Dapertutto. Er singt und spielt die vier Rollen überzeugend, mit klarer Diktion und sauberer Intonation. Auch seine schauspielerische Leistung überzeugt von Anfang an. Inga Schäfer als Muse und Niklaus gibt diese eher unscheinbare, aber zwiespältige, schwierige Rolle mit Bravour.
Generell kann bei allen Künstlerinnen und Künstlern eine hervorragende Sprachbeherrschung des französischen Librettos und eine vorzügliche Diktion festgestellt werden. Dies dürfte der intensiven Arbeit mit dem französischen Regieteam zuzuschreiben sein. Auf dieses Regieteam komme ich noch weiter unten intensiv zu sprechen.
Als Olympia erleben wir die junge Sopranistin Samantha Gaul, welche den Olympia Akt spielend dominiert, dies sowohl gesanglich als auch schauspielerisch. Sie ist eine Spezialistin der kleinen, aber effektiven Gesten. Jeder kleine Schritt unterstreicht die Wichtigkeit ihrer Rolle im gesamten Kontext des Werkes.
Die Interpretation der Antonia durch die französische Sopranistin Solen Mainguené ist ergreifend. Ihre Interaktion mit Hoffmann, ihre gelebte Abneigung gegen Miracle, ihre Hingabe zur Musik lässt niemanden kalt. Speziell erwähnenswert in diesem Akt ist das Duett mit Ihrer Mutter, hervorragend gesungen von Anja Jung, welch wir schon als Walküre in Frank Hilbrichs Ring-Inszenierung hören durften. Auch die Zwiespältigkeit, das Hin- und Hergerissen sein, zwischen der Liebe zur Musik und ihrer Liebe zu Hoffmann spielt und singt Mainguené mit viel Emotion.
Die venezianische Kurtisane Giulietta wird glaubhaft dargestellt und schön gesungen von der aus Kolumbien stammenden Sopranistin Juanita Lascarro. Der Giulietta Akt ist, trotz der allgemein bekannten Baccarole, wahrscheinlich der am schwierigsten glaubhaft zu inszenierende Teil des Bühnenwerkes. Juanita Lascarro gibt dem dritten Akt mit ihren Partnern Schlehmil, Pitichinaccio, und natürlich Hoffmann den nötigen Drive. Auch hier wieder Luan Orozco als grandioser Dapertutto mit der Spiegelarie.
Den Andrès, Cochenille, Franz und Pitichinaccio gab das Ensemblemitglied Roberto Gionfriddo, hier in eher komischen Rollen, welche er schauspielerisch und sängerisch hervorragend ausfüllte. Ich habe Roberto auch schon als hervorragenden Siegmund erlebt.
In weiteren Rollen waren zu sehen und hören: Anja Jung überzeugende „Stimme der Mutter“, auf der Bühne als Nathanael und Spalanzani Jörg Golombek, den Lutter und den Crespel gab Jin Seok Lee, den Wilhelm und den Wolfram sangen Jongsoo Yang und Stefan Fiehn und Schlehmihl und Herrmann wurde von John Carpenter gegeben. Speziell erwähnenswert sind die beiden Schauspieler, welche die Zwischentexte sprachen und spielten: Stefanie Mrachacz und Thiess Bramer. Frau Mrachacz übernahm auch die nicht singende Rolle der Stella.
Ein ganz spezieller Dank geht an das Künstlerkollektiv „Le Lab“, welches für die gesamte Produktion verantwortlich zeichnet.
Die Regisseure Jean-Philippe Clarac und Olivier Deloeuil, auch verantwortlich für die Kostüme, zeichnen sich aus durch ihre hervorragende Personenführung und der ausgezeichneten Arbeit mit den schauspielerischen Fähigkeiten ihres Künstlerteams auf der Bühne, so dass nicht nur professionell gesungen wird, sondern durch Gestik, Mimik, Bewegung auch Interaktionen zwischen den einzelnen Protagonisten_Innen entstehen. So und nur so können auf Musiktheaterbühnen Geschichten glaubhaft inszeniert werden.
Für das wunderbare Lichtdesign verantwortlich zeichnet Christophe Pitoiset, das sparsam aber effektiv eingesetzte Video kreierte Jean-Baptiste Beis. Zuständig für die Grafik war Julien Roques und als künstlerische Mitarbeiterin Lodie Kardouss. Alle sind Mitarbeiter_Innen im Kollektiv Le Lab.
Unter der Stabführung von Francis Bollon musizierte das Philharmonische Orchester Freiburg gekonnt mit viel Spielfreude. Der Opernchor Theater Freiburg meisterte seine zum Teil nicht einfache Rolle professionell.
Die Regisseure der Freiburger Produktion von Hoffmanns Erzählungen haben, wie weiland Wieland Wagner den Mut gehabt das Bühnenbild vom romantischen Ballast, vom Jugendstil-Groove zu befreien. Dazu muss man/frau JeClarac und Deloeuil gratulieren und auch danken. Nur mit diesem Mut kann sich das Musiktheater weiterentwickeln, allen Unkenrufen der ewig gestrigen zum Trotz, welche alles immer gleich im alten Stil haben wollen. Ohne diesen Mut müssten wir auch heute noch Brünnhilde im Flügelhelm und andere Stilblüten „bewundern“.
Das erwartungsvolle, zahlreich erschienene Freiburger Premierenpublikum wurde nicht enttäuscht. Es erlebte einen Opernabend der Spitzenklasse und belohnte die Leistung der Künstler auf der Bühne mit langanhaltendem Applaus. Die neue Ära in Freiburg, die Ära Peter Carp, hat spektakulär angefangen. Ich bin überzeugt dass die neue Intendanz im ähnlichen Stil weitermachen wird.
Peter Heuberger 23.11.2017
Zum Zweiten
JERUSALEM
Premiere: 1. Oktober 2016
Seine Kreuzzugsoper hat Giuseppe Verdi in zwei Fassungen aufgelegt, einmal als „Die Lombarden auf dem ersten Kreuzzug“ (1843) und dann als „Jerusalem“ (1847). Regisseur Calixto Bieito bringt in Freiburg eine eigene Fassung heraus, in der die Moslems als Gegner im Kreuzzug fehlen. Bei ihm wird die ganze Geschichte auf einen Familienkonflikt reduziert.
Wahrscheinlich denkt sich Bieito, dass sowieso niemand im Publikum diese Oper kennt, da sie erst im Januar 2016 ihre szenische deutsche Erstaufführung in Bonn erlebt hat, er mit dem Stück also anstellen kann, was er will. Vielleicht liegt hier auch ein Fall vorauseilender „politischer Korrektheit“ vor, und man befürchtet irgendjemand könne sich beleidigt fühlen, wenn man einen Krieg zwischen Christen und Moslems auf die Bühne bringt, der sich vor 900 Jahren ereignete.
In Freiburg läuft das Stück so ab: Ritter Roger will den Ritter Gaston umbringen lassen, weil dieser Rogers Nichte Helene heiraten will, auf die Roger auch ein Auge geworfen hat. Stattdessen wird aber Rogers Vater, der Graf von Toulouse, Opfer des Anschlags: Große Verwirrung und Schuldgefühle! Nach gut 40 Minuten ist der erste Akt beendet, dann folgt die Pause, und in den nächsten drei Akten und anderthalb Stunden kämpfen alle Personen mit ihrem schlechten Gewissen. Von dem wollen sie sich in Jerusalem befreien. Da die militärische Seite dieses Unternehmens gekürzt wird, ist die Freiburger Aufführung auch 25 Minuten kürzer als in Bonn.
Bei der Einführung durch Dramaturgin und Operndirektorin Domenica Volkert hört sich Bieitos Konzept intelligent und durchdacht an, die Umsetzung hat aber, trotz der hochkonzentrierten und spannungsgeladenen Umsetzung durch die Akteure, einige Durchhänger. Das gesamte Personal ist nur auf sich selbst und seine Probleme fixiert, so dass kaum Interaktion stattfindet, sondern alle Solisten an der Rampe stehen und mit traumatisiertem Gesichtsausdruck ihre Partie singen.
In Zusammenarbeit mit Bühnenbildnerin Aida Guardia entstehen immerhin eindrucksvolle Bilder. Bieito lässt Chöre gerne im Nebel, der von Gegenlicht durchflutet wird, auf der Bühne stehen und praktiziert dies auch in Freiburg. Im zweiten Teil des Abends befinden wir uns in einer Steinwüste. Nachteil dieser Steinlandschaft ist, dass sie fürchterlich unter den Füßen der Sänger knirscht. Ihr Vorteil ist, dass der Chor zu den Steinen greifen und mit diesen den Rhythmus des darauffolgenden Marsches klopfen kann.
Anderthalb Stunden steht Jin Seok Lee als Bösewicht Roger auf dem Steinhaufen mit ausgebreiteten Armen am Stacheldrahtkreuz und formt mit hellem und kraftvollem Bass ein sängerisch beachtliches Rollenporträt. Auch sonst überzeugt das Freiburger Ensemble: Giulio Peligra singt mit schön gefärbtem Tenor den gute Ritter Gaston. Sopranistin Anna Jeruc begeistert mit schwungvollen Koloraturen und dramatischen Aufschwüngen.
Freiburgs GMD Fabrice Bollon wählt ein düster dramatisches Klangbild, in dem die einzelnen Instrumentengruppen ihre Spieltechniken besonders stark akzentuieren. Dadurch werden die Farben der Instrumente noch über das bloße Spielen von Melodien, Akkorden und Rhythmen hinaus kräftiger in den Mittelpunkt gerückt.
Wer jetzt auf Verdis „Jerusalem“ neugierig geworden ist: Im März 2017 folgt eine Neuinszenierung im belgischen Liege. Wie man die dortigen Opernmacher kennt, kann man sich auf großes Ausstattungstheater freuen.
Rudolf Hermes 9.10.16
Bilder siehe unten !
Grand opéra in vier Akten von Giuseppe Verdi
JERUSALEM
Premiere am 01.10.2016
Qualitatives Frühwerk
Verdis erste Grand opéra JERUSALEM erlebte gestern Abend am Theater Freiburg erst die zweite Aufführung in Deutschland, die deutsche Erstaufführung fand im Januar diesen Jahres in Bonn statt. Und wenn diese Produktion eines zeigte, dann dies: Verdis dem breiten Publikum wenig vertraute Oper verdient es, vermehrt in den Fokus der Musiktheater und deren BesucherInnen gerückt zu werden. Die Partitur bietet ein Füllhorn von melodischen Einfällen, konzis und effektvoll komponierten Szenen und Arien, mitreissenden Finali, grandiosen Chören. Sie ist dem weitaus populäreren NABUCCO durchaus ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Und gerade in den breit angelegten Chorszenen konnte die Aufführung musikalisch punkten: Der Opern- & Extrachor des Theater Freiburg sowie Studierende der Hochschule für Musik Freiburg leisteten klanglich Grossartiges (Einstudierung: Bernhard Moncaldo). Diese Leistung verdient ganz besondere Anerkennung, da von den Chorsängerinnen und -sängern in den Szenen vom Regisseur einiges auch an physischer Kraft abverlangt wurde (minutenlanges Erstarren mit ausgestreckten Armen!).

Da der Chor oft von weit hinten auftreten und sich dann langsam nach vorne zur Rampe bewegen musste, war die Distanz zum Dirigenten oftmals ziemlich gross, was zu leichten rhythmischen Temporückungen führte. Dies wird sich im Verlauf der Aufführungen sicherlich noch einpendeln. Insgesamt auf sehr hohem Niveau bewältigten auch die Solisten ihre (dankbaren) Aufgaben. Allen voran Anna Jeruc als Hélène: Die polnische Sopranisten verfügt über einen echten Spinto-Sopran, lyrisch grundiert, mit fulminanter Durchschlagskraft in den dramatischen Passagen und den Massenszenen, sicherer Höhe, Agilität in den Koloraturen und ein wunderbar tragfähiges Piano, ein faszinierendes Singen in der mezza-voce Szene (Une pensée amère). Ihr tenoraler Partner war ihr ebenbürtig: Giulio Pelligra sang den Gaston mit biegsamem, angenehm und unangestrengt klingendem Tenor, leuchtender Strahlkraft in der (sicheren!) Höhe, differenziert in den dynamischen Abstufungen.
Wunderbar in der Sonorität seines autoritären und markanten Baritons gestaltete Juan Orozco den herrischen, unnachgiebigen und erbarmungslosen Grafen von Toulouse und Vater von Hélène. Eine Gewaltsleistung, welcher vom Publikum verdientermassen enthusiastische Anerkennung gezollt wurde, vollbrachte Jin Seok Lee mit seinem schwarzen, voll und resonanzreich klingenden Bass als Roger: Eindringlich zeigte er die Wandlung vom Saulus (sein hart am Inzest vorbeischrammendes Begehren seiner Nichte, der geplante Mordanschlag auf Gaston) zum Paulus (als von den Sarazenen und den Christen als Heiliger verehrter Eremit in Palästina). Einzig in seiner grossen Arie zu Beginn des zweiten Aktes schlich sich etwas gar viel Vibrato ein, da nahm er die Zeile „ma voix tremble“ etwas gar zu wörtlich. Andrei Yvan sang einen schmierigen päpstlichen Legaten, Shinsuke Nishioka war der dienstfertige Raymond. Eine besondere szenische Aufwertung wurde der Rolle von Hélènes Vertrauter, Isaure, zuteil: Kim-Lillian Strebel vollbrachte geradezu eine athletische Spitzenleistung, musste oft pausenlos um den Chor herumrennen (warum?), stellte (als einzige Frau in einem farbigen, senfgelben Kleid) das ewig unterjochte Weib dar.

Verdi hat in seinen Opern oft grosses Welttheater aus der Keimzelle der familiären Konflikte heraus erschaffen – z.B. in seinem ebenfalls für Paris konzipierten DON CARLO und eben auch in JERUSALEM. Dieses Welttheater, das Allgemeingültige, Zeitlose aufzudecken, war die Intention des Inszenierungsteam um den Regisseur Calixto Bieito. Die Bühne von Aida Guardia war schwarz und praktisch leer. Einzig ein gigantischer, trockener Steinhaufen – der Ölberg - ab dem zweiten Akt, auf welchem Jin Seok Lee als sich selbst kasteiender Roger 80 Minuten lang als Gekreuzigter am Querbalken hängen (und singen) musste, gab ihr etwas Struktur. Im Hintergrund waren gigantische Scheinwerferbatterien aufgestellt, welche ihr erbarmungslos gleissendes Licht direkt und schmerzhaft in den Zuschauersaal warfen. (Wer es nicht mag, dauerhaft geblendet zu werden, sollte sich Plätze in der rechten Saalhälfte besorgen!) Calixto Bieito jedoch schien die Handlung nicht sonderlich zu interessieren. Jedenfalls lag ihm an der Individualität der Charaktere wenig. Auf der Bühne zu sehen war eine uniforme und amorphe Masse, aus welcher die Protagonisten zwar heraustraten, es nicht mit der Handlung vertrauten Besuchern aber trotzdem schwer machten, das Geschehen zu verstehen. Zumal die erstarrten Tableaux auch zu einem statischen Rampensingen führten. Bieito nahm die Oper Verdis also eher zum Anlass, symboltriefende, allegorische und nicht immer einfach zu entschlüsselnde Tableaux vivants auf die Bühne zu stellen, die teils wirklich eindrücklich und beklemmend ausfielen.

Quälend langsam hob sich der schwarze Vorhang zu Beginn. Aus dem diffusen Bühnennebel zeichneten sich allmählich Figuren ab, die ebenso quälend langsam aus dem Hintergrund nach vorne rückten. Wenn dann endlich die Ouvertüre einsetzt, erkennt man, dass Männer und Frauen einheitlich in grünen Damenkleidern stecken (Kostüme: Rebekka Zimlich). Bieito entwickelt sein allegorisches Theater also quasi aus einer matriarchalischen Ursuppe heraus. Später dann sind Chor und Solisten (Herren und Damen) einheitlich in Massanzüge in Grau und Schwarz gekleidet (beim Aufbruch zum Kreuzzug wird dann noch in Kampfstiefel geschlüpft), das Patriarchat hat übernommen, die Weiblichkeit ist verdrängt und die Unterdrückung durch Religion, Machtstreben und sexuelle Ausbeutung hält Einzug. (Witzig der Zufall, dass der Zürcher TagesAnzeiger gerade vor einem Tag einen satirischen Artikel publizierte, welcher ein Verbot des Herrenanzugs forderte, da er ein Symbol sowohl für die Unterdrückung der Frau sei, als auch eines des männlichen Kastendenkens, und deshalb mit unseren Grundwerten als nicht vereinbar zu betrachten sei). Wie wäre es mit einem Anzugsverbot wenigstens erst mal auf der Opernbühne? ;-))
 Selbstverständlich durften in diesen symbolhaften Bildern des Welttheaters auch Anspielungen auf die gegenwärtige Migrationskrise nicht fehlen: Im zweiten Akt tauchten sie auf, orange Rettungswesten über den Anzügen tragend (in der trockenen Wüste Palästinas ...). Diese Rettungswesten lagen dann verstreut herum und evozierten den Strand von Lesbos. Plakativ auch die Zurschaustellung des brutalen, machohaften Verhaltens des Grafen von Toulouse: Minutenlang zerrt und schleift er seine Tochter über die Bühne, bespuckt und schlägt sie, bis sie blutüberströmt (wenn man die roten Rinnsale an ihren Schenkeln sieht, weiss man, was in Bieitos Fantasie passiert ist) wieder an die Rampe torkelt. Eindringlich jedoch die „Steinigungs“- Szene, in der bewusst gemacht wird, dass sich die archaischen Rituale monotheistischer Religionen (Christentum, Judentum, Islam) kaum unterscheiden. (Nur dass sich die einen doch mehr um den Einzug des Humanismus und der Aufklärung in ihre Doktrin gekümmert haben als andere ...) Am Ende sind dann alle beschädigt, blutüberströmt - das Jerusalem-Syndrom, dieses vergebliche und verderbliche Streben nach Herrschaft, hat wieder gnadenlos zugeschlagen, der Skorpion sein tödliches Gift verspritzt (das Spinnentier beherrschte den ersten Akt als Videosequenz). Und nun findet Bieito tatsächlich zu seinem stärksten Bild: Am Bühnenhimmel werden ineinander verschachtelte Schriftzüge sichtbar, die man kaum entziffern kann. Allmählich senken sich sich, werden lesbar: Es sind Ausschnitte aus der heiligen Schrift oder dem Katechismus in verschiedenen Sprachen, die vom ewigen Licht, von Unterwerfung, von Seligkeit und Wahrheit handeln. Diese metallenen Schriftzüge senken sich zum Boden und bilden so eine Art Stacheldrahtverhau, hinter welchem das gemeine Volk gefangen ist. Gegen das Metall dieses Gefängnis der Gedanken schlagen die Eingesperrten wutentbrannt und vergeblich, während die Hymne „La cité du Seigneur“ erklingt. Klasse!
Selbstverständlich durften in diesen symbolhaften Bildern des Welttheaters auch Anspielungen auf die gegenwärtige Migrationskrise nicht fehlen: Im zweiten Akt tauchten sie auf, orange Rettungswesten über den Anzügen tragend (in der trockenen Wüste Palästinas ...). Diese Rettungswesten lagen dann verstreut herum und evozierten den Strand von Lesbos. Plakativ auch die Zurschaustellung des brutalen, machohaften Verhaltens des Grafen von Toulouse: Minutenlang zerrt und schleift er seine Tochter über die Bühne, bespuckt und schlägt sie, bis sie blutüberströmt (wenn man die roten Rinnsale an ihren Schenkeln sieht, weiss man, was in Bieitos Fantasie passiert ist) wieder an die Rampe torkelt. Eindringlich jedoch die „Steinigungs“- Szene, in der bewusst gemacht wird, dass sich die archaischen Rituale monotheistischer Religionen (Christentum, Judentum, Islam) kaum unterscheiden. (Nur dass sich die einen doch mehr um den Einzug des Humanismus und der Aufklärung in ihre Doktrin gekümmert haben als andere ...) Am Ende sind dann alle beschädigt, blutüberströmt - das Jerusalem-Syndrom, dieses vergebliche und verderbliche Streben nach Herrschaft, hat wieder gnadenlos zugeschlagen, der Skorpion sein tödliches Gift verspritzt (das Spinnentier beherrschte den ersten Akt als Videosequenz). Und nun findet Bieito tatsächlich zu seinem stärksten Bild: Am Bühnenhimmel werden ineinander verschachtelte Schriftzüge sichtbar, die man kaum entziffern kann. Allmählich senken sich sich, werden lesbar: Es sind Ausschnitte aus der heiligen Schrift oder dem Katechismus in verschiedenen Sprachen, die vom ewigen Licht, von Unterwerfung, von Seligkeit und Wahrheit handeln. Diese metallenen Schriftzüge senken sich zum Boden und bilden so eine Art Stacheldrahtverhau, hinter welchem das gemeine Volk gefangen ist. Gegen das Metall dieses Gefängnis der Gedanken schlagen die Eingesperrten wutentbrannt und vergeblich, während die Hymne „La cité du Seigneur“ erklingt. Klasse!
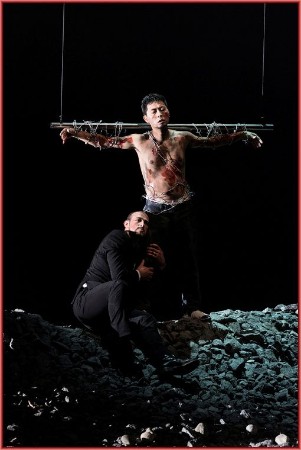 Passend zu den manchmal harten, manchmal abstossenden und manchmal unter die Haut gehenden Bildern die musikalische Lesart der Partitur (die Szene im Harem des Emirs von Ramla und das Ballett wurden leider gestrichen) durch Fabrice Bollon am Pult des Philharmonischen Orchesters Freiburg: Knallhart, unerbittlich, brutal drängen die martialischen Akzente des frühen Verdi ins Ohr, umso schöner ausmusiziert dann die wenigen kontrastbildenden, warmen und kammermusikalischen Phrasen. So hielt dann doch noch etwas vom Humanismus Verdis in die Produktion Einzug, denn Verdi war nicht nur der antiklerikale, sarkastische Kritiker und Beobachter menschlicher Abgründe. Gerade in seiner Musik klingt auch eine tief verwurzelte tröstliche und empathische Saite an, ein Aspekt, welchem in der szenischen Gestaltung in Freiburg kein Platz eingeräumt wurde. Und vielleicht deshalb gab es neben begeistertem Applaus für die Ausführenden des musikalischen Geschehens auch einige Missfallenskundgebungen gegenüber dem Inszenierungsteam.
Passend zu den manchmal harten, manchmal abstossenden und manchmal unter die Haut gehenden Bildern die musikalische Lesart der Partitur (die Szene im Harem des Emirs von Ramla und das Ballett wurden leider gestrichen) durch Fabrice Bollon am Pult des Philharmonischen Orchesters Freiburg: Knallhart, unerbittlich, brutal drängen die martialischen Akzente des frühen Verdi ins Ohr, umso schöner ausmusiziert dann die wenigen kontrastbildenden, warmen und kammermusikalischen Phrasen. So hielt dann doch noch etwas vom Humanismus Verdis in die Produktion Einzug, denn Verdi war nicht nur der antiklerikale, sarkastische Kritiker und Beobachter menschlicher Abgründe. Gerade in seiner Musik klingt auch eine tief verwurzelte tröstliche und empathische Saite an, ein Aspekt, welchem in der szenischen Gestaltung in Freiburg kein Platz eingeräumt wurde. Und vielleicht deshalb gab es neben begeistertem Applaus für die Ausführenden des musikalischen Geschehens auch einige Missfallenskundgebungen gegenüber dem Inszenierungsteam.
Kaspar Sannemann 4.10.16
Bilder (c) Theater Freiburg / Muranyi
Zum Zweiten
DER SCHMUCK DER MADONNA
Premiere am 05.03.2016
Nach dieser zu Recht umjubelten Premiere im Theater Freiburg von Ermanno Wolf-Ferraris Ausflug in den Verismo mit seiner einstigen Erfolgsoper "I Gioielli della Madonna" bleibt kein Zweifel mehr:
DIESES WERK MUSS ZURÜCK INS STANDARDREPERTOIRE !!!
Es mag ZuschauerInnen geben, die an der zur Schau gestellten Drastik der "Blut-Sperma-Weihrauch" - Thematik (Ulrich Schreiber) Anstoss nehmen. Doch muss man das Werk auch unter dem Zeitgeist der Entstehungszeit bewerten (Freuds Psychoanalyse) und dem Umfeld anderer Erfolgskompositionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa Puccinis TOSCA (Mord, Hinrichtung, Suizid) oder Strauss' SALOME (lässt den Täufer köpfen und küsst den blutigen Mund) und ELEKTRA (Anstiftung zum Muttermord, Ermordung des Geliebten der Mutter). Wenn man nun bei DER SCHMUCK DER MADONNA etwas tiefer gräbt - wie dies das Duo Kirsten Harms (Regie)/Bernd Damovsky (Bühne und Kostüme) in Freiburg getan hat - so entfernt man sich eben rasch von der realistisch-drastischen Oberfläche von Sex/Religion/Tod und stösst auf die komplexeren Themenkreise von krankhafter Obsession, unterdrückter Sexualität, Bigotterie, schamloser patriarchaler Begierde und ebensolcher Machtspiele, Abwertung der Frau zur Hure oder deren Hochstilisierung zur keuschen Jungfrau.
Harms/Damovsky haben zur Umsetzung ihres tiefenpsychologischen Konzepts auf einen realistischen Bühnenraum verzichtet und lassen die Handlung albtraumartig (und mit surrealistischen Elementen versetzt) in einem klinisch weissen Halbrund ablaufen, die Drehbühne wird erfreulich sparsam eingesetzt, die Kostüme (50er Jahre) verdeutlichen den Interpretationsansatz zum Teil überdeutlich. (Zum Beispiel die riesigen Kruzifixe, mit denen sich die Camorristi "schmücken"). Dem Inszenierungssteam (und auch dem Lichtdesign von Dorothee Hoff) gelingen immer wieder Szenen von beeindruckender Symbolkraft, so wenn Maliella von ihrem Freiheitsdrang singt und sich dabei einen Vogelbauer über den Kopf stülpt, wenn Gennaro und Maliella vor der sexuellen Vereinigung die frisch gewaschenen Kleider der Bräute Christi mit Füssen treten, wenn die bigotten Camorristi sich in der Höhle (hier Nachtclub) versammeln und sich wie auf Da Vincis Bild vom "letzten Abendmahl" um den Tisch gruppieren und dabei Spagetti fressend und aufgegeilt eine Stripperin begrapschen (um gleich darauf Maliella quasi zu exkommunizieren, nur weil sie keine Jungfrau mehr ist, da sie von ihrem Stiefbruder Gennaro missbraucht wurde).
Das stärkste Bild aber gelingt der Regisseurin im zweiten Akt: Gennaro sperrt seine Stiefschwester nicht in einem Gartenhaus ein, sondern fesselt sie auf einem Sanatoriumsbett, wirft ein schwarzes Netz über sie, in welchem sich die beiden beim Liebesakt verstricken, das Netz der beinahe widernatürlichen Begierde. Und mit diesem Netz der krankhaften Obsession über dem Kopf erscheint Gennaro auch im Nachtclub, befreit davon ist er erst bei seiner Selbsttötung zu Füssen der Madonna. Maliella hatte sich vorher schon selbst gerichtet, nachdem sie als "Entehrte" für den Anführer der Camorristi jeglichen Reiz verloren hatte. Eindrücklich und geschickt choreografiert waren auch die Volksszenen rund um die Marienprozession im ersten Akt (das Finale I ist sowieso auch musikalisch von überwältigender Gänsehaut-Emphase und ist dem Finale I aus TOSCA mehr als ebenbürtig!). Zu diesem grandiosen, atemberaubenden Gesamteindruck des ersten Bildes trugen der phänomenal singende Opern- & Extrachor des Theater Freiburg, die Studierenden der Hochschule für Musik und der exzellente, wunderbar rein und sauber singende Kinder- und Jugendchor des Theater Freiburg entscheidend bei (Einstudierung: Bernhard Moncado, Thomas Schmieger).
Die Besetzung der Maliella mit Elena Stikhina erwies sich als veritabler Glücksfall. Welch eine Stimme! Durchschlagkräftig, dabei stets warm timbriert bleibend und nie ins Schrille abdriftend, darstellerisch ein furioser Wirbelwind, von der aufreizenden Tarantella über den (beinahe inzestuösen) Liebesakt bis zum verzweifelten Suizid auf dem Abendmahlstisch. Mit überaus klangschönem, bruchlos und sicher geführtem Tenor wartete Hector Lopez-Mendoza als Gennaro auf. Auch in Fortissimo-Ausbrüchen drohte sein Timbre nie ins Weinerliche zu kippen, blieb viril und doch spürte man die ungeheure Verletzlichkeit seiner Seele, das Hadern mit seiner sexuellen Obsession.
Kartal Karagedik als Camorra-Boss Rafaele hingegen haderte gar nicht mit seiner Sexbesessenheit, strotzte vor Selbstbewusstsein und Sexappeal. Stimmlich schien er in den ersten beiden Akten (Premierennervosität?) noch etwas zurückhaltend, neben den gross auftrumpfenden Stimmen von Stikhina und Lopez-Mendoza wirkte er volumenmässig zu dünn, doch im dritten Akt lief auch er zu ganz grosser Form und überzeugendem stimmlichen Format auf. Anja Jung begeisterte einmal mehr mit ihrem satten, fantastisch ausdrucksstarken Alt als Mutter Carmela. Wenn so eine Besetzung für diese Partie aufgeboten werden kann, bedauert man umso mehr, dass die Librettisten und der Komponist die Rolle nicht umfangreicher angelegt und wenigstens um eine Soloszene für sie erweitert hatten. Stimmlich und darstellerisch ganz wunderbar war auch der Auftritt der drei "leichten" Mädchen Concetta, Serena und Grazia (Susana Schnell, Silvia Regazzo, Amelie Petrich) im Nachtclub, die Besetzung der solistischen Rollen innerhalb der Camorristi und des Volkes. Aufreizend und agil tanzte die Stripperin (Saskia Motschall) beim „Abendmahl“ und der Strassenclown Pazzariello (Fabian Flender) überraschte mit virtuosen Tricks.
Packend vom tumultartigen Auftakt über die zart und mit immenser Innigkeit gespielte Introduktion zum zweiten Akt (immerhin diese fünf Minuten der Partitur sind bis heute ein beliebtes Konzertstück geblieben) bis zum so unheimlich weich und traurig verklingenden Ende - zu dem passend zur Musik die Bühne langsam in abgestuften Grautönen erstarrt - spielte das Philharmonische Orchester Freiburg die schwelgerische, mit spätromantischer Klangfülle aufwartende Musik Wolf-Ferraris. Der wunderbar zügig und doch mit grosser Eindringlichkeit und klanglicher Transparenz die abwechslungsreich komponierte Partitur auslotende Dirigent Fabrice Bollon und das Orchester lieferten mit dieser Interpretation ein überzeugendes Plädoyer für diese Ausgrabung einer hoch spannenden Oper, die man sich gerne ein weiteres Mal anschaut und anhört!
Kaspar Sannemann 7.3.16
Bilder siehe unten / 1. Kritik !
REDAKTIONS-TIPP
Bitte hören Sie sich dieses wunderschöne Intermezzo an
DER SCHMUCK DER MADONNA
Premiere am 05.03.2016
Weit mehr als „Cavalleria 2.0“
Lieber Opernfreund-Freund,
ausgeklügeltes Marketing ist kein Phänomen der heutigen Zeit. Schon Hermann Wolf, Sohn eines Malers aus dem nördlichen Baden-Württemberg und einer Venezianerin, setzte den Geburtsnamen seiner Mutter ab 1895 hinter seinen, italienisierte seinen Vornamen und nannte sich Ermanno Wolf-Ferrari, weil er sich davon in seinen beiden Heimatländern Italien und Deutschland gleichermaßen mehr Erfolg als Komponist versprach. Und den hatte er im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert durchaus mit seinen kammermusikalischen Komposition und erfreute sich vor allem als Komponist von Buffo-Opern großer Beliebtheit. 1911 unternahm er einen musikalischen Ausflug in den Verismus und brachte „Der Schmuck der Madonna“ in Berlin (auf Deutsch) heraus. Dieses Werk hatte zwar nicht den Erfolg seiner beliebten „Donne curiose“, „Die vier Grobiane oder „Susannas Geheimnis“, war aber bis zum ersten Weltkrieg durchaus erfolgreich und wurde sogar noch 1926 mit Maria Jeritza an der Met gegeben, ehe es in der Versenkung verschwand. Zu unrecht, wie die italienisch gesungene Premiere dieser wahren Opernrarität vor nahezu ausverkauftem Großen Haus des Theaters Freiburg am gestrigen Abend zeigte.

Doch worum gehts? Maliella ist die brave Welt, in der sie leben muss, zu klein. Sie erwartet mehr als Kirchgang und sittsames Leben und ist deshalb von Rafaele fasziniert, der ein Draufgänger ist und ihr sagt, dass er alles für sie tun würde. Selbst den Schmuck der Madonnenstatue würde er für sie stehlen, sagt er. Das macht Eindruck, so dass Maliella taub ist für Gennaros Werben, mit dem zusammen sie aufgewachsen, aber - wie sich heraus stellt - nicht verwandt ist. Der sieht keinen anderen Ausweg, als selbst für seine Angebetete das wertvolle Geschmeide zu stehlen. Im Überschwang der Gefühle missbraucht er die junge Frau sogar, nachdem er ihr den Schmuck zu Füßen gelegt hat. Die sucht Hilfe bei Rafaele, will Rache für ihre Schande, erfährt jedoch von diesem noch eine weitere Schmähung. Er, selbst nicht der Anständigste, wie er freimütig bekennt, will eine reine Frau. Er unterstellt ihr, sich für den Schmuck hingegeben zu haben - ihr bleibt, von allen verstoßen, nur der Freitod. Auch Gennaro bleibt von allen verlassen zurück und bringt sich um.

Da erinnert im Plot so manches an „Cavalleria rusticana“, den Verismo-Reisser von Pietro Mascagni, in dem es auch um kirchliche wie gesellschaftliche Zwänge, Doppelmoral, Betrug und Ehre geht - sogar musikalisch. So manche Stelle klingt nach „Cavalleria“, ein ausladendes Intermezzo vor dem zweiten Akt gibt es auch, das an Schönheit und Einfallsreichtum das abgespielte Mascagni-Gegenstück sogar noch in den Schatten stellt. Doch das Werk des Deutsch-Italieners ist trotz seines Pathos weit mehr als eine Kopie. Musikalisch finden sich Anklänge an Giordanos „Andrea Chenier“, ein paar Takte weiter klingt das Werk fast modern, nimmt Harmonien vorweg, die an Poulenc erinnern, klingt stellenweise Strauss-artig und zeigt mit neapolitanischen Canzoni reichlich Lokalkolorit. Es wird also allerhand geboten und von der musikalischen Seite aus betrachtet bleibt in jedem Fall zu hoffen, dass das Werk nicht wieder 90 Jahre in der Versenkung verschwindet, ehe sich ein Theater seiner annimmt.
Die Regisseurin Kirsten Harms verzichtet glücklicherweise darauf, das Werk auf links zu drehen und mit dem Holzhammer zu aktualisieren. Sie erzählt schlicht die Geschichte, legt den Focus dabei auf die Bigotterie der Gesellschaft, aber auch jedes Einzelnen, auf die Leidenschaften der Handelnden. Dass sie im langen Interview im ansonsten recht dünnen Programmheft Rafaele als Mafioso zeichnet, dies dann aber auf der Bühne nicht wirklich zeigt, ist geschenkt. Ihr gelingt ein spannender Opernabend. Und dazu braucht es nicht viel Szenerie, wie die Bühne von Bernd Damovsky zeigt. Eine Kulisse gibt es streng genommen nicht - die schafft im Wesentlichen das ausgeklügelte Licht von Dorothee Hoff, das wunderbar mit den Leidenschaften und Stimmungen spielt.

Damovskys zeitgemäße Kostüme und die all gegenwärtigen überdimensionalen Rosenkranzkreuze, die von der Decke und um die Hälser von Rafaeles Clique hängen, verstärken den Ansatz der Regisseurin, die Doppelmoral der Akteure zu betonen. So sind fast drei Stunden Musiktheater im Flug vergangen, klare Personenführung, gelungene Chorszenen und die Einlagen durch die Tänzerin Saskia Motschall oder den Gaukler Fabian Flender sorgen zusätzlich für Kurzweil.
Ach ja, und gesungen wird natürlich auch. Ganz hervorragend sogar. Allen voran sei hier die Maliella von Elena Stikhina genannt, der mit betörender Mittellage, verführerischer und bombensicherer Höhe sowie intensivem Spiel ein beeindruckendes Rollenportrait gelingt. Der mexikanische Tenor Hector Lopez-Mendoza muss sich offensichtlich erst frei singen, überzeugt nach der Pause mit viel Kraft, Gefühl und warmem Timbre und ist ihr da ein würdiger Partner. Gegenspieler Rafaele wird von Kartal Karagedik verkörpert, dessen imposanter Bariton mit sämtlichen Farben vom einlullend Werbenden bis zum brutal Zurückweisenden spielt. Anja Jungs eindrucksvoller Mezzo verleiht der Mutterfigur Carmela Kontur.

Aus der Riege der vielen kleineren Rollen, die allesamt mehr als solide besetzt sind, möchte ich unbedingt den Rocco von Jin Seok Lee hervor heben, dessen Bass über eine tolle Durchschlagskraft verfügt. Unbedingt aufhorchen lässt auch
Roberto Ortiz, dessen helle, klare Stimme während des kurzen Auftritts im ersten Akt (leider vergeblich) hat hoffen lassen, dass diese Figur im Laufe der Handlung noch einmal wieder kommt.
„Der Schmuck der Madonna“ ist beinahe schon eine Chor-Oper. Die gesellschaftlichen Konflikte im Drama werden durch eine starke Präsenz von Freunden, Nachbarn, schlicht Menschen im ersten und dritten Akt verdeutlicht. Der Chor ist also viel beschäftigt, zeigt sich glänzend disponiert und tritt imposant auf. Bernhard Moncado hat die Einstudierung übernommen und ihm gebührt für diese umfangreiche Partie ein besonderes Lob. Ebenso tadellos zeigt sich der von Thomas Schmieger betreute Kinder- & Jugendchor. Aus dem Graben tönt es schlichtweg italienisch. Fabrice Bollon legt die vielschichtige Partitur behutsam frei, entfacht Feuer und erlaubt Intimität, die durch wunderbare Flötensoli verstärkt wird. Trotz des stilistischen Facettenreichtums gelingt ihm ein Dirigat aus einem Guss. Herrlich!
Das Publikum ist schon zur Pause begeistert, applaudiert frenetisch und spart am Schluss nicht mit anhaltenden Ovationen für alle Beteiligten. Ein hörens- und sehenswerter Abend geht zu Ende, den sich auch Auswärtige an dem einen oder anderen Wochenendtermin gönnen können, den es hier glücklicherweise im Gegensatz zum ebenfalls hoch gelobten und sehenswerten „Mefistofele“ am gleichen Haus gibt. Also: Nix wie hin!
Ihr
Jochen Rüth aus Köln / 06.03.2016
Die Fotos stammen von Maurice Kobel.
Die CD wird heuer zu Liebhaberpreisen gehandelt - leider!

MEFISTOFELE
Premiere am 16.01.2016
Teuflich gut
Ach, wie ekelt ihn doch der holde Sang der in biederen Alltagskleidern den Herrn lobpreisenden "himmlischen Heerscharen", wie ödet ihn das peinliche Schülertheater der Cherubine an. Gelangweilt fläzt sich der smarte Rocker Mefistofele auf der abgewetzten braunen Ledercouch, schlägt einige perfekt zur Musik Boitos abgestimmte Akkorde auf seinem E-Bass an, beisst in den Apfel der Versuchung, lässt sich von seiner platinblonden, mit Hotpants bekleideten Muse - die sich später in eine Art KISS-Groupie verwandelt und auch als Marta und Pantalis auftritt - dazu inspirieren, Gott mit einer Wette herauszufordern. Dazu bedient er sich des Nerds und Wissenschaftlers Faust, der eh schon "à la recherche du temps perdu" ist und sich bereitwillig von Mefistofele auf einen psychedelischen Trip zurück in die wilden Disco-Nächte der frühen 70er mitnehmen lässt, so à la "Lucy in the Sky with Diamonds" (obwohl John Lennon ja immer bestritten hatte, dass sein Song etwas mit LSD Trips zu tun habe). Und wer weiss schon genau, welche bewusstseinserweiternden Substanzen in dem Rauch im Plexiglaskasten versteckt waren, der bestimmt nicht nur harmlose Wölkchen am Himmel symbolisieren wollte.

Ludger Engels(verantwortlich für die eindringliche, kurzweilige und genaue Personenführung) und Ric Schachtebeck(Gestaltung der funktionalen Bühne und der ungemein stimmigen und nostalgische Gefühle weckenden Kostüme – ach, wie unwiderstehlich sexy fühlten wir uns doch in den Netzshirts!) haben Boitos komprimierte Fassung des gigantischen Faust Stoffes (der Tragödie erster UND zweiter Teil) mit leicht augenzwinkernder Ironie auf die Bühne des Theaters Freiburg gehievt, sehr genau auf die Musik und den Text (und den Subtext) gehört. Hier nur einige Beispiele: Am Ostermorgen vergnügt sich das Volk in einer witzigen Choreografie mit blassrosa Luftballonen (warum bloss habe ich diese ständig mit aufgeblasenen Kondomen assoziiert? ... ), der biedere, mit einem zwanghaften Ordnungsfimmel behaftete Teetrinker Wagner wandelt sich in der klassischen Walpurgisnacht zum liebestollen Nereus, steht endlich zu seinen Gefühlen und setzt sich auf Fausts Schoss, die Geschlechtertrennung im die ideale Liebe preisenden Arkadien ist vollständig aufgehoben, alle tragen die selbe platinblonde Bubikopf-Perücke von Mefistofeles Muse (ausser den beiden Rockgören Elena und Pantalis), das Häuschen der Margherita ist wahrlich klein und bieder (Kaffee und Schwarzwälder Torte, wir sind ja in Freiburg!), selbst das berühmte Zitat von "des Pudels Kern" ist humorvoll umgesetzt - Mefistofele trägt im ersten Akt einen Hoodie mit Pudel auf dem Rücken. Klasse!

Der Hexensabbat auf dem Brocken gerät zur "Glitter and be gay"- Disconight, das dunkle, nüchterne Tribünenelement wird zur Showtreppe, die Discokugel verströmt, wie schon zu Beginn der Aufführung, wandernde Leuchtpunkte gleich den Sternen des Universums in den Saal. Dass ein Trip auch gefährliche Abstürze zur Folge haben kann, ist allgemein bekannt. Auch Faust muss das erkennen: Im dritten Akt ist das Häuschen Margheritas zu einem Drecksloch verkommen, die blumigen Klebekacheln sind nun unverputzten Wänden gewichen, der Kühlschrank strotzt vor Schmutz, die Pizza ist vergammelt, die Torte schimmlig geworden. Im Epilog dann sitzt Faust wieder an seinem mit Büchern überladenen Tisch, den Laptop klappt er entnervt zu, die Bibel wirft er zu Boden, greift zur Gin-Flasche, lässt verträumt einen Spielzeug-Kreisel drehen. Vielleicht wird er nach all den bewusstseinserweiternden Erfahrungen mit oder ohne Mefistofeles Hilfe nun doch endlich zu leben beginnen.
Das Theater Freiburg konnte eine starke Besetzung für dieses leider nicht allzu häufig gespielte Werk des jungen Komponisten Boito aufbieten: Mit dem stimmgewaltigen, resonanzreich und ausdrucksstark singenden und mit herrlicher Nonchalence agierenden Bassisten Jin Seok Lee stand ein beeindruckender Interpret des Mefistofele auf der Bühne, von dem man sich gerne verführen liess. Martin Muehle sang den Faust mit klangvollem, hell und durchschlagkräftig klingendem Tenor, meisterte bruchlos die nicht unproblematische Tessitura und agierte mit leicht distanzierter, zum Schmunzeln anregender, Ironie. Wunderschön emphatisch sein Duett mit Elena im vierten, gefühlvoll und berührend intoniert das Duett (Lontano, lontano) mit Margherita im dritten Akt.

Diese beiden Frauengestalten wurden von Sandra Janušaité mit grosser, schon fast hochdramatischer Stimme gesungen, mit deutlichem Registerbruch zwischen der mittleren und der tiefen Lage, dabei aber von einer Gänsehaut erregenden, packenden Intensität. Kein sanftes, verschüchtertes Gretchen also, sondern zuerst eine etwas prollig-ordinäre junge Frau, dann eine um Hilfe schreiende, gefangene Raubkatze und eine selbstbestimmt agierende, von herber Erotik geprägte Elena. Silvia Regazzo sang mit ihrem wunderschön satt timbrierten Alt eine ausgezeichnete Marta und verschmolz diese schöne Stimme herrlich als Pantalis mit derjenigen von Elena in der hellenischen Walpurgisnacht. Ihre Bühnenpräsenz den ganzen Abend hindurch war ganz grosses Theater.

Christoph Waltle ergänzte als Wagner und Nereo das Solistenquintett hervorragend. Begeisternd auch die akrobatischen Einlagen der Artisten Julien Bazerque-Voogden, Dagny Borsdorf, Jan Dages, Max Föhrenbach, Mifiam Kustermann und
Edith Oppold.
Die Sängerinnen und Sänger des Opern- & Extrachors des Theaters Freiburg, die Studierenden der Hochschule für Musik (Einstudierung: Bernhard Moncado) und vor allem auch der Kinder- und Jugendchor (Einstudierung: Thomas Schmieger) bewältigten ihre anspruchsvollen Aufgaben mit beachtlicher Klangqualität und (wenn gefordert) ätherischer Schönheit des Gesangs. Fabrice Bollon am Pult des farbenreich und mit grosser Prägnanz die rhythmischen Klippen der Partitur meisternden Philharmonischen Orchesters Freiburg sorgte für atmosphärisch dichte Sogwirkungen aus dem Graben - mehr als einmal war man versucht auszurufen „Arrestati, sei bello!“ - und schenkte dem Publikum eine Musik mit Suchtpotential (womit wir wieder bei bewusstseinserweiternden Substanzen wären ...).
Fazit: Zu Recht begeisterter Applaus des Premierenpublikums für diesen szenisch und musikalisch fantastischen, leicht augenzwinkernden Trip zurück in die verlorene Jugend. Großartige Sängerdarsteller, ein fulminant singender Chor und das farbenreich und packend spielende Philharmonische Orchester Freiburg unter Fabrice Bollon werden Boitos MEFISTOFELE teuflisch gut gerecht.
Kaspar Sannemann 17.1.16
Bilder (c) Theater Freiburg
Weitere Aufführungen
16.1. | 23.1. | 29.1. | 12.2. | 21.2. | 17.3. | 24.3. | 24.4. | 13.5. | 27.5. | 2.6. | 11.6.2016
DER LIEBESTRANK
Premiere am 28.11.2015
Nemorino und die Zahnradfabrik

Das Theater Freiburg feiert eine umjubelte Premiere von Gaëtano Donizettis berühmter Buffo-Oper „L’elisir d’amore“. Ein wenig irritierend wirkt die Ankündigung des Werks mit dem deutschen Titel „Der Liebestrank“, obschon das Bühnenstück – zum Glück –italienisch gegeben wird, gelangt doch die kongeniale Verschränkung von Text und Musik nur in der Originalsprache zur vollen Blüte.
Wesentlich zum Erfolg des Abends beigetragen hat die skurril-surreale Inszenierung von Alexander Schulin. Er lässt das Stück nicht auf einem idyllischen Bauernhof spielen, wo es Donizetti und dessen Librettist Felice Romani angelegt hatten,sondern in einer urbanen, sterilen Zahnradfabrik. Die an Hängern schwebenden Ausführungen verschiedenster sich drehender Zahnräder lassen Assoziationen zu Charlie Chaplins legendärem Film „Modern Times“ zu. Die Aktualisierung des Stoffes ist im Grossen und Ganzen schlüssig, handelt doch Donizettis Oper von den zeitlosen Themen Geld und Liebe. Nur vereinzelt ergeben sich – für den Handlungsbogen allerdings unbedeutend – Ungereimtheiten mit dem Text.

Der pastorale Eröffnungschor kann hierfür Pate stehen: DerOpernchor des Theater Freiburg singt, dass das Laub der Buchen ihn vor der Hitze und Schwüle beschützen würde. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn der Chor Landarbeiter repräsentiert, die tagsüber den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Die Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter bei Schulin müssen eher die Wärme der Sonne als Erholung denn den Schatten der Bäume suchen, da sie den ganzen Tag am Förderband in der Fabrik verbringen und Zahnräder auf irgendwelche Defekte prüfen müssen.
Bei Schulin ist Nemorino ein Raumpfleger mit blauem Putzkittel, weissem Strickpullover und beigen Hosen. Seine angebetete Adina, die jedoch seine Liebe nicht erwidert, ist eine Art Aufseherin in der Fabrik. Kim-Lillian Strebel als Adina wirkt im ersten Akt noch ein wenig blass in der Figurenführung, kann jedoch nach der Pause eine bedeutende Steigerung verzeichnen. Ihre wunderschöne, reine und klare Sopranstimme vermag sie im zweiten Akt geschickter und facettenreicher einzusetzen und schleudert sogar ein paar Spitzentöne des Belcanto-Meisters Donizetti regelrecht in den Zuschauerraum. Das macht Spass!

Die Auftritte der beiden von der Commedia dell’ arte inspirierten Figuren des Belcore und des Dulcamara wirbeln den monotonen und kalten Alltag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fabrik auf. Belcore, der der festen Überzeugung ist, dass er alle Frauenherzen im Nu höher schlagen lässt, umwirbt Adina mit seinem prahlerischen Machogehabe. Die Rolle wird herrlich interpretiert von Alejandro Lárraga Schleske mit dessen sorgfältig geführter tenoraler Baritonstimme. Andrei Yvan zeichnet den verkaufstüchtigen Dulcamara als skurril-schrillen Buffobass. Er erinnert an Johnny Depp als Willy Wonka in Roald Dahls Verfilmung von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ von Tim Burton. Bettina Meyer, die für Kostüme und Bühnenbild verantwortlich zeigt, schneidert ihm einen weiss-roten Ganzkörperanzug, der zwischen Arlecchino und Superman angelegt ist. Das Kostüm wird ergänzt durcheinen langen Pelzmantel, einen schwarzen Zylinder, weisse Handschuhe, Cowboystiefel und eine grosse, weisse Sonnenbrille. Dulcamaras Zauber-Liebestrank, der eigentlich nichts anderes als Rotwein ist, lockert Nemorinos Gemüt und führt ihn schliesslich in die Arme seiner geliebten Adina.
Dem Regisseur gelingt es, zwischen den von Donizetti und Felice Romani angelegten komischen und rührenden Momenten zu changieren. Die Inszenierung ist durchdrungen von zahlreichen Slapstick-Nummern, schreckt aber nicht davor zurück, insbesondere im zweiten Akt nach der Stückpause, intime, melancholische Momente aufblitzen zu lassen. Nemorinos „Una furtiva lagrima“, eine der wohl bekanntesten Arien des Belcanto, gerinnt zu einem solchen Augenblick.

Nutthaporn Thammathi hat die Arie komplett verinnerlicht. Er singt sie emotional und schlicht– glücklicherweise ohne überflüssige Tenorgesten– an Ort und Stelle und dies notabene nachdem Nemorino zwei Flaschen Rotwein getrunken hat; so etwas kann eben nur in der Oper geschehen.Die Musik allein trägt die Gefühle und kannden ganzen Theaterraum füllen. Leider kommt Thammathi in den mehrstimmigen Nummern nicht gegen seine Sängerkollegen an. Er singt oft zu leise und wird deshalb von den Partnern übertönt.
Der in Freiburg oft gesehene Gastdirigent Gerhard Markson gestaltet „Una furtiva lagrima“ sehr transparent und differenziert. Man hätte sich gewünscht, dass er das Philharmonische Orchester Freiburg auch in den anderen kantablen Teilen zugunsten der Sängerinnen und Sänger mehr zurückgenommen hätte. Das Philharmonische Orchester hat ansonsten bis auf ein paar Unreinheiten in den Blechbläsern durchwegs überzeugt und kann vor allem in den rasanten Stretta-Passagen und Finali auftrumpfen.
Fazit: Das Theater Freiburg fährt mit einer schrillen Inszenierung auf, die unterhaltend und hörenswert ist. Letzteres schon allein deswegen, weil Donizettis Meisterwerk eine ungeheure Vielfalt an wunderschönen, eingängigen Melodien bietet!
Carmen Stocker 30.11.15
Besonderer Dank an MERKER-online (Wien)
Fotos: Maurice Korbel / Theater Freiburg
IL TROVATORE
15.05.2015
Verdi at his Best

Mitreissend, feurig lodernd, packend – das ist die musikalische Sprache Verdis in seinem Erfolgswerk IL TROVATORE. Und genau so erklang sie gestern Abend im Theater Freiburg. Da mag mal der eine oder andere Ton etwas daneben gegangen, die Tempokoordination zwischen Chor und Dirigent nicht immer perfekt abgestimmt gewesen sein, dem positiven Gesamteindruck der musikalischen Seite des Abends tat dies keinen Abbruch. Dazu gesellte sich eine Inszenierung des schwierig auf der Bühne umzusetzenden Werks, welche nicht nur nicht gross störte, sondern gar einiges erhellte. Das ist heutzutage schon viel!

Enrico Caruso, der kleingewachsene grosse Tenor, soll einmal gesagt haben, alles was es brauche um IL TROVATORE erfolgreich in Szene zu setzen, seien die vier weltbesten Sänger. Nun, in Freiburg standen fünf ausgezeichnete Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Denn hier erhielt die Rolle des Ferrando endlich einmal das ihr zustehende Gewicht. Die Regisseure Rudi Gaul und Heiko Voss verlegten die Handlung in eine Art Varieté- oder Kinosaal. Die Zeit war nicht genau definiert, denn die Bühne hatte mal etwas von Art déco der Stummfilmzeit, dann, wenn sich dieser Muschelsaal drehte, sah er aus wie von Christo und Jeanne-Claude verpackt, mit einer Öffnung die einer Vulva glich (Bühne und Kostüme: Olga Motta). Die Kostüme und Teile der Handlung spielten mit deutlichen Assoziationan an Stanley Kubricks blutigen Kultfilm A CLOCKWORK ORANGE.

So trat eben der erwähnte Ferrando als Conférencier, Magier und Séance-Künstler auf, weissgekleidet, mit rotem Zylinder, roten Kothurnen und (wie alle Männer) mit über der Kleidung getragenem, sehr auffälligem Suspensorium. Jin Seok Lee füllte die Rolle mit seinem sonoren Bass hervorragend aus, lieferte im ersten Bild eine packende Erzählung der Vorgeschichte und begleitete die Handlung mit seiner immensen Präsenz im weiteren Verlauf des Abends. Sein Dienstherr, Graf Luna, wurde von Alejandro Lárraga Schleske mit einnehmend timbriertem Bariton gesungen. Darstellerisch vielleicht etwas statisch, doch das mag auch an der insgesamt etwas vernachlässigten Personenführung durch die Regisseure gelegen haben, da auch die anderen Protagonisten vielfach eher unbeholfen, ja fast unbeteiligt herumstanden oder -gingen. Das galt auch für den Manrico von James Lee. In den ersten beiden Akten punktete er mit seinem souverän eingesetzten, viril und markant klingenden Tenor. Im dritten Akt hatte er zu Beginn einige kleinere Intonationsprobleme, stürzte sich dann mutig und mit Attacke in die gefürchtete Stretta Di quella pira, das erste hohe C ging leider krächzend daneben, doch für den Schlusston des All'armi war die Stimme wieder voll da. Sehr schön gelangen ihm die Szenen mit seiner vermeintlichen Mutter Azucena, in denen er Tröstender, Zweifelnder und Fragender (nach seiner wahren Herkunft) zugleich war.

Diese Azucena war eine Wucht: Anja Jung verfügt über die perfekte Stimme für diese Rolle, welche wohl eine der dankbarsten und intensivsten aus Verdis Feder ist. Frau Jungs Rollengestaltung zeichnete sich durch eine dunkle Grundfarbe aus, sie vermochte die sie psychisch verzehrenden Gewissensbisse über den Mord am eigenen Kind und die in ihrer Seele drohend wuchernden Rachegedanken auf eindringliche Art und Weise zu akzentuieren. Töne die durch Mark und Bein gingen, loderten wie heisse Lava, sich gleissend vom Brustregister in die Höhe drehten und in ein entrücktes Piano wechseln konnten (Schlussbild Ai nostri monti). In ihrem Lager beschäftigte Azucena eine ganze Horde Kinder (mit blutigen Narben), welche in ihrem Auftrag mit blutroter Farbe Poster malen mussten, die sich mit Kindesmord und Hexenverbrennungen beschäftigten. Eine Art selbstauferlegter Psychotherapie? Die fünfte wichtige Person der Oper ist natürlich die Primadonna, Leonora, welche die von einander nichts wissenden Brüder als Rivalen um ihre Gunst in fataler Art aufeinander treffen lässt. Christina Vasileva sang die anspruchsvolle Partie mit einer fulminanten Selbstverständlichkeit. Sauber die Triller und kleinen Fiorituren, den grossen Tonumfang mühe- und bruchlos durchschreitend, von fortissimo Ausbrüchen wie durch Magie in tragfähige Piani zurückgleitend. Wunderbar! Selbstverständlich musste sie in platinblonder Pony Perücke und im kurzen Schwarzen auftreten.

Wie sich die Bilder gleichen: Auch in der KÖNIGIN VON SABA am Abend zuvor war platinblond und schwarz angesagt gewesen. Gibt es noch ein anderes Frauenbild? Auch die Inez (sehr gut Viktoria Varga) war identisch gekleidet, den Büstenhalter als Betonung der weiblichen Attribute mussten die Damen über dem Kleid tragen, genau wie die Männer ihr Suspensorium. In der Soldatenszene räkelten sich dann drei dieser Blondinen lasziv an den roten Speeren, eine ziemlich geschmacklose Mischung zwischen Strip-Club und Golgatha. Aber eben, Kubrick liess grüssen!
Der eigentlich gut disponierte Chor und Extrachor des Theater Freiburg vermochte die ziemlich rasanten Tempovorgaben von Johannes Knapp am Pult des sehr prägnant die Verdischen Begleitfiguren ausführenden Philharmonischen Orchesters Freiburg nicht immer auf Anhieb aufzunehmen, so dass es zu kleineren Wacklern kam.

Witzig und einfallsreich waren die holzschnittartigen Comic Videosequenzen von Thilo Nass auf dem Vorhang (und auf der Leinwand des Kinos), welche erklärend die einzelnen Tableaus miteinander verbanden.
Kaspar Sannemann 17.5.15
Bilder: Theater Freiburg / Rainer Murnyi
DIE KÖNIGIN VON SABA
14.05.2015
Ein ambitioniertes Ziel
hat sich das Theater Freiburg mit der Neuproduktion von Karl Goldmarks einstigem Erfolgserstling DIE KÖNIGIN VON SABA gesetzt – und, das darf ich schon mal vorwegnehmen, vor allem in musikalischer Hinsicht reüssiert. Die Frage stellt sich natürlich, woran es genau lag, dass dieses Werk in der Zeit nach seiner Uraufführung und bis Mitte der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts so populär war und weshalb diese Oper auch nach dem Untergang der Nazidiktatur den Weg ins Repertoire nicht mehr gefunden hat.

Doch erst einmal zur Aufführung: Anspruchsvoll sind sie, die fünf Hauptpartien in Goldmarks Oper – glänzend besetzt wurden sie im Theater Freiburg: Nuttaporn Thammati ist ein hervorragender Assad. Mit seinem wunderschön timbrierten Tenor schafft er den schwierigen Spagat zwischen liedhaftem Gesang und heldischem Aplomb. Bruchlos führt er seine Stimme durch die Register, verzichtete wohltuend auf Forcieren und tenorale Schluchzer und zeichnet mit seiner klaren Diktion das Porträt dieses sich selbstzerstörerisch zwischen den beiden Frauen, der femme fatale (Königin von Saba) und der femme fragile (Sulamith), aufreibenden Jünglings. Dass er sich dazu manchmal in lächerlich spastischen Verrenkungen produzieren muss, ist wohl nicht ihm, sondern der Regisseurin anzulasten. Katerina Hebelková in der Titelpartie bringt alles mit, was die Figur der femme fatale glaubhaft erscheinen lässt: Viel Sexappeal, ein ausgesprochen erotisch klingendes Timbre in der raumgreifenden, wunderschön ebenmässig geführten Stimme, die auch in der hohen Lage nie schrill klingt. Nicht nur im Schlussakt, wo sie sich wie eine Mischung aus Barbarella, Pornosternchen Cicciolina und Catwoman raubtierartig über die Bühne schleicht, auch in den ersten drei Akten im tief geschlitzten sexy Pailletten-Abendkleid aus purem Gold (an ein Gemälde
Gustav Klimts erinnernd) macht sie eine ausgezeichnete Figur. Sie ist mit jeder Faser ihres Körpers die Frau, die sich selbstbewusst das nimmt, was ihr zuzustehen scheint, emanzipiert, stolz und eben auch verletzlich. Gerade diesen Aspekt der vielschichtigen Figur schälen Frau Hebelková (und natürlich die Regisseurin Kirsten Harms) besonders eindrücklich heraus. Als starke Gegenspielerin erweist sich Petya Ivanova als Assads Braut Sulamith. Goldmark hat hier ja auf eine ähnliche Figurenkonstellation gesetzt wie Bizet in CARMEN (die verführerische Carmen und die jungfräulich reine Micaëla).

Frau Ivanova berührt mit ihrem glockenreinen Gesang, ihrem mädchenhaften Timbre. Sie verfügt über eine strahlende Durchschlagskraft in den Ensembles. Besonders ergreifend ist ihre grosse Szene im dritten Akt: Während sie sich die Haare abschneidet, gestaltet sie mit von Trauer umflorter Stimme ihre Todessehnsucht. Am Ende dann lässt Kirsten Harms sie nicht zusammen mit Assad in der Wüste den Liebestod sterben, sondern Sulamith zerschneidet das weisse Band, welches sie symbolhaft immer an das Patriarchat gefesselt hat, lässt Assad in der wüsten Einsamkeit zurück und nimmt den selben Ausgang, welchen die Königin kurz vorher genommen hat: ein Frau hat sich emanzipiert, weil sie ahnt, dass der Mann eben (trotz aller gegenteiligen Schwüre) ein fleischlich schwacher Mann bleiben wird.
Mit eindringlicher vokaler und szenischer Präsenz überzeugt Juan Orozco als König Salomon. Klar und deutlich seine Diktion, wunderbar satt und reichhaltig strömend sein Bariton. Der weise König darf sich zwischendurch auch als Dr. Freud betätigen: Während Assad ihm seine sexuelle Begegnung mit der Königin von Saba schildert, erscheint auf der Rückwand die Projektion der berühmten Analysecouch (neben Gina Lollobrigida aus King Vidors Film) und Salomon setzt sich mit Brille und Notizbuch neben den „Patienten“. Als gestrenger Hohepriester und Vater Sulamiths verkörpert Andrei Yvan mit markantem Bass das konservative, orthodoxe Element. In der kleinen Partie der Sirene Astaroth lässt Viktoria Varga mit schönen Vokalisen aufhorchen. Ob es wirklich notwendig war, die Stimme mittels Mikrofon und Lautsprecher besonders hallig erklingen zu lassen, sei mal dahingestellt. Kraftvoll und klangschön bewältigen der Opernchor und der Extrachor des Theater Freiburg die extensiven Chortableaus. Zur Unterstreichung der patriarchalischen und strengläubigen Ordnung am Hofe Salomons haben Kirsten Harms und ihr Ehemann Bernd Damovsky (Bühnenbild und Kostüme) auch die Damen des Chores mit Bärten und Pelzhüten ausgestattet. Das Philharmonische Orchester Freiburg unter der Stabführung von Fabrice Bollon interpretiert Goldmarks farbenreiche Orchestrierung mit transparentem, ausgewogenem und schlankem Klang. Bollon deckt die Sänger nie mit der üppig-schwülen Klangsprache zu, sondern überlässt ihnen das Primat. Neben aufpeitschend und mitreissend gestalteten Aktschlüssen und tollen sforzati-Effekten (Ouvertüre) sind auch ganz introvertierte Passagen zu vernehmen, zum Beispiel die wunderbare Introduktion zum dritten Akt.

Kirsten Harms inszeniert die Oper als eine Art Kampf zwischen Eros und Ratio, wie erwähnt mit etwas Freud und vielen Bildern von starkem Symbolgehalt. Einige gelungen (Klagemauer, die von der Projektion der altbabylonischen Darstellung der Lilith überlagert wird), andere etwas rätselhaft (der brennende Dornbusch) oder abgedroschen. In der Ausstattung von Bernd Damovsky dominiert natürlich Schwarz. Daraus heben sich das Goldkleid der Königen von Saba (bei ihrem ersten Auftritt regnet es Goldplättchen vom Bühnenhimmel wie bei Jauchs Wer wird Millionär) und Sulamiths weisses Hochzeitskleid besonders effektvoll ab. Ärgerlich sind die heutzutage allgegenwärtigen hässlichen, weissen Monobloc Stühle, welche beim Wüstensturm in Trümmern von oben schweben (wie im ersten Akt die Gebetsbücher). Dass mit den Monobloc Stühlen im dritten Akt dann auch gleich noch ein Sesseltanz (Reise nach Jerusalem) aufgeführt wird, trägt bloss zur Belustigung des Publikums bei und erklärt die vorzeitige Abreise der Königin. Salomon fragt sie nämlich: „Behagt mein Fest dir nicht?“ Kein Wunder dass die kluge, emanzipierte Königin diesem infantilen Getue der Orthodoxen nichts abgewinnen kann ... .
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Wird diese Oper den Weg zurück ins Standardrepertoire finden? Da bin ich eher skeptisch. In Freiburg hat man die Oper von den Attributen der Grand Opéra etwas entschlackt, das Ballett z.B. gestrichen, nicht auf Opulenz der Ausstattung gesetzt, sondern das Werk auf die psychoanalytischen und emanzipatorischen Aspekte hin untersucht. Das ist durchaus statthaft und bei andern Opern aus dieser Epoche auch erfolgreich praktiziert worden. Der Autodidakt Goldmark war ein sehr begabter Orchestrierer, doch in der Behandlung der Gesangslinien zeigen sich eklatante Brüche: Das Changieren zwischen Schubertschem Liedgesang und der pathetischen Attitüde Wagners wirkt allzu unausgegoren, die grosse Linie und auch der melodische Einfallsreichtum oder die rhythmische Akzentuierung fehlen über weite Strecken. Dazu gesellt sich noch die allzu blumige Sprache des Librettos mit seinen grobschlächtigen Reimen. Nichtsdestotrotz: Dem Theater Freiburg muss man für diese Ausgrabung dankbar sein und darf sich auch auf die Veröffentlichung der geplanten CD freuen.
Und noch ein kleiner Hinweis: Für die nächste Saison ist Wolf-Ferraris DER SCHMUCK DER MADONNA geplant. Dieser veristische Reisser war einst ebenfalls ein Welterfolg: Man darf gespannt sein.
Kaspar Sannemann 17.5.15
Bilder: Theater Freiburg / Rainer Murnyi
OPERNFREUND-CD-TIPP
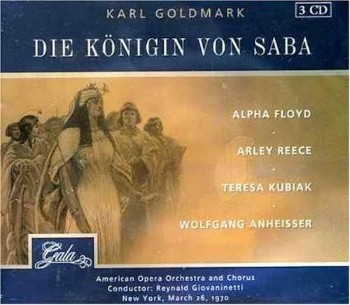
leider ist obige CD mittlerweile eine enebso audiophile Seltenheit, ebenso wie die folgende Aufnahme (Bild unten), die ich noch vor 10 Jahren für knappe 10 Euro erwerben konnte - nun bestimmt leider die Nachfrage den unverschämten Preis (zumindest beim größen Tonträgeranbieten)
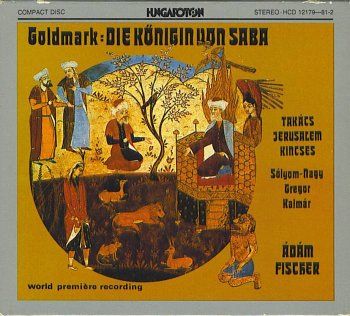
Die Fischer-Aufnahme glänzt wenigstens mit tollen Sängern und einem grandiosen Dirigenten - auch ist die Tonqualität sehr gut. PB
Primat von Musik und Gesang
DIE TOTE STADT
Besuchte Aufführung: 8.2.2015 (Premiere: 17.1.2015)
Trauerarbeit in surrealistisch-phantastischen Traumwelten
In diesem Jahr jähren sich zum 70. Male das Ende des Zweiten Weltkrieges und die damit verbundene Befreiung des deutschen Volkes von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Das Wirken der bornierten braunen Machthaber hat im deutschen Kulturbetrieb eine klaffende Wunde hinterlassen, deren Auswirkungen auch heute noch zu spüren sind. Was den Nazis als entartete Kunst galt und vehement verfemt wurde, waren oft hochkarätige Meilensteine im Wirken ihrer Schöpfer. So auch Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“, deren Uraufführung gleichzeitig an den Opernhäusern von Hamburg und Köln erfolgte und für die der Vater des Komponisten Julius Korngold unter dem Pseudonym Paul Schott - der Vorname entspricht dem der Hauptfigur der Oper, Schott ist der Name des Verlegers, bei dem das Werk herauskam - das Libretto verfasst hat. Wie so viele andere jüdischen Künstler musste auch Korngold aus Deutschland emigrieren. Seine außergewöhnlichen Qualitäten verhalfen ihm in Hollywood als Komponist von Filmmusiken zu großem Erfolg und bescherten ihm sogar den Oscar. Sein bestes und bekanntestes Werk stellt jedoch zweifelsfrei die „Tote Stadt“ dar, die jetzt am Theater Freiburg in einer Neuproduktion herausgekommen ist.

Michael Bedjai (Paul), Sigrun Schell (Marietta)
Florentine Klepper setzt bei ihrer Inszenierung nicht auf konventionelle, vordergründige Schauerromantik, sondern rückt die Handlung auf eine überzeugende psychoanalytisch-symbolhafte und surrealistische Ebene unter Einbeziehung von Sigmund Freuds „Traumdeutung“. Das von Martina Segna geschaffene karge Bühnenbild zeigt im Hintergrund eine Bretterwand, vor der rechts ein Turm aus verhüllten Möbeln aufragt und links das ebenfalls verschleierte Bild von Marie hängt. Hierbei handelt es sich um eine Phantasiewelt, während die Realität hoch oben auf der Wand verortet ist. Von dort schauen zu Beginn Frank und Brigitta, Bewohner der wirklichen Welt, auf die andere hinunter. Erster seilt sich schließlich zu Paul ab, der zu Beginn ebenfalls von einem Laken verdeckt wird, das er dann aber abwirft. Marietta entspringt seinem irrealen Wahn und ist damit kein Teil der Realität. Konsequenterweise darf sie auch nicht denselben Weg auf die Bühne nehmen wie der der Wirklichkeit verhaftete Frank. In die Rückwand ein großes, klaffendes Loch brechend, dringt sie unmittelbar in die phantastischen Traum-Gefilde Pauls vor. Dass ihr Besuch dort für sie tödlich endet, belegen symbolhaft die von Brigitta auf Befehl Pauls gebrachten Blumen: Nicht rote Rosen als Zeichen der Liebe, wie von ihrem Herrn gewollt, bringt sie, sondern weiße. Und letztere versinnbildlichen den Tod.

Sigrun Schell (Marietta)
Auf einer risikoreichen Grenzlinie zwischen noch zulässiger Trauer und ungesundem Wahn bewegen sich die Handlungsträger ungelenk und furchtsam fort, immer in Gefahr, vom Strudel der Wahnvorstellungen Pauls in den Abgrund gestürzt zu werden. Sie ist schon in höchstem Maße obsessiv, die krankhaft-psychopathische Umachtung Pauls, die sich immer mehr steigert und im zweiten Akt bei der von Marietta und ihrem Team nachgespielten Nonnenauferstehung aus Meyerbeers „Robert, le diable“ in ein sämtliche Grenzen zur Realität sprengendes, stark surrealistisches Bild von hoher Eindringlichkeit mündet. Der jetzt von einer riesigen Glocke dominierte Raum verliert seine Konturen, und die nach wie vor verhüllten Möbel und Gegenstände sowie von Adriane Westerbarkeys geradezu zauberhaft eingekleidete Traumgestalten schweben behende durch die Luft. Die Grenze zur gesunden Trauerarbeit ist eindeutig überschritten und mündet in den Wahnsinn des Protagonisten. Marietta wird zunehmend zur Projektionsfläche seiner unstillbaren Sehnsucht nach der toten Marie. Feuerbach lässt grüßen. Dass Paul ihr keine eigene Identität zugesteht und in ihr immer nur die Reinkarnation seiner verstorbenen Frau sieht, ruft schließlich ihren Widerstand hervor. Dieser findet während der ebenfalls nur in Pauls krankem Hirn stattfindenden Prozession in einem Coitus per Os der Tänzerin, wie die Mediziner dieses von der Regisseurin bewusst als Provokation des tief religiösen Paul eingesetzten, nicht gerade appetitlichen Sexspielchen nennen, seinen krassen Höhepunkt. Hinter das Ende setzt Frau Klepper ein Fragezeichen. Die Heilung Pauls von seiner krankhaften Trauer bleibt bei ihr Utopie. Im letzten Bild ertönen sämtliche Stimmen aus dem Off, während ein Double Pauls einsam und stumm um den immer noch verhüllten Möbelturm streift. Der Alptraum des Protagonisten hat keinen Abschluss gefunden, sondern geht weiter.

Ensemble
So weit so gut. Mit diesem durchaus überzeugenden Konzept kann man leben. Ein gelungener gedanklicher Überbau macht indes noch keine gelungene Inszenierung aus. Dafür sind auch gute handwerkliche Fähigkeiten erforderlich. Und daran mangelt es der jungen Regisseurin - zumindest im Augenblick - noch ein wenig. Insbesondere ließ sie eine spannungsgeladene, stringente Personenführung vermissen. Manchmal eintretende szenische Löcher vermochte sie nicht sonderlich gut zu füllen. Es gab Stellen, bei denen die Regie lediglich ein wenig an der gut aufbereiteten Oberfläche kratzte, dann aber nicht weiter in die Tiefe vordrang. Da ließ Frau Klepper schon manchmal die Zügel etwas schleifen anstatt sie straff anzuziehen. Bei aller Akzeptanz ihres durchaus ansprechenden geistig-innovativen Ansatzpunktes: Rein vom technischen Standpunkt aus betrachtet war ihre Inszenierung nicht sehr ausgereift und damit letztlich nur mittelmäßig. Schade.

Sigrun Schell (Marietta), Alejandro Lárraga Schleske (Fritz)
Im Graben hatte Johannes Knapp die musikalische Leitung von GMD Fabrice Bollon übernommen. Ihm gelang zusammen mit dem sich mächtig ins Zeug legenden Philharmonischen Orchester Freiburg eine geradezu rauschhaft-intensive Auslotung von Korngolds herrlicher Musik. Wunderbar gefühlvoll erklangen die an Puccini und Lehar gemahnenden Passagen. Hier erzielten insbesondere das Duett „Glück, das mir verblieb“, das Lied des Pierrot Fritz „Mein Sehnen, mein Wähnen“ und Pauls emotionaler Schlussgesang „O Freund, ich werde sie nicht wieder sehn“ eine emotionale Wirkung, die zu Tränen rührte. Die spätromantischen Elemente der grandiosen Partitur wurden vom Dirigenten und den Musikern trefflich herausgearbeitet, aber auch ihre impressionistischen Elemente wurden derart opulent und unter die Haut gehend vor den Ohren des beigeisterten Publikums ausgebreitet, dass man am Ende hoch beglückt den Theaterraum verließ. Dass die aus dem Graben tönenden wuchtigen Klangmassen teilweise etwas zu gewaltig gerieten und die Sänger etwas zudeckten, sei nur am Rande erwähnt.

Auf insgesamt hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Michael Bedjai hatte sich als Paul den Ansatzpunkt der Regie gut zu eigen gemacht und trefflich umgesetzt. Auch stimmlich vermochter er zu überzeugen. Mit seinem gut fokussierten, ausdrucksstarken Tenor bewältigte er die unangenehm hohe Tessitura der Rolle sehr achtbar und rang ihm auch schöne Differenzierungen und Nuancierungen ab. Dass hier und da mal die Intonation nicht so ganz stimmte, fällt angesichts seiner ansprechenden Gesamtleistung nicht ins Gewicht, ebenso wie einige kleine Abstriche, die man bei ihr in der exponierten Höhe machen muss, die insgesamt gute Leistung von Sigrun Schell in der Doppelrolle Marie/Marietta nicht schmälern konnten. Es ist schon beeindruckend, wie sie mit ihrem sonoren, gut verankerten und wandelbaren Sopran insbesondere bei der Marietta den regen Wechsel zwischen dramatischen, leichtstimmig-koketten und sehr emotional dargebotenen Stellen meisterte und zudem noch mit feinen Zwischentönen aufwartete. Auch darstellerisch war sie mit intensivem, verführerischem Spiel phantastisch. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ Alejandro Lárraga Schleske, der mit kernigem, elegant geführtem Bariton den Frank und den Pierrot Fritz sang. Einen sehr gefühlvollen, tief in sich ruhenden und geradlinig geführten Mezzosopran brachte Bernadett Wiedemann für die Brigitta mit. Solide präsentierten sich Susanna Schnell (Juliette) und Kyoung-Eun Lee (Lucienne). Bei den durch die Bank nur über ausgesprochen dünnes Stimmmaterial verfügenden Tenören Johannes Vondey, Christoph Waltle und Shinsuke Nishioka in den kleinen Partien von Gaston, Victorin und Graf Albert blieben einige Wünsche offen. Gut gefiel der von Bernhard Moncado einstudierte Chor.
Fazit: Ein wunderbares Werk, das den Besuch schon wegen der beachtlichen musikalischen und gesanglichen Leistungen lohnt.
Ludwig Steinbach, 9.2.2015
Die Bilder stammen von Rainer Muranyi
Vordergründig und uninspiriert
DIE TOTE STADT
Der Tiefsinn und das Rätselhafte bleiben im wahrsten Sinne des Wortes verhüllt
Simultan an den Opernhäusern in Hamburg und Köln wurde 1920 „Die tote Stadt“, die schon dritte Oper des damals 23-jährigen Komponisten Wolfgang Korngold aufgeführt. Librettist war Paul Schrott. Hinter diesem Pseudonym verbarg sich der einflussreiche Musikkritiker Julius Korngold, Vater des Komponisten. Der konnte unter seinem Namen schlecht als Förderer und Antreiber seines wunderkindmäßig begabten Sohns und gleichzeitig als sein Kritiker auftreten. In den zwanziger Jahren gehörte die Oper zu einer Reihe beliebter und viel gespielter Werke, die ehe diese allesamt durch die Nazi-Verfemung des Juden Korngold und seiner „entarteten“ Zeitgenossen in der Versenkung verschwanden. Im Ausland hatten sich die Werke dieser Generation nicht durchgesetzt; im Nachkriegsdeutschland wurden sie von der musikalischen Avantgarde belächelt und ins Abseits verbannt. Erst ab den neunziger Jahren hat man sich dieser Werke, die musikalisch auf der Spätromantik fußen, wieder vermehrt angenommen. Heute ist „Die Tote Stadt“ von den Opern der Generation der „doppelt Verfemten“ wohl die meistgespielte: für die letzte und die laufende beiden Spielzeit listet operabase allein 14 verschiedene Produktionen in mehreren Ländern.

Sigrun Schell (Marietta), Alejandro Lárraga Schleske (Frank/Fritz)
Das Libretto basiert auf dem Roman „Bruges la morte“ (Das tote Brügge) (1892) des belgischen Symbolisten Georges Rodenbach, nimmt dazu noch die morbide Stimmung auf, welche das Wien der vorletzten Jahrhundertwende bestimmte und geht auf Traumdeutung und Tiefenpsychologie ein, wie sie Freud in dieser Zeit entwickelte. Der Einführungsvortrag des Dramaturgen der Freiburger Produktion Heiko Voss zeichnete die architektonischen Linien des Werks, ihre horizontale und vertikale Mehrschichtigkeit, die Parallelen zwischen Protagonisten und Spielort, die Gegensätze zwischen der Anbetung der Asche und vitaler Existenz und die Übergänge zwischen Traum und Sein in einer Welt auf, die von Bigotterie durchzogen ist und in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit laufend verschwimmen.
Der Roman von Rodenbach spielt in Brügge Brügge, einst die reichste Handelsstadt der Hanse, nun in Bedeutungslosigkeit versunken. Diese „tote Stadt“ ist Metapher für den in einen pathologischen Gemütszustand versunkenen Paul, Hauptfigur der Handlung, der seine Tage zeitvergessen vor einem Reliquiar mit „Devotionalien“ seiner verstorbenen Frau Marie verbringt. Marietta, vor Lebenslust sprühende Leitfigur einer Komödiantentruppe mit einer frappanten Ähnlichkeit zur Verstorbenen scheint Paul ins wahre Leben zurückholen zu können. Aber die Beziehung zerbricht, als Marietta Paul endgültig aus seiner Anbetung der Vergangenheit schütteln will. Sie will nicht als wiedererstandene Ikone verehrt werden, sondern als Frau aus Fleisch, Blut und Temperament. Pauls Freundschaft zu Frank zerbricht, weil der auch eine rätselhafte Beziehung zu Marietta hatte/hat; seine Haushälterin Brigitta verlässt ihn, um sich den Beghinen anzuschließen. Als Marietta Paul ein letztes Mal aufreizt, erdrosselt er sie: „Nun gleicht sie ihr (Marie) ganz.“ – Ein (geträumter?) Befreiungsmord? Das Libretto lässt ihn das tatsächlich nur träumen, denn auch für das geschockte Publikum kommt die echte Marietta kommt noch mal herein, um einen vergessenen Regenschirm zu holen. Paul und Frank verlassen die tote Stadt.

Michael Bejai (Paul); Sigrun Schell (Marietta)
Die Regisseurin Florentine Klepper ist ihrem Kritiker durch zwei gelungene Studioproduktionen in Frankfurt im LAB und im Depot bekannt. Aber eine Hauptbühne stellt größere Anforderungen. Denen zeigt sich Frau Klepper in Freiburg nicht gewachsen. Die Inszenierung wirkte improvisiert, teilweise unfertig und blieb oberflächlich. Von dem, was der Vortrag des Dramaturgen versprach, wurde so gut wie nichts eingelöst. Das kann ihm nicht verborgen geblieben sein. Was macht dann eigentlich ein Produktionsdramaturg im Inszenierungsprozess?
Dabei ist der Einstieg in das Werk noch ganz interessant. Von hoher Warte schaut Frank in die abgeschottete Welt des Paul hinunter, der in einem riesigen Raum mit unter weißen Laken verhüllten, hoch aufgetürmten Möbeln sitzt. Er selbst ist auch verhüllt. (Bühne: Martina Segna) Das Portrait von Marie hängt oben im Raum – ebenso verhüllt – schlecht geeignet als Reliquiar und szenisch mit divergierenden Aussehen von Marie und Marietta höchst fragwürdig benutzt. Frank, der Paul besuchen kommt, lässt sich mit Sitzgurt und Seil in dessen Welt hinab. Marietta macht es sich bei ihrem Auftreten viel einfacher: sie zerstört die Tapete und ist einfach da! Damit ist die unterschiedliche Welt der Freunde sowie der Toten und Mariettas schön exponiert. Aber dann kommen schon die handwerklichen Fehler. Die Akteure balancieren ängstlich, unsicher und ungeschickt auf den aufgetürmten Möbeln herum oder hängen halb hilflos im Seil. Warum muss die Regisseurin gestandenen Darstellern so etwas zumuten? Dazu kommen Ungereimtheiten: Paul bestellt bei Brigitta (seiner „alten treuen Magd“) für seine Frau rote Rosen, denn für ihn ist sie noch Teil seines Lebens. Brigitta bringt aber weiße Rosen. Am Text kann man sich ja reiben, aber am Sinn? Dann kommen auch noch Regiemätzchen hinzu („Ferz“ wie man in Rheinhessen sagt). Marietta besorgt es Paul mit einer Fellatio, während der sich religiösem Gesang hingibt: doppelt geschmacklos, aber „Ich bin Regie!“

Sigrun Schell (Marietta)
Das zweite Bild spielt in der Stadt. Hier ist auch alles mit Laken verhüllt. Da aber im Scheinwerferlicht die Strippen silbrig leuchten, weiß man schon, dass die Hüllen hochgezogen werden. Die Szene der Komödianten, in der sie nachts eine Szene aus Robert der Teufel aufführen, ebenfalls eine Szene zwischen Tag und Traum, die die Parallelität der psychologischen Gegenwartssituation mit einer der Schauerromantik zeigt, wird in klamaukiger Surrealität mit z.T. grotesken Kostümen (Adriane Westerbarkey) gezeigt. Das würde eine tiefgründige oder verkopfte Inszenierung in wünschenswerter Weise auflockern, aber in der platten Vordergründigkeit dieser Produktion wirkt das aufgesetzt. Regie Insgesamt: Gewogen (nur Tara) und zu leicht befunden.
Kinder- und Frauenchor (Einstudierung Thomas Schmieger bzw. Bernhard Moncado) werden Libretto-getreu von der verdeckten Hinterbühne zugespielt. Auf den Beghinenzug verzichtet die Regie. Die akustische Qualität der Zuspielungen war aber an diesem Abend eher bescheiden – oder gewollt verdumpft? Zudem hielt man anscheinend die Mikrophone im zweiten Bild dauernd eingeschaltet; denn da erklangen plötzlich die Solisten unnatürlich laut und ebenfalls klangfarblich unangenehm dunkel. Was für die einzuspielende Stimme der (toten) Marie konventionell richtig gedacht und gemacht ist, führt dann auch bei „Mein Sehnen, mein Wähnen“ (Fritz) zu einer vergröbernden Verstärkung, verfälscht die Stimme des Solisten und nimmt den filigranen Charakter bis hinein in den Orchesterklang. Die Schlussszene der Inszenierung mit nur noch zugespieltem Gesang und einer völlig verfälschten szenischen Darstellung („Neudeutung“?) hinterlässt einen schalen Nachgeschmack der Oper – und der letzte Eindruck ist bekanntlich der nachhaltigste.

Michael Bedjai (Paul); Sigrun Schell (Marietta)
Den Klang hatte GMD Fabrice Bollon mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg zu gestalten. Er hatte sich wohl Gedanken darüber gemacht, was der junge Komponist im Sinne gehabt haben konnte. Das konnte kaum ein ausgewogenes, abgehobenes Klangbild sein, sondern eher „Sturm und Drang“. Bollon ließ die Partitur zwischen spätromantischer Opulenz, irisierendem Impressionismus und operettig-leichtem Schmelz überwiegend recht ruppig ertönen, auch laut bis zum Lärmigen und scheute sich stellenweise nicht, die Sänger herauszufordern. Dass der Klang teilweise auch über die Hinterbühnenmikrophone zurück kam und nivelliert wurde, trug nicht zu einem wünschenswerteren ausgewogeneren Klangbild und zu Transparenz des Orchesters bei, das als Musikergruppe indes untadelig aufspielte. Bei den operettenhaften Passagen der Oper wurde hingegen ein schmiegsamer Klang erzeugt. Fritzens Sehnen und Wähnen wird mit feinem Pastell der Holzbläser untermalt.

Komödianten; in der Mitte: Sigrun Schell (Marietta)
Sehr ordentlich waren die vier Hauptrollen besetzt. Michael Bedjai als Paul konnte mit seiner kraftvollen und nuanciert färbenden bronzene Mittellage sowie mit strahlenden klaren und festen Höhen überzeugen, hatte aber dazwischen auch mit Schwankungen und Intonationsunsicherheiten zu kämpfen. Alejandro Lárraga Schleske, auf den die Rollen von Frank und Fritz (dieser auch als Pierrot) vereint waren, gefiel mit seinem sehr kultivierten lyrischen Baritonmaterial von guter Textverständlichkeit. Im (unverstärkten) Wechselgesang mit Marietta und Paul hätten sich letztere im Sinne ausgewogener Klangwirkung etwas zurücknehmen können; verstärkt kam Schleskes Stimme dagegenvöllig verändert durch; da klang sein Sehnen und Wähnen undifferenziert. Sigrun Schell, der „Allzweckwaffe im Freiburger Ensemble“, die von Rollenfachkategorisierung nichts hält, lag die Marietta passagenweise zwar etwas hoch, aber die sängerischen Facetten der Rolle von subrettenhaftiger Leichtigkeit, Lyrik und Dramatik gelangen ihr bei sehr engagiertem Spiel gut. Die Mezzosopranistin Bernadett Wiedemann gab eine sängerisch überragende, stimmgewaltige Brigitta mit warmer Grundierung und guter Fokussierung bis in ihre leuchtend klaren hohen Passagen.
Dem Premierenpublikum im vollen Haus hat der Abend gefallen. Mit riesigem Beifall (verhalten nur für die drei Damen des Leitungsteams) bedankten sie sich für den Abend. Man hat es hier zwar nicht in seiner Tiefgründigkeit geboten bekommen, aber dennoch als effektvolles Musiktheater. Weitere Aufführungen: 22., 24., 29. Januar; 1., 4., 8., 13. Februar; 6., 20. März.
Manfred Langer, 19.01.2015
Fotos: Rainer Muranyi
DER SPIELPLAN 2014/15
Tote und gute Städte
Nach einer mehrmonatigen Umbauphase soll das Publikum im Oktober dieses Jahres wieder im sanierten Großen Haus empfangen werden. Neben der Neugestaltung der Bar »Passage« (ehemals Jackson-Pollock-Bar), verfügt das Theater dann über eine neue Drehbühne und eine komplett digitalisierte Bühnentechnik.

GMD Fabrice Bollon (Foto: Maurice Korbel)
Opern des 18. Jahrhunderts rahmen den neuen Spielplan ein: Händels „Orlando“ hat im November 2014 Premiere, Glucks „Orpheus und Eurydike“ im Juni 2015. Beide Werke beschritten jeweils musiktheatralisches Neuland, indem sie die barocke Tradition der Da-capo-Arien aufzubrechen bzw. dem artifiziellen musikalischen Gestus eine Handlungsdramaturgie vorzuziehen beginnen. Orlandos ‚Wahnsinn‘ mag die Richtung für den weiteren Opernspielplan vorgeben, der ansonsten unangepassten Grenzgängern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet ist – bekannten und weniger bekannten, aber alle gleich in ihrer Obsession, die Realität nach ihrer Vision gestalten zu wollen: „Carmen“, der „Troubadour“, die „Königin von Saba“ und „Die Tote Stadt". An Karl Goldmark wird auch mit einem Stück in der „Nuit Philharmonique“ gedacht.
Der Ausbau der Tanzsparte zu einer Produktionsplattform, die internationale Tanzschaffende einlädt, in Freiburg zu arbeiten, steht auch in der neuen Spielzeit im Mittelpunkt. Nach Anna Wagner übernimmt die Hamburger Kuratorin Anne Kersting die künstlerische Leitung der Sparte. Die ersten Monate stehen im Licht der von Graham Smith geleiteten "School of Life and Dance" (SoLD) des Theaters Freiburg. Zu Weihnachten erarbeiten 100 tanzbegeisterte Freiburger im Alter von 8 - 75 Jahren eine ganz eigene Version von „Der Nussknacker“. In einer Kooperation mit dem Museum für Neue Kunst beschäftigen sich Künstlerinnen aus den Bereichen „Choreografie“ und „Bildende Kunst“ unter dem Themenschwerpunkts »Rip it!« mit der Konstruktion von Geschlechteridentitäten. Beim Abschlussfestival im Februar 2015 wird erstmals die berühmte Choreografin Anne Teresa de Keersmaker mit ihrer Company in Freiburg zu Gast sein. Choreograf Sebastian Matthias entwickelt mit „Groove me Freiburg“, eine Produktion, die sich mit dem (?) für Freiburg spezifischen Rhythmus (?) auseinandersetzt.

Intendantin Barbara Mundel (Foto: Maurice Korbel)
Die Opernpremieren:
29.11.2014 Georg Friedrich Händel Orlando
ML: Julia Jones I: Joachim Schloemer
17.01.2015 Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt
ML: Fabrice Bollon I: Florentine Klepper
21.02.2015 Giuseppe Verdi Der Troubadour
ML: Gerhard Markson I: Rudi Gaul & Heiko Voss
18.04.2015 Karl Goldmark Die Königin von Saba
ML: Fabrice Bollon I: Kirsten Harms
30.05.2015 Christoph Willibald Gluck Orpheus und Eurydike
ML: NN I: Markus Bothe
13.06.2015 Sinem Altan und Tina Müller Die gute Stadt (UA)
ML: Nikolaus Reinke I: Thalia Kellmeyer
Der Star ist das Orchester
Giacomo Puccini Béla Bartók
IL TABARRO HERZOG BLAUBARTS BURG
Premiere am 26.04.2014
Zwei Stücke passend gemacht?
Während der Instandsetzungsarbeiten der Bühnentechnik im Freiburger Theater bis zum Ende der Spielzeit dient die Theaterhalle auf dem Gelände der Brauerei Ganter am Rande der Innenstadt an der Dreisam als Ausweichquartier. Hierfür wurde eine Leichtbauhalle mit einer gerade aufsteigenden Tribüne und Platz für knapp 600 Besucher errichtet. Bühne und Orchester befinden sich ebenerdig; Bühnentechnik über Beleuchtungseinrichtungen hinaus ist nicht vorhanden. Der Hinterbühnen- und Künstlerbereich ist in Containern untergebracht. Die Spielfläche stößt vorne gleich an den Zuschauerbereich an; die Akteure können über drei Monitore am Rand der sehr breiten Spielfläche dem Dirigenten folgen, der das im hinteren Bereich sitzende Orchester leitet. Die akustische Abstimmung zwischen Solisten und Orchester war gut; in der Halle herrscht eine sehr präsente, transparente Akustik. Sehr präsent, aber weniger transparent war an diesem Abend das Geräusch eines niedergehenden kräftigen Gewitterschauers und der damit verbundene Donner; man freute sich wohl über den lang ersehnten Regen; aber während etwa fünf Minuten in Herzogs Blaubarts Burg übertönten die Naturgewalten zwanglos das musikalische Geschehen des Opernabends.
IL TRITTICO (Das Triptychon) von Giacomo Puccini erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit; aber nicht nur bestimmungsgemäß als Dreifachopernabend, sondern auch als „Steinbruch“ zur Gewinnung von Doppelpartnern für andere Kurzopern. Vor allem Il tabarro und Gianni Schicchi bieten sich an. Von Bartók gibt es den Solitär „Herzog Blaubarts Burg“; den hat man schon mit allem Möglichen kombiniert; als denkwürdigste Zusammenspannung muss wohl immer noch der Frankfurter Doppelabend mit Purcells „Dido and Aeneas“ gelten (Insz. Barrie Kosky). Bei dieser Frankfurter Zusammenschaltung steht im Programmheft wahrheitsgemäß, dass diese beiden Opern nur eins gemeinsam haben: sie brauchen eine weitere Kurzoper zur Gestaltung eines abendfüllenden Programms. Nun kam im Theater Freiburg die sicher neuartige Kopplung des Blaubart mit dem Tabarro aus dem Trittico heraus. Stilistische Gemeinsamkeiten sind auch bei dieser Kopplung Fehlanzeige; aber immerhin bringt man vor, was die beiden Kurzopern gemein haben. Am auffälligsten ist das gemeinsame Uraufführungsjahr 1918 der jeweils einige Jahre zuvor entstandenen Stücke. Dann handelt es sich bei beiden Opern um düstere Nachtstücke; Il tabarro spielt wirklich am Abend und in der Nacht; in Herzog Blaubarts Burg wird die dunkle, blutbedeckte Burg thematisiert als Abbild seiner finsteren unzugänglichen Psyche, in die seine letzte Frau Judith durch Öffnen von sieben Türen Licht zu bringen bemüht ist, d.h. Heiterkeit und Liebe.

Der Mantel: Juan Orozco, Christina Vasileva
Bei diesem Doppelabend (Il tabarro wird zuerst gezeigt) bemüht sich der Regisseur Jörg Behr allerdings, auch durch szenische Elemente die beiden Opern zu verklammern, was zum einen kaum störend ist, zum anderen aber eine rein äußerliche Übung bleibt und glatt an der vertiefenden Psychologiestudie des zweiten Teils vorbeiführt. Die Verklammerung erfolgt auch über das Einheitsbühnenbild über die riesig breite Spielfläche für beide Stücke von Tilo Steffens. Dieser hat ein halbes Dutzend Flachdachkabinen mit Türen aufgestellt. Aha, sagt sich der Zuschauer, da stehen sie schon, die Türen von Blaubarts Burg; aber warum sind es nur sechs und warum sind sie alle schon offen? Für den „Mantel“ hätte es hingegen nur einer einzigen Kajüte bedurft. Aber das Bühnenbild ist hier den räumlichen Gegebenheiten der Halle mit seiner enormen Breite angepasst, und mehr Hütten schaffen mehr Bewegungsmöglichkeiten, für die auch die ganze Breite vom Regisseur ausgenutzt wird. Dagegen bleiben die Seine und das Flussschiff der Fantasie der wissenden Zuschauer vorbehalten.

Der Mantel: Christina Vasileva, Adriano Graziani
Da Herzog Blaubarts Burg über einen gesprochenen Prolog verfügt, wird auch Il tabarro mit gesprochenen Versen eingeleitet. Danach bevölkert die Tabarro-Mannschaft die Bühne und stellt Requisiten auf: einige auf einem Hubwagen herangefahrene Paletten mit Weinkartons, ein paar Kisten und sonstiger Plunder. Dann erfährt man während der Ouvertüre etwas von der Vorgeschichte der Oper. Das Kind Giorgettas und Micheles fährt mit einem Dreirad über die Bühne, wird hinter einer der Hütten von einem Auto erfasst und getötet. Diese Szene wird von Darstellern gespielt, die später die beiden Hauptfiguren doppeln (merkwürdiger Weise im Programm jeweils „alter ego“ genannt, was unzutreffend ist, denn die beiden stummen Rollen gelten Giorgetta und Michele in jüngeren, glücklicheren Jahren; ihr Erscheinen auf der Bühne während der Oper drückt jeweils Gedanken an die Person oder Erinnerung an früher aus. Standardhandwerkzeug der Regisseure.) Sehr gut gelingt die Milieu-Schilderung im ersten Teil dieser veristischen Oper und die Charakterisierung der Akteure. Aber bei der Umsetzung des Geschehens (viel geschieht eigentlich gar nicht, weil vieles nur Schilderung ist), bleibt die Regie von szenischem Realismus zeitweise etwas entfernt; sehr naturalistisch hingegen der Zweikampf zwischen Michele und Luigi, der zum Tod des letzteren führt, dessen Leiche unter einem noblen weißen Mantel verborgen wird. Die naturalistisch-funktionellen Kostüme sind von Marc Weeger.

Der Mantel: Juan Orozco, Adriano Graziani (liegend), Christina Vasileva
Zu Beginn von HERZOGS BLAUBARTS BURG befindet sich noch die Belegschaft des Tabarro auf der Bühne, ebenso wie die Requisiten des vorhergehenden Stücks (Verklammerung!) Als die Bühne von Personen und Gegenständen freigeräumt ist und der Prolog (auf Deutsch) gesprochen ist, kommen Judith und der Herzog in einem schicken Sportwagen auf die Bühne gerollt. Sie im Hochzeitskleid, er wie eine Erscheinung aus der Halbwelt im Dreiteiler, offenen Hemd und Hut (Kostüme wiederum: Marc Weeger). Frisch verheiratet! Die Türen der sechs Kabinen auf der Bühne sind nun doch nicht die Türen zu Blaubarts geheimen Räumen; das wäre zu vordergründig gewesen; vielmehr bleiben diese Türen teilweise imaginär, es kommt ja auch mehr auf das an, was sich dahinter verbirgt. So steigen die beiden über eine Leiter auf eine der Hütten, von wo aus die weiten Ländereien Blaubarts besichtigt werden können; seine unermesslichen Schätze kommen aus dem Polsterkissen eines hereingefahrenen Sofas; die Tränensee wird durch wabernde Dämpfe im Inneren der Sportkarosse dargestellt; die diesbezügliche Tür ist der Kofferdeckel des Wagens. Das alles ist durchaus spannend. Inzwischen haben sich auch schon die drei „verstorbenen Frauen“ Blaubarts ins Bild geschoben – alle ähnlich mit platinblondem Haar und langen weißen Gewändern. An den Auspuff des Sportwagens schließen sie einen Schlauch an, dessen anderes Ende ins Innere des Wagens gelegt wird. Nachdem Blaubart seine vierte Frau als Nachtgemahlin schwarz eingekleidet und dann erstochen hat, will er mit seinem Sportwagen davonfahren; aber er erstickt im Auto... Der Blumenstrauß, den Michele im Tabarro seiner Frau zur Wiederannäherung mitgebracht hat, spielt ebenso wieder im Blaubart mit wie der große weiße Mantel und sogar die doppelnde Frauenrolle der Giorgetta. Die Absicht des Regisseurs, die Stücke zu verbinden, gipfelt aber in der Szene des Tränensees. Wieder kommt das Kleinkind auf seinem Dreirad angeradelt und stößt - diesmal sichtbar auf der Bühne - gegen den stehenden Sportwagen; die doppelnden Figuren aus dem Tabarro tragen es tot fort. Regisseur Jörg Behr zieht hier dem verinnerlichten Spiel zu Zweit (Judith will durch das Öffnen der Türen Licht in die Burg und die Seele des finsteren Herzogs bringen.) die Ablenkung durch eine unmotivierte Äußerlichkeit vor.

Herzog Blaubarts Burg
Das Ringen zwischen Judith und dem Herzog ist auch in der Musik abgebildet. Dass das unter die Haut ging und nachhaltig beeindruckte, ist das Verdienst von GMD Fabrice Bollon und des Philharmonischen Orchesters Freiburg, das an diesem Abend in Bestform aufspielte. Immer wieder fällt das Orchester in Blaubarts Burg in fast einlullende Ostinati der tiefen Streicher zurück, und nach den immer wieder harten „Judit!“ des Herzogs brechen die großartigen Farben der Partitur lautmalerisch oder programmatisch zur Entwicklung des Bühnengeschehens in immer stärkeren Emotionen aus. Härter und expressionistisch - wie der Duktus der ungarischen Sprache, in der der Blaubart gesungen wird – erklingt Bartóks Musik im Vergleich zum Italienischen des vorangegangenen Puccini, dessen harmonische Rückungen impressionistisch wirken. Dabei sind Puccinis komponierte Befindlichkeiten weitaus leichter zugänglich, weil ganz konkret mit dem Bühnengeschehen verbunden: vom beruhigenden Fließen der Seine und den heiteren folkloristischen Milieu-Passagen bis zu den hochdramatisch emotionalen Passagen reizte das Orchester in Dynamik und Ausdruckskraft die Partitur aus. Es war der Abend des Freiburger Orchesters und seines Leiters, der zudem immer sängerfreundlich abstufte, wozu noch die Tatsache beitrug, dass die Sänger im Schnitt über fünf Meter näher zum Publikum agierten als die Instrumentalisten.
In DER MANTEL stimmlich und darstellerisch sehr präsent war die bulgarische Sopranistin Christina Vasileva in der Rolle der Giorgetta. Zwar klang ihre Stimme in der glasklaren Akustik der Halle in der Höhe etwas hart, aber sowohl in Klarheit und Linienführung als auch in der Kraftentfaltung bestach ihr heller Sopran. Mit Adriano Graziani als Luigi war ein Gasttenor mit großer Strahlkraft und der Geschmeidigkeit eines Puccini-Helden engagiert, die er mit recht mühelos erscheinender Kraftentfaltung ohne Schärfe zu verbinden wusste. Sein schauspielerischer Einsatz als Aufmüpfer gefiel gut. Die dritte Hauptrolle, die des Michele, sang Juan Orozco vom Freiburger Ensemble. Er machte aus dem Schiffseigner mit sozialer Verantwortung einen Sympathieträger, zu welchem auch sein geschliffen-eleganter Bariton wie auch seine Kostümierung elegant im Dreiteiler beitrug. Den mörderischen Eifersuchtsausbruch und Zweikampf mit dem jüngeren Luigi mochte man ihm indes nicht so abnehmen. Auch die Regie war hier nicht glaubwürdig; denn Luigi hatte von seinem Standpunkt auf dem Dach einer der Kabinen Michele beim Anzünden der Zigarette gar nicht sehen können. In den Nebenrollen gefiel die Frugola der Qiu Ying Du mit erfrischend humoristischem Spiel und leichtem, schlankem Mezzo. Evert Sooster, Dauergast in Freiburg, gestaltete mit kernig-kraftvollem, aber ziemlich eindimensionalem Bass die Rolle des Talpa; und Shinsuke Nishioka bewährte sich mit geschmeidig-feinem Tenor als Tinca. Die Textverständlichkeit aller Sänger war sehr ordentlich.

Herzog Blaubarts Burg
Die beiden Rollen in HERZOG BLAUBARTS BURG konnte das Theater Freiburg mit Muttersprachlern besetzen. Der harte Klang dieser Sprache gab den Dialogen das entscheidende Stück Authentizität. Viktoria Mester ist international auf die Rolle der Judith abonniert; sie sang diese Rolle in Freiburg nuanciert und expressiv bis emotional, gefiel stimmlich mit ihrem warm grundierten Mezzo und viel Leuchtkraft in der Höhe und wirkte glaubwürdig in der Rolle der Frau, die den verstockten Blaubart für sich gewinnen will. Für letzteren war Levente Molnár besetzt, der über den für diese Rolle erforderlichen kraftvoll-dunklen und tiefgründigem Bassbariton verfügt, mit dessen Substanz er restlos überzeugen konnte.
Das Premierenpublikum nahm den gelungenen Doppelabend sehr gut an. Er kommt vom 30.04. bis zum 11.07.2014 noch insgesamt zwölf Mal in der Thaterhalle auf dem Ganter-Gelände.
Manfred Langer, 28.04.2014 Fotos: Maurice Korbel
Modern und werkgetreu
TANNHÄUSER
Premiere: 22. 2. 2014
Rückblick eines Traumatisierten
Das Theater Freiburg kann wahrlich auf eine große Wagner-Tradition zurückblicken. In den vergangenen Jahren kamen an diesem schon oft bewährten Opernhaus im Breisgau geradezu sensationelle Produktionen von Musikdramen des Bayreuther Meisters zustande, die auch gesanglich Maßstäbe setzten. An dieses hohe Niveau vermag der jetzt neu herausgebrachte „Tannhäuser“, der in einer Mischfassung aus Pariser und Dresdener Fassung präsentiert wurde, nahtlos anzuknüpfen. Hier haben wir es mit einem geradezu preisverdächtigen Musterbeispiel in Sachen spannendes, hervorragend durchdachtes und einen überzeugenden psychologischen Einschlag aufweisendes Musiktheater zu tun. Während bei den vorangegangenen Freiburger Wagner-Produktionen immer Frank Hilbrich für die Inszenierung verantwortlich zeigte, hatte dieses Mal Eva-Maria Höckmayr, die dem Theater Freiburg bereits eine gelungene „Pique Dame“ beschert hatte, am Regiepult Platz genommen und dort eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie zu den ersten ihres Fachs gehört.

Christian Voigt (Tannhäuser), Chor
Nina von Essen hat ihr als Einheitsbühnenbild einen Kirchenraum mit Bänken und einer Kanzel entworfen. Ein im Hintergrund erhöht liegender kleinerer „Sakralraum“ dient Elisabeth, dem Landgrafen und zum Schluss auch Venus als stiller Rückzugsort, von dem aus sie gleichsam von einer erhöhten Warte aus das im unteren Bereich wie in einer Arena ablaufende dramatische Geschehen beobachten können. In diesem Ambiente hat die Regisseurin Wagners Werk in starken, oft sehr unter die Haut gehenden Bildern - so wird beispielsweise während des Bacchanals Elisabeth unter den Augen des hier persönlich auf der Bühne erscheinenden Papstes ans Kreuz geschlagen und anschließend zum Schnürboden emporgezogen - gekonnt modernisiert, ohne dabei dessen Wesensgehalt anzutasten. Sämtliche Regieeinfälle lassen sich aus dem Libretto heraus begründen, womit man diese gelungene Produktion trotz ihres zeitgenössischen Anstrichs als durchaus werkgetreu bezeichnen kann, wobei dieser nicht unproblematische Begriff ja sowieso längst einer Neudefinition harrt.
Frau Höckmayr rollt das Stück von hinten auf und setzt mit ihrer Interpretation in der Psyche des Titelhelden an. Das Kernereignis sieht sie in dem Bannfluch des Papstes, der bei ihr am Anfang des Geschehens steht. Dieses emotional in krassester Weise einschneidende Erlebnis löst in dem vergebens um Gnade flehenden Tannhäuser eine Psychose aus. Im Folgenden hält er eine Rückschau und durchlebt noch einmal alle positiven und negativen Ereignisse der Vergangenheit mit all ihren Emotionen, die sowohl positiver als auch negativer Natur sind. Dabei steht ihm ein Alter Ego zur Seite. Dem aufgewühlten, traumatisierten Inneren des Helden entspricht es, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zunehmend durchlässig werden und eine phantastische, surreal anmutende Traumwelt entsteht, die ihren Ursprung in Tannhäusers Seelenleben hat. In extremer Weise schwankt er zwischen Wirklichkeit und Phantasie hin und her, wobei ihm die Welt des Venusbergs eine Möglichkeit zur Verarbeitung seiner auf der Wartburg gemachten schlechten Erfahrungen bietet. Sie erscheint als Ort der Reflexion und auch der Sehnsucht. Letztere manifestiert sich auch in dem weiblichen Prinzip, verkörpert durch Venus und Elisabeth als zwei gleichermaßen notwendige Komponenten geistiger als auch sinnlicher Liebe.

Anna Nechaeva (Elisabeth), Christian Voigt (Tannhäuser), Jin Seok Lee (Landgraf)
Dieser Ansatzpunkt ist nicht mehr neu, wird aber gekonnt mit schonungsloser Radikalität durchgezogen. Während andere Regisseure mit derselben Idee beide Frauen ein und derselben Gesangssolistin anvertrauten, sind sie bei Eva-Maria Höckmayr in traditioneller Weise mit zwei Sängerinnen besetzt. Das ist in dieser Produktion aber auch nötig, denn häufig sind beide Damen gemeinsam auf der Bühne - manchmal real, teilweise aber auch in Form von überlebensgroßen Videoprojektionen. Das als ausgemachtes Zerrbild von Tannhäusers erotischen Phantasien mit äußester Rasanz in Szene gesetzte Bacchanal konfrontiert das Publikum nachhaltig mit teils reellen, teils imaginären Erscheinungsformen der beiden Damen, wobei es hoch erotisch hergeht. Nicht immer war das Durcheinander, das bei dieser Szene auf der Bühne herrschte, in allen seinen Einzelheiten genau zu erfassen. Dabei führt die Regisseurin den Zuschauer auch ein wenig an der Nase herum. Die traditionelle, von Julia Rösler mit einem herrlichen blauen Kostüm und einem Heiligenschein ausgestattete Madonna, die man zuerst für Elisabeth hielt, entpuppt sich auf einmal als Venus, die dem Minnesänger vor einem ziemlich rasch vollzogenen Kostümwechsel von dem „Sakralraum“ aus ihren entblößten Busen präsentiert. Auf der anderen Seite scheint eine in Form einer riesigen Videoprojektion auf die Wand geworfene, aber nur von hinten gezeigte splitternackte Frau, deren allmählichem Entkleidungsvorgang man vorher verfolgen durfte und in der man natürlich Venus zu erkennen glaubte, überraschenderweise Elisabeth darzustellen. Dass keine der beiden Liebesarten ohne die andere auskommt, beide sich gegeneinander bedingen und sogar austauschbar sind, wurde durch diesen genialen Regieeinfall nur allzu deutlich. Wenn sich am Ende des dritten Aufzuges Elisabeth und Venus im „Sakralraum“ zum ersten Mal richtig treffen, erfährt dieser Einfall noch einmal eine Bestätigung. Als die Nichte des Landgrafen ihre Rivalin auf einmal in diesem Gemach erblickt, das Venus zuvor auch schon einmal fast nackt betreten hatte, wird sie sich schlagartig über diese eherne Notwendigkeit klar. Bereits zuvor hat die Regie sie weniger als Heilige als vielmehr als sehr sinnliche Frau gezeichnet, deren auf die Wände projiziertes und auf diese Weise bewusst herausgestelltes vielsagendes Minenspiel Bände sprach. Dieses Konzept wird zudem durch eine Identifikation auf der Kostümebene bestätigt. Beide Damen dürfen sowohl ein in reinem Weiß gehaltenes als auch ein die Sünde ausdrückendes rotes Kleid tragen. In dem „Sakralraum“ stirbt Elisabeth dann auch.

Christian Voigt (Tannhäuser), Victoria Mester (Venus)
Auch die Vorführung der Wartburg als einer von einer fragwürdigen Doppelmoral geprägten Gesellschaft hat man schon ähnlich gesehen. Hier fühlte man sich ein wenig an Sebastian Baumgartens zu Unrecht so sehr gescholtener Bayreuther Inszenierung von Wagners Oper erinnert. Nicht nur einmal begibt sich der Landgraf in den „Sakralraum“ und beobachtet derart abgeschirmt das sinnliche Treiben. Er und sein Hofstaat sind sich der Präsenz des Venusbergs wohl bewusst. Jeder hat eine bestimmte Vorstellung von dieser Gegenwelt, artikuliert sie aber nicht. Das ist auch nicht erlaubt. Gegen dieses Verbot verstößt Tannhäuser, wenn er beim von der Kanzel aus geführten Sängerwettstreit dieses gesellschaftliche Tabu bricht. Er hat das Schweigegebot gebrochen und konfrontiert die fragwürdige Gemeinschaft mit einer für sie unangenehmen Wahrheit. Er fördert das zutage, was verborgen bleiben soll - ein Vorgang, der sich später beim Papst wiederholt. Dieser gehört in Frau Höckmayrs Interpretation ebenfalls zur Wartburgwelt und ist vielleicht sogar mit Landgraf Hermann verwandt. Derselben fragwürdigen Mentalität wie dieser verhaftet, ist es kein Wunder, dass er dem reuigen Büßer die Absolution verweigert. Dieser Einfall, Rom als verlängerten Arm der Wartburg zu zeigen, ist brillant.

Anna Nechaeva (Elisabeth), Christian Voigt (Tannhäuser), Viktoria Mester (Venus)
Lediglich Wolfram versteht es, geschickt zwischen sinnlicher und geistiger Liebe hin und her zu pendeln, ohne seinen Sängerkollegen dabei seine wahre Gesinnung zu offenbaren. Zu Elisabeth pflegt er eine innigere Beziehung als es in sonstigen Produktionen des Werkes der Fall ist, gerät mir ihr auch mal in körperlichen Kontakt und auch Küsse werden ausgetauscht. Gleichzeitig ist er aber auch Venus sehr zugetan und macht aus seinem Lied an den Abendstern ein an sie gerichtetes Liebesbekenntnis. Da sie ja der Abendstern ist, ist diese Idee von Frau Höckmayr nur zu berechtigt. Es ist schon ein tolles Versteckspiel, dass Wolfram mit der manchmal auch in Form von Filmprojektionen vorgeführten und beim Sängerkrieg auf Galerien sitzenden Wartburggesellschaft da treibt. Im dritten Aufzug warten alle Sänger im Kollektiv auf die Rückkehr Tannhäusers. Fast wahnsinnig anmutend rennt die verzweifelte Elisabeth in ihrem Kreis umher und bricht schließlich zusammen. Auf dem Boden liegend bricht sie in hysterisches Lachen aus. Später lauschen alle gemeinsam auch der Romerzählung Tannhäusers, der inzwischen ein gehöriges Maß an Selbsthass entwickelt hat. Der Ekel vor der in einem ewigen Kreislauf von Sünde und Vergebung gefangenen Welt lässt ihn zu guter Letzt zugrunde gehen.
GMD Fabrice Bollon hatte das bestens disponierte Philharmonische Orchester Freiburg gut im Griff und ließ es bereits in dem Bacchanal in tristanhaft berauschenden und gewaltigen eruptiven Klangwogen glänzen. Sein Dirigat war ausdrucksstark und energiegeladen und trotz einiger Stellen, die man sich vielleicht etwas leiser gewünscht hätte, auch recht differenziert.

Alejandro Lárraga Schleske (Wolfram), Chor
Bei den Sängern hatte an diesem Premierenabend leider der Krankheitsteufel zugeschlagen. Getroffen hatte es ausgerechnet den Vertreter der Titelrolle Christian Voigt, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hatte, trotz einer starken Erkältung zu singen. Diese machte ihm im Lauf des Abends aber immer mehr zu schaffen. Nach einem noch relativ gut durchgehaltenen ersten Aufzug wurde seine Tongebung im zweiten Akt insbesondere in der Höhe immer flacher und im dritten Aufzug, den er kaum noch durchhielt, kam es auch zu stimmlichen Einbrüchen. Im Vollbesitz seiner stimmlichen Kräfte müsste er ein guter Tannhäuser sein. Der OPERNFREUND wünscht gute Besserung. Eine Hoffnung für das hochdramatische Sopranfach stellt Anna Nechaeva dar, die sich mit fulminantem, insgesamt gut durchgebildetem Sopranmaterial und großer vokaler Intensität in die Partie der Elisabeth stürzte. Manchmal wollte sie stimmlich indes zu viel geben, woraus eine etwas flackernde Tongebung entstand. Ein derartiges Übermaß an Stimmkraft hat sie bei ihren tollen vokalen Qualitäten nicht nötig. Vorsicht kann man da nur sagen, das kann sich womöglich eines Tages rächen. Weniger wäre mehr gewesen! Als Venus war ihr die über einen sinnlichen, tiefgründigen und dabei bestens gestützten Mezzosopran verfügende Viktoria Mester eine treffliche Gegenspielerin. Weiterentwickelt hat sich Alejandro Lárraga Schleske, der einen schönen, lyrisch grundierten Wolfram sang und nur bei Pianissimi manchmal etwas vom Körper weg ging. Einen wunderbar sonoren, italienisch geschulten Bass brachte Jin Seok Lee für den Landgrafen Hermann mit. Und in dem den Walther von der Vogelweise mit strahlendem, hervorragend focussiertem Heldentenor singenden Roberto Gionfriddo wächst ein guter Tannhäuser nach. Nicht sein derzeit gewohntes Niveau erreichte der Biterolf von KS Neal Schwantes, dessen Tongebung etwas trocken wirkte. Vokal unauffällig blieben Shinsuke Nishioka (Heinrich der Schreiber) und Andrei Yvan (Reinmar von Zweter). Nachhaltig machte dagegen der junge David Rother auf sich aufmerksam. Noch nie hat man einen so guten, kraftvollen Knabensopran den jungen Hirten singen hören. Auf hohem Niveau entledigte sich der von Bernhard Moncado hervorragend einstudierte Chor und Extrachor seiner Aufgabe. Für die ebenfalls treffliche Vorbereitung des Kinder- und Jugendchors zeigte Thomas Schmieger verantwortlich. Tannhäusers stummes Alter Ego wurde von Eduard Martens verkörpert.
Fazit: Eine ungemein mitreißende, stringent umgesetzte und atmosphärisch dichte Produktion, die dem Theater Freiburg zu großen Ehren gereicht und deren Besuch sehr empfohlen wird.
Ludwig Steinbach, 23. 2. 2014 Die Bilder stammen von Maurice Korbel.
Anrührend
OSCAR UND DIE DAME IN ROSA
(Fabrice Bollon)
UA: 5. 1. 2014
Kindlich-poetische Lebensbejahung
Zu einem großen Erfolg für alle Beteiligten gestaltete sich die Uraufführung von Fabrice Bollons Familienoper „Oscar und die Dame in Rosa“. Damit hat der GMD des Freiburger Theaters seinem Stammhaus und dessen Publikum ein schönes Neujahrsgeschenk gemacht, das er auch selbst dirigierte.
Bollons erste Oper, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist, beruht auf der gleichnamigen Erzählung von Eric-Emmanuel Schmitt aus dessen „Zyklus des Unsichtbaren“. Daraus hat Clemens Bechtel, der auch für die gelungene Inszenierung verantwortlich zeigte, ein vielschichtiges Libretto verfasst, das trotz einer tragischen Grundsituation auch zahlreiche heitere Stellen aufweist. Nicht zuletzt dieser gelungene Spagat zwischen ernsten und lustigen Elementen macht den großen Reiz des Werkes aus, das bei dem neuen Opern anscheinend durchaus aufgeschlossenen Freiburger Publikum dann auch auf begeisterte Zustimmung stieß. Erzählt wird die Geschichte des sterbenskranken 10jährigen Oscar, der sich seines traurigen Loses wohl bewusst ist, aber wütend darüber wird, dass seine Eltern nicht mit ihm darüber sprechen wollen. Trost bringt ihm die liebenswürdige, taffe und recht skurrile Oma Rosa, eine ehemalige Catcherin und Meisterin im Schimpfen, deren oft recht gewöhnliche, ordinäre Ausdrucksweise viel zur heiteren Komponente des Stücks beiträgt. Sie verrät ihm ihr Geheimnis und rät ihm, jeden Tag als zehn Jahre seines Lebens anzusehen. Zudem solle er vertrauensvolle Briefe an Gott schreiben. Oscar geht auf ihren Vorschlag ein und durchlebt im Folgenden die verschiedensten Lebensabschnitte, seine erste Liebe zu Peggy Blue, Heirat, Midlifecrisis und Endstadium. Auf diese Weise durchlebt er 110 Jahre und gewinnt zunehmend an Erfahrung, die nur das Alter bringen kann. Am Ende steht die Erkenntnis, dass das Sterben ein ganz selbstverständlicher Teil des Lebens ist. Ruhig und mit sich und der Welt im Reinen geht Oscar nach einem erfüllten Leben in den Tod - nicht ohne sich zuvor mit seinen Eltern versöhnt zu haben.

Xavier Sabata (Oma Rosa), Sharon Carty (Oscar)
Ein tristes Werk? Nein, durchaus nicht. Trotz ihres traurigen Ausgangspunktes ist die Oper von Bollon äußerst lebensbejahend. In ihrem ausgedehnten Streifzug durch alle Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins erweist sich die Handlung als Parabel über den Sinn des Lebens, als flammendes Plädoyer für das Leben in allen seinen Ausprägungen. Hier geht es letzten Endes nicht darum, die Angst vor dem Sterben irgendwie zu besiegen, sondern um die Etablierung eines festen Standpunktes im Leben, wobei hilfsbereite Ratgeber wie Oma Rosa immer willkommen sind. Gleich Schmitts „Zyklus des Unsichtbaren“ legen auch Bollon und Bechtel großen Wert auf die christlichen und philosophischen Aspekte des Ganzen, wobei sie im Vergleich zur literarischen Vorlage manche Handlungsstränge reduzieren, andere aber ausdehnen. Ihr tiefschürfender Blick in das Seelenleben Oscars erfährt derart noch eine zusätzliche Intensivierung. Während er lernt, den Tod zu akzeptieren, sind seine Eltern dazu nicht in der Lage. Sie verzweifeln an der Situation, was wiederum Oscar wütend macht. Konfrontationen zwischen der kindlichen und der Erwachsenenwelt sind die Folge, die letztlich zu einem harmonischen Ausgleich gebracht werden. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Kombination von Oscars Reifungsprozess mit seiner kindlichen Perspektive, aus der heraus er die Geschehnisse um sich herum betrachtet.

Xavier Sabata (Oma Rosa), Sharon Carty (Oscar)
Dieser kindlich-imaginäre Blick auf eine Welt, in der ein ödes Krankenzimmer zu einem bunten, farbenreichen Abenteuerspielplatz wird, die Grenzen zwischen Realität und Traum mithin fließend sind, steht im Zentrum von Bechtels Inszenierung. Olga Motta hat ihm einen abstrakt anmutenden, in verschiedenen Coleurs erstrahlenden Einheitsraum auf die Bühne gestellt, dessen zunächst diffuse Ausleuchtung eine beklemmende Wirkung entfaltet, aber zunehmend einen schillernd bunten Charakter entfaltet. Er ist mit vereinzelt dastehenden Türrahmen und einem überdimensionalen Bett ausgestattet, auf dem die kleinen Patienten ausgelassen herumtollen und sich vergnügen können. Letzteres stammt aus der Sphäre der Erwachsenen, deren Welt der Regisseur von derjenigen der jungen Generation deutlich abgegrenzt. Die Handlung wird, wie bereits erwähnt, aus der Perspektive Oscars erzählt, woraus sich erklärt, dass die Eltern und Ärzte in ihren langen Mänteln, unter denen sie anscheinend auf Stelzen gehen, geradezu riesig wirken, während die Darsteller der Kinder sowie Oma Rosa in ihrer normalen Größe auftreten. Ihre Einstellung zum Leben bestimmt die Handlung, nicht die der Eltern, die abgehoben und sogar ein wenig furchteinflößend dargestellt werden.

Xavier Sabata (Oma Rosa), Sharon Carty (Oscar), Wolfgang Newerla (Vater), Sigrun Schell (Mutter)
In diesem Ambiente setzt Bechtel die Grundpfeiler seines Librettos auf sehr assoziative Weise und mit großem Einfühlungsvermögen um, aber nicht ohne dem Ganzen ein ansprechendes innovatives Flair zu verleihen. Die religiösen, philosophischen und psychoanalytischen Aspekte des Stoffes werden von ihm trefflich herausgestellt, aber nie überbetont, und erschließen sich dem Verständnis leicht. Insbesondere die Aufzeigung des christlichen Wesensgehalts ist dem Regisseur vorzüglich gelungen. Die Briefe, die Oscar zunächst nur schreibt, um Oma Rosa einen Gefallen zu erweisen, und deren von ihm vorgelesener Text gesprochen aus der Lautsprecheranlage des Theaters ertönt, werden ihm im Lauf des Abends immer mehr zu einem Bedürfnis. Er lernt, dass Gott jemand ist, dem man sich voll und ganz anvertrauen kann und entwickelt aus dieser Erkenntnis heraus ein ganz persönliches Christentum, das indes auch etwas banaler Natur sein kann, wie die Szene mit den Schneeflocken zeigt. Die Briefe dienen ihm gleichzeitig als Hilfsmittel zur Selbstreflektion und -analyse. In seiner Auseinandersetzung mit seinen einzelnen Lebensabschnitten wird er selber zum Empfänger seiner Schreiben. Diese ermöglichen ihm einen differenzierten Blick auf seine Umwelt. Psychologischen Erkenntnissen trägt Bechtel dadurch Rechnung, dass er Oma Rosa weniger als reale Person, sondern vielmehr als Ausfluss der Phantasie Oscars begreift. Ihre Existenz ist untrennbar mit derjenigen des kranken Jungen verbunden. Sie entspricht ganz dessen Vorstellungen und ist als Manifestation eines in ihm allmählich aufkeimenden metaphysischen Denkens zu verstehen - ein überzeugender Ansatzpunkt, dessen Berechtigung sich aus der Geschichte von Schmitt ergibt, und zwar konkret aus Oscars letztem Brief an Gott. Oma Rosa ist sich dabei ihrer Funktion wohl bewusst. Dieses imaginäre Verständnis dieser Figur vorausgesetzt ist die Handlung als Kampf des Knaben gegen sich selbst zu begreifen, in der aber nicht der Tod, sondern das Leben sein Gegner ist. Nicht dessen Dauer ist entscheidend, sondern was man daraus macht. Das erkennt auch Oscar. Indem er zunehmend zu leben versteht, weiß er schließlich auch zu sterben. Als „Geschichte über das pralle Leben“, als „Liebeserklärung an das Leben“ wollen Bollon und Bechtel ihre Oper verstanden werden. Und diese Intention ist in jeder Beziehung voll aufgegangen. Die Inszenierung machte einen atmosphärisch dichten, anrührenden und positiven Eindruck.

Christoph Waltle (Popcorn), Kinderchor
Bollon hat eine abwechslungsreiche Musik geschrieben, die sich aus vielfältigen Elementen zusammensetzt. Er klebt nicht an einer bestimmten Form, sondern bezieht mehrere Stilrichtungen in seine Komposition mit ein. Der Anfang scheint den Hörer in eine Art kosmische Sphäre mit ätherischen Klängen zu versetzen. Im Folgenden erscheint die Tonsprache mal modern, mal klassisch. Sich reibende Cluster korrespondieren mit schönen tonalen Momenten und Liebes-Chromatik. Auch Tschaikowskys „Nussknacker“ und das Weihnachtslied „O du fröhliche“ werden mit einbezogen. Genauso bunt wie die Inszenierung ist auch der Klangteppich. Bollon versteht es gut, mit Hilfe vielfältiger orchestraler Farben ganz spezifische Wirkungen zu erzielen, die dem Geschehen auf der Bühne hervorragend entsprechen. Seine Musik lebt von Reflektionen, die die Tiefe des Stoffes noch verstärken und in ihrer Gesamtheit recht eindringlich wirken. All diese Vorzüge der Partitur haben Bollon und das prächtig und hochkonzentriert aufspielende Philharmonische Orchester Freiburg subtil und differenziert vor den Ohren des Auditoriums ausgebreitet.

Christoph Waltle (Popcorn), Carina Schmieger (Peggy Blue), Kinderchor
Von den Sängern/innen vermochte in erster Linie Sharon Carty zu begeistern, die nicht nur darstellerisch durch sehr gefühlvolles Spiel alle Facetten des Oscar zog, sondern diesem mit wunderbar vollem und rundem, bestens italienisch focussiertem und emotional eingefärbtem Mezzosopran auch gesanglich ein sehr berührendes Profil verlieh. Vom Schauspielerischen her war ihr Carina Schmieger als beherzt agierende, zierliche Peggy Blue durchaus ebenbürtig. Vokal blieben bei ihrem vor allem in der Höhe noch nicht völlig ausgereiften, flachen Sopran indes noch Wünsche offen. Hier wäre mehr stimmliche Anlehnung erforderlich gewesen. Das gilt in gleichem Maße für Christoph Waltles dünnstimmigen Popcorn. Da schnitt der Einstein von Kyoung-Eun Lee schon besser ab. Die Oma Rosa hat Bollon für Vertreter des von mir aufgrund seines unnatürlichen Fistelklangs nicht zusagenden Fachs des Countertenors geschrieben. Zumindest darstellerisch machte Xavier Sabata aus seiner Rolle ein wahres Kabinettstückchen. Sein fetziges, ausgelassenes Spiel und eine gute komödiantische Ader hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. Bei Oscars Eltern vermochte die gut gestützt und sehr profund singende Sigrun Schell (Mutter) besser zu gefallen als der etwas halsig klingende, typisch deutsche Bariton von Wolfgang Newerla (Vater). Ein markant und ausdrucksstark intonierender Dr. Düsseldorf war Ks Neal Schwantes. Solide gaben Qiu Ying Du Dr. Winterfeld und die Putzfrau und Lucia Schreiber die Sandrine. Als Kindersoli waren Anna Viola Schmieger und Coura-Lale Tall zu hören. Das zweite Elternpaar gaben Yulianna Vaydner und Stefan Fiehn. Als Klinikclown erschien Prince Fischer auf der Bühne. Oscars Briefstimme war Josias Grube. Nachhaltig empfahlen sch der von Bernhard Moncado und Thomas Schmieger trefflich einstudierte Chor und Kinderchor. Insbesondere letzterem sei an dieser Stelle ein großes Lob ausgesprochen.
Fazit: Wieder einmal ein neues Werk des Musiktheaters, dessen Besuch durchaus zu empfehlen ist und dem es zu wünschen wäre, wenn es den Weg auch in die Spielpläne anderer Opernhäuser finden würde.
Ludwig Steinbach, 8. 1. 2014 Die Bilder stammen von Maurice Korbel
I VESPRI SICILIANI
Premiere am 23.11.2013
Modernisiert, aber immer nahe am Libretto und: mit voller Kraft
Von nur wenig Opern lässt sich die Handlung historisch so genau verorten wie bei der Sizilianischen Vesper: Es handelt sich um den historisch verbürgten Aufstand der Sizilianer 1282 gegen die Herrschaft des Franzosen Karl I von Anjou, in dessen Folge die Insel von der französischen Fremdherrschaft befreit wurde und an das spanische Haus Aragón als Rechtsnachfolger der „Schwaben“ fiel. Nach seiner trilogia populare war Verdi ein berühmter Mann geworden und erhielt vom Théâtre Impérial den Auftrag, zur Weltausstellung 1855 eine Oper zu schreiben, die nach einem Libretto aus Eugène Scribes Schreibfabrik im Stile der grand opéra angelegt war. Obwohl die Uraufführung ein großer Erfolg wurde, war Verdi nicht recht zufrieden mit seinem Werk; es wurde zu einem der weniger gespielten Werke des maestro. Dem Historienschinken mit fünf Akten (Ballett, alle Handlungselemente linear auf der Bühne zeigend, großer szenischer Aufwand) wurde später genau das zum Verhängnis, weswegen ihm zunächst der Zeitgeschmack huldigte. In Italien konnte das Werk erst ab 1861, nachdem im Resorgimento die Bourbonen aus Süditalien vertrieben worden waren, in einer neuen Bearbeitung Fuß fassen. Heute wird die Oper als I vespri siciliani überwiegend in Italien gespielt. Im Trend der deutschen Opernhäuser, im Verdi-Jahr die weniger populären Werle wieder zu präsentieren, hatte die Oper Frankfurt das Werk in der letzten Spielzeit in der französischen Fassung vorgestellt. Nun kommt das Theater Freiburg mit der italienischen Version.

In der Barockoper hatte sich durchgesetzt, einen historischen Stoff mit echten historischen Figuren herzunehmen, ihn mit einer – im allgemeinen unhistorischen – Liebesgeschichte zu kreuzen und mit einem lieto fine, meist durch den
deus ex machina herbeigeführt, enden zu lassen. In vielen Verdi-Opern kommt zu diesem Grundprinzip das Familienprinzip hinzu – und besonders ausgeprägt in den Vespri, in denen der anfängliche Bösewicht Montfort seinen Sohn Arrigo wiederfindet und dadurch kein Bösewicht mehr ist: familiäre Bande. Die Liebesgeschichte zwischen dem Sohn Arrigo der Contessa Elena ist indes weniger ausgeprägt als die dramaturgische Konstellation des Arrigo, der sich zwischen dem wieder gefundenen Vater und den gegen diesen revoltierenden Freunden und seiner Geliebten befindet.
James Lee (Arrigo); Juan Orozco (Montfort)
Eine Erkennungsszene Sohn/Vater oder Tochter/Vater oder allgemein Kind/Eltern stellt häufig in der Dramaturgie von Stücken des 18. oder 19.Jhdts. die Wendung zum lieto fine her. Nicht hier, wo wegen Procidas Rachsucht lediglich zu einem retardierenden Moment auf dem Weg zur Katastrophe kommt. Sehr präsent ist auch das poltisch-historische Geschehen um den sizilianisch-italienischen Aufstand gegen die französischen Unterdrücker, was die Oper zu einer der politischsten in Verdis Schaffen macht. Warum gerade die Franzosen sich 1855 an diesem Stoff delektieren konnten, ist rätselhaft. Die Oper als Historienschinken stilgerecht im 13. Jhdt anzusiedeln, traut sich heute kaum mehr ein Regisseur zu. Also wird der Stoff, der durchaus viele zeitlose Aspekte enthält in Verdis Ära des resorgimento oder gleich ganz in die Gegenwart verlegt.

Anja Hildenbrand (Santa Rosalia); James Lee (Arrigo)
Der Regisseur geht mit einem doppelten Zeitbezug an die Geschichte heran: „Die Franzosen“, das sind Soldaten in modernen Uniformen, Képi oder Schiffchenmütze je nach Rang, alle mit trikolorer Schärpe. Ihr Chef Montfort indes in historisierender Uniform des 19. Jhdts aus der Zeit des Resorgimento – ebenso wie sein Gegenspieler Procida im Gehrock und mit an Verdi gemahnender Barttracht und Frisur. Die Sizilianerinnen in aktuellem Schwarz, zu Hochzeitsfeier und Vesper aber in wallenden weißen Kleidern. Stefan Rieckhoff hat die Kostüme entworfen und zeichnet auch für die Bühne verantwortlich. Da steht zunächst nur ein nacktes Halbrund mit einer Heiligenstatue (in der Hand Bibel und Totenkopf) in der Mitte, um welche die erste Szene spannungsgeladen inszeniert wird: die Rangelei zwischen den Franzosen und dem sizilianischen Volk. Szenisches wie musikalisches Bedrohungspotential wird aufgebaut – bis zum Auftreten Montforts, dessen Effektmöglichkeit leider von der Regie verschenkt wird und das ganz platt geriet. Im zweiten Akt liegt ein Ruderboot am Bühnenrand: Procida ist gelandet. Dieser ist vielleicht von der Regie am eindrücklichsten gezeichnet: agent provocateur, der die Franzosen animiert, sich auf die sizilianischen Frauen zu stürzen, damit der Aufruhr ihrer Männer beschleunigt werde. Diese Sizilianer haben nämlich, statt sich zu wehren, sich nur unter einer riesigen italienischen Flagge versteckt, während Procida, zunächst noch mit einer gewissen Sympathie auftretend, seine nostalgische Palermo-Arie singt. Dann kommt noch einmal Spannung auf, als die Franzosen die Sizilianerinnen wegschleppen und diese – ein starkes Bild - zurückkehren und mit den anderen zerzaust und geschändet zum Fest ziehen.

In der Folge wird das Geschehen auf der Bühne immer statischer und gerät streckenweise zum Steh- und Rampentheater. Richtige Aufmischer wollen nicht mehr gelingen oder sie bleiben erklärungsbedürftig wie das plötzliche Herauffahren der Santa Rosalia, nun plötzlich lebendig werdend, oder die Videosequenz, in welcher ein Gepard eine Gazelle zur Strecke bringt, die gleich zweimal gezeigt wird: Sollte das mit irgendeinem Jagdgeschehen auf der Bühne korrelieren? z.B. Sizilianerinnenhatz? Auch das stumme Herumgeistern des ermordeteten Federigo trägt nur wenig bei. Während bei den großen Chortableaus zu den Aktschlüssen die Chorbewegung zugunsten eines gewaltigeren Klangbilds durchaus zurücktreten kann, ist die schwache bewegungsmäßige und schauspielerische Regie der Solisten deren Charakterisierung abträglich. Der "Befreier": Jin Seok Lee (Procida)
Nur Procida wirkt in seiner Entschlossenheit und Unbeugsamkeit glaubhaft, Montfort und Arrigo bleiben bei einfachster Standardgestik. Dabei wird auch eine zweite ansonsten sehr bühnenwirksame Stelle vergeben, in der sich Arrigo zwischen Vater und die dolchschwingende Geliebte stürzt. Was ein szenischer Höhepunkt sein soll, gerät zum müden Auftritt. Der Bühnenaufbau schreitet voran: Gemach des Montfort und Festsaal werden aufgebaut; ein Gefängnis als einfachste Käfigstruktur; und schließlich wieder zurück zur leeren Fläche mit Santa Rosalia, um welche herum nun das Gemetzel die Oper beendet: Procida scheint als einziger übrig geblieben zu sein und schwenkt die italienische Trikolore: historisch heißt das nichts anderes als die Annexion Siziliens durch Piemont-Sardinien 1860 (Zug der Tausend). Die Lega Nord bedauert das noch heute... Gemischte Gefühle hinterlässt letztlich diese Regiearbeit.
Die Musik, die Verdi für diese französische Oper eingefallen ist, gehört nicht zum Filigransten, was der maestro geschrieben hat, sondern ist sehr auf Effekt und Überwältigung aus: Nachwehen des Geschmacks der grand opéra eben. Soweit die Partitur über Feinheiten verfügt, so hat sie Fabrice Bollon am Pult des Philharmonischen Orchesters Freiburg nicht heben wollen. Die für Verdi lange, für die Grand Opéra aber typische Potpourri-Ouvertüre gelang recht differenziert und spannungsreich süffig-schmissigem Verdi bis zu akzentuierten dramatischen Schärfungen und dräuenden Streicher-Crescendi. Dabei ist das gar nicht so einfach zu musizieren. Die charakteristische Unruhe verkündende Leitformel de Musik, das kurze rhythmische vorschlagähnliche Motiv mit mit zwei 32steln liegt an der Grenze des distinkt Spielbaren, vor allem wenn es in die tieferen Instrumente übernommen wird; und das muss sogar der große Chor bewältigen. In der letzten Schärfe gelang das nicht. Insgesamt war Bollon stark auf Effekt aus und ließ es zeitweise mit holzschnittartiger Grobheit aus dem Graben krachen. Die von Bernhard Moncado prägnant einstudierten Chor und Extrachor über überzeugten mit ihrer Klanggewalt und runden Geschlossenheit, aber ihre schiere Masse schaffte sich hier und da rhythmische Freiräume, die Bollon mit prägnanten Schlägen wieder schließen musste.
Die Oper hat die typische personelle Dreierkonstellation der italienischen Oper und dazu noch eine weitere tiefe Männerstimme. Die vier Hauptrollen gestalten fast den ganzen Abend. Bezüglich der Solisten stand die Neuproduktion des Freiburger Theaters nicht unter einem günstigen Stern. Wegen Erkrankungen musste die Premiere verschoben werden; Ersatz kann man bei dieser eher weniger gespielten Oper nicht so leicht einsammeln. Für die neuangesetzte Premiere meldete sich nun auch die Zweitbesetzung der Elena, Liene Kinča, als leicht indisponiert. Aber die Litauerin bewältigte die schwierige Partie abgesehen von minimalen Eintrübungen im mezza voce bravourös. Hervorstechend ihre kräftige dunkle und samtige tiefe Lage, ihr reifes und leicht eingedunkeltes espressivo und die glühenden dramatischen Passagen von großer Durchschlagskraft und Klarheit. Dazu überzeugte sie mit ihrer Bühnenpräsenz. Die zweite Top-Besetzung war Jin Seok Lee als Procida. Er stieg kraftvoll bis in die Tiefen ab und kombinierte Stimmkultur mit der donnernden Durchschlagskraft und Schwärze, die es für diese unversöhnlich antreibende Gestalt bedarf. Auch der Montfort von Juan Orozca konnte sich hören lassen. In der Höhe zunächst etwas schwankend intonierend festigte sich sein kraftvoll strömender Bariton schnell. Aber selbst in den Passagen, wo es ihm das Orchester erlaubt hätte, vor allem in seiner großen Arie zu Beginn des dritten Akts, war das dauernde Forcieren weder angebracht noch notwendig.
Beim dauernden Forcieren saß der junge Tenor James Lee als Arrigo am kürzesten Hebel. Zwar verfügt er über schönes, klares und helles Tenormaterial, musste sich aber im spinto sehr bemühen und wirkte doch teilweise noch eng. Gestik und Mimik sind bei ihm noch ausbaufähig. Er hat eine Stimme mit viel Potential, aber auch er powerte letztlich zu viel. Die musikalische Leitung hätte bei den Stimmen etwas mehr ausbalancieren können. – Alle Nebenrollen waren adäquat besetzt

Jin Seok Lee (Procida); Liebe Kinča (Elena); James Lee (Arrigo); Juan Orozko (Monfort) Foto: K. Sannemann
Dem Publikum gefiel’s. Langanhaltender begeisterter Beifall aus dem ausverkauften Haus beendete die Premiere nach gut drei Stunden. Die sizilianische Vesper wird in dieser Spielzeit noch dreizehn Mal gegeben: am 5., 7., 13., 20., 25.12.; 10., 12., 17., 19., 24.1; 12., 14. und 16.2.
Manfred Langer, 25.11.13 Bilder: Maurice Korbel
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich ohne Bilder unten auf der Seite Freiburg des Archivs.