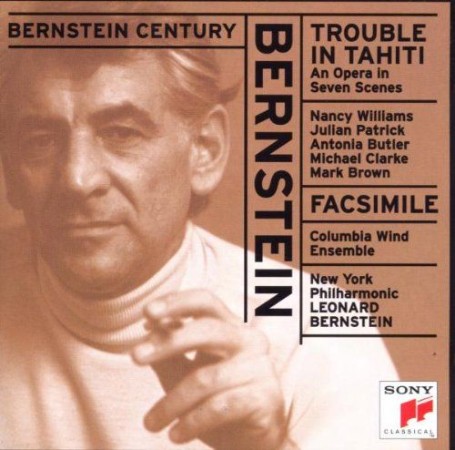Kleines Opernhaus - ganz großes Programmangebot


www.staatstheater.de
GÖTTERDÄMMERUNG
21.Juli 22
Im Finale der Ring-Saga spitzen sich die Ereignisse zu, die Handlungsfäden der vorherigen Aufführungen laufen zusammen und die Ankunft neuer Charaktere lässt das Geschehen unaufhaltsam auf das Ende zulaufen.
Die Gibichungen schmieden nämlich Hochzeitspläne. Die Geschwister Gunther und Gutrune erfahren von ihrem Halbbruder Hagen, dass Siegfried und Brünnhilde für sie als Heiratskandidaten in Frage kämen. Hagen interessiert sich für den Ring des Nibelungen und seine Macht. Um dies zu erreichen schmiedet er einen Plan: Siegfried soll beim Besuch der Gibichungenhalle mit einem Trank begrüßt werden. Dieser Trank lässt ihn vergessen, dass er Brünnhilde zur Frau hat. Der Plan geht auf. Siegfried verliebt sich in Gutrune und lässt sich von Hagen in weitere Pläne einspannen. Brünnhilde indes wird von ihrer Schwester Waltraute vor dem Fluch des Rings gewarnt und erfährt, dass Wotan die Weltesche zerstört hat. Sie möchte den Ring nicht abgeben, wird aber von Siegfried in Gestalt von Gunther überrumpelt. Das ehemalige Liebespaar trifft sich schließlich wieder. Siegfried ist nun Träger des Rings und wird von der verletzten Brünnhilde des Meineids angeklagt. In ihrem Zorn verrät sie den Gibichungen, dass Siegfried am Rücken verwundbar ist. Hagen erschlägt den Helden daraufhin. Er beruft sich seinerseits auf Meineid, wurde jedoch zuvor nochmals von seinem Vater Alberich auf den Ring angesetzt. Im anschließenden Handgemenge erschlägt Hagen auch Gunther. Brünnhilde hat das ganze Spiel mittlerweile durchschaut. Sie bittet die Rheintöchter, einen Scheiterhaufen zu errichten. So verbrennen sie, ihr geliebter Siegfried und der auf dem Ring lastende Fluch. Gereinigt kehr er zu den Rheintöchtern zurück.

Verfall und Verderben bestimmen also die Handlung in der „Götterdämmerung.“ Nichts ist mehr übrig geblieben von der einstigen Pracht des Göttergeschlechts. Dies wird auch durch das Bühnenbild deutlich gemacht. Die Weltesche wurde offensichtlich brutal in Stücke gehauen, auch das Bauernhaus ist teilweise stark beschädigt. Winterliche Kälte bestimmt das Geschehen. Schnee fällt in den meisten Szenen herab. Das Licht flackert, es ist die meiste Zeit dunkel. In dieser Endzeitstimmung weben die Nornen im ersten Akt ihren Schicksalsfaden und ahnen das Ende voraus. Wabernder Nebel verhüllt auch dem Zuschauer an einigen Stellen einen genauen Blick auf die Geschehnisse.
Die Geschwister Gunther und Gutrune sind im Gegensatz dazu als fast schon grotesk anmutende Witzfiguren inszeniert. Für heitere Momente sorgt zum Beispiel Gutrunes extreme Kurzsichtigkeit, die häufiger zu Verwirrungen führt. Sie wirkt zudem wie ein Mauerblümchen und ist damit das exakte Gegenteil von Siegfried. Es geht dekadent zu bei den Gibichungen, Champagner wird in rauen Mengen verzehrt und Gunther muss häufig lautstark aufstoßen. Siegfried dirigiert die Rheintöchter mit dem sich immer noch an Alberichs abgeschlagenem Arm regelrecht, was ebenfalls für einige Lacher sorgt.
Insgesamt ist die Aufführung statischer als die vorherigen, als wäre sie ebenfalls in der Kälte eingefroren. Zwei große Wandelemente dienen als Vorhang, welcher die große Bühne hinter sich verbirgt und somit viele persönliche Momente schafft. Dadurch wird das Schicksal der Charaktere persönlicher, greifbarer. So zum Beispiel als der leicht anämisch wirkende Hagen am Anfang des zweiten Akts Zwiesprache mit Alberich hält. Offensichtlich quält ihn der Auftrag des Vaters sehr, denn er versucht sich unter anderem durch Erhängen das Leben zu nehmen.

Siegfrieds kindlicher Übermut wird ihm schließlich zum Verhängnis. Unter den Überresten der Weltesche beschließen Gunther, Hagen und Brünnhilde seinen Tod. Dieser zeigt hier, dass der Held nicht jedermanns Liebling ist, sondern ein Mittel zum Zweck. Denn anders als im Libretto muss Siegfried (Zoltán Nyári, mit kräftiger, angenehmer Stimme, aber leider mit einigen Textunsicherheiten) hier allein sterben. Anschließend wird er wie ein totes Tier auf dem Boden liegend an einem Seil über den Boden geschleift und findet seine letzte Ruhestätte schließlich in einem Bett, nicht in einem Heldengrab.
Dort verbrennt er zusammen mit Brünnhilde. Durch die düstere Szenen zeigende Drehbühne und verkohlte Puppen entsteht ein beklemmender Effekt. Hagen indes wird von den Rheintöchtern in einem Waschzuber ertränkt. Der Ring-Zyklus endet daraufhin wie er begonnen hat. Mit Alberich auf der Toilette. Diesmal allerdings erhängt er sich dort mit dem Seil, welches sein Sohn Hagen zuvor geknüpft hatte.
Als die letzten Takte verklingen, setzt tosender Applaus ein. Applaus für diese großartige, packende Inszenierung und die Leistung aller daran Beteiligten!
Gleich mehrere Sänger waren in einer Doppelrolle zu erleben. So Maiju Vaatoluoto als erste Norn und Rheintochter Floßhilde sowie Ann-Beth Solvang als Zweite Norn und Gutrune.
Großartig gelingt Ann-Beth Solvang mit ihrer angenehmen Stimme die Interpretation der schüchternen Gutrune, sie kann sie jedoch auch dank ihrer großen Wandlungsfähigkeit in der Traumszene nach Siegfrieds Tod verzweifelt klingen lassen.
Ergänzt werden die beiden von Susanne Serfling (Dritte Norn), Martha Eason (Woglinde) und Erica Back (Wellgunde).

Eine beachtliche Anzahl an Rollen sang auch Kihun Yoon. Zuerst als Alberich in Rheingold, dann als Wotan in Walküre, als Wanderer in Siegfried und nun als Gunther in der Götterdämmerung. Trotz der vielen Rollen hat seine Stimme nichts an Kraft eingebüßt, im Gegenteil. Kihun Yoon bezaubert durch seinen kraftvollen, auch bei den eher leisen Stellen wundervoll klaren Gesang. Stets textsicher präsentierte sich der südkoreanische Sänger stärker denn je, auch in der darstellerischen Leistung. Tiefsten Respekt vor dieser Leistung, das Publikum dankt es ihm mit großem Applaus und vielen Bravorufen.
Ein großes Lob gilt auch Nancy Weißbach als Brünnhilde. Fast unglaublich scheint es, dass sie nach drei Aufführungen die Kraft hat sich selber sogar noch einmal zu übertreffen. Perfekt in jeder Hinsicht gelingen ihr die anspruchsvollen Gesangpartien. Ihre strahlenden, kräftigen Höhen machen das Zuhören zu einer wahren Freude.
Sami Luttinen singt im Oldenburger Ring den Hagen. Das dunkle Timbre in seiner Stimme weiß sich an den richtigen Stellen zurückzunehmen, um dann umso kraftvoller an den richtigen Stellen hervorzubrechen. Im Zusammenspiel mit dem Orchester entsteht das Bild von einem gequälten, unter der Last seines Schicksals leidenden Mann.
Das Oldenburgische Staatsorchester macht unter der Leitung von Hendrik Vestmann das Finale rund. Gewaltige Klangwelten entschweben dem Orchestergraben, der Boden erzittert unter den hinreißend gespielten Passagen während des Finales. Auch die feinen, leisen Töne der Harfen kommen dank des harmonischem Zusammenspiels zur Geltung.
Der „Ring“ in Oldenburg – ein unvergessliches Erlebnis! Selten wurde „Der Ring des Nibelungen“ so kurzweilig und zugleich detailverliebt inszeniert. (Regie: Paul Esterhazy/Bühne und Kostüme: Mathis Neidhardt) Alles baut aufeinander auf, jede Handlung und jedes Detail ist durchdacht und wirkt dabei doch nicht überladen. Dadurch ist ein Mitfühlen mit den Charakteren uneingeschränkt möglich. Das Ganze wird meisterhaft begleitet vom Sängerensemble und dem Oldenburgischen Staatsorchester. So haben sowohl Kenner und Liebhaber der Werke Richard Wagners als auch Neulinge die Chance, auch außerhalb Bayreuths eine großartige Aufführung des „Rings“ zu erleben!
Katrin Düsterhus, 24.7.22
Besonderer Dank an unsere Freunde vom OPERNMAGAZIN
Foto @ Stephan Walzl
Adriana Lecouvreur
konzertant
Premiere: 06.06.2021
besuchte Vorstellung: 10.06.2021
Stimmcontest mit vielen Siegern
Lieber Opernfreund-Freund,
nach mehr als sieben Monaten darf ich Ihnen wieder schreiben und es freut mich besonders, dass ich das von der konzertanten Aufführung eines meiner Lieblingswerke tun kann: Cileas Adriana Lecouvreur wird derzeit konzertant am Staatstheater Oldenburg unter Coronabedingungen gegeben und der Abend gerät zum regelrechten Sängerfest.

Die Sitzplätze sind dezimiert – nicht nur weil zwischen den Platzpärchen jeweils unbesetzte Sitze frei bleiben, sondern weil im Parkett jede zweite Stuhlreihe komplett fehlt; die zehn Sänger sind durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt, beim Auf- und Abtreten maskengeschützt; die Musiker sind ungewohnt weit voneinander entfernt auf der Bühne dahinter platziert – und doch wirkt nichts gekünstelt an diesem Abend. Das Ensemble hat sichtlich Freude daran, wieder auftreten zu dürfen und auch das Publikum hält sich akribisch an die Vorgaben. „Hauptsache wieder Live-Theater“ möchte man denken oder „Sie haben Ihr Ziel erreicht“, wie eine der entsprechend markierten Sitzplätze verkündet. Mit kleinen Requisiten, wie beispielsweise dem Veilchenstrauß, an dem die Titelheldin am Ende stirbt, oder dem Armband, das die Fürstin bei ihrer Flucht verliert, belebt das Ensemble die Konzertversion der Oper, die nördlich der Alpen noch immer eher als Rarität gilt. Dass mir dabei ausgerechnet eine konzertante Aufführung im Vorspiel zum Finalakt erstmals visualisiert, wie die Fürstin das Bouquet vergiftet, um ihre Rivalin um die Ecke zu bringen, ist dabei ein besonderes Schmankerl.

An akustischen Schmankerln reich ist auch die Darbietung: Lada Kyssy zieht in der Titelrolle sämtliche Register, betört mit bezauberndem messa di voce ihres dunkel gefärbten Soprans, glänzt in den Höhen und brilliert in den affektierten Ausbrüchen der Diva, die sie darstellt. Ihre Gegenspielerin beim Kampf um die Gunst von Maurizio, die mächtige Fürstin von Bouillon, findet in Ann-Beth Solvang eine ideale Gestalterin. Die Norwegerin punktet mit kehliger Tiefe, immensem Ausdruck und stimmlicher Power, so dass man fast bedauert, dass sie ihre Figur nicht auch im Spiel darstellen darf. Das Finale des zweiten Aktes gerät zur regelrechten Stimmschlacht der beiden Damen, aus der beide als Siegerinnen hervorgehen. Jason Kim hält als Maurizio mit geschmeidig weichem Tenor dagegen, beeindruckt mit unglaublichem Atem und immensem Gefühl. Kiyun Yoon zeigt als Theaterchef Michonnet direkt in den ersten Phrasen, wo der stimmliche Hammer hängt, kontrolliert seinen imposanten Bariton aber in den leiseren Passagen zu einfühlsamem Piano und zeigt so die enorme Bandbreite seiner vokalen Fähigkeiten.

Auch die kleineren Rollen sind toll besetzt: Martyna Cymerman, Erica Back, Henry Kiichli und Ihor Salo übernehmen nicht nur das kokette Quartett aus der Comédie-Française, sondern auch den Chorpart im dritten Akt und Ill-Hoon Choung schlägt sich tapfer als Fürst. Herausragend sind die Qualitäten des Opernstudiomitglieds Johannes Leander Maas, der mit seiner Interpretation des Abbé von Chazeuil Lust darauf macht, mehr von dem jungen Tübinger zu hören. Am Pult führt Vito Cristofaro, seines Zeichens 1. Kapellmeister und Stellvertreter des GMD, durch den Abend. Der Italiener lässt beschwingt aufspielen, scheint sich aber vor allem in den emotionsgeladenen Passagen wohl zu fühlen und kostet diese regelrecht aus, würzt dabei beinahe mit zu viel Pathos, präsentiert aber dennoch ein differenziertes Dirigat von Cileas farbenreicher Partitur. Ein voller Erfolg also für alle Beteiligten!
Ihr
Jochen Rüth
13.6.2021
Die Fotos stammen von Stephan Walzl.
PRESSEKONFERENZ ZUR SPIELZEIT 2020/21
am 10.07.2020
Ein Spielplan der besonderen Art
Die überbordende Fröhlichkeit, die das Photo vermittelt, kann natürlich trügerisch sein. Denn alle Planungen können durch neue Corona-Ereignisse von jetzt auf gleich wieder hinfällig werden. Der Oldenburger Intendant Christian Firmbach gab denn bei der Pressekonferenz auch nur die Planungen bis Dezember bekannt, so wie es das Bremer Theater ebenso getan hat. Aber die Freude, dass es nun wieder losgehen soll, war schon deutlich spürbar.
 „Es ist ein Spielplan, den wir sonst nie so geplant hätten. Diesen Umplanungsprozess begannen wir schweren Herzens, schätzten ihn aber schon bald als beflügelnde Herausforderung, nachdem wir erkannt hatten, dass ein solches Umdenken auch die große Chance birgt, Formate und Ideen umzusetzen, für die sonst nur selten Raum ist“, sagt Christian Firmbach. Ein Aspekt war, dass jeder Sänger und jeder Schauspieler wenigstens in einer Produktion mit einer großen Partie oder einer großen Rolle zum Zuge kommt. Firmbach sieht das auch als Teil seiner Fürsorgepflicht für das Ensemble. So kommt man, alle Sparten zusammengerechnet, immerhin bis Dezember auf die stattliche Anzahl von vierundzwanzig Premieren.
„Es ist ein Spielplan, den wir sonst nie so geplant hätten. Diesen Umplanungsprozess begannen wir schweren Herzens, schätzten ihn aber schon bald als beflügelnde Herausforderung, nachdem wir erkannt hatten, dass ein solches Umdenken auch die große Chance birgt, Formate und Ideen umzusetzen, für die sonst nur selten Raum ist“, sagt Christian Firmbach. Ein Aspekt war, dass jeder Sänger und jeder Schauspieler wenigstens in einer Produktion mit einer großen Partie oder einer großen Rolle zum Zuge kommt. Firmbach sieht das auch als Teil seiner Fürsorgepflicht für das Ensemble. So kommt man, alle Sparten zusammengerechnet, immerhin bis Dezember auf die stattliche Anzahl von vierundzwanzig Premieren.
Im Musiktheater geht es mit Zaide (05.09.) von Wolfgang Amadeus Mozart los. Die Sänger kommen teilweise aus dem Opernstudio und werden am Klavier begleitet. Nils Braun inszeniert. Es folgt Don Pasquale (12.09.) von Gaetano Donizetti in der Inszenierung von Christoph von Bernuth. Die Chorszenen werden gestrichen, das Orchester spielt in schlanker Besetzung. Hier präsentiert sich auch das neue *-Ensemblemitglied Donato Di Stefano in der Titelpartie. Der Bassist Di Stefano ist schon u. a. an der Scala, der Met, in Paris und bei den Salzburger Festspielen aufgetreten. Zudem wird er in Oldenburg auch als Gesangslehrer wirken.
Die letzten fünf Jahre (03.10.) von Jason Robert Brown ist ein Musical mit nur zwei von Martyna Cymerman und Paul Brady verkörperten Personen. Regie führt Mathilda Kochan im Kleinen Haus. Zarah 47 (17.0.) ist eine Hommage an Zarah Leander, deren Lieder von Melanie Lang interpretiert werden. L’heure espagnola (Die spanische Stunde) ist eine Kurzoper von Maurice Ravel, die in der Regie von Tobias Ribitzki und unter der musikalischen Leitung von Hendrik Vestmann am 03.10. Premiere hat. Es folgt Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg. Hier hat der Chorleiter und Dirigent Thomas Bönisch die musikalische Leitung, bevor es mit Adriana Lecouvreur (28.11.) von Francesco Cilea unter der Leitung von Vito Cristofaro auch große Oper gibt, allerdings nur als konzertante Aufführung.
Wegen der begrenzten Zuschauerzahlen (140 im Großen Haus, 55 im Kleinen Haus) werden alle Stücke häufiger als sonst üblich gespielt. Im Großen Haus werden neben den Sitzplätzen kleine Tische aufgestellt, an denen man Getränke konsumieren kann. Eine Maskenpflicht besteht während der Aufführungen nicht.
Wolfgang Denker, 11.07.2020
Foto von Stephan Walzl
RUSALKA
Premiere am 15.02.2020
Kein Wasser weit und breit
Dvořáks Oper handelt von der Nixe Rusalka, die unbedingt ein Mensch werden will, weil sie sich in einen Prinzen verliebt hat. Die Hexe Ježibaba erfüllt ihr den Wunsch, allerdings um den Preis, dass sie stumm bleiben muss. Der Prinz wendet sich von ihr ab und der Fremden Fürstin zu. Rusalka kehrt als Irrlicht in das Reich des Wassermanns (ihres Vaters) zurück. Von ihrem Fluch kann sie nur durch den Tod des Prinzen befreit werden.

Ist Rusalka die Geschichte von einer romantischen, aber unerfüllbaren Liebessehnsucht oder geht es eher um Loslösung und Befreiung? Bei der Rusalka in Bremen vor gut zwei Jahren ging es um einen Konflikt zwischen Vater und Tochter. Bei der Oldenburger Inszenierung von Hinrich Horstkotte will Rusalka sich vor allem aus ihrem Milieu befreien. Und das ist keine märchenhafte Wasserwelt, sondern im 1. Akt ein schäbiger Hinterhof in Prag um 1900. Der Wassermann ist ein alkoholabhängiger Penner, die Elfen sind Bordsteinschwalben. In der Hexe Ježibaba sieht Horstkotte eine Art Puffmutter. Ein angetrunkener Herr aus „besseren“ Kreisen erscheint in Frack und Zylinder. Es ist der Prinz auf der Suche nach einem flüchtigen Abenteuer. Horstkotte erläutert im Programmheft seine Assoziationen zu Rusalka, die von Jack the Ripper über „My Fair Lady“ bis zu Abnormitätenshows reichen, aber nicht alle Eingang in die Inszenierung finden. Seine Umdeutung und seine scheinbare Abwendung vom Märchenhaften sind dabei etwas unentschlossen.

Denn letztendlich erzählt er doch eine romantische Liebesgeschichte, die allein schon wegen seiner opulenten Bühnenbilder (auch von Horstkotte unter Assistenz von Larissa Moreno) mit Schneefall und gelungenen Lichtstimmungen wunderschön anzuschauen ist. Im 1. Akt werden die Häuserfronten heruntergefahren und geben den Blick auf eine zauberhafte Szene über den Dächern von Prag frei. Dort spielt auch der Schluss, bei dem sich Rusalka in die Tiefe stürzt. Prunkvoll ist der Festsaal im Schloss des Prinzen mit dem ironischen Einmarsch der Hochzeitsgäste, düster dessen Außenansicht. Hier wird sehr deutlich, dass Rusalka hilflos zwischen den Welten steht. Auch wenn ihr im Kabinett der Hexe brutal die Schwimmhäute aus den Fingern geschnitten wurden, bleibt sie doch ein Zwitterwesen mit krankhafter Blässe - nicht Fisch und nicht Fleisch.

Die dramatischen Aufschwünge in der Partie der Rusalka - und davon gibt es viele - bewältigt Lada Kyssy mit kraft- und glanzvoller Entfaltung ihres üppigen Soprans. Nur dem „Lied an den Mond“ bleibt sie einiges an zarter Entrücktheit schuldig. Begeistern kann auch Jason Kim als Prinz, der seinen prächtigen Tenor mit glutvoller Leidenschaft führt. Sein heldischer, aber dennoch dem Belcanto verpflichteter Gesang ist einfach mitreißend. Ill-Hoon Choung sichert dem Wassermann mit schlankem Bass trotz seines Penner-Kostüms und dem ständigen Griff zur Flasche durchaus Autorität. Trefflich porträtiert Melanie Lang mit dunklem Mezzo die abgetakelte Hexe. Äußerst attraktiv gibt Ann-Beth Solvang die Fremde Fürstin - verführerisch, aber eiskalt und berechnend.

Paul Brady und Nian Wang sorgen als Heger und Küchenjunge für heiterte Akzente. Die Elfen werden von Martha Eason, Martyna Cymerman und Erica Back lebenslustig verkörpert.
Das Oldenburgische Staatsorchester vollbringt unter Vito Cristofaro ein kleines Wunder. So farbenreich, so ausdrucksvoll und so klangschön wie hier musiziert wird, erlebt man es nicht alle Tage. Der von Thomas Bönisch und Piotr Fidelus einstudierte Chor rundet den guten Eindruck von der musikalischen Präsentation eindrucksvoll ab.
Wolfgang Denker, 16.02.2020
Fotos von Stephan Walzl
Un Ballo in Maschera
besuchte Vorstellung: 05.01.2020
Premiere: 07.12.2019
Mafia an der Hunte
Lieber Opernfreund-Freund,
fast ganz aus dem eigenen Ensemble besetzt derzeit das Staatstheater Oldenburg seinen Maskenball – und stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, über welch hochkarätige Sängerriege man am Haus verfügt. Die kurzweilige Inszenierung von Rodula Gaitanou und das charaktervolle Dirigat von GMD Hendrik Vestmann machen den gestrigen Nachmittag gänzlich zu einem musikalischen Ereignis vor voll besetztem Haus.

Verdis Un Ballo in Maschera im Mafia-Milieu zu inszenieren, ist sicher keine ganz neue Idee. Und doch schafft die aus Athen stammende Regisseurin Rodula Gaitanou mit ihrer Lesart weit mehr als einen Abklatsch bereits gesehenen, setzt mit originellen Ideen Akzente und so gelingt der jungen Griechin ein überzeugendes Deutschlanddebüt: irgendwo im Amerika der 1970er Jahre siedelt sie die Handlung an. Renato ist ein Bandenboss, doch seine Organisation ist von FBI-Spitzeln unterwandert. Trotz seines brutalen Geschäftes zeichnet Gaitanou ihn schöngeistig und seinen Bonsai pflegend, während neben ihm seine Handlanger Informationen aus Männern herausprügeln; so bleibt nachvollziehbar, dass die wunderschöne Gattin seiner rechten Hand Renato, Amelia, sich in ihn in verliebt. Ulrica erscheint als eine sich als Putzfrau in einem seiner Unterhaltungsetablissements verdingende Pennerin, die einen Leguan als Haustier hält und deren Wahn und Skurrilität von der Finnin Maiju Vaahtoluoto, einziger Gast am gestrigen Nachmittag, dermaßen glaubhaft dargestellt werden, dass es einen förmlich graust. Ihren kehligen, dämonisch klingenden Altgesang durchmischt sie immer wieder mit hysterischen Lachern, paranoiden Zuckungen und zwanghaftem Gekratze – Wahnsinn, im wahrsten und positivsten Sinne dieses Wortes!

Das genial wandlungsfähige Skelett des Bühnenbildes bilden ein paar verklinkerte Bögen, die im ersten Bild als Separees in den Bars, im zweiten Akt als ruinenhafte Katakomben, in denen Obdachlose nächtigen, dienen und in denen die unglücklich verliebte Amelia auf einen Dealer trifft, um ihren Liebeskummer mit Drogen zu betäuben. Als Renatos Arbeitszimmer bestückt Simon Corder die Bögen mit Buchregalen, ehe sie im Schlussbild wieder zur dezenten Kulisse werden. Und auch die Kostümabteilung darf sich austoben: Gøje Rostrup ersinnt nicht nur wunderbar detailverliebte, an venezianischen Karneval und den mexikanischen Día de Muertos gleichermaßen erinnernde Kostüme für den namengebenden Maskenball, sondern auch originelle Garderobe und Requisiten der späten 70er in den übrigen Szenen. Die ausgezeichnete Personenregie von Rodula Gaitanou tut ein Übriges, diesen Maskenball nicht nur hörens- sondern auch unbedingt sehenswert zu machen.

Im Graben entfacht Generalmusikdirektor Hendrik Vestmann zusammen mit dem Oldenburgischen Staatsorchester ein Verdi-Feuerwerk, präsentiert durchaus ein kantiges Dirigat, fühlt sich aber in den wogenden, sentimentalen Passagen der Partitur hörbar ebenso wohl, wie in den klanglich wuchtigen. Die Damen und Herren des Opernchors laufen unter der Leitung von Thomas Bönisch zu Höchstform auf, singen und spielen exzellent und fein aufeinander abgestimmt.

Ach ja, Solisten gab es auch: Neu im Oldenburger Ensemble ist die aus Kasachstan stammende Lada Kyssy, die der Amelia mit zahlreichen Farben und intensiver Darstellung Seele einhaucht. Dass ihr kraftvoller, dunkel timbrierter Sopran in der Höhe mitunter zu einer gewissen Härte neigt, ist geschenkt, so intensiv und emotionsgeladen ist ihr Gesang. Ebenfalls dunkel klingt der Riccardo von Jason Kim, fast wie ein Bariton mit ordentlich tenoraler Höher – als ob Placido Domingo zurück ins Tenorfach gewechselt wäre. Und auch in Farbe und noblem Ausdruck erinnert der höhensichere Südkoreaner an die jüngeren Jahre des spanischen Startenors. Leonardo Lee trumpft als Renato mit nicht nachlassender Kraft auf und rührt doch in seiner großen Arie Eri tu zu Tränen. Martyna Cymerman glänzt als herrlich überdrehter Oskar mit perlenden Koloraturen und kristallklaren Spitzentönen, Kammersänger Paul Brady macht in seinem kurzen Auftritt als Silvano Eindruck, während Ill-Hoon Choung und ein glänzend aufgelegter Stephen K. Foster als Verschwörerduo Tom und Samuel das exquisite Ensemble komplettieren.
Das Publikum ist zu Recht aus dem Häuschen am Ende der Vorstellung, ruft die Protagonisten wieder und wieder zum Applaus. Und auch ich finde diesen Maskenball durch die Bank gelungen. Er ist sicher kein Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte dieses Werkes, aber weit mehr als eine 08/15-Bebliderung – und zudem ein wahres Sängerfest.
Ihr Jochen Rüth 06.01.2020
Die Fotos stammen von Stephan Walzl
UN BALLO IN MASCHERA
Premiere am 07.12.2019
Mord im Mafia-Milieu
Wo spielt eigentlich Verdis Un ballo in maschera? In Bremerhaven war 2017 der Schauplatz ein geheimnisvolles Land der Phantasie, in Bremen war 2018 die Oper (wie im Original) in Schweden angesiedelt. Und in Oldenburg hat Regisseurin Rodula Gaitanou die Handlung in ein Mafia-Milieu verlegt. Riccardo ist kein Graf oder König, sondern einfach der Boss einer kriminellen Gang, die bereits vom FBI ins Visier genommen wird. Gaitanou zieht dabei eine Parallele zu dem kolumbianischen Drogenkönig Pablo Escobar, der sogar zeitweilig Abgeordneter im kolumbianischen Kongress war.

Das klingt alles schlimmer als es ist, denn Rodula Gaitanou ist trotz dieser (eigentlich überflüssigen) Zutaten eine grundsolide und im guten Sinne fast konventionelle Inszenierung gelungen, die das Werk nicht verfälscht und die tragische Dreiecksgeschichte im Mittelpunkt belässt. Die emotionale Talfahrt von Renato, der sich von seiner Frau Amelia und seinem besten Freund Riccardo betrogen sieht, steht dabei im Zentrum und wird von ihr sehr eindringlich entwickelt. Seine Verzweiflung und seine Rachegedanken sind hier absolut nachvollziehbar.
Simon Corder hat eindrucksvolle Bühnenbilder entworfen: Zu Beginn eine Bar, in der der Page Oscar hinter dem Tresen bedient, und in der bereits die blonde und verführerische Amelia auftaucht. Der zweite Akt zeigt verfallene Mauerbögen in einem unheimlichen Wald, und der dritte Akt führt in eine wahrhaft opulente Bibliothek im Hause Renatos. Auch die im Stil der 90er Jahre gehaltenen Kostüme von Gøje Rostrup fügen sich da nahtlos ein.

Musikalisch herrscht Hochspannung. Wie Hendrik Vestmann am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters die Akzente setzt, lässt keine Wünsche offen. Die knalligen, trockenen Orchesterschläge zu Beginn der Ulrica-Szene, das leidenschaftlich gesteigerte Melos beim Liebesduett oder das gewaltige Chor-Fortissimo am Ende - das ist bezwingend.
Um den Einsatz von Jason Kim als Riccardo musste man krankheitsbedingt bangen. Vorsorglich stand Remus Alăzăroae bereit, um im Bedarfsfall von der Seite zu singen. Aber Kim sang die Partie strahlend, kraft- und ausdrucksvoll ohne jede Einbuße. Dass man den Schluss trotzdem dem Gast überließ, war eine faire Geste. Und auch der überzeugte mit weichem, lyrischem Tenor. Lada Kyssy ist eine Amelia, die mit schlankem, höhensicherem Sopran und sehr ausdrucksvoller Gestaltung für sich einnimmt. Kihun Yoon beherrscht als Renato in jeder Phase seiner Rolle die Bühne mit unglaublicher Präsenz. Mit wuchtigem, volltönendem Bariton verdeutlicht er die emotionalen Nöte und singt den Schluss von „Eri tu“ mit fast tränenerstickter Stimme. Maiju Vaahtoluoto gibt die Ulrica mit satter, „orgelnder“ Tiefe und Martyna Cymerman singt den Oscar mit blitzsauberen Koloraturen.

Die kleine Partie des Silvano hört man selten so eindringlich wie hier von Leonardo Lee. Immerhin ist er alternativ auch als Renato besetzt. Die Verschwörer Tom und Samuel sind bei Ill-Hoon Choung und Stephen K. Foster bestens aufgehoben, ebenso der Diener bei Georgi Nikolov und der Richter bei Volker Röhnert, der der Figur eine leicht komische Note verleiht. Chor und Extrachor (in der Einstudierung von Thomas Bönisch) zeigen sich in allerbester Form. Insgesamt eine sehens- und hörenswerte Produktion von Un ballo in maschera, die vom Publikum mit enthusiastischem Jubel aufgenommen wurde.
Wolfgang Denker, 09.12.2019
Fotos von Stephan Walzl
Zum Zweiten
La Sonnambula
Premiere: 18.10.2019
besuchte Vorstellung: 23.10.2019
Fest der schönen Stimmen
Lieber Opernfreund-Freund,
Vincenzo Bellinis Œuvre scheint neben dem seiner Kollegen Gioachino Rossini und Gaetano Donizetti, den beiden Fließbandarbeitern im italienischen Belcanto, mit zehn Opern vergleichsweise gering. Schaut man auf die deutschen Bühnen, hat sich hier nur seine Norma dauerhaft auf den Spielplänen halten können, in jüngster Zeit wagt man sich aber auch immer wieder an eine Aufführung der Puritani oder an seine Beschäftigung mit dem Romeo-und-Julia-Stoff I Capuleti e i Montecchi. Sucht man nach deutschen Produktionen von Beatrice di Tenda und Zaira oder Il pirata, ist dies allerdings vergebens. La Sonnambula nimmt da eine Zwitterstellung ein, wird gerne jahre- und jahrzehntelang komplett ignoriert und dann fast gleichzeitig von mehreren Häusern gewissermaßen kollektiv wiederentdeckt und aufgeführt. Warum sich die melodienreiche, spritzige und durchaus lustige Nachtwandlerin neben dem Barbiere oder dem Liebestrank nicht fest im Repertoire der hierzulande gezeigten komischen Opern hat etablieren können, ist nach der gestrigen Aufführung am Staatstheater Oldenburg weniger nachvollziehbar denn je.
Ob man sich in Oldenburg deshalb für eine konzertante Produktion entschieden hat, weil sich die szenisch eingebundenen Abteilungen gerade an einer so hörens- wie sehenswerten Götterdämmerung ausgepowert haben, kann nur gemutmaßt werden. Vielleicht hat es aber auch mit dem Sujet der Sonnambula zu tun, das heutzutage mitunter als zu kitschig-romantisch, ja sogar als zu belanglos empfunden wird. In einem kleinen Ort in den Schweizer Alpen bezichtigt Elvino seine Verlobte Amina der Untreue, weil er sie schlafend im Zimmer des Grafen Rodolfo vorgefunden hat. Die Bemühungen von Lisa, die er für Amina verlassen hatte, ihn zurück zu gewinnen, scheinen von Erfolg gekrönt. Doch der Graf – weltgewandt und gebildet, was sonst – berichtet vom Phänomen des Schlafwandelns und das ganze Dorf samt Elvino werden Augenzeuge eines nachtwandelnden Ausflugs von Amina. So wendet sich alles zum Guten und einem Happyend vorm Alpenpanorama steht nichts mehr im Wege. Auf die Enthüllung aus Eugen Scribès Vorlage, dass sich der Graf als Aminas Vater herausstellt, hatte Bellini zusammen mit seinem Librettisten Felice Romani jedoch verzichtet.
Eine Inszenierung fehlt einem keine Minute lang am gestrigen Abend im außerordentlich gut besuchten Opernhaus. Das mag daran liegen, dass sämtliche Protagonisten außerordentlich lebendig agierende Interpreten sind und kleine Requisiten wie Handtasche oder Notariatskladde ausreichen, die Handlung zu untermalen. So kann sich alles auf Bellinis zauberhafte Musik konzentrieren, die eingängigen Melodien genießen und dem hohen Niveau der Sangeskunst lauschen. Sooyeon Lee ist eine Amina wie aus dem Bilderbuch, ihr schlanker, beweglicher Sopran verfügt über außerordentlichen Facettenreichtum und Ausdruckskraft, die die Südkoreanerin nicht nur in ihrer großen Schlussszene unter Beweis stellt. Martyna Cymerman steht ihr diesbezüglich in nichts nach, doch verfügt ihre Stimme über mehr klangliche Substanz, was gut zum durchtriebeneren Charakter ihrer Gegenspielerin Lisa passt. Das tut aber der Geläufigkeit des Soprans der jungen Polin keinen Abbruch. Der aus Kolumbien stammende César Cortés begeistert mich mit einem vor Frische und Farbenreichtum überschäumenden Tenor, mit dem er den Elvino zum Leben erweckt. Ill-Hoon Choung hingegen stattet den Grafen mit sonorem Bass aus und hätte auch gut eine Vaterfigur abgegeben. Als Mutter wie als Komödiantin überzeugend ist Melanie Lang mit weichem, Wärme verströmendem Mezzo als Teresa. Chorsolist Alwin Kölblinger ist ein präsenter und eindrucksvoller Alessio mit einschmeichelndem, elegant klingendem Bariton, während sein Kollege Georgi Nikolov den Notar in seinem kurzen Auftritt voller hinreißendem Witz gestaltet.
Der Chor wurde von Thomas Bönsch betreut, singt pointiert und tadellos, während Vito Cristofaro die Musikerinnen und Musiker des Oldenburgischen Staatsorchesters mit einer Spur klanglicher Nonchalance durch die Partitur von Bellinis siebenter Oper führt, den Melodienreigen farbenreich präsentiert und dabei allerhand Italianitá versprüht. Das Publikum ist begeistert und hat, wie ich, irgendwie geartete Szenerie keine Sekunde vermisst. Wenn Sie, lieber Opernfreund-Freund, Lust auf junge, frische Stimmen und wunderbare Melodien abseits des Standardrepertoires haben, sei Ihnen diese Produktion in Oldenburg wärmstens ans Herz gelegt.
Ihr Jochen Rüth, 24.10.2019
Bilder siehe Prermierenkriti unten!
LA SONNAMBULA
Premiere am 18.10.2019
Belcanto-Wonnen in Oldenburg
Vor einem Jahr konnte die Sopranistin Sooyeon Lee mit ihrer fulminanten Gestaltung der Titelpartie in Donizettis „Lucia di Lammermoor“ einhellig begeistern. Jetzt hat sie ihre damalige Leistung noch übertroffen. Der Komponist heißt diesmal nicht Donizetti sondern Vincenzo Bellini und ist fast ein Synonym für Belcanto und Melodienseligkeit. Seine Oper La Sonnambula („Die Nachtwandlerin“) erscheint in unseren Breiten eher selten auf den Spielplänen. Das Oldenburgische Staatstheater präsentiert sie auch „nur“ in konzertanter Form, wenn auch mit spielerischen Elementen angereichert. Aber das ist kein Manko, denn das dramaturgisch eher schwache Textbuch von Felice Romani mit seiner banalen Handlung steht per se hinter Bellinis herrlicher Musik zurück.
 Die Handlung spielt in einem schweizerischen Bergdorf. Amina und Elvino wollen heiraten, was die Eifersucht von Elvinos früherer Freundin Lisa anstachelt. Sie selbst wird von Alessio umworben, dem sie aber keine Chance gibt. Inzwischen kommt Graf Rodolfo nach langer Abwesenheit ins Dorf zurück. Amina ist Schlafwandlerin und verirrt sich in Rodolfos Zimmer. Als man sie dort findet, bezichtigt Elvino sie der Untreue und will nun Lisa heiraten. Bei einem erneuten Schlafwandel spricht Amina nur von ihrer Liebe zu Elvino. Auch Graf Rodolfo bezeugt Aminas Unschuld, sodass dem glücklichen Ende nichts mehr im Wege steht.
Die Handlung spielt in einem schweizerischen Bergdorf. Amina und Elvino wollen heiraten, was die Eifersucht von Elvinos früherer Freundin Lisa anstachelt. Sie selbst wird von Alessio umworben, dem sie aber keine Chance gibt. Inzwischen kommt Graf Rodolfo nach langer Abwesenheit ins Dorf zurück. Amina ist Schlafwandlerin und verirrt sich in Rodolfos Zimmer. Als man sie dort findet, bezichtigt Elvino sie der Untreue und will nun Lisa heiraten. Bei einem erneuten Schlafwandel spricht Amina nur von ihrer Liebe zu Elvino. Auch Graf Rodolfo bezeugt Aminas Unschuld, sodass dem glücklichen Ende nichts mehr im Wege steht.
Die Partie der Amina, die in früheren Jahren von Sängerinnen wie Maria Callas und Joan Sutherland geprägt wurde, erfordert eine erstrangige Belcanto-Sängerin. Und die steht dem Oldenburger Haus mit Sooyeon Lee zur Verfügung. Die aus Südkorea stammende Sängerin hat es erst kürzlich ins Finale des Wettbewerbs „BBC Cardiff Singer of the World“ geschafft und beweist nun als Amina erneut ihre außergewöhnlichen Qualitäten.
Sie singt die Partie nicht nur technisch perfekt, sondern auch mit beseeltem, zu Herzen gehendem Ausdruck. Ihr Stimmklang ist dabei von bezaubernder Süße, ihre Höhe von traumwandlerischer Sicherheit. Die oft in der Höhe angesetzten Schwelltöne, die agilen Koloraturen und die ebenmäßige Tonentfaltung begeistern ohne Einschränkung. Das alles zeigt sie schon in ihrer ersten Arie „Come per me sereno“ und erst recht in der großem Szene „Ah! Non credea mirarti“, in der sie noch mal alle Register ihres Könnens zieht. Mit etwas Glück dürfte sie Chancen auf eine internationale Karriere haben - das Format dazu hat sie.

Ihr zur Seite steht der aus Kolumbien stammende Tenor César Cortés als Elvino. Auch er wurde schon mit internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Belcanto-Preis des Festivals „Rossini in Wildbad“. Sein heller Tenor verfügt über ein ausgesprochen schmelzreiches Timbre und über eine strahlende Höhe. All seine Empfindungen von Liebe, Eifersucht und Enttäuschung verdeutlicht er mit seinem ausdruckvollen Gesang. Das wunderschöne Liebesduett „Prendi, l’anel ti dono“, bei dem er Amina den Verlobungsring überreicht, zeigt Innigkeit und Herzenswärme. Lee und Cortés sorgen für reinste Belcanto-Wonnen.
Die Lisa gewinnt in der Interpretation von Martha Eason besonderes Profil. Sie überzeugt mit ihrem klaren, frischen Sopran, aber auch mit ausgefeilter Mimik.
 Herrlich, wie biestig sie ihre Eifersucht verdeutlicht. Eine gute Figur macht auch Ill-Hoon Choung als Graf Rodolfo. Sein schlanker Bass hat eine angenehme, elegante Färbung. Seine Cavatina „Vi ravviso , o luoghi ameni“ wirkt durch die Schlichtheit des Vortrags. Melanie Lang ist Teresa, die mitfühlende Mutter von Amina. Wenn sie stets ihre Handtasche mit sich herumschleppt, in der sich nicht nur ihre Noten, sondern auch ein Beweisstück für Lisas Untreue befinden, macht das Schmunzeln. Nahtlos (aber etwas unauffällig) fügt sich Alwin Kölblinger als Alessio ins Ensemble ein. Die wenigen Worte des Notars sind Georgi Nikolov anvertraut.
Herrlich, wie biestig sie ihre Eifersucht verdeutlicht. Eine gute Figur macht auch Ill-Hoon Choung als Graf Rodolfo. Sein schlanker Bass hat eine angenehme, elegante Färbung. Seine Cavatina „Vi ravviso , o luoghi ameni“ wirkt durch die Schlichtheit des Vortrags. Melanie Lang ist Teresa, die mitfühlende Mutter von Amina. Wenn sie stets ihre Handtasche mit sich herumschleppt, in der sich nicht nur ihre Noten, sondern auch ein Beweisstück für Lisas Untreue befinden, macht das Schmunzeln. Nahtlos (aber etwas unauffällig) fügt sich Alwin Kölblinger als Alessio ins Ensemble ein. Die wenigen Worte des Notars sind Georgi Nikolov anvertraut.
Der Chor (Einstudierung Thomas Bönisch) und das Oldenburgische Staatsorchester unter Vito Cristofaro zeigen sich von ihrer besten Seite. Schon die Ouvertüre mit ihren Echoeffekten macht Freude. Cristofaro schwelgt differenziert und mit vielen Nuancen in Bellinis Melodienseligkeit. Das kann auch der Zuschauer: Ein Abend zum Zurücklehnen und Genießen.
Wolfgang Denker, 19.10.2019
Fotos von Stephan Walzl
GÖTTERDÄMMERUNG
Premiere am 28.9.2019
Finale im sterbenden Bergdorf

„Vollendet das ewige Werk“ singt Wotan im „Rheingold“ und meint damit den Bau der Götterburg Walhall. Und alle am Oldenburgischen Staatstheater könnten eigentlich einstimmen. Da wäre dann aber die in der Oldenburger Theatergeschichte erstmalige Vollendung der kompletten Tetralogie von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ gemeint. Begonnen hat das ehrgeizige Unterfangen im Februar 2017 und fand nun mit der Götterdämmerung seinen krönenden Abschluss. Eine Mammutaufgabe ist vollbracht - und das auf allerhöchstem Niveau. Das gilt für die Regie und die Bühnenbilder ebenso wie für die Leistungen der Solisten, des Dirigenten und des Orchesters.

Regisseur Paul Esterhazy hat sein Konzept vom „Rheingold“ bis zur Götterdämmerung konsequent und klug durchgezogen. Das abgeschiedene Bergdorf ist auch hier wieder Schauplatz der Handlung. Aber der Großbauer Wotan hat inzwischen abgedankt und sitzt nur noch apathisch auf einer Bank oder beobachtet das Geschehen. Seine Funktion, die des Chefs im Dorf, hat nicht Gunther übernommen, sondern es ist Hagen, der hier eindeutig das Sagen hat. Nicht ohne Grund, denn Gunther ist hier ein debiler Trottel, der ständig seinen Stammtisch-Wimpel vor sich herträgt, während Hagen ein Meister der Manipulation ist.
Die Zeit ist nicht spurlos am Bergdorf vorübergegangen. Die Weltesche ist inzwischen gefällt worden und es liegen nur noch kahle Äste herum, die später zum Entfachen des Weltenbrands benutzt werden. Die Szenerie suggeriert eine düstere Endzeitstimmung. Die Bühne und die Kostüme von Mathis Neidhardt unterstreichen das trefflich. Mittels Drehbühne gibt es, wie auch schon an den anderen drei Abenden, immer neue Perspektivwechsel.

Eine triste Scheune, eine Bauernstube, Brünnhildes Schlafkammer, ein in Nebel getauchter Wald oder die Waschküche, in der die Nornen agieren - alles führt die optischen Eindrücke der ersten drei Teile fort und ist doch auch wieder aufregend neu. Esterhazy hat den vier Teilen des „Rings“ die vier Jahreszeiten zugeordnet. Hier im Winter fallen auch hin und wieder Schneeflocken, etwa bei der Szene der Waltraute. Und auch die Gefühlskälte hat Einzug ins Bergdorf gehalten, etwa wenn der tote Siegfried an einem Seil wie ein erlegtes Wild fortgezerrt wird. Einzig Brünnhilde hat noch menschliche Empfindungen.
Esterhazys Ansatz, die Teile rückblickend und vorausschauend zu verzahnen, greift hier ebenfalls perfekt. So tauchen Siegfrieds Bär und der Waldvogel auch hier auf. Und es ist der Feuergott Loge, der Brünnhilde beim Zündeln hilft. Die Charakterisierung der Figuren ist bis ins Detail ausgefeilt. Auch Hagen ist nicht nur der kraftstrotzende Bösewicht, er hat deutlich psychische Probleme. Die Erscheinung Alberichs erlebt er als Albtraum in der Sauna.

Wie das Oldenburgische Staatstheater musikalisch auch diese Götterdämmerung gestemmt hat, ist sensationell. Das Oldenburgische Staatsorchester musiziert unter Hendrik Vestmann auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Insbesondere die Blechbläser sind einfach toll. Was hier an Klangrausch, an klugem Herausarbeiten der dramatischen Höhepunkte und Disposition der Tempi erreicht wird - darauf kann man in Oldenburg stolz sein. Stolz sein kann man auch auf die geschlossene Ensembleleistung. Mit Nancy Weißbach steht eine Brünnhilde zur Verfügung, deren Sopran mit stählernem Glanz mühelos alles überstrahlt. Dazu kommt eine bezwingende Bühnenpräsenz. Mit dieser Leistung könnte sie auch in Bayreuth bestehen. Ebenfalls ganz großes Format beweist Randall Jakobsh als Hagen. Seinem Wachtgesang und seinen Mannenrufen sichert er mit schwarzem Bass überwältigende Urgewalt. Dass Zoltán Nyári das richtige stimmliche Format für den Siegfried hat, zeigt sich erneut auch in der Götterdämmerung. Seine vor allem kraftvolle Gestaltung kann überzeugen, weil er auch zu differenzierteren Tönen fähig ist. Michael Kupfer-Radecky war in der „Walküre“ noch der Wotan. Jetzt zeigt er als Gunther ein stimmstarkes Charakterporträt. Mit Melanie Lang (Waltraute), Aile Asszonyi (Gutrune, 3. Norn), Leonardo Lee (Alberich), Maiju Vaahtoluoto (1. Norn), Ann-Beth Solvang (2. Norn, Floßhilde), Martha Eason (Woglinde) und Nian Wang (Wellgunde) sind alle weiteren Partien bestens besetzt.
Im Juni, September und Oktober 2020 wird der „Ring“ dann in Oldenburg zyklisch aufgeführt.
Wolfgang Denker, 29.9.2019
Fotos von Stephan Walzl
Zum Zweiten
Venus & Adonis und Dido & Aeneas
Barockdoppel wird zum kurzweiligen Hochgenuss
Premiere: 31.08.2019
besuchte Vorstellung: 15.09.2019
Lieber Opernfreund-Freund,
zwei kurze Barockopern stehen derzeit am Staatstheater Oldenburg auf dem Spielplan. Während die eine in den letzten Jahren zusehends ihren festen Platz im Standardrepertoire erkämpft, dürfte von der anderen und ihrem Schöpfer hierzulande kaum jemand gehört haben, obgleich das Sujet weithin bekannt ist. Die vergleichsweise bekannte Dido and Aeneas von Henry Purcell bekommt die unbekannte Masque Venus and Adonis von John Blow vorangestellt – und was sich das Produktionsteam um Tobias Ribitzki rund um die beiden antik-mythologischen Stoffe hat einfallen lassen, machen Sänger und Musiker unter der Leitung von Thomas Bönisch zum kurzweiligen Erlebnis mit Tiefgang.

Eine Masque ist ein höfisches Maskenspiel im England des 16. Und 17. Jahrhunderts und gilt als direkter Vorläufer der barocken Oper in England. Eine solche hat John Blow, 1649 im Osten Englands geboren, auf die Geschichte von Venus und Adonis aus Ovids Metamorphosen ersonnen und mit dem Untertitel „Masque zur Unterhaltung des Königs“ versehen. Erzählt wird die Geschichte von Venus, die ihres Geliebten Adonis überdrüssig wird, obwohl sie zusammen mit ihrem Sohn, dem frechen Cupido darüber nachdenkt, wie sie sich Adonis‘ Gunst dauerhaft sichern kann. Erst als er von einer Jagd, zu der sie ihn geschickt hat, um ihn vorübergehend loszuwerden, tödlich verwundet zurückkehrt, wird sie sich ihrer tiefen Liebe zu ihm bewusst und bleibt in Gram zurück. Auch Dido, die Gründerin von Karthago hat schon zu Beginn der Purcell-Oper Dido and Aeneas nach Vergils Aenaeis ihren Liebsten verloren, schöpft aber, ermuntert von ihrer Gefährtin Belinda, neuen Lebensmut, als sie sich in Aeneas verleibt. Doch böse Mächte rund um eine Zauberin gönnen der Königin ihr Glück nicht und beordern den trojanischen Flüchtling zurück nach Italien. Als Dido erkennt, dass sie ihre Liebe erneut verliert, stirbt sie an gebrochenem Herzen.

Zwei Herrscherinnen, die eine als Göttin über die Liebenden, die andere durchaus irdischer Herkunft, haben den Verlust der Liebe ihres Lebens zu verkraften – doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der jeweils rund eine Stunde dauernden Werke: Die beiden Komponisten standen in persönlicher Beziehung zueinander, Blow war zeitweise Purcells Lehrer und der wiederum rückte Blow auf die Organistenstelle in Westminster Abbey nach. Der Aufbau beider Opern ähnelt sich stark und die Werke enden jeweils mit einer großen Schlussszene der Titelheldin (In Oldenburg beendet Blows Rundgesang Chloe found Amintas den ersten Teil der Vorstellung). Tobias Ribitzki etabliert die Figur des Cupido in beiden Stücken, indem er die Rolle der Second Woman bei Purcell durch den kleinen Engel ersetzt und erzählt mit viel Witz die Venus-Geschichte, die wie eine Komödie beginnt und in einer Tragödie endet. Mittendrin statt nur dabei ist man auch im teilweise bespielten Zuschauerraum, die Bühne auf der Bühne kommt mit einer Recamiére als einzigem Requisit aus (Bühne und historisch angehauchte Kostüme: Stefan Rieckhoff) – und dennoch wird es keine Sekunde langweilig. Das ist nicht nur der gekonnten Personenführung des Regisseurs zu verdenken, sondern vor allem auch der überschäumenden Spielfreude des Ensembles, dem man in jeder Sekunde anmerkt, wie viel Spass es bei der Arbeit hat. So gelingt ein unterhaltsamer Nachmittag, dem Ribitzki durchaus auch ernste Akzente mitgibt, nach denen das Finale der Blow-Oper und das Purcell-Werk an sich ja durchaus auch verlangen.

Tragischer Höhepunkt von Dido and Aeneas ist schließlich nach seiner Lesart, dass Dido keineswegs stirbt, sondern sich für den Rest des Lebens der Liebe versagt – ein vielleicht noch furchtbareres Schicksal als der Tod an sich. Dies visualisiert gekonnt, mit eindrücklichem Ausdruck und höchster Körperbeherrschung die Tänzerin Renate Nehrkorn, die in beiden Werken die gealterte Version der Titelheldin darstellt. Aufgelockert wird das Blow-Werk zudem von den drei agilen Tänzern Uri Burger, Ruben Reniers und Charlie Riddiford, die die Vorstellung nach einer Choreografie von Elvis Val vollends zum echten Gesamtkunstwerk machen.
Gesungen und gespielt wird obendrein vorzüglich. Ann-Beth Solvang wächst als Venus und Dido schier über sich hinaus, zeigt sämtliche Facetten ihres ausdrucksstarken Mezzos, ist kokette Liebesgöttin, der zu spät die eigenen Gefühle klar werden, und bedrückte Dido, die immer wieder in Hoffnung erstrahlt, ehe sie in völliger Desillusion erstarrt. Intensiv-dramatische Ausbrüche wechseln sich mit zartesten Tönen ab, so dass man als Zuschauer das Wechselbad der Gefühle der beiden Figuren nahezu körperlich miterlebt. Das ist grandios! Leonard Lee setzt dem als schmachtender Adonis und fordernder Aeneas mit kraftvollem Bariton einiges entgegen, ist aber von beiden Komponisten eigentlich zur Nebenfigur verdammt, stellen sie doch die jeweilige Frau und deren Empfinden in das Zentrum ihrer Werke. Elena Harsányi ist Mitglied des Opernstudios des Oldenburger Staatstheaters und das ist kaum zu glauben, so versiert und gekonnt verkörpert sie die Belinda mit zartem, gefühlvollen Sopran. Mehr überrascht mich gestern nur noch Erica Back, ebenso Opernstudiomitglied, die den Cupido mit frechen Zwischentönen ganz und gar zu ihrer Rolle macht – das macht neugierig auf das, was die junge Finnlandschwedin mit ihrem wandelbaren Mezzosopran künftig noch alles zeigen wird. Ich bin gespannt! Melanie Lang erinnert mich in ihrer Verkörperung der Zauberin an die böse Stiefmutter in Walt Disneys Schneewittchen-Version, so dämonisch schaut sie in die Runde und solch teuflische Töne mischt sie ihrem tollen Mezzo bei. Martha Eason und KS Paul Brady sind ein vorzüglich-skurriles Hexengespann, währen der junge amerikanische Tenor Mark Watson Williams als Matrose das engagiert agierende Solistenensemble komplettiert.

Chorleiter und Kapellmeister Thomas Bönisch hält im Graben die Fäden zusammen, hat die Damen und Herren des Chores, die in beiden Werken umfangreiche Parts übernehmen, präzise vorbereitet und zeigt zusammen mit den historisch informiert aufspielenden Musikerinnen und Musikern, dass schlanker Barockklang alles andere als nüchtern sein muss, sondern vielmehr lebendig klingen und zu Tränen rühren kann. Dieser Nachmittag, lieber Opernfreund-Freund, war genau nach meinem Geschmack, kommen doch eine gewitzte Regie, engagiert und unprätentiös aufspielende Künstler und herrlich ausdrucksvolle Musik zusammen – das wärmt die Seele und ist genau das richtige für einen der kommenden kühlen Herbstabende.
Ihr Jochen Rüth 16.09.2019
Die Fotos stammen von Stephan Walzl
VENUS AND ADONIS / DIDO AND AENEAS
Premiere am 31.8.2019
Trauer um verlorene Liebe
Das Oldenburgische Staatstheater hat seine Kompetenz in Sachen Barockoper in den letzten Jahren mit Werken von Händel, Hasse oder Rameau wiederholt bewiesen. Dabei ging es immer um bedeutende Werke. Das war bei der Eröffnungspremiere der neuen Saison im Kleinen Haus nicht unbedingt der Fall.
 Präsentiert wurden die beiden Kurzopern Venus and Adonis von John Blow und Dido and Aeneas von Henry Purcell. John Blow (1649-1708) war ein Zeitgenosse von Henry Purcell (1659-1695) und mit diesem gut bekannt. Purcell war sogar zeitweilig Schüler von Blow. Während Purcells Werke wie „Dido and Aeneas“, „The Indian Queen“ oder „The Fairy Queen“ regelmäßig auf den Spielplänen erscheinen, sind Blows Werke weitgehend in Vergessenheit geraten. So gesehen, ist dem Oldenburger Haus mit „Venus and Adonis“ eine veritable Ausgrabung gelungen. Ob sie sich wirklich gelohnt hat, dürfte Geschmackssache sein. Denn die Musik von Blow fällt gegenüber der von Purcell doch deutlich ab.
Präsentiert wurden die beiden Kurzopern Venus and Adonis von John Blow und Dido and Aeneas von Henry Purcell. John Blow (1649-1708) war ein Zeitgenosse von Henry Purcell (1659-1695) und mit diesem gut bekannt. Purcell war sogar zeitweilig Schüler von Blow. Während Purcells Werke wie „Dido and Aeneas“, „The Indian Queen“ oder „The Fairy Queen“ regelmäßig auf den Spielplänen erscheinen, sind Blows Werke weitgehend in Vergessenheit geraten. So gesehen, ist dem Oldenburger Haus mit „Venus and Adonis“ eine veritable Ausgrabung gelungen. Ob sie sich wirklich gelohnt hat, dürfte Geschmackssache sein. Denn die Musik von Blow fällt gegenüber der von Purcell doch deutlich ab.
Trotzdem sind beide Werke eng miteinander verknüpft, weshalb Regisseur Thomas Ribitzki sie wohl auch zu einem Abend gekoppelt hat. Sowohl bei Venus wie auch bei Dido geht es um den tragischen Verlust einer Liebe. Venus huldigt zunächst dem Lustprinzip und der freien Liebe. Erst als sie ihr fortschreitendes Alter realisiert (Ribitzki verdeutlicht das sehr sinnfällig durch eine Tänzerin, die als gealtertes Double von Venus auftritt), entwickelt sie echte Gefühle für Adonis. Der wurde aber inzwischen bei einem Jagdausflug tödlich verwundet. Dido trauert um ihren gestorbenen Ehemann und ist zunächst nicht bereit für eine neue Liebe. Ihre Vertraute Belinda bestärkt aber ihre aufkommende Zuneigung zu Aeneas. Eine Zauberin, die Didos Glück zerstören will, lockt Aeneas durch Vorspiegelung eines göttlichen Auftrags von ihr fort. Sie bleibt zurück und sieht im Leben keinen Sinn mehr.

Thomas Ribitzki hat mit den Möglichkeiten des Kleinen Hauses beide Opern sinnfällig inszeniert. Ein riesiger Hintergrundprospekt zeigt ein Gemälde von Rubens mit dem Motiv von Venus und Adonis. In der ersten Oper, die die Bezeichnung „Masque“ trägt und mit vielen Tanzszenen angereichert ist, setzt er zunächst auf Elemente der Komik. Der Liebesgott Cupido (eine quirlige Variante des Puck im „Sommernachtstraum“) zieht die Fäden, unterrichtet kleine Amoretten in der Liebeskunst und schießt munter mit seinen Liebespfeilen.
 Der Cupido kommt eigentlich nur in der Blow-Oper vor, aber Ribitzki versetzt ihn auch in die Purcell-Oper. Die formale und inhaltliche Verzahnung beider Werke wird damit unterstrichen. Bei Purcell steht allerdings die Tragik Didos im Mittelpunkt.
Der Cupido kommt eigentlich nur in der Blow-Oper vor, aber Ribitzki versetzt ihn auch in die Purcell-Oper. Die formale und inhaltliche Verzahnung beider Werke wird damit unterstrichen. Bei Purcell steht allerdings die Tragik Didos im Mittelpunkt.
Ann-Beth Solvang singt beide Partien, Venus und Dido, bravourös, mit viel Glanz und Wärme in der Stimme. Das Lamento der Dido, eine der zeitlosen Szenen der Opernlitaratur, gestaltet sie bewegend. Leonardo Lee punktet als Adonis und Aeneas mit markantem, kernigem Bariton. Erica Back ist ein schelmischer Cupido, Martyna Cymerman eine anmutige Belinda. Melanie Lang gibt der Zauberin dämonische Züge. Ob sich Paul Brady unbedingt als Counter versuchen musste, sei dahingestellt.
Kinderchor und der teilweise aus dem Zuschauerraum singende Chor erfüllen ihre Aufgaben bestens. Das gilt auch Thomas Bönisch, der das sechzehnköpfige, überwiegend mit Streichern besetzte Orchester umsichtig leitet.
Wolfgang Denker, 1.9.2019
Fotos von Stephan Walzl
LA CLEMENZA DI TITO
Premiere am 04.05.2019 besuchte Aufführung: 08.05.2019
Zu Herzen gehende Töne
Maria Louisa, die frisch gekrönte Kaiserin von Böhmen, bezeichnete Mozarts La Clemenza di Tito nach der Uraufführung 1791 als „una porcheria tedesca“ - eine „deutsche Schweinerei“. Vielleicht hat es ihr nicht gefallen, dass ein Herrscher auf die Bestrafung der Attentäter und auf sein eigenes Liebesglück verzichtet. Aber die „Milde“ des Titus wurde in manchen Inszenierungen ohnehin kritisch hinterfragt – auch in Oldenburg 2006, als Regisseur Anthony Pilavachi die scheinbar Begnadigten vergifteten Wein trinken ließ.

Für die Neuproduktion zeichnet Laurence Dale verantwortlich. Derartige Überraschungen gibt es in seiner Inszenierung keine. Zur Ouvertüre wird ein Video projiziert, das u. a. die Namen römischer Kaiser auflistet. Es waren bewegte Zeiten. Allein im Jahr 69 n. Chr., dem sogenannten Vierkaiserjahr, saßen nacheinander vier Personen auf dem römischen Thron, bevor mit Vespasian und dann mit dessen Sohn Tito wieder Stabilität einkehrte. Dale bindet den historischen Kontext durchaus in seine Inszenierung ein, legt aber das Schwergewicht auf die emotionale Zerrissenheit der Hauptfiguren Tito, Vitellia und Sesto. Und das gelingt hervorragend, denn Macht und Mord, Liebe und sexuelle Hörigkeit, Verzweiflung und Hoffnung sind die Themen, die in ihrer ganzen Zeitlosigkeit in Mozarts lange unterschätztem Werk (erst Jean-Pierre Ponnelle hat das Stück 1969 in seiner Kölner Inszenierung dem Repertoire wiedergeschenkt) enthalten sind.

Dale verliert sich bei seiner Personenführung nicht in vordergründigen Aktionismus, sondern erzählt die Geschichte in ruhigen Bahnen und scheut dabei auch nicht vor statischen Momenten zurück. Besonders im zweiten Teil, wo sich die bekenntnishaften Arien häufen, sichert er den Sängerinnen und Sängern Ruhe für die musikalische Ausführung. Das funktioniert, weil die sängerischen Leistungen so ausdrucksvoll und fesselnd sind, dass kein Leerlauf entsteht. Das soll nicht heißen, dass nicht viel auf der Bühne passiert. Der Brand Roms (mit Feuerwehrleuten im Hintergrund), die Bergung der Verletzten, das Krankenlager von Tito, der den Brandanschlag überlebt hat, und die großen Volksaufmärsche - das alles wird in eindrucksvollen Sequenzen verdeutlicht. Unterstützend wirkt das Bühnenbild von Matthias Kronfuß, das mit spiegelnden Wänden und mit paralleler Handlung im vorderen und hinteren Teil der Bühne arbeitet.

Bei den Solisten ist Ann-Beth Solvang an erster Stelle zu nennen, die als Sesto mit ihrem klangvollen Mezzo Töne findet, die wahrhaftig zu Herzen gehen. Ihre Arie „Parto, ma tu ben mio“ (mit obligater Klarinette) gerät zu einem Höhepunkt. Sie kann die Zerrissenheit, die Gewissensqualen, den jugendlichen Überschwang und auch die sexuelle Hörigkeit des Sesto glaubhaft vermitteln. Kein Wunder, denn die Verführungskünste von Vitellia, die dabei gekonnt ihre langen Beine einsetzt, zeigen ihre Wirkung. Dabei scheint Vitellia keinen klaren Lebensplan zu haben. Sie taumelt zwischen Rachsucht und Machtstreben, zwischen Kalkül und Gewissensnot ebenso wie zwischen ihrer Liebe zu Tito und zu Sesto. Narine Yeghiyan gibt der Figur mal furienhafte, mal verzweifelte Züge und verdeutlicht das mit ihrem höhensicheren und in allen Lagen durchschlagskräftigen Sopran. Auch Tito ist nicht frei von Selbstzweifeln. Philipp Kapeller gibt diesem Kaiser ein stimmiges Profil und gestaltet seine lange Arie „Ma che giorno“ mit lyrischem und substanzreichem Tenor. In den weiteren Partien überzeugen Erica Back als Annio, Martyna Cymerman als Servilia und Ill-Hoon Choung als Publio. Auch der von Markus Popp einstudierte Chor zeigt sich in großer Form.

Eine hervorragende Leistung liefern Hendrik Vestmann und das Oldenburgische Staatsorchester ab. Da paaren sich Detailgenauigkeit und dramatischer Impetus zu einer Wiedergabe, die den Spannungsbogen über die gesamte Aufführung hält. Mit vielen Akzenten wird Mozarts Musik hier zum Ereignis.
Wolfgang Denker, 09.05.2019
Fotos von Stephan Walzl
Dead Man Walking
Premiere: 23.03.2019
besuchte Vorstellung: 07.04.2019
Unter die Haut
Lieber Opernfreund-Freund,
die ergreifende Geschichte Dead Man Walking, die dem einen oder anderen aus dem gleichnamigen Film mit Susan Sarandon und Sean Penn aus dem Jahr 1996 geläufig sein dürfte, hat im Jahr 2000 den Sprung auf die Opernbühne geschafft und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Renner der zeitgenössischen Opernmusik – auch an deutsche Theatern. In der laufenden Spielzeit präsentieren die Theater in Erfurt und Bielefeld das Werk, das 2006 an Semperoper in Dresden zur deutschen Erstaufführung kam. Und auch am Staatstheater Oldenburg ist Dead Man Walking noch bis in den Juli hinein zu sehen. Gestern nun habe ich mir eine Vorstellung für Sie angeschaut – und bin noch immer bewegt.

Moderne klassische Musik wird hierzulande gerne mit ausufernder Atonalität, verfremden Klängen, wenn beispielsweise Styropor oder Reißzwecken Geigen- oder Klaviersaiten malträtieren, schier unsingbaren Partien und zugleich absurden Handlungen gleichgesetzt, mit dem Effekt, dass selbst Kenner und Liebhaber von Klassik und Oper mit dem Ergebnis oft wenig anfangen können. In den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nähert man sich heutzutage dieser Kunstform anders. Man lässt Einflüsse von Jazz, Gospel, Filmmusik und Rock 'n' Roll bewusst zu und setzt u.a. auf aktuelle Stoffe, die nicht selten bereits als Filmhit auf der Leinwand zu sehen waren – und spielt sie vor ausverkauften Häusern.

So ist es auch Dead Man Walking ergangen, der oscarprämierten Verfilmung des gleichnamigen Buches der Nonne Helen Prejean, die sich seit Beginn der 1980er Jahre um zum Tode Verurteilte kümmert – erst als Brieffreundin, später auch persönlich – und die als Gallionsfigur der Gegner der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten gilt. Von einem fiktiven Gefangenen handelt die Geschichte, der in der Oper Joseph De Rocher heißt, einem verurteilten Vergewaltiger und Mörder, der sich angesichts der nahenden Todes durch die Giftspritze an Prejean wendet, in der Hoffnung darauf, mit ihrer Hilfe eine Begnadigung zu erreichen. Die Oper setzt dabei – wie auch schon der Film – ein Hauptaugenmerk auf die Suche der Nonne nach der Wahrheit und die Uneinsichtigkeit des Mörders, der die Tat bis Minuten vor der Hinrichtung abstreitet. Auch seine Familie hilft ihm bei der Verdrängung der Tat, beim letzten Besuch seiner Mutter verhindert die ein Geständnis ihr gegenüber, damit sie den Tatsachen nicht ins Gesicht sehen muss. Erst Minuten vor der Hinrichtung gesteht de Rocher gegenüber Schwester Helen die Tat und bittet in seinen letzten Worten die Angehörigen seiner Opfer um Vergebung. Die hatten Helen zuvor vorgeworfen, sich auf die falsche Seite geschlagen zu haben.

Die nahezu leere Bühne von Jamie Vartan wird immer wieder durch herabgelassene Gefängnisgitter begrenzt, mehr braucht es nicht, um die Beklommenheit der Situation zu visualisieren. Das ausgefeilte Licht von Arne Waldl schafft zusätzlich Bedrohung, so dass mit wenigen Requisiten der Boden bereitet ist für die eindringliche Inszenierung von Olivia Fuchs. Die 80er-Jahre-Mode spiegelt sich in den Kostümen von Zahra Mansouri wider, danke ihr und aufgrund der genauen Zeichnung der einzelnen Charaktere erscheinen die Protagonisten selbst in Massenszenen als Individuen. Die Tat selbst und die Hinrichtung werden in drastischen Bildern gezeigt. Das ist nichts für schwache Nerven – wie das ganze Thema an sich. Die Regisseurin beleuchtet alle Aspekte, das Zwiegespräch zwischen Schwester und Mörder, das Ringen von beiden mit sich selbst, das Warten auf das Urteil des Bewährungsausschusses und schließlich die Hinrichtung mit nicht nachlassender Intensität. Das geht unter die Haut, lässt mitfühlen, nachdenken, hallt lange nach. Genau so muss Musiktheater heute sein!

Was da aber auch künstlerisch geleistet wird, verdient höchsten Respekt. Allen voran ist die umwerfende Leistung von Melanie Lang zu nennen, die als Schwester Helen Prejean über sich hinauswächst. Nahezu ständig auf der Bühne, bewältigt sie diese Monsterpartie nicht nur, sondern füllt sie bis in die letzte Faser aus. Ihr klangschöner, voluminöser Mezzo brilliert in den Momenten der Kampfeslust und der Hoffnung mit nie nachlassender Kraft und vermag bis zu den letzten zarten Tönen des Gospels, mit dem das Werk endet, immer auch wieder aufs Innigste zu berühren. Kihun Yoon gibt den Joseph De Rocher als selbstverliebten Macho mit einschmeichelnden Piani und dreckig-verdorbener Tiefe. Man nimmt dem Südkoreaner, dessen Figur sich der Aussichtslosigkeit ihrer Situation nur zögernd stellt, die Verzweiflung ebenso ab wie den Selbstbetrug, sein imposanter, farbenreicher Bariton verfügt über große Wandlungsfähigkeit. Einen Gänsehautmoment habe ich beim innbrünstigen Appell von Josephs Mutter vor dem Bewährungsausschuss, den Ann-Beth Solvang so intensiv gestaltet, dass man kaum zu blinzeln wagt, um ja keine Millisekunde ihres eindringlichen Spiels und ihres bewegenden Gesangs zu verpassen. Auch die Eltern der ermordeten Jugendlichen imponieren durch eindringliches Spiel, perfekte Intonation und intensiv-anrührenden Gesang. Martha Eason, Erica Back und Timo Schabel leisten Großartiges und spielen tadellos. Dass aber Stephen K. Foster „erst“ Mitglied im Opernstudio ist, mag ich kaum glauben – so bühnenpräsent ist sein Auftritt als Owen Hart, so vollkommen und kraftgeladen ist sein raumfüllender Bassbariton. Da darf man auf die musikalische Zukunft des jungen Künstlers gespannt sein, der überdies noch die Rolle des ersten Gefängniswärters für den erkrankten Andreas Lütje von der Seite singt. Gegen ein solches Powerseptett haben es Henry Kiichlis Gefängnisdirektor und Sandro Montis Pater Grenville schwer.

Beeindruckend ist das Dirigat von Carlos Vásquez, das die außergewöhnliche Partitur in all ihrer Schroffheit und Brutalität zeigt. Er entfacht im Graben zusammen mit dem Oldenburgischen Staatsorchester ein wahres Klangfeuerwerk, gesteht jeder zitierten Musikrichtung ihr Existenzrecht zu und verwebt die einzelnen Stile zu einem großen, imposanten Ganzen. Der glänzend disponierte Chor, von Markus Popp betreut, tut ein Übriges, damit es ein perfekter Abend wird. Nach der Hinrichtungsszene herrscht naturgemäß betroffene Stille im voll besetzten Saal, der sich in einem wahren Jubelorkan entlädt. Die Story, der packende Stilmix des Komponisten Jake Heggie, die fesselnde szenische Umsetzung sowie der fast makellose musikalisch-künstlerische Teil sorgen dafür, dass dieser eindringliche Appell gegen die Todesstrafe zum vielleicht bewegendsten Theaterabend der laufenden Saison wird.
Ihr Jochen Rüth 08.04.2018
Die Fotos stammen von Stephan Walzl.
LES PALADINS
Premiere am 16.02.2019
Barocker Zauber für alle Sinne
Seit einigen Jahren glänzt das Oldenburgische Staatstheater mit jeweils einer Barockoper in jeder Spielzeit. „Siroe“, „Xerxes“ oder „Hercules“ waren hervorragend gelungene Produktionen. In dieser Saison fiel die Wahl auf Les Paladins von Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

Rameau, der auch ein bedeutender Musiktheoretiker war, schrieb seine wichtigsten und größten Werke, darunter die Opern „Castor et Pollux“, „Dardanus“, „Zoroastre“ und „Les Indes galantes“, als er das Alter von fünfzig Jahren schon überschritten hatte. Obwohl er es zu Lebzeiten zu großer Berühmtheit brachte und als einer der größten französischen Musiker galt, gerieten seine Werke für fast 140 Jahre in Vergessenheit. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde erstmals wieder die Ballettmusik „La Guirlande“ aufgeführt.
Bei Les Paladins handelt es sich auch um ein Spätwerk. Es wurde 1760 in der Pariser Oper uraufgeführt. Der Autor des Librettos dieser „lyrischen Komödie“ steht nicht eindeutig fest, aber wahrscheinlich stammt es von einem der Brüder Jean- François oder Pierre-Jacques Duplat di Monticourt. Die Handlung rankt sich um das junge Mädchen Argie, auf die ihr unsympathischer Vormund Anselme sein begehrliches Auge geworfen hat. Doch sie liebt den Paladin (adliger Ritter) Atis, der sie aus den Fängen von Anselme befreien will. Die Flucht scheint zunächst zu gelingen, doch Anselme und sein Diener Orcan bringen Argie, ihre Vertraute Nérine und Atis wieder in ihre Gewalt. Erst das Eingreifen der listigen Fee Manto sorgt für ein glückliches Ende.

Das Stück war zunächst kein großer Erfolg und wurde nach fünfzehn Aufführungen wieder abgesetzt. Die Mischung aus Ernst, Komik und Burleske empfand das damalige Publikum für die Pariser Oper, die dem „noblen Genre“ vorbehalten war, als unangemessen. Sogar die Vertreter der Opéra-comique kritisierten diese Mixtur. Heute gilt Les Paladins neben „Platée, seiner anderen berühmten „Comédie lyrique“, als eines der wichtigsten Werke von Rameaus.
Genau das ist es, was die Oldenburger Aufführung auch vermittelt. François de Carpentries (Inszenierung), Alexis Kossenko (musikalischen Leitung), Antoine Jully (Choreografie) und Karine Van Hercke (Bühne und Kostüme) - sie alle entfachen barocken Zauber für alle Sinne. Die Zeit von Rameau, der sein Werk selbst als Parodie konzipiert hatte und viele Stile, szenisch und musikalisch, ironisch zitiert, wird hier liebevoll zum Leben erweckt.

Die Bühne wird von Burgmauern mit Türmchen umrundet und bietet viel freien Raum für die lebendigen und phantasievoll ausgeformten Ballettszenen. Besonders die von Ballettsolisten gestaltete Pantomime, in der die gesamte Handlung der Oper wie im Zeitraffer und mit viel Witz dargestellt wird, sorgt für ein besonderes Vergnügen.
Am Rande der Bühne befindet sich ein riesiger Vogelkäfig, in dem Anselme sein Mündel Argie gefangen hält und von Orcan, einem frühen Vorgänger von Mozarts Osmin, bewacht wird. Beim Erscheinen von Atis und seinem Gefolge flattern Schmetterlinge über die Burgmauern. Um Anselme in Angst zu versetzen, verwandeln sich Atis und seine Leute in furchterregende Furien mit großen Hörnern. Und die Fee Manto erweist sich hier nur als eine List von Atis. Dazu schnallt er sich so riesige Brüste um, dass man befürchtet, Anselme würde den Erstickungstod erleiden. Diese Szene hätte auch von Offenbach sein können.

Und gleich nach der Hochzeitsnacht drückt Argie ihrem verblüfften Atis ein Baby nach dem anderen in den Arm, insgesamt vier - Quartett im Bett! Es sind viele abwechslungsreiche Details, die den Reiz dieser aufwändigen, in Kooperation mit dem Centre de musique baroque de Versailles erarbeiteten Produktion ausmachen.
Auch die musikalische Umsetzung kann höchste Authentizität beanspruchen, denn Oldenburg ist das erste Haus, das aus dem Material einer wissenschaftlich fundierten Neuedition spielt. Zu den üblichen Instrumenten tritt eine Musette (gespielt von Jean-Pierre Van Hees) hinzu, eine französische Sackpfeife, die im französischen Barock für Pastoralstimmung sorgte. Alexis Kossenko und dem Oldenburgischen Staatsorchester gelingt es bestens, den weichen, elegischen Klang von Rameaus Musik umzusetzen. Einmal mehr wird hier hohe Kompetenz in Sachen Barockoper bewiesen.

Das gilt auch für das Ensemble. Martyna Cymerman und Philipp Kapeller als Argie und Atis treffen stimmlich und darstellerisch ihre Partien sehr gut. Bei Sooyeon Lee als neckischer Nérine und Stephen K. Foster als Orcan kommt zu den gesanglichen Leistungen noch eine gehörige Prise Komik dazu. Und auch Ill-Hoon Choung macht seine Sache als überlisteter Anselme, der am Ende selbst in dem Käfig landet, sehr überzeugend.
Wolfgang Denker, 17.02.2019
Fotos von Aurelie Remy
LUCIA DI LAMMERMOOR
Premiere am 08.12.2018
Edgardo bleibt am Leben
Die Titelpartie in Gaetano Donizettis Oper Lucia di Lammermoor ist eine der anspruchsvollsten Partien des Belcanto-Repertoires. Man bedenke, dass es in den 50er und 60er Jahren Sängerinnen wie Maria Callas, Joan Sutherland oder Beverly Sills waren, die das Werk wieder populär machten und gleichzeitig Maßstäbe für die Partie der Lucia setzten. Wenn ein Haus wie Oldenburg diese Rolle mit Sooyeon Lee aus dem eigenen Ensemble so hervorragend besetzen kann, das keine Wünsche offen bleiben, ist das schon bemerkenswert.

Wobei man aber sagen muss, dass auch Nerita Pokvytyté die Partie vor einem Jahr in Bremen gut bewältigt hatte. Während die Bremer Inszenierung von Paul-Georg Dittrich aber szenisch überfrachtet war und viel überflüssiges Beiwerk enthielt, fällt die Oldenburger Version in der Regie von Stephen Lawless hingegen eher schlicht aus. Es gibt hier kaum etwas, was nicht in jedem Opernführer nachzulesen ist, wenn man einmal davon absieht, das Edgardo hier am Ende von seinem Selbstmord abgehalten wird. Das ist per se nichts Schlechtes - auch in einer „altmodischen“ Inszenierung kann sich spannendes Musiktheater entfalten. Allerdings müsste die Personenführung dann etwas ausgefeilter sein. Vieles wirkt einfach nur bieder. Vor allem die Behandlung des Chors fällt hier etwas unbeholfen aus, dessen Auftritte zu pauschal und weitgehend statisch geraten. Ein paar Akzente setzt aber auch Stephen Lawless. So wird ein riesiger Hirsch von Enricos Jagdgesellschaft auf die Bühne geschleppt und ausgeweidet.

Und es wird viel getrunken: Enrico und Edgardo greifen ständig zum Flachmann. Bei der sonst oft gestrichenen, aber hier erfreulicherweise enthaltenen ersten Szene des dritten Aktes mit einer eindrucksvollen Gewitterstimmung ist Edgardo regelrecht betrunken. Zur Einleitung des zweiten Bildes im ersten Akt sitzt Lucia an einer Harfe und erwartet träumerisch ihren Edgardo. Das Bild eines nächtlichen, nebelverhangenen Friedhofs verstärkt die unheilvolle Stimmung. Überhaupt das Bühnenbild: Verschiebbare Wände und diverse Requisiten wie Sarg, Kronleuchter oder Schreibtisch markieren geschickt und nahtlos immer neue Schauplätze. Die Entwürfe stammen von Benoîit Dugardyn, der aber überraschend verstorben ist. Lionel Lesire ist eingesprungen und hat die Durchführung übernommen. Beim Schlussbeifall hielt Lesire ein großes Photo von Dugardyn in den Händen - eine sympathische Geste.

Musikalisch bereitet die Oldenburger Lucia reinsten Genuss. Sooyeon Lee ist der Partie der Lucia in jedem Moment gewachsen. Sie setzt die Töne mitunter etwas vorsichtig an, kann aber mit herrlichem Piano und technisch perfekten Koloraturen begeistern. Ihre Wahnsinnsszene, bei der sich ihre Stimme und die Flöte in einem subtilen Duett umspielen, wird man so schnell nicht vergessen. Als Edgardo setzt Jason Kim seinen robusten, aber auch zu empfindsamer Lyrik fähigen Tenor effektvoll ein. Seine Verzweiflung am Ende geht zu Herzen. Die Tristesse der Szene wird durch sanfte Schneeflocken verstärkt. Kihun Yoon hat man schon markanter gehört, dennoch beweist er als Enrico mit dunklem Bariton gestalterisches Format und kann gleich mit seiner Auftrittsarie seine zielgerichtete Autorität unterstreichen. Philipp Kapeller gibt den von Lucia ungewollten Verlobten Arturo mit ansprechendem Tenor als selbstgefälligen Schnösel.

Der Priester Raimondo wird von Tomasz Wija teils durch mitfühlende Güte, teils durch energisches Handeln charakterisiert. Seine Partie wird in dieser Inszenierung aufgewertet, weil das sonst nie gespielte große Duett zwischen ihm und Lucia vor dem Hochzeitsbild hier berücksichtigt wird. Die Partien der Alisa und des Normanno werden von Ann-Beth Solvang und Timo Schabel gut erfüllt. Ein Sonderlob gebührt dem klangvoll und intensiv singenden Chor in der Einstudierung von Markus Popp.
Die musikalische Leitung dieser ohne Striche gespielten Lucia liegt in den Händen von Vito Cristofaro, der sich einmal mehr als energiegeladener, umsichtiger Dirigent erweist. Er scheut mitunter nicht die knalligen Effekte, geht in Tempo und Dynamik hervorragend auf seine Sänger ein und sorgt für veritable Dramatik, etwa in dem hitzigen Sextett.
Wolfgang Denker, 9.12.2018
Fotos von Stephan Walzl
LA DAMNATION DE FAUST
Premiere am 20.10.2018
besuchte Aufführung: 30.10.2018
Videos beeinträchtigen die Wirkung der Musik

Traut man dem Zuschauer nicht mehr zu, sich zweieinhalb Stunden „nur“ auf die Musik zu konzentrieren? Oder hält man diese Musik für nicht stark genug, allein aus sich selbst heraus zu wirken? Das kann nicht sein, denn immerhin handelt es sich hier um La Damnation de Faust von Hector Berlioz, eines seiner prachtvollsten Werke. Warum also hat man sich entschlossen, die als konzertant angekündigte Aufführung mit einer Video-Installation von Christoph Girardet zu „bereichern“? Dabei werden auf der dreigeteilten Projektionsfläche anscheinend zufällig ausgewählte Schnipsel aus Spielfilmen, wissenschaftlich-technischen Lehrfilmen oder von Natureindrücken gezeigt, mal in Endlosschleifen, mal in Zeitlupe.
Wenn man das Programmheft liest, könnte der Eindruck entstehen, dass diese Videos aus reinem Selbstzweck gezeigt werden: „Nach der Dekonstruktion der ursprünglichen filmischen Zusammenhänge entstehen aus den unterschiedlich gearteten Fragmenten so neue Zusammenhänge. Bilder, die nach oder nebeneinander erscheinen, bilden Beziehungen zueinander aus. Diese sind jedoch nicht immer planbar und bisweilen unaussprechlich. Dies erschließt neue Bedeutungsräume und nicht selten auch eine neue Sicht auf das Ausgangsmaterial.“ Aha. Strömendes Wasser, Luftballons, Türschlösser, Astronauten, sich umkreisende Glühbirnen, farbige Kreise und vieles mehr sind da in permanenter Unruhe zu sehen.
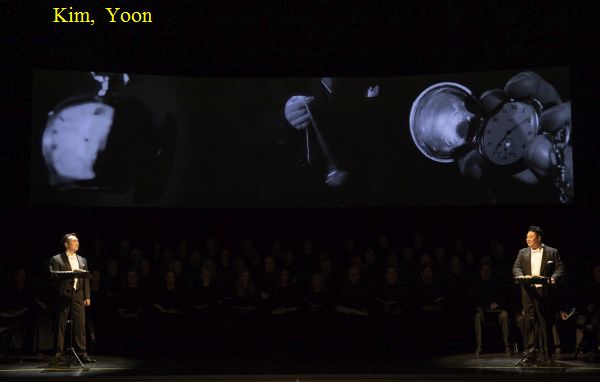
Manche Videos haben zwar durchaus Symbolcharakter, manche auch direkten Bezug zum Text, wobei sie ihn dann aber nur banal verdoppeln. Nein - diese Videos bringen keinen Erkenntnisgewinn, dafür stören sie aber in ärgerlicher Weise die Konzentration auf das Wesentliche. Und das ist eben doch die wunderbare Musik von Hector Berlioz, die in dieser Oldenburgischen Erstaufführung in ganzer Pracht erkling.
Das Orchester sitzt im Graben, der Chor ist auf der Bühne postiert, davor stehen die Solisten an ihren Notenpulten. Vito Cristofaro führt das Oldenburgische Staatsorchester zu einer packenden und klanglich opulenten Wiedergabe. Hervorzuheben sind auch die solistischen Leistungen, etwa die der Oboe. Den bekannten Rakoczy-Marsch nimmt Crisofaro reißerisch-effektvoll, die dramatischen Momente werden intensiv gesteigert und der in voller Besetzung großartig singende Chor (Einstudierung von Markus Popp) sorgt für überwältigende Momente. Bei den Solisten ist vor allem der Bassist Kihun Yoon als Méphistophélès hervorzuheben. Er gibt der Figur wahrhaft diabolische Ausstrahlung und singt die Partie mit erzener Wucht. Sehr suggestiv gelingt sein ironisches Flohlied. Mit dunkel grundiertem Mezzo gibt Ann-Beth Solvang die Marguerite. Sie lässt ihre Stimme in makellosem Ebenmaß strömen und kann in „Meine Ruh’ ist hin“ den Aufruhr des Herzens dieser Figur bestens vermitteln.

Auch Jason Kim kann als Faust mit einer soliden Leistung überzeugen. Sein baritonal timbrierter Tenor hat eine gute Mittellage, wenn er ins Falsett geht, wird es allerdings etwas eng. Leonardo Lee ist mit seinem Lied über die „Ratt’ im Kellernest“ in der kleinen Partie des Brander zu hören, Alwin Köblinger gestaltet das Bass-Solo.
Wolfgang Denker, 31.10.2018
Fotos von Stephan Walzl
ORPHEUS IN DER UNTERWELT
Premiere am 10.10.2018
Der Olymp in Zeiten des Internets
Auf die Frage, was man bei seiner Inszenierung von Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ im Kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters erwarten könne, sagte Regisseur Felix Schrödinger: „Den Zuschauer erwartet all das, was man von einer guten Operette erwarten kann: Humor, schmissige Musik, Tanz, Erotik und - typisch für Offenbach - eine große Portion Gesellschaftskritik.“ Er hat nicht zuviel versprochen.

Die Gesellschaftskritik bezieht sich in dem Werk allerdings auf die Zustände zu Offenbachs Zeiten. Um sie in unsere Zeit zu transportieren, hat Schrödinger eine eigene Textfassung geschrieben, bei der das Internet mit Facebook und Twitter sowie die Boulevard-Presse eine zentrale Rolle spielen. Denn das sind die Medien, die heute die öffentliche Meinung bestimmen. Diese Öffentliche Meinung ist in Offenbachs Werk als Figur personifiziert. Hier tritt sie als Managerin von Orpheus, als Reporterin oder als Spielmacherin auf. Melanie Lang macht das souverän.
Die Handlung der Operette lässt Schrödinger dabei in seiner Version unangetastet. Die olympischen Götter bleiben auch bei ihm Götter. Aber das heutige Publikum soll sich wiedererkennen, wie das bei der Uraufführung 1858 in Paris im Théâtre des Bouffes-Parsiens auch war. Da eine Scheidung für einen Violinprofessor, der Orpheus bei Offenbach ist, heute kein Skandal mehr wäre, mutiert Orpheus bei Schrödinger zu einem Popstar wie David Garrett.

Kostüm und Maske unterstreichen das. Und als solcher muss er darauf achten, dass das liebgewonnene Bild des Publikums nicht beschädigt wird, damit es keinen Karriereknick bedeutet. Die Managerin verbietet die Scheidung, also wird Eurydike mit Hilfe von Pluto in die Unterwelt entsorgt. Aber da bricht ein Shitstorm los, dessen Auswüchse in Internet und Presse alle auf den Gazevorhang, hinter dem das Orchester postiert ist, projiziert werden (Bühne von Josefine Smid). „Fick dich“ oder „Du bist die nächste Leiche“ ist da zu lesen. Und auch die Presse-Schlagzeilen wie „Schnulzenfiedler tötet Gattin“ sind nicht zimperlich. Orpheus muss handeln. Leider haben auch die Götter, die ständig mit ihren Tablets hantieren, Interesse an dem Vorfall. Insbesondere Jupiter gelüstet es nach Eurydike und will ihr in Gestalt einer Fliege näherkommen. Und da kommt die von Schrödinger versprochene Erotik ins Spiel. Wenn Eurydike sich wollüstig auf dem Boden wälzt, wenn die (unsichtbare) Fliege ihr in den Ausschnitt krabbelt, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ansonsten ist aber in der Hölle zunächst Schluss mit lustig: Handy-Verbot und kein Internet. Dafür gibt es mit dem berühmten Höllen-Cancan eine ausgelassene Party, bei der alle Hemmungen fallen. Die Öffentlichkeit ist ja ausgesperrt. Am Ende, wenn Orpheus widerwillig seine Eurydike aus der Unterwelt führt, bricht er das Verbot, sich umzudrehen. Nicht, weil er nach Eurydike schauen will, sondern weil ein Handy klingelt. Modern times.

Schrödingers Konzept geht, von ein paar langatmigen Momenten abgesehen, durchgängig auf. Der Charakter eine Operette wird dabei in Richtung Boulevard-Theater verschoben. Aber das ist kurzweilig und handwerklich gut umgesetzt. Dabei kann er auf ein engagiertes Ensemble setzen. Martha Eason ist eine ebenso zickige wie laszive Eurydike, deren Spitzentöne effektvoll in den Raum knallen. Timo Schabel gibt den Orpheus als eitlen, aber unentschlossenen Popstar und hratzt sogar eigenhändig die Fidel. Der Blitze schleudernde Jupiter von Jason Kim ist ein stets um Contenance bemühter Göttervater. Pluto, das schwarze Schaf der Familie, wird überzeugend von Paul Brady gespielt. Seinen Diener Hans Styx, der sich schon mal gern in dem Kühlschrank mit den vielen Flaschen versteckt, gibt Stefan Vitu als vertrottelte Figur. Auch die anderen Mitglieder der Götterwelt zeichnet Schrödinger mit eigenständigem Profil, etwa Sharon Starkmann als keifende Juno, Hagar Sharvit als lockenköpfiger und liebenswerter Cupido, Tomasz Wija in Frauenkleidern als skurrile Venus oder Martyna Cymerman als forsche und schönstimmige Diana.

Dass die Musik von Offenbach bei allen Turbulenzen nicht zu kurz kommt, dafür sorgen besonders der von Markus Popp einstudierte Chor und das Oldenburgische Staatsorchester unter Carlos Vázquez. Schade nur, dass man die schöne Ouvertüre weggelassen hat.
Wolfgang Denker, 11.10.2018
Fotos von Stephan Walzl
SIEGFRIED
Premiere am 22.09.2018
besuchte Aufführung: 29.09.2018
Der Großbauer, sein Enkel und der Dorfschmied
Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ am Oldenburgischen Staatstheater - das Projekt geht in die nächste Runde. Inzwischen ist man beim „Siegfried“ angelangt - und dem Oldenburgischen Staatstheater ist anerkennend zu bescheinigen, dass es die gewaltige Aufgabe bisher glänzend bewältigt hat.

Regisseur Paul Esterhazy siedelt auch den „Siegfried“ in der Welt eines alpinen, abgeschiedenen Bergdorfs an. Wotan ist ein herrischer Bauer, ehemals der mächtigste Großgrundbesitzer des Dorfes. Seine Vormachtstellung bröckelt und so streift er verkleidet und mit einem angeklebten Bart durchs Dorf, um die Lage zu eruieren. Insbesondere will er nach seinem Enkel Siegfried schauen, auf den sich seine Hoffnungen für den Fortbestand der Macht setzen. Der wächst bei Mime, dem zwielichtigen und hinterhältigen Dorfschmied auf. Alberich ist Wotans trunksüchtiger Nachbar, Erda die Dorfälteste mit seherischen Fähigkeiten.
Wie schon im „Rheingold“ und in der „Walküre“ arbeitet Bühnen- und Kostümbildner Mathis Neidhardt intensiv mit der Drehbühne. Die vielen Räume mit dunklen Holzwänden gehen (fast filmisch) nahtlos ineinander über. Es ist ein wahrer Irrgarten, der hier auf die Bühne gewuchtet wird. der oft in geheimnisvolles Halbdunkel getaucht und von sanften Nebelschleiern eingehüllt wird. Obwohl Neidhardt dieses Gestaltungsprinzip seit dem „Rheingold“ nicht verändert und nur in Einzelheiten variiert hat, ist die Faszination ungebrochen geblieben. Von besonderem, geradezu poetischem Reiz gelingt das Waldweben, bei dem die Weltesche in herbstlichen Farben und mit fallenden Blättern im Mittelpunkt der Bühne steht.

Die Personenführung von Paul Esterhazy ist auch im „Siegfried“ bis ins kleinste Detail ausgelotet. Alle Figuren bleiben auch in dieser Bergwelt von archaischer Größe. Esterhazy weist in seiner Inszenierung auch sehr kunstvoll auf vergangene und auf zukünftige Elemente der Handlung hin. Alles greift sinnvoll ineinander über. Man spürt, dass Esterhazy bei seiner Regie die gesamte Tetralogie im Blick und den großen Zusammenhang konzipiert hat. So geisterte Erda bereits in der „Walküre“ über die Bühne und im „Siegried“ scharen sich bereits die Nornen um sie herum. Auch Loge hat hier im „Siegfried“ einen stummen Auftritt, wenn er dem Wanderer das Feuer reicht. Grane ist (wie schon in der „Walküre“) ein Greis auf Krücken.
Der Zweikampf zwischen Fafner und Siegfried wirkt wie ein neckisches Lausbubenspiel. Fafner hat hier nicht die Gestalt eines Drachens. Den gibt es vorher in der Projektion eines echsenartigen Ungeheuers zu sehen, das bedrohlich ein Auge öffnet. Wenn Siegfried die auf einem Kaminsims gebettete Brünnhilde mit einem Kuss aus ihrem Dornröschen-Schlaf erweckt, scheint diese den Verlust ihrer Göttlichkeit zu ahnen, wenn sie sich auf Siegfried einlässt. Und so kann sie sich erst nicht entscheiden, in welchem der vielen Betten sie sich ihm hingibt.

Zoltán Nyári ist Siegfried. Mit nie versiegender Kraft und imponierendem Glanz singt er die Riesenpartie von den heroischen Schmiedeliedern über das lyrische Waldweben bis zum ekstatischen Finale ohne geringste Ermüdungserscheinungen und mit durchgängig schönem Ton. Mit dieser Leistung könnte er an den größten Häusern bestehen. Auch Nancy Weißbach ist eine Brünnhilde, die mit kraftvollem und leuchtendem Sopran mühelos über das Orchester tönt und keine Wünsche offen lässt. Auch darstellerisch ist sie absolut überzeugend.
Die Partie des Wotan/Wanderer ist bei Thomas Hall bestens aufgehoben. Sein voluminöser Bariton erfüllt die Anforderungen mit heldischem Glanz, seine Gestaltung ist bis in die großen Ausbrüche äußerst differenziert. Mit Kihun Yoon als Alberich hat er allerdings einen starken Gegner. Auch Yoon kann mit seinem wuchtigen Gesang überzeugen und wäre ebenfalls ein potentieller Wotan.

Die Begegnung der beiden ist an dramatischer Spannung kaum zu übertreffen. Ein eindringliches Rollenporträt liefert Timothy Oliver als Mime. Mit seinem ausdrucksvollen Charaktertenor verdeutlicht er die Verschlagenheit der Figur punktgenau. Marta Świderska ist eine pastos klingende Erda, Ill-Hoon Choung mit profundem Bass ein bedrohlicher Fafner. Sooyeon Lee trägt als Waldvogel ihren schon in der „Walküre“ zu sehenden Vogelkäfig grazil über die Bühne und singt die Partie mit bezaubernder Leichtigkeit.
Die Leistung des Oldenburgischen Staatsorchesters unter Hendrik Vestmann verdient höchste Bewunderung. Trotz reduzierter Besetzung kann ein überwältigender Klang realisiert werden. Dieser „Siegfried“ wird dabei dennoch mit feinsten Details musiziert. Seine Wiedergabe ist von sicherer Disposition für die dramatischen Momente ebenso geprägt wie von dem lyrischen Klangzauber des Waldwebens oder dem mit großem Atem genommenen Finale.

Man darf sich jetzt schon ungeduldig auf die „Götterdämmerung“ im nächsten Jahr freuen.
Wolfgang Denker, 30.09.2018
Fotos von Stephan Walzl
DIE COMEDIAN HARMONISTS
Premiere am 23.06.2018
Vor allem toller Gesang

„Man wird von uns noch in 89 Jahren sprechen“ - das sagt Harry Frommermann, der Gründer der Comedian Harmonists, in der Oldenburger Inszenierung des gleichnamigen musikalischen Schauspiels von Gottfried Greiffenhagen. In der Tat sind die Comedian Harmonists auch heute noch ein Begriff. Nach anfänglichen Wechseln in der Besetzung fand die endgültige Formation mit Harry Frommermann (Tenor), Robert Biberti (Bass), Ari Leschnikoff (Tenor), Erich A. Collin (Tenor), Roman Cycowski (Bariton) und Erwin Bootz (Pianist) erst 1929 zusammen, also vor 89 Jahren.
Begonnen hatte alles - und hier setzt das Stück ein - mit einem Casting, wie man heute sagen würde. „Achtung. Selten. Tenor, Bass (Berufssänger, nicht über 25), sehr musikalisch, schönklingende Stimmen, für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit gesucht. Ej. 25 Scherlfiliale, Friedrichstr. 136.“ - so lautete die Anzeige, mit der Harry Frommermann 1927 Sänger für sein Ensemble suchte, das er nach dem Vorbild der US-amerikanischen Gruppe „The Revelers“ gründen wollte. Dass sich auch Johannes Heesters beworben haben soll, ist zwar ein Gerücht, wird aber in das Stück eingebracht. Die Folgen dieser Anzeige sind jedenfalls Musikgeschichte. Die Lieder der Comedian Harmonist sind auch heute noch in allen Ohren. Besonders Max Raabe hat viele von ihnen in sein Repertoire übernommen.

Regisseur Felix Schrödinger, der in Oldenburg auch eine fulminante „Regimentstochter“ von Donizetti inszeniert hat, gelingt es mit einfachen Mitteln, den Aufstieg der Comedian Harmonists nachzuzeichnen. Der Boden des Roncalli-Zeltes, das dem Oldenburgischen Staatstheater unter dem Namen „Uferpalast“ als Ausweichquartier dient, ist mit einem Holzfußboden bedeckt, im Hintergrund eine stilisierte Konzertmuschel, die auch Schattenspiele ermöglicht, sowie ein Klavier für die Begleitung. An Requisiten genügen ein Grammophon und ein Sofa. Josefine Smid zeichnet für Bühne und Kostüme verantwortlich.
Das Stück zeigt die ersten Proben der Harmonists, berichtet von ihrem Engagement an der Berliner Scala und in Leipzig sowie von ihrer Verpflichtung durch Erik Charell, den damaligen „Gott“ der Berliner Revuen. Und schließlich 1932 von ihren ersten Auftritten in der Berliner Philharmonie. Aber da zeichnet sich schon das Ende ab. Es gibt Streit zwischen den Mitgliedern der Gruppe und erste antisemitische Äußerrungen gegen Collin, Frommermann, und Cycowski. Nach der Machtergreifung Hitlers (angedeutet durch Armbinden mit Hakenkreuz bei den beiden Statistinnen) kommt 1934 der Erlass von Joseph Goebbels, der alle öffentlichen Auftritte von „Nicht-Ariern“ ab sofort verbietet. Damit ist das Ende der Comedian Harmonists besiegelt.

In dem Stück gibt es eine als Hans bezeichnete, von Johannes Schumacher verkörperte Figur. Sie hat mehrere Funktionen und steht mal für den Impresario Bruno Levy, mal für einen Conferencier, mal für einen Nazi, der den Beschluss von Goebbels verkündet. Eine exzentrische, schrille Figur, der sogar eine (entbehrliche) Stepp-Einlage gegönnt wird. Aber im Mittelpunkt stehen die Mitglieder der Harmonists, die allesamt vom Opernensemble gegeben werden, das nicht nur die gesanglichen, sondern auch die schauspielerischen Anforderungen hervorragend meistert. Den Part von Erwin Bootz hat Kapellmeister Felix Pätzold übernommen, der für die musikalische Einstudierung zuständig ist und die Sänger am Klavier begleitet. Philipp Kapeller (Leschnikoff), Timo Schabel (Collin), Paul Brady (Frommermann), Stephen K. Foster (Cycowski) und besonders Julian Popken (Biberti) haben sich den Klang der Comedian Harmonists bis zur Perfektion erarbeitet. Der Zusammenklang der Stimmen ist in ihrer Balance und Feinabstimmung einfach begeisternd. Die Lieder werden hinreißend serviert: „Mein kleiner, grüner Kaktus“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“, „In der Bar zum Krokodil“, „Ein Freund, ein guter Freund“, „Der Onkel Bumba aus Kalumba“, „Veronika, der Lenz ist da“, „Wochenend und Sonnenschein“ - man kann sie gar nicht alle aufzählen.

Ein besonderer Höhepunkt ist „Schöne Isabella von Kastilien“, bei der auch die Choreographin Yoko El Edrisi für höchst amüsante Akzente sorgt. Besinnliche Momente gibt es bei dem Volkslied „In einem kühlen Grunde“ oder bei einem Gesang aus dem Repertoire eines jüdischen Kantors. Nach dem jubelnden Beifall des Publikums gibt es mit „Irgendwo auf der Welt“ und „Das ist die Liebe der Matrosen“ noch zwei stimmungsvolle Zugaben. Die empfehlenswerte Produktion wird nach der Sommerpause im Großen und im Kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters weiterhin gespielt.
Wolfgang Denker, 24.06.2018
Fotos von Stephan Walzl
LA CENERENTOLA
Premiere am 05.05.2018
Realistischer Schluß, denn es gibt keine Märchen
Die meisten Opern enden traurig oder tödlich. Gioachino Rossinis „La Cenerentola“ gehörte bisher nicht dazu. Bisher - denn Regisseur Axel Köhler hält in seiner Oldenburger Inszenierung am Ende eine überraschende Wendung bereit, die die märchenhafte Komödie im Handumdrehen in ein Trauerspiel verwandelt.

Während der von Vito Cristofaro in Bezug auf Tempi und Dynamik hervorragend dirigierten Ouvertüre hebt sich der Vorhang und gibt den Blick auf einen trostlosen Hinterhof inmitten von alten Industrielagerhallen frei. Angelina (Cenerentola) schuftet dort bis zur Erschöpfung und schleppt Pakete, während sich ihre Kollegen (das sind später Don Ramiro und Dandini) mit zwei aufgetakelten Mädels (die Schwestern Clorinda und Tisbe) amüsieren. Angelina wird von allen schikaniert, auch vom Lagerchef Don Magnifico. Mobbing und Ausgrenzung sind auf der Tagesordnung. Mit einem obdachlosen Lumpensammler (Alidoro), der seine wenigen Habseligkeiten in einem Einkaufswagen transportiert, hat Angelina als Einzige Mitleid. Irgendwann sinkt Angelina ohnmächtig zu Boden und erlebt die eigentliche Märchengeschichte als Traum, in dem sich ihre „Arbeitskollegen“ in die Figuren der Oper verwandeln.

Und dieses „Märchen für Erwachsene“ inszeniert Axel Köhler, der renommierte Countertenor und erfahrene Regisseur, durchweg vergnüglich. Da wird das gegenseitige Angezicke von Clorinda und Tisbe bis zu handgreiflichem Slapstick auf die Spitze getrieben, da entwickeln sich die Auftritte von Don Magnifico und Dandini mit feiner, nie aufgesetzter Komik. Und die Begegnung zwischen Don Ramiro und der zur Prinzessin gewandelten Angelina trifft mitten ins Herz. Köhler findet stets die richtige Balance zwischen turbulenter Aktion und Momenten der Ruhe (in den großen Ensembleszenen. Das Schloss des Prinzen wird mit Vorhängen und Kronleuchtern bestens imaginiert, sodass der triste Hinterhof schnell vergessen ist. Arne Walther sorgte mit seinem Bühnenbild und seinen Kostümen für die stimmige Ausstattung.

Wenn der Prinz seine Angelina wiederfindet (ein Armreifen ist das Erkennungsmerkmal) kann eigentlich für das glückliche Ende nichts mehr schiefgehen. Aber irgendwie muss Köhler ja den Anschluss an den Anfang herstellen. Und der gelingt ihm überraschend stimmig, wenn auch die komödiantische und glückliche Stimmung dadurch wie durch einen Schlag in die Magengrube getroffen wird. Angelina (von einem Double gespielt) liegt tot auf dem Boden, während die anderen betroffen und trauernd um sie herumstehen. Die letzte Arie singt nur noch der (bleich geschminkte) Geist Angelinas. Die mit schwarzen Gewändern und Zylindern gekleidete Hofgesellschaft des Prinzen steht plötzlich für das Totengeleit Angelinas. Das war handwerklich gut umgesetzt und entlässt den Zuschauer mit gleichermaßen heiteren und nachdenklichen Gefühlen.

Diese Oldenburger „Cenerentola“ kann mit einer überzeugenden Ensembleleistung aufwarten. Allen voran begeistern Yulia Sokolik in der Titelpartie und Philipp Kapeller als Don Ramiro. Sokolik führt ihren purpurn gefärbten, sinnlichen Mezzo mit einem Klang wie aus Samt und Seide koloratursicher durch alle Lagen. Kapeller begeisterte schon als Tonio in der „Regimentstochter“. Auch hier kann er mit seinem höhensicheren Tenor und mit viel Stilempfinden überzeugen. Alexandra Scherrmann (Clorinda) und Melanie Lang (Tisbe) sind an Spielfreude kaum zu übertreffen. Der Spaß, den sie offensichtlich an ihren Partien haben, ist in jedem Moment spürbar. Davide Fersini (Dandini) und João Fernandes (Don Magnifico) würzen ihre Aufgaben mit viel Komik, Tomasz Wijja gibt dem Alidoro würdevolles Profil.
Wie schon bei der Ouvertüre sorgen Vito Cristofaro und das Oldenburgische Staatsorchester für eine durchgängig spritzige und lebendige Wiedergabe. Auch der Herrenchor (Einstudierung Felix Pätzold) erfüllt seinen Part tadellos. Insgesamt eine Produktion, die (bis auf den Schluss) heitere und beste Unterhaltung garantiert.
Wolfgang Denker, 06.05.2018
Fotos von Stephan Walzl
Roman Statkowski
MARIA
Premiere am 17.03.2018
Düsteres Drama um Macht und Mord

Das Oldenburgische Staatstheater ist immer gut für Überraschungen. So konnte man in jüngster Zeit etwa mit „Cristina, Regina di Svezia“ von Jacopo Foroni und „Yvonne, Princesse de Bourgogne“ von Philippe Boesmans absolute Raritäten bewundern.
Den Status einer Rarität kann auch die 1906 uraufgeführte Oper „Maria“ des polnischen Komponisten Roman Statkowski (1859-1925) für sich beanspruchen. Sowohl das Werk wie auch der Komponist dürften den meisten völlig unbekannt sein. In Polen wurde „Maria“ zwar rund ein halbes Dutzend Mal inszeniert, außerhalb Polens fand „Maria“ aber erstmalig 2011 in Wexford auf die Bühne. In Oldenburg präsentieren Regisseurin Andrea Schwalbach und Generalmusikdirektor Hendrik Vestmann nun die deutsche Erstaufführung.

Das Libretto stammt vom Komponisten und basiert auf einem Gedicht von Antoni Malczewski. Der Woiwode, Chef einer regionalen Verwaltung, wollte seinen Sohn Wacƚaw eigentlich mit der polnischen Königstochter verheiraten, um seine Macht zu stärken. Der aber hat Maria, die Tochter des Gutsbesitzers Miecznik, geheiratet. Der Woiwode schickt seinen Sohn unter fadenscheinigem Vorwand in eine Schlacht und verspricht, danach die Schwiegertochter anzuerkennen. Tatsächlich beauftragt er aber seinen Vertrauten Zmora (Henry Kiichli), Maria zu beseitigen. Als Wacƚaw von dem Mord erfährt, will er seinen Vater töten, wird aber durch die Erscheinung von Marias Geist daran gehindert. Daraufhin bringt Wacƚaw sich selber um.
Das Wunder dieser Ausgrabung ist die Musik. Manche Opern sind durchaus zu Recht vergessen - diese jedenfalls nicht! Statkowski hat seine Musik mit Herz und Leidenschaft ausgestattet. Da gibt es dramatische Zuspitzungen von elementarer Kraft, aber auch lyrische Momente voller Zauber. Ganz wunderbar sind die vielen, rein orchestralen Einschübe, die von sinfonischem Atem geprägt sind. Die großen Chorszenen erinnern an die besten Momente von russischen Opern, die Leidenschaft der Liebenden ist glutvoll wie bei Puccini. Statkowskis „Maria“ ist in ihrem musikalischen Duktus deutlich an Tschaikowsky oder auch an Rimsky-Korssakoff angelehnt. Mit dezenten Leitmotiven findet sich sogar ein Bezug zu „Tristan und Isolde“. Hier wie dort geht es schließlich um eine Liebe, die im Diesseits keine Erfüllung finden kann. Hendrik Vestmann und das Oldenburgische Staatsorchester führen die Farbigkeit und die Schlagkraft dieser Musik glänzend vor. Da gibt es von der opulenten Ouvertüre bis zum dramatischen Finale keine Schwachstelle und kein Nachlassen der Intensität.

Zu der hervorragenden Leistung von Chor (Einstudierung Thomas Bönisch) und Orchester kommt die durchweg ausgezeichnete sängerische Besetzung. Die Oper enthält vier große und dankbare Partien. Den Wojewoda zeichnet Bass-Bariton Thomasz Wija sehr eindringlich als düsteren und skrupellosen Opernschurken. Sein Sohn Wacƚaw findet in Jason Kim einen Interpreten, der die Partie mit leidenschaftlicher Glut und tenoraler Strahlkraft gestaltet. Mit dunklem und kraftvoll geführtem Bariton gibt Kihun Yoon dem Vater von Maria besonderes Profil. Die Titelpartie wird von der Gastsängerin Arminia Friebe glänzend verkörpert. Sie verdeutlicht die Liebe und die Verzweiflung der Figur, ihre Kraft und ihre Schwäche gleichermaßen.
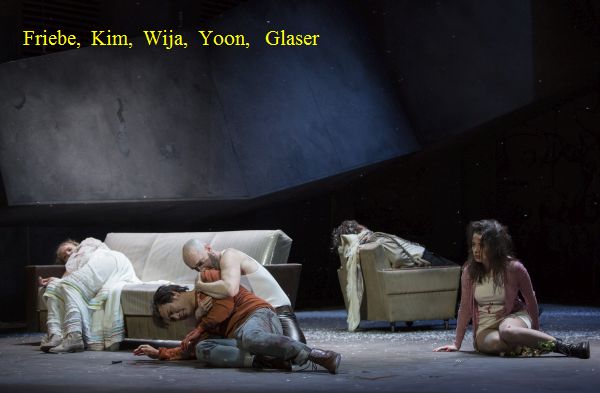
Andrea Schwalbach gelingt mit ihrer Regie eine zeitlose, eng an der Musik geführte Inszenierung, ohne dabei auf eindrucksvolle Effekte zu verzichten. Beim Mord an Maria, bei dem sie mit einer Plastiktüte erstickt wird und bis zum Eintreffen von Wacƚaw tot auf dem Sofa hängt, dringen die wie eine skurrile Karnevalsgesellschaft maskierten Häscher des Woiwoden in ihre Gemächer ein. Der Bühnenhimmel öffnet sich und Schneefall setzt ein. Anne Neuser zeichnet für die stimmige Bühnengestaltung verantwortlich.
Schwalbach zeichnet die Charaktere sehr genau. Der Woiwode ist ein skrupelloser Machtmensch, der über Leichen geht. Sein Sohn Wacƚaw ist vor Liebe so blind, dass er schnell auf die falschen Versprechungen des Vaters hereinfällt. Auch Marias Vater Miecznik scheint an ein glückliches Ende zu glauben, wenn er am Ende des zweiten Aktes in einer vor Pathos triefenden Szene freudig in den Krieg zieht. Einzig Maria scheint mit ihren Ängsten und Zweifeln dem Frieden nicht zu trauen. Sie trägt noch immer ihr Hochzeitskleid, wie ein Unterpfand ihres Glückes, das sich am Ende ja doch nicht erfüllt. Auf die Geistererscheinung Marias wird verzichtet.

Schauplatz ist ein etwas heruntergekommener Festsaal, in den eine kleine Bühne integriert ist, die später nach vorne gerollt wird. Auf ihr finden die Szenen zwischen Maria und ihrem Vater statt. Wojewoda sitzt auf einem Stuhl davor und genießt die Wirkung seiner Intrige. Die Gesellschaft beim Woiwoden ist von Angst geprägt: Es wird zwar ständig davon geredet, man solle tanzen, trinken und feiern, aber es ist eine erzwungene, unechte Heiterkeit. Auch beim Tanz zur Mazurka wirken die Menschen verkrampft. Nur Pacholę, die in ihrem roten Kleid aus der Menge hervorsticht, wagt es, mit ihrem Lied „Der Tod zerstört alle auf dieser Welt“ die tatsächliche Stimmung auszudrücken. Diese Figur wird bei Schwalbach aufgewertet, indem sie zur Gefährtin Marias wird, die am Ende sogar den Woiwoden ersticht. Britta Glaser überzeugt mit ihrem Gesang ebenso wie mit stummem Spiel. Ein Opernjuwel, das sich niemand entgehen lassen sollte!
Wolfgang Denker, 18.03.2018
Fotos von Stephan Walzl
RIGOLETTO
Premiere am 10.02.2018
besuchte Aufführung am 18.02.2018
Eine perverse Gesellschaft und ein reines Herz

Noch kürzlich war der „Rigoletto“ in Bremen (Regie Michel Talke) und Bremerhaven (Regie Andrezej Woron) zu sehen. Jetzt zeigt das Oldenburgische Staatstheater Verdis „Rigoletto“ in der Sicht von Hinrich Horstkotte, der für Inszenierung und Kostüme verantwortlich zeichnet. Bei ihm ist der Hof des Herzogs von Mantua ziemlich heruntergekommen, moralisch sowieso und auch optisch nur ein düsteres Gemäuer. Horstkotte entwirft hier das Bild einer bösen, perversen Gesellschaft, in der Korruption und Gewalt an der Tagesordnung sind. Mit abstoßender Drastik wird die Vergewaltigung der Gräfin Ceprano vorgeführt, brutal werden dem Grafen Monterone (beeindruckend schleudert Leonardo Lee seinen Fluch heraus) von Rigoletto die Krücken weggehauen.

Der Herzog zeigt sich gegenüber Frauen nur zynisch-verächtlich und lebt seine sexuellen Phantasien im letzten Akt bei der Domina Maddalena aus, die mit ihrem Bruder Sparafucile ein SM-Studio betreibt - Ausschweifungen, die er mit Gilda nie hätte realisieren können, denn die ist ein Mauerblümchen mit einem reinen Herzen. Bei Horstkotte ist nicht Rigoletto der Krüppel, sondern Gila sitzt im Rollstuhl und geht an Krücken. Rigoletto trägt Brille und Uniform, schleppt dabei ein riesiges Herz auf dem Rücken. Horstkotte will damit einen Vergleich mit Heinrich Himmler ziehen, der gleichzeitig Familienvater und NS-Scherge war. Rigoletto sieht seine Tochter als ewiges Kind und gibt ihr eine Puppe zum spielen. Das „falsche Herz“ schnallt er in seiner engen Behausung zwar ab, aber seine Vaterrolle bleibt trotzdem fragwürdig.

Die Regie arbeitet teilweise mit grellen Überzeichnungen, die aber sinnvoll ins Konzept eingebunden sind. Dazu gehören auch die phantasievollen Kostüme, von denen manche sogar in einem Horrorfilm passend gewesen wären (etwa bei Maddalena und Sparafucile). Beeindruckend sind die in zwei Ebenen gestalteten Bühnenbilder von Siegfried E. Mayer. Durch geschickten Einsatz der Drehbühne werden nahtlos immer neue Ansichten gezeigt, insbesondere die engen Gassen, in denen Gildas Entführung stattfindet. Das SM-Studio ist mehr als nur angedeutet, aber der gute Geschmack bleibt gewahrt.
 Vito Cristofaro sorgt am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters für eine bestechende Wiedergabe, bei der Tempi, Klangfarben und Dynamik zu einer so eher seltenen Einheit finden. Er hält die Spannung durchgehend und setzt oft überraschende, aber stimmige Akzente. Bei der Premiere sangen Kihun Yoon den Rigoletto und Sooyeon Lee die Gilda. Aber mit Daniel Moon als Rigoletto und Martyna Cymerman als Gilda stehen ebenfalls ausgezeichnete Sänger zur Verfügung, die ihre Partien darstellerisch und gesanglich bestens ausfüllen. Cymerman gestaltet ihr „Caro nome“ klug und sicher, wenn man es vielleicht auch schon fragiler gehört hat. Moon bringt bei „Cortigiani“ seine Emotionen anrührend über die Rampe. Besonders im großen Duett des zweiten Aktes entfalten beider Stimmen sich zu betörend strömendem Gesang. Auch Jason Kim kann mit seinem eher dunklen und virilen Tenor als Herzog durchweg gefallen, besonders bei „Ella mi fu rapita“ entwickelt sein ansonsten auch höhensicherer Tenor einen warmen und einschmeichelnden Klang. Ill-Hoon Choung ist ein düsterer, eindringlicher Mörder Sparafucile, Yulia Sokolik macht als Maddalena im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Figur. Die Partie der hier korrupten Giovanna wird durch Melanie Lang aufgewertet. In weiteren Partien bewähren sich Alwin Köblinger als Graf Ceprano, Sharon Starkmann als Gräfin Ceptano, Stephen K. Foster als Marullo und Philipp Kapeller als Borsa. Der hier auch darstellerisch geforderte Herrenchor (Einstudierung Thomas Bönisch) bewährt sich bestens.
Vito Cristofaro sorgt am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters für eine bestechende Wiedergabe, bei der Tempi, Klangfarben und Dynamik zu einer so eher seltenen Einheit finden. Er hält die Spannung durchgehend und setzt oft überraschende, aber stimmige Akzente. Bei der Premiere sangen Kihun Yoon den Rigoletto und Sooyeon Lee die Gilda. Aber mit Daniel Moon als Rigoletto und Martyna Cymerman als Gilda stehen ebenfalls ausgezeichnete Sänger zur Verfügung, die ihre Partien darstellerisch und gesanglich bestens ausfüllen. Cymerman gestaltet ihr „Caro nome“ klug und sicher, wenn man es vielleicht auch schon fragiler gehört hat. Moon bringt bei „Cortigiani“ seine Emotionen anrührend über die Rampe. Besonders im großen Duett des zweiten Aktes entfalten beider Stimmen sich zu betörend strömendem Gesang. Auch Jason Kim kann mit seinem eher dunklen und virilen Tenor als Herzog durchweg gefallen, besonders bei „Ella mi fu rapita“ entwickelt sein ansonsten auch höhensicherer Tenor einen warmen und einschmeichelnden Klang. Ill-Hoon Choung ist ein düsterer, eindringlicher Mörder Sparafucile, Yulia Sokolik macht als Maddalena im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Figur. Die Partie der hier korrupten Giovanna wird durch Melanie Lang aufgewertet. In weiteren Partien bewähren sich Alwin Köblinger als Graf Ceprano, Sharon Starkmann als Gräfin Ceptano, Stephen K. Foster als Marullo und Philipp Kapeller als Borsa. Der hier auch darstellerisch geforderte Herrenchor (Einstudierung Thomas Bönisch) bewährt sich bestens.
Wolfgang Denker, 19.02.2018
Fotos von Stephan Walzl
SIROE, RE DI PERSIA
Premiere am 02.12.2017
Liebe, Verrat und Gnade am persischen Königshof
Da ist dem Oldenburgischen Staatstheater wieder einmal eine veritable Ausgrabung gelungen. Hand aufs Herz - wer kennt schon die Oper „Siroe, re di Persia“ („Siroe, König von Persien“) von Johann Adolf Hasse? Dabei ist der Stoff, zu dem Pietro Metastasio ein Libretto schrieb, über 35mal vertont worden, darunter von Nicola Antonio Porpora, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Baldassare Galuppi, Niccolo Piccini und Tommaso Traetta. Unter all diesen war die Version von Händel am erfolgreichsten.

Die Handlung spielt im Jahr 628 n. Chr. am Hofe des persischen Königs Cosroe. Der will seinen jüngeren Sohn Medarse und nicht den erstgeborenen Siroe zu seinem Nachfolger machen. Das führt zu komplizierten Verwicklungen und Intrigen zwischen den beteiligten Personen. Dazu gehört Emira, die sich in Männerkleidung unter dem Namen Idaspe an den Hof geschlichen hat, um sich an Cosroe für den Tod ihrer Familie zu rächen. Sie liebt Siroe, der von ihrer Identität weiß und der ihre Gefühle erwidert. Laodice ist die Mätresse von Cosroe, liebt aber in Wahrheit ebenfalls Siroe. Arasse schließlich ist General der persischen Armee und der Bruder von Laodice. Er ist Siroe treu ergeben und führt Cosroes Befehl, Siroe zu töten, nicht aus. Dieser Befehl wurde ohnehin nur gegeben, weil man den unschuldigen Sirooe für einen Verräter hielt. Bei dieser Konstellation gibt es jede Menge an Intrigen, an heftigen Gefühlen wie Hass, Verzweiflung, Liebe und Todesbereitschaft mit immer neuen Kehrtwendungen. Ein Wunder, dass alles doch zu einem glücklichen Ende führt, weil die Liebe zum Vater Schlimmweres verhindert. So wird Siroe denn doch König und kann Emira heiraten, die ihrerseits auf die Rache an Cosroe verzichtet.

Regisseur Jakob Peters-Messer, der vor zwei Jahren in Oldenburg bereits Händels „Xerxes“ prachtvoll inszeniert hatte, fand auch zu „Siroe“ einen leichtfüßigen und abwechslungsreichen Zugang. Das ist bei einer Oper, bei der es keine Duette und keine Ensembles gibt und sich nur Rezitative und Arien aneinanderreihen, gar nicht so einfach. Aber er verdeutlicht alle Emotionen mit einer ausgefeilten Personenführung, die eine differenzierte Körpersprache mit einschließt, stets auf den Punkt. Und Bühnenbildner Markus Meyer, der schon den „Xerxes“ mitgestaltet hat, liefert auch hier barocken Bühnenzauber vom Feinsten. Bemalte Prospekte, die einen unendlichen Säulengang vortäuschen, weiße Elefanten aus Pappmaché, ein vom Bühnenhimmel herabschwebendes Flugobjekt und ein „Bilderrahmen“ mit Rosenblättern und orientalischen Ornamenten rund um das Bühnenportal sorgen für ein Flair wie aus 1001 Nacht.

Zu Emiras empfindsamer Arie „Non vi piacque, ingiusti dei, ch’io nascessi pasrorella“ („Ihr wolltet nicht, ungerechte Götter, dass ich als Schäferin geboren wurde“) gesellen sich Statisten mit Schafsköpfen um sie herum. Solche liebenswerten Details finden sich an vielen Stellen. Oft sind im Hintergrund auch aktuelle Bilder von zerbombten Häusern aus Syrien zu sehen oder ein Video mit bedrohlichen Rauchwolken. Das hat aber nichts mit platter Aktualisierung zu tun, sondern verdeutlicht nur, dass der König sich im Krieg befindet. Auch die phantasievollen Kostüme stammen von Markus Meyer, unter denen besonders das mit barockem Pomp gestaltete Kleid von Laodice hervorzuheben ist.
Es ist erstaunlich, wie kompetent das Oldenburger Haus Barockopern weitgehend aus dem eigenen Ensemble besetzen kann. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt und wurde aufs Neue bestätigt. Mit dem Countertenor Nicholas Tamagna steht als Siroe ein ausgezeichneter Sänger zur Verfügung, der mit mal makellos schwebenden, mal mit ausdrucksintensiven Tönen die Riesenpartie nicht nur durchsteht, sondern von Anfang bis Ende auch bezwingend gestaltet.

Philipp Kapeller beweist als Cosroe mit seinem höhensicheren und wandlungsfähigen Tenor einmal mehr seine Vielseitigkeit. Dem Medarse (eigentlich auch eine Rolle für Countertenor) gibt die prachtvolle Yulia Sokolik mit schimmerndem Mezzo ein eher sanftes Profil. Die Emira gestaltet Hagar Sharvit mit einer breiten Palette an Emotionen. Myrsini Margariti besticht als Laodice mit einem Feuerwerk schwierigster Koloraturen. Martyna Cymerman kehrt als Arasse mit leuchtendem Sopran mehr den treuen Freund als den General heraus.
Mit Wolfgang Katschner steht ein ausgewiesener Barock-Fachmann am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters. Das hat sich ganz auf den barocken Klang eingestellt und musiziert, teilweise auf historischen Instrumenten, äußerst subtil und feinsinnig. Hasses individueller Orchestersatz mit ihren beredten Streicherfiguren kommt bestens zur Geltung. Barock-Oper in Oldenburg – das ist immer wieder ein Ereignis!
Wolfgang Denker, 03.12.2017
Fotos von Stephan Walzl
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Premiere am 29.10.2017
Eine moderne Leidensgeschichte
Was für ein Abend! Standing Ovations und rhythmisches Klatschen bis zum Abwinken - eine Publikumsbegeisterung, wie man sie seit vielen Jahren in Oldenburg nicht erlebt hat. Der Anlass war das Musical „Jesus Christ Superstar”, das in einer hinreißenden Produktion präsentiert wurde. Andrew Lloyd Webber war bei der New Yorker Uraufführung seines Musicals “Jesus Christ Superstar“ im Jahr 1971erst 23 Jahre alt und noch weitgehend unbekannt. Mit dieser „Rockoper“ begann sein Weltruhm, den er mit populären Stücken wie „Evita“, „Cats“, „Starlight Express“, „Phantom der Oper“ oder „Sunset Boulevard“ festigte. Aber schon „Jesus Christ Superstar“ ist ein ausgesprochener Geniestreich und genießt bis heute besonderen Kultstatus.

Andrew Lloyd Webber hat sein Werk als „Rockoper“ bezeichnet. In Oldenburg hat man den Focus mehr auf „Rock“ und weniger auf „Oper“ gelegt, was sich vor allem in der Wahl der Fassung ausdrückt. Es gibt kein großes Orchester, lediglich fünf (ausgezeichnete!) Musiker kommen um Einsatz: Jürgen Grimm (Keyboard und Leitung), Tobias Deutschmann (Keyboard), Peter Engelhardt (Gitarre), Rainer Wind (Bass) und Robert Walla (Schlagzeug). Damit ist eine tolle Band aufgeboten, die im Hintergrund auf einer erhöhten Spielfläche agiert. Die Musiker liefern Sound und Drive von allererster Güte und servieren die Songs von Andrew Lloyd Webber sehr eindringlich, spielen dabei wirklich rockig und fetzig.

Die musikalische Fassung korrespondiert bestens mit der Interpretation von Regisseur Erik Petersen. Hier geht es um Starkult. Petersen hat die Geschichte sinnvoll in die heutige Zeit verlegt und aus Jesus von Nazareth den Frontsänger einer Rockband gemacht „The Prophets“ nennt sie sich. Zu den Bandmitgliedern zählen auch Judas Ischariot, Petrus und Maria Magdalena. Jesus ist in seinem schwarzen Büßergewand eine charismatische Persönlichkeit mit Weltverbesserungs-Visionen, die von seinen fanatischen Fans bejubelt wird. Er selbst aber ist ein ausgebrannter Mann, der am Ende seiner Kräfte angelangt ist, von Selbstzweifeln getrieben wird und sein nahes Ende spürt. Gleich zu Anfang sieht man ihn bei einem Auftritt mit seiner Band, zu dem er sich regelrecht überwinden muss. Petersen zeigt die Szene aus einer gelungenen Perspektive: Die Musiker und der Sänger stehen mit dem Rücken zu den Theaterzuschauern und spielen für ein imaginäres Publikum im Hintergrund. Wir befinden uns quasi im Backstage-Bereich. Dort tummeln sich dann die Mitglieder der Rockband. Die Ausstattung von Sam Madwar zeigt eine attraktive Showbühne, die sich am Ende aber zu einem Kabinett des Schreckens wandeln soll.

Die Verlegung in das Milieu von Popstars ist dabei bestens gelungen und beißt sich auch nicht mit dem Text. Petersen wirft ein Schlaglicht auf den modernen Starkult. Auch Popstars werden von ihren Fans oft wie ein Messias verehrt und dann ebenso schnell wieder fallengelassen. Wie leicht die Massen zu beeinflussen sind und wie dicht hysterische Begeisterung und fanatischer Hass beieinander liegen, wird in dieser Inszenierung erschreckend deutlich. Judas ist dabei nicht einfach nur der Verräter, sondern ein kritischer Beobachter, der deutlich spürt, dass die Ideale von Jesus zunehmend dem Starkult geopfert werden. Die Regie bleibt der Spritzigkeit und der Turbulenz, die von einem Musical erwartet werden, nichts schuldig, was sich auch in der lebendigen Choreographie von Yoko El Edrisi und in der ironisierenden Personenführung etwa von Herodes und dem Priester Kaiphas ausdrückt. Aber von der Auspeitschung Jesu bis hin zur finalen Kreuzigung schlägt die Stimmung um. Zwar ist das Kreuz mit roten Lampen ausstaffiert, aber die Szene wird so intensiv gestaltet, dass am Schluss nur noch das Mitleid mit einer wahrhaft geschundenen Kreatur bleibt. Dieses bedrückende Ende geht direkt unter die Haut. In dieser tief berührenden letzten Szene hat sich Regisseur Petersen von der falschen Glanzwelt des Showbusiness verabschiedet.

Getragen wird die Aufführung von einem hervorragenden Ensemble, allen voran von Oedo Kuipers in der Titelpartie. Er gestaltet seinen Part mit flexibler, wandlungsreicher Stimme und bestechender Bühnenpräsenz. Den Charakter der Figur zwischen Verzweiflung, Jähzorn und Zuversicht zeichnet er mit feinsten Nuancen. Sein „I only want to say“ ist einfach begeisternd. Nicht weniger eindrucksvoll agiert Rupert Markthaler als sein Gegenspieler Judas Ischariot, der gesanglich wie darstellerisch die Vielschichtigkeit der Figur verdeutlicht. Aus dem Opernensemble sind Martyna Cymerman (Magdalena), Paul Brady (Herodes) und Henry Kiichli (Kaiphas) dabei. Maria Magdalena wirkt zunächst wie ein Groupie, hat aber doch echte Gefühle für Jesus. Martyna Cymerman verleiht ihnen mit ihrer Ballade „I don’t know how to love him“ mit seidigem Sopranglanz tiefen Ausdruck - ein besonderer Höhepunkt. Paul Brady hat sich den Musical-Ton ganz zueigen gemacht und liefert mit „Try and see“ als Herodes eine schillernde und perfekte Show-Nummer. Herodes wird von Kaiphas protegiert, der wie ein konkurriender Impresario daherkommt, aber von Henry Kiichli nicht optimal gesungen wird. Mark Weigel kann als zynischer Pontius Pilatus überzeugen, Kim David Hammann ist als Petrus rollendeckend. Der Chor in der Einstudierung von Thomas Bönisch gefällt mit Klangfülle und sehr individualisiertem Spiel.
Wolfgang Denker, 31.10.2017
Fotos von Stephan Walzl
DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
Premiere am 14.10.2017
besuchte Aufführung am 21.10.2017
Nur noch eine triviale Liebesgeschichte

Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ wurde in Oldenburg zuletzt 2004 gespielt. Die neue Opernpremiere trägt zwar den gleichen Namen, aber im Grunde ist es ein Stück der Regisseurin Kateryna Solokova mit der Musik von Mozart. Sie hat die Geschichte komplett umgeschrieben und im Programmheft eine Inhaltsangabe geliefert, die mit „Entführung“ und „Serail“ nichts mehr zu tun hat. Konstanze und Bassa Selim sind hier ein turtelndes Liebespaar. Der Bassa will sich mit Konstanze im Rahmen einer von Blonde vorbereiteten Party verloben. Auch Pedrillo und Osmin gehören zum Personal des Bassa. Pedrillo ist eine Art Kammerdiener und Osmin ein psychisch gestörter Mann, der sich in Bücher flüchtet und in seinen Henkers-Phantasien verirrt. Als Belmonte auftaucht (hier ist er der ehemalige Liebhaber Konstanzes) und bei Konstanze Zweifel über ihre Gefühle für den Bassa auslöst, wird die Verlobung gekippt.

Solokova hat sich völlig neue Dialoge ausgedacht, damit ihre Sicht der Dinge einigermaßen mit den Arien harmoniert. Das klappt aber nicht immer wirklich. Ein „psychologisches Kammerspiel“ hat sie angestrebt, es bleibt aber eine triviale Liebesgeschichte, an der Rosamunde Pilcher sicher ihre Freude gehabt hätte. Dazu passend ist das Bühnenbild von Christian Andre Tabakoff, das ein schickes Landhaus mit Ausblick auf eine liebliche Landschaft zeigt. Konflikt der Kulturen? Humanistischer Großmut? Alles Fehlanzeige. Statt dessen fuchtelt Bassa Selim am Ende nur hilflos mit einer Pistole herum und bleibt frustriert zurück.
Vollkommen überzeugend ist die Leistung des Oldenburgischen Staatsorchesters unter Vito Cristofaro, der (schon bei der mit schnellem Tempo genommenen Ouvertüre) mit geschärftem und oft dramatisch zugespitztem Mozart-Klang überzeugt. Bei den Solisten steht Sooyeon Lee als Konstanze im Mittelpunkt, die ihren Arien emotionalen Tiefgang gibt und ihre Koloraturen virtuos bewältigt. Philipp Kapeller singt den Belmonte, der hier mit seiner Brille eher wie ein Beamter wirkt; mit bemerkenswerter Kultur und sicher ansprechendem Tenor.

Alexandra Schermann gibt mit ihrem agilen und aufstrahlenden Sopran eine beherzte Blonde, während Timo Schabel als Pedrillo in der Höhe kleine Probleme hat. Ill-Hoon Choung gibt den Osmin im Sinne der Regie rollendeckend, aber mitunter fehlt es ihm an Volumen. Auch Johannes Sima folgt als Bassa Selim dem Konzept der Regie und gibt ihn als smarten Jüngling.
Wolfgang Denker, 22.10.2017
Fotos von Stephan Walzl
DIE WALKÜRE
Premiere am 09.09.2017
Wir bleiben im Bergdorf
Mit der „Walküre“ wurde nun der zweite Streich im Oldenburger Projekt eines kompletten „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner bewältigt. Dabei ist „bewältigt“ eigentlich ein zu schwacher Ausdruck: Dem Oldenburgischen Staatstheater ist musikalisch und szenisch eine von der ersten bis letzten Sekunde fesselnde Aufführung gelungen, deren Niveau und deren Konsequenz an größten Häusern bestehen könnte.

Regisseur Paul Esterhazy entführte bei der „Rheingold“-Premiere in die Welt eines alpinen, abgeschiedenen Bergdorfs. Auch in der „Walküre“ bleibt er in diesem Bergdorf. Man sieht auch wieder die von Mathis Neidhardt entworfenen Räume, die mittels Drehbühne naht- und pausenlos ineinander übergehen und um die in vollem Laub stehende Esche gruppiert sind - das eheliche Schlafzimmer des „Bauern“ Wotan und seiner wieder im Rollstuhl sitzenden Gattin Fricka, die Stube beim gemeinsamen Frühstück oder die Diele mit den aufgebahrten Leichen, die ständig von den Walküren angeschleppt werden und in der sie sich nach getaner Arbeit zur Brotzeit versammeln. Die Verwandlung der Räume vollzieht sich dabei immer sinnvoll und fast unmerklich, unterstützt von einer phantastischen Lichtregie (Ernst Engel), bei der die Bühne oft in geheimnisvolles Halbdunkel getaucht und von sanften Nebelschleiern eingehüllt wird. Sogar die Assoziation einer Waldlandschaft wird dadurch möglich.

Esterhazy lässt auch die im Text erwähnten Tiere auftreten. Bei der Gewitterszene zu Beginn sieht man schemenhaft ein Wolfsrudel, Sieglinde und Siegmund tragen Wolfskostüme, der Bär, den Siegfried später fangen wird, ist zu sehen, Hunding führt seinen Schäferhund an der Leine und in einem Käfig sitzt der spätere Waldvogel. Esterhazy weist in seiner Inszenierung sehr kunstvoll auf vergangene und auf zukünftige Elemente der Handlung hin. Alles greift sinnvoll ineinander über. So geistert bereits hier schon Erda über die Bühne, etwa wenn Wotan seiner Tochter Brünnhilde eröffnet, dass diese ihre Mutter ist. Grane ist ein „Begleiter“ Bünnhildes, ein Greis auf Krücken, der am Ende die Wache vor ihrer feurigen Lagerstatt übernimmt. Esterhazys Personenführung ist bis ins kleinste Detail ausgefeilt. Wann hat man den langen Monolog Wotans im zweiten Akt je so kurzweilig, geradezu spannend erlebt wie hier, bei einer „Plauderei“ am Frühstückstisch? Auch Kleinigkeiten zeugen von der Akribie, mit der Esterhazy zu Werke gegangen ist. Beim Walkürenritt sind nicht alle Walküren auf der Bühne, einige sind noch im Rang. Und die „Hojotoho“-Rufe dienen hier zur Verständigung über große Entfernungen in der Bergwelt. Es ist eine Inszenierung, die in sich stimmig ist und das im „Rheingold“ begonnene Konzept konsequent weiterentwickelt hat. Man darf auf den „Siegfried“ und die „Götterdämmerung“ mehr als gespannt sein.

Auch musikalisch erweist sich die Oldenburger Walküre als hochrangig. Hendrik Vestmann und das Oldenburgische Staatsorchester haben ein kleines Wunder bewirkt. Selten hat man die vom Gewittersturm durchtoste Eingangsszene so kraftvoll musiziert und mit solch elementarer Gewalt umgesetzt erlebt. Vestmann und das Orchester spielen durchgängig auf hohem Niveau. Allein Wotans Abschied wird mit einer berauschenden Klangpracht aufgefächert, dass man nur Staunen kann. Auch in Bezug auf Tempo und Dynamik kann man die Szene (und nicht nur diese) kaum besser machen. Beim Schlußbeifall zeigt sich das Orchester denn auch komplett und völlig zu Recht auf der Bühne.

Ohne Gäste geht eine „Walküre“ in Oldenburg natürlich nicht. So gibt Nancy Weißbach eine Brünnhilde mit Stahl in der Stimme, mit einer Leuchtkraft, die sich stets über dem Orchester behauptet. Wie Raketen feuert sie ihre Spitzentöne ab und gibt der Rolle zudem ein attraktives, glaubhaftes Profil. Als Wotan hinterlässt auch Michael Kupfer-Radecky einen denkbar besten Eindruck. Mit hervorragender Diktion, mit substanzreicher Pianokultur, aber auch mit großen Bögen voller Volumen bleibt er der Partie nichts schuldig - erschütternd sein Wunsch nach dem Ende und der schmerzvolle Abschied von Brünnhilde. Zoltán Nyári braucht ein paar Momente, um seinen höhensicheren Tenor von „lyrisch“ auf „heldisch“ umzuschalten, aber dann schmettert er kraftvoll sein „Ein Schwert verhieß mir der Vater“ mit den mühelosen Wälse-Rufen und findet in den „Winterstürmen“ zu innigem Ausdruck. Nadja Stefanoff hat sich vom belcantogeschulten Mezzo zum lyrisch-dramatischen Sopran (etwa als Tosca in Bremen) entwickelt.

Ihre Sieglinde glüht geradezu vor Leidenschaft, die von ihrer dunklen Stimmfarbe noch verstärkt wird. Großartig allein wie ihr emotionaler Ausbruch „O hehrstes Wunder“ in den Raum bricht. Der international gefragte Pavel Shmulevich (er singt u.a. am Mariinsky-Theater) gibt mit sehr metallischem Bass und erzener Wucht den Hunding als kaltherzigen Schurken. Aus dem eigenen Ensemble behauptet sich Melanie Lang als Fricka mit starker Persönlichkeit, der sich sogar Wotan beugen muss. Stimmgewaltig zeigt sich auch die Walküren-Schar mit bewährten Kräften des Hauses.
Wolfgang Denker, 11.09.2017
Fotos von Stephan Walzl
CARMEN
Premiere am 27.05.2017
Ein Showstar im Pariser Bordell
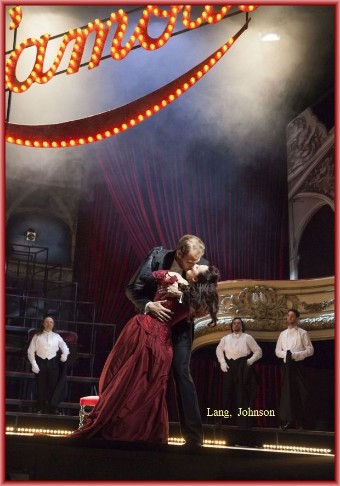
In Oldenburg spielt Bizets „Carmen“ nicht in Sevilla, sondern in einem Etablissement namens „L’amour“, einer Mischung aus Varietétheater und Bordell. Regisseur Robert Lehmeier verlegt die Handlung in das Paris der Uraufführungszeit (1875). Carmen ist unter den Halbweltdamen eine Art Showstar - ihre Habanera gerät zur effektvollen Shownummer, bei der sie vom Bühnenhimmel schwebt. Diese Carmen-Figur ist nicht nur die stolze, von Freiheitsliebe geprägte Frau, sondern in erster Linie ein Wesen, das die Gelüste der Männer in gezielter und kalkulierter Weise erfüllt. Der „Tanz“ im zweiten Akt beschränkt sich darauf, dass sie am Boden liegt und die Beine breit macht. Und die männliche Gesellschaft, die sie bedient, ist eine Schar von voyeuristischen Herren, die alle uniform in Frack und Zylinder das Etablissement bevölkern. Ihre Bewegungen sind weitgehend synchron, ob sie nun den Arm ausstrecken, die Jacke ausziehen, den Zylinder lüften, auf eine Stufe steigen oder ihren Hosenstall schließen. Und ihren Nachwuchs haben sie auch gleich mit in den Puff genommen: Auch der Kinderchor tritt in Frack und Zylinder auf - man muss schließlich fürs Leben lernen.

Lehmeiers Inszenierung hat durchaus ihre Meriten, sie bewegt sich stets in einem sehr ästhetischen Rahmen. Dazu trägt auch das opulente, durchgängig beibehaltene Bühnenbild von Stefan Rieckhoff bei, das den Zuschauerraum des Staatstheaters auf der Bühne mit Rang und Showtreppe gekonnt fortsetzt. Die Ausstattung ist wirklich sehenswert, auch wenn sie als Rahmen eher für „Die lustige Witwe“ als für „Carmen“ geeignet ist. Zudem kommt, dass Inszenierung und Text doch oft auseinanderklaffen. Und seit wann gibt es in Frankreich Stierkämpfe? Der Auftritt Escamillos gerät ziemlich blass, für Micaëla gibt es dafür eine neue Sicht. Den Kuss der Mutter übermittelt sie nicht keusch, sondern sofort und leidenschaftlich fordernd. Im dritten Akt schleppt sie sich sterbend auf die Bühne. Am Ende ist es mit der Party-Stimmung vorbei: Die Auseinandersetzung zwischen Carmen und Don José ist derart packend inszeniert, dass die Änderungen von Raum und Zeit dank der hervorragenden Sängerleistungen sofort vergessen sind. Es ist ein Kampf - nein nicht bis auf Messer, sondern bis zum finalen Pistolenschuss - der atemberaubend intensiv gestaltet ist.

Mit Melanie Lang als Carmen und Evan LeRoy Johnson als Don José steht ein stets überzeugendes Protagonistenpaar zur Verfügung. Lang spielt alle Vorzüge ihres dunklen, sehr sinnlichen Mezzos voll aus. Die Habanera hätte vielleicht noch mehr wie ein Chanson angelegt sein können, aber die stimmliche Wucht und die optische Präsenz, die sie der Partie verleiht, trägt den ganzen Abend. Johnson erweist sich (darstellerisch eher zurückhaltend) als ein Sänger, der die Partie kraftvoll mit Glanz, Leidenschaft und Sinn für Zwischentöne mitreißend gestaltet. Sein individuelles Timbre, seine sichere Höhe und die gut dosierten Ausbrüche sorgen für eine restlos gute Erfüllung der Partie. Seine „Blumenarie“ führt zu begeistertem Zwischenbeifall. Als Micaëla kann Anna Avakian mit kraftvoll und sicher geführtem Sopran der Figur besondere Prägung geben. Aber sie gibt stimmlich manchmal zuviel und der Liebreiz der Partie geht dabei etwas verloren. Der Escamillo ist eigentlich eine undankbare Partie.

Den eitlen, narzisstischen Charakter der Figur kann Tomaz Wija nur teilweise vermitteln, zumal seine Stimme in der Höhe nur noch über wenig Volumen verfügt. Eine ansprechende Ensembleleistung wird von Timo Schabel (Remendado), Paul Brady (Dancaïro), Ill-Hoon Choung (Zuniga), Aarne Pelkonen (Moralès) Martyna Cymerman (Frasquita) und Hagar Sharvit (Mercédès) geboten. Opernchor und Extrachor (Thomas Bönisch) sowie der Jugendchor KlangHelden (Thomas Honickel) überzeugen mit Klangfülle und Präzision. Das kann man auch über die Leistung des Oldenburgischen Staatsorchesters unter Hendrik Vestmann sagen, der der Musik von Bizet den richtigen Schwung, aber auch delikate Feinabstimmung mit auf den Weg gibt. Bei den dramatischen Teilen scheut er sich aber auch nicht, es ordentlich „krachen“ zu lassen. Durch den kompletten Verzicht auf die Dialoge reiht sich eine Musiknummer nahtlos an die andere. Das ist kein Nachteil.
Wolfgang Denker, 28.05.2017
Fotos von Stephan Walzl
YVONNE, PRINCESS DE BOURGOGNE
Premiere am 25.03.2017 besuchte Aufführung: 06.04.2017
Eine Gesellschaft entlarvt sich selbst

Es ist eher ungewöhnlich, dass die Titelfigur in einer Oper eine stumme Rolle ist. In „La Muette di Portici“ von Auber ist das so und in der in Oldenburg als deutsche Erstaufführung präsentierten „Yvonne, Princesse de Bourgogne“ von Pilippe Boesmans (Libretto von Luc Bondy und Marie-Louise Bischofberger) ist es auch fast so. Yvonne gibt, bis auf ganz wenige Worte, keinen Ton von sich. Dabei ist sie ständig auf der Bühne - und alles dreht sich nur um sie.
Als Vorlage für die 2009 in Paris uraufgeführte (und in Wien nachgespielte) Oper diente das gleichnamige Schauspiel von Witold Gombrowicz aus den 30er Jahren. Yvonne ist ein hässliches, plumpes und vor allem sehr schweigsames Mädchen. Aus purer Langeweile verlobt sich Prinz Philippe mit ihr. Lethargie scheint Yvonnes vorherrschendes Lebensgefühl zu sein. Das provoziert den Hofstaat, der sich zunehmend von ihrer bloßen Existenz bedroht fühlt. Auch der Prinz wird ihrer überdrüssig und verlobt sich mit Isabelle. Man beschließt, Yvonne auf „elegante“ Art zu ermorden, indem man ihr einen Barsch serviert, an dessen Gräten sie prompt erstickt. Nach einem kurzen „Lacrimosa“, mit dem die Oper endet, scheint man wieder zur Tagesordnung übergehen zu können.

Aber das darf bezweifelt werden, denn Yvonne hat in der Hofgesellschaft wie ein Katalysator gewirkt und zum Ausbruch von Streit, Aggression und der Abrechnung mit eigenen Schwächen geführt. Es ist ein ernstes und immer aktuelles Thema, das hier in der Form einer Farce mit durchaus auch heiteren Elementen angerissen wird. Wie reagiert eine Gesellschaft auf das Fremde? Warum ist es oft blanker Hass und Ablehnung? In „Yvonne, Princesse de Bourgogne“ hat sich die Gesellschaft jedenfalls selbst entlarvt.

Regisseurin Andrea Schwalbach geht in ihrer Inszenierung noch einen Schritt weiter, indem sie die Verhältnisse einfach umkehrt. Yvonne ist hier keineswegs ein hässliches Wesen, sondern ein zwar leicht debiles, aber liebenswertes Mädchen, das eigentlich Schutz und Fürsorge benötigt. Der Hofstaat, der als eitle, bigotte Gesellschaft gezeichnet wird und somit in Wahrheit das Hässliche repräsentiert, kann ihr das nicht geben. Hier triumphiert die Unmenschlichkeit. Die Frage, was „normal“ ist, hängt eben immer vom Blickwinkel und von den Verhältnissen ab. Diese Quintessenz kommt in der insgesamt kurzweiligen und temporeichen Inszenierung klar zum Ausdruck. Schwalbach inszeniert nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern spielt auch die komischen, grotesken Momente aus. Der König und sein Kammerherr etwa hätten auch in einer Offenbach-Operette oder in der Muppet-Show eine gute Figur gemacht. Und wenn Yvonne sich ein Tütü überstreift und ein paar hilflose Ballettschritte macht, weil sie sich nicht anders artikulieren kann, hat das etwas Rührendes.

Das phantasievolle Bühnenbild von Anne Neuser (sie sorgte auch für die ausgefallenen Kostüme) spielt mittels Projektionen durchgehend mit dem Fischmotiv und wird im Schlussakt gekrönt von einem riesigen Fischskelett mit gefährlichen Reißzähnen. Der weiße Hai lässt grüßen.
Das Markenzeichen der Musik von Pilippe Boesmans ist Eklektizismus. Er illustriert die Handlung mit vielen Anleihen und vielen Stilen. Im ersten Teil wirkt diese Musik noch etwas konstruiert, in der zweiten Hälfte gewinnt sie an Farbigkeit. Von Händel und Debussy bis zum zackigen Kosakenlied geht es im Geschwindmarsch durch die Epochen. Das Grummeln der tiefen Blechbläser und das flirrende Glissando der Geigen liefern beredte Kommentare, die von Vito Cristófaro mit dem Oldenburgischen Staatsorchester sorgfältig artikuliert werden.
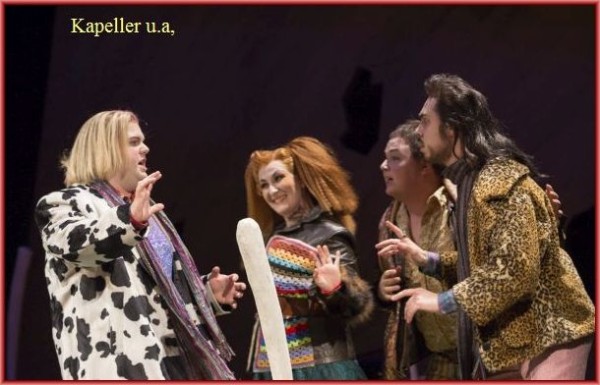
In der Rolle der Yvonne kann Nientje C. Schwabe mit einer ausdrucksvollen Körpersprache überzeugen. Philipp Kapeller ist mit gleißendem Tenor der Prinz, Tomasz Wija und Paul Brady liefern als König und Kammerherr wahre Kabinettstückchen. Sarah Tuttle gibt die Parodie einer Regentin und greift dabei zu etwas schrillen Tönen. Hagar Sharvit ist eine flippige Isabelle. Tadellos erfüllt der von Thomas Bönisch einstudierte Chor seine Aufgaben, insbesondere im Lach-Ensemble.
Wolfgang Denker, 07.04.2017
Fotos von Stephan Walzl
DAS RHEINGOLD
Premiere am 04.02.2017
Szenen aus einem Bergdorf

Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ am Oldenburgischen Staatstheater - das klingt abenteuerlich. Und es ist auch erstmalig, dass sich das Theater in seiner langjährigen Geschichte an die gesamte Tetralogie wagt. Seit dieser Spielzeit ist Hendrik Vestmann neuer Generalmusikdirektor in Oldenburg. Er stellt sich der immensen Herausforderung eines kompletten „Rings“. Geplant ist eine Produktion pro Saison. Mit dem „Rheingold“ fiel nun der Startschuss des ehrgeizigen Projekts.
Schon während des geheimnisvollen Vorspiels in Es-Dur hebt sich der Vorhang. Man erblickt Alberich, der auf einem Plumpsklo thront und sich mit Pornos aufgeilt, um dann den Rheintöchtern an die Wäsche zu gehen. Diese Rheintöchter sind hier aber Waschfrauen im Dienste Wotans. Ihre Aufgaben sind vielfältig - auch das Waschen einer Leiche gehört dazu.

Regisseur Paul Esterhazy hat dem „Rheingold“ alles Mythologische ausgetrieben. Die Götterwelt wird durch die dunkle, bedrückende Atmosphäre eines abgeschiedenen Bergdorfes ersetzt. Wotan ist ein herrischer Bauer, Froh der Pfarrer, Loge ein vagabundierender Landstreicher, Donner der Schmied, Erda eine Dorfwahrsagerin, Fricka eine verhärmte Frau im Rollstuhl und Alberich der verachtete Nachbar. Wenn man sich mit diesem Konzept erst einmal angefreundet hat, geht es überraschend gut auf.
Halbdunkel ist die vorherrschende Lichtstimmung: „Das Rheingold“ als Nachtstück. Mathis Neidhardt arbeitet bei seiner Bühnenausstattung pausenlos mit der Drehbühne. Er hat immer neue Räume von klaustrophobischer Enge entworfen - vom Schlafzimmer der Eheleute Wotan und Fricka über die Wohndiele und die Waschküche bis hin zu Alberichs Reich im Keller. Und es sind überwiegend dunkle Kammern. Die haben in ihrer Gesamtheit fast den Charakter eines Labyrinths, nicht nur physisch, sondern auch als Nistplatz für seelische Abgründe.

Und davon gibt es genug, denn jede der Figuren ist in Esterhazys Inszenierung beschädigt an Körper oder Gemüt. Sie werden vom Regisseur prägnant gezeichnet. Und er blättert die Handlung in ruhigem Erzählfluss auf, wobei er ironische und drastische Momente mischt. Fafner und Fasolt sind bei ihm wirkliche Riesen, die auf Stelzen über die Bühne laufen, die Verwandlung Alberichs in eine Kröte wird augenzwinkernd serviert. Blutig geht es zu, wenn Alberich der Unterarm abgeschlagen wird. Das Ende weist auf die Fortsetzung mit der „Walküre“ hin: Wotan stößt das Schwert Notung in die Esche, das Siegmund später wieder herausziehen wird. Siegmund und Sieglinde sind hier schon als Babys zu sehen.
Dass ein kleineres Theater auch musikalisch Wagner-Opern stemmen kann, wenn es denn über ein gutes und um einige Gäste verstärktes Ensemble, ein motiviertes Orchester und einen Dirigenten mit Gestaltungswillen verfügt, wurde in Oldenburg eindrucksvoll bewiesen. Bei den Solisten ist an erster Stelle Johannes Schwärsky zu nennen, der den Alberich zur Hauptfigur der Oper beförderte. Seine unglaublich präsente und suggestive Darstellung in Verbindung mit kraft- und ausdrucksvollem Gesang fesselte durchgehend.

Die Szenen, in der er die Liebe und später den Ring verflucht, gehörten zu den Höhepunkten des Abends. Daniel Moon führte als Wotan einen schlanken und markanten Bariton ins Feld, der aber für die Partie doch vielleicht eine Spur zu schmal ist. Melanie Lang war als Fricka eine gute Besetzung, die gesanglich mit ihrem fülligen Mezzo ein gutes Gegengewicht zu Wotan darstellte. Der Loge wurde von Timothy Oliver mit geschliffenem Tenor präsentiert, hätte aber durchaus noch etwas verschlagener sein können. Ein fulminanter Auftritt gelang Ann-Beth Solvang als Erda mit pastoser, raumfüllender Stimme. Die Riesen Fafner und Fasolt fanden in Ill-Hoon Choung und besonders Randall Jakobsh bassgewaltige Interpreten. Gut waren das Spiel und der Zusammenklang der Rheintöchter Sooyeon Lee, Anna Avakian und Julia Faylenbogen. Tadellose Leistungen gab es von Philipp Kapeller als lyrischem Froh, Aarne Pelkonen als Donner, Sarah Tuttle als Freia und Timo Schabel als Mime.

Die Gretchenfrage bleibt aber, wie das Orchester die Aufgabe bewältigt. Im „Rheingold“ ist das schon mal gut gelungen. Hendrik Vestmann blieb in der (von Wagner autorisierten) Besetzung mit 65 Musikern dem Werk nichts schuldig. Der Klang konnte sich in feiner Differenzierung entfalten. Vestmanns Dirigat zeichnete sich durch ruhig strömenden Fluss aus. Die dramatischen Akzente setzte er äußerst wirkungsvoll, großartig die Verwandlungsmusik, zu der Wotan und Loge nach Nibelheim hinuntersteigen. Insgesamt zeigte sich das Orchester den Anforderungen bestens gewachsen. Ob das bei den nachfolgen Teilen der Tetralogie auch so gut gelingen wird, bleibt eine spannende Frage.
Wolfgang Denker, 06.02.2017
Fotos von Stephan Walzl
LA FILLE DU RÉGIMENT
Premiere am 02.12.2016
Perfektes Vergnügen
„La Fille du régiment“ („Die Regimentstochter“) von Gaetano Donizetti - das ist die Oper mit der berühmtem Tenor-Arie, die neun hohe C’s in Folge verlangt. Man hat sie etwa von Luciano Pavarotti oder Juan Diego Florez im Ohr - also keine leichte Aufgabe für Philipp Kapeller, der die Partie des Tonio in Oldenburg singt. Und wie er die Herausforderung mit seinen stimmlichen Mitteln besteht, ist grandios. Dabei gelingt es ihm sogar, die exponierten Töne ganz in die Gesangslinie einzubinden. Oder um es „militärisch“ auszudrücken: Donnerwetter, tadellos!

Marie ist die Regimentstochter, die von Soldaten als Baby gefunden und von ihnen aufgezogen wurde. Die Marquise de Berkenfield entpuppt sich als Maries Mutter. Sie holt Marie auf ihr Schloss und will sie standesgemäß verheiraten. Sehr zum Unwillen Maries, die sich in den Tiroler Burschen Tonio verliebt hat und zudem von Sehnsucht nach ihren „Vätern“, nämlich den Soldaten des französischen Regiments, geplagt wird. Nach einigen Wirren und Enthüllungen findet aber alles zum glücklichen Ende.
Die Produktion wurde als „halbszenisch“ angekündigt. Das Orchester sitzt auf der Bühne und die sechs Stühle für die Solisten deuten tatsächlich zunächst auf eine konzertante Aufführung hin. Aber weit gefehlt! Regisseur Felix Schrödinger ist mit wenigen Mitteln eine perfekte Inszenierung gelungen, die das Werk mit leichter, komödiantischer Hand vergnüglich serviert, die an Turbulenz und sinnlichem Vergnügen kaum zu überbieten ist.

Sie ist zudem mit äußerst feinsinnigem Humor angereichert, bei dem es auf jede Gestik, jede Mimik und auf tausend Kleinigkeiten ankommt. Das beginnt schon mit Stefan Vitu, der einen lustlosen, frustrierten und immer wieder unterbrochenen Erzähler mimt - und der auch schon mal seinen Einsatz „verschläft“. Die Auf- und Abmärsche der Soldaten in ihren bunten Uniformen (Kostüme von Josefine Smid) sind einfach köstlich gelungen. Wenn Marie von den Soldaten Abschied nimmt, müssen die ganz viele Taschentücher zücken.Die augenzwinkernd gezeichnete Welt des Militärs und die Rokoko-Steifheit an dem mit treffenden Requisiten charakterisierten Hof der Marquise geben einen reizvollen Kontrast. Eine witzige Gesangsstunde, bei der Marie aber immer wieder das Lied des Regiments anstimmt, erinnert an den „Barbiere di Siviglia“.

Sooyeon Lee ist als Marie ein wahrer Glücksfall. Die koreanische Sopranistin ist Preisträgerin mehrerer Gesangswettbewerbe und neu im Oldenburger Ensemble. Ihr leicht ansprechender und sehr beweglicher Sopran klingt in allen Lagen rund und leuchtend. Als anmutige und resolute Darstellerin erobert sie alle Herzen im Sturm. Zusammen mit Philipp Kapeller sorgt sie für die gesanglichen Höhepunkte der Aufführung. Hagar Sharvit ist mit ausdrucksvollem Mezzo als Marquise alles andere als eine „adlige Schreckschraube“, sondern eine attraktive Frau, die sich ihrer Wirkung bewusst ist und am Ende mit Sulpice, dem Anführer des Regiments, zusammenfindet. Den stattet Ill-Hoon Choung mit Charme und satten Basstönen aus. Aarne Pelkonen ist als Hofmeister der Marquise, Paul Brady in der kleinen Rolle eines Korporals zu hören.
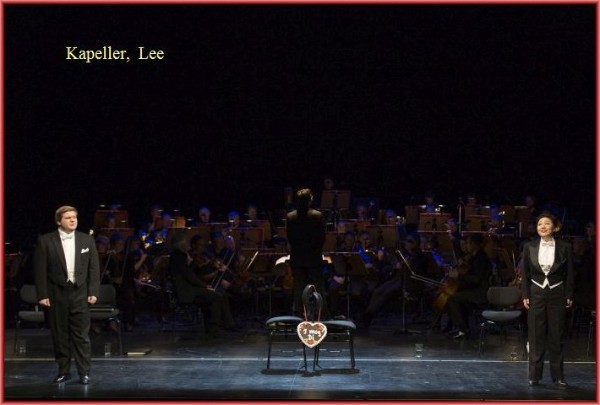
In bester Form zeigt sich der von Thomas Bönisch einstudierte Chor, der nicht nur musikalisch, sondern mit ausgefeilter Mimik auch darstellerisch gefordert ist. Die leichtfüßige Musik von Donizetti ist bei Vito Cristofaro und dem Oldenburgischen Staatsorchester in den besten Händen. Die Ouvertüre beginnt mit einem gelungenen Solo des Horns, bevor die Marschrhythmen einsetzen. Für jede musikalische Wendung findet Cristofaro das richtige Tempo und eine ausgefeilte Klangbalance. Auf nach Oldenburg - das sollte man sich nicht entgehen lassen!
Wolfgang Denker, 03.12.2016
Fotos von Stephan Walzl
SWEENEY TODD
Premiere am 05.11.2016
Gruseliges im viktorianischen London
Es gibt im Bereich der Oper und der Operette so einige Barbiere, die ihr heiteres Unwesen auf der Bühne treiben. Man denke nur an den berühmtesten unter ihnen, den „Barbier von Sevilla“ aus Rossinis Feder, oder auch an den nicht minder ausgelassenen „Barbier von Bagdad“, dessen Schöpfer Peter Cornelius ist. Doch Sweeney Todd ist da von einem anderen Kaliber. Auch er ist ein Barbier. Man sollte sich aber von ihm besser nicht rasieren lassen, da er seinen Kunden schon mal gern die Kehle durchschneidet.

Das Musical „Sweeney Tod - The Demon Barber of Fleet Street“ von Stephen Sondheim (der auch das Libretto zur „West Side Story“ schrieb) ist ein herrlich gruseliges Stück. Es wurde 1979 am Broadway uraufgeführt und gewann neun Tony Awards. Eine der Hauptrollen, die Pastetenbäckerin Mrs. Lovett, wurde damals von Angela Lansbury gespielt, die später in vielen Filmen als Miss Marple zu sehen war. 2007 wurde das Stück als „Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“ mit Johnny Depp in der Titelrolle verfilmt.
Die Handlung spielt im viktorianischen London. Der Barbier Benjamin Barker kommt als Sweeney Todd nach 15 Jahren aus der Verbannung zurück, in die ihn der Richter Turpin geschickt hat, um sich an Barkers Frau Lucy vergehen zu können. Lucy nahm angeblich Gift, die Tochter Johanna wurde von Turpin adoptiert. Jetzt will er sie heiraten. Todd hat nur einen Gedanken: Rache und Tod für Turpin. Mehrere Versuche scheitern. Todds Hass weitet daraufhin sich auf die gesamte Menschheit aus. Und so meuchelt er skrupellos immer weiter.

Mit der Pastenbäckerin Mrs. Lovett hat er ein einträgliches „Geschäftsmodell“ entwickelt. Die verarbeitet nämlich Todds Opfer in den bisher so miesen Pasteten, die jetzt plötzlich reißenden Absatz finden. Am Ende wird auch Mrs. Lovett von Todd umgebracht ebenso wie eine verwirrte Bettlerin, die sich aber als die tot geglaubte Lucy entpuppt. Auch Todd selbst findet sein Ende auf dem Rasierstuhl durch die Hand eines Bäckergehilfen.
Bei der ersten Musiktheaterpremiere dieser Saison mit Verdis „Macbeth“ ging es durchaus blutig zu. Bei „Sweeney Todd“ wird auch hemmungslos gemordet. Und Regisseur Michael Moxham sieht durchaus Parallelen zwischen Macbeth und Sweeney Todd. Macbeth mordet aus Ehrgeiz, Todd aus Rache. Bei beiden läuft schließlich alles aus dem Ruder. Und auch bei der Bäckerin Mrs. Lovett, die Todds Opfer zu Pasteten verarbeitet, zieht er einen Vergleich zu Lady Macbeth.

Moxham und sein Ausstatter Jason Southgate haben in Oldenburg für drei Stunden bester Unterhaltung gesorgt. Gesungen wird in deutscher Sprache. Die oft dunklen Bühnenbilder vermitteln einen überzeugenden Eindruck vom gruseligen London. Die verschiedenen Schauplätze sind gut umrissen. Bei Todds Ankunft werden die Masten eines Schiffes angedeutet, Johanna schwebt wie in einem goldenen Käfig über der Bühne. Richter Turpin sitzt arrogant auf einem überdimensionalen Thron. Im „Erdgeschoß“ der Bühne befindet sich die Pastetenbäckerei, darüber Todds Frisiersalon mit einem geradezu heimtückischen Rasierstuhl. Auf Knopfdruck werden die Mordopfer aus diesem über eine Rutsche nämlich direkt in die Backstube befördert. Und für die kurze Szene im Irrenhaus wird die Bühne hochgefahren und gibt den Blick auf Gefängniszellen frei. Die Ausstattung ist phantasievoll, abwechslungsreich und stimmig. Das gilt auch für die Kostüme, ebenfalls von Southgate.
Die Inszenierung von Max Moxham ist trotz der blutigen Handlung stets von feinsinnigem Humor durchzogen. Das zeigt sich in vielen kleinen Details, etwa wenn Todd und Mrs. Lovett darüber sinnieren, welche Berufsstände sich am besten zu Pasteten verarbeiten lassen. Wenn Mrs. Lovett in den Backofen gestoßen wird, ist das eine kleine selbstironische Spitze - Moxham hat nämlich vor einem Jahr „Hänsel und Gretel“ in Oldenburg inszeniert.

Die Charakterisierung der Personen wird auf den Punkt gebracht. Mrs. Lovett etwa ist trotz ihres makabren Handwerks irgendwie doch ein knuddelige, fast liebenswerte Person, die mit ihrem Schalk und mit ihren Sehnsüchten für sich einnimmt. Und auch die Entwicklung von Sweeney Todd, der sich über seine verständlichen Rachegelüste hinaus immer mehr zum monströsen Massenmörder entwickelt, ist sehr gut gezeichnet.
Für die Titelpartie steht mit dem Bassbariton Tomasz Wija eine ideale Besetzung zur Verfügung. Mit düsterer, verschlossener Ausstrahlung wird er der Figur beklemmend gerecht. Seine runde, volle Stimme begeistert mit ihrer profunden Tiefe und ihrem satten Klang in jeder Phase. Melanie Lang ist als Mrs. Lovett komisch und tragisch zugleich. An Bühnenpräsenz steht sie Thomas Wija in nichts nach. Lukas Strasheim ist der in Johanna unsterblich verliebte Freund von Todd, Stephen Foster der aufgeblasene Richter Turpin.

Als Johanna wirkt Alexandra Scherrmann mit hübschem Sopran wie eine Lichtgestalt unter all den düsteren Figuren. Philipp Kapeller gibt mit ausdrucksvollem Tenor den Bäckergesellen und späteren Mörder Todds. In kleineren Rollen sind Paul Brady als der von Todd als erster umgebrachte Barbier Pirelli, der wie ein Bruder des Quacksalbers Dulcamara (im „Liebestrank“) wirkt, sowie Sandro Monti als Turpins Büttel und Friederike Hansmeier als Bettlerin zu erleben.
Carlos Vázquez steht am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters und bringt die rhythmisch durchaus schwierige Musik von Stephen Sondheim bestens zum Klingen. Chor und Extrachor steigern sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu guter Form.
Wolfgang Denker, 06.11.2016
Fotos von Stephan Walzl
AGRIPPINA
Premiere am 15.10.2016
Intrigen und Machtspiele im alten Rom
Die Intrigen in den früheren Fernsehserien „Dallas“ und „Denver“ sind nichts gegen die Hinterlist und Heimtücke, mit der Agrippina, die Gattin des Kaisers Claudio, vorgeht, um ihren Sohn Nerone auf den römischen Kaiserthron zu hieven. Im gefühlten Viertelstundentakt werden immer neue Ränke geschmiedet - und das sind bei dreieinhalb Stunden Spieldauer schon einige.

Mit der Oper „Agrippina“ von Georg Friedrich Händel setzt das Oldenburgische Staatstheater seine Pflege der Barockoper erfolgreich fort. Wie schon bei „Hercules“ und „Xerxes“ in den beiden letzten Spielzeiten ist dem Haus einmal mehr ein Volltreffer gelungen. Für die musikalische Qualität ist wieder Jörg Halubek verantwortlich, der mit dem teilweise auf historischen Instrumenten spielenden Oldenburgischen Staatsorchester einen erstaunlich authentischen Barockklang erzeugen kann. Seine in durchweg ruhigen Tempi gehaltene Wiedergabe überzeugt durch eine sehr differenzierte Lesart, bei der Stimmen und Orchester stets fein aufeinander abgestimmt sind. Die vielen Nuancen in Dynamik und Phrasierung zeugen von der Sorgfalt, mit der Halubek das Orchester auf diese Aufgabe vorbereitet hat.

Die Inszenierung von Laurence Dale ist eine Übernahme von den Göttinger Händel-Festspielen, wo sie bereits im Mai 2015 gefeiert wurde. Dale ist es gelungen, ein ausgefeiltes Kammerspiel mit komödiantischen, anrührenden und satirischen Anteilen auf die Bühne zu bringen. Kalkulierte Weinkrämpfe, nie eingelöste Liebesversprechen oder neckische Versteckspiele in Poppeas Schlafzimmer gehören hier zum Arsenal von List und Tücke. Anspielungen auf heutige politische Unkulturen versagt er sich: Die Machtspiele von Agrippina und später auch von Poppea sprechen ohnehin für sich. Dafür sind die Charaktere punktgenau und sehr individuell gezeichnet. Kaiser Claudio etwa, der kraftlos hinkend und leicht debil daherkommt, könnte als Figur direkt aus einer Offenbach-Operette stammen. Nerone in seinem feuerroten Kostüm (historisch hat er ja den Brand von Rom zu verantworten) ist ein pubertierender Rotzbub, der von Agrippina schon mal eine Ohrfeige bekommt, wenn er nicht spurt.

Poppea, die von allen heiß begehrte Blondine, gibt sich zunächst als naives Unschuldslamm, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Und Agrippina, die Drahtzieherin, becirct Pallante und Narciso genau nach dem gleichen Muster, um sie für ihre Zwecke gefügig zu machen. Wenn sie bei der (falschen) Nachricht vom Tode Claudios hämisch auflacht, bestehen über ihren Charakter keine Zweifel. Der einzig Anständige dieser Gesellschaft ist Ottone, der fälschlicherweise des Verrats beschuldigt wird, der am Thron kein Interesse hat und einzig für seine Liebe zu Poppea lebt. Ihm hat Händel auch eine sehr berührende Arie, voller Verzweiflung und voller Liebessehnsucht, gegönnt. Am Ende eilt Regisseur Dale im Zeitraffer durch die Geschichte: Claudio, Agrippina, Poppea und Nerone werden ins Jenseits befördert und Ottone setzt sich die herrenlose Kaiserkrone auf. Man soll eben niemals nie sagen…

Das Bühnenbild von Tom Schenk ist sehr schlicht, dabei aber auch sehr ästhetisch - zwei verschiebbare Stellwände mit Spiegeln, eine große Säule und ein Thronhocker genügen vollauf. Auch die Kostüme (nach einem Entwurf von Robby Duiveman) sind in ihrer phantasievollen Ausgestaltung eine Augenweide.
Sängerisch bleiben keine Wünsche offen. Nina Bernsteiner als Agrippina und Martyna Cymerman als Poppea sind die konkurrierenden Diven, deren Stimmen wunderbar harmonieren und die ihre Partien virtuos ausführen. Als Ottone begeistert Leandro Marziotte mit ebenmäßigem Countertenor und berührender Darstellung. Hagar Shavit ist ein frecher, agiler Nerone mit klangvollem Mezzo. Claudios Diener Lesbo wird von Ill-Hoon Choung mit sonorem Bass verkörpert. Aarne Pelkonen und Yulia Sokolik sind als Pallante und Narciso absolut vergnüglich. Das gilt auch für João Fernandes, der als Claudio ein wahres Kabinettstückchen abliefert. Ein langer Opernabend, der sich aber als gleichbleibend kurzweilig erweist.
Wolfgang Denker, 16.10.2016
Fotos von Stephan Walzl
MACBETH
Premiere am 17.09.2016
Die Hexen sind allgegenwärtig
Die Entstehung von Verdis Oper „Macbeth“ (1847) fällt in die Zeit seiner sogenannten „Galeerenjahre“, sie ist aber bereits ein vollendetes Meisterwerk und seinen Spätwerken durchaus ebenbürtig. Verdi hat seinen „Macbeth“ 1865 für die Pariser Oper überarbeitet und u. a. eine Ballettmusik hinzugefügt. Diese Fassung wird in Oldenburg gespielt. Im Ergebnis ist eine musikalisch weitgehend gelungene Aufführung herausgekommen, die auch szenisch mit ungewöhnlichen Bildern überzeugt.

Gleich zum Vorspiel ist die in Nebelschwaden getauchte Bühne (Daniela Kerck) mit Leichen übersät. Macbeth und Banquo fallen sich als Überlebende der Schlacht erleichtert in die Arme. Regisseurin Nadja Loschky hat so in dieser Szene die enge Verbindung der beiden verdeutlicht.
Zur Charakterisierung von Macbeth und Lady Macbeth bezieht sie sich auf Sigmund Freud und seinen Text zum Thema der Kinderlosigkeit in Shakespeares „Macbeth“. Lady Macbeth ist in Loschkys Inszenierung schwanger, umgibt sich mit Puppen und strikt, wobei ihre Dienerinnen die Wollfäden schicksalhaft wie die Nornen halten. Allerdings verliert sie ihr Kind (in einer blutigen Szene) nach dem Mord an König Duncan. Überhaupt das Blut: Loschky spielt etwas plakativ mit dem Horror: Macbeth blutverschmiert, die Wand über Duncans Lagerstatt mit Blut besudelt.

Der Ansatz, Kinderlosigkeit als Ursache für den grausamen Ehrgeiz der Lady festzumachen, geht nicht auf. Sie ist schon während ihrer Schwangerschaft die personifizierte Bösartigkeit, während Macbeth zunächst zögerlich ist und durchaus Skrupel zeigt. Im letzten Akt wird Lady Macbeth von ihrem Mann erwürgt. Der singt danach die Arie „Pietà, rispetto, amore“ - eigentlich zu schön für einen Charakter wie Macbeth. Aber hier wirkt es so, als hätte sich Macbeth gerade von seinem Dämon befreit und sich auf sein „eigentliches“ Wesen besonnen.

Aber für das Dämonische sind die Hexen ohnehin zuständig. Warum man sie in so hässliche Unterkleider gestopft hat (Kostüme Claudio Pohle), bleibt allerdings ein Rätsel. Sie sind jedenfalls allgegenwärtig, ob als Hofdamen oder Flüchtlinge Sie sind es auch, die beim Bankett unter der gedeckten Tafel lauern und Macbeth die Geistererscheinung Banquos vorgaukeln. Anfangs hüten sie ein riesiges Ei, das Symbol der Fruchtbarkeit. Eine Miniaturausgabe wird am Ende an Malcolm überreicht, der die Königsdynastie fortsetzen wird. Es sind viele faszinierende Bilder und Gedanken, die Nadja Loschky in ihre Inszenierung eingebracht hat: Bei den Teilen der Ballettmusik, die hier gespielt wurden, wird die Schreckensherrschaft von Macbeth und seiner Lady verdeutlicht. Immer wenn sie mit einem riesigen Zepter auf den Boden stampfen, sinkt jemand tot zu Boden. Die Ermordung Banquos wird von einer mit Totenköpfen maskierten Beerdigungsgesellschaft angedeutet. Und die Schlafwandelszene der Lady wird hier zu einem Spiel mit Stoffpuppen.

Der neue GMD Hendrik Vestmann stand am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters. Er dirigierte diesen mittleren Verdi mit schnellen Tempi und betonte die Dramatik der Musik. Vielleicht ist dabei manches doch etwas zu knallig ausgefallen, bewegte er sich zu häufig im Fortissimo-Bereich. Aber seine effektvolle Wiedergabe war doch von pulsierendem Drive bestimmt und durchaus mitreißend. Wie er die großen Chor-Tableaus aufbaute und machtvoll steigerte, war eine Klasse für sich. Chor und Extrachor (Einstudierung Thomas Bönisch) zeigten sich dabei in bester Verfassung.
Bei den Solisten ist an erster Stelle Daniel Moon als Macbeth zu nennen, der mit markantem und kernigem Bariton die Zerrissenheit und die zunehmende Grausamkeit der Figur sehr plastisch verdeutlichte. Höhepunkt war die schön phrasierte Arie im letzten Akt, die er mit viel Belcanto gestaltete. Anfangs unterschieden sich die Stimmen von ihm und Ill-Hoon Choung, der den Banquo sang, fast zu wenig.

Choung ist kein basso profundo, aber ein sehr klug gestaltender Sänger, der vor allem mit schönen Legato in der Szene „Studia il passo, o mio figlio!“ begeisterte. Der Eindruck, den Raffaella Angeletti als Lady Macbeth hinterließ, war etwas zwiespältig. Ihr Sopran hat einen dramatischen Kern, eine satte Tiefe und Durchschlagskraft für die großen Ausbrüche. Aber zwischendurch waren immer wieder Passagen zu hören, in denen die Stimme verflachte. Als Persönlichkeit erfüllte sie die Partie aber sehr gut. Leider ist die Rolle des Macduff sehr klein - umso bedauerlicher, wenn sie von einem Tenor wie Emanuel Mendes gesungen wird. Seine Arie „Ah, la paterna mano“ ließ jedenfalls aufhorchen. Ein Tenor mit sicherer Höhe, einem schönen Timbre und einem aparten Flackern, wie man es auch etwa bei Joseph Calleja hört. Philipp Kapeller (in unvorteilhaftem Kostüm) als Malcolm, Melanie Lang als Kammerfrau und Henry Kiichli als Arzt erfüllten ihre Aufgaben zuverlässig.
Insgesamt eine Eröffnungspremiere, die viele Meriten hatte und Verdis „Macbeth“ endlich nach 22 Jahren wieder auf die Oldenburger Bühne brachte.
Wolfgang Denker, 19.09.2016
Fotos von Stephan Walzl
Christina, regina di Svezia
Zum Zweiten
Premiere: 21.05.2016
besuchte Aufführung: 27.05.2016
Rarität mit kleinen Wermutströpfchen
Lieber Opernfreund-Freund,
„Was von wem?“ hat mich ein durchaus opernkundiger Freund gefragt, als ich ihm gestern erzählte, dass ich nach Oldenburg fahre, um mir dort „Cristina, regina di Svezia“ von Jacopo Foroni anzusehen. Und in der Tat hatte kaum jemand von dem italienischen Komponisten gehört, der, nach Schweden ausgewandert, dort mit 23 Jahren Hofkomponist wurde und nur 10 Jahre später an der Cholera starb, ehe das Staatstheater Oldenburg seine Pläne für die Spielzeit 2015/16 veröffentlichte.
Der Zeitgenosse von Boito, der in Italien ebenfalls bei Alberto Mazzoccato studierte, konnte in seinem kurzen Leben lediglich drei Opernwerke vollenden. Das zweite, „Cristina, regina die Svezia“, das nun in deutscher Erstaufführung in Oldenburg zu erleben ist, entstand bereits in Schweden, wo es den jungen Komponisten aus der Gegend von Verona 1948 mit einer Operntruppe verschlagen hatte. Das Werk ist dem damaligen schwedischen König Oscar I. und seiner Mutter, Königin Désirée, gewidmet und war bei seiner Uraufführung 1849 in Stockholm ein dermaßen großer Erfolg, dass dem jungen Komponisten neben dem WASA-Orden direkt auch der Posten des Hofkapellmeisters übertragen wurde. In der Folge bemühte er sich um die Aufführung und Verbreitung der Werke seines Heimatlandes in Schweden, dirigierte Donizetti, Rossini, Bellini und Verdi und macht sich auch um die deutschen Komponisten verdient, indem er beispielsweise Werke von Beethoven, Schumann und Mendelssohn zur Aufführung brachte. „Cristina, regina di Svezia“ beschäftigt sich mit Chrsitina von Schweden, die das Land von 1650 bis 1654 regierte. Ihr Vater König Gustav II. Adolf hatte sie zu seiner Nachfolgerin bestimmt und angeordnet, dass sie nach seinem Tod eine Ausbildung erhalten sollte, wie sie sonst seinerzeit nur Männern zuteil wurde. Christina war fünf Jahre alt, als ihr Vater starb, und wurde ab da in Sprachen, Astronomie und Geographie, Fechten und Reiten unterrichtet und auf ihr künftiges Amt vorbereitet. Als Regentin gilt sie als große Förderin der Künste, ist aber vor allem auch für ihr egositisches Wesen und ihren Kleidungsstil bekannt - sie trug bevorzugt Männerkleidung, zur damaligen Zeit eigentlich undenkbar. Sie blieb unverheiratet und nährte damit Gerüchte um eine homoerotische Beziehung zu ihrer Hofdame Ebba Sparre, siedelte nach ihrer Abdankung nach Italien über und kovertierte zum katholischen Glauben. Sie war also offensichtlich eine streitbare, unangepasste und konsequente Frau, in vielem sicher ihrer Zeit voraus, über die das Libretto von Giovanni Carlo Casanove folgende dann doch sehr romantisierte Geschichte erzählt:
Christina will Kanzler Oxenstierna belohnen und deshalb seinem Sohne Erik ihre Cousine Maria zur Frau geben. Die allerdings liebt Gabriel de la Gardie, dem wiederum die Königin in Liebe zugetan ist. Als Maria bei der Hochzeit den Namen ihres Liebsten preisgibt, besteht die Königin auf der Eheschließung mit Erik. Gleichzeitig ist unter Federführung von Johan Messenius eine Verschwörung im Gange, der sich nach dem Affront in der Kirche auch Gabriel anschließt. Während Christina über ihr Leben nachdenkt und von Oxenstierna aufgefordert wird, als Regentin ihre persönlichen Gefühle hintenan zu stellen, dringen die Verschörer ins Schloss ein und legen Feuer. Christina geschieht nichts, da sich ihr Cousin Carl Gustav den Rebellen zum Schein angeschlossen hat. Als die Königin unter den Aufständischen auch Gabriel entdeckt, lässt sie sofort den Rat zusammenrufen, um das Urteil über die Verschörer zu sprechen. Dieser verurteilt Gabriel, Messenius und dessen Sohn Johan zum Tode. Christina möchte abdanken, um alles hinter sich lassen zu können. Sie bestimmt Karl Gustav zu ihrem Nachfolger und möchte nicht, daß ihre Regentschaft mit einem Todesurteil endet. Also hält sie das Geschehen auf und gibt Gabriel und Maria ihren Segen, während der Hofstaat Karl Gustav als neuem König huldigt. Diese Geschichte hat Foroni in wunderbare Musik gegossen. Ausgehend von der farbenreichen, fast sinfonisch anmutenden Ouvertüre entspinnen sich herrliche heitere, beinahe tänzerische Melodienbögen, hymnisch-pathetitsche Chöre und berauschende Arien, deren Harmonik immer wieder unerwartete Wendungen nimmt und so eine extrem spannenden Teppich knüpft, auf dem sich die Handlung entspinnen kann.
Für die erst zweite szenische Produktion dieser Oper nach deren langem Schlaf - die erste wurde beim Wexford-Festival 2013 gezeigt - hat man in Oldenburg Michael Sturm gewinnen können, der die vielschichte Story im Liebe, Staatsraison und persönliche Bedürfnisse stringent erzählt. Er zeigt Cristina als kalte Despotin, die die Menschen um sich herum wie Marionetten steuert, um ihren Willen durchzusetzen. Sie kleidet sich konsequent in Männeranzügen, wird nur in der einzigen Szene fraulich, in der sie als Privatperson gezeigt wird. Eingefasst ist die Handlung in einen Rahmen, der den Weg der Regentin von Kindesbeinen an (während der bespielten Ouvertüre stellt die kleine Julie Günzel das Kind Christina mit überragendem Talent überzeugend dar) bis zu deren Abdankung. Der Einheitsbühnenraum von Stefan Rieckhoff ist in königsblau gehalten und fungiert als Thronsaal, Kirche und Gerichtssaal gleichermaßen, die gelungenen, weitestgehend modernen Kostüme betonen die Zeitlosigkeit des Ansatzes, lediglich die Portraits von Christinas Vorfahren verorten das Geschehen in Schweden. Ausgeklügelte Personenführung erzeugt Spannung und Bewegung, so dass eigentlich ein durch und durch überzeugender Abend gelingen könnte, ABER: warum bemüht Sturm das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe in der ersten Hälfte des Abends dermaßen penetrant, obwohl weder Libretto noch Musik Hinweise darauf geben, um diesen so sehr strapazierten Faden in der zweiten Hälfte des Abends nicht einmal mehr ansatzweise aufzunehmen? Das wirkt wie plakative, gewollte Provokation ohne tieferen Erkenntnisgewinn und ist dermaßen unlogisch, dass es den grundsätzlich positiven Gesamteindruck doch enorm beeinträchtigt.
Musiziert wird auf beachtlichen Niveau. Foroni wollte es wohl hymnisch, wie man an der enormen Bläserbesetzung im Verhältnis zu den Streichern erkennen kann.. Vito Crisófaro hält am Pult die Fäden zusammen, läßt beschwingt aufspielen, gibt aber auch dem Pathos Raum und präsentiert eine Partitur voller - zumindest für diese Zeit - ungewohnter Harmonik und toller Farben. Angefangen bei Alexander Murashov und Anna Avakian, die in den kleineren Rollen durchaus Akzente setzen, über Philipp Kapeller, dessen heller Tenor als Johan aufhorchen lässt, Tomasz Wija, der einen verschwörerischen Messenius gibt, und Ill-Hoon Choung, der als eindrucksvollem Axel Oxenstienera überzeugt, präsentiert sich ein starkes Sängerensemble. Paulo Ferreira verfügt über einen kraftvollen Tenor mit sicherer Höhe, kann sich aber auch zurücknehmen und gestaltet seine Arie im ersten Akt mit unvegleichlicher dolcezza. Melanie Lang ist als seine Geliebte Maria zu sehen. Ihr Mezzo ist mächtig nachgedunkelt, seit ich sie das letzte Mal habe hören dürfen, und glänzt nun mit warmem Timbre, hoher Beweglichkeit und ist auch zu überzeugenden Ausbrüchen fähig. Das macht neugierig auf die „Carmen“, die sie in der kommenden Spielzeit in Oldenburg präsentieren wird. Ensemblemitglied Daniel Moon als Carlo Gustavo bringt seinen beeindruckenden Bariton wahrlich betörend zum Einsatz. Da leuchten dermaßen viele Farben, dass man es kaum zu beschreiben vermag. Das Duett mit Cristina im letzten Akt wird so zu einem der Höhepunkte des Abends. Nicht ganz so überzeugt mich der von Thomas Bönisch einstudierte Chor. Während die Herren eine mehr als solide Leistung zeigen, gibt es bei den Damen doch ein erheblich weniger homogenes Klangbild, einzelne Stimmen stechen fast unangenehm hervor. Schade.
Man fragt sich in der ersten Hälfte des Abends mitunter, warum die Oper „Cristina“ heißt, denn erst im zweiten Teil gibt Foroni Miriam Clark Gelegenheit, ihr Können zu zeigen, indem er die Rolle erst recht spät mit dafür umso halsbrecherischeren Koloraturen und ausdrucksvollen Kantilenen versieht. Die sind bei der jungen Sängerin in besten Händen: geschmeidig und mit so bombensicherer wie feiner Höhe, berührender Mittellage und fast bedrohlicher Tiefe zeigt ihr beweglicher Sopran sämtliche Facetten und macht den Abend so zu ihrem Triumph.
Es ist also ein Abend mit kleinen Wermutströpfchen. Die Musik ist dennoch mit Sicherheit eine Entdeckung wert, erinnert eher an den frühen Verdi als an die Belcantisten. Aber sie packt mich emotional nicht ganz so wie die Raritäten, die man derzeit in Braunschweig, Gelsenkirchen oder Freiburg zeigt. Empfehlenswert ist die Produktion aber allemal. Und sollten Sie diese Spielzeit keine Aufführung mehr besuchen können: Oldenburg nimmt die Foroni-Ausgrabung erfreulicherweise auch in der kommenden Spielzeit wieder ins Programm.
Ihr Jochen Rüth / 28.5.2016
(Bilder siehe unten)
JACOPO FORONI
CRISTINA, REGINA DI SVEZIA
Premiere am 21.05.2016
Pathos und Belcanto
Der Name Jacopo Foroni ist in den gängigen Opernführern nicht zu finden. Seine wenigen Werke sind heute weitgehend vergessen. Dabei galt der in Verona geborene Verdi-Zeitgenosse nach dem Erfolg seiner ersten Oper „Magherita“ (1848) als eines der vielversprechendsten Komponistentalente Italiens. Foroni lebte von 1825 bis 1858, wurde also nur 33 Jahre alt. Die Frage, ob er ein ernsthafter Konkurrent Verdis geworden wäre, bleibt somit offen. Foroni wirkte ab 1849 vor allem in Schweden als Komponist und Chefdirigent der Königlich Schwedischen Oper.

Sein wichtigstes Werk ist die Belcanto-Oper „Cristina, Regina di Svezia“ („Christine, Königin von Schweden“), die zuletzt 2013 beim Wexford Festival ausgegraben und als Entdeckung des Jahres gefeiert wurde. Das Oldenburgische Staatstheater hat sich nun die deutsche Erstaufführung gesichert und gleich mit dem Coup einer Live-Übertragung im Rundfunk verbunden. Die Reihe von Wiederentdeckungen hat nach der erfolgreichen „La dame blanche“ vor einem Jahr damit eine würdige Fortsetzung gefunden.
Die Oper behandelt den letzten Abschnitt der Regentschaft von Königin Christine bis zu ihrer Abdankung. Es geht um Macht, Liebe und Verschwörung. Christine liebt den Adligen Gabriele, der aber seinerseits Christines Cousine Maria. Christine will Maria mit Erik, dem Sohn ihres väterlichen Erziehers Axel Oxenstierna, zwangsweise verheiraten. Daraufhin schließt sich Gabriele den Rebellen an. Die Verschwörung wird von Christines Cousin Karl Gustaf aufgedeckt. Christine bestimmt Karl Gustaf zu ihrem Nachfolger, dankt ab und begnadigt als letzte Amtshandlung ihre Gegner. Bei Regisseur Michael Sturm kommt Christines Gnadenakt zwar etwas zu spät, denn zwei der Rebellen werden noch erschossen, bevor Christine eingreifen kann.

Wenn der Vorhang gleich zu Beginn der langen Ouvertüre hochgeht, ist ein geräumiger Ratssaal zu sehen, mit großen Gemälden früherer schwedischer Herrscher und mit einem Thron in der Mitte. Man sieht Christine als Kind, wie sie von Axel Oxenstierna Fecht- und Geschichtsunterricht bekommt und für ihre Aufgabe als Königin vorbereitet wird. Wenn Christine später enttäuscht mit ihrem Schicksal hadert, sind alle Bilder abgehängt, nur das Bild ihres Vaters liegt noch auf dem Boden zu ihren Füßen.
In der ersten Szene der Oper blickt der Chor mit schreckgeweiteten Augen in den Zuschauerraum, als würde er einer Hinrichtung beiwohnen. Eigentlich feiert man den Frieden nach dem gerade überstandenen Dreißigjährigen Krieg, aber es ist doch ein erster Hinweis auf Christines kaltes Machtbewusstsein. Ihre lebenslustige, vielleicht auch zynische Seite wird dadurch angedeutet, dass sie tanzt und tanzen lässt, wann immer es Foronis Musik hergibt.

Michael Sturm setzt in seiner Inszenierung den historischen Stoff geradlinig und ohne Mätzchen um. Vielleicht ist es insgesamt mit seinen vielen statischen Tableaus und etwas stereotypen Bewegungsabläufen ein wenig zu konventionell ausgefallen. Es ist so, als ob Sturm zu einem Besuch ins Opernmuseum einlädt. Aber es ist durchaus ein anregender Museumsbesuch. Und Sturm lässt auch zwischen den Zeilen historische Details einfließen. So wird der Königin Christine eine lesbische Beziehung mit der schönen Gräfin Ebba Sparre (die in der Oper nicht vorkommt) nachgesagt. Sturm deutet das durch einen leidenschaftlichen Kuss zwischen Christine und Maria an. Die historische Christine trug gern Männerkleidung, die Opern-Christine zeigt sich meistens in einem Hosenanzug. Insgesamt sind die zeitlosen, modernen Kostüme von Stefan Rieckhoff passend.
Das im Prinzip einheitliche Bühnenbild (auch von Stefan Rieckhoff) ist gleichermaßen opulent und zweckmäßig. Im späteren Verlauf wird um das gesamte Bühnenbild als weitere Metapher für den „musealen“ Bilderbogen ein riesiger Bilderrahmen gespannt. Wenn die Verschwörer das Schloss in Brand setzen, sollte der eigentlich lichterloh brennen, was aber technisch nicht ganz geklappt hat.

Bei Christines Abdankung lässt Sturm sie wie einen Moderator vor den geschlossenen Vorhang treten und ihre Botschaft direkt ins Publikum, also an das Volk richten - eine der wenigen Szenen, die nicht ganz überzeugen.
Musikalisch ist Foronis Oper eine tolle Entdeckung. Vielleicht ist das Pathos der Musik, vor allem in der Schlußszene, ein bisschen zu sehr ausgereizt, was Sturm noch mit einer Vielzahl schwedischer Flaggen verstärkt. Aber insgesamt ist die Musik eine gelungene Mischung aus frühem Verdi, melodiösem Bellini und rhythmisch-elegantem Donizetti. Die vielen Arien und Duette, aber vor allem die großen Chorszenen, die in der Oper einen breiten Raum einnehmen, sind im Einzelfall wahre Juwele. Es sind reizvolle Pfade, die Foroni in seiner Musik beschreitet. Aber - es sind zu wenige Pfade. Sie sind schnell ausgeschritten und ermüden in den knapp drei Stunden durch ihre oft ähnliche Machart. Vielleicht liegt es auch etwas am Dirigenten Vito Cristófaro, der sich am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters zwar mit Verve und Engagement, mit feurigen Tempi und prachtvoller Klangentfaltung der Aufgabe gestellt hat, der aber den Forte-Bereich sowohl bei den Sängern wie auch beim Orchester selten verlässt.

Sängerisch hat der Chor fast den Löwenanteil zu bestreiten, den er in der Einstudierung von Thomas Böhnisch in hervorragender Form bewältigt. Miriam Clark ist, trotz kleiner Intonationstrübungen, eine hervorragende Besetzung für die Christine - ausdrucksvoll und mit Belcanto-Glanz. Melanie Lang ist mit sicherem Mezzo eine attraktive Maria. Als Axel Oxenstierna gibt Ill-Hoon Choung eine Vaterfigur von fast schon Verdischer Prägung. Paulo Ferreira bietet für den Gabriele tenorales Feuer, viel Leidenschaft und eine sichere, etwas kehliger Höhe. Eindrucksvoll kann Daniel Moon in seiner gesanglich sehr dankbaren Rolle als persönlichkeitsstarker Karl Gustav überzeugen. Seine Arie hat großes stimmliches Format. In weiteren Rollen bieten Alexander Murashov als Erik, Tomasz Wija und Philipp Kapeller als Verschwörer sowie Anna Aviakan als Voce interna eine gute Ensembleleistung.
Wolfgang Denker, 22.05.2016
Fotos von Stephan Walzl
EIN SOMMERNACHTSTRAUM
Premiere am 09.04.2016
Die Welt steht auf dem Kopf

Das Oldenburger Publikum wird sich gern an die Spielzeiteröffnung der Saison 2004/2005 erinnern: „The Fairy Queen“ von Henry Purcell war ein phantasievolles, pralles Theatererlebnis, basierend auf dem „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare. Fast dreihundert Jahre nach Purcell hat ein anderer Engländer den Stoff zu einer Oper verarbeitet. „Ein Sommernachtstraum“ von Benjamin Britten wurde 1960 in Aldeburgh uraufgeführt. Auch musikalisch sind beide Werke verbunden, denn Britten nahm durchaus Bezug auf barocke Form- und Stilelemente, nicht zuletzt durch die Besetzung des Feenkönigs Oberon mit einem Countertenor. Brittens vielschichtiges Werk wurde nun in Oldenburg in einer liebenswerten Aufbereitung gezeigt.

Ist Paris die Stadt der Liebe? Regisseur Tom Ryser scheint in seiner Inszenierung eher Oldenburg dafür zu halten, zumindest für die Stadt der Liebeswirren. Denn das Bühnenbild von Stefan Rieckhoff zeigt eine Oldenburger Stadtansicht, die allerdings auf den Kopf gestellt ist. Auf den Kopf gestellt sind auch die Gefühle der beiden Paare Lysander und Hermia bzw. Demetrius und Helena, weil der Feenkönig Oberon wegen eines Streits mit Titania seinen Adlatus Puck mit allerlei Zaubereien beauftragt. Aber Puck vermasselt seine Mission und löst ein wahres Chaos der Gefühle aus. Am Ende muss Oberon es wieder richten - und auch die Stadt Oldenburg wird aus ihrem Kopfstand erlöst.
Rysers Inszenierung bewegte sich dabei in ruhigen Bahnen und erzählte die Ereignisse dieser Sommernacht in einer unspektakulären, sehr märchenhaften Art und Weise, ohne die sexuellen Abenteuer drastisch vorzuführen. Weiter als bis zur Unterwäsche ging es nicht. So blieb auch dank der phantasievoll ausgestatteten Bühne der poetische Zauber des Elfenreichs gewahrt. Hatten Ryser und Rieckhoff bei ihrem „Falstaff“ vor zwei Jahren auf die Farbe Grün gesetzt, so war es diesmal Rot. Oberon und Titania erschienen in knallroten, sehr hübschen Kostümen, ebenso Puck mit einem drolligen Bowler-Hütchen. Auch die Beleuchtung des Zuschauerraums war rot. Die theaterbesessenen Handwerker rund um den später in einen Esel verwandelten Bottom (eigentlich besser bekannt als Zettel), waren hier zu Müllwerkern mutiert, die den Dreck auf Oldenburgs Strassen in Säcke stopfen.

Ryser ließ sie durchaus munter agieren, aber das hätte doch etwas witziger und pointierter ausfallen können. Diese Szenen sorgten denn doch für einige Längen. Umso quirliger waren die des mit David Bennent prominent besetzten Pucks. Wie ein Derwisch wirbelte er über die Bühne und konnte sich vor Schadenfreude über das von ihm verursachte Chaos kaum wieder einkriegen. Und im Finale des zweiten Aktes fühlte man sich beim Chor der Elfen fast in „Hänsel und Gretel“ versetzt. Gleichwohl - die Inszenierung ist in ihrer soliden, eher der Poesie als der Drastik verpflichteten Art gut gelungen und trägt über drei Stunden.
Fast das gesamt Opernpersonal des Oldenburgischen Staatstheaters stand auf der Bühne und konnte mit einer homogenen Leistung auf hohem Niveau überzeugen. Jede Rolle konnte stimmig besetzt werden. Leandro Marziotte war (mit etwas zurückhaltendem) Countertenor der Oberon, Alexandra Scherrmann die attraktive, sehr stimmgewandte Titania. Hagar Sharvit und Philipp Kapeller waren als Hermia und Lysander ebenso glaubhaft wie Valda Wilson und Daniel Moon als Helena und Demetrius. Wunderbar gestalteten sie das Quartett der Erwachensszene. Die Riege der Handwerker wurde von Thomasz Wija als Bottom stimmstark angeführt. Paul Brady gab den Theseus wie einen Operetten-Bonvivant, Yulia Sokolik war seine zickige Hippolyta.

Die Elfenschar wurde erfolgreich aus dem Jugendchor KlangHelden rekrutiert. Am Pult des Oldenburgischen Staatsorchesters stand Vito Cristófaro, der vor allem auf die Schönheit der Musik setzte, weniger auf die kantigen Momente. Mit seinen breiten Tempi stand er im Einklang mit dem ruhigen Fluss der Inszenierung. Suggestiv ließ er im Orchester die Seufzer der Nacht erklingen. Insgesamt brachte er Brittens kunstvolle Komposition mit ihren Glissando-Klängen durchaus zum Leuchten. Keine sensationelle, dafür aber sehr liebenswerte Inszenierung.
Wolfgang Denker, 10.04.2016
Fotos von Stephan Walzl
LA VOIX HUMAINE
TROUBLE IN TAHITI
Premiere am 19.03.2016
Abschied von der Liebe
Eine reizvolle Kombination von zwei Opern-Einaktern gibt es im Kleinen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters zu bewundern. Die Oper „La voix humaine“ („Die menschliche Stimme“) von Francis Poulenc ist zumindest selten und „Trouble in Tahiti“ („Ärger in Tahiti“) von Leonard Bernstein ist eine ausgesprochene Rarität. Beide Werke wurden in den fünfziger Jahren uraufgeführt: „La voix humaine“ 1959 und „Trouble in Tahiti“ 1952. Es gibt gute Gründe, gerade diese beiden Werke (Dauer jeweils eine dreiviertel Stunde) zu koppeln. Beide handeln von gescheiterten Beziehungen, bei beiden scheint es keine Hoffnung zu geben. Bei Poulenc ist das Ende allerdings tödlich, bei Bernstein immerhin nur resignativ.

„La voix humaine“ (auf eine Dichtung von Jean Cocteau) ist ein Monolog für eine Sängerin. Eine junge Frau wartet auf den Anruf ihres Geliebten, der sie verlassen hat. Man hört nur, was die Frau sagt, der Mann am anderen Ende der Leitung bleibt unsichtbar. Das Gespräch wird immer wieder unterbrochen, entweder durch das Fräulein vom Amt oder durch fremde Personen, die plötzlich in der Leitung sind. Zu erleben sind die wechselvollen Gefühle der Frau: Ihre Ängste, Momente der trügerisch aufkeimenden Hoffnung, gespielte Gleichgültigkeit und fassungslose Verzweiflung. Poulenc hat sein Werk für Sopran und Orchester komponiert, gab aber auch eine Fassung für Sopran und Klavier heraus. Diese Version wird in Oldenburg gespielt.
 Auf der ins Halbdunkel getauchten Bühne sitzt im Hintergrund Carlos Vázquez am Klavier, vorne agiert Nina Bernsteiner als die junge Frau. Sie drückt ihre seelische Höllenfahrt stimmlich bis in die feinsten Nuancen aus, mal weich und zärtlich flehend, mal aggressiv auftrumpfend, mal in tonlosem Sprechgesang, mal mit ariosen Aufschwüngen. Dazu kommt eine körperliche Ausdrucksvielfalt, die vom Wutausbruch bis zur physischen und psychischen Erschöpfung reicht. Regisseurin Julia Wissert hält den Spannungsbogen von Anfang bis Ende ungebrochen durch. Wenn die Frau ihr verzweifeltes „Ich liebe dich“ in den Hörer schleudert, zieht sie den Telefonstecker - danach gibt es nichts mehr zu sagen, das soll das letzte Wort gewesen sein. Anschließend erdrosselt sie sich mit der Telefonschnur. Aber das ist nur noch ihre Privatsache, die Verbindung ist da schon längst gekappt.
Auf der ins Halbdunkel getauchten Bühne sitzt im Hintergrund Carlos Vázquez am Klavier, vorne agiert Nina Bernsteiner als die junge Frau. Sie drückt ihre seelische Höllenfahrt stimmlich bis in die feinsten Nuancen aus, mal weich und zärtlich flehend, mal aggressiv auftrumpfend, mal in tonlosem Sprechgesang, mal mit ariosen Aufschwüngen. Dazu kommt eine körperliche Ausdrucksvielfalt, die vom Wutausbruch bis zur physischen und psychischen Erschöpfung reicht. Regisseurin Julia Wissert hält den Spannungsbogen von Anfang bis Ende ungebrochen durch. Wenn die Frau ihr verzweifeltes „Ich liebe dich“ in den Hörer schleudert, zieht sie den Telefonstecker - danach gibt es nichts mehr zu sagen, das soll das letzte Wort gewesen sein. Anschließend erdrosselt sie sich mit der Telefonschnur. Aber das ist nur noch ihre Privatsache, die Verbindung ist da schon längst gekappt.
„Trouble in Tahiti“ kommt nicht so depressiv daher, obwohl auch dieses Werk vom Ende einer Beziehung handelt. Dinah und Sam haben sich nicht mehr viel zu sagen. Er interessiert sich nur für seine Geschäfte, seine Sekretärin und seine sportlichen Erfolge, sie verbringt ihre langweiligen Tage entweder beim Psychiater oder im Kino.

Dort sieht sie den schrecklich kitschigen Film „Trouble in Tahiti“ (der der Oper den Titel gab) als Talmiersatz für echte Gefühle. Wissert leuchtet die Bühne dazu in orangefarbigem Licht aus und lässt Flitter vom Himmel regnen. Es ist ein unwirklicher „Inselzauber“ der hier beschworen wird und nichts mit dem realen Leben zu tun hat. Die Farbe, die sich hier im Bühnenbild von Thurid Peine und in den Kostümen von Viola Weltgen zeigt, ist im Alltag ihrer Ehe nicht mehr zu finden. Auf der Bühne stehen weiße Kästen und Türme in verschiedenen Formen und Größen. Sie haben doppelte Funktionen. In Dinahs Welt sind es Kühlschränke oder Waschmaschinen als Symbol für gehobenen Lebensstil, für Sam können es auch Wolkenkratzer für seine Businesswelt oder einfach Podeste für seine vielen Sportpokale sein, die überall herumstehen.

Bernsteins durchweg schmissige Musik wird von sechs Musikern unter der Leitung von Carlos Vázquez gespielt. Sie hat vorwiegend Musical- oder Jazz-Charakter. Vieles von seiner späteren „West Side Story“ klingt hier schon an. Wenn sich Dinah und Sam jeder für sich nach einem stillen Ort sehnen, wohin sie die Liebe führt, dann erinnert das an „Somewhere“. Und auch die Mambo-Rhythmen von Anita finden sich schon in „Trouble in Tahiti“. Neben den beiden Protagonisten Nina Bernsteiner, die hier als Dinah zu einer Art Doris Day erblondet ist und gekonnt in eine ganz andere Rolle schlüpft, und dem Bariton Aarne Pelkonen als Sam gibt es noch ein Figurentrio (Carolina Walker, Maciej Michael Bittner und Kim-David Hammann - alles Studierende der Hochschule Osnabrück), das eine ähnliche Funktion hat wie der Chor in der antiken Tragödie und munter kommentierend über die Bühne wuselt. Aber zur Tragödie kommt es bei Bernstein nicht. Es scheint so, dass Dinah und Sam ein kleines Stückchen von dem Inselzauber aus dem „Tahiti“-Film in ihren Alltag gerettet haben. Das Ende bleibt offen.

Dem Oldenburgischen Staatstheater ist jedenfalls ein gleichermaßen berührender wie unterhaltsamer Opernabend gelungen, der in seiner szenischen und musikalischen Umsetzung rundum überzeugt.
Wolfgang Denker, 21.03.2016
Fotos von Stephan Walzl
ULTIMATIVER OPERNFREUND-CD-TIPP