STAATSTHEATER KASSEL



(c) Der Opernfreund / Bilsing
GÖTTERDÄMMERUNG
Premiere: 7.3. 2020
Dass ausgerechnet Ulrich Spiller, besser bekannt als „(Bayreuther) Kartenhai“, am Ende des sechs Stunden langen Abends und des nunmehr glücklich vollendeten kompletten „Ring“, also zu den selig verklingenden Schlusstakten der „Götterdämmerung“ den Ring geschenkt bekommt, weil er zufällig in der ersten Reihe Mitte des Kasseler Staatstheaters sitzt: diese hintersinnige Pointe hätte sich kein Regisseur ausdenken können – aber wer weiß: Vielleicht ist diese seltsame Ringvergabe aus den Händen eines Kindes bedeutungsvoller, als es die Entgegennahme des titelgebenden Symbols durch einen „normalen“ Kasseler Bürger je sein könnte.

Wir sehen auch diesmal, wie schon im „Rheingold“, Dutzende von „Bürgern der Stadt Kassel und Umgebung“, wie die Herren und Damen von der Statisterie genannt werden, die uns am Ende des fünften Kasseler Nachkriegs- „Ring“ wenigstens kurz, unvermeidbar an Chéreaus „Ring“-Schluss erinnernd, bedeutungsvoll anschauen. Natürlich: Tua res agitur, oder, wie der Dramaturg Christian Steinbock im Programmheft schreibt: „In welcher Welt wollen wir leben?“ Die Idee des Kollektivs, das sich aus den Einwohnern der Stadt und ihrer Umgebung speist, für die dieser „Ring“ zuallererst gemacht wird, und die nicht zu verwechseln ist mit den Massenornamenten des Münchner „Rings“ von Andreas Kriegenburg, wäre allzu simpel, würden sich mit ihr nicht immer wieder beeindruckende und berührende Bildfindungen verbinden. Wenn Waltraute der Schwester den Ring abzugewinnen versucht und gleichzeitig ein Heer von Menschen wie Du und Ich in fast uniformen Unterhosen und -hemden einer zentralen Szene nicht nur der „Götterdämmerung“ beiwohnen, und wenn sie gleichzeitig den traurig zusammengesunkenen Gott namens Wotan und seine zwei „Raben“ in die Mitte aufgenommen haben, braucht es keine weiteren Worte, um die Intention der Regie zu begreifen – auch wenn zwischen dem Schicksal der Götter und dem der Menschen Unterschiede bestehen mögen; am Anfang wie am Ende sind auch die Götter bei Wagner stets nur Menschen gewesen. Die Szene funktioniert auch deshalb, weil Ulrike Schneider, obwohl ihre Stimme ihren Zenit bereits überschritten hat, dem kurzen, aber wichtigen Part etwas Wesentliches mitgibt: eine Anteilnahme, die die Bewegung und Motivation dieser Figur umstandslos auf uns überträgt. Das Orchester hilft ihr freilich dabei; an diesem Abend setzt der GMD Francesco Angelico mit dem Staatsorchester Kassel gelegentlich auf betonte, langen Atem abfordernde Langsamkeit, die den Emotionen allen Raum lässt, und auf feinste Kammermusik, wobei ihm der tiefe Graben mit dem breiten Steg perfekt entgegenkommt. Und die dissonanten Hörner des Mannenchors dröhnen, das ist, pardon, einfach nur „geil“, von den Rangtüren ins Haus.

Der erste Rabe ist übrigens bei Regisseur Markus Dietz keiner von Wagners Wotanraben, denn diese verfolgen ja, wie Wotan selbst zu Siegfried sagt, den Vogel. Er ist in Kassel, als eigene Deutung des Symboltiers, niemand anderes als der Waldvogel, also die Seele von Siegfrieds Mutter, worauf Wagner selbst mehrmals hinwies – nur, dass er bei Wagner im letzten Teil der Tetralogie „nur“ noch in der Musik erinnert wird: doch immerhin kurz vor seiner Ermordung. Berührend zu sehen, wie die junge blutbeschmierte Frau (Dalia Velandia) Siegfried auf seinem letzten Weg begleitet, Sieglindes blutgetränktes Gewand anzieht und nicht verhindern kann, dass die älteste Norn dem zweifelhaften Helden im Kostüm der zur Hochzeit gezwungenen Brünnhilde schließlich stumm den Tod verkündet. Es sind dies so Szenen, die auch die Inszenierung der „Götterdämmerung“ zu einem spielerischen wie symbolisch tiefsinnigen Schauspiel machen, angesichts dessen es nicht ins Gewicht fällt, dass Grane einer jener SM-Männer mit nacktem Oberkörper und Mundverschluss ist, der von den Walküren in ihr höllisches Walhall gezogen werden sollte. Reizvoller ist ohne Zweifel die Frage, wieso die Rheintöchter ihren herrlich-herbstlichen Gesang beim toten Alberich ihren schönen Mündern herrlich entspringen lassen. Hat sich der Kadaver aus dem Albtraum des die Halle hütenden Hagen in die Wirklichkeit der Rheinszene und ihres Goldlamettavorhangs begeben? Möglich wäre ja diese surreale Idee, denn der „Ring“ spielt, wie Götz Friedrich einmal ganz richtig (und durchaus unbanal) gesagt hat, auf dem Theater.

Hagens Nachtwache gehört in dieser Deutung also zu den stärksten Interpretationen dieser Szene, die ich je gesehen habe: Zu Beginn des 2. Akts erinnert sich Hagen träumend daran, wie sein Vater ihn einst asozialisierte: „Hasse die Frohen!“ Aus dem Albtraum des furchtbaren Vaters vermag sich der gequälte Traumsohn, dem auch die tröstende Handauflegung des „realen“ Hagen nicht hilft, nur durch die Ermordung des lieblosen Erzeugers, der von Thomas Gazheli angemessen deutlich gesungen wird, zu befreien – und wir begreifen ohne weitere Erklärungen, wie so Hagen wurde, wie er ist. Ähnlich Starkes wird man an diesem unterhaltsamen wie gelegentlich bannenden Abend kaum noch sehen, ähnlich Beklemmendes sah man am Ende des 1. Akts: die vor einer Großbildleinwand kauernde Brünnhilde, deren Vergewaltigung im Schwarz-Weiß-Film gezeigt wird (Video: David Worm), während der falsche Gunther vom Rang herab singt und unsichtbar bleibt. Weitere Projektionen sehen wir in den Zwischenspielen: Probenszenen mit Alberich und den Rheintöchtern, Fricka auf ihrem Motorrad – die Oper ist auch eine Welt des Scheins, und das Opernhaus ist zugleich die Welt mit ihren Menschen. Das ist so banal wie sinnfällig.
Die Menschen heißen Gunther und Gutrune, sie pflegen – auch das ist nicht neu – sich dem Inzest hinzugeben. Sex & Wine – Rotwein fließt, so wie das Kunstblut, in Fülle. Er ist ein legerer Yuppie, der von Hansung Yoo sehr baritonstark gesungen wird, sie eine gestylte Frau, die zunächst beim schmutzigen Deal willig mitmacht und zu spät versteht, was Mann auch ihr antat. Die Regie hält einen Trost für sie bereit, die von Jaclyn Bermudez komödiantisch wendig und tragisch-ernst gespielt wird: der Waldvogel schlüpft vor dem Mannenchor kurz zur schlafenden Gutrune. Auch Brünnhilde agiert an diesem Abend ausgesprochen menschlich: Kelly Cae Hogan spielt und singt die Rolle zwischen der Verzweiflung des Abschieds und der Verzweiflung des totalen Verrats bis zm souveränen Verzicht aufs Erdenglück mit dem sopranwarmen Timbre für die großen Gefühle und den präzisesten Ausdruck – und die Regie gönnt ihr, bei ihrer großen Abschiedsrede, allen Raum im Zentrum des Lichts, das diesmal nicht vom blendenden „Tarnhelm“ ausgeht: assistiert von den Rheintöchtern. Der „Ring“ ist ja nicht allein eine Tragödie des scheiternden Vaters…

Ihr Siegfried ist ein leicht verwahrloster Jüngling mit Drachen-T-Shirt und (echtem) Langhaar; dass er verwahrlost ist, merkt man daran, dass er nicht weiß, wie eine Kaffeemaschine funktioniert; der Rest des Inhalts des Geräts landet auf dem Boden, was nicht nur in die Musik hineinrumpelt, sondern auch ein überalterter Regieeinfall ist, dessen Haltbarkeitsdatum ebenso abgelaufen ist wie manches, was Siegfried im Kühlschrank entdeckt – aber Daniel Frank singt den naiven jungen Kerl mit einem lyrischen Ton, der sich heldisch aufschwingen kann, ohne ins bloße Brüllen zu geraten. Starker Beifall auch für diesen Darsteller.

Albert Pesendorfer spielt dagegen einen Hagen, dem auf den ersten Blick und aufs erste Hören anzumerken ist, dass er dem tumben Toren haushoch überlegen ist: wie schon sein Bayreuther Hagen (und sein Nürnberger Sachs etc. etc.) eine Person von Statur: vokal wie körperlich, auch wenn die Regie ihn eher zurückhaltend agieren lässt. Die graue Eminenz bleibt, wenigstens bis zur versuchten Vergewaltigung Gutrunes, lieber im Hintergrund oder während des Eids auf dem reichlich bespielten Orchestersteg, wenn er nicht gerade das Heer der Mannen furios antreibt. Dieses ist beim Kasseler Opernchor unter Marco Zeiser Celesti bei besten Kräften: hier schollert nicht nur bei des berühmten Basses Grundgewalt das Stimmkollektiv äußerst gewaltig in den Saal.

Gewaltig im Sinne der Ästhetik aber agieren die Rheintöchter; Marta Herman, Vero Miller und Elizabeth Bailey singen in den Vintage-Strandkostümen der 50er Jahre (als die Welt noch „in Ordnung“ war), aber körperlich versehrt, ein wunderschönes Terzett, für das der Begriff „homogen“ erfunden wurde (auch wenn sie die durchaus unschöne Tat der Erstickung Hagens durch herumliegende Kleiderstoffe durchführen). Das zweite Mini-Kollektiv der „Götterdämmerung“ ist das der Nornen, hier ergänzt Doris Neidig, freilich mit überlautem Ton, als 3. Norn das Duo von Herman und Miller.

Gespielt wird die urälteste Norn von einer Statistin; sie darf sich am Ende die Tötung Gunthers von der Bühnenseite aus anschauen, bevor sie sich erhebt und zu Wotan und einer weiteren Norn gesellt, die schon auf dem zentralen Bühnenelement dieses „Ring“, dem Lichtstäbe-„W“, Platz genommen haben. Es wird schließlich, szenisch schlicht und eher als Verlegenheitslösung, von einer Wand verdeckt werden, nachdem eine Feuerreihe entflammt wurde; mit dem Feuer, um das sich die Kasseler Bürger scharten, hat der Abend ja begonnen. Als sog. Gutmenschen wurden sie indes nicht angelegt; Aggressivität herrscht zu Beginn auch in dieser Truppe, doch wenn am Ende der Ring die Bühne verlässt, um von einem unwissenden Kind einem Kartenhai geschenkt zu werden, wissen wir, dass die Welt noch nicht ganz verloren ist: und dass es gelegentlich gelingt, mit nicht wenigen szenischen Momenten und einer insgesamt guten bis überwältigenden musikalischen Interpretation die „Ring“-Welt wieder ein wenig neu und doch überzeugend auszumessen. Riesenbeifall für alle, keine Buhs für die Regie: die Kasseler Wagner-Welt hat, Jahre nach dem konzeptionell exzellenten „Leinert-Ring“, einen weiteren bildstarken und dramatisch meist packenden „Ring“ erhalten.
P.s. Dieser Meinung war übrigens auch eine vielleicht 17jährige, die am Abend neben mir saß und mir kurz vor dem 3. Akt sagte, dass ihr die Aufführung „sehr gut“ gefalle. Wie gesagt: Die (Opern)-Welt ist nicht verloren – solange es begeisterte Zuschauerinnen gibt, die ca. 125 Jahre nach der Premiere des Werks geboren wurden.
Frank Piontek, 9.3. 2020
Fotos: © Nils Klinger
Leonard Bernstein
CANDIDE
29.1. 2020
Broadway Revival 1974 Version

Die Ouvertüre ist wohlbekannt als funkelndes Konzertstück, die Arie der Kunigunde „Glitter and be gay“ dient mit ihren exaltierten Koloraturen als Schaustück für stimmversierte Soprane. Aber das Ursprungswerk dieser Evergreens, Leonard Bernsteins „Candide“, gehörte bisher eher in die B-Reihe der Repertoire-Lieblinge. Das änderte sich mit dem 100. Geburtstag Bernsteins 2018: Plötzlich war die zwischen Oper, Operette und Musical balancierende Voltaire-Vertonung in den Spielplänen präsent. Von Wien bis Weimar, von Berlin bis Bremen häuften sich die Versuche, der Satire mit dem irrwitzigen, messerscharfen Libretto von Hugh Wheeler (1974) oder der Voltaire-Adaption vom John Wells (1988) beizukommen. So auch am Staatstheater Kassel, wo sich Regisseur Philipp Rosendahl und die Dramaturgen Maria Kuhn und Christian Steinbock für die Fassung von 1974 entschieden, die am Broadway erfolgreich war und mit Auszeichnungen (Tony Awards, Drama Desk Awards) überhäuft wurde.

Zu erzählen ist die Reise durch die „beste aller Welten“ – bei Voltaire eine bissige Satire auf Gottfried Wilhelm Leibniz – nicht einfach linear. Denn die Unwahrscheinlichkeiten häufen sich: Candide, ein Provinzbürschlein aus Westfalen, gerät unter grausame bulgarische Angreifer, muss das berüchtigte Lissaboner Erdbeben miterleben. Wird übers spanische Cadiz nach Montevideo geschleust, erlebt das sagenhafte El Dorado, strandet auf einer einsamen Insel und findet nach einem Intermezzo in Konstantinopel zum weisesten Mann der Welt. Der ist kein anderer als jener Doktor Pangloss, der ihm schon am Anfang seiner Irrfahrten die These von der „besten aller möglichen Welten“ verkündet hatte.
Bernstein und Wheeler stürzen sich in diesen abenteuerlichen Parcours und schöpfen ihn genüsslich-grotesk aus. Und Philipp Rosendahl macht mit seinem Co-Regisseur Volker Michl das einzig Richtige: Er lässt in einer nach vorne geöffneten, nach High-Tech aussehenden Kuppel auf der Bühne des Teams Daniel Roskamp/Brigitte Schima eine distanzierte, vielfach gebrochene Show ablaufen, die unweigerlich fragen lässt, ob wir es mit Menschen, Marionetten, Cyborgs oder einfach nur einem höheren Kasperltheater mit Kuh und Schafen zu tun haben.

Dass der naive Candide, von Daniel Jenz in köstlicher Mischung aus baritonalem Ernst und aufgedrehter Überzeichnung gesungen, erst einmal einen Schwan erlegt, legt den Rückgriff auf den „reinen Tor“ nahe; dass im Hintergrund der Bühne auf einem runden Bildschirm rätselhafte, graphisch verbildlichte Operationen (Video: Daniel Hengst) ablaufen, deutet an, dass der transzendente Weltschöpfer längst durch undurchschaubare, alles bestimmende Programme abgelöst sein könnte: Garanten für die Sinnlosigkeit der Welt, die als einzige Antwort die ins Surreale gesteigerte Groteske zulässt?
Dabei stellt Candide durchaus die existenziellen Fragen: Ob das Leben nur „happyness“ und wozu die Welt erschaffen sei, was aus dem Schlechten resultiere, ob Güte nur Lüge sei und ob man nur lebt, um zu sterben. Die Antworten bleiben in den irrwitzigen Kurven der imaginären Lebensfahrt stecken, in denen vergewaltigt, verstümmelt und gemordet wird, die aber auch die wundersamsten Errettungen und Wiederauferstehungen parat haben. Die Kasseler Inszenierung findet dafür zwischen Märchen und Groteske einen sicheren Pfad, verfremdet die Personen mit hoffmannesker Mechanik, dick aufgetragenen Posen oder ironisch überladenen Show-Gesten. Dass es für alles unter der Sonne einen Grund gebe, diese Annahme wird mit leichter Hand zur Absurdität erklärt. Zwischen Willkür und Ignoranz, Dummheit und Zufall gibt es keine Spur von Sinn. Auch der Schluss mit seinem naiv hintersinnigen Rekurs auf arkadisch-friedliches Landleben oder Paradiesgärtlein-Visionen unterstreicht nur, dass es diesen Figuren nicht gelingen dürfte, dem Chaos der Welt zu entgehen. Das alles absolut nicht ernst zu nehmen, bleibt die einzige Methode, die Verzweiflung zu vermeiden.
Dank des fabelhaft spielfreudigen Kasseler Ensembles gelingt es, die Spannung des Unernstes zu halten und das Absurde unterhaltsam zu präsentieren, ohne in schwere Ernsthaftigkeit abzudriften. Philipp Basener als mal zynisch, mal kokett schnarrender Erzähler – zugleich Pangloss und weisester Mann der Welt – manövriert sich in Leibchen, Corsage und dekonstruiertem Reifrock durch die verrückte Welt. Lin Lin Fan tiriliert sich mit feiner Stimme durch die überdreht kichernden Koloraturen der Kunigunde.

Daniel Holzhauer ist als Maximilian ein selbstgefälliger blonder Strahlemann und Belinda Williams kehrt als Paquette ihren abgebrühten Sarkasmus noch mehr heraus als die allfälligen weiblichen Reize. Als alte Dame hat Inna Kalinina mit ihrem Assimilations-Song einen grandiosen Auftritt. Bassem Alkhouri schlüpft in nicht weniger als sieben Rollen, von denen die eindrücklichste wohl die des Königs ist – ein karikiert aufgeblasener Donald Trump. Cozmin Sime als wollüstiger, aber glaubensstrenger Großinquisitor sowie Marc-Olivier Oetterli, Michael Boley und Bernhard Modes in vielfältigen Rollen – alle rücksichtlos quietschfidel kostümiert – halten wandlungsfähig die Spannung auf stets gleicher Höhe.
Ihre ganze Brillanz versprüht die Musik: Alexander Hannemann hat in der Ouvertüre noch Mühe, die Balance zwischen den kräftig besetzten Bläsern und der zu dünnen Streichergruppe herzustellen; das Orchester aus 16 Solisten artikuliert noch weich. Aber die markanten Pointen in Bernsteins Instrumentation brechen sich bald ihre Bahn und die vielfältigen Tanzrhythmen, die herrlich sentimentale Melodie des Duetts Candide-Kunigunde, die krachenden „Carmen“-Anklänge bei der Abfahrt nach Cadiz und der Neue-Welt-Tanzsound für die Südamerika-Szenen fetzen und zünden. Allein um dieser Musik willen lohnt es sich, dieses Stück auf die Bühne zu bringen; für eine überzeugende Inszenierung braucht es – wie in Kassel zu erleben – den entsprechenden Sinn fürs Absurde und eine von kluger Ironie gewürzte, humorvolle Distanz zum Drang des Erzählens.
Werner Häußner, 12.2.2020
Besonderer Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (WIEN)
Bilder (c) Staatstheater
CAVALLERIA RUSTICANA / I PAGLIACCI
Premiere: 12.10. 2019. Besuchte Vorstellung: 16.10. 2019
Was unterscheidet die sog. veristische Oper von anderen Opern? Einzig die Tatsache, dass die Sterbenden keine langen Abschiedsarien mehr singen – das war es auch schon. Der Begriff der „veristischen“ Oper, die angeblich besonders realitätsnah ist, sollte endlich zu den Akten gelegt werden. Es ist schließlich kein Zufall, dass so ziemlich alle „veristischen“ Opern nicht im bäuerlichen Milieu spielen (so wie die beiden oft gekoppelten Kurzwerke), sondern in gleichsam höheren Sphären: Tosca, André Chenier und Adriana Lecouvreur… Mag sein, dass „Cavalleria rusticana“ in die Schublade des Realismus und „I pagliacci“ in die des Naturalismus gepackt werden kann (als habe Gerhart Hauptmann die Geschichte vom ausrastenden Komödianten entworfen) – in einer echt veristischen Oper dürfte streng genommen nicht einmal gesungen werden.

Jede Konzeption von modernen Aufführungen dieser beiden Opern hat es mit dem Problem der Anbindung an die Gegenwart zu tun. Darin unterscheidet sich „I pagliacci“ nicht von „Le nozze di Figaro“, denn auch Leoncavallos Oper spielt in einem nichtmodernen Milieu, das unserer sozialen Erfahrung weit entrückt ist. In dem kalabrischen Dorf gibt es eben kein Staatstheater und kein Fernsehen, auch kein Internet, das die Informationen und das Theater der Gegenwart den Einwohnern einmal jährlich bringt. Wo also spielen diese beiden Opern in Kassel? Sie spielen im von Herbert Murauer entworfenen Kunstraum einer Einheitsbühne mit Erinnerungen an die italienische Wirklichkeit und Filmfiktion: „Cavalleria“ arbeitet, wie die „Pagliacci“, mit einer intimen Vorder- und großen Hauptszene, setzt zudem in erhöhtem Maße Videoprojektionen und Live-Einspielungen der Protagonisten ein. Gut! Denn so können selbst die Zuschauer vom Rang aus die emotionalen Spannungen beobachten, die sich in den Gesichtern der Figuren abzeichnen. Wir sehen also das Lächeln, das sich allmählich in den Gesichtern von Santuzza und Turridu abzeichnet, nachdem sie sich ihre fatalen Worte an den Kopf geworfen haben – wenn Lola hinter der Szene ihr beziehungsreiches Liedchen singt und gleich in überdeutlichem Rot auftreten und die beiden gleichsam stören wird.

Für den Regisseur Tobias Thorell ist die Geschichte von Santuzza und Turridu, Lola und Alfio und Mamma Lucia zudem eine Passionsgeschichte. Laufen schon die Figuren der Aufführung, die am Ostersonntag stattfinden soll, über die Bühne, imaginiert sich Santuzza in die Gestalt der von sieben Schwertern durchbohrten und blutige Tränen weinenden Muttergottes hinein; das schwarzweiße Filmbild transportiert den Neorealismus ins Fantastische. Fantastisch ist auch Santuzzas Wunschtraum eines geglückten Zusammenleben mit Turridu und all den anderen Protagonisten der sizilianischen Tragödie. Während sie, das Opfer ihrer Gefühle, nach der Auseinandersetzung mit dem einstigen Geliebten im Intermezzo wie versteinert auf einem Stuhl sitzt, sehen wir zugleich, wie die Mamma den beiden glücklichen Paaren Kaffee einschenkt. Über allen aber strahlt manchmal, zwischen den seitlichen Kabinenein- und ausgängen, der Himmel einer Barockkirche, unter dem die „Gesellschaft“, die doch von allen intimen Auseinandersetzungen ausgeschlossen ist, die Stühle durcheinander schiebt, die der Mesner gerade erst für die Messe mühselig geordnet hat. Der kleine Engel, der im Vorspiel noch Santuzza beobachtet hat, ist da schon längst verschwunden.

Der schöne Symbolismus der Aufführung, dem der Realismus der zwangsläufig ins Blutige abdriftenden Handlung zugeordnet wurde, findet leider nicht ganz im Musikalischen eine Entsprechung. Die Schwachstelle dieser Abends liegt im Tenor. Der Turridu des Gasts Marius Vlad verfügt nämlich leider nur über einen sehr engen und gepressten Ton, der indes für den Canio zwar nicht schön, doch immerhin charakteristisch klingt. Erstaunlich angesichts der Tatsache, dass sich die Tessitura des Turridu vor allem in der Mittellage bewegt. Dafür glänzt Khatuna Mikaberidze als lyrisch angelegte, doch dramatisch-schmerzhaftes Melos nicht scheuende Santuzza – so wie später die exzellente Ani Yorentz als Nedda. „I Pagliacci“ spielt, deutlicher noch als es in „Cavalleria“ sichtbar war, mit der Metapher des Theaters auf dem Theater – logisch, doch wird die Idee erweitert. Dass der Prolog von einem Akteur gesungen wird, der vorher durchs Parkett ging und sich an der Garderobe auf der Bühne auf der Bühne geschminkt hat, ist business as usual, doch wenn am Ende der Vorhang auf der Bühne fällt, der, wie in „Cavalleria“, die Vorderbühne von der Hauptbühne trennte und schließlich nur Nedda hinter demselben tot liegenbleibt, während Silvio, der in einem Spiel im Spiel im Spiel agierte, übrig ist, weil er eben nur spielte, haben wir es mit einer reizvollen und durchaus originellen Bestätigung des Satzes zu tun, dass eh alles nur Theater ist: selbst der „Tod“, selbst das „Leben“ auf der Bühne. Soviel zur „Wahrheit“, die in einer Oper (angeblich) komponiert wurde.

Die Schülerinnen, die hinter dem Rezensenten saßen, mögen dieses hintersinnige Spiel nicht ganz begriffen haben. Es verschlägt nichts, denn wichtiger ist die Tatsache, dass das Jugendabo fleißig in den Reihen vertreten war und die 16-17jährige, die hinter mir saß, beim Auftreten der Komödianten und dem Einsatz des guten Kasseler Opernchors (geleitet von Marco Zeiser Celesti) und des Jugendchors namens Cantamus-Chor große, begeisterte Augen machte. Und wenn, hier wie in „Cavalleria“, Gregory Peck als trauriger Held eines „Roman Holiday“ Audrey Hepburn im Arm hat und in Zeitlupe und immer wieder küsst, bleibt eh kein Auge trocken… Auch nicht, wenn der hervorragende Hansung Yoo als Tonio und als präpotenter Alfio, der eine Reihe von Choristen brutal beherrscht, baritonal glänzt. Der Gast Nikola Diskic spielt hingegen einen eher blassen, nicht besonders ausdrucksstarken Silvio und Inna Kalinina eine vokal zurückhaltende, aber szenisch überzeugende Mamma Lucia. Das Orchester aber darf unter der subtilen Leitung von Mario Hartmuth sowohl die lyrisch-pastosen Seiten der „Cavalleria“ als auch die drastischen, klangkoloristisch brillanten Passagen der „Pagliacci“ optimal herausspielen.
Wann spielen die Opern? Wenn sie im Zwischenraum von Theater und „Wirklichkeit“ so bildmächtig, vokal meist sehr gut und schauspielerisch intensiv gebracht werden, muss die Frage glücklicherweise nicht genau beantwortet werden – und ist es nicht so, dass die Affekte, von denen die Figuren besessen sind, tatsächlich zeitlos scheinen?
Frank Piontek, 18.10. 2019
Fotos: ©Nils Klinger
DIE WALKÜRE
Premiere: 9.3.2019. Besuchte Aufführung: 28.4.2019
TRAILER
Oder anders: Die Halbschwester der Walküre

Nadja Stefanoff: Der Name muss zuerst genannt werden – denn sie packt den Hörer und Zuschauer vom ersten Moment an. Sie ist eine Sieglinde, wie sie sein soll: extrem wortverständlich und dramatisch vollkommen, innig und hysterisch, intelligent und verzweifelt, mit einem Wort: Nadja Stefanoff ist – das geht nicht gegen die anderen Sängerinnen, die an diesem Abend auf der Bühne stehen – die Königin des Abends. „Sie muss schlank und tüchtig sein“, schrieb der Komponist am 2. Januar 1875 an seinen Mannheimer Paladin Emil Heckel über die Darstellerin der Sieglinde – Nadja Stefanoff ist all das. Sie wirft sich mit einer niemals überagierenden Inbrunst, die man selbst in guten Aufführungen nur selten sieht, in die Rolle. Zusammen mit Martin Ilievs Siegmund ist sie die Frau im Dreamteam der Wälsungentragödie. Das „W“, das sich als Neonskulptur durch diesen „Ring“ zieht, heißt nicht allein „Wotan“, „Walhall“, „Weltherrschaft“, „Wagner“, „Walküre“ oder „Weh“. Es heißt, mit Blick auf die starken Frauen und Sängerinnen dieser hinreißenden „Walküre“-Aufführung, zuallererst „Weib“ und „Wonne“. Denn zärtlicher und erotischer kann man und frau die Begegnung und die aufkeimende amor fou zwischen Siegmund und Sieglinde nicht zeigen. Verzweifelter und sensibler kann die Flucht der beiden nicht ausgemalt werden.

Selten habe ich die Todverkündigung so spannungsvoll und, ja: so schön und innig erlebt: denn Brünnhilde steht im Rücken der Zuschauer, auf dem dunklen Rang, während wie minutenlang dem in mystisches Licht getauchten Geschwisterpaar dabei zusehen, wie schauspielerisch diffizil es auf die Ankündigung reagiert. Und was macht die nicht angesprochene Schwester? Sie flüstert dem Bruder die Fragen No. 2 und 3 ins Ohr. Sinkt sie schließlich wieder in Schlaf, so erwacht sie panisch, als ihr Geliebter ihr das Schwert an den Hals legt, womit ihr nächstes Trauma schon in Anmarsch ist. Muss man sich wirklich darüber wundern, dass Sieglinde bei der Geburt des Sohnes sterben wirdt? Und schließlich: Nadja Stefanoff singt die Hochzeits-Erzählung wie ein dramatisches Lied: glasklar, bewegt und schier bewegend. Dagegen schmiert – pardon – selbst die Version der wunderbaren Jeannine Altmeyer ab, die im Film der zurecht legendären Chéreau-Inszenierung festgehalten wurde. Respekt für diese AUSSERGEWÖHNLICHE Leistung, die doch, siehe Wagners Ansprüche an eine intelligente Sänger/Darstellerin, der Normalfall sein sollte. Voilà, wir waren dabei: beim Musik-Drama.
 Markus Dietz, Oberspielleiter am Kasseler Schauspiel, hat nun, mit mehr Glück als beim bereits beachtlichen, also typischen Kasseler „Rheingold“, seine Spieler zu Höchstleistungen animiert, die diesen Abend so kurzweilig machen. Apropos „Konzept“: Es besteht, darauf verweisen schon die „Notizen zur Kasseler Neuinszenierung“, die im Programmheft nur wenig mehr als eine bekannte Interpretation des Stoffs bringen, weniger in irgend einer mehr oder weniger blödsinnigen „Neudeutung“ oder „Befragung“ als in einer handwerklich sauberen und genauen Erzählung dessen, was jeder „Ring“-Kenner kennt: was kein Manko ist. Bewegen wir uns auf der Bühne von einem fast leeren Raum, der aseptischen Hunding-Halle, über den im 2. Akt ausgebrannten Saal in den Schluss-Akt, in dem die Hubpodien und das große leuchtende „W“ die von Mayke Hegger entworfene Bühne strukturieren, so ziehen wir mit den Protagonisten durch einen zerstörten Kriegsraum, bis wir im Abstrakten eines märchenhaften Feuerzaubers landen. Dies ist die deutlichste Setzung der Interpretation: „Die Walküre“ muss als ein Drama in Zeiten des Krieges verstanden werde - zuallererst als ein Krieg Mann gegen Frau. Im Vorspiel überwältigen acht schwarze Hundings-Männer eine leicht- und weißgekleidete Frau, eine Schwester Sieglindes; als Hunding seine Geschichte erzählt, legen sie – das ist überflüssig verdoppelnd und doch stark, den toten blutigen Körper der Frau, der Mutter auf den Tisch. Es geht, darauf basierend, weiter: Ehemann gegen Liebhaber, Ehemann gegen Ehefrau (und dies gleich zweimal: Hunding gegen Sieglinde, Wotan gegen Fricka), Vater gegen Tochter, der Gott gegen den Zwerg… Hier röhrt nicht nur Hundings Bass, hier röhrt auch eine schwere Maschine.
Markus Dietz, Oberspielleiter am Kasseler Schauspiel, hat nun, mit mehr Glück als beim bereits beachtlichen, also typischen Kasseler „Rheingold“, seine Spieler zu Höchstleistungen animiert, die diesen Abend so kurzweilig machen. Apropos „Konzept“: Es besteht, darauf verweisen schon die „Notizen zur Kasseler Neuinszenierung“, die im Programmheft nur wenig mehr als eine bekannte Interpretation des Stoffs bringen, weniger in irgend einer mehr oder weniger blödsinnigen „Neudeutung“ oder „Befragung“ als in einer handwerklich sauberen und genauen Erzählung dessen, was jeder „Ring“-Kenner kennt: was kein Manko ist. Bewegen wir uns auf der Bühne von einem fast leeren Raum, der aseptischen Hunding-Halle, über den im 2. Akt ausgebrannten Saal in den Schluss-Akt, in dem die Hubpodien und das große leuchtende „W“ die von Mayke Hegger entworfene Bühne strukturieren, so ziehen wir mit den Protagonisten durch einen zerstörten Kriegsraum, bis wir im Abstrakten eines märchenhaften Feuerzaubers landen. Dies ist die deutlichste Setzung der Interpretation: „Die Walküre“ muss als ein Drama in Zeiten des Krieges verstanden werde - zuallererst als ein Krieg Mann gegen Frau. Im Vorspiel überwältigen acht schwarze Hundings-Männer eine leicht- und weißgekleidete Frau, eine Schwester Sieglindes; als Hunding seine Geschichte erzählt, legen sie – das ist überflüssig verdoppelnd und doch stark, den toten blutigen Körper der Frau, der Mutter auf den Tisch. Es geht, darauf basierend, weiter: Ehemann gegen Liebhaber, Ehemann gegen Ehefrau (und dies gleich zweimal: Hunding gegen Sieglinde, Wotan gegen Fricka), Vater gegen Tochter, der Gott gegen den Zwerg… Hier röhrt nicht nur Hundings Bass, hier röhrt auch eine schwere Maschine.

Schon die Walküren des letzten Kasseler „Ring“ kamen auf Motorrädern auf die Bühne, um in den Winterkrieg zu fahren., Endstation Stalingrad. Nun sitzt Fricka auf dem Teil, vor ihr der Fahrer, der offensichtlich auch ihr Lover ist: eine zart dröhnende und durchaus witzige Hommage an Michael Leinerts wichtigem und konzeptionell hervorragendem „Ring“ - und eine Möglichkeit, ein aufgetuntes Widdergespann auf die Bühne zu bringen, von dem, glaube ich, nicht nicht einmal diejenigen Zuschauer träumen, die glauben, dass so etwas wie „Werktreue“ im Sinne des Wagner des 19. Jahrhunderts heute noch möglich ist. Abschliffe, an die der Zuschauer sich nicht gewöhnen sollte, sind natürlich dort vorprogrammiert, wo eine altgermanische Waffe in der Wand eines Lofts, in dem der Blick zunächst auf die bunten Alkoholika in einer glaslosen Lichtvitrine fällt, so absurd ist wie der Kampf eines Jagdwaffenbesitzers mit einem Schwertträger. Aber was soll ein Regisseur auch machen, wenn er nicht ausschließlich auf Waffen der Gegenwart zurückgreifen will und kann? Woe Gertrude Stein schon so schön sagte: Ein Schwert ist ein Schwert ist ein Schwert. Immerhin wird im nächtlichen Kampf, der tatsächlich, Sieglinde sagt's ja, im Dunkel vor sich geht, ein abstraktes Lichtschwert und ein Lichtspeer eingesetzt: was vermutlich als Zitat aus der Popkultur des Fantasy-Films gedeutet werden darf.

Die typischen Probleme der Wagner-Regie, sie scheinen auch in Kassel unlösbar zu sein. Der Zuschauer vergisst sie schnell, wenn prägnante Sänger und Darsteller auf einer Bühne stehen, die das Drama unterstützt und nicht mit einer willkürlichen Meta-Ebene zubaut. Werden Ulrike Schneider (Fricka) und Nancy Weißbach (Brünnhilde) als indisponiert angekündigt, so kann der Hörer sich nur die Ohren reiben: Beide singen so, wie man es aus Kassel gewöhnt ist. Ulrike Schneider scheint die dramatisch konturierte Partie der Walküre-Fricka wesentlich besser zu liegen als die des „Rheingolds“ (aber vielleicht hatte sie letztens auch nur einen schwachen Abend), und Nancy Weißbach ist ganz Wotanstochter und herzhaft mitleidende Halbschwester und kommt gut durch die technisch höchst anspruchsvolle Partie.
Die anderen Halbschwestern haben übrigens schon im zweiten Akt, dann wieder am Schluss zu tun. Schon während Wotans Jubelszene begleiten sie, vielleicht ein bisschen zu offensiv anfeuernd, ihren Papa, und schließlich bedecken sie Brünnhilde mit jenem Glanzstoff, den sie schon am schöngewandeten Leib tragen: Sexy Halbgöttinnen, die die zuckenden wilden Kerle wie SM-Ladys am Schnürl führen. Das Oktett hat auch rein akustisch schlicht Klasse: den schick-schönen Kostümen Henrike Brombers und den von Ungenannt hergestellten Masken samt Perücken und gestylten Echthaaren entspricht die selten zu hörende Einträchtigkeit ihrer höchst anspruchsvollen Einsätze. „Nebenrollen“? In der „Walküre“ gibt es sie nicht.

Bleiben die anderen Hauptrollen: Martin Iliev singt einen Siegmund, der in der Artikulation, ein wenig auch im Klang an den großen Kollegen Placido Domingo erinnert, der sich nach 1000 anderen Rollen auch den Siegmund erarbeitet hat. Iliev singt mit einem Ton, den man südamerikanisch nennen möchte: anrührend, heldisch, doch nicht dröhnend, sondern schlicht und einfach potent, im Ganzen immer einen Bogen haltend, immer klanglich gut kontrolliert und zugleich atemstark. Für Statistiker: die Wälse-Rufe dauerten sechs bis sieben Sekunden (und klangen nicht angestrengt). Großartig, weil stahlklar, fokussiert, also durchaus nicht gottlobfrickig finster und zerknautscht: der eher zynisch als brutal auftretende Hunding des Yorck Felix Speer; man darf sich auf seinen Hagen freuen. Bleibt Robert Bork als Wotan. Spielen kann dieser gute Sänger, dem drei Gesten zur Verfügung stehen (1. Kleine Bewegung mit dem rechten Arm 2. Schaufelbewegung mit dem rechten Arm. 3. Rechte Hand an den Mund), zwar nicht, aber als Ersatz für Egil Silins, der Wotan in dieser „Walküre“ sonst sang, ist er mit seinen 60 Jahren vokal noch so gut bei Kräften, so dass er bis zum Abschied gut bis sehr gut „durchkommt“. Gut ist auch die Idee, ihn und Brümmhilde bei seinem Monolog nicht auf der Bühne, sondern vorn rechts auf dem Orchesterrand zu platzieren, bevor in seinem wütenden Abgang das Motorrad akustisch beeindruckend von der Bühne brummt. Hätte Wagner gewusst, dass es irgend wann einmal solche Klangerzeugungsgeräte gibt, hätte er sicher nicht nur eine Donnermaschine in der „Walküre“-Partitur untergebracht… Ein lieber weißer Hund, irgendetwas zwischen Schäferhund und Colly, hat übrigens im Auftritt der Men in Black, der schon während des Vorspiels erfolgte, nicht nur nach den Leckerli seines Herren geschnappt, sondern auch herzhaft mitgebellt – als wär's ein Stück aus dem „Tannhäuser“. Und genannt werden MÜSSEN wieder die Statisten, denn sie tun nicht nur als Hundingsmannen, sondern auch als Walkürenopfer und als mystisch beleuchtete nackte Tote aus jenem Jenseits, das Brünnhilde dem Siegmund verheißt, gute Dienste.

So wie das Orchester, das erstrangige Staatsorchester Kassel, das unter dem GMD Francesco Angelico einen Wagner vom Feinsten hervorbringt. Die Kasseler wissen, wie man leiseste Töne produziert, ein samtener Streicherteppich zieht ins Herz hinein, die Tupfer der Klarinette erinnern nicht allein in den „Winterstürmen“ an Mendelssohns Süßklang. Wo der Orchesterklang schlank ist und vom ersten bis zum letzten Takt eines Aktes ein einziger großer Bogen die Spannung hält, wirken die relativ wenigen „lauten“ Stellen umso ergreifender: der blechbläserne, dynamische Höhepunkt des Siegmund-und Sieglinde-Jubels (nach dem Herausziehen des Schwerts) kommt genauso überlegt wie das vergleichsweise vorsichtige, also eben nicht brutale Reiten der Walküren über die Rampe.
Aber gab es diesmal nicht, abgesehen von der erwähnten und offensichtlich kaum vermeidbaren szenischen Absurdität, irgend etwas zu beckmessern? Denn vollkommene „Ring“-Aufführungen sind bekanntlich so selten wie ein geglückter Inzest. Tatsächlich: Der „Wonnemond“ kommt trotz der beiden hervorragenden Sänger/in und des impressiven Orchesterklangs nicht so, wie er kommen sollte: herzergreifend, rückenmarkerschütternd.

Statt Licht sehen wir, nachdem sich die Rückwand zu einem nachtdunklen Raum gehoben hat, auf die schlafenden Hundingsmänner. Der Effekt bleibt aus: Ich begriff, dass die Utopie der Freiheit nicht im Frühlingsmondlicht steckt, aber ich wurde an dieser Stelle nicht bewegt. Es spricht jedoch für die Güte und den interpretatorischen Glanz dieser spannenden Produktion, dass ein derartiges Versagen die Szene der Aufführung als Ganzes nicht im Geringsten tangiert. Denn ihr gelang der Spagat zwischen einer symbolhaften wie konkreten Optik und einer „normalen“ Erzählung im Lichte unserer Psychologie, wie der Wagnerkenner Thomas Mann vielleicht gesagt hätte. Und Nadja Stefanoff hätte gewiss auch er gelobt.
Frank Piontek, 30.4. 2019
Fotos © Nils Klinger
MADAMA BUTTERFLY
Premiere am 8. Dezember 2018
Besuchte Vorstellung Mittwoch, 13. März 2019
Das Grauen, das Grauen... - eine etwas andere Butterfly-Sicht

Pinkerton Merunas Vitulskis / Butterflys Seele Jessica Kirstein
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich habe in den vielen Jahren meiner Kritikertätigkeit selten so spannendes, sinnvoll umstilisiertes und überzeugend durchdachtes Musiktheater gesehen und regelrecht durchfiebert. Auch nach 50 Jahren gibt es sie noch, die Momente, wo das Herz ergriffen bis zum Hals schlägt. Hier ist es ein Herz in der Finsternis, um Joseph Conrads Titel etwas zu verändern. Diese Inszenierung ist eine Geisterbahnfahrt in die Welt des Grauens.
Regisseur Jan-Richard Kehl gelingt es, dieses schöne, aber doch meist allzu verquast kitschige Epos kritisch durchdacht und durchaus werktreu - wenn man nicht gerade in den Steinzeitmomenten des Wiener Staatsopernmuseums lebt - auf die Bühne unserer 2019er Gegenwart zu bringen. Damit beantwortet er auch die Frage, ob und warum Oper - besser Musiktheater - auch heute noch eine Berechtigung hat und erhaltenswert ist.

Das Regieteam inszeniert weder gegen den Text, noch gegen die wunderbare Musik Puccinis. Im Gegenteil: hier kommt die ungeheure Dramatik des Komponisten sogar noch viel besser zur Geltung, als im konservativ exotischen Theater oder den verlogenen Japan-Klischees, wie wir sie ja aus den meisten traditionellen Butterflys kennen. Diese Butterfly ist eigentlich eine echte Problemoper, eine Herausforderung für mitdenkende Opernregisseure.
Was macht man mit einer Partie/Hauptrolle - und hier liegt ja das große Problem der Butterfly, ähnlich der Strauss'schen Salome - die eine 15-Jährige darstellt, aber nur von einer hocherfahrenen Sängerin mit Monsterstimme überhaupt bewältigt werden kann? Und was macht man mit einem Publikum, dessen Altersschnitt in der heutigen Oper bei deutlich über 60 liegt (den Rezensenten eingeschlossen) und welches wie selbstverständlich erwartet, das Taschentuch zücken zu müssen, weil sich die liebe Mutti quasi vor den Augen ihres meist drollig, süß-niedlichen Kindleins massakriert? Das ist doch Kernbestandteil der Oper Puccinis! Wir haben ein Recht auf Tränen? Wirklich?

Chio Chio Sans Seele Jessica Kirstein / Butterfly real Celine Byrne
Wie begegnet man dem unsinnigen Klischee diverser Opern-Produktionen, daß man ältere Sopranistinnen auf japanische Jung-Geisha schminkt, und sie dann blödsinnig kindisch umhertippelnd läßt, wo sie dann eher Lachanfälle als Betroffenheit beim Publikum auslösen?
Wie geht man mit der Atombombe auf Nagasaki in einer zeitgemäßen Inszenierung um, die ja eigentlich in dem Lokalkolorit der Zeit erheblich betroffener machen müßte, als der leidige Tod der Chio Chio San? Wie mit dem damaligen mörderischen Zeitgeist des Kolonialismus?
Das alles löst dieses begnadete Regieteam - Bühne Ralf Käselau, Kostüme Annette Braun & Licht Stefanie Dühr - auf höchst formidable Art und Weise. Man macht mit düster wehenden Vorhängen, alten Schloßkostümen, diversen unheimlichen Türen und schauderlichen Lichteffekten fast eine Gothic Novel aus dieser Opera. Der strahlende Pinkerton ist hier am Anfang noch der nahkampferprobte Marine im Kampfanzug - sogar Blut klebt noch an seinen Stiefeln. So rüde und rücksichtslos wie er kämpft, besorgt er sich auch ein Liebchen.

Zum ersten Mal in einer Oper erlebte ich überzeugend das Problem der Splittung einer Person in zwei Seelen und zwei Körper. Da ist die bildhübsche und hocherotisch wirkende Butterfly-Seele - in realiter Jessica Kirstein. Die moderne Geisha - zeitgemäße Sexsklavin - nimmt man ihr ab. Ein junges Top-Model mit Mandelaugen, die ihr Zuhälter Goro zu Recht hochpreisig verkaufen kann. Sie ist immer präsent, während Celine Byrne die Partie singt und auch überzeugend musiktheater-darstellerisch agiert. Das ist schwer zu beschreiben, man muss es gesehen haben. Es endet auf der Bühne aber niemals in einer ménage a troi, sondern beendet den ersten Teil sowie das tragische Finale geradezu herzergreifend.
Natürlich braucht es kein Kind in diesem Konzept. Kinder auf der Bühne sind ja ohnehin meist schwierig in dramatischen Momenten einzusetzen. Hier bildet sich Butterfly nur ein, daß sie ein Kind von Pinkerton hat. Es ist eine Puppe, die sie immer mit sich trägt oder an die Wand hängt wie ein Bild, ein Erinnerungsfoto.
 Im zweiten Teil warten zwei alte Frauen, gekleidet wie die Geister in einem uralten Schloß (Dame blanche) - von Strahlung noch dazu gekennzeichnet - eigentlich nur noch auf den Tod. Da hat man Tränen in den Augen, vor allem weil die wunderbare Musik Puccinis hier immer noch stimmt und erschreckend endzeit-stimmig ist.
Im zweiten Teil warten zwei alte Frauen, gekleidet wie die Geister in einem uralten Schloß (Dame blanche) - von Strahlung noch dazu gekennzeichnet - eigentlich nur noch auf den Tod. Da hat man Tränen in den Augen, vor allem weil die wunderbare Musik Puccinis hier immer noch stimmt und erschreckend endzeit-stimmig ist.
Natürlich gibt es das blutige Ende des Alteregos der Butterfly - aber ist das alles Imagination? Wunschvorstellung? Wahnsinn? Am Ende erkennen wir die rätselhafte alte Frau vom Anfang wieder. Da sind wir in der Realität gelandet. Chio Chio San hat sich eben nicht umgebracht. Sie hat das Kind erfunden - ebenso wie die junge Geisha. Alles endet in einer beunruhigenden Morbidität, die berührt. Der Zuschauer ist mitgenommen und mehr erschüttert als durch ein traditionelles Harakiri. Unfaßbar. Was für eine Inszenierung!
Ein Musiktheaterabend, den man so schnell nicht vergißt, der unter die Haut geht...
Wenn dazu noch gesungen wird wie an der MET - ich möchte pars pro toto die grandiose Marta Hermann (Suzuki) noch neben die Weltstimme von Celine Byrne (Butterfly) stellen und auch die Herren Merunas Vitulkis (Pinkerton), Hansung Yoo (Sharpless), sowie Bassem Alkhouri (Goro) gleichermaßen ins herausragende Lob einbeziehen - dann ist der Puccini-Fan sowie der eigentlich konservative bärbeißige Rezensent gleichermaßen beglückt wie das Publikum.
Selbstredend und last but not least unbedingt noch erwähnenswert, ist das traditionell immer gute Staatsorchester Kassel unter Mario Hartmuth mit einem ergreifenden Sound und dem nötigen Rubato, aber ohne kitschiges Pathos. So sollte moderner Puccini klingen.
Für diesen Meilenstein an Inszenierung lohnt sich auch die weiteste Anfahrt.
Peter Bilsing 16.3.2019
Bilder (c) Staatstheater
Das Rheingold
Premiere: 1.9.2018.
Besuchte Aufführung: 17.10.2018
Den kleinen Metallring kann man sich bereits ans Revers heften, obwohl er auf der Bühne noch nicht gänzlich gelungen ist. Zumindest hat man in Kassel wieder begonnen, die Tetralogie zu schmieden: zum 5. Mal nach 1945.
Kassel war immer gut für „Ringe”, die überregional Furore machten. Hier entstand um 1970 mit einem extrem politischen Pop-“Ring” der wohl modernste „Ring” der Nachkriegszeit, gegen den selbst Wieland Wagners Arbeiten wie Fingerübungen wirkten. Der letzte „Ring”, der ab 1994 in der Documenta-Stadt geschmiedet wurde, erzählte – absolut überzeugend und widerspruchsfrei – mit Hilfe der vier Teile nicht weniger als über 120 Jahre deutsche Geschichte: von Wagners Gründerzeit (das Festspielzeit als stolzes Symbol) über die Weimarer Republik mit ihren Fememorden (Siegmunds Verfolgung), den Winterkrieg in Russland (Walküre III), die Nachkriegsmisere (in Mimes Wohnküche), die Hippiebewegung (Siegfried und Brünnhilde) in die Gegenwart der Industrialisierung und des wuchernden Kapitalismus. Dass dieser heute und hier anders aussieht, konnte sich das Leitungsteam damals freilich nicht vorstellen. Auch musikalisch überzeugte dieser „Ring”, unter der Leitung des regieführenden Intendanten Michael Leinert und des damaligen GMD Roberto Paternostro zumeist. Jeder neue Kasseler „Ring” steht also unter dem Druck, inszenatorisch und musikalisch ein Niveau zu halten, das dem der großen Vorgänger und, natürlich, dem Werk selbst angemessen ist, obwohl es die eine und einzige verbindliche Inszenierung und musikalische Interpretation niemals geben wird. Dafür sind Wagners Ansprüche und historischen Anweisungen einfach zu komplex.

In Kassel setzt man, so heißt es, das Werk nicht erst unter eine einzige „Interpretationsglocke”. Man will, so der Regisseur Markus Dietz und sein Dramaturg Christian Steinbock, jedes Einzelteil für sich betrachten. Schauen wir einmal, was dabei herauskommt. Mit dem „Rheingold” hat man jedenfalls schon zu einer interessanten und diskutablen Lösung gefunden. Wagners „Ring” zu inszenieren bedeutet ja zunächst einmal: die Symbole zu übersetzen und die richtigen Fragen zu stellen: Was ist das eigentlich heute: das Gold, der Hort, der Speer, das Schwert? Man macht sich (denke ich) etwas vor, wenn man davon ausgeht, dass sich all das, was zum Teil immer noch auf den Bühnen besichtigt werden kann, von selbst und nicht als Symbol versteht. Dass ein „Hort” eher szenische Probleme verursacht, wenn man ihn im Sinne der Wagnerzeit interpretiert, liegt auf der Hand – und überzeugende Lösungen der technischen Frage, wie wir das Zeug vor Freia aufschichten und danach von der Bühne bringen, werden höchst selten gegeben. Der Hort und das Gold aber sind zentrale Dingsymbole, die nicht trivialisiert werden dürfen. Im neuen Kasseler „Rheingold” ist der Hort – die Menschen, genauer: die Kasseler Bürgerschaft. Als „Humankapital” muss es den verbrecherischen Zielen des Ausbeuters dienen, der lieblos auf jegliche Empathie verzichtet hat, um in seinem Arbeits-KZ willkürlich walten zu dürfen. Wir sehen auf die Bühne und merken: Opfer sind wir alle, wenn wir uns den Zwängen eines hässlichen Zwergs unterwerfen, der, als wär er ein Scherge in Auschwitz, ein unschuldiges junges Ding in den Kopf schießt, um mit Angst und Schrecken sein Regiment zu befestigen. Damit ist Dietz ganz nah dran an Wagners Nibelungen-Szene und an George Bernard Shaws genialischer Deutung, die er in seinem Standardwerk „The perfect Wagnerite” einst fixiert hat. Einziger Nachteil der Übersetzung: die 100 in unschuldiges Weiß gewandeten Kasseler, die sich, so menschlich sind sie eben, auch tätlich an der Verspottung Alberichs beteiligen, und die ausdrücklich nicht als Statisten bezeichnet werden, bewegen sich ohne Spannung. Dietz vermochte es leider auch nicht, einzelnen Laiendarstellern soviel an Energie mitzugeben, dass alles wirkt. Auch die Auseinandersetzungen zwischen den Riesen gehören zu den szenischen Schwachstellen der Inszenierung, die im Ganzen ihrer grundlegenden Ideen doch überzeugt.

Zur Deutung: Nach der neuen Kasseler Lesart bezeichnet Alberichs Zurückweisung durch die Rheintöchter die Vertreibung aus dem lichtvollen Paradies, nachdem der die Ursünde beging, die Liebe zu verfluchen. Das Licht, das ja im Schein des Rheingolds Wirklichkeit war, düstert sich buchstäblich ein, nachdem Alberich, und auch dies buchstäblich, von den Rheintöchtern schwarz bepinselt, also „angeschwärzt“ wurde. Der Raub des Rheingolds geht also so vonstatten, dass es genügt, das reine Wasser durch die schwarze Farbe zu verschmutzen. Nun ja… aber die Idee, soweit sie Idee ist, funktioniert tatsächlich, wenn man als mündiger Zuschauer 1. das Programmheft erworben und/oder gelesen hat (wie gesagt: Beim „Ring“ versteht sich nichts von selbst, auch wenn wir das Werk schon 3000mal gesehen haben) und 2. stark abstrahiert. Leuchtendes Gold ist übrigens durchaus auf der großen, von Ines Nadler entworfenen Bühne zu sehen: in den Glitzervorhängen der ersten Szene. Allerdings behauptet die Regie nicht, dass es sich bei den drei Rheintöchtern um die drei Marien handelt. Sind sie auch keine Bordsteinschwalben, Schlampen etc., so zeigt ihr „neckisches“ Spiel hier die entzückenden wie aufreizenden Ladies, dort der zu Unrecht Verspottete, der Unrecht begehen wird. Man braucht vielleicht heute den Einsatz der Wasserfolter, um den Wutausbruch des „rasenden Alben“ verständlich zu machen. Man begreift's – aber der Zuschauer sieht leider bereits in der ersten Szene, dass Dietz zuweilen erstaunlich dilettantisch inszeniert. Das Plätschern und Spritzen ist, nun ja, eher peinlich und szenisch schwach. Fast wünscht man sich einen Castorf an seine Seite, dem, ich sag's ungern, doch im Wiederspiel zwischen Loslassen und Anziehen der Regiekandare mit selbstbewussten Sängern gelegentlich starke Momente gelangen. Hier müsste sich der Kasseler „Ring“ en detail deutlich verbessern.

„Nach Golde drängt, / Am Golde hängt / Doch alles. Ach wir Armen!“, behauptet das Programmheft mit Goethes Gretchen und zeigt Wotan mit seinem Speer: einem Lichtstab, mit dem er – nicht der zunächst nur stehende und schauende Alberich, nicht die Töchter des Rheins – die Handlung in Gang bringt, indem die Neonrahmen der Bühne urplötzlich strahlen. Das ist einfach und sinnfällig, auch wenn wir erst in der „Götterdämmerung“ erfahren werden, was es mit Wotans (problematischem) Wissenserwerb auf sich hat, der der „Rheingold“-Handlung vorangeht. Aus Leuchtstäben, die ein monströses „W“ bilden, besteht schließlich auch Walhall – Walhall wie Wotan wie Wagner. Schön die Details: wann sieht man schon einmal, dass das Frühstück in Walhall aus knallroten und kerngesunden Äpfeln besteht? Loge braucht sie bekanntlich nicht; stattdessen scharwenzelt der möglicherweise (!) fast emotionslose Intellektuelle – ein Typ, der so aussieht, wie vor einigen Jahren jeder Theaterdramaturg aussah – um Fricka herum, die sich samt Perücke und von Henrike Bromber designten Wildkatzenkleid für den großen Tag aufgebrezelt hat, wenn er nicht gerade auf dem Steg steht und, begleitet von einem von David Worm gestalteten, beeindruckenden Werbefilm über die durch- und überflogene Welt, über Weibes Wonne und Wert spricht. Mit einem Wort: Überzeugend – so überzeugend wie die zugleich trivialen und doch nicht falschen Rollatoren, an die sich die Götter, die natürlich auch nur Menschen sind, nach dem Abgang der Riesen klammern. Wotan wird mit ihm noch nach Nibelheim steigen; auch das ist richtig und wird selten so inszeniert – denn wieso sollte Wotan in der Tiefe frischer sein als seine Familienmitglieder in den wolkigen Höhen?
Leider aber geht der Umbau zum zweiten Bild so laut vor sich, dass die Illusion unabsichtlich gebrochen wird; den Ruf eines Technikers hört man später noch bei Donners Gewitterruf. Auch hier MUSS, da beißt die Maus kein' Faden ab, nachgebessert werden, auch wenn es sympathisch sein sollte, zu bemerken, dass eine Opernvorstellung auch „nur“ von Menschen und ihren irdischen Möglichkeiten realisiert wird. Es hilft nichts: Plötzlich ist der Zuhörer raus aus der Handlung. Also bitte: nachbessern und die weiteren Teile so inszenieren, dass der technische Direktor zufrieden ist und die Zuschauer nicht mitkriegen, wie der Zauber ins Werk gesetzt wird.

Die brutale Strafe für ihr Spottspiel erhalten die Rheintöchter übrigens schon wenig später. Sie sind in Nibelheims Nacht und auf Walhalls lichten Höhen permanent auf der Bühne, werden nur von Loge kurzfristig von ihr vertrieben. In der Tiefe des Kasseler Arbeitslagers werden sie von Alberich als Sexsklavinnen gehalten; gut möglich, dass Wellgunde zur Mutter Hagens werden wird, nachdem sie von Alberich vergewaltigt wurde. Ansonsten versteht sich der Mann auf Zaubereien. Riesenwurm und Kröte wurden, es steht im Programmheft, für die beiden Filme von einem Zoo-Fachgeschäft und einem Filmtierhof zur Verfügung gestellt. Das bringt ein bisschen Kindervergnügen ins Spiel, bevor die Rheintöchter tätig dabei mithelfen, den Despoten zu schnappen. Am Ende werden sie wieder in die Tiefe abtauchen, nachdem Loge sie gewaltsam von der Bühne vertrieb. Interessante Frage: Tat er es gleichsam im Auftrag Wotans? Oder muss er ihnen mit Nachdruck klarmachen, dass diese Welt – die moralisch verschmutzte - nicht die ihre sein kann? Will er sie also vor dem Irrtum bewahren, dass die „Götter“ dort oben irgendetwas für sie tun könnten, nachdem sich Wotan weigerte, ihnen den Ring zu geben? Ich nehme das Letzte an.
Andererseits: Was wollen die Rheintöchter eigentlich mit dem Ring anfangen, nachdem Alberich ihn verflucht hat? Es würde doch nur auf einen Zickenkrieg hinauslaufen, in dem die Älteste, also der Alt, zwar am ehesten das Recht hätte, das aus dem Gold geschmiedete Ding zu tragen, aber aufgrund des Fluchs kaum eine Chance hätte, schadlos wegzukommen. In diesem Sinn ist die Inszenierung zwar reizvoll und szenisch ergiebig, auch bedeutungsvoll, aber nicht im Sinne des Erzeugers. Sie singen's ja selbst: sie wollen das Gold wieder haben – doch das Gold ist, wie sie gerade in der Inszenierung erfahren müssen, aufgegangen in den Hort und den Ring. Der Hort aber ist – in der Kasseler Interpretation – eine Menschenmasse und der Ring nicht das unschuldige Naturmaterial aus Licht und klarem Wasser mehr. Wer annimmt, dass der Ring den Rheintöchtern zusteht, irrt übrigens. Wagner wusste, wieso er die Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ nannte. Nach dem BGB, das man bei der Betrachtung der Straffälle durchaus zu Grunde legen kann, da es unser Rechtsverständnis und wesentliche Rechtsinhalte der Wagnerzeit differenziert spiegelt, gehört der Ring eindeutig dem, der ihn geschaffen hat. Wer's nicht glaubt, möge demnächst Peter Küfners fundamentales (und höchst amüsantes) Buch „Vier Ehedramen und zehn Todesfälle – Unrecht und Recht in Richard Wagners 'Ring des Nibelungen'“ lesen. Und wenn die Töchter nach 15 Stunden mit dem Ring durch die Fluten sprudeln, nachdem sie Hagen ermordet haben, fragt sich's, ob das Ding wirklich ein Äquivalent für das geraubte Gut ist. Natürlich ist es das nicht.
Das sind so Wagners Widersprüche, an denen sich ein Regisseur beweisen kann. Die Anwesenheit der Rheintöchter in Nibelheim und Walhall ist eine Möglichkeit, sie produktiv und szenisch sinnfällig zu machen, auch wenn sie nicht ganz so aufgehen wie der Hort. Außerdem erhält, aber das nur nebenbei, der Zuschauer die Möglichkeit, wesentlich länger auf die schönen (und schön singenden) Töchter zu schauen als von Wagner vorgesehen… Schön ist es auch, die Rheintöchter beim Sehen zu sehen: wenn sie die Auseinandersetzungen zwischen Wotan und den Riesen vom großen „W“ aus beobachten. Schön ist es gleichfalls, die weiß leuchtende, mit einem Lichtstreifenrock auftretende Erda die Bühne betreten zu sehen; leider macht sie es, wie irgendein Wesen, von der rechten Gasse aus, obwohl sie danach im Untergrund der Bühne verschwindet. Auch hier diktierte offensichtlich die technische Einrichtung – die Verschiebung des riesenhaften „W“ nach hinten ließ wohl keine andere Auftrittsmöglichkeit zu – das Arrangement. Schade drum, denn wer abtaucht, sollte auch auftauchen können. Wie gesagt: das Regieteam sollte bei den nächsten drei Teilen sorgfältig prüfen, was zugleich bühnentechnisch machbar und sinnvoll ist. Die Bühne bleibt, ob die Regie das will oder nicht, doch ein Ort der Illusion. Es sei denn, man verzichtet auf Zaubereien und setzt nur noch auf V-Effekte. Schließlich lässt Erda ja, im Dunkel der letzten Takte, für Wotan den Rock fallen, der sich gleich die nötige, aber langfristig ignorierte Weisheit holen und mit der Urmutter seine Lieblingstochter zeugen wird.

Und die Hauptsache, die Musik? Das Staatsorchester Kassel spielt unter Francesco Angelico einen äußerst sublimen Wagner. Klingt das Vorspiel zunächst noch etwas analytisch, so merkt man bald, was gemeint ist. Die äußerste Klarheit paart sich mit einer poetischen Delikatesse, in der langsame Verläufe besonders wichtige Stellen betonen. Überhetzt ist hier nichts, im (subjektiv) richtigen Tempo alles. Würden alle Sänger so genau singen wie der Loge des Lothar Odinius, würde man tatsächlich schon aufgrund der Tempi jedes Wort verstehen. Apropos Loge: dessen Lobeshymne auf die „Weiber“ erinnert wohl nicht zufällig an Mendelssohn, dem Wagner einiges an Material, wohl auch an Klangorganisation verdankte, ohne dass je der Einruck aufkäme, dass es sich beim „Rheingold“ um anverwandelten Mendelssohn handelte. Nur spielt das Orchester jene Feenmusik heraus, die weite Teile der Partitur aufweist. NB: Man sollte alle Ignoranten, die immer noch von Wagners „Bombast“ schwafeln, in diese Aufführung schicken und ihnen die Augen verbinden – danach wären sie von ihrem Irrtum geheilt. Und wenn es mal kracht, dann auf kultivierte Art. Der Auftritt der Riesen, mit dem schweren Blech auf der rechten Seite, kommt gestochen scharf und eindrücklich her, dabei wuchtig und zugleich hell. Dass das Finale mit seinem affirmativen Walhall-Jubel so hohldröhnend wie an diesem Abend klingen muss, versteht sich von selbst. Für die Rheintöchter steht dagegen kurz zuvor der metallisch hervorstechende Klang der höchsten Harfentöne ein; dass die drei Schönen sich vorn und nicht unten oder hinten befinden, ist sehr gut: denn so versteht man die zentrale – und von Wagner herrlich harmonisierte – Botschaft der drei Damen umso besser. Sie heißen Elizabeth Bailey, Marie-Luise Dreßen und Marta Herman, sie tun, wenn auch nicht an Alberich, einen guten Dienst. Alberich ist Thomas Gazheli, den ich in einer so exotischen Wagnerrolle wie der des Friedrich im „Liebesverbot“ in guter Erinnerung habe. Sein Alberich ist leicht guttural, dramatisch ausdrucksvoll, stimmlich potent. Der König der Götter heißt Bjarni Thor Kristinsson, dessen Bass eine mächtige Tiefe aufweist und in der Höhe an Alan Titus' Wotan erinnert, ohne so stark zu knödeln. Wichtig in den finsteren Stahl- und Gittergängen Nibelheims: der erbarmungswürdige, fast verrückte Mime des Arnold Bezuyen. Früher war er Loge in Bayreuth, nun ist er Mime in Kassel. Er gestaltet, mit vokalem und körperlichem wie mimischem Einsatz, die Partie mit größter Bravour. Ulrike Schneiders Fricka, mehr noch die weinrot tönende Erda der Marlene Lichtenberg: sie halten das gute Kasseler Niveau. Weniger beeindruckend: der erstaunlich helle, gar nicht riesenhafte Bariton des Fasolt, Marc-Olivier Oetterli, der auch den tieferen Ausdruck vermissen lässt, und der arg gaumige Rúni Brattaberg als Fafner. Angemessen: Jaclyn Bermudez' Freia. Bleiben die „kleinen“ Götter, die teilweise Erstaunliches aufbieten: besonders der sonore Donner des Hansung Yoo. Neben ihm steht Tobias Hächlers Froh. Loge aber dominiert im 2. Bild mehr als die Szene. Lothar Odinius ist ein Vorbild an Stimmschönheit, genauester Artikulation, Spielwitz und intelligenter (und durchaus nötiger widersprüchlicher) Rollengestaltung. Chapeau!
Wisst Ihr, wie das wird? Der neue Beginn war, wenngleich in den schauspielerischen und technischen Details nicht immer überzeugend, durchwegs spannend, bei allen wagnereigenen Widersprüchen durchdacht, szenisch anspruchsvoll und musikalisch meist auf dem bekannten Kasseler Niveau. Wir sehen uns wieder – im März bei der „Walküre“.
Frank Piontek, 20.10.2018
Fotos: © N. Klinger
ANDREA CHENIER
Premiere: 09.09.2017
Fast bieder und mit überraschendem Finale

Lieber Opernfreund-Freund,
der aus Apulien stammende Umberto Giordano ist einer der wenigen Komponisten, die im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert neben dem omnipräsenten Puccini gewisse Erfolge mit ihren Werken erzielen konnten. Doch von seinen 14 Opern konnte sich nur das Revolutionsdrama „Andrea Chénier“ dauerhaft auf den Bühnen der Welt etablieren. In Deutschland vergleichsweise selten gespielt, ist es nun seit gestern am Staatstheater Kassel zu erleben.
Am Vorabend der französischen Revolution wird im Hause der Gräfin di Coigny ein großes Fest vorbereitet. Der Diener Gérard ist heimlich in Maddalena, die Tochter seiner Herrin, verliebt, hasst jedoch den Adel und hat sich dem sich aufbäumenden Volk angeschlossen. Zum Fest erscheint auch der freigeistige Dichter Andrea Chénier, von dem Maddalena fasziniert ist. Fünf Jahre später ist die Revolution in vollem Gange. Maddalena versteckt sich nach der Ermordung ihrer Familie in Paris und schreibt anonyme Briefe an Andrea. Doch Gérard, mittlerweile im neuen Regime etabliert, lässt nach ihr suchen.

Bei einem geheimen Treffen offenbart sich Maddalena dem angebeteten Dichter. Der hinzutretende Gérard wird von Andrea im Kampf verletzt, verrät aber den Dichter nicht, sondern bittet ihn, Maddalena zu beschützen. Dennoch wird der Poet wenig später festgenommen, Maddalena verspricht sich Gérard, wenn er eine Verurteilung von Chénier verhindert. Doch es ist zu spät. Maddalena kann Andrea nur noch einmal im Kerker besuchen und nimmt, als die Verurteilten zum Schafott gehen, freiwillig den Platz einer jungen Mutter ein und schreitet statt ihrer zusammen mit ihrem Geliebten dem Tod entgegen.
Mit der szenischen Umsetzung dieses Dramas um Freiheit, Intrige und Liebe hat man Michael Schulz verpflichtet, seines Zeichens Intendant des Musiktheaters im Revier. Der entschließt sich zu einer vergleichsweise traditionellen, fast bieder wirkenden Lesart. Den ersten Akt lässt er herrlich überzeichnet in puderfarbenen Rokkokokostümen und aufgepluderten Perücken spielen, die von Renée Listerdal stammen.

Ab dem zweiten Bild schleichen sich auf der wunderbar verwandlungsreichen Bühne von Dirk Becker nach und nach Aktualisierungen in Form von Verkehrsschildern, Handys und Laptops ein, ehe der Finalakt komplett in unserer Zeit angekommen scheint und darüber hinaus noch mit einem durchaus stimmigen Schluss aufwartet, der vom Libretto abweicht. Auch verdeutlicht der versierte Theatermann gekonnt, dass Chénier eigentlich gar nicht Maddalena zu lieben scheint, sondern eher ihre Bewunderung für ihn und seine Ideen und Gedanken. Und doch werden diese Interpretationen zusammen nicht richtig rund, bleiben ohne Mehrwert für das Werk und so nur nette Bebilderung der Geschichte.
Auf der Bühne zeichnet Rafael Rojas die Titelfigur als im Wesentlichen in sich selbst und seine Ideen verliebten, vergeistigten, fast emotionslosen und irgendwie der Welt entrückten Poeten, zeigt stimmliche Kraft und sichere Höhe, auch wenn das nicht immer ohne Anstrengungen vonstatten zu gehen scheint. Anstrengung hingegen scheint Vida Mikneviciute fremd. Die junge aus Litauen stammende Sängerin hatte mich in der vergangenen Spielzeit bereits als Blanche in Poulencs „Dialogues des Carmèlites“ in Mainz tief berührt und meistert auch als Maddalena in Kassel scheinbar mühelos den Spagat zwischen umwerfender Bühnenpräsenz, stimmlicher Farbtiefe und tiefem Sentiment. Dazu verfügt sie über ebenso viel darstellerisches Talent wie ihr Kollege Hansung Yoo.

Das südkoreanische Ensemblemitglied zeigt seinen farbenreichen Bariton voll eindrucksvoller Durchschlagskraft, so dass Carlo Gérard in ihm den idealen Darsteller findet. Lona Culmer-Schellbach überzeugt als gebrochene Madelon mehr als als überdrehte Contessa, Marie-Luise Dreßen ist eine aufgeweckt-quirlige Bersi und Daniel Jenz macht als schmieriger Spitzel Incredible nicht nur eine gute Figur, sondern auch nachhaltig Eindruck mit seinem feinen Tenor. Hee Saup Joon gibt mit imposantem Bass den Matieu und auch der Rest des Ensembles ist durchweg gut besetzt. Der Chor, von Marco Zeiser Celesti betreut, komplettiert den Reigen der überzeugenden Sangesleistungen.
Das Staatstheater Kassel hat seit dieser Spielzeit einen neuen GMD. Am Pult des Staatsorchesters Kassel gab gestern Francesco Angelico seinen gelungenen Einstand. Der Italiener legt viel Herzblut in sein Dirigat, erweckt Giordanos melodienreiche Partitur gekonnt und seelenvoll zum Leben und legt den Sängern einen farbenreichen Klangteppich aus.
Im ausverkauften Haus ist man begeistert von dieser ersten Spielzeitpremiere und auch ich kann Ihnen diese Produktion guten Gewissens ans Herz legen. Überzeugt mich auch die Regie nicht auf ganzer Linie, so tut dies die musikalische Seite umso mehr. Kassel ist mit diesem „Andrea Chénier“ also auch nach der Documenta noch eine Reise wert.
Ihr Jochen Rüth 10.09.2017
Die Fotos stammen von Nils Klinger.
DIE TOTE STADT
Premiere am 23.04.2016
Von bezwingender Stringenz
Sie gehört zweifelsohne zu den anspruchsvollsten Tenorrollen der Opernliteratur, die Partie des Paul in Korngolds phänomenaler Oper DIE TOTE STADT. Wenn man nun, wie das am Staatstheater Kassel der Fall war, diese Rolle so exzellent zu besetzen in der Lage ist, dann steht einem bewegenden, aufwühlenden Opernerlebnis mit dieser rauschhaften, ekstatisch-erotischen Partitur aus der Feder des zum Zeitpunkt der Komposition knapp 20jährigen, "letzten" Wunderkinds der klassischen Musikwelt nichts mehr im Wege.

Charles Workman ist dieser Sänger, welcher mit seiner wunderbaren Stimme und seiner feinfühligen Gestaltung das Premierenpublikum in Kassel zu Begeisterungsstürmen hinzureissen vermochte. Mühelos meisterte der Sänger die oft unangenehm hohe Tessitura, berückte die Zuhörer mit fantastisch tragfähigen Piani, sauberer Intonation auch in diffizilsten Passagen, biegsam und weich phrasierend und doch die Kraft aufbringend für ekstatische Ausbrüche erotischer oder religiös verschrobener Verzückung. Nie musste er forcieren oder stemmen, alles wuchs organisch aus der perfekten Stütze. Geradezu zu sonnen schien er sich auf den vielen langen Notenwerten - da bröckelte nichts ab, jeder Ton war ungemein sauber und mit phänomenaler Intensität aufgeladen. Berückend und rührend bis zur letzten Reminiszenz an "Glück, das mir verblieb". Doch nicht nur vor der sängerisch-musikalischen Leistung von Charles Workman (meine Zürcher Opernfreunde werden sich an ihn als verführerischer Jupiter an der Seite von Cecilia Bartoli in Händels SEMELE erinnern) darf man sich verneigen, auch seine Darstellung dieses krankhaft Besessenen war restlos überzeugend.

Der gross gewachsene, blendend aussehende Sänger füllte die Rolle begeisternd aus. Schlaksig, jungenhaft sein erster Auftritt, voll freudiger Erwartung das erste Zusammensein mit Marietta, in welche er Marie projizierte, später angewidert seine Enttäuschung über ihr flatterhaftes Wesen ausdrückend, erotisch aufgeladen die sexuelle Vereinigung, krankhaft in der Raserei und der religiösen Verblendung im Alptraum, die kathartische Wirkung des Traums begreifend in der Schlussszene, wo er unsicher schwankend ins Dunkel abgeht. Dabei hatte es ihm der der Regisseur dieser Produktion, Markus Dietz, wahrlich nicht einfach gemacht. Denn Paul musste nicht nur mit Marietta interagieren, auch seine verstorbene Frau Marie (Eva-Maria Sommersberg gelang mit der Darstellung dieser stummen Rolle eine Glanzleistung von beklemmender Intensität!) war auf der Bühne dauerpräsent. Als Marietta begeisterte Celine Byrne mit silbern glänzendem, hellem und klarem Sopran, spritzig und voller Lebenslust in der Darstellung. Traumhaft zart und mit exemplarischer Pianokultur intonierte sie die erste Strophe von "Glück, das mir verblieb", prall ihre Darstellung in der Komödiantenszene, himmlisch schön und rein das "... errang mir an mich selbst den Glauben".

Zu Tränen rührend war auch ihr nur leicht elektronisch verfremdeter Gesang als Stimme der Marie am Ende des ersten Bildes. Pauls Freund Frank hat zwar keine eigene grössere Szene zu singen, aber in der Darstellung durch Marian Pop erlangte er in dieser Inszenierung doch bemerkenswertes Gewicht. Marian Pop zeichnete sich nicht nur mit seinem kernigen Bariton aus (die Diktion könnte noch etwas klarer sein), sondern vor allem durch seine sehr genau auf den Text abgestimmte Mimik und Gestik - ein echter Freund eben, fast ein Zwillingsbruder Pauls, attraktiv und schlank auch er - glaubhaft und reell. Marta Herman sang eine solide (sehr jugendlich erscheinende) Haushälterin Brigitte, mit schön jubelnder Höhe im Arioso des ersten Bildes und (für meinen Geschmack) etwas viel Vibrato in der tieferen Lage. Sehr gut gelungen dann aber ihr zweiter Auftritt mit den Beghinen im zweiten Bild. Dass sie sich in schwarzer Seidenunterwäsche den Nonnen anschloss, passte natürlich zum Alptraumhaften der Szene! Und dass Frank in der Schlussszene seine Worte "Kommst du mit mir weg aus der toten Stadt" erst an Brigitte und nicht an Paul richtete, machte dann auch wieder Sinn, so wegen Seidenunterrock...

Immerhin galt sein zweiter Blick dem Freund! Aus der Komödiantentruppe rund um Marie ragt natürlich Fritz, der Pierrot, heraus, welcher mit "Mein Sehnen, mein Wähnen" den zweiten ganz grossen Hit der Oper singen darf. Und wenn dieses Lied mit solch tief rührender Anmut und unprätentiöser Schlichtheit gesungen wird wie in Kassel von Hansung Yoo, dann würde man es am liebsten gleich nochmals hören wollen. Die perfekte Sanftheit der Stimmführung und die wunderbare Sonorität der tieferen Lage versetzte nicht nur den Paul, sondern auch den Zuhörer im Saal, in einen hypnotischen Zustand! Grandios! Sehr gut und quirlig auch die Juliette von Lin Lin Fan und die Lucienne von Maren Engelhardt, sowie der Victorin von Jun-Sang Han (tolle Tenorstimme!) und der Graf Albert von Johannes An.

Maestro Patrik Ringborg und das Staatsorchester Kassel blieben der ekstatischen Partitur nichts an spätromantischen Schwulst (das ist beileibe nicht pejorativ gemeint!) schuldig. Schön, dass der Klangteppich aus dem Graben nie zu dick und zu schwer klang, sondern eine exquisite Transparenz bewahrte und die Sänger so in keinem Moment zum Forcieren verführte! Einige Patzer des Blechs werden sich in den kommenden Aufführungen bestimmt noch legen. Aus dem Opernchor und dem CANTAMUS-Chor des Staatstheaters Kassel liessen insbesondere die lupenrein intonierende Kinderstimmen aufhorchen!
Von bezwingender Stringenz war die in eine nicht näher bestimmte Gegenwart verlegte Inszenierung von Markus Dietz, dem insbesondere mit den Porträts von Paul, Marietta, Marie und Frank feinsinnige Charakterzeichnungen gelangen. Der überaus funktional gestaltete Bühnenraum von Mayke Hegger vermochte genauso zu überzeugen wie die passenden Kostüme von Henrike Bromber.

Kongenial unterstützte auch die stimmungsvolle Lichtgestaltung von Albert Geisel die Szenerie. In dem sich in die Tiefe stark verjüngenden Raum, welcher durch eine weisse Regalwand unterteilt war, auf welcher sich die Memorabilia an Marie verteilten, spielte sich die Handlung ab. Hinter der Regalwand konnte eine Leinwand für Projektionen der Verstorbenen heruntergefahren werden, die Bodenelemente der Hinterbühne liessen sich vertikal verschieben und boten so Raum für Chorauftritte und beängstigende Szenen, in welchen Paul der Boden unter den Füssen regelrecht wegzubrechen drohte. Ganz starke Bilder prägten die Heilig-Blut-Prozession, mit den Kindern, deren Gesichter mit schwarzen Kreuzen verunstaltet waren, oder der blutüberströmten Marie, welch wie der Erlöser am kalt-weiss leuchtenden Neonkreuz hing, während sich blutige Hände erst nach oben reckten und darauf die grauen Wände von Pauls Wohnung mit ihrem Blut beschmierten. Paul verfiel darauf in seine von religiösem Wahn besessene Raserei, erwürgte Marietta mit Maries goldenem Haarzopf und erwürgte schliesslich als Katharsis das omnipräsente Phantom seiner Marie. Und doch: So ganz sicher war man sich bei genauerem Nachdenken über das Gesehene und Erlebte plötzlich nicht mehr, ob da nicht doch noch mehr war, als bloss ein Alptraum...
Kaspar Sannemann 25.4.16
Bilder (c) Staatstheater Kassel / Klinger
Desweiteren am 27.4. | 30.4. | 5.5. | 21.5. | 27.5. | 1.6. | 3.6. | 12.6. | 22.6.2016
Leonardo Vinci
ARTASERSE
Premiere: 12. Dezember 2015
Nachdem Leonardo Vincis „Artaserse“ im Jahr 2012 durch die konzertante Aufführung mit fünf Countertenören der Vergessenheit entrissen wurde, wagt sich das Staatstheater Kassel jetzt als erstes deutsches Theater an die Barockrarität. Seit 1746 ist dieses Stück nicht mehr in Deutschland gespielt worden, weshalb man gespannt ist, wie sich diese Oper auf der Bühne entfaltet?

Bei der Lektüre des Programmheftes ist man zunächst verwirrt: Was da als Handlung erzählt wird, scheint ein wirres Intrigenspiel. Zudem ist bedauerlich, dass sich im Programmheft nur bruchstückhafte Informationen über den Komponisten und nichts über die Geschichte dieses Werkes und seine Wiederentdeckung zu lesen ist. Auch hätte man gern etwas von Regisseurin Sonja Trebes über ihren Zugang zum Werk und ihr Konzept gelesen.
In der Aufführung, die fast drei Stunden dauert, ist man dann aber erleichtert: Trebes bringt die Geschichte verständlich und nachvollziehbar auf die Bühne. Die deutschen Übertitel erleichtern zusätzlich das Verstehen. Der persische Großkönig Xerxes wird ermordet und daraus entspinnt sich einerseits die Suche nach dem Täter, zum anderen setzt sich sein Bruder Artaxerxes als sein Nachfolger durch.

Waren bei der konzertante Aufführung und der Inszenierung von Silviu Purcarete sogar zwei Frauenrollen mit Countertenören besetzt worden, so gibt es in Kassel mit Yuriy Mynenko nur noch einen Counter. Die anderen Partien sind mit Frauen besetzt. Sonja Trebes spielt zwar mit den Geschlechteridentitäten, wenn die Sängerinnen von General Megabise und Prinz Arbace Spitzenunterwäsche tragen. Aber die wichtige Frage, wer Mann oder Frau ist, wird nicht eindeutig beantworten. Dabei hätte man aus diesem Komplex eine Menge szenisches Kapital schlagen können.
Gegen Ende der Aufführung erlaubt sich Trebes auch eine eigene Deutung, wenn sie das Happy End verweigert. Im Original wird Arbace nicht hingerichtet, hier wird er/sie von Artaxerexes im Kerker erstochen. Das hat zur Folge, dass Arbace zum Duett mit Mandane, der Schwester der Titelfigur, als Geist erscheint. Im Original verhindert Bösewicht Artabano im letzten Augenblick noch die Vergiftung des Königs, in Kassel findet sie statt, so dass das Happy End nur noch eine Phantasie des sterbenden Königs ist.

Bühnenbildner Dirk Becker, der durch die Ausstattung des Weimarer „Ring“ und einige Arbeiten für Christof Loy bekannt geworden ist, beeindruckt vor allem mit dem großen „X“, das wie ein Symbol aus dem Actionfilm „Triple X“ an der Palastmauer prangt. Das sieht zwar schick aus, hat aber ansonsten keine Bedeutung. Immerhin lässt Beckers Bühne den Darstellern genügend Platz.
Schwächelt die Regie, so ist Kassel aber eine musikalische starke Produktion zu erleben: Das ist zum einen dem Komponisten Leonardo Vinci selbst zu verdanken, dessen Musik sich auf einem ähnlich hohen Niveau wie die Werke Händels befindet. Die Arien sind nicht bloße Koloratur-Massenware, die dem Zuschauer in andren barocken Opern begegnet. Da Vinci fühlt sich wirklich in die Figuren ein und zeichnet sie sensibel und abwechslungseich. Dirigent Jörg Halubek dirigiert das Stück mit einem Schwung und einer Energie, dass man echt begeistert ist: Diese Musik ist plastisch, expressiv und reißt mit. Die Streicher des Staatsorchesters Kassel pflegt einen rauen Bogenstrich und werden noch mit Theorben und Cembali verstärkt, die oft sehr perkussiv gespielt werden.

Hörenswert ist das Kasseler Ensemble: Yuriy Mynenko gefällt in der Titelrolle mit seinem wendigen und klangvollen Countertenor. Den meisten Beifall gibt es für die Sopranistin Lin Lin Fan als Arbace. Die Sopranistin begeistert mit einer differenzierten Rollengestaltung. Zudem interpretiert sie die Koloraturarien furios und hat mit „Vo solcando“ den großen Hit des Abends.
Sopranistin Anni Yorentz singt die Semira mit kräftiger und schön gefärbter Stimme. Die Regie macht aus dem General Megabise eine Art Lesbendomina, die von Sopranistin Inna Kalina mit geläufiger Gurgel gesungen wird. Die Mandane gestaltet Maren Engelhardt mit hellem und dramatischem Mezzo. Den Intriganten Artabano singt Bassem Alkhouri mit zuverlässigem Tenor.
Die Oper würde man gerne einmal in einem großen Haus unter einem Barockspezialisten wie Rene Jacobs und von einem Regisseur wie David Alden oder Robert Carsen inszeniert sehen.
Rudolf Hermes 16.12.15
Bilder Staatstheater Kassel
Luciano Berio
UN RE IN ASCOLTO
(Ein König horcht)
Premiere: 23. Mai 2015

Luciano Berios „Un Re In Ascolto“ ist eine faszinierende Oper über die Vermischung von Theater und Realität, bedarf aber eine der richtigen Vermittlung, um beim Publikum anzukommen. Bei der Kasseler Premiere bleiben die Zuschauer jedoch weitgehend ratlos, weil es keine Einführung in das Stück gibt, Regisseur Paul Esterhasy in seine Inszenierung ein paar unlösbare Rätsel einbaut und auch das dünne Programmheft keine Hilfestellung bietet.
In Berios „Azione Musicale“ auf ein Libretto des italienischen Schriftstellers Italo Calvino geht es um den Theaterdirektor Prospero, der von einer eigenen Form des Theaters träumt. Immer wieder gibt es Sängerinnen, die sich einem Vorsingen stellen, Diskussionen zwischen Prospero und einen Regisseur sowie schwärmerische Arien, in denen Prospero über das Theater und die Musik philosophiert. Dazwischen gibt es Anspielungen auf Shakespeares „Sturm“, denn Theaterzauberer Prospero hat noch einen Caliban-Sklaven, der hier Freitag heißt, und einen stummen Windgeist Ariel an seiner Seite.

Um sich auf dieses Stück einzulassen, muss man es als poetischen und phantasievollen Traum über das Theater begreifen, in dem es nicht unbedingt logisch zugeht. Die Texte Italo Calvinos sind wunderbar lyrisch und regen an, mal wieder den einen oder anderen Roman dieses großartigen Autos zu lesen. Empfohlen seien: „Der Baron auf den Bäumen“, „Wenn ein Reisender in einer Winternacht“ oder „Herr Palomar“.
Luciano Berios Musik glüht nur so vor Leidenschaft und Dirigent Alexander Hannemann koordiniert das Zusammenspiel zwischen den Sängern und dem Staatsorchester Kassel mit klarer Schlagtechnik. Dabei lässt er auch die Emotionen dieses Stückes nicht zu kurz kommen. Berio hat den Sängern viel Belcanto geschrieben und besonders die fünf Prospero-Arien sind wunderschöne Verbindungen von Poesie und Musik.

Ausstatter Mathis Neidhardt hat ein holzvertäfeltes Theaterfoyer entworfen, in dem Direktor Prospero seinen Träumen nachgeht. Prospero ist eine Künstlerklischeefigur, langmähnig, alkohol- und nikotinsüchtig schlürft er im Bademantel durch das Geschehen. Marc-Oliver Oetterli singt diese Rolle mit warm-strömendem Bariton und steigert sich schön in die Phantastereien dieser Figur hinein.
Der Sänger des Regisseurs Markus Francke, der seine Partie mit recht engem Tenor singt, darf vor der Vorstellung an die Rampe treten und behaupten, er sei der „Regisseur dieser Aufführung“ und er suche noch einen Freiwilligen aus dem Publikum, der nach einer kleiner Einweisung mitspielen dürfe. Es melden sich tatsächlich einige Freiwillige, „gewählt“ wird dann aber Schauspieler Gunnar Seidel, der auf der Bühne den Freitag verkörpert, der sich hier sogar mit Erde beschmieren muss und einige Tritte und Schläge abbekommt.

Paul Esterhasys Inszenierung wird diesem phantasievollen Theatertraum weitgehend gerecht, enthält aber auch Rätsel: Ein Kalenderblatt verrät, dass wir uns am 7. August 1984, also dem Tag der Uraufführung dieses Stückes, befinden. Sind wir uns also im Foyer des Kleinen Festspielhauses in Salzburg, wo „Un Re in Ascolto“ uraufgeführt wurde und soll Prospero Berio sein? Eine optische Übereinstimmung zwischen Marc-Oliver Oetterli und dem Komponisten gibt es nicht und das Foyer des Kleinen Festspielhauses dürfte an diesem Tag ordentlich hergerichtet sein als diese Bühne.
Warum gibt es hier Anspielungen auf die UdSSR? An der Wand hängt ein sowjetisches Propagandaplakat, mehrfach tritt ein Akkordeon spielender Rotarmist auf und schließlich kramt Prospero eine UdSSR-Fahne hervor, mit der er sich erhängt. Auch der Auftritt der großartig singenden Anna Nesyba als Frau mit Judenstern, die durch die Seitenwand bricht, bleibt rätselhaft.

Der Schlussbeifall wird bei dieser Premiere komplett versemmelt: Direkt nach Ende der Vorstellung bekommt Marc-Oliver Oetterli einen verdienten großen Solo-Applaus, danach treten die Sänger nur Gruppeneise auf, was einen differenzierten Beifall unmöglich macht. Währenddessen gibt es im Publikum tatsächlich Diskussionen, ob Schauspieler Gunnar Seidel, der den Freitag verkörpert hat, nicht vielleicht doch „ein normaler Zuschauer“ gewesen sei und ob man Markus Francke, den Sänger des Regisseurs, auch für die Regie ausbuhen müsse? Der echte Regisseur des Abends, Paul Esterhasy, lässt nämlich auf sich warten, kommt erst nach dem zweiten Solo-Beifall auf die Bühne: Da ist der Saal schon halbleer.
Rudolf Hermes 24.5.15
Produktionsbilder: Staatstheater Kassel
Einsamkeit und Coolness
DOG / SCIENCE! FICTION! NOW!
Premiere: 22.11. 2014. Besuchte Vorstellung: 18.3. 2015
Ein toller Doppelabend
Modernes Tanztheater ist, man weiß es, zugleich einfach und schwer: schwer, weil sich die Bilder, Schritte, Gesten und Wendungen oft einer unmittelbaren Deutung entziehen, leicht, weil der Zuschauer aufgerufen ist, geradewegs zu assoziieren. Eine Hilfestellung erhält er bisweilen durch die Texte der Dramaturgie, aber auch hier gilt: Es kann getanzt und gefühlt sein, was nicht geschrieben steht oder: Es kann geschrieben sein, was kaum getanzt wird. Im Grunde, sagt der moderne Tanztheaterdramaturg, ist es nicht so wichtig. „Assoziieren Sie“, ruft er dem Publikum zu, das allerdings, seitdem Johannes Wieland 2006 mit der Arbeit in Kassel begonnen hat, auch in Kassel schon Einiges an Tanztheater kennengelernt hat. Die Compagnie des Staatstheaters hat unter der Leitung Johannes Wielands die Gegenwart, nach einigen kommunikativen Anfangsschwierigkeiten, für das Publikum erfolgreich ins schöne Haus gebracht.
Das Wichtigste zuerst: es tanzen Rémi Benard, Akos Dozsa, Martin Durov, Laja Field, Gotaute Kalmatavičūte, Victor Rottier, Shafiki Sseggayi und Ann-Christin Zimmermann – und wie sie tanzen! Mit vollem Einsatz, individuell konturiert (auch im Mimischen) und doch als Teile eines begeisternden, homogenen Ensembles.

Und was steht nun im Beipackzettel? „Für Johannes Wieland ist die Zukunft ein realer und unauflöslicher Widerspruch in sich. Ist die Zukunft mehr als das zeitliche Phänomen, das auf die Gegenwart folgt, aber bereits im nächsten Augenblick Vergangenheit ist, also eigentlich nie existiert? Zukunft ist der imaginierte Widerspruch zwischen Behauptung und Erwartung: science! fiction! now!“ Und also tanzen die acht Tänzerinnen und Tänzer in der ausgefuchsten Schlaglichtdramaturgie aneinander vorbei, begegnen sich, trennen sich, umschweben sich, springen sich vor allem sehr schnell und sehr aggressiv an, reichen sich weiter, verharren in Stillstand, küssen sich (auch homoerotisch). „Die Liebe liebt das Wandern“, wie es in der „Winterreise“ heißt, aber hier liebt sie auch die Geschwindigkeit und die Verzweiflung. Grundiert wird dies, sagt Thorsten Teubl, von einer Sehnsucht nach Liebe und Glück, die sich über radikalen, peitschenartigen und dumpf grollenden Beats und Disco-Rhythmen entlädt. Einsamkeit und Coolness, so könnte die Choreographie auch heißen, die mit einem einsamen, weinenden Bartmann beginnt und mit der Ausgrabung von zwei Kondensatormikrophonen älterer Bauart endet. Da spricht frau dann hinein – aber wer hört es?

Dies also ist eine „Handlung“ zur Musik von Donna Summer, Aidan Baker, Ben Frost & Daniel Bjarnason, John King und Ethel: die taumelnden Figuren graben, als wär's ein absurder Akt, den (von Matthieu Götz entworfenen) Bühnenboden aus und schaufeln wie verrückt den Sand nach oben. Mit hysterischen Wahnsinnsdrehungen, Erinnerungen an Breakdance und Rock'n Roll und langen Blicken ins Publikum hat der Abend begonnen, mit einem offenen Umbau wird er durch die Pause weitergeführt. Was folgt, ist rätselhafter – und sehr schön, auch wenn der Dramaturg der Meinung ist, dass der Israel-Palästina-Konflikt hier jederzeit sichtbar sei.

„'Dog' ist ein Schnelldurchlauf durch die Evolutionstheorie: Elefanten, Delphine, Affen und Menschen – sie alle tauchen auf in einer wilden Jagd rund um Darwins 'Kampf ums Dasein' (Struggle for Life). Hofesh Shechter sieht noch lange kein Ende in der Geschichte der Evolution: it's not ower yet.“ Den Hund, der auf allen Vieren kriecht, sieht man, auch gebückte Gestalten im betörenden Halbdunkel (Licht: Lawrie McLennan), die in Gruppen wedeln oder einzeln kommunizieren, aber schon nach wenigen Minuten driften die Gedanken ab: hin zu seltsamen Menschen, die sich kaum berühren, sich umfangen wollen, sich anziehen und doch abstoßen. Zum einfachen und packenden Rhythmus der Tribal Beats werden wilde und doch konzentrierte Tänze getanzt, zu lauten Verschluss-, Pfeif- und Schmatzgeräuschen entwickelt sich eine ausgeprägte Handarbeit: als wolle man etwas Unsichtbares bilden. Vielleicht sieht man auch Dressurakte. Da ist er dann: der politische Konflikt, der zur Musik von Aleph, Atm, Ophir Ilzetzki, Hofesh Shechter und Sergio Mendes entwickelt wurde.

Am Ende herrscht die pure Kakophonie; der fröhliche Tribal Beat wird vom Chaos übermannt, die musikalische Schicht des „Zuballerns“ aber mündet doch in einem befreienden Schweigen – und das letzte Licht wird schließlich ausgeknipst. „Es ist“, so zitiert das Programmheft Edward O. Wilsons „Einheit des Wissens“, „an der Zeit, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden intellektuellen Werkzeugen als gleichzeitig biologische und kulturelle Spezies erkennen“. Das Ensemble ertanzt sich diesen Erkenntnisprozess mit aggressiven und lyrischen Ausdrucksmitteln. Es sagt uns nicht, was war und was sein könnte, sondern das, was ist: auch unabhängig von Delfinen (den Erfindern einer sehr eigenen, individuumbestimmten Kommunikation) und Hunden. Der Rest sind hinreißende Begegnungen, geheimnisvolle und sanfte Gesten, Berührungen und Abstoßungen.
Riesenbeifall für einen tollen Doppelabend, der – auf sehr verschiedene Arten – das Problem und die Hoffnung auf eine geglückte Kommunikation in die Körper bekommen hat – auch in die Gehirne und Herzen der Zuschauer.
20.3. 2015, Frank Piontek
Fotos: N. Klinger / Staatstheater Kassel
Rokoko-Reflexionen
DER ROSENKAVALIER
Besuchte Aufführung: 9.11.2014 (Premiere: 13.10.2014)
Verabschiedung des Feudalzeitalters
Seit dem Jahr 2000 ist Strauss’ „Rosenkavalier“ am Staatstheater Kassel nicht mehr zu sehen gewesen. Die Inszenierung hatte damals Sebastian Baumgarten besorgt. In der aktuellen Neuproduktion des bereits 1911 uraufgeführten Werkes lag die Regie in den Händen von Lorenzo Fioroni, der zusammen mit Paul Zoller (Bühnenbild) und Sabine Blickenstorfer (Kostüme) eine ebenso eigenwillige wie auch kurzweilige Inszenierung zur Diskussion stellte. Mit leichter Hand setzte er die heiteren Momente in Szene, erwies sich aber auch als Meister in der Herausstellung tiefgehender Emotionen. Der Spagat zwischen betonter Sentimentalität und komisch-grotesken Szenen, die manchmal etwas überzeichnet wirkten, traf den Kern des Stückes voll und ganz.

Celina Byrne (Feldmarschallin), Maren Engelhardt (Octavian)
Einer der für die Oper von Strauss und Hofmannsthal ursprünglich ins Auge gefassten Titel war „Ochs auf Lerchenau“. Dieser Tatsache trägt Fioroni Rechnung, wenn er die Handlung aus der Perspektive von Ochs erzählt, wobei er Brecht’sche Elemente in seine Deutung einfließen lässt. Das Ganze erscheint bei ihm als Erinnerung des hier ganz und gar nicht grobschlächtig gezeichneten, jungen, sympathischen und als etwas heruntergekommener Ludwig XIV-Verschnitt erscheinenden Landedelmanns. Bereits während das Publikum seine Plätze einnimmt, sieht man die leere Bühne bis hin zu den Brandmauern. Beim Einsetzen der Musik schließt sich der Vorhang, dem hier die Funktion einer Brecht’schen Gardine zukommt. Durch eine auf der linken Seite befindlichen Tür ins Off betritt Ochs den Raum, begibt sich über eine seitliche, den Orchestergraben überspannende Brücke auf die Bühne und erweist dem Publikum höflich seine Reverenz. Immer stärker wird er von der Erinnerung übermannt. In heftigem Zorn auf seinen alten Widersacher Octavian zieht er den Säbel, um gleich darauf von unsichtbarer Hand hinter den Vorhang und damit mitten hinein in die Handlung gezogen zu werden.

Friedemann Röhlig (Baron Ochs)
Im Folgenden scheint sich das Geschehen in für Fioroni eigentlich eher untypischen konventionellen Bahnen zu bewegen. Diese Vorgehensweise entpuppt sich letztlich aber nur als Mittel zum Zweck. Nachhaltig praktiziert Fioroni das altbewährte Prinzip des Theaters auf dem Theater, um den Ausklang einer Epoche zu versinnbildlichen. Die Zeit des Rokoko erscheint nur mehr als Reflexion der Darsteller, die in Kostümen dieser Zeit den „Rosenkavalier“ zur Aufführung bringen und an deren Ende wieder ihre moderne Alltagskleidung anlegen. Der erste Aufzug entführt den Zuschauer in das herkömmliche Gemach der Feldmarschallin, dessen Ausstattung sicher auch in Produktionen vergangener Jahrzehnte trefflich gepasst hätte. Dem im Hintergrund platzierten Himmelbett entsteigt zu Beginn nach einer heftigen Liebesnacht mit völlig nacktem Busen die Marschallin, die noch während der ganzen Szene mit Ochs Unterwäsche trägt. Auch im dritten Aufzug erscheint sie in dieser. Offenbar ist sie auf die Schnelle gar nicht mehr dazu gekommen, sich anzukleiden. Wenn es um Emotionen geht, sind alle Menschen unabhängig von ihrer Kleidung gleich. Und in dieser Beziehung hat die Feldmarschallin hier ja bekanntermaßen das Nachsehen. Ihr stellt der Regisseur zwei Doubles, ein riesiges und eines von normaler Größe, zur Seite, die aufgrund ihrer eckigen, kantigen Bewegungen wie Automaten wirken. Hier wird von der Regie nachhaltig das Schreckgespenst des emotionslosen Maschinenmenschen der Zukunft beschworen. Der mit Zahnrädern ausgestatte, abenteuerlich anmutende Rollstuhl des farbigen Mohammed scheint direkt Fritz Langs berühmtem Film „Metropolis“ entsprungen zu sein. Durch diese futuristischen Elemente innerhalb des traditionellen äußeren Rahmens wird das unbarmherzige Verrinnen der Zeit nur zu sinnbildlich. Und genau darin besteht ja auch das Kernproblem der Marschallin, die vor dem Altern große Angst hat. Das gnadenlose Verfließen der Zeit wird zudem durch einige Uhren und die Lebenskrise der aus heutiger Sicht mit 33 Jahren noch recht jungen Adligen, die das Scheitern ihrer Liebe zu dem viel jüngeren Octavian voraussieht, durch das Herausreißen ihres Herzens verdeutlicht.

Marian Pop (Faninal), Friedemann Röhlig (Baron Ochs)
Einerseits weist Fioronis Interpretation mithin sehr werktreue Züge auf, andererseits bürstet er das Stück aber auch ganz schön gegen den Strich. Octavian ist bei ihm kein Mann, sondern eine junge Adlige, die zu Beginn eine auffällige Ähnlichkeit mit der Feldmarschallin aufweist. Die beiden Damen sind hinsichtlich ihrer sexuellen Bedürfnisse wohl Schwestern im Geiste. Irgendwann reißt sich Octavian den sowieso kaum sichtbaren Schnurrbart ab und ist nun ganz eine Frau, die in ihrem weißen Umhängelaken und auch später als po- und busenbetonte Wasserstoff-Blondine Mariandl äußerst sexy wirkt. Das war gut gemacht. Unklar blieb indes, warum sich Octavian während des gemeinsamen Frühstücks mit der Geliebten auf einmal die heiße Schokolade über dem Arm ausschüttet. Dieser deplatziert wirkende Einfall Fioronis ergab überhaupt keinen Sinn. Konnte man bei diesen Szenen durchaus noch an die Aufzeigung einer lesbischen Veranlagung mit entsprechenden Auswirkungen auf Octavians Verhältnis zu Sophie denken, so offenbarte sich alsbald beim Auftritt des Haushofmeisters und der Lakaien der Marschallin der wahre Ansatzpunkt des Regisseurs. Die Bediensteten waren allesamt als Frauen kostümiert, trugen breite Reifröcke und turmhohe Frisuren. Hier wurde klar, dass es Fioroni ganz allgemein um eine Umkehrung der herkömmlichen spezifischen Geschlechterverteilung ging, die er auf diese Art und Weise einfach köstlich auf die Schippe nahm. Fast schon etwas zu überspitzt und aufgedreht ging er dabei ans Werk, die Wirkung war aber enorm. Die Übertreibung erschien hier als legitimes Regie-Mittel.

Friedemann Röhlig (Baron Ochs), Maren Engelhardt (Octavian)
Relativ normal geht es im zweiten Akt zu, der in einer von zahlreichen Jagdtrophäen des reichlich karikativ vorgeführten Großwildjägers Faninal geschmückten Halle angesiedelt ist. Auch hier vermischen sich die Ären. Die zur Schau gestellten Gewehre sind der Entstehungszeit des Werkes zuzuordnen, während die Kostüme an das Zeitalter Maria Theresias angelehnt sind. Octavian erscheint hier wieder als Mann und Sophie trägt den barocken Krinolinen-Rock. In die Gefilde des modernen Musiktheaters dringt Fioroni hier insoweit vor, als er den jungen Grafen seinen ungehobelten Widersacher nicht mit dem Degen verletzen, sondern ihn mit der silbernen Rose in das Geschlecht stechen lässt. Im dritten Aufzug, in dem die Musik auch mal in Brecht’scher Manier aus dem Lautsprecher ertönt, erweist sich dann aber alles als Fassade. Die Theaterillusion der vorausgegangenen beiden Akte wird abgetragen. Der altbackene Rokoko-Mummenschanz erfährt eine Dekonstruktion und der Abend endet in der heutigen Zeit. Ochs stürzt nicht etwa von der Bühne, wie es im Libretto heißt, sondern verlässt sie langsam und immerhin noch als Standesperson durch eine Parketttür. Die Marschallin, Octavian und Sophie ziehen ihre altmodischen Kleider aus und legen modernen Jeans-Look an. Nach Schluss der Aufführung des Theaters auf dem Theater werden die Darsteller privat. Ein regelrechter Theatercoup, der aber gänzlich aus dem Stück heraus begründet ist, gelingt Fioroni am Ende, wenn er die Feldmarschallin schlagartig gealtert und am Stock abgehen lässt - ein sehr eindringliches Bild, das seine Wirkung nicht verfehlte. Ihre größte Angst ist Wirklichkeit geworden. Der Utopie einer zeitübergreifenden Liebe, auf die sie gesetzt hat, bleibt die Erfüllung versagt. Gebrochen und auf der ganzen Linie gescheitert verlässt sie zu den Schlussklängen den Raum, während eine Filmprojektion in den ersten Weltkrieg ziehende Soldaten zeigt. Auf der Bühne befindet sich nur noch ein schwarzer Sarg. Eine neue Ära ist angebrochen, das Feudalzeitalter wird zu Grabe getragen.

Sophie, Maren Engelhardt (Octavian), Celine Byrne (Feldmarschallin)
Einen hervorragenden Eindruck hinterließen Patrik Ringborg und das versiert aufspielende Staatsorchester Kassel. Trefflich gelang es Dirigent und Musiker, das Auditorium in einen mächtigen Klangrausch zu versetzen, der einerseits durch große Intensität und Spannung, andererseits aber auch durch kammermusikalische Klarheit und eine hervorragende Transparenz geprägt war.
Eine Glanzleistung erbrachte Celine Byrne als Feldmarschallin. Die larmoyanten, wehmütigen Züge ihrer Rolle hat sie mit Hilfe einer einfühlsamen, gefühlsbetonten Darstellung trefflich vermittelt. Gesanglich war sie mit ihrem bestens fokussierten, warmen und zur zarten Höhe hin fein aufblühenden Sopran, der überdies über viele Farben und eine ansprechende Pianokultur verfügt, ebenfalls sehr überzeugend. Aufgedreht, fetzig und in hohem Maße spielfreudig präsentierte sich Maren Engelhardt, die zudem mit ihrem in jeder Lage voll und ausdrucksintensiv klingenden Mezzosopran eine Idealbesetzung für den Octavian war. Im Schlussterzett bildeten der über eine solide tiefe Stütze und wunderbar schwebende Höhen verfügende Sopran von Eun Yee Yous Sophie mit den beiden anderen Stimmen einen feinen harmonischen Gesamtklang. Ganz und gar kein herkömmlicher Ochs auf Lerchenau war Friedemann Röhlig. Hier stand kein älterer, dicker und am Ende glatzköpfiger Polterer auf der Bühne, sondern ein gut aussehender, schlanker junger Mann, der nicht nur durch sein prägnantes Spiel, sondern in erster Linie auch mit seinem bestens fokussierten, schön auf Linie und textverständlich eingesetzten und bis zur der extremen Tiefe klangvollen Bass stark für sich einzunehmen wusste. Dass er bei der Stelle „zu nutz“ das von Strauss an dieser Stelle vorgeschriebene hohe gis nicht erreichte, fällt angesichts der beeindruckenden Gesamtleistung nicht ins Gewicht. Freude bereitete das Wiedersehen mit Marian Pop, der mit seinem italienisch geschulten, substanzreichen und höhensicheren Bariton einen guten Faninal sang.
Eigentlich über solides Stimmmaterial verfügend, tat sich Jaclyn Bermudez mit den Spitzentönen der Leitmetzerin schwer. Bei den hohen h’ s ging sie immer vom Körper weg, woraus ein ziemlich schriller Klang resultierte. Als Fehlbesetzung erwies sich Paulo Paolillo, der die Arie des eine ausgemachte Abziehfigur darstellenden italienischen Sängers so ganz und gar nicht auf italienische Manier, sondern vielmehr ziemlich flach und maskig sang. Das gilt auch für Seong Ho Kims Tierhändler und Wirt sowie den Haushofmeister der Feldmarschallin in Gestalt von Tobias Hächler, die beide nur recht dünnes Tenormaterial aufwiesen. Gesangssolisten, die den Valzacchi ordentlich im Körper singen, sind selten. Bassem Alkhouri ist einer von ihnen. Die Annina der voll und rund singenden Brenda Williams stand ihm in nichts nach. Eine Karikatur von Polizeikommissar, dessen sehr halsig klingender Bass zudem noch recht unfertig schien, stellte Abraham Singer dar. Ordentlich sang Hyunseung You den Haushofmeister bei Faninal. Als Notar hatte Dieter Hönig seine besten Zeiten hinter sich. in der Mini-Partie der Modistin war Ann-Christine Förste zu erleben. Die drei adeligen Waisen gaben Anna Sorokina, Sabine Roppel und Sabina Kuznetsova. Tadellos war der von Marco Zeiser- Celesti einstudierte Chor.
Fazit: Ein sehens- und hörenswerter Abend, dessen Besuch zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 10.11.2014 Die Bilder stammen von Nils Klinger.
Die neue Spielzeit 2014 / 2015
Kurzfassung:
DER ROSENKAVALIER
Komödie für Musik von Richard Strauss
Musikalische Leitung: Patrik Ringborg
Inszenierung: Lorenzo Fioroni
Premiere: 11. Oktober 2014 | Opernhaus
THE SOUND OF MUSIC
Musical in zwei Akten von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II
Musikalische Leitung: Alexander Hannemann
Inszenierung: Philipp Kochheim
Premiere: 1. November 2014 | Opernhaus
IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Tragédie opéra in vier Akten von Christoph Willibald Gluck
Musikalische Leitung: Jörg Halubek
Inszenierung Reinhild Hoffmann
Premiere: 20. Dezember 2014 | Opernhaus
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Melodramma buffo in drei Akten von Gioachino Rossini
Musikalische Leitung: Yoel Gamzou
Inszenierung: Adriana Altaras
Premiere: 14. Februar 2015 | Opernhaus
TURANDOT
Dramma lirico in drei Akten von Giacomo Puccini, Schluss von Luciano Berio
Musikalische Leitung: Patrik Ringborg
Inszenierung: Markus Dietz
Premiere: 28. März 2015 | Opernhaus
UN RE IN ASCOLTO [EIN KÖNIG HORCHT]
Musikalische Handlung in zwei Teilen von Luciano Berio
Musikalische Leitung: Alexander Hannemann
Inszenierung: Paul Esterhazy
Premiere: 23. Mai 2015 | Opernhaus
DER MOND 11. TJO
»Ein kleines Welttheater« (1938/71) von Carl Orff
Musikalische Leitung: Alexander Hannemann
Inszenierung: Espen Fegran
Premiere: 3. Juli 2015 | Schauspielhaus
EUGEN ONEGIN
Lyrische Szenen in drei Aufzügen von Peter Tschaikowsky
Musikalische Leitung: Patrik Ringborg
Inszenierung: Lisa Marie Küssner
Premiere: 4. Juli 2015 | Opernhaus
Geneviève de Brabant / Der Diktator
Premiere: 12. Juli 2014
Absolute Raritäten
Im Rahmen des seit zehn Jahren laufenden Projekts „Theater-Jugendorchester“ brachte das Staatstheater Kassel im Schauspielhaus einen Operndoppelabend mit zwei kaum gespielten Stücken zur Aufführung: „Geneviève de Brabant“ von Erik Satie und „Der Diktator“ von Ernst Krenek.

Das 1899 uraufgeführte dreiaktige Werk (Libretto: Lord de Chaminot) des französischen Komponisten Erik Satie (1866 – 1925), der mit Debussy und Diaghilew befreundet war und ab 1918 die Gruppe „Les Six“ leitete, wurde eine „miniature marionette opéra“ genannt. In ihr wird die alte Sage von Genoveva abgehandelt: Sie ist mit dem Pfalzgrafen Siegfried verheiratet, der vom Gewehr seines Haushofmeisters Golo getroffen wird. Golo verliebt sich in Geneviève, die ihn jedoch entrüstet abweist. Aus Rache will er sie vernichten, doch in Gestalt einer Hirschkuh, die imstande ist, auch ihr Kind zu ernähren, wird ihr göttliche Hilfe zuteil. Happyend: Siegfried wurde nicht getötet, nur verwundet und rettet schließlich Geneviève vor dem Unhold Golo.

Ernst Krenek (1900 – 1991) zählt zu jenen österreichischen Komponisten der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, die vor den Nationalsozialisten fliehen und nach Amerika emigrieren mussten und nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich nicht mehr Fuß fassen konnten. Ihre Werke wurden in der Heimat kaum noch gespielt. Seine Einakter-Trilogie („Der Diktator“, „Das geheime Königreich“, „Schwergewicht oder Die Ehre der Nation“) wurde 1928 in Wiesbaden uraufgeführt.
Die Handlung des Einakters „Der Diktator“, dessen Libretto der Komponist selbst verfasste, in Kurzfassung: Maria verwandelt sich von der potentiellen Tyrannenmörderin in eine willfährige Geliebte des Diktators. Sie hatte ihn aufgesucht, um an ihm Rache für ihren im Krieg erblindeten Ehemann zu nehmen, liegt aber bald in seinen Armen. Als Charlotte, seine von ihm seit langem gedemütigte Frau, die zu Boden gefallenen Pistole aufnimmt und Maria, die vom Diktator als Schutzschild missbraucht wird, erschießt, verwandelt sich der Diktator binnen Sekunden in einen kühl kalkulierenden Herrscher und seine despotische Handlungsweise bricht wie eine Fassade zusammen.

Lisa Maria Küssner inszenierte beide Werke sehr realistisch – die Gewehr- und Pistolenschüsse ließen das Publikum regelrecht zusammenzucken – und mit exzellenter Personenführung. Die kleine Bühne im Untergeschoß des Schauspielhauses wurde von Isabell Heinke durch verschiebbare Wände und Türen gut genutzt, die der heutigen Zeit entsprechenden Kostüme entwarf Ulrike Obermüller.
Die Rollen waren in beiden Opern mit demselben Sängerensemble besetzt. Ausgezeichnet die Sopranistin Anna Nesyba, die im ersten Stück sowohl die Erzählerin – gemeinsam mit dem CANTAMUS-Jugendchor – wie auch Geneviève (in einigen Szenen abwechselnd mit der Sopranistin Jaclyn Bermudez) gab. In Kreneks Oper sang und gestaltete sie eindrucksvoll die Rolle der durch „Amor“ verhinderten Tyrannenmörderin Maria, die schließlich als Schutzschild des Diktators ihr Leben lässt.
Der koreanische Tenor Kwonsoo Jeon stellte im ersten Werk Siegfried dar und im zweiten den blinden Offizier, der verzweifelt seine Ehefrau Maria sucht. Sein am Schluss der Oper in höchsten Tönen immer eindringlicher gesungene Ruf „Maria“ hallt in meinen Ohren jetzt noch nach!

Die Rollen der beiden Bösewichte gestaltete der polnische Bassbariton Tomasz Wija stimmlich wie darstellerisch sehr ausdrucksstark. War in Saties Oper mehr seine schauspielerischen Qualitäten als hinterhältiger Golo gefragt, konnte er in Kreneks Werk den Diktator facettenreicher singen und spielen.
Die Titelrolle in Saties Oper Geneviève de Brabant verkörperte die Sopranistin Jaclyn Bermudez, die in Kreneks Werk Der Diktator dessen vernachlässigte Frau Charlotte spielte, die zur Mörderin wird. Beide Rollen füllte sie stimmlich wie schauspielerisch eloquent aus.
Ausgezeichnet agierte auch der CANTAMUS-Jugendchor, dem in der Satie-Oper erzählender Charakter zukam und im Krenek-Einakter Soldaten und Krankenschwestern darzustellen hatte (Einstudierung: Maria Radzikhovskiy). Den jungen Chormitgliedern war ihre Freude und Begeisterung am Spielen anzusehen!
Das mit knapp sechzig Personen stark besetzte Theater-Jugendorchester stand unter der Leitung von Alexander Hannemann. Dass die jungen Musikerinnen und Musiker die Partituren beider Werke so professionell zum Besten gaben, ist gewiss einer intensiven Probezeit mit dem Dirigenten zuzuschreiben. Das bereits seit zehn Jahren bestehende Projekt „Theater-Jugendorchester“ scheint ein Erfolgsprodukt zu sein, zu dem man dem Staatstheater Kassel gratulieren muss.
Das Premierenpublikum anerkannte die Leistungen am Schluss der Vorstellung mit nicht enden wollendem Applaus für alle Mitwirkenden und für das Regie-Team.

Udo Pacolt 14.7.14 - Übernahme Merker-online
Bilder: N. Klinger
CD-Tipp:
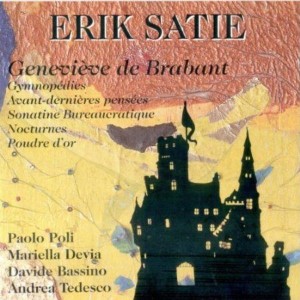

Pressemitteilung:
Heute, am 26. März 2014, hat Intendant Thomas Bockelmann mit seinem künstlerischen Leitungsteam den Spielplan für die Saison 2014/2015 vorgestellt. Neu im Team ist ab der Spielzeit 2014/15 Markus Dietz, der Patrick Schlösser als Oberspielleiter im Schauspiel nachfolgt. Dietz hat am Staatstheater Kassel bereits mehrfach inszeniert: „Woyzeck“, „Der nackte Wahnsinn“, „Wir lieben und wissen nichts.“ Aktuell erarbeitet er Shakespeares „Macbeth“. Premiere ist am 23. Mai.
Das Programm des Musiktheaters umfasst wieder einige Jahrhunderte: Werke von Gluck bis Berio stehen auf dem Spielplan. Eröffnet wird die Saison am 11. Oktober mit Richard Strauss´ Komödie für Musik Der Rosenkavalier unter der musikalischen Leitung von Patrik Ringborg und in der Inszenierung von Lorenzo Fioroni. The Sound of Music, das Musical von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, folgt am 1. November. Die musikalische Leitung übernimmt Alexander Hannemann, Regie führt Philipp Kochheim. Christoph Willibald Glucks Iphigénie en Tauride wird unter der musikalischen Leitung von Jörg Halubek und in der Inszenierung von Reinhild Hoffmann am 20. Dezember seine Premiere im Opernhaus feiern. Il Barbiere di Siviglia (Der Barbier von Sevilla) von Gioachino Rossini ist unter der musikalischen Leitung von Yoel Gamzou und in der Inszenierung von Adriana Altaras ab 14. Februar 2015 im Opernhaus zu erleben. Turandot von Giacomo Puccini - mit Schluss-Fassung von Luciano Berio - hat unter der musikalischen Leitung von Patrik Ringborg und in der Inszenierung von Markus Dietz am 28. März 2015 Premiere. Am 23. Mai folgt dann von Luciano Berio Un Re in Ascolto (Ein König horcht). Die musikalische Leitung dieses Abends hat Alexander Hannemann, Regie führt Paul Esterhazy. Das nunmehr schon 11. Theater-Jugendorchester-Projekt (TJO) bringt unter der musikalischen Leitung von Alexander Hannemann und in der Inszenierung von Espen Fegran Carl Orffs Ein kleines Welttheater (1938/71) am 3. Juli im Schauspielhaus auf die Bühne. Eugen Onegin von Peter Tschaikowsky beschließt unter der musikalischen Leitung von Patrik Ringborg und in der Inszenierung von Lisa Marie Küssner am 4. Juli 2015 das Programm des Musiktheaters der Spielzeit 2014/2015.
Im Schauspielhaus eröffnet Intendant und Schauspieldirektor Thomas Bockelmann am 3. Oktober die Saison im Schauspiel mit der deutschsprachigen Erstaufführung Smokefall des jungen amerikanischen Autors Noah Haidle (die Spielzeit 13/14 eröffneten wir mit der Uraufführung Lucky Happiness Golden Express dieses Autors) Schon am 2. Oktober kommt in der Inszenierung von Martin Schulze auf der Studiobühne im Fridericianum (tif) Waisen von Dennis Kelly zur Premiere. Feydeaus Komödie Floh im Ohr, inszeniert von Markus Dietz, folgt am 10. Oktober im Schauspielhaus. Am 12. Dezember hat Gift. Eine Ehegeschichte von Lot Vekemans in der Regie von Maik Priebe im tif Premiere und am 13. Dezember folgt im Schauspielhaus Hamlet, in einer Inszenierung von Gralf-Edzard Habben. Sebastian Schug wird am 13. Februar mit Heinrich von Kleists Penthesilea im Schauspielhaus Premiere feiern - und die Uraufführung des Stückes Die Kunst der Selbstabschaffung (Arbeitstitel) von Rebekka Kricheldorf, inszeniert von Schirin Khodadadian, steht am 15. Februar im tif auf dem Spielplan. Die bittere Komödie von Wajdi Mouawad Hochzeit bei den Cromagnons inszeniert Gustav Rueb, Premiere ist im tif am 10 April. Im Schauspielhaus folgt, inszeniert von Eva Lange, am 11. April 2015 Yasmina Rezas Drei Mal Leben. Markus Dietz bringt Nachtasyl von Maxim Gorki am 5. Juni im tif zur Premiere. Einen Tag später folgt im Schauspielhaus Peter Handkes Stück Immer noch Sturm in einer Inszenierung von Marco ©torman. Das Sommertheater findet in diesem Jahr en suite und mit viel Musik diesmal ab 17. Juli im Schauspielhaus statt: The Who´s Tommy, Rockoper von Pete Townshend, inszeniert von Patrick Schlösser.
Die erste Produktion des Tanztheaters zukunft 2.0 (Arbeitstitel) wird am 22. November im Schauspielhaus in einer Choreografie von Johannes Wieland und einem weiteren Choreografen zur Premiere kommen. Es folgen am 25. April im Opernhaus die Uraufführung Aurora (Arbeitstitel) zu Musik von Tschaikowsky mit dem Staatsorchester Kassel unter der musikalischen Leitung von Yoel Gamzou und die Choreografische Werkstatt am 21. Mai 2015 in der Studiobühne im Fridericianum. (tif)
Das Kinder- und Jugendtheater (KJT)
Die erste Produktion des Kinder und Jugendtheaters ist die Uraufführung Kaltes Herz von Dieter Klinge - der auch inszeniert - nach dem Märchen von Wilhelm Hauff für Kinder ab 8 Jahre. Premiere ist am 12. Oktober 2014. Als Weihnachtsmärchen steht im Opernhaus ab 19. November Aladin und die Wunderlampe auf dem Programm. Regisseur Peter Seuwen hat das Stück nach den „Märchen aus Tausendundeiner Nacht“ geschrieben. Tschick von Wolfgang Herrndorf in einer Bühnenfassung von Robert Koall steht für alle ab 14 Jahre ab 1. Februar 2015 auf dem Spielplan des tifs. Regie führt Philipp Rosendahl. Am 29. März gibt es dann im tif die deutsche Erstaufführung des Stücks Restmüll von Ko van den Bosch für Besucher ab 7 Jahre. Dieter Klinge inszeniert.
THE TURN OF THE SCREW
Besuchte Aufführung: 4. 10. 2013 (Premiere: 15. 6. 2013)
Nackte Geister
Sie stellt einen wahrlich erstklassigen Beitrag zum Britten-Jahr 2013 dar: Die bereits im vergangenen Juni aus der Taufe gehobene Neuproduktion von „The Turn of the Screw“, zu deutsch „Die Drehung der Schraube“, mit der das Staatstheater Kassel dem Komponisten, der heuer gegenüber den berühmteren Jubilaren Wagner und Verdi etwas ins Hintertreffen geriet, seine aufrichtige Reverenz erweist. Jetzt erlebte diese rundum gelungene Produktion ihre erfolgreiche Wiederaufnahme.

Brittens 1954 im Teatro la Fenice, Venedig uraufgeführte Oper beruht auf der gleichnamigen, 1898 erstmals veröffentlichten Geistergeschichte von Henry James. Es geht um die Erlebnisse einer jungen Gouvernante auf dem englischen Landsitz Bly. Einzig unterstützt durch die alte Haushälterin Mrs. Grose soll sie sich dort um die beiden Waisenkinder Miles und Flora kümmern. Den Auftrag dazu hat ihr der Onkel und Vormund der beiden Kinder erteilt, in den sie sich verliebt hat. Bedingung für ihre Anstellung ist, dass sie ihn unter keinen Umständen kontaktiert und alle auftretenden Probleme allein bewältigt. Und solche gibt es genug. Denn die Geister der ehemaligen Gouvernante Miss Jessel und des alten Dieners Quint machen ihr das Leben ganz schön schwer. Mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln versuchen sie, sich der Kinder zu bemächtigen, was die Gouvernante vehement zu verhindern trachtet. Letzten Endes kann sie aber die Katastrophe doch nicht verhindern.
Brittens Musik mutet recht kammermusikalisch an. Im Graben sitzen lediglich dreizehn Spieler, woraus ein zeitweilig recht intimer Charakter resultiert. So z. B. gleich zu Beginn, als die Worte des Prologs nur von einem Klavier untermauert werden und der Focus demzufolge noch auf dem narrativen Element liegt. Nichtsdestotrotz drängt sich im Folgenden von Zeit zu Zeit bei dramatischen Ausbrüchen auch der Eindruck eines riesigen Orchesters auf. Herrliche Traumbilder wechseln mit ätherischen Stimmungen ab. Das sind aber nur zwei Aspekte von Brittens interessanter und abwechslungsreicher Partitur. Er hat seine Oper symmetrisch in zwei Teile aufgespalten, die aus jeweils acht Bildern bestehen. Letztere wiederum sind durch fünfzehn Variationen voneinander abgetrennt. Obwohl das Hauptthema aus zwölf Tönen besteht, haben wir es hier nicht mit Zwölftonmusik zu tun. Britten setzt vielmehr auf Tonalität. Das Schraubenmotiv erfährt bei ihm eine klare Gliederung. Es ist aus sechs aufsteigenden Quartensprüngen aufgebaut, die durch absteigende Terzen miteinander verbunden sind. Diese Quarten winden sich über sämtliche zwölf Töne immer höher, so dass auch musikalisch der Eindruck einer sich drehenden Schraube entsteht. Diese pendelt ständig zwischen den Tonarten der Gouvernante (A-Dur) und Quints (As-Dur) hin und her. Diese Spiralbewegung der Musik erzeugt eine enorme Spannung und zieht sich unter oft asynchronen Rhythmen durch das ganze Werk. Schon zu Anfang lässt Britten damit rein musikalisch die Gouvernante und Quint gegeneinander antreten.

Dieses Aneinanderreiben zweier Tonarten hat eine ausgesprochen bitonale Struktur zur Folge, die zu den Hauptcharakteristiken der Oper gehört. Miss Jessel bewegt sich gerne zwischen den Paralleltonarten f-Moll und As-Dur, was insbesondere im ihrem Duett mit der Gouvernante im zweiten Akt der Fall ist, die hier ebenfalls durch f-Moll gekennzeichnet ist. Die musikalischen Charakterisierungen sind Britten vorzüglich gelungen. Der Anfang wirkt noch unbeschwert, die Gouvernante tritt zwischen C-Dur und D-Dur wandelnd in Bly ein. Aber schon wenig später kommt es beim Eintreffen des Briefes aus Miles’ Schule mit dem Einsetzen von a-Moll erstmals zu einer musikalischen Trübung. Im zweiten Akt steht die düstere und das tragische Ende vorausnehmende Nachttonart es-Moll öfters im Vordergrund. Am Ende schließt sich der Kreis. Bei Miles’ Tod ist Britten wieder bei der Ausgangstonart A-Dur angelangt. Des Weiteren springt ins Auge, dass die vom Komponisten gewählten Tonarten im ersten Akt durchweg aus den Tönen der weißen Klaviertasten gebildet werden, im zweiten Aufzug dagegen von den schwarzen Tasten bestimmt werden. Von A-Dur und As-Dur ausgehend schrauben sich die Tonarten immer weiter nach unten, wobei sie ständig b-Moll, die Tonart des Bösen, anstreben. Mit Blick auf die Tatsache, dass die beiden Geister, die sich hier im Gegensatz zu James’ Novelle auch artikulieren können und viel zu singen haben, immer stärker die Oberhand gewinnen, ist diese Vorgehensweise des Komponisten durchaus nachvollziehbar. Der Kampf zweier gegensätzlicher Welten wird offenkundig. Gut und Böse, Hell und Dunkel bekriegen sich. Klangfarblich zieht Britten die Grenze zwischen den beiden Bereichen mit Hilfe der Quint zugeordneten Celesta, die trefflich das magisch Lockende dieser Figur versinnbildlicht. Hier fühlt man sich etwas an die Klangdramaturgie von Mahlers Sechster Symphonie erinnert. Insgesamt hat Britten eine schwermütige Musik geschrieben, die den tristen Inhalt der Handlung aufs Beste unterstreicht. Alexander Hannemann bewies ein vorzügliches Gespür für Brittens Tonsprache, die er zusammen mit dem gut disponierten Staatsorchester Kassel in all ihrer Suggestivität sehr eindringlich und mit hohem emotionalem Gehalt vor den Ohren des Publikums ausbreitete.

Das Stück hat im Lauf der Zeit vielerlei Interpretationen erfahren. Bis heute ist nicht so recht klar geworden, ob es sich bei dem Ganzen nun um eine Geistergeschichte, um eine Halluzination der Gouvernante oder um ein Stück über Kindesmissbrauch handelt. Alles ist möglich. Paul Esterhazy hat für seine gelungene Inszenierung den psychologischen Zugang gewählt und erzählt die Geschichte in Form einer Rückblende als Wahn der Gouvernante, die bereits zu Beginn den toten Miles im Arm hat. In engem Bezug zu der Handlung steht Sigmund Freuds Bericht von Miss Lucy R, einer seiner Patientinnen, die sich unbewusst in den Vater der von ihr gehüteten Kinder einer entfernten Verwandten verliebt hat und nicht weiß, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Dieser Essay des genialen Psychoanalytikers dient Esterhazy als Ausgangspunkt für seine Deutung. Bei ihm erscheint Freud persönlich auf der Bühne. Er singt den Prolog und beobachtet und analysiert im Folgenden das sich in Pia Janssens - von ihr stammen auch die gelungenen, altmodischen Kostüme - engem Bühnenraum, durch dessen Fenster man auf eine idyllische Landschaft mit einem naturalistisch anmutenden See hinausblickt, mit großer Stringenz ablaufende Geschehen. Da der Sänger des Prologs ja auch den Quint singen muss, hat der Regisseur den Psychiater im weiteren Verlauf der Handlung durch ein Double ersetzt. Um das Gespaltene in der Wahrnehmung der hier verrückten, mit manchmal etwas zwanghaften Bewegungen versehenen Gouvernante zu verstärken, hat er auch den übrigen Personen Doppelgänger an die Seite gestellt, wie es jüngst auch Frank Hilbrich in Mannheim bei derselben Oper - wir berichteten - gemacht hat.
Durch diesen genialen Schachzug seitens der Regie verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion miteinander. In dem stark beengten äußeren Raum, der von Umbaustatisten von Bild zu Bild ständig etwas variiert wird, entsteht eine geistige Zwischenwelt, in der sich nicht zuletzt durch Esterhazys ausgefeilte, dicht gedrängte Personenregie eine Atmosphäre von beklemmender Wirkung ausbreitet. Einfühlsam nimmt der Regisseur den Zuschauer bei der Hand und unternimmt mit ihm eine Reise durch die Psyche der Gouvernante, die zunehmend verstörter wird und Dinge sieht, die den anderen Personen verborgen bleiben, so die beiden fast stets präsenten Geister. Miss Jessel und Quint sind die ganze Zeit über splitternackt, was indes von Esterhazy in keinerlei Hinsicht als Provokation gemeint ist, sondern in geschickter Weiterführung seines Ansatzpunktes sogar ausgesprochen konsequent, logisch und äußerst stimmig erscheint. Inmitten der altmodischen, streng viktorianischen Kostüme der anderen Handlungsträger ist es gerade diese totale Nacktheit, die den beiden imaginären Astralwesen eine besondere Unheimlichkeit und regelrechte Dämonie verleiht und deshalb dramaturgisch großen Sinn macht. Selten hat man eine Inszenierung gesehen, in der die Nacktheit auf der Bühne so schlüssig und gut begründet war.

Der äußeren Nacktheit von Miss Jessel entspricht eine innere Entblößung der Gouvernante, wenn der Spiegel ihr einmal nicht ihr eigenes Gesicht, sondern das ihrer toten Vorgängerin zeigt, mit der sie ein intensives Zwiegespräch führt - ein ungemein starkes Bild, das genauso unter die Haut geht wie das vorangegangene, in der sich die Beteiligten an der Gruft von Miss Jessel und Quint ein Stelldichein geben. Insbesondere die diabolischen Züge des ehemaligen Dieners werden durch seine Identifikation mit dem Teufelsgeiger Paganini noch intensiviert. Zu diesem Zweck gibt der Regisseur ihm zwar keine Geige, aber immerhin ein Cello in die Hand. Und wenn er während des traurigen, Unheil verheißenden „Malo“-Gesangs des kleinen Miles dasselbe Wort mit Kreide an die Schultafel schreibt, kann an dem tragischen Ausgang kein Zweifel mehr bestehen. Durch derartig imposante visuelle Impressionen wird der triste Charakter, dem Esterhazy und sein Team dem Ganzen zugrunde legen, nur noch verstärkt. Letztlich kann aber sogar Freud nicht mehr helfen. Seine Versuche, die Gouvernante von ihrer psychologischen Störung zu heilen, sind schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sich das innere Wesen der Gouvernante jeglicher tiefschürfenden Psychoanalyse entzieht. Das alles wurde von Esterhazy mit großer Stringenz und spannend umgesetzt.

In der Umsetzung seines Konzeptes fand er in den aufgebotenen Sängern und Statisten hervorragende Partner. Sie alle liefen rein darstellerisch zur Höchstform auf. Hier ist an erster Stelle die famose Runette Botha zu nennen, die voll in der Rolle der von ihr sehr intensiv und impulsiv sowie mit hoher emotionaler Ausdruckskraft gespielten Gouvernante aufging. Auch gesanglich vermochte sie mit ihrem gut focussierten, tiefgründigen und höhensicheren Sopran voll zu überzeugen. Treffliche Unterstützung fand sie im Gouvernanten-Alter-Ego Franziska Schwedes . Maren Engelhardt legte die Miss Jessel mit trefflich gestütztem, sonorem Sopran rech dramatisch an. Gideon Poppe als Quint und Prolog klang dagegen ziemlich dünnstimmig. Während die beiden Sänger konzeptgemäß aus dem Off heraus sangen, agierten die stummen Nackedeis Astrid Weigel und Till-Ulrich Herber eindrucksvoll auf der Bühne. Als Freud-Double bewährte sich Pablo Schelter. Mit insbesondere in der Höhe etwas variablem Stimmsitz sang Lona Culmer-Schellbach die Mrs. Grose, die Doppelgängerin der Haushälterin war Melitta Schäffer. In jeder Hinsicht erfreulich waren auch die Leistungen der beiden Kinder Sophie Geismann und Matthias Gude in den Rollen der Geschwister Flora und Miles.
Fazit: Ein spannungsgeladener, gut durchdachter Opernabend, der dem Staatstheater Kassel zu großer Ehre gereicht und dessen Besuch sehr zu empfehlen ist.
Ludwig Steinbach, 14. 10. 2013 Die Bilder stammen von Nils Klinger.
TANNHÄUSER
Besuchte Vorstellung am 04.05.2013
Das Staatstheater gibt Wagner – oder das, was Lorenzo Fioroni vom „Tannhäuser“ übrig lässt
Dreimal bemühte die Leitung des Staatstheaters Lorenzo Fioroni, Richard Wagners Opernwerke auf der Bühne zu realisieren. Zweimal misslang dieses gründlich: Dem „Fliegenden Holländer“ und „Lohengrin“ stülpte er eine eigene „Story“ über, in der sich der Zuschauer zu Wagners Musik die passenden Bilder selbst denken musste. Auch die „Meistersinger“ gerieten vor drei Jahren zu einer Klamauk-Nummer.
Es gab einen Flyer zu „Tannhäuser“: Der rote Faden der realen Bühnenhandlung wurde richtig angedeutet, die inhaltlichen Prinzipien des Werkes genannt. Die Musik der magischen Klangbilder ließ hoffen. Auch die Ankündigung auf der Internet-Seite blieb dem roten Faden der Handlung treu, sie mochte einen Opernführer ersetzen. Gespanntheit auf die Musik wurde erzeugt. Ein Teil der Opern-Soiree allerdings galt einer Wagner-Parodie. Sollten da die „Weichen gestellt“ werden? Eine erste klare Ansage, dass Wagners Opernstoff eine „Mutation“ durch die Regie erlebt, ergeht beim Studium des Programmheftes. Nicht die „Handlung“, sondern die „Vorgänge“ werden formuliert. Das Regie-Team (m.E. eine Art „Murks-Brothers“) hat in Kassel längst als fester Bestandteil der Theater-Wirklichkeit Furore gemacht und breitet erneut seinen Regie-Theater-Brei par excellence aus. Das ist nichts als bloße Beliebigkeit, Verzicht auf Originalität! Wagner selbst spielt offensichtlich keine Rolle mehr. Lediglich die Musik muss herhalten.
Beispiele für die missglückte Regie: Der Hörselberg als Balkon-Vorbau, ohne jeglichen Bezug zu Erotik oder gar sinnlich-erotischer Liebe. Waldszene und Wartburghalle geraten zur Party-Kaschemme, mit Sauforgien, mal heller, mal dunkler beleuchtet. Die Protagonisten stolpern und fallen durch die Szene. Der „Einzug der Gäste“ als karnevalistischer Mummenschanz geht musikalisch durch Gekreisch, Gekicher und Gestolper fast unter. Es gehört zwar nicht zur Wartburg-Szene, aber was kommen muss, kommt auch: Tannhäuser liftet die Hosenträger und lässt die Hosen fallen. Wahrscheinlich will er erschrecken. Dafür greift er der „Party-Diva“ Elisabeth vehement in den Schritt (Was sein muss, muss wohl sein: Ein Hurra auf das Sudel-Theater!). Regie-Theater à la Fioroni eben.
Und der Schluss? Statt Szenengestaltung lässt er den Libretto-Text als Video-Projektion laufen! Er kneift vor der szenischen Herausforderung, die Regie-Theater- Masche (eines Peter Konwitschny) im Rücken.
(M)Eine Erklärung: Fioroni liefert uns eine Persiflage (!). Was sich textlich zu seinen Eigenwilligkeiten eignet, wird aufgegriffen. Wenn er die Text-Grundlage bewusst ignoriert oder überspielt, dann veralbert er uns als Zuschauer/Besucher, dazu allerdings auch die Theaterleitung. Meine Vermutung jedoch: Er treibt sein Spiel unbewusst. Er meint ernst, was er auf die Bühne bringt, glaubt an die eigene Seriosität. Das liegt m.E. daran, dass er die Wagnersche Textgrundlage gar nicht kennt (oder nicht verstanden hat)! Bei solchen Voraussetzungen verkommt dann auch Kunst unversehens zu Event, Happening, Klamauk. Die Kunst- und Künstlerszene ist (leider) voll von solchen Beispielen. Auch Regie-Theater „suhlt“ sich mittlerweile in solchen Entgleisungen. Den Anfängen zu wehren wurde versäumt.
Und die Musik? Zu Recht hat Christian Thielemann sich jüngst darüber beklagt, dass die Kommentare der Medien-Scribenten sich in den Wagner-Rezensionen zu großen Teilen mit der Regie und deren Konzept beschäftigen. Die musikalischen Aufwendungen bleiben eher auf der Strecke, obwohl keine (Wagner) –Oper ohne hohe musikalische Leistungen von Dirigent, Orchester, Solisten und Chor funktioniert, von den Einzelvorbereitungen angefangen bis zum klangvollen Zusammenspiel bei der Aufführung.
Zugestandenermaßen: Das Tohuwabohu der Bühnen-Gags und die teils makabre Personenführung und –gestaltung lenken heftig davon ab, sich der musikalischen Präsentation hinzugeben. Das wunderbare Septett am Ende des I. Aktes geht (leider) im szenischen Klamauk unter. Auch bei der musikalisch eigentlich berührenden, ja ergreifenden Klangwelt und Stimmung beim Finale des II. Aktes hatte man Mühe, die bemerkenswerte Klanggestaltung zu erkennen und ihr zu lauschen. Die Chöre, eigentlich Sternstunden der Wagnerschen Opernchor-Musik, leiden unter der Zerfledderung des Bühnengeschehens.
Neben den düpierten Besuchern sind die Säulen des Musik-Teams unter dem GMD trotz ihrer Leistungen die eigentlichen Verlierer des Inszenierungs-Desasters. Schade. Dem Kasseler Theater, dem man eine gewisse Wagner-Tradition zuzugestehen hat, ist erneut eine Gelegenheit zu großem Operngeschehen entgangen. Das Kasseler Theater und seine Besucher haben Besseres verdient.
Hans-Hermann Trost, 16.05.2013 Fotos weiter unten
Den kompletten Text seiner Impressionen und Gedanken stellt der Verfasser gern zur Verfügung. (Tel: 0561-811267 oder E-Mail Trost-Fuldatal@gmx.de).
TANNHÄUSER
Besuchte Aufführung: 4. 5. 2013 (Premiere: 27. 4. 2013)
Archetypische Heldenreise mit Tarot-Karten

Um es vorwegzunehmen: In szenischer Hinsicht hat sich die Aufführung voll gelohnt. Mit der Verpflichtung von Lorenzo Fioroni für die Neuproduktion des „Tannhäuser“ zum Wagner-Jahr 2013 ist dem schon oft bewährten Staatstheater Kassel wieder einmal ein großer Coup gelungen. Fioroni, dessen diverse Regiearbeiten aus Mainz und Heidelberg man noch in bester Erinnerung hat, bewies auch hier, dass er ein Meister seines Fachs ist. Er versteht es ganz ausgezeichnet, mit Sängern umzugehen, die unter seiner Ägide zu darstellerischer Höchstform aufliefen, und sein außergewöhnliches, nichtsdestotrotz sehr beeindruckendes Konzept, das vielfältige Tschechow’sche und Brecht’sche Elemente enthielt, mit Bravour umsetzten. Wie nicht anders zu erwarten, siedelte der Regisseur die Handlung nicht in einem altbackenen, biederen romantischen Flair an, sondern bettete es in einen neuen, modernen Kontext ein, den er gekonnt mit psychologischen Elementen anreicherte. In dem von ihm gewählten zeitgenössischen Rahmen gelingen Fioroni ungemein eindrucksvolle, packende und insbesondere stimmige Momente, die Ausfluss einer hervorragend durchdachten, geistigen und sehr innovativen Konzeption sind, die zeitweilig auch mit ironischen Brechungen operiert, was dem Ganzen eine besondere Würze gibt.

Wenn sich der Vorhang öffnet, erschließt sich dem Blick ein von Paul Zoller entworfener, riesiger Kubus mit Balkon, auf dem die gutbürgerlichen Eheleute Venus und Tannhäuser zu Beginn beim Austern-Frühstück einen heftigen Streit austragen. Das in steriles Weiß getauchte Innere des Quaders wird von einer im Hintergrund aufragenden Treppenlandschaft mit immer wieder aufscheinenden Projektionen bestimmt, die das Einheitsbühnenbild für alle drei Aufzüge bildet und mittels der Drehbühne in die verschiedensten Stellungen gebracht werden kann. Trefflich wird damit der Kreislauf der Welt symbolisiert, in der am laufenden Band Feste gefeiert werden. So geht die Fete bei Venus, in der eine junge Sängerin - ursprünglich der junge Hirt - beherzt ein pastorales Liedchen zum Besten gibt, nahtlos über in die ausgelassene Party des gut situierten Adligen Hermann von Thüringen, dessen Star die große Künstlerin Elisabeth ist. Ihre große Hallenarie gerät zur glänzenden Primadonneneinlage, in deren Verlauf sie einige der von Katharina Gault gefällig eingekleideten Gäste herzlich begrüßt. Unter diesen tummeln sich zahlreiche bekannte Märchenfiguren wie Rotkäppchen und der böse Wolf, die sieben Raben, Schneewittchen sowie die Prinzessin mit der goldenen Kugel und ihr Froschkönig. Hier gerät die Inszenierung zur heiter-vergnüglichen und liebevollen Märchenparodie, mit denen Fioroni den Brüdern Grimm, die ja lange in Kassel ansässig waren und dieses Jahr wie der Bayreuther Meister ihr Jubiläum begehen, nachhaltig seine Reverenz erweist.

Es ist eine ausgesprochen oberflächliche, eigentlich nicht ernst zu nehmende Spaßgesellschaft, die Fioroni da auf die Bühne stellt. Nur auf letztlich belanglose Äußerlichkeiten bedacht, fehlt ihr jedweder Tiefgang. Feiern heißt das Obermotto, das hier nachhaltig gepflegt wird. Sowohl bei Hermann als auch bei Venus ist man immer nur auf lustvolle Partys aus. Letztere erscheint auch beim Sängerwettstreit, dessen Teilnehmer per Losverfahren durch Champagnerflaschendrehen bestimmt werden. Die Trennung zwischen Wartburg und Venusberg ist aufgehoben, die Gesellschaft tanzt in immer derselben monotonen Art und Weise auf beiden Festivitäten und pflegt eigentlich ein recht ödes Dasein. Zwischen den geistig hochstehenden Idealen der Wartburg und dem erotischen Treiben im Venusberg wird nicht mehr unterschieden. Dass Venus und Elisabeth den Titelhelden, auf den sie zu Beginn des dritten Aufzuges gemeinsam warten, unabhängig voneinander mit ihren nackten Beinen zu reizen versuchen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Alles folgt immer demselben sinnentleerten, unsinnlichen Alltagstrott, der keine geistigen Ziele mehr kennt und dementsprechend im Laufe des Abends immer marodere Züge annimmt. Im dritten Aufzug sind die Gäste dann schon ziemlich heruntergekommen. Der ausgemachten Dekadenz dieser im Untergang befindlichen Gesellschaft trägt der Regisseur dadurch Rechnung, dass er den Tod in Gestalt dreier Frauen mit Totenkopfmasken ständig präsent sein läst. Eine der Todesbotinnen trägt ein Skelett bei sich. Das erste Opfer des Sensenmannes ist die dem Superstar Elisabeth hoffnungslos unterlegene Hirtensängerin, die mit der Sinnlosigkeit ihres Daseins nicht mehr zurechtkommt und sich demzufolge an der Rückwand erhängt. Sie ist die erste, die sich der Tristesse der Verhältnisse bewusst wird und davor per Selbstmord kapituliert. Auch Tannhäuser erkennt die Fragwürdigkeit dieser Versammlung. Er vermag nicht zu akzeptieren, dass sich die übrigen Minnesänger über das von ihm sehr ernst genommene Thema Liebe ständig nur lustig machen. Schließlich kann er ihre ausgemachte Ironie nicht mehr länger ertragen, lässt provokant die Hosen herunter und greift anschließend Elisabeth zuerst an die Busen und dann in den Schambereich - eine Grenzüberschreitung ersten Ranges, die aber für die eigentlich völlig wertfreie Spaßgesellschaft in keinster Weise akzeptabel ist und nachhaltig ihren Widerstand hervorruft. Jetzt zeigen die Gäste auf einmal ein anderes Gesicht. Sie nehmen gewalttätige Züge an, schlagen Tannhäuser nieder und zerbrechen ein Bild des Papstes auf seinem Kopf.

Dem Oberhaupt der katholischen Kirche kommt im Deutungszusammenhang der Produktion eine ganz zentrale Bedeutung zu. Dass der Papst, der zu Beginn auch einmal gleichsam als spiritueller Weltenlenker den ganzen Kubus in Bewegung hält, später Tarot-Karten verteilt, mag manchem Zuschauer blasphemisch vorgekommen sein. Hier ist allerdings der Schlüssel zu Fioronis Konzept verborgen. Er hebt das Ganze auf eine überzeugende innovative Ebene, deren Aussage nichts weniger als brillant ist und beredtes Zeugnis von der immensen psychoanalytischen Beschlagenheit des Regisseurs ablegt. Zwar bringt uns hier C. G. Jungs auf der esoterisch-spirituellen Erklärung beruhender Begriff der Synchronizität nicht weiter, jedoch führt die psychologische Erklärung, die in den Tarotkarten ein projektives bzw. assoziatives Verfahren erblickt und folgerichtig als einen Spiegel innerer und äußerer Prozesse deutet, geradewegs in die Seele des Titelhelden, an dem der Regisseur in Anlehnung an dieses Verständnis grundlegende, typisch menschliche Erfahrungen beleuchtet, die als Mittel der Selbsterkenntnis un- oder vorbewusste Gefühle an die Oberfläche bringen. Auf diese Weise wird Tannhäuser zum Spiegel seines eigenen Selbst. Es ist eine archetypische Reise, die er im Verlauf des Stücks immer stringenter durchläuft. Die Fahrt tritt er als Narr der Tarot-Karten an. Daraus erklärt sich, dass der Protagonist von Fioroni als überaus lächerlicher, unbeholfener Idiot dargestellt wird, eben als Narr und Esel, als dessen äußerer Ausdruck ihm am Ende des zweiten Aufzuges dann auch ein Eselskopf verpasst wird. Diesen Einfall des jungen Regisseurs, auf einem auf den ersten Blick so unscheinbaren Detail wie den Karot-Karten seine Interpretation aufzubauen, kann man als absolut kühn und genial bezeichnen. Er belegt, dass Fioroni zu den ganz Großen der Regiezunft gehört.

Das an Peter Konwitschny gemahnende Ende atmet große Resignation und erstickt geradezu in Schopenhauer’schem Pessimismus. Elisabeth entkleidet sich auf der von Partyabfall bedeckten Bühne und legt ein Büßerhemd an. Anschließend schneidet sie sich die Haare ab und verweilt, nun gänzlich dem Irrsinn verfallen, an der Rampe, ohne das um sie herum Geschehende noch wirklich wahrzunehmen. Eine irgendwie geartete Erlösung findet nicht statt. Auf eine Leinwand werden Wagners Regieanweisungen für den Schluss projiziert, die von der Menge aufmerksam gelesen werden, während der Chor im Hintergrund in Konzertkleidung den Schlussgesang intoniert. Tannhäuser, der sich letztlich nicht zwischen der wahnsinnigen Elisabeth und der betrunkenen Venus entscheiden kann, hat in dieser Welt nichts mehr verloren. Er steigt aus der Handlung aus und verlässt die Bühne durch die Tür des Zuschauerraumes. Venus nimmt es locker und angelt sich Wolfram.

Auf hohem Niveau bewegten sich auch die musikalischen Leistungen. Gespielt wurde eine Mischfassung. Die Ouvertüre und das anschließende Bacchanal entstammten der Pariser Fassung, während der Rest in der Dresdener Fassung ertönte. Patrik Ringborg steht wohl eine große Karriere bevor. An diesem Abend vermochte er zusammen mit dem äußerst diszipliniert und versiert aufspielenden Staatsorchester Kassel das Publikum in einen gleichsam magischen Klangrausch zu versetzen. Bereits das Vorspiel und das Bacchanal präsentierte er mit viel Feuer und atemberaubendem Elan. Auch im Folgenden ließ er es nie an Spannung und Intensität mangeln. Bei aller glühenden Leidenschaftlichkeit des Klangbildes kamen aber Transparenz und feinfühlige Detailarbeit nicht zu kurz. Beherzt zauberten Dirigent und Musiker große musikalische Bögen und eine Vielzahl an Coleurs, was ihre Leistungen ungemein vielschichtig und differenziert erscheinen ließ.
 Insgesamt zufrieden sein konnte man auch mit den Sängern. Die Titelpartie bewegt sich vorwiegend im Passaggiobereich des Baritons und ist deshalb für von dieser tieferen Stimmlage kommenden Tenöre schwer zu singen. Das wurde an diesem Abend wieder nur allzu offenkundig. Sein Bruchton ‚e’ weist Paul McNamara als eigentlichen Bariton aus, der dann auch bereits zu Beginn mit der unangenehm hohen Lage des Tannhäuser ganz schön auf Kriegsfuss geriet. Die drei Strophen seines Liedes an Venus waren von großer stimmlicher Anstrengung, viel zu kurzem Aushalten eines Spitzentones und einmal sogar von einem leichten stimmlichen Einbruch geprägt. Obwohl er sich im Verlauf der Aufführung steigern konnte und insbesondere die heiklen „Erbarm Dich mein“-Rufe passabel hinbekam, wäre er gut beraten, diese Partie nicht allzu oft zu singen. Eine phantastische Leistung erbrachte Stefan Zenkl, der als Wolfram mit gut fundiertem Stimmsitz, der Intelligenz eines Liedersängers, feinen Phrasierungen und vielfältigen dynamischen Nuancen zu begeistern wusste. Puren balsamischen Wohllaut verbreitete der Landgraf Hermann von Hee Saup Yoon, der einen vorbildlich italienisch geschulten, sonoren Bass sein Eigen nennt. Grundsolides Tenormaterial brachte Johannes An in die Rolle des Walther von der Vogelweide ein. Ein markant singender Biterolf war Marc-Olivier Oetterli. Vokal eher unauffällig blieben Musa Nkuna (Heinrich der Schreiber) und Krzysztof Borysiewicz (Reinmar von Zweter). Mit bestens focussiertem, bis zum hohen ‚h’ kräftigem, voll und rund klingendem Sopran stattete Kelly Cae Hogan die Elisabeth aus. In ihrem geradezu wild anmutenden, verzweifelten Flehen um Tannhäusers Leben setzte sie auch imposante darstellerische Akzente. Der Mezzosopran von Ulrike Schneiders Venus hätte vielleicht noch etwas mehr Wärme und Sinnlichkeit vertragen können, wies aber ein solides Fundament auf und wurde ansprechend geführt. LinLin Fan gab mit angenehm timbrierter, leidlich sitzender Sopranstimme den jungen Hirten. Nicht gerade gefällig war der von Marco Zeiser Celesti einstudierte Chor, der insbesondere bei den Männern zu viele dünne Stimmen aufwies, was sich nachteilig auf die Gesamtwirkung insbesondere des Pilgerchores im dritten Aufzug auswirkte, aber auch schon im zweiten Aufzug negativ zu Buche schlug. Um die Damen war es besser bestellt.
Insgesamt zufrieden sein konnte man auch mit den Sängern. Die Titelpartie bewegt sich vorwiegend im Passaggiobereich des Baritons und ist deshalb für von dieser tieferen Stimmlage kommenden Tenöre schwer zu singen. Das wurde an diesem Abend wieder nur allzu offenkundig. Sein Bruchton ‚e’ weist Paul McNamara als eigentlichen Bariton aus, der dann auch bereits zu Beginn mit der unangenehm hohen Lage des Tannhäuser ganz schön auf Kriegsfuss geriet. Die drei Strophen seines Liedes an Venus waren von großer stimmlicher Anstrengung, viel zu kurzem Aushalten eines Spitzentones und einmal sogar von einem leichten stimmlichen Einbruch geprägt. Obwohl er sich im Verlauf der Aufführung steigern konnte und insbesondere die heiklen „Erbarm Dich mein“-Rufe passabel hinbekam, wäre er gut beraten, diese Partie nicht allzu oft zu singen. Eine phantastische Leistung erbrachte Stefan Zenkl, der als Wolfram mit gut fundiertem Stimmsitz, der Intelligenz eines Liedersängers, feinen Phrasierungen und vielfältigen dynamischen Nuancen zu begeistern wusste. Puren balsamischen Wohllaut verbreitete der Landgraf Hermann von Hee Saup Yoon, der einen vorbildlich italienisch geschulten, sonoren Bass sein Eigen nennt. Grundsolides Tenormaterial brachte Johannes An in die Rolle des Walther von der Vogelweide ein. Ein markant singender Biterolf war Marc-Olivier Oetterli. Vokal eher unauffällig blieben Musa Nkuna (Heinrich der Schreiber) und Krzysztof Borysiewicz (Reinmar von Zweter). Mit bestens focussiertem, bis zum hohen ‚h’ kräftigem, voll und rund klingendem Sopran stattete Kelly Cae Hogan die Elisabeth aus. In ihrem geradezu wild anmutenden, verzweifelten Flehen um Tannhäusers Leben setzte sie auch imposante darstellerische Akzente. Der Mezzosopran von Ulrike Schneiders Venus hätte vielleicht noch etwas mehr Wärme und Sinnlichkeit vertragen können, wies aber ein solides Fundament auf und wurde ansprechend geführt. LinLin Fan gab mit angenehm timbrierter, leidlich sitzender Sopranstimme den jungen Hirten. Nicht gerade gefällig war der von Marco Zeiser Celesti einstudierte Chor, der insbesondere bei den Männern zu viele dünne Stimmen aufwies, was sich nachteilig auf die Gesamtwirkung insbesondere des Pilgerchores im dritten Aufzug auswirkte, aber auch schon im zweiten Aufzug negativ zu Buche schlug. Um die Damen war es besser bestellt.

Fazit: Wieder einmal eine Kasseler Wagner-Inszenierung, die schon von ihrem intellektuellen Gehalt her ungemein zu fesseln vermochte. Ein herzliches Dankeschön an die Theaterleitung für diesen phantastischen „Tannhäuser“, dessen Besuch jedem Opernfreund dringendst empfohlen wird.
Ludwig Steinbach, 8. 5. 2013 Die Bilder stammen von Nils Klinger.
Besprechungen älterer Aufführungen befinden sich ohne Bilder auf der Seite Kassel unseres Archivs