KÁTJA KABANOVÁ
Kenner und Könner am Werk!
Premiere am 7. August 2022
Gestern Abend ging mit großem Erfolg die fünfte Opern-Premiere bei den Salzburgern Festspielen 2022 über die Bühne. Die Inszenierung der „Katja Kabanova“ von Leoš Janáček durch Barrie Kosky im rein aus Menschen bestehenden Bühnenbild von Rufus Didwiszus, den Kostümen von Victoria Behr und im genialen Licht von Franck Evin stellte unter schlagenden Beweis, wie stark und emotional gutes Operntheater sein kann, wenn es von Kennern der Materie und aus der Musik heraus konzipiert wird. Kosky und sein Team sind genau solche Kenner und beherrschen das Handwerk der Opernregie aufs Feinste. Und darauf kommt es letzten Endes immer noch an.
Kosky schafft es, ohne eine einzige Requisite die riesige Bühne der Felsenreitschule intensiv zu bespielen mit einem Stück, welches eigentlich eher wie ein mährisches Kammerspiel konzipiert ist.Er und Didwiszus stellen viele Puppen in Kostümen im tristen Grau des Dorfalltags auf die Bühne gegen die Hinterwand, während in den vorderen Reihen echte Statisten mit vermummten Gesichtern agieren. Das wirkt, als würden sie ständig auf die weite Wolga schauen, die ja im Stück eine wichtige Rolle spielt, andererseits aber dem Geschehen wie in Nichtakzeptanz der Handlungen Katjas und Boris‘ den Rücken zuwenden. Nach und nach treten die Protagonisten aus diesem Menschenpulk hervor und beginnen zu spielen. Am Ende treten sie wieder in ihn hinein und verschwinden so aus dem Blick…
Die weite restliche Bühne wird auch durch Katja und Varvara, Ziehtochter der Kabanicha, choreografisch gekonnt einbezogen, während ein riesiger Bühnenvorhang sich in die Aktübergänge schiebt, der teilweise transparent ist und von Dorfgeräuschen wie Glocken oder Grillenzirpen, sowie am Ende von dem ominösen Gewitter begleitet wird. So entsteht das Stück ohne umständliche Verwandlungen, aber mit einer wie immer bei Kosky exzellenten Personenregie wie aus einem Guss. Katja spürt somit „den Druck von etwas Größerem“, wie Kosky im Programmheft formuliert, während gleichzeitig die Problematik ihrer familiären Situation und der Fluchtversuch aus dieser Enge mit Boris in starken Bildern gezeigt wird.
Die US-amerikanische Sopranistin Corinne Winters ist eine Katja der Sonderklasse und erinnert an Asmik Grigorian zu ihrem Karriere-Beginn. Winters spielt unglaublich engagiert und emphatisch und verfügt über einen leuchtenden einnehmenden Sopran, mit dem sie alle Facetten der Rolle ausloten kann. Die slowakische Mezzosopranistin Jarmila Balázová ist als Varvara eine Partnerin auf Augenhöhe, vokal und darstellerisch mit ebenfalls klangvollem Organ. Evelyn Herlitzius gibt eine eiskalte und ultradominante Kabanicha mit bestechenden vokalen Momenten. In einer kurzen Szene mit Dikoj, der prägnant von Jens Larsen verkörpert wird, offenbart sie die ganze Falschheit und Verlogenheit der Figur – und das liegt der Herlitzius gegen Ende ihrer eindrucksvollen Karriere! Wann kommt die Klytämnestra?!
Jaroslav Brezina gibt den Tichon als jämmerliches, aber auch gewalttätiges Muttersöhnchen der Kabanicha und Ehemann Katjas, dem man seine vermeintliche Liebe zu ihr nicht abnehmen kann. David Butt Philip ist ein Boris mit kernigem Tenor, nicht durchgängig schön timbriert, was aber zur Zerrissenheit der Rolle passt. Benjamin Hulett spielt den Liebhaber Varvaras, Kudrjáš, mit charaktervollen Lauten.
Die Konzertvereinigung Wiener Staastopernchor unter der Leitung von Huw Rhys James singt die Töne der riesigen Wolga mystisch als dem Off, und Jakub Hrúša findet am Polt der Wiener Philharmoniker genau die slawischen Linien, die dieses wunderbare Stück mit großem Erneuerungspotential der Oper als Kunstform im 20. Jahrhundert so auszeichnen. Dabei stellte Hrúša stets eine intensive Beziehung zwischen Orchester und dem lebhaften Geschehen auf der Bühne da.
Ein Abend in Salzburg, der vor allem nach dem überaus enttäuschenden neuen „Ring des Nibelungen dokumentierte, wozu Oper in der Lage ist, wenn Plot und Ideen des Komponisten ernst genommen und kenntnisreich aus der Musik heraus umgesetzt werden. Und ganz nebenbei wurde einmal mehr die Mähr wiederlegt, dass Regisseure immer nur dann glücklich sein können, wenn sie besonders heftig ausgebuht werden. Das Publikum feierte die Sänger ohnehin, aber auch das leading team mit begeistertem Applaus. Kein einziges Buh! Und auch Kosky freute sich, ganz ehrlich…
Weitere Termine 11., 14., 21., 26. und 29. August – Besuch dringend empfohlen!
Klaus Billand , 12..8.22
Lohengrin Salzburg 2022-Auch Elsa kann Verbrechen.
Die Salzburger Osterfestspiele versuchen eine Drehung der Verantwortlichkeiten im „Lohengrin“.
Von irgendwo senkten sich ätherische Klänge auf den Orchestergraben des Großen Festspielhauses, wurden von den Streichern der Sächsischen Staatskapelle aufgenommen und mit jedem neuen Takt weiter und weiter gedehnt, bis sie alles umfassten; Musiker und Besucher gleichermaßen.
Mit wenigen Takten gelingt es Christian Thielemann einen höchst dynamischen Spannungsbogen zu eröffnen, der auch im weiteren Verlauf des Abends nicht abreißt. Der Klangzauberer konnte antreiben, martialisches krachen lassen oder große Bögen laufen lassen. Vor allem konnte er das Klangbild in seine Spektralfarben auffächern, abdämpfen und verflechten.
Christian Thielemanns Meisterschaft der Tempi Wechsel, seine Raffinesse der Pausensetzungen, von der Sächsischen Staatskapelle ohne Fehl umgesetzt, machten den Orchesterpart zum dominierenden Gipfel der Lohengrin-Premiere der Osterfestspiele 2022.
Die Übermacht der Klangbilder aus dem Graben war derart frappierend, dass man stellenweise den Eindruck erhielt, die Solisten dürften mit ihrem Gesang das Orchester begleiten und nicht umgekehrt. Dabei agierte Thielemann gewohnt Sänger-freundlich, ließ Raum und deckte nichts zu.
Die Chöre vom Salzburger Landestheater, der Staatsoper Dresden und der Bachchor Salzburg waren perfekt und auf Augenhöhe in dieses Klangbild eingebunden und stützten den Eindruck auf das Eindringlichste. Deshalb seien deren Vorbereiter Ines Kaun, Carl Philipp Fromholz, André Kellinghaus und Christiane Büttig besonders erwähnt.

Das Produktionsteam Jossi Wieler, Anna Viebrock und Sergio Morabito stellte uns vor die Situation, dass Ortrud mit ihrem Verdacht, Elsa habe ihren Bruder bewusst im Walde ausgesetzt, doch richtig gelegen haben könnte.
Denn Elsa konnte nicht akzeptieren, dass sie als die Erstgeborene des im Brabant herrschenden Hauses wegen ihres Frauentums den Machtanspruch an den jüngeren Gottfried abtreten musste und darüber hinaus den ungeliebten Telramund heiraten sollte.
Elsa hatte aber nicht einkalkuliert, dass Ortrud aus ihrer Vermutung eigene Machtoptionen für ihren Partner Telramund ableiten könne.
Das waren aber derart heutige Überlegungen, dass die Handlung der Inszenierung aus dem Jahre 933 um fast eintausend Jahre in die Nähe der Jetzt-Zeit verschoben werden musste.
Das Ganze spielt sich auf einer stilisierten Szene von Anna Viebrock und Torsten Gerhard Köpf in einer düsteren Landschaft an einer Kanal-Schleuse des Schelde-Rhein-Kanals ab. Die Aggressoren aus Thüringen kamen auf Flössen und auch das Brautgemach kam aus der Schleuse in die Schelde geschwommen.
Das handwerklich hervorragend Inszenierte passte von den Personenführungen und den Textverständlichkeiten. Die Kostüme überbrückten den Zeitbereich zwischen 933 und dem ersten Weltkrieg.
In ihrer Hilflosigkeit beamt sich Elsa den Retter Lohengrin als Traumfigur, Selbstsuggestions-Objekt herbei, der ihr begrenzt aus der Patsche helfen sollte, was in eine große Massensuggestion des ersten Aufzugs mündete.
Der zweite Aufzug konnte diesen interessanten Ansatz nicht aufrechterhalten und begnügte sich in Bildern, mit welchen Strategien Populisten arbeiten und wie Feminismus zu Auswüchsen führen können.
Mit viel Effekten, die derzeit die Opernbühne beherrschen, wurde gearbeitet. Da brachten Solisten und Chorsänger die Requisiten mit auf die Szene und es musste auch unbedingt auf der Bühne koitiert werden
Der dritte Aufzug löste das Problem der Agierenden nahezu konventionell. Lohengrin verabschiedete sich in die Schelde und der ausgesetzte „Erbe von Brabant“ tauchte als Geretteter aus den Fluten auf, so dass sich Elsas Bemühungen als gegenstandslos erwiesen.

Die großen, dankbaren Solopartien waren durchweg gut besetzt gewesen.
Die Elsa von Brabant, von der Regie komplett ins Zentrum des Geschehens gerückt, wurde von Jacqueline Wagner mit intensiver Bühnenpräsenz und kraftvollem Gesang dargeboten. Unter der schweren Anklage des Brudermordes stehend, erträumt sie sich mit einer enormen musikalisch-dramatischen Steigerung den auf mysteriöse Art eingeführten Retter.
Mit Eric Cutler war für den Lohengrin ein in jeder Tonlage sicherer Heldentenor gewonnen worden, der jedes Wort kraftvoll, perfekt und verständlich sang.
In Lohengrin materialisiert sich das Wunder, das von Elsas und König Heinrichs Vorstellungskraft herbeigezaubert werde.
Mit imposanten Spitzentönen wartete die Ortrud von Elena Pankratova auf, als sie in Elsas Defensivsituation ihre Chance erkannte. Dabei gelang es ihr, die Stimme mit der von Jaqueline Wagner auf das wundersamste in Einklang zu bringen, so dass Wut und verführerisch-vergifteter Gesang auch immer überzeugend blieben.
Martin Gantners Telramund bietet mit robustem Bariton gesanglich und darstellerisch, was in der Rolle des betrogenen Betrügers stecken kann.
Mit sonorem klaren Bass und viel Wohlklang beeindruckte Hans-Peter König als Heinrich der Vogler in der plumpen Uniform eines Weltkriegs-Kommandeurs. Prägnant und dominant gestaltete er seine Figur.
Stimmlich kraftvoll agierte Markus Brück als Heerrufer

Gewaltige Begeisterungen im Großen Festspielhaus folgten der Aufführung, wobei die reichen lang anhaltenden Missfallenskundgebungen für das Produktionsteam nicht zu überhören waren.
Stehende Ovationen erhielt Christian Thielemann für seine außergewöhnliche Interpretation der Wagner-Komposition.
Bilder von Ruth Waltz
Thomas Thielemann, 10.4.2022
Konzert der Wiener Philharmoniker unter Christian Thielemann mit Elina Garanča
3. August 2021
Wieder ein großes Salzburger Trio!
Nun gab es das zweite Konzert der Wiener Philharmoniker unter Christian Thielemann mit Elina Garanča bei den Salzburger Festspielen 2021, also von einem Trio, das schon im Vorjahr das Publikum begeisterte. Und so war es auch diesmal wieder.
Mit den Rückert-Liedern ging Gustav Mahler von der „Identität von Ton und Wort“ aus, um zu einer „organischen Verschmelzung“ von lyrischer Vorlage und Musik zu gelangen, wie Harald Hodeige im Programmheft darstellt. Dass er damit auch eine Sehnsucht nach Verinnerlichung verband, die ihn möglicherweise auch von einem Rückzug in eine Welt der Ruhe und des Friedens träumen ließ, angesichts seines bekanntlich nicht ganz ruhigen Berufes als Wiener Hofoperndirektor, das merkte man dem Gesang der lettischen Mezzosopranistin Elina Garanča schon in den beiden ersten Liedern, „Ich atmet‘ einen linden Duft“ und „Liebst Du um Schönheit“, auf jeder Note an. Ruhig ließ sie ihr klangvolles Material bei guter Diktion strömen, mit einer feinfühligen Orientierung durch Thielemann, der direkt seitlich vor ihr stand und jede noch so feine Nuance vorzugeben schien, natürlich auch dem Orchester. Im Lied „Um Mitternacht“ steigerte Garanča die Verzweiflung des in den Sternen Trost Suchenden mit einem sich langsam zum Forte aufbauenden klangvollen Crescendo bis zu dem Punkt, an dem er erkennt, dass der Mensch die Schlacht um die Leiden der Menschheit nicht gewinnen kann und ihr Schicksal in die Wacht des Herrn um Mitternacht abgeben muss. Mit dem folgenden „Blicke mir nicht in die Lieder!“ setzte Garanča einen starken Kontrast zum melancholischen „Mitternacht“ und ließ eine gewisse Koketterie in ihrer Aufforderung hören, wenn die Bienen die reichen Honigwaben zu Tag gefördert haben und sie die Hörer - sicher im übertragenen Sinne - bat: „Dann vor allem nasche Du!“

Nahezu völlige Entrückung bot aber Garančas Interpretation des letzten und wohl bekanntesten Liedes „Ich bin der Wert abhanden gekommen“. Thielemann ließ zuvor eine extra große Pause verstreichen, um die besondere Tragweite gerade dieses Liedes hervorzuheben. So war die Spannung im Großen Festspielhaus mit den Händen zu spüren. Mit wirklich authentisch erscheinender Verinnerlichung lotete die Sängerin mit der Tiefe ihres Mezzo den Verlustschmerz der Welt aus, in der sie sich gestorben glaubt. Das finale „Ich leb‘ allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied!“ fasste eigentlich alles zusammen, was sie sowie Thielemann mit den Wienern an diesem Abend zu Mahler sagen wollten. Es klang wie aus einer anderen Welt…

Einen bisweilen sehr starken Kontrast dazu bot natürlich die Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107 von Anton Bruckner nach der Pause. Es ist sicher keine Überraschung, wenn man hier festhält, dass Christian Thielemann sich auf diesen Komponisten besonders gut versteht. Wenn dann noch die Wiener Philharmoniker dazu kommen, ist eigentlich ganz Großes zu erwarten. Das wurde auch an diesem Abend wieder eingelöst, zur einhelligen Begeisterung des Festspielpublikums.

Schon im Kopfsatz ließ Thielemann seine Versatilität bei der komplexen Architektur des Allegro moderato spüren. Der Satz erhielt so innere Spannung, und das finale Klanggewitter unter Führung des schweren Blechs wirkte wie zwangsläufig aus dem Gewebe des zuvor Musizierten entstanden, ohne auch nur ansatzweise in plakative Lärmentwicklung zu geraten. Im folgenden Adagio: Sehr feierlich und sehr langsam hatte Bruckner, der während der Arbeit an der Siebten vom Tode Richard Wagners erfuhr, nach dem emphatischen C-Dur-Höhepunkt des Satzes als Wagner-Tombeau einen ergreifenden Bläsersatz mit den von Wagner selbst konzipierten Wagnertuben und den Hörnern hinzukomponiert, wie Harald Hodeige im Programmheft präzisiert. Später setzte er vier Takte dieser Trauermusik für Wagner noch für die Wagnertuben an den Beginn des Adagio. Wie Thielemann das dann dem Orchester entlockte, ließ natürlich auch seine große Verehrung des Bayreuther Meisters erkennen. Seine Einsätze für die Tuben wirkten nahezu wie ein Zelebrieren. Und ihr Klang war ganz einfach umwerfend und ließ einen natürlich für einen Moment in die Welt Wagners und seinen „Ring“ eintreten. Im Adagio kamen auch die großen Streicherlinien mit dem zentralen Thema zu eindrucksvoller Wirkung, ja es entstand ein klingender Streicherteppich. Im Scherzo zog Thielemann das Tempo an, ohne jedoch von der satzübergreifenden Harmonie seiner Interpretation der Siebten abzuweichen. Im kurzen Finale: Bewegt, doch nicht schnell ließ er noch einmal das ganzen Potential der großen Musik Bruckners durch die Wiener erklingen. Eine Interpretation seiner 7. Symphonie wie aus einem Guss!
Fotos: Salzburger Festspiele/Marco Borelli
Klaus Billand/3.9.2021
www.klaus-billand.com
Abschlusskonzert Young Singers Project (YSP)
28. August 2019
Unglaubliche jugendliche Qualität!
Die Salzburger Festspiele neigen sich unter Dauerregen ihrem Ende zu – das ist der Moment des Abschlusskonzerts des Young Singers Project, welches die Festspiele mit Jürgen Flimm und Michael Schade 2008 ins Leben gerufen haben. Diesmal waren es 12 Teilnehmer aus neun Nationen, und zum ersten Mal war ein Sänger aus Mexiko und eine Sängerin aus Japan dabei. Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler betonte mit dieser Internationalät des Projekts die Grenzenlosigkeit der Kunst und hier besonders der Musik, wo es eben nur auf Qualität ankommt und nicht auf Nationalität.

Sie hob auch wieder die große Förderrolle des Ehepaars Kühne hervor, das anwesend war und „nun auch zum Hauptsponsor der Festspiele geworden ist.“ Sie erwähnte schließlich die bedeutende Rolle von Evamaria Wieser, der Leiterin des YSP. Und, ganz wichtig, die diesjährige Ausgabe stand im Namen von KS Christa Ludwig (1928-2021), die selbst viele Jahre Meisterklassen im Rahmen des YSP gegeben hat und bei den Festspielen 169 Mal aufgetreten ist, in 126 Opernaufführungen, 21 Liederabenden, 21 Orchesterkonzerten und einer Matinee!

Im wieder ausverkauften Großen Saal der Stiftung Mozarteum spielte das Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Adrian Kelly wie jedes Jahr bei diesem Konzert. Das ist wohl schon eine Institution. Man begann mit der Ouvertüre zum „Schauspieldirektor“ KV 486 von W. A. Mozart. Und dann gab es wie schon im letzten Jahr ein Feuerwerk an jugendlicher Gesangskunst, die das Publikum aus dem Häuschen brachte. Freya Apffelstaedt aus Südafrika, Evgenia Asanova aus Russland (heuer Vertraute in „Elektra“), Tobias Hechler aus Deutschland, Alexander Köpeczi aus Rumänien (heuer Schließer in „Tosca“), Miriam Kutrowatz aus Österreich, Sebastian Mach aus Polen, Ángel Macías aus Mexiko, Liubov Medvedeva aus Russland, Ikumi Nakagawa aus Japan, Gabriel Rollinson, Deutsch-Amerikaner, Verity Wingate aus Großbritannien (heuer Schleppträgerin in „Elektra“) und Nikolai Zemlyanskikh aus Russland sangen in allen Stimmlagen inkl. Countertenor (Hechler). Die meisten von ihnen sind derzeit in Opernstudios engagiert, einige haben schon ihre Operndebuts hinter sich und beginnen in festen Opernensembles. Der jüngste war gerade einmal 24 Jahre!

Auf dem Programm standen zunächst Arien und Duette von Händel, Haydn, Vivaldi, Mozart und nach der Pause Opernarien und -duette von Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Puccini, Gounod und Korngold mit einer wirklich beeindruckenden sängerischen Qualität, hoher Musikalität und auch einnehmendem szenischem Ausdruck der jungen Talente. Alles ging ganz gelöst und souverän über die Bühne mit einem unübersehbaren Maß an Freude an der eigenen Leistung. Zum Schluss gab es ein formidables Tutti mit „Bevo a tuo fresco sorriso“ aus der Oper „La rondine“ von G. Puccini. Das Publikum wollte Sänger und Orchester kaum ziehen lassen…
Fotos: Klaus Billand
Klaus Billand/5.9.2021
www.klaus-billand.com
SALZBURGER FESTSPIELE 2020
Canto lirico mit Anna Netrebko et al.
25. August 2020
Einmal nicht so begeisternd…
Erst dreieinhalb Wochen zuvor hatte ich das Ehepaar Netrebko/Eyvazov bei den Stelle dell’Opera in der Arena di Verona erlebt (Rezension weiter unten), dort aber mit einem dezidiert italienischen/französichen Repertoire, zudem mit Arien, die man als frequenter Opernbesucher gut kennt. Unter der musikalischen Leitung des St. Petersburger Dirigenten Mikhail Tatarnikov gaben sie mit dem Mozarteumorchester Salzburg im Großen Festspielhaus diesmal einen reinen Tschaikowski-Abend, der eigentlich kein solcher wurde, da das Konzert bereits nach knapp eineinhalb Stunden ohne Pause und Zugabe endete.
 Nun, Anna Netrebko brillierte in einem attraktiven und ausdrucksstarken hell-türkisfarbenen Kleid als Tatjana in der Brief-Arie aus der Oper „Eugen Onegin“. Fast mädchenhaft, bisweilen sublim und verzweifelt lässt sie die Stimmung der enttäuschten Tatjana mit ihrem so herrlich charaktervollen, dunkel timbrierten und makellosen Sopran erhören. Mitnehmend die wiederholten absteigenden Linien gegen Ende der Arie, in denen sie auch dramatisch ihre ganze Klangschönheit und Emotion entfaltet. Netrebko lebt immer die Rolle, die sie gerade singt, auch mimisch und mit ihrer ganzen Körpersprache. Ebenso emotional und bewegend singt sie Lisa im Duett mit ihrem Mann aus dem 1. Akt der Oper „Pique Dame“ op. 68 „Ostanowites, umoljaju was“ (Bleiben Sie stehen, ich flehe Sie an!). Hier vermag sie durch die Klarheit ihres Vortrags, eine perfekte Diktion und klangvolle Spitzentöne zu bestechen. In diesem Duett wirkt auch die ungarische Mezzosopranistin Szilvia Vörös aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper mit, deren klangvoller und ausdrucksstarker Mezzo einen schönen vokalen Kontrapunkt setzt. Man hätte ihr ohne weiteres auch eine Einzelnummer gönnen können. Auch bei den Stelle in Verona sangen neben dem Ehepaar weitere Sänger in Solonummern. Zum Schluss gibt Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov noch das Duett Iolanta und Vaudémont „Twojo moltschanje neponjatno“ (Ich verstehe dein Schweigen nicht) aus der Oper „Iolanta“ op. 69, ein Duett, das wohl nicht jeder Festspielbesucher kennt. Insofern wären die Texte der Stücke in den kleinen Programmheften hilfreich gewesen. Aber sie waren eh fast immer kurz vor Aufführungsbeginn vergriffen, da kostenlos...
Nun, Anna Netrebko brillierte in einem attraktiven und ausdrucksstarken hell-türkisfarbenen Kleid als Tatjana in der Brief-Arie aus der Oper „Eugen Onegin“. Fast mädchenhaft, bisweilen sublim und verzweifelt lässt sie die Stimmung der enttäuschten Tatjana mit ihrem so herrlich charaktervollen, dunkel timbrierten und makellosen Sopran erhören. Mitnehmend die wiederholten absteigenden Linien gegen Ende der Arie, in denen sie auch dramatisch ihre ganze Klangschönheit und Emotion entfaltet. Netrebko lebt immer die Rolle, die sie gerade singt, auch mimisch und mit ihrer ganzen Körpersprache. Ebenso emotional und bewegend singt sie Lisa im Duett mit ihrem Mann aus dem 1. Akt der Oper „Pique Dame“ op. 68 „Ostanowites, umoljaju was“ (Bleiben Sie stehen, ich flehe Sie an!). Hier vermag sie durch die Klarheit ihres Vortrags, eine perfekte Diktion und klangvolle Spitzentöne zu bestechen. In diesem Duett wirkt auch die ungarische Mezzosopranistin Szilvia Vörös aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper mit, deren klangvoller und ausdrucksstarker Mezzo einen schönen vokalen Kontrapunkt setzt. Man hätte ihr ohne weiteres auch eine Einzelnummer gönnen können. Auch bei den Stelle in Verona sangen neben dem Ehepaar weitere Sänger in Solonummern. Zum Schluss gibt Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov noch das Duett Iolanta und Vaudémont „Twojo moltschanje neponjatno“ (Ich verstehe dein Schweigen nicht) aus der Oper „Iolanta“ op. 69, ein Duett, das wohl nicht jeder Festspielbesucher kennt. Insofern wären die Texte der Stücke in den kleinen Programmheften hilfreich gewesen. Aber sie waren eh fast immer kurz vor Aufführungsbeginn vergriffen, da kostenlos...
 Gleich nachdem Yusif Eyvazov als Hermann zu Anna Netrebko zu ihrem Duett aus „Pique Dame“ hereingestürzt ist, wird klar, dass ihm das russische Repertoire nicht so gut liegt wie das italienisch/französische. Da ist zunächst mal wenig Tenorales zu hören. Die Stimme berührt nicht, hat keinen tenoralen Klang und schon gar keinen Schmelz. Man sollte allerdings auch festhalten, dass der Hermann normalerweise von einem Heldentenor gesungen wird. Man denke nur an Vladimir Altantov und andere. Die Stimme blüht zu keinem Zeitpunkt auf, und so ist es auch mit seinem „Kuda, kuda wy udalilis“ (Wohin, wohin seid ihr entschwunden) aus der Oper „Eugen Onegin“ op. 24. Zwar ist gute Technik zu vernehmen, die Noten werden durchwegs gesungen, aber das Timbre seiner Stimme ist einfach allzu gewöhnungsbedürftig, wenn man an andere Tenöre mit dieser Arie denkt. Die Höhen werden zudem unüberhörbar guttural. Darstellerisch macht er seine Sache sehr emotional und damit gut.
Gleich nachdem Yusif Eyvazov als Hermann zu Anna Netrebko zu ihrem Duett aus „Pique Dame“ hereingestürzt ist, wird klar, dass ihm das russische Repertoire nicht so gut liegt wie das italienisch/französische. Da ist zunächst mal wenig Tenorales zu hören. Die Stimme berührt nicht, hat keinen tenoralen Klang und schon gar keinen Schmelz. Man sollte allerdings auch festhalten, dass der Hermann normalerweise von einem Heldentenor gesungen wird. Man denke nur an Vladimir Altantov und andere. Die Stimme blüht zu keinem Zeitpunkt auf, und so ist es auch mit seinem „Kuda, kuda wy udalilis“ (Wohin, wohin seid ihr entschwunden) aus der Oper „Eugen Onegin“ op. 24. Zwar ist gute Technik zu vernehmen, die Noten werden durchwegs gesungen, aber das Timbre seiner Stimme ist einfach allzu gewöhnungsbedürftig, wenn man an andere Tenöre mit dieser Arie denkt. Die Höhen werden zudem unüberhörbar guttural. Darstellerisch macht er seine Sache sehr emotional und damit gut.
 Maestro Tatarnikov versuchte bei ansprechender Begleitung der Vokalnummern insbesondere mit drei Orchsterstücken musikalischen Akzente zu setzen, mit der Introduktion aus „Pique Dame“, dem „Rosen-Adagio“ aus dem 1. Akt des Balletts „Dornröschen“ op. 66 und der Polonaise aus dem 3. Akt von „Eugen Onegin“. Konnte in der Introduktion zu „Pique Dame“ noch das prägnant exzessive Hervorbrechen des Hauptthemas im Blech beeindrucken und auch sonst eine gefühlvolle Interpretation dieses tiefgründigen Musikstücks, so geriet das „Rosen-Adagio“ nach den anfänglichen Harfenarpeggien um einiges zu laut und verwaschen. Am Schluss gelang es dem Pauker fast, die gesamten Streicher zuzudecken… Auch die abschließende Polonaise hätte mehr Differenzierung und weniger Lautstärke gut vertragen. Immerhin stellten sich sofort erfreuliche Assoziationen zum Wiener Opernball ein…
Maestro Tatarnikov versuchte bei ansprechender Begleitung der Vokalnummern insbesondere mit drei Orchsterstücken musikalischen Akzente zu setzen, mit der Introduktion aus „Pique Dame“, dem „Rosen-Adagio“ aus dem 1. Akt des Balletts „Dornröschen“ op. 66 und der Polonaise aus dem 3. Akt von „Eugen Onegin“. Konnte in der Introduktion zu „Pique Dame“ noch das prägnant exzessive Hervorbrechen des Hauptthemas im Blech beeindrucken und auch sonst eine gefühlvolle Interpretation dieses tiefgründigen Musikstücks, so geriet das „Rosen-Adagio“ nach den anfänglichen Harfenarpeggien um einiges zu laut und verwaschen. Am Schluss gelang es dem Pauker fast, die gesamten Streicher zuzudecken… Auch die abschließende Polonaise hätte mehr Differenzierung und weniger Lautstärke gut vertragen. Immerhin stellten sich sofort erfreuliche Assoziationen zum Wiener Opernball ein…

Insgesamt gesehen sprang in diesem Konzert bei aller bespielloser Qualität von Anna Netrebko der Funke auf das Publikum letztlich nicht über. So war auch niemand überrascht, dass es keine Zugabe gab, die man sich normalerweise erwarten würde. Insofern ist vielleicht auch der Kommentar Netrebkos in einem Interview zu verstehen, dass das Salzburger Festspielpublikum in diesem Corona-Jahr nicht so engagiert sei wie sonst. Das dem ganz und gar nicht so ist, hätte sie bei den weiteren Ausgaben des „Canto Lirico“ mit Juan Diego Flórez einerseits und Cecilia Bartoli mit den Musiciens du Prince-Monaco anderseits erleben können. Da waren die Zugaben fast halb so lang wie das Konzert selbst, und das Publikum war mit Herz und Seele dabei, wollte gar nicht gehen…!
Fotos: SF / Marco Borrelli
Klaus Billand/11.9.2020
www.klaus-billand.com
Wiener Philharmoniker mit Wagner und Bruckner
am 22. August 2020
Eine symphonische Sternstunde!
Christian Thielemann mit den Wiener Philharmonikern, eine singuläre Beziehung, die den Salzburger Festspielen 2020 in Corona-Zeiten einen ganzvollen Höhepunkt bescherte. Und natürlich muss es Wagner geben, wenn Thielemann ans Pult der Wiener tritt, wenn auch einen eher verhaltenen, nachdenklichen - passend zur gegenwärtigen Lage der Kultur - aber natürlich auch Anton Bruckner mit der 4. Symphonie, der „Romantischen“.

Die Mezzosopranistin Elina Garanca gab mit den Wesendonck-Liedern von Richard Wagner ihren alljährlichen Salzburg-Auftritt und vermochte mit der überaus einfühlsamen Unterstützung von Thielemann den fünf Liedern, die der Komponist 1857/58 schon im Hinblick auf seine Werke „Tristan und Isolde“ für seine Muse und heimliche Geliebte Mathilde Wesendonck zu deren Gedichten komponierte, einige Emotion und stimmliche Leuchtkraft zu verleihen. Ursprünglich für Klavierbegleitung komponiert, orchestrierte der Bruckner-Schüler und Bewunderer Wagners, Felix Mottl, die Lieder später und erhöhte damit die musikalische Assoziation zu dessen Musikdramen, vor allem zu seinem opus summum, „Tristan und Isolde“.

„Der Engel“ gerät mit herrlich lyrischer Transparenz und großer Klarheit, wobei Garanca Akzente durch lange vokale Bögen setzt. In „Stehe still!“ erzielt Thielemann mit dem Orchester einen fast traumwandlerischen Gleichklang mit dem Erzählton der Mezzosopranistin. Mühelos erhebt sich ihre Stimme über das Tutti des Orchesters und mündet in einen hymnischen Schlusston. „Im Treibhaus“, in der Tat eine Studie zu „Tristan und Isolde“, ist „Tristan“-Lyrik vom Feinsten zu hören. Hervorzuheben ist hier, dass Christian Thielemann, der ja stets auch mit starker Körperlichkeit dirigiert, sich Garanca auch physisch so eng zuneigt, dass eine intensive Vereinigung von Gesang und Musik zu entstehen scheint. Sie kann das Melancholische und die Trübsal, die hier die nicht realisierbare Nähe Wagners zu Mathilde andeuten, stimmlich eindrucksvoll wiedergeben, wenn auch die Textverständlichkeit Garancas, und nicht nur in diesem Lied, nicht immer die beste ist. Wunderbar das kurze Viola-Solo und die aufsteigende Linie der Streicher im Finale! In „Schmerzen“ lässt Thielemann die ganze Kraft des Orchesters aufblühen. Überwältigend dabei die prägnanten Blechbläserfanfaren. Im finalen „Träume“, der zweiten Studie zu „Tristan und Isolde“, fühlt man sich unmittelbar in den 2. Aufzug des Musikdramas versetzt, auf dessen romantische Interpretation sich Thielmann ja besonders gut versteht. Er macht hier gemeinsam mit Elina Garanca musikalisch nachvollziehbar klar, wie intensiv die Neigung Wagners zur für ihn unerreichbaren Mathilde Wesendonck war. Die Beziehung führte bekanntlich schließlich zum Bruch mit seinem Mäzenaten, ihrem Mann Otto Wesendonck.

Dann folgte mit der 4. Symphonie von Anton Bruckner das Werk eines von Christan Thielemanns Lieblingskomponisten, und er kann mit den Wiener Philharmonikern einmal mehr beweisen, das er wohl der beste Bruckner-Dirigent unserer Tage ist. Diese „Romantische“ wurde zu einer Sternstunde der Wiener Philharmoniker unter seiner erfahrenen Führung und vermochte mit der Klarheit, Prägnanz und Transparenz, die auch immer wieder Solo-Passagen ebenso klang- wie eindrucksvollen Raum gaben, das Publikum zu begeistern. Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Dirigent nach so einem Konzert in Salzburg noch mehrmals, nachdem bereits alle Musiker verschwunden sind, zu einem Einzelapplaus „herausgeklatscht“ wird.

Mit zehn Celli, acht Kontrabässen, fünf Hörnern, vier Trompeten und drei Posaunen war das Orchester im Blech angetreten. Die in einer Reihe am oberen Ende aufgebaute Blechbläser-Phalanx wirkte wahrlich beeindruckend und sollte das musikalische Geschehen in der kommenden Stunde immer wieder eindrucksvoll beherrschen. Im 1. Satz geben nach dem zurückhaltenden und verklärten Beginn durch die Streicher gleich die Hörner mit geballter Kraft den Ton an. Das Andante des 2. Satzes beginnt mit großer Lyrik und setzt sich in einem langsamen, getragenen, ja trauermarschartigen Rhythmus fort. Hier lässt Thielmann sehr schön einige Einzelinstrumente zu „Wort“ kommen und ist mit den entsprechenden Musikern stets in intensivem Augenkontakt. Großartig sodann das sich langsam aufbauende Crescendo zu einem fast eruptiven musikalischen Höhepunkt, einmal mehr mit der unbestrittenen Dominanz der Blechbläserreihe. Im Scherzo geben dann immer wieder die Hörner mit klar artikulierten Klangkaskaden den Ton an. Aber auch die anderen Bläsergruppen beteiligen sich an Motiven, die auf eine Jagd hinweisen. Bestechend ist dabei die Transparenz der einzelnen Instrumentengruppen, die Thielemann offenbar ein erstes Anliegen ist. Im Finale mit seiner großen Dramatik sind zunächst auch romantischen Streicherlinien zu hören, bevor es dann wieder explosionsartig ins Tutti geht, mit mächtigem Auftritt der Posaunen, unterstützt von der zentral platzierten Tuba. Thielemann fordert den maximalen Einsatz dieser Musiker mit entsprechenden Körperbewegungen regelrecht heraus.

Und dann eben der Riesen- und kaum enden wollende Applaus! Ich hoffe, die Osterfestspiele Salzburg sind sich klar (geworden), was sie mit der unerwarteten und in ihrer Art zumindest bemerkenswerten Beendigung der Zusammenarbeit mit Christian Thielemann bewirkt haben. Es ist kaum zu glauben, zumal wenn man die ersten Ideen zu einer Neugestaltung der Osterfestspiele hört, dass etwas musikalisch Hochkarätigeres nachkommt.
Klaus Billand/11.9.2020
www.klaus-billand.com
Fotos: SF / Marco Borrelli
CANTO LIRICO mit JUAN DIEGO FLÓREZ
Juan Diego als Publikumsliebling!
28.08.2020
Ja, das ist der peruanische Ausnahme-Tenor des Belcanto ganz sicher, und das Große Festspielhaus stand praktisch Kopf, als er mit dem langen Reigen seiner Zugaben begann, die dem eigentlichen Konzert noch einmal eine halbe Stunde anschlossen. Es ging gleich los mit der Gitarre, auf der Flórez zunächst einen Tango von Carlos Gardel und dann auch Mariachis und anderes erklingen ließ, bis er über die halsbrecherische Arie des Tonio mit ihren neun hohen Cs aus „La fille du régiment“, die er makellos ansetzte und zum Klingen brachte, sogar noch mit dem „Nessun dorma“ (obwohl der Calaf gar nicht sein Fach ist) einen absoluten Hit mit äußerst lang gehaltenem H als wirklich endgültigen und glanzvollen Schlusspunkt seines Abends setzte – das Publikum war aus dem Häuschen!

Im Konzert selbst bewegte sich Flórez auf „ungewöhnlichen Pfaden durch das 19. Jahrhundert“, wie Gavin Plumley im Programmzettel schreibt, aber auf durchaus attraktiven und musikalisch wie sängerisch auch anspruchsvollen. Es geht los mit den Beethoven-Liedern „Adelaide“, „Der Kuss“ und „Sad and luckless was the season“ aus 20 „Irische Lieder“, die er akzentuiert und mit guter Diktion vorträgt. Dann folgen „Zueignung“, sehr engagiert, „Heimliche Aufforderung“ und „Cäcilie“ von Richard Strauss, die er mit einiger Emphase und seinem schlanken wohlklingenden Tenor ausdrucksstark interpretiert. Vincenzo Bellini, d e r Belcanto-Papst, folgt mit der Arietta „Ma rendi pur contento“ aus „Sei ariette da camera“ sowie der Cavatina und Cabaletta des Pollione „Me protegge, me difende“ aus „Norma“, wo Flórez schon langsam zur bekannten Opernform aufläuft. Von Giuseppe Verdi folgt eine beherzte Interpretation der Cavatina und Cabaletta des Jacopo „Odio solo“ aus „I due Foscari“. Von Édouard Lalo singt er sodann die Arie des Mylio „Vainement, ma bien-aimée“ aus der selten gespielten Oper „Le Roi D’Ys“.
Vincenzo Scalera, der Flórez am Flügel begleitet, kann die große Qualität seiner Kunst ebenfalls eindrucksvoll unter Beweis stellen und bekommt den entsprechenden Applaus vom aufmerksamen Publikum. Zunächst spielt er das Venezianische Gondellied fis-Moll für Klavier solo aus „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, bei dem man sich die sanft im Canale Grande dümpelnden Gondeln musikalisch vorstellen kann. Es folgen die Arietta „Almen se non poss’io“ aus „Sei ariette da camera“ von Vincenzo Bellini in einer Bearbeitung für Klavier solo von Carl Czerny und die Romanza senza parole F-Dur für Klavier solo – „Il cielo d’Italia“ von Giuseppe Verdi, bevor er mit der innig gespielten Méditation aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet in der Bearbeitung für Klavier solo glänzt.

Und dann ging es doch noch in das klassischere Repertoire der Opernarien. Zuerst singt Flórez die Arie des Chevalier Des Grieux „Ah, fuyez, douce image“ aus „Manon“ von Jules Massenet mit viel stimmlicher Couleur und Ausdruck und danach – als vorläufigen Abschluss des Konzerts – die Arie des Rodolfo „Che gelida manina“ aus „La bohème“ von Giacomo Puccini. Ein geschickt gewählter Schlusspunkt, denn mit seiner Art und Weise, sich emotional ganz in die Rolle des mittellosen Dichters hineinzuversetzen, erzielte er natürlich beim Publikum die Begeisterung und den Wunsch, den dann beginnenden Zugabe-Reigen mit seiner Gitarre zu starten. Da kam dann der Tango „El día que me quieras“ und „Cielito Lindo“, schließlich auch noch „Ay ay ay ay“, wobei er das Publikum zum Mitsingen animiert, ebenso für die Choreinlage bei „Nessun dorma“… Ein in der Tat noch lange nachklingender Auftritt von Juan Diego Flórez bei den Salzburger Festspielen 2020!
Klaus Billand, 3.9.2020
www.klaus-billand.com
Copyright: Marco Borrelli/ Salzburger Festspiele
Wiener Philharmoniker mit Bernard Haitink
am 30. August 2019
Ein ganz Großer tritt ab!
Gestern Abend hielt die Salzburger Festspielwelt für einen langen Moment den Atem an. Der niederländische Maestro Bernard Haitink, mittlerweile 90 Jahre alt, tritt endgültig von der Salzburger Bühne ab mit einem Konzertabend mit den Wiener Philharmonikern, die ihn soeben zu ihrem Ehrendirigenten ernannt haben. Schon das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 von Ludwig van Beethoven mit Emmanuel Ax am Flügel, der für den erkrankten Murray Perahia eingesprungen war, ließ eine ganz bestimmte auratische Stimmung im Saal entstehen, der sich offenbar der Bedeutung des Abends bewusst war. Mit einer nahezu göttlichen Ruhe erklang dieser Beethoven mit einer exzellenten Harmonie zwischen dem Dirigenten und dem großartigen Pianisten Ax, wobei Haitink ihn gar nicht im Blick hatte. Eine Zusammenarbeit wie im Traum…

Nach der Pause dann die mit großer Spannung erwartete Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107 von Anton Bruckner! Ein Riesenorchster saß auf der Bühne mit 50 Streichern, darunter 10 Celli, 8 Kontrabässe und einem enormen Blechbläsersatz mit 5 Hörnern und 4 Wagner-Tuben etc., insgesamt zählte ich 88 Musiker, darunter aber nur 5 Frauen. Mit moderaten Schlägen konnte Haitink das Orchester zu einer Spitzenleistung motivieren. Bruckners Siebte erklang mit all ihren Facetten, die man sich wünschen kann, von sublimen Zwischentönen, kaum hörbaren Piani bis zu den gewaltigen Crescendo und Ausbrüchen im Tutti, die für den österreichischen Komponisten so charakteristisch sind. Es wurde ein Manifest für Bernard Haitinks letzten Auftritt in Salzburg! Er wird nur noch wenige Konzerte an anderer Stelle leiten und sich dann ganz zurückziehen. Wir wünschen ihm das Allerbeste und vor allen noch lange gute Gesundheit!
Fotos (c) Salzburger Festspiele / Neumayr /Leo
Klaus Billand, 2.9.2019
SALOME
WA am 25. August 2019
Neue Horizonte bei „Salome“…
Festspielintendant Markus Hinterhäuser hatte die blendende Idee, Richard Strauss‘ „Salome“ des meiner Ansicht nach großartigen Regisseurs Romeo Castellucci, der mir schon mit seinem „Parsifal“ 2011 in Brüssel am Munt positiv aufgefallen war, nach ihrer Premiere 2018 noch einmal mit drei Vorstellungen anzusetzen. Als einzige Oper hatte er sie damit aus dem Vorjahr übernommen. Das war nicht nur berechtigt, sondern zahlte sich auch aus, wenn man es am Publikumszuspruch an diesem Premieren-Abend bemessen möchte sowie an der Tatsache, dass alle drei Aufführungen wieder ausverkauft waren. Ungewöhnlich viel politische Prominenz hatte sich eingefunden, darunter Ursula von der Leyen, der ehem. deutsche Bundespräsident Horst Köhler, Ursula Plassnik und Wolfgang Schüssel, was mich angesichts genau dieser Oper und der ganz speziellen Art und Weise, wie Castellucci sie deutet - denn das war ja bekannt - etwas wunderte, zumal auch noch ohne Pause...

Als absoluter Star des Abends in der Felsenreitschule strahlte wieder einmal die litauische Sopranistin Asmik Grigorian mit einer schier unermüdlichen und unverwüstlichen Stimme, die selbst noch in den letzten Momenten wie von Katapulten abgeschossen auf das Publikum niederging - mit all ihren Facetten von mädchenhafter Naivität, Ignoranz, Abenteurertum, Boshaftigkeit, Rachegefühlen und finalem Untergang - im wirklich letzten Bild, als ihr die ganze Dimension ihrer Handlungen klar zu werden schien - da weinte sie sogar! Also auch darstellerisch eine Leistung der Sonderklasse! Der Ungar Gábor Betz singt eindringlich mit exzellenter Phrasierung sowie Diktion und spielt vor allem auch wieder den Jochanaan mit seinen düsteren und maskulinen Apercus, wie schon zu Beginn an der Wand hängendem Pferdegeschirr, später einem dunklen Hengst. Ein solcher ist sicher als Metapher männlicher Potenz aufzufassen, zumindest in dieser Inszenierung, und wie Salome darauf reagiert...

John Daszak gibt wieder diesen eigenartigen, leicht verrückten und, bis es zur grausamen Realität kommt, stets von zwei Statisten geführten Herodes, der offensichtlich nicht Herr seines (Viertel-)Reiches ist und permanent Führung benötigt - eben ein Schwächling, für den Herodias ihn ohnehin hält. Das macht Anna Maria Chiuri auch vokal eindrucksvoll deutlich, die mit ausdrucksstarkem Mezzo bei jeder Gelegenheit hören und sehen lässt, was sie von ihrem zweiten Ehemann, dem Bruder ihres ersten, hält. Julian Prégardien sang einen wohlklingenden Narraboth mit hellem Tenor, immer unter Obhut des guten und besorgten Pagen von Christina Bock, bis es nicht mehr geht und er in sein Schicksal läuft… Man lässt ihn lange achtlos liegen. Die Befehle dieses Herodes‘ wie „Fort mit ihm!“ haben offenbar schon lange keine Wirkung mehr…
In den Nebenrollen sind durchwegs gute gesangliche Leistungen bei von der Regie ganz bewusst reduzierter schauspielerischer Aktivität zu konstatieren. Tilman Rönnebeck ist ein klangvoller Erster Nazarener, sein Kollege Pawel Trojak steht ihm als Zweiter kaum nach, singt aber auch fast nichts.

Sowohl Peter Kellner als auch Dashon Burton lassen gute Stimmen für den Ersten und Zweiten Soldaten hören. Burton gewann beim 61. Internationalen Musikwettbewerb der ARD München 2012 übrigens den 2. Preis. Matthäus Schmidlechner, Mathias Frey, Kristofer Lundin, Joshua Whitener und David Steffens streiten sich als Juden wirr und vokal ansprechend über ihre Religion. Thomas Bennett singt die wenigen Zeilen des Kappadoziers als Teilnehmer des YSP (Bericht in diesem Heft).
Die Inszenierung Castelluccis, der ja auch für Bühne, Kostüme und Licht verantwortlich zeichnet, mit einer ebenso ungewohnten wie interessanten Choreografie von Cindy van Acker und dramaturgischer Unterstützung von Piersandra Di Matteo, besticht einmal mehr durch ihre ungeheure Bildersprache und die Art und Weise, wie sich die Figuren auf der Riesenbühne der Felsenreitschule bewegen, die wie der Thron und andere Herrscher-Apercus ganz in Gold gefasst ist, um die allerdings nur vordergründige und oberflächliche Macht des Herodischen Viertel-Reiches mit dem kostbarsten und begehrtesten Metall zu versinnbildlichen. Man denkt unwillkürlich an den Trump-Tower… Die so charakteristischen Galerien der Felsenreitschule sind zudem total verschlossen, sodass sich eine einzige riesige Steinfläche ergibt, die den Akteuren die Luft abzuschneiden scheint und aus dem es kein Entrinnen gibt, es sei denn der Tod - ganz dem Drama entsprechend. „TE SAXA LOQUUNTUR“ schreibt Castellucci auf den Bühnenvorhang, was so viel heißt wie „Von dir sprechen die Steine.“ Diese Inschrift wurde vom Salzburger Neutor übernommen.

Dass Blut fließen wird, zeigen schon von Beginn an die Gesichter der Akteure - bis auf jenes von Herodias, das grün ist - denn sie sind zur unteren Hälfte blutrot bemalt. Auch bei Salome ist Blut zu sehen, als roter Fleck auf der Hinterseite ihres weißen Prinzessinnengewandes. Genau dort also, wo eine unbemerkte - weil noch unbekannte - Menstruation sich optisch ihren Weg bahnt. Das ist sicher ein Ergebnis ihrer just zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens mit Jochanaan - und wohl genau deswegen - beginnenden Sexualität… Denn das Erlebnis des finsteren, schwarz angemalten Propheten mit schwarzem Bärenfell aus einem furchteinflößenden dunklen Loch im Goldboden des Tempelgartens und seiner archetypischen Bewegungen, von zwei Statisten hinter ihm sonderbar entfremdet, müssen einen unglaublichen Eindruck auf das Mädchen machen, als das Asmik Grigorian hier erscheint. Bedrohlich auch der dunkle kreisrunde Schatten, der mit seinem Ausstieg aus der Zisterne auf der Felswand erscheint und immer größer und bedrohlicher wird - bis die ganze Wand verdunkelt ist - wie bei einer Sonnenfinsternis. Noch nie habe ich den Ausstieg des Jochanaan aus der Zisterne so intensiv, spannend und bedrohlich erlebt. Ein Meisterstück der Regie!!
Immer wieder verstört Castellucci durch scheinbar überflüssige Nebenpersonen bzw. Nebenschauplätze, die offenbar zu seinem Duktus gehören, das wirklich Wesentliche noch stärker hervorzuheben bzw. die absolute Sinnleere solchen Handelns am hedonistischen Hof des Herodes aufzuzeigen - ganz auf Linie mit dem irren Verhalten des Tetrarchen.

So wird bereits der Boden gereinigt, obwohl noch gar kein Blut darauf geflossen ist, zumal die sicher gewaltsam ins Jenseits Beförderten sorgsam verpackt in Plastiksäcken entsorgt werden. Oder eine Gruppe von Vermessern der Felsenreitschule, also des Tempelgartens, tritt ein und macht ihre Sache kaum halb, wobei man ohnehin nicht weiß, warum. Zwei Boxer stellen sich auf, kämpfen aber gar nicht und gehen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Musiker einer kleinen Kapelle rühren keinen Finger (Gott sei Dank!) und verschwinden wieder, zusammen mit den nicht genutzten Stehlampen, die aus dem Film „Arsen und Spitzenhäubchen“ aus dem Jahre 1944 stammen könnten…
In anderen Momenten wiederum sehen wir Szenen, in denen außer den Protagonisten niemand auf der Bühne ist. So erleben wir Salomes Tanz, der gar keiner ist, weil er m.E. schon viel früher stattgefunden hat, ohne jede Person auf der Bühne. Die Prinzessin ist in einem embryonalen Zustand der Nacktheit auf dem goldenen Thron wie ein Geschenk für den ohnehin wohl impotenten Herodes auf einem Quader mit der Inschrift „SAXA“ (Felsen) drapiert. Kaum schaut er während der wunderbaren Tanzmusik hin, die man so einmal in ihrer vollen Pracht und einzigartigen Facettenreichtum erleben kann, ohne von Schleierwürfen abgelenkt zu werden. Gegen Ende dieser Musik kommt vom Schnürboden ein quadratischer Stein herunter, in dem Salome schließlich verschwindet - sie wird (für Herodes) zu Stein.

Bei immerhin schon einigen erlebten „Salome“-Inszenierungen erschien mir noch nie so schlüssig und nachhaltig klar, wie sehr ihre Abweisung durch Jochanaan das grausame Ende der Oper bestimmt. Das geht hier wie ein Pfeil durch das Geschehen, auch wenn Salome gar nicht agiert, sondern in einer Ecke kauert - und das ganz unabhängig von all den Nebenpersonen und -schauplätzen. Castellucci hat dies auf der sexuellen Ebene meines Erachtens noch damit akzentuiert, dass er Salome zur ja recht langen Abgangs-Musik des Propheten in die Zisterne einen völlig beinfreien erotischen „Tanz“ im Liegen vollführen lässt. Dieser endet ganz offensichtlich mit einem Orgasmus, aus dessen Erschöpfung sie erst erwacht, als Herodes mit seiner Entourage samt Hoffotograf polternd auf die Bühne kommt. DAS war für mich Salomes Tanz! Ein Tanz für Jochanaan! Zuvor hat sie sich den Pferdesattel übergezogen, der ihr von einem der Helfer des Jochanan entgegen geworfen wurde und unter dem sie nun relativ eindeutige Bewegungen vollführt - auch das wohl eine Form ihres sexuellen Angebots an Jochanaan. Denn vorher sind sie sich einen kurzen Moment ganz nahe gekommen, in dem er sie sogar leicht umarmte, um sie dann sofort wieder von sich zu stoßen - eine nachdenkenswerte und völlig offene Szene, mit der uns der Regisseur in gewisse Zweifel bringt.
Über diese „Salome“ lässt sich unendlich lange und interessant diskutieren. Ist es nicht genau das, was das Musiktheater leisten kann und soll, wenn es nur GUT gemacht ist?! Und was es wiederum interessant macht? Ich warte auf den „Ring des Nibelungen“ von Romeo Castellucci, eigentlich schon seit 2011…
Franz Welser-Möst zeigte am Pult der Wiener Philharmoniker seine und deren ganze Kompetenz beim Entziffern der genialen Partitur von Richard Strauss. Er verstand insbesondere die ruhigeren Phasen und kontemplativen Momente fein ausmusizieren zu lassen und konnte dann bei den dramatischen Szenen noch stärker auftrumpfen. Nie aber wurde es pathetisch oder gar zu laut - oft klang es geradezu kammermusikalisch. Das genau liegt ja auch in der Musik der „Salome“, die mitten im Verismo eine ganz neue Stilrichtung vorgab. Musikalisch war es also ebenfalls ein großer Abend! Wenn er auch nur eine Stunde und fünfzig Minuten dauerte, so kam er mir aufgrund seiner Spannung und Detailliertheit wie vier Stunden vor… Musiktheater at its best!
Klaus Billand / 2.9.2019
Bilder (c) Ruth Waltz
Abschlusskonzert Young Singers Project
am 24. August 2019
„So schön war’s noch nie!“
Das war der Ausruf der Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler nach „Tutto nel mondo è burla“ aus dem „Falstaff“ von Giuseppe Verdi, von den 13 Teilnehmern des YSP im restlos ausverkauften Großen Saal der Stiftung Mozarteum zum Abschluss eines wirklich begeisternden Gesangskonzerts mit dem Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung vom Adrian Kelly. Und sie hatte Recht damit. So gut habe auch ich diese talentierten und offenbar für die Lust am Singen und Darstellen nur so brennenden (und das ist nach Krassimira Stoyanova eine Bedingung für Erfolg im Sängerberuf) jungen Sängerinnen und Sänger aus diesmal 11 Ländern bisher beim Salzburger YSP nicht gehört. Die weltweiten castings waren offenbar äußerst erfolgreich. Man merkte allen an, dass diese Wochen in Salzburg für sie etwas ganz Großes waren, für manche ja auch mit einer Beteiligung in kleinen Rollen bei den Festspielen verbunden.

Alljährlich findet im Rahmen der Salzburger Festspiele das sog. Young Singers Project (YSP) statt. Sein Ziel ist es, jungen Talenten neben einer musikalischen sowie repertoiremäßigen Weiterbildung und szenischem Unterricht auch die Möglichkeit zu geben, Proben zu besuchen und mit den Künstlern der Salzburger Festspiele zu arbeiten, auch in Opernproduktionen in Nebenrollen. Zudem konnten sie an Meisterklassen von KS Christa Ludwig, Anne Sofie von Otter und Helmut Deutsch teilnehmen, sowie technisch, körperlich und darstellungsbildend mit Michelle Wegwart, Catharina Lühr und Martina Gredler arbeiten. Darüber hinaus besuchten sie zahlreiche Proben, begegneten renommierten Festspielkünstlern und sammelten somit viele wertvolle Erfahrungen. Eine besondere Stimme, Bühneninstinkt, solide technische Kenntnisse und Leidenschaft sind für die Teilnahme am YSP Voraussetzung. Auch 2019 gab es wieder eine Eigenproduktion, und zwar zum ersten Mal in der Geschichte des YSP eine Uraufführung: „Der Gesang der Zauberinsel oder: wie der rasende Roland wieder zu Verstand kam“. Libretto und Musik stammen von Marius Felix Lange, Dirigent war Ben Glassberg, und für Regie und Ausstattung waren Andreas Weirich und Katja Rotrekl verantwortlich. Lange hatte die Partien in Kenntnis der Stimmen der sieben mitwirkenden Sänger des YSP genau auf sie abgestellt…
 Dieses Jahr wie schon zuvor hatte der britische Dirigent Adrian Kelly die musikalische Leitung des YSP inne. In der Saison 2019/20 kehrt er als erster ständiger Gastdirigent zum Salzburger Landestheater zurück, wo er von 2010 bis 2017 schon Erster Kapellmeister war. Ferner ist Kelly eng mit dem Buxton Festival verbunden.
Dieses Jahr wie schon zuvor hatte der britische Dirigent Adrian Kelly die musikalische Leitung des YSP inne. In der Saison 2019/20 kehrt er als erster ständiger Gastdirigent zum Salzburger Landestheater zurück, wo er von 2010 bis 2017 schon Erster Kapellmeister war. Ferner ist Kelly eng mit dem Buxton Festival verbunden.
Das Abschlusskonzert beginnt mit einer beschwingt vorgetragenen Ouvertüre aus „La Cenerentola“ von G. Rossini. Sodann singt die polnische Sopranistin Joanna Kedzior die Arie der Ewa aus „Hrabina“ (Die Gräfin) von St. Moniuszko, „Per que´ belli labbri“. Kedzior verfügt über einen hell timbrierten, leuchtenden Koloratursopran mit gutem Tiefenregister und liefert einen einnehmenden emotionalen Vortrag. Die spanische Mezzosopranistin Carmen Artaza singt danach gemeinsam mit dem kanadischen Tenor Josh Lowell Szene und Duett der Angelina (Cenerentola) und des Don Ramiro aus „La Cenerentola“, „Tutto è deserto - Un soave non so che“ und besticht mit einem auf lyrischer Basis auch zu gewisser Dramatik fähigen Sopran und guter Farbgebung. Lowell lässt einen lyrischen Tenor hören, bestens geeignet für das italienische und französische Fach. Sodann singt der britische Bass Thomas Bennett die Arie des Osmin aus „Die Entführung aus dem Serail“ von W.A. Mozart, „Oh, wie will ich triumphieren“ mit einem eher hellen Timbre bei relativ wenig Volumen in der Tiefe. Die Stimme hat m.E. auch keine allzu große Resonanz.

Ein Terzett schließt sich an, mit Joanna Kedzior als Alcina, dem russischen Countertenor Iurii Iushkevich als Ruggiero und der ukrainischen Mezzosopranistin Valentina Pluzhnikova als Bradamante mit „Non è amor, ne gelosia“ aus „Alcina“ von G. F. Händel. Der noch sehr junge Iushkevich lässt einen klangvollen und geschmeidigen Countertenor hören. Pluzhnikova beeindruckt mit einem leicht abgedunkelten farbigen Mezzo bei sehr guter Tiefe und Kedzior - wie schon gesagt bei ihrem Solo - mit ihrem leuchtenden hellen Sopran. Der neuseeländische Bariton Benson Wilson singt sodann die Kavatine des Belcore „Come Paride vezzoso“ aus „L’elisir d’amore“ von G. Donizetti. Bei einem schönen Timbre und kraftvollem Gesang wirkt die Stimme jedoch etwas verschlossen und einfarbig.
Der kanadische Bassbariton Joel Allison intoniert sodann Rezitativ und Arie des Figaro, „Tutto è disposto - Aprite un po´quegli occhi“ aus „Le nozze di Figaro“ von W. A. Mozart. Er präsentiert einen variationsreichen Bassbariton mit sowohl guter Tiefe als auch Höhe. Hinzukommen eine nahezu perfekte Diktion und Phasierung. Exzellent! Die irische Sopranistin Sarah Shine folgt mit „Se i padre perdei“, Arie der Ilia aus „Idomeneo“ von W. A. Mozart. Sie hat eine sehr lyrische und flexible Stimme mit guter Höhe und für die lyrischen Qualitäten auch eine gutes Volumen. Allerdings stellt diese Arie keine allzu großen Herausforderungen. Nun kommt die Mezzosopranistin Valentina Pluzhnikova mit ihrem Soloauftritt und singt „Ah scotasti! - Smanie implacabili“, Rezitativ und Arie der Dorabella aus „Così fan tutte“ von W. A. Mozart. Zwar ist ihr Mezzo klangvoll und hat auch starken Aplomb, aber es fehlt etwas an Technik in der Stimmführung.
Vor der Pause kommt gibt es noch ein starkes, gut artikuliertes Sextett, und zwar von Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, Don Ottavio, Leporello und Masetto aus „Don Giovanni“ von W. A. Mozart. Mit Tamara Bounazou (Donna Anna), Marie-Andrée Bouchard-Lesieur (Donna Elvira), Sarah Shine (Zerlina), James Ley (Don Ottavio), Ricardo Bojórquez (Leporello) und Thomas Bennett (Masetto) mit „Sola, sola in buio loco“. Das wurde der erste große Höhepunkt des Abschlusskonzerts!

Nach der Pause geht es mit Josh Lowell weiter, der Rezitativ und Arie des Ernesto „Povero Ernesto - Cercherò lontana terra“ aus „Don Pasquale“ von G. Donizetti singt. Lowell hat sehr gute lyrische Höhen, fast vibratofrei, und auch eine gute Attacke. Ein exzellenter Vortrag! Man denkt an Juan Diego Flores… Es folgt die französische Mezzosopranistin Marie-Andrée Bouchard-Lesieur mit „Me voilà seule, enfin - Plus grand, dans son obscurité“, Rezitativ und Kavatine der Balkis aus „La Reine de Saba“ von Ch. Gounod. (Das hatte ich noch nie gehört, für mich gab es die nur von Goldmark…!). Satte Tongebung ausdrucksvoller Gesang und viel Farbe stellt sie unter Beweis, zu denen auch noch eine sehr gute Höhe und Attacke kommen. Ebenfalls vom Feinsten!
Der Mexikaner Ricardo Bojórquez singt sodann die Arie des Rodolfo aus „La Sonambula“ von V. Bellini, „Vi ravviso - o luoghi ameni“. Er begeistert mit einem satten und sehr kantablen Bass mit viel Ausdruck bei hoher Musikalität. Sein Vortrag hat auch viel Charakter. Ebenfalls einer der besten an diesem Abend! Die Französin Tamara Bounazou singt nun den schon recht anspruchsvollen Valse-ariette der Juliette aus „Roméo et Juliette“ von Ch. Gounod, „Je veux vivre“. Sie verfügt über einen sehr farbigen Mezzo mit glanzvollen Höhen und sehr viel Ausdruck. Bei großer Emotionalität sind auch ihre Koloraturen gut, und sie schließt mit einer tollen Höhe ab. Brava! Iurii Iushkevich kommt sodann mit dem Lied des Lehl aus „Snegurocka“ (Schneeflöckchen) von N. Rimski-Korsakow, „Zu dem Donner eine Wolke sprach“. Mit einem hell-timbrierten Countertenor und einem sympathischen Vortrag bei viel Ausdruck und großer vokaler Flexibilität gewinnt er zu Recht umgehend die Herzen des Publikums. Super!
 Carmen Artaza singt daraufhin das Chanson des Stéphano aus „Roméo et Juliette“ von Ch. Gounod, „Depuis hier je cheche en vain mon maitre - Que fais-tu, blanche tourterelle”. Auch sie kann mit einem vollen und ausdrucksstarken Mezzo glänzen, zeigt unglaublich viel Charakter im Vortrag bei entsprechender Mimik. Auf jedem Ton ist voller Klang mit guter Resonanz zu hören. Das wird wohl ein Bühnentier… Dann kommen Benson Wilson und Joel Allison mit dem Duett des Sir Giorgio Valton und Sir Riccardo Forth aus „I puritani“ von V. Bellini. Allison ist wieder ausgezeichnet, Wilson etwas einfarbig, aber sehr energisch im Vortrag bei guter Resonanz und Höhe. Allison erscheint mir als blendender Bassbariton für das italienische und französische Fach. Ein Höhepunkt! Als letzter Solist tritt James Ley an mit der Arie des Lyonel aus „Martha“ von F. von Flotow. Er geht das Stück allzu zu vorsichtig an, fast depressiv, bei einer schönen lyrischen Mittellage. Dass die Höhe nicht gelingt, mag auch an einer gewissen Nervosität gelegen haben.
Carmen Artaza singt daraufhin das Chanson des Stéphano aus „Roméo et Juliette“ von Ch. Gounod, „Depuis hier je cheche en vain mon maitre - Que fais-tu, blanche tourterelle”. Auch sie kann mit einem vollen und ausdrucksstarken Mezzo glänzen, zeigt unglaublich viel Charakter im Vortrag bei entsprechender Mimik. Auf jedem Ton ist voller Klang mit guter Resonanz zu hören. Das wird wohl ein Bühnentier… Dann kommen Benson Wilson und Joel Allison mit dem Duett des Sir Giorgio Valton und Sir Riccardo Forth aus „I puritani“ von V. Bellini. Allison ist wieder ausgezeichnet, Wilson etwas einfarbig, aber sehr energisch im Vortrag bei guter Resonanz und Höhe. Allison erscheint mir als blendender Bassbariton für das italienische und französische Fach. Ein Höhepunkt! Als letzter Solist tritt James Ley an mit der Arie des Lyonel aus „Martha“ von F. von Flotow. Er geht das Stück allzu zu vorsichtig an, fast depressiv, bei einer schönen lyrischen Mittellage. Dass die Höhe nicht gelingt, mag auch an einer gewissen Nervosität gelegen haben.
Zum Abschluss gab es dann eben die Fuga finale aus „Falstaff“, das berühmte und wohl immer wieder stimmende „Tutto nel mondo è burla“ von G. Verdi. Natürlich waren hier alle 13 Sänger beteiligt. Riesenapplaus, ja stehende Ovationen für alle Beteiligten!
Man kann der Festspielpräsidentin in diesem Falle nur zustimmen, wenn sie ausrief „So schön war’s noch nie!“ Das sind ganz ausgezeichnete junge Sänger mit wohl großen Karrierechancen, wenn sie alles richtig machen. Zum Schluss stellte man auch noch das Ehepaar Kühne vor, dessen Kühne-Stiftung das YSP seit Jahren signifikant fördert. Festspielintendant Markus Hinterhäuser und einige Agenten, für die sich der Weg gelohnt haben könnte, waren auch im Publikum.
Klaus Billand, 2.9.2019
Bilder (c) Marco Borrelli
SIMON BOCCANEGRA
Großes Festspielhaus
Aufführung am 18.8.19 (Premiere am 15.8.)
Zeitversetzt, aber modern?
Giuseppe Verdis Schmerzenskind aus 1857 wurde auch nach der gründlichen Umarbeitung von 1881 unter der Mitarbeit von Arrigo Boito nicht zum Publikumsrenner. Im Salzburger Sommer war das Werk erst ein einziges Mal auf dem Programm gestanden – das war im fernen 1961 mit Tito Gobbi in der Titelrolle.
So wie es sich damals um eine der historischen Epoche Rechnung tragende Inszenierung handelte, so war sie fast 60 Jahre später „selbstverständlich“ zeitversetzt. Tatsächlich geht es um eine Handlung, wie sie sich auch – und gerade – heute abspielen könnte, sieht sich der Doge Boccanegra doch gezwungen, einen großen Aufruf für „Frieden“ und „Liebe“ an die einander bekämpfenden Parteien zu machen: Ob das Patrizier gegen Plebejer oder Rechte gegen Linke sind, spielt ja nun wirklich keine Rolle. Hier geht es auch um Genua gegen Venedig – ein blinder Lokalpatriotismus, den man in größerem Maßstab durchaus mit Nationalismus übersetzen kann.

Also keine schlechten Voraussetzungen für Regisseur Andreas Kriegenburg, der die Aktualität der Themen allerdings mit Hilfe von Äußerlichkeiten aufzeigen wollte. So liefen die Verbindungen der verschiedenen Gruppen von Verschwörern ausschließlich über Mobiltelefone, wobei (erfundene) Texte projiziert wurden. So weit, so gut, aber damit wirklich alle verstanden, worum es ging, mussten die Verschwörer während des Gehens gekrümmt auf ihre Geräte starren, was eher auf heftiges Darmgrimmen denn auf Rachegedanken schließen ließ. Auch dass die tobende Volksmenge drohend ihre Handys reckte, wirkte schablonenhaft. Als im zweiten Teil szenisch keine großen Choreinsätze mehr zu bewältigen waren, wirkte Kriegenburgs Regie entspannter und besser auf die Solisten fokussiert. Unglücklich war allerdings der Einfall, den Dogen nach Einnahme des Giftgetränks und der zu Herzen gehenden Phrase „Persin l'acqua del fonte“ auf einem Klavier sich ausstrecken zu lassen, was in der Premiere zu Lachern im Publikum führte.

Bei dieser ersten Reprise begnügte sich der Titelheld Luca Salsi aus freien Stücken damit, vor der Tastatur des Klaviers zusammenzusinken, womit Lacher prompt verhindert wurden (das den Regisseuren ins Stammbuch). Mit Ausnahme des vor einem Gazevorhang spielenden Prologs war das Instrument dann immer zu sehen, und Gabriele Adorno begleitete sich bei seiner Auftrittsarie dabei (bzw. tat er so als ob). Ansonsten war das Bühnenbild von Harald B. Thor überzeugend geraten, denn ein paar Sträucher zeigten passend die Idylle zwischen Gabriele und Amelia an, während die rechte Bühnenseite von einem massiven Bau gefüllt war, der wohl an demokratische Parlamente, aber auch an den Stil faschistischer Monumentalbauwerke erinnerte. Sehr intensiv die Beleuchtung durch Andreas Grüter und vor allem auch die Videoprojektion von Peter Venus, die das Meer und seine Bedeutung sowohl für Genua, als auch für den Ex-Korsaren unaufdringlich ins Bild brachte. Die Kostüme von Tanja Hofmann? Tja, zeitgenössisch eben, und nicht unbedingt eine Hilfe, um die Persönlichkeit von Sängern zu unterstreichen.

Die musikalische Umsetzung war, mit winzigen Abstrichen, auf dem hohen Niveau, das man sich von diesen Festspielen erwarten – und nicht nur erhoffen – darf. Valery Gergiev ließ eine spannende, manchmal ein wenig rustikale Interpretation hören, die von den mit dem Werk bestens bekannten Wiener Philharmonikern in wundersamer Schönheit umgesetzt wurde. (Dass Gergiev den Gesangssolisten praktisch keine Einsätze gibt, wird von den opernerfahrenen Musikern spielend aufgefangen). Luca Salsi in der Titelrolle bot eine Interpretation, die in der Erinnerung bleiben wird. Es gab nicht nur die volle, schön timbrierte, die Register untadelig wechselnde Baritonstimme zu hören, sondern auch einen Gestalter voller vokaler Nuancen, welche die von der Regie teils um ihre menschliche Größe gebrachte Figur zu voller Entfaltung brachten. Mehr als imposant auch René Pape als Boccanegras rachsüchtiger Gegenspieler Fiesco. Es war nicht nur eine Freude, anstelle der heute für die Rolle oft eingesetzten Bassbaritone einen echten Vertreter des verlangten Stimmfachs zu hören, sondern auch ein Genuss, die psychologischen Farben zu verfolgen, die der Künstler ab der Auftrittsarie in die Rolle einbrachte. Als Adorno war Charles Castronovo szenisch das Abbild eines testosterongesteuerten Jünglings; seine Stimme ist dramatischer geworden.

Eine gute vokale Leistung, obwohl die Stimmfarbe nach dem passaggio nicht ganz homogen blieb. Die Amelia Grimaldi der Marina Rebeka gefiel durch selbstbewusstes, ihren Gabriele Adorno zügelndes Verhalten, wobei ihr eher neutral timbrierter Sopran trotz einiger scharfer Höhen gute Technik zeigte. Als fieser Paolo konnte man bei André Heyboer durchaus schon die Anlagen zu Jago hören; stimmlich sicher, ist er vor allem dafür zu loben, dass die Gestalt Profil gewann, was mit deren äußerlicher szenische Reduzierung auf einen Bürokraten gar nicht so leicht war. Stimmlich nachdrücklich empfahl sich der junge Italiener Antonio Di Matteo als weiterer Verschwörer Pietro für größere Rollen. Als Hauptmann der Armbrustschützen zeigte Long Long mit seinen wenigen Phrasen, dass er seine verschiedenen Wettbewerbspreise nicht vergeblich errungen hat. Marianne Sattmann aus der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor ergänzte als Amelias Magd. Der von Ernst Raffelsberger einstudierte Chor glänzte mit großem Einsatz und Stimmschönheit.
Lange, begeisterte Zustimmung (mit Füßetrampeln) des Publikums.
Eva Pleus 25.8.19
Bilder: Ruth Walz
MESSA DA REQUIEM
Großes Festspielhaus
Vorstellung am 17.8.19 (Premiere am 13.8.)
Die Wiener Philharmoniker und Riccardo Muti: Eine Art Symbiose mit einem schwerlich zu übertreffenden künstlerischen Ergebnis. Es gab drei Wiedergaben der grandiosen Totenmesse Giuseppe Verdis, deren zweite (besprochen wird hier die dritte) dem dreißigsten Todestag Herbert von Karajans gewidmet war.
Ich hatte mehrmals Gelegenheit, Muti „das“ Requiem dirigieren zu hören, und seine Interpretation war nie die gleiche. Jedes Mal schien der Dirigent weiter die - eigentlich unerschöpflichen - Tiefen dieses Meisterwerks erforschen zu wollen. In der ausgezeichneten Akustik des Großen Festspielhauses konnte man einerseits jedes kleinste Detail hören, jeden Moment, in welchem sich einer der Musiker eines Orchesters auszeichnen konnte, das aus so vielen Könnern im Rang von Solisten besteht, andererseits die sofort erkennbare Klangfarbe, die nur bei den bedeutendsten Klangkörpern gesichert ist. So ist es auch unmöglich, einen besonderen Moment von Mutis Interpretation mit einem Orchester hervorzuheben, das Wachs in seinen Händen war. Das dramatische 'Dies irae', die sanften Anrufungen des 'Agnus dei', das Flehen des 'Libera me' können nur als Beispiele einer Auslegung genannt werden, die mir wirklich sehr nah an dem scheint, was Verdi zum Ausdruck gebracht wissen wollte.

Den Intentionen Mutis folgte ein ausgezeichnetes Solistenquartett: Den Sopranpart sang Krassimira Stoyanova nicht nur mit großer stimmlicher Reinheit, sondern mit ebenso viel Ausdruck und furchtlos in den tiefen Noten, die Verdi der Solistin im 'Libera me' abverlangt. Prachtvoll die Leistung von Anita Rachvelishvili im Mezzopart – eine leuchtende, über alle Register volltönende Stimme und, nicht zuletzt, stilistisch perfekt. Der Part des Tenors wurde von Francesco Meli mit der bei ihm bekannten Stimmschönheit und ausgezeichneten Technik gemeistert, aber auch mit einer Art spezieller Konzentration (beispielsweise im 'Hostias'), die vielleicht mit einer nicht 150prozentigen Form zusammenhing. (Das ist leider der Wert, an dem heute die herausragenden Sänger klassischer Musik gemessen werden). Den Basspart interpretierte Ildar Abdrazakov sowohl stimmlich, als auch stilistisch ausgezeichnet. Dass er kein echter Bass, sondern eher ein Bassbariton ist, ist bekannt, aber es ist auch eine Tatsache, dass echte Bässe in der Welt der klassischen Musik sehr rar geworden sind.
Die von Ernst Raffelsberger einstudierte Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor extra loben zu wollen, hieße Eulen nach Athen zu tragen.
Ein ergriffenes Publikum feierte alle Mitwirkenden, nachdem sich der berühmte Knoten im Hals gelöst hatte.
Eva Pleus 25.8.19
Bild: Marco Borrelli
IDOMENEO
am 9. August 2019
Peter Sellars kommt in die Jahre…
Gestern Abend gab es also eine weitere Aufführung von Mozarts „Idomeneo“ in der Felsenreitschule. Es wurde offenbar, nicht zuletzt durch signifikante Buhrufe am Schluss, dass die Idee des mittlerweile auch schon als Altmeister zu bezeichnenden Regisseurs Peter Sellars, den Idomeneo auf die fortschreitende Zerstörung der Umwelt und insbesondere den Klimawandel, aus welchen Gründen auch immer er fortschreitet, abzustellen, in er von ihm gewählten szenischen und dramaturgischen Form nicht verfing und schon gar nicht überzeugte. Zu sehr ist Sellars inszenatorische Ästhetik in einem „Schön“ und „Appetitlich“-Inszenieren fixiert, als dass der Umweltfokus seines „Idomeneo“ optisch offenbar würde. Erst recht, wenn man die eindringlichen und einschlägig bekannten sowie Tagesschaugerecht bebilderten Appelle von sage und schreibe zehn bekannten und weniger bekannten Umweltaktivisten gleich zu Beginn des Programmheftes gelesen hat. Sie sind noch vor der Besetzung und also noch vor dem Inhalt zu finden – darunter Luisa Neubauer, ein offener Brief von FridaysForFuture, deren Sprecherin sie in Deutschland ist, und natürlich Greta Thunberg, die nach schweizerischen und deutschen Medien offenbar auf der Klimakonferenz „Smile for Future“ in der Schweiz gestern Journalisten aus dem Saal hat werfen lassen, sie dann nach etwa zehn Minuten aber wieder herein durften. Es gab offenbar ernste Meinungsverschiedenheiten unter den Aktivisten. Fängt die Revolution bereits jetzt an, ihre Kinder zu fressen, noch bevor Thunberg ihre Segelyacht in die USA bestiegen hat?! Es wäre etwas früh. Jedenfalls sehen die von Sellars und seinem Bühnenbildner George Tsypin, der immerhin den berühmten ossetischen „Ring des Nibelungen“ von Valery Gergiev in St. Petersburg eindrucksvoll bebildert und dort wie hier eine Vorliebe für transparente gläserne Gebilde an den Tag legte, gezeigten mittelgroßen bis riesigen kugelförmigen Plastikgebilde nicht wie Müll sondern eher wie die bei Südwind an der südafrikanischen Küste bei Kleinmond zusammen mit den dort üblichen Riesenalgen antreibenden Schaumblasen aus. Oder wie kunstvoll von Swarovski bzw. in Murano geblasene Glasarbeiten, die noch der Bemalung harren. Die beiden größten lassen auch eine mögliche optische Vaterschaft des futuristischen Kunsthauses Graz vermuten, immerhin nicht so weit weg wie Südafrika…

Das sieht ja ganz nett aus, auch das spätere Ziehen an die Decke der Felsenreitschule, wohl weil es doch am Ende hinderlich war. Aber es war ohne Programmheftstudium ganz und gar nicht eingängig. Der Müll unserer Tage sieht anders, schlimmer aus! Und der im Meer treibende zumal! Wer mal in eine Hafenbucht in Buenos Aires oder Lagos geschaut hat, weiß das. So fies, aber damit viel intensiver in der gewünschten Zusage, darf es bei Sellars wegen seines oben angedeuteten ästhetischen Anspruchs aber nicht sein. Auch der Müll muss noch ansprechend aussehen. Wenn man aber neben dem Klimawandel auch den Umweltschutz zum Thema macht, an dem man die allgemeine Zerstörung des Lebensraumes schildern will, dann muss man, wenn man realistisch sein will – und das dokumentiert Sellars mit zwei Maschinengewehr-bewaffneten Sicherheitsbeamten, die bei jeder noch so geringen Bewegung Ilias die Waffen auf ihren Kopf richten – beim Thema Müll so richtig in die Sche… fassen. Und mit dem offensichtlichen Verzicht darauf verliert sein Regiekonzept an Klarheit und Überzeugungskraft.
Stattdessen werden Wellenbewegungen durch modische, blau leuchtende, aus dem Boden aufsteigende Röhren stilisiert. Wenn sie bei Idomeneos „Ankunft“ am Strand rot blinken, wirken sie wie die Einweisungsfeuer am Kopf der Landebahnen an Großflughäfen. Bei Sellars Bühnenbildern spielen meist aus Glas bestehende Röhren offenbar immer eine große Rolle. So sahen wir es auch schon in seinem Titus 2018. Vor vielen Jahre erlebte ich an der Finnischen Nationaloper Helsinki einmal die Oper „L’amour de loin“ der bekannten finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Auch hier gab es bühnehohe leuchtende Säulen über einem See, die damals großen Eindruck machten und dramaturgisch sinnvoll erschienen. Im Salzburger „Idomeneo“ wimmelt es nun aber nur so von Glassäulen, von denen einige recht umfangreich sind und sogar mit dem Plastik-Müll zum Schnürboden hochgezogen werden. Damoklesschwerter der heutigen Zivilisation? Die Sinnhaftigkeit dieser großen Säulen, die vielleicht rituelle Stelen sein sollen, erschloss sich mir zumindest allenfalls in der Szene des Gran Sacerdote, den Idomeneo um Gnade bittet, der aber flieht, als man ihm den Plastikmüll vor die Füße legt… Issachah Savage, den ich im Mai in Bordeaux als guten Siegmund hörte, ließ als Sacerdote einen anbrechenden Tenor erklingen.

Hier, und gerade auch bei den verwüstenden Stürmen und Umweltkatastropen, die den „Idomeneo“ auch charakterisieren, wäre nun wirklich einmal der intensive Einsatz von Video und Filmtechnik auf der dafür so dankbaren riesigen Galerien-Wand der Felsenreitschule angebracht gewesen, die Sellars und Tsypin total verschenken – bis auf ein paar rote Ampeln, wenn Elektra ihre finale Arie singt. Sie sollten sich einmal in Savonlinna umsehen, wie man das macht. Stattdessen muss der herrlich facettenreich singende und sowohl im Piano wie gerade auch in den dramatischsten Momenten beeindruckende musicAeterna Choir of Perm Opera, von Vitaly Polonsky einstudiert und dem Samoaner Lemi Ponifasio perfekt choreografiert, die Gewitter- und Katastrophenszenen bewerkstelligen.
Und damit kommen wir zur musikalischen Seite, und damit dem erfreulicheren Teil. Offenbar wurde, was das Sängerensemble angeht, auf eine vornehmlich lyrische Interpretation gesetzt. Die irische Mezzosopranistin Paula Murrihy singt einen wundervollen Idamante, klangschön, wenn nötig mit dem erforderlichen Aplomb, aber auch im Piano beeindruckend. Darstellerisch meistert sie ihr emotionales Spannungsfeld zwischen Ilia und Elektra, übrigens schon von der ersten Szene an, bestens. Die aus Ningbo in China stammende Sopranisten Ying Fang, die in Shanghai an der New Yorker Juilliard School studierte und auch am bekannten Lindemann Young Artist Development Program der Met teilnahm, ließ einen perfekt geführten glockenreinen sowie fast vibratofreien Sopran erklingen, in jedem Moment ein nahezu perfekter Vortrag. Darstellerich gab sie mit ihrer sanften Zurückhaltung einen klaren Gegenpol zur Rivalin Elektra. Die US-Amerikanerin Nicole Chevalier setzt ihren dramatischen Sopran gekonnt zur Darstellung der schwierigen Situation der einerseits liebenden, andererseits aber auch abgrundtief hassenden Atridentochter ein. Ihre finale Arie bis zum tödlichen Umfallen war vielleicht der Höhepunkt des Abends. Eine großartige Rolleninterpretation!

Leider stand diesem begnadeten Trio der Damen kein männlicher Gegenpol gegenüber. Denn der Idomeneo, immerhin die Titelpartie des Stücks, wenngleich Idamante die wichtigere Rolle spielt, erwies sich mit dem US-amerikanischen Tenor Russel Thomas als unterbesetzt, wenn nicht sogar fehlbesetzt. Zu keinem Zeitpunkt kann sein Tenor Klangfarbe entfalten, die Resonanz ist viel zu gering und schon zu Beginn hatte der Sänger hörbare Probleme mit den Höhen. Im übrigens belanglos choreografierten aber so wichtigen Quartett im 2. Teil war Thomas neben den drei Damen kaum zu hören. Wie erfreulich dagegen die Stimme von Jonathan Lemalu, einem in Neuseeland geborenen Samoaner, der vom rechten Seitenbalkon Nettuno hörenswerten Respekt verschuf. Der Südafrikaner Levy Sekgapane ergänzte das also weitgehend gute bis exzellente Ensemble mit einem etwas kleinen Tenor ansprechend.
Teodeor Currentzis hatte die musikalischen Leitung und beeindruckte gleich von Beginn an mit seinem exakten Schlag, dem intensiven Blickkontakt mit einzelnen Musikern oder Gruppen des Freiburger Barockorchesters. Dieses gab sein wohl Allerbestes, was Currentzis auch in der Lage war herauszuholen. Und es passte zur lyrischen Schwerpunktsetzung des Sängerensembles. Ich habe den „Idomeneo“ auch schon dramatischer gehört, aber das können die alten Instrumente des Barockorchesters naturgemäß auch nicht leisten. Es war dennoch musikalisch erstklassig.

Ein große Verwunderung am Schluss. Alle Akteure, bis hinunter zu den Statisten, versammelten sich nach der abschließenden Ballettmusik KV 367 in einer langen Reihe und nahmen den Applaus in dieser Formation bis auf die Ausnahme, die acht Protagonisten allein vortreten zu lassen, entgegen. Wo waren die „Einzelvorhänge“!? Insbesondere die drei Damen hätten sich diese verdient gehabt. Bei allem Verständnis für eine hier möglicherweise überpostulierte Teamarbeit, bei der es keine Bevorzugten geben soll, halte ich das für völlig unakzeptabel. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass auch in Theatern mit großer Bühne und fehlendem Vorhang die Protagonisten nicht einzeln zum Applaus vortraten. Und ich gehe öfters in die Oper. Was war denn der Grund? Ich würde es gern wissen, habe aber einen Verdacht…
Klaus Billand 11.8.2019
Foto: Salzburger Festspiele/ Ruth Walz
ADRIANA LECOUVREUR. Konzertant
Nahezu himmlischer Gesang!
3. August 2019
Ja, sie sang tatsächlich, welches Glück für die Festspielbesucher, die ausgerechnet die letzte der drei Aufführungen gebucht hatten. Denn es war ein Glück, ein künstlerisches Glück zu erleben, wie Anna Netrebko, offenbar völlig genesen – was einen wiederum etwas neidisch macht auf ihren Arzt, wie schnell er eine Erkältung wegbekommt – die Adriana Lecouvreur gestern Abend im Großen Festspielhaus interpretierte. In einem kupferpatina-farbenen wehenden Gewand, mit Strass besetzt, welches dann zu einem wichtigen Instrument ihres Spiels werden sollte, kam sie siegerhaft lächelnd herein. Strahlend bis in die letzten Reihen des Festspielhauses erinnerte sie mich sofort an die Freiheitsstatue in New York – es fehlten nur die Strahlen aus Kupfer wie auf dem Kopf des New Yorker Wahrzeichens.
Die Salzburger Festspiele nennen diese Produktion bescheiden „konzertant“. Was man aber erlebte, war eine klassische semi-konzertante Aufführung, denn nicht nur die Netrebko, sondern auch Anita Rachvelishvili, Yusif Eyvazov, Nicola Alaimo und alle anderen lebten diesen Abend mit intelligenter und absolut passender Gestaltung und Mimik, dass man eine Inszenierung kaum vermisste. Da gab es, wie früher, auch keine Notenpulte mehr, eine absolute Bedingung für eine semi-konzertante Aufführungsform. Ist das vielleicht eine Option für die Zukunft und gar das Überleben der Kunstform Oper, wenn das so schwierige, übertriebene und oft verquere und eben nicht aufgehende Regietheater die Zuschauer den Opernhäusern reihenweise den Rücken kehren lässt?! Man könnte mal darüber nachdenken… Oder besser nicht! Die Regisseure sollen eben gutes Musiktheater machen! Wir wissen ja, dass es geht.
Aber zurück zu Netrebko, Rachvelishvili, Eyvazov und Alaimo sowie dem wie immer bestens aufgelegten Marco Armiliato am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg. Da stimmte einfach alles, ein nie zu lautes, federndes Dirigat, das die Höhen der Partitur von Francesco Cilea zum Leuchten brachte und die Sänger voll zur Geltung, bei perfekter Koordination.
Ich benutze ja äußerst ungern die Attribute „fabelhaft“ oder „phantastisch“, um in einer Rezension die Qualität von Sängern zu beschreiben, weil dann keine Steigerung mehr möglich ist. Aber hier wäre es einmal angebracht. Als Anna Netrebko zur berühmten Arie gleich zu Beginn anhebt, lässt sie eine charaktervolle, sehr gereifte Stimme hören, deren Timbre nun etwas rauchig dunkel geworden ist, dass man meint, sie streife bereits die oberen Register des Mezzosoprans. Dass sie ein solcher nicht ist, wird kurz darauf überdeutlich, wenn sie die Höhen, und dazu noch mit Piano und einem nahezu nicht enden wollenden Atem zelebriert, denn „singt“ würde hier zu kurz greifen. Dabei zeigt sie auch noch eine Gestik, die ihren Gesang auf optimale Weise mit der Aussage und der Rolle integriert, es ist alles eins! Dazu kommt ein bezauberndes Legato, kurz, während der Arie dachte ich einen Moment, Maria Callas zu hören, als wenn sich der Opernhimmel geöffnet hätte und die stets so erwünschten Sonnenstrahlen ungehindert auf die Erde fallen würden. Schade, dass Opernsängerinnen in der Regel nach auch noch so stürmischem Applaus Arien nicht wiederholen, warum eigentlich?! Hier hätte man es sich sooo gewünscht!
In Anita Rachvelishvili als Principessa di Bouillon hatte die Netrebko aber eine ebenbürtige Partnerin und Gegnerin, die eine Mezzo-Röhre erschallen ließ, die, in der Nähe eines Friedhofs gesungen, wohl die Toten wieder auferstehen ließe… Die Mezzosopranistin verfügt über eine enorme vokale Spannbreite und kann ebenso tief ins Alt gehen wie saubere Höhen produzieren – mit unglaublicher stimmlicher Kraft und ebenfalls bemerkenswertem mimischem Ausdruck. Wenn die beiden auf der Bühne standen, gab es nichts mehr zu deuteln – es waren die Höhepunkte dieser „Adriana Lecouvreur“! Auch die Georgierin bewegte sich wie Anna Netrebko auf der gesamten Bühne und ließ so den Eindruck einer intensiven Gestaltung entstehen, die mit dem Begriff „konzertant“ nicht mehr einzufangen ist.
Offenbar fühlte sich Yusif Eyvazov als Maurizio von diesem Sängerfest animiert und sang den Conte di Sassonia mit heldischem Aplomb, alle Höhen technisch bestens meisternd, aber halt mit einem Timbre, das nicht jedermanns Sache ist und sein kann. Es verfügt über keine tenorale Wärme, keine nennenswerte Italianità, die man ja in solchen Rollen doch gern hören möchte. Darstellerisch machte Eyvazov seine Sache sehr gut. Nicola Alaimo ließ als Michonnet seinen kultivierten und bestens geführten Bariton hören, der ideal ins italienische Fach passt. Sehr glaubhaft gestaltete er die naive Hoffnung, mit Adriana doch noch eine Beziehung anzufangen. Mika Kares als Principe di Bouillon und Andrea Giovannini als Abate di Chazeuil rundeten das exzellente Sängerensemble mit hoher stimmlicher Qualität ab. Der Chor spielt zwar keine allzu große Rolle in dem Stück. Der Philharmonia Chor Wien unter der Leitung von Walter Zehmachte sich aber in den entsprechenden Szenen äußerst positiv bemerkbar.
Ein Abend er besonderen Art, ganz sicher. Das Publikum war begeistert. Und Netrebko verabschiedete sich bis 2020 von Salzburg. Nun bin ich gespannt auf ihr Bayreuth-Debut mit der Elsa im „Lohengrin“ am 14. August. Hoffentlich ist ihr Arzt dann in der Nähe…
Klaus Billand 5.8.2019
MÉDÉE von Cherubini
Vom Höllenritt der Gefühle
31.07.2019

Vitalij Kowaljow (Creon).
Eine Frau setzt alles für Ihre große Liebe – und ihre zwei Kinder – ein. Doch der Ehemann verliebt sich in eine Jüngere, aus Liebe wird Hass, aus Trennung eine Orgie des Hasses, aus Verzweiflung ein „Höllenritt“ der Gefühle. Am Ende ermordet Medea ihre Konkurrentin und die Kinder und beginnt den eigenen Abstieg in die „Unterwelt“.
Die Geschichte von Medea und Jason gibt es in vielen Version. Die Oper von Luigi Cherubini „Medee“– UA 1797 in Paris – ist seit der Wiederentdeckung des Werkes durch Maria Callas und Leonie Rysanek eine echte Primadonnen-Oper. Nun Salzburg wollte offenbar für Sonya Yoncheva die französische Original-Version ansetzen. Doch die Bulgarin sagte wegen Schwangerschaft ab. Und Salzburg fand fulminanten Ersatz: Elena Stikhina wurde im Laufe des Abends immer besser, sie meisterte die klassizistischen Verzierungen wie die sich steigernden Ausbrüche. Sie kann weinen und drohen, winseln und attackieren. Sie verfügt über eine gut sitzende Höhe, das Timbre der russischen Sopranistin ist in der Mittellage dunkel, in der Tiefe etwas zu eng. In der Höhe strahlt und glänzt sie dafür und wird nicht an den exponiertesten Stellen scharf oder schrill. Beim Solovorhang am Ende kam die Antwort: der Applaus explodiert geradezu! Solch frenetischen Jubel hat man auch in Salzburg erst selten erlebt. Den Namen Stikhina hat man sich ab sofort zu merken. Unterstützt wurde ihr Triumph übrigens auch von den Wiener Philharmonikern und dem Dirigenten Thomas Hengelbrock. Der schürte ab dem ersten Takt die Glut und die emotionale Besessenheit – jenen Teil der Partitur, der sich auf die Tragödie bezieht, die ja schon weit fortgeschritten, wenn sich der Vorhang hebt.
Ach ja da gab es ja auch eine Inszenierung von Simon Stone (Bühne Bob Cousins. ). Er aktualisierte das Drama auf eine Riesen- Hochzeits-Party (inklusive Rotlicht-Niveau), fügte endlose Stummfilm-Sequenzen ein, unterbricht Cherubini durch Radio- Tonsequenzen. Es ist eine der vielen Modernisierungsversuche, die „nicht weh tun“…. Aber mit der genialen Musik von Cherubini hat dies alles nichts zu tun! Auch der Rest der Besetzung war mittelmäßig, mehr nicht: Pavel Chernoch hat vor allem zu jammern und seinen Anteil an der Zuspitzung der Tragödie zu übersehen, Vitalij Kolwaljow war ein unauffälliger Kreon, Rose Feola war eine bemühte, aber leicht überforderte Dirce, Alisa Kolosova darf man nicht mit einer Rollenvorgängerinnen wie Margarita Lilowa als Neris vergleichen. Nur der Chor (Konzertvereinigung Wiener Staatsoper, Leitung Ernst Raffelsberger) muss extra gelobt werden.
Alles in allem: eine Sternstunde für eine neue russische Sopranistin, eine harmlos pseudoaktuelle Inszenierung, ein guter Dirigenten und eine ansonsten „mäßige“ Besetzung.
Peter Dusek 1.8.2019
Dank an unseren Kooperationspartner MERKER-online (Wien)
Fotos (c) Thomas Aurin





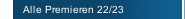




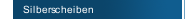
















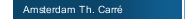













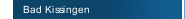




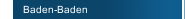





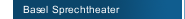




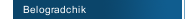

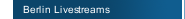





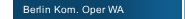



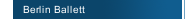





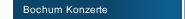



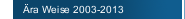





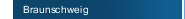

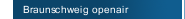




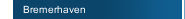




















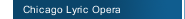


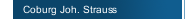





















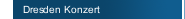



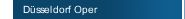



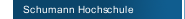









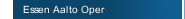




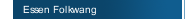










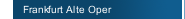
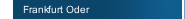





















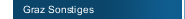








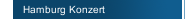
















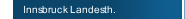

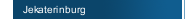

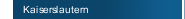











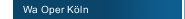


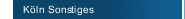
















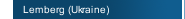





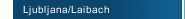





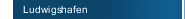























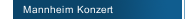













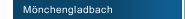





















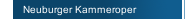
















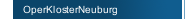


























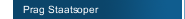
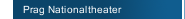

















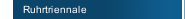

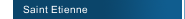







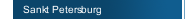



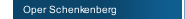
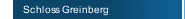














































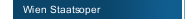

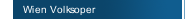

















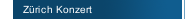
















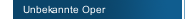




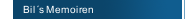










 Nun, Anna Netrebko brillierte in einem attraktiven und ausdrucksstarken hell-türkisfarbenen Kleid als Tatjana in der Brief-Arie aus der Oper „Eugen Onegin“. Fast mädchenhaft, bisweilen sublim und verzweifelt lässt sie die Stimmung der enttäuschten Tatjana mit ihrem so herrlich charaktervollen, dunkel timbrierten und makellosen Sopran erhören. Mitnehmend die wiederholten absteigenden Linien gegen Ende der Arie, in denen sie auch dramatisch ihre ganze Klangschönheit und Emotion entfaltet. Netrebko lebt immer die Rolle, die sie gerade singt, auch mimisch und mit ihrer ganzen Körpersprache. Ebenso emotional und bewegend singt sie Lisa im Duett mit ihrem Mann aus dem 1. Akt der Oper „Pique Dame“ op. 68 „Ostanowites, umoljaju was“ (Bleiben Sie stehen, ich flehe Sie an!). Hier vermag sie durch die Klarheit ihres Vortrags, eine perfekte Diktion und klangvolle Spitzentöne zu bestechen. In diesem Duett wirkt auch die ungarische Mezzosopranistin Szilvia Vörös aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper mit, deren klangvoller und ausdrucksstarker Mezzo einen schönen vokalen Kontrapunkt setzt. Man hätte ihr ohne weiteres auch eine Einzelnummer gönnen können. Auch bei den Stelle in Verona sangen neben dem Ehepaar weitere Sänger in Solonummern. Zum Schluss gibt Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov noch das Duett Iolanta und Vaudémont „Twojo moltschanje neponjatno“ (Ich verstehe dein Schweigen nicht) aus der Oper „Iolanta“ op. 69, ein Duett, das wohl nicht jeder Festspielbesucher kennt. Insofern wären die Texte der Stücke in den kleinen Programmheften hilfreich gewesen. Aber sie waren eh fast immer kurz vor Aufführungsbeginn vergriffen, da kostenlos...
Nun, Anna Netrebko brillierte in einem attraktiven und ausdrucksstarken hell-türkisfarbenen Kleid als Tatjana in der Brief-Arie aus der Oper „Eugen Onegin“. Fast mädchenhaft, bisweilen sublim und verzweifelt lässt sie die Stimmung der enttäuschten Tatjana mit ihrem so herrlich charaktervollen, dunkel timbrierten und makellosen Sopran erhören. Mitnehmend die wiederholten absteigenden Linien gegen Ende der Arie, in denen sie auch dramatisch ihre ganze Klangschönheit und Emotion entfaltet. Netrebko lebt immer die Rolle, die sie gerade singt, auch mimisch und mit ihrer ganzen Körpersprache. Ebenso emotional und bewegend singt sie Lisa im Duett mit ihrem Mann aus dem 1. Akt der Oper „Pique Dame“ op. 68 „Ostanowites, umoljaju was“ (Bleiben Sie stehen, ich flehe Sie an!). Hier vermag sie durch die Klarheit ihres Vortrags, eine perfekte Diktion und klangvolle Spitzentöne zu bestechen. In diesem Duett wirkt auch die ungarische Mezzosopranistin Szilvia Vörös aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper mit, deren klangvoller und ausdrucksstarker Mezzo einen schönen vokalen Kontrapunkt setzt. Man hätte ihr ohne weiteres auch eine Einzelnummer gönnen können. Auch bei den Stelle in Verona sangen neben dem Ehepaar weitere Sänger in Solonummern. Zum Schluss gibt Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov noch das Duett Iolanta und Vaudémont „Twojo moltschanje neponjatno“ (Ich verstehe dein Schweigen nicht) aus der Oper „Iolanta“ op. 69, ein Duett, das wohl nicht jeder Festspielbesucher kennt. Insofern wären die Texte der Stücke in den kleinen Programmheften hilfreich gewesen. Aber sie waren eh fast immer kurz vor Aufführungsbeginn vergriffen, da kostenlos... Gleich nachdem Yusif Eyvazov als Hermann zu Anna Netrebko zu ihrem Duett aus „Pique Dame“ hereingestürzt ist, wird klar, dass ihm das russische Repertoire nicht so gut liegt wie das italienisch/französische. Da ist zunächst mal wenig Tenorales zu hören. Die Stimme berührt nicht, hat keinen tenoralen Klang und schon gar keinen Schmelz. Man sollte allerdings auch festhalten, dass der Hermann normalerweise von einem Heldentenor gesungen wird. Man denke nur an Vladimir Altantov und andere. Die Stimme blüht zu keinem Zeitpunkt auf, und so ist es auch mit seinem „Kuda, kuda wy udalilis“ (Wohin, wohin seid ihr entschwunden) aus der Oper „Eugen Onegin“ op. 24. Zwar ist gute Technik zu vernehmen, die Noten werden durchwegs gesungen, aber das Timbre seiner Stimme ist einfach allzu gewöhnungsbedürftig, wenn man an andere Tenöre mit dieser Arie denkt. Die Höhen werden zudem unüberhörbar guttural. Darstellerisch macht er seine Sache sehr emotional und damit gut.
Gleich nachdem Yusif Eyvazov als Hermann zu Anna Netrebko zu ihrem Duett aus „Pique Dame“ hereingestürzt ist, wird klar, dass ihm das russische Repertoire nicht so gut liegt wie das italienisch/französische. Da ist zunächst mal wenig Tenorales zu hören. Die Stimme berührt nicht, hat keinen tenoralen Klang und schon gar keinen Schmelz. Man sollte allerdings auch festhalten, dass der Hermann normalerweise von einem Heldentenor gesungen wird. Man denke nur an Vladimir Altantov und andere. Die Stimme blüht zu keinem Zeitpunkt auf, und so ist es auch mit seinem „Kuda, kuda wy udalilis“ (Wohin, wohin seid ihr entschwunden) aus der Oper „Eugen Onegin“ op. 24. Zwar ist gute Technik zu vernehmen, die Noten werden durchwegs gesungen, aber das Timbre seiner Stimme ist einfach allzu gewöhnungsbedürftig, wenn man an andere Tenöre mit dieser Arie denkt. Die Höhen werden zudem unüberhörbar guttural. Darstellerisch macht er seine Sache sehr emotional und damit gut. Maestro Tatarnikov versuchte bei ansprechender Begleitung der Vokalnummern insbesondere mit drei Orchsterstücken musikalischen Akzente zu setzen, mit der Introduktion aus „Pique Dame“, dem „Rosen-Adagio“ aus dem 1. Akt des Balletts „Dornröschen“ op. 66 und der Polonaise aus dem 3. Akt von „Eugen Onegin“. Konnte in der Introduktion zu „Pique Dame“ noch das prägnant exzessive Hervorbrechen des Hauptthemas im Blech beeindrucken und auch sonst eine gefühlvolle Interpretation dieses tiefgründigen Musikstücks, so geriet das „Rosen-Adagio“ nach den anfänglichen Harfenarpeggien um einiges zu laut und verwaschen. Am Schluss gelang es dem Pauker fast, die gesamten Streicher zuzudecken… Auch die abschließende Polonaise hätte mehr Differenzierung und weniger Lautstärke gut vertragen. Immerhin stellten sich sofort erfreuliche Assoziationen zum Wiener Opernball ein…
Maestro Tatarnikov versuchte bei ansprechender Begleitung der Vokalnummern insbesondere mit drei Orchsterstücken musikalischen Akzente zu setzen, mit der Introduktion aus „Pique Dame“, dem „Rosen-Adagio“ aus dem 1. Akt des Balletts „Dornröschen“ op. 66 und der Polonaise aus dem 3. Akt von „Eugen Onegin“. Konnte in der Introduktion zu „Pique Dame“ noch das prägnant exzessive Hervorbrechen des Hauptthemas im Blech beeindrucken und auch sonst eine gefühlvolle Interpretation dieses tiefgründigen Musikstücks, so geriet das „Rosen-Adagio“ nach den anfänglichen Harfenarpeggien um einiges zu laut und verwaschen. Am Schluss gelang es dem Pauker fast, die gesamten Streicher zuzudecken… Auch die abschließende Polonaise hätte mehr Differenzierung und weniger Lautstärke gut vertragen. Immerhin stellten sich sofort erfreuliche Assoziationen zum Wiener Opernball ein…















 Dieses Jahr wie schon zuvor hatte der britische Dirigent Adrian Kelly die musikalische Leitung des YSP inne. In der Saison 2019/20 kehrt er als erster ständiger Gastdirigent zum Salzburger Landestheater zurück, wo er von 2010 bis 2017 schon Erster Kapellmeister war. Ferner ist Kelly eng mit dem Buxton Festival verbunden.
Dieses Jahr wie schon zuvor hatte der britische Dirigent Adrian Kelly die musikalische Leitung des YSP inne. In der Saison 2019/20 kehrt er als erster ständiger Gastdirigent zum Salzburger Landestheater zurück, wo er von 2010 bis 2017 schon Erster Kapellmeister war. Ferner ist Kelly eng mit dem Buxton Festival verbunden.

 Carmen Artaza singt daraufhin das Chanson des Stéphano aus „Roméo et Juliette“ von Ch. Gounod, „Depuis hier je cheche en vain mon maitre - Que fais-tu, blanche tourterelle”. Auch sie kann mit einem vollen und ausdrucksstarken Mezzo glänzen, zeigt unglaublich viel Charakter im Vortrag bei entsprechender Mimik. Auf jedem Ton ist voller Klang mit guter Resonanz zu hören. Das wird wohl ein Bühnentier… Dann kommen Benson Wilson und Joel Allison mit dem Duett des Sir Giorgio Valton und Sir Riccardo Forth aus „I puritani“ von V. Bellini. Allison ist wieder ausgezeichnet, Wilson etwas einfarbig, aber sehr energisch im Vortrag bei guter Resonanz und Höhe. Allison erscheint mir als blendender Bassbariton für das italienische und französische Fach. Ein Höhepunkt! Als letzter Solist tritt James Ley an mit der Arie des Lyonel aus „Martha“ von F. von Flotow. Er geht das Stück allzu zu vorsichtig an, fast depressiv, bei einer schönen lyrischen Mittellage. Dass die Höhe nicht gelingt, mag auch an einer gewissen Nervosität gelegen haben.
Carmen Artaza singt daraufhin das Chanson des Stéphano aus „Roméo et Juliette“ von Ch. Gounod, „Depuis hier je cheche en vain mon maitre - Que fais-tu, blanche tourterelle”. Auch sie kann mit einem vollen und ausdrucksstarken Mezzo glänzen, zeigt unglaublich viel Charakter im Vortrag bei entsprechender Mimik. Auf jedem Ton ist voller Klang mit guter Resonanz zu hören. Das wird wohl ein Bühnentier… Dann kommen Benson Wilson und Joel Allison mit dem Duett des Sir Giorgio Valton und Sir Riccardo Forth aus „I puritani“ von V. Bellini. Allison ist wieder ausgezeichnet, Wilson etwas einfarbig, aber sehr energisch im Vortrag bei guter Resonanz und Höhe. Allison erscheint mir als blendender Bassbariton für das italienische und französische Fach. Ein Höhepunkt! Als letzter Solist tritt James Ley an mit der Arie des Lyonel aus „Martha“ von F. von Flotow. Er geht das Stück allzu zu vorsichtig an, fast depressiv, bei einer schönen lyrischen Mittellage. Dass die Höhe nicht gelingt, mag auch an einer gewissen Nervosität gelegen haben.








