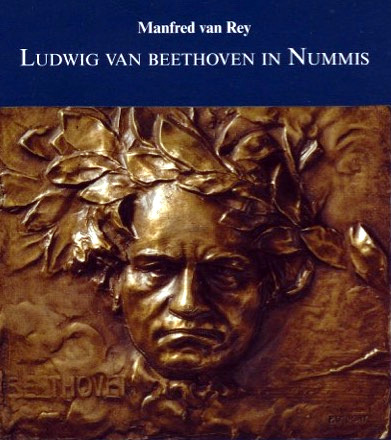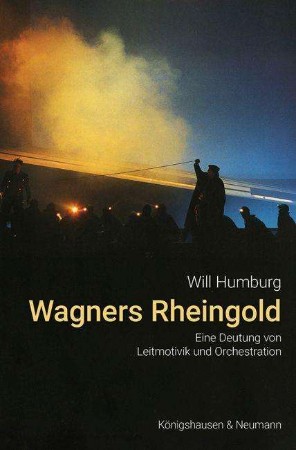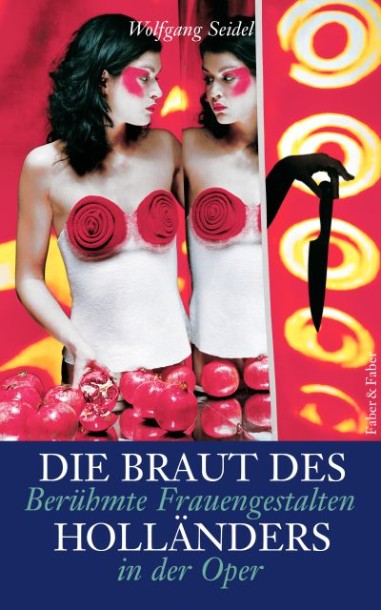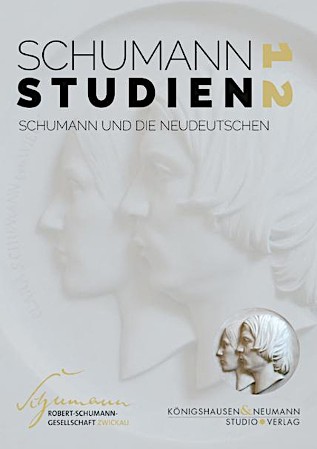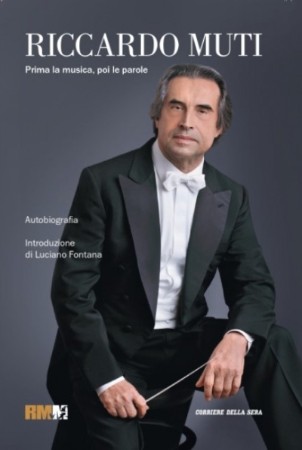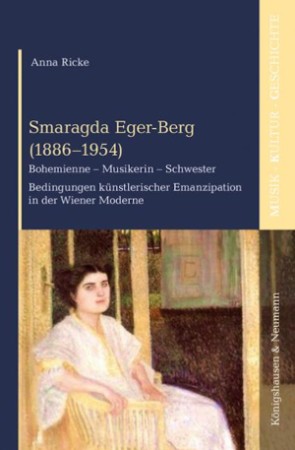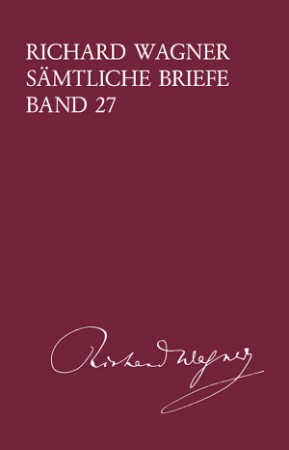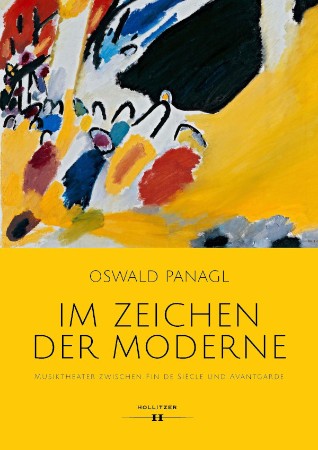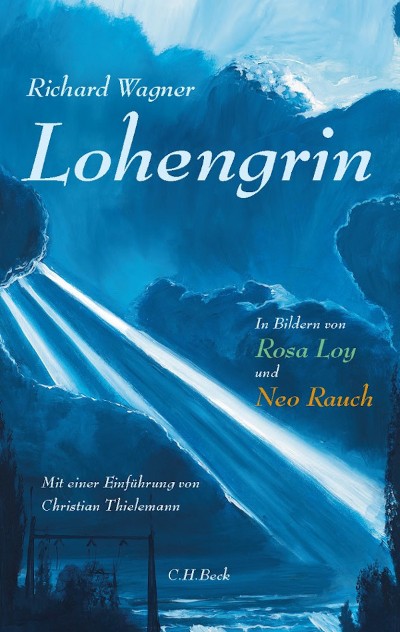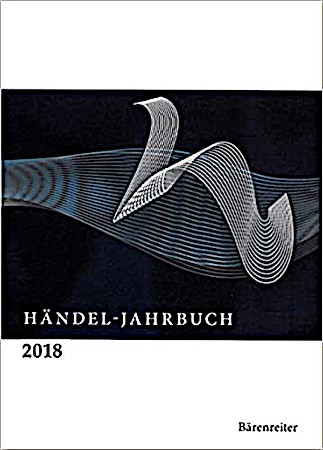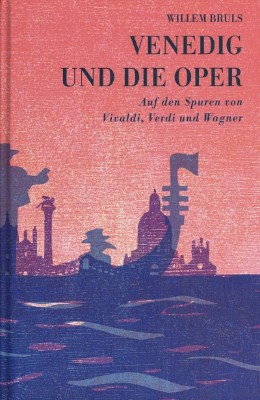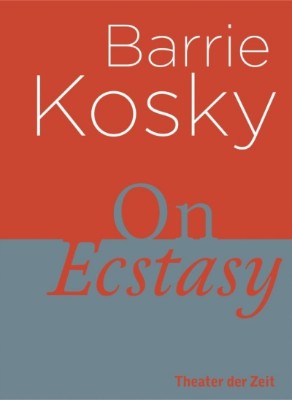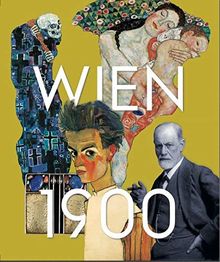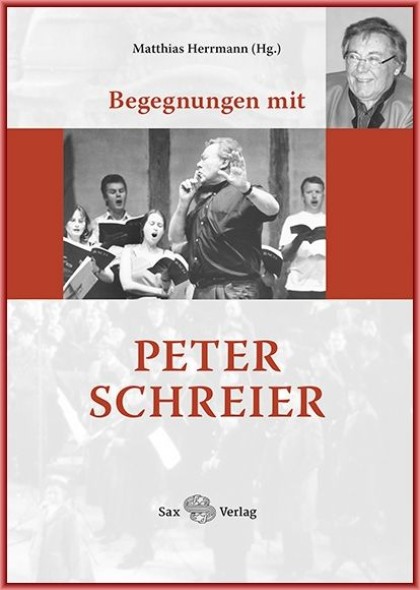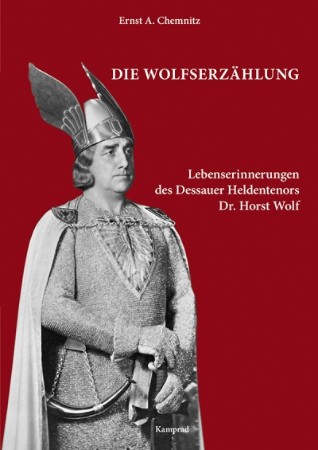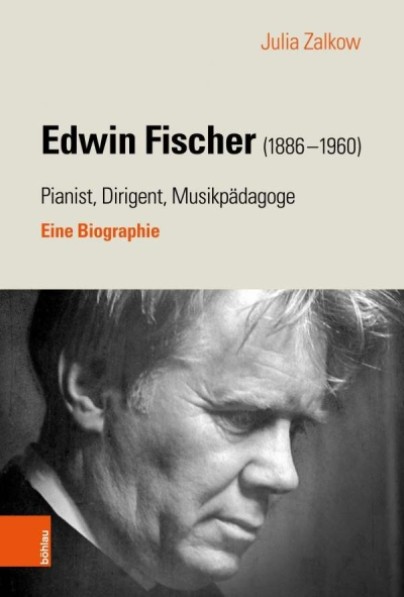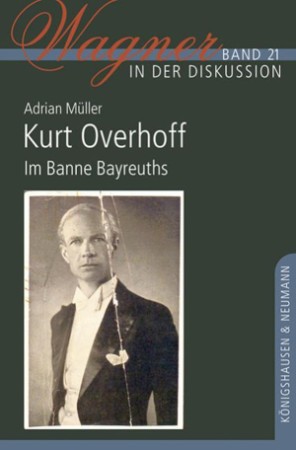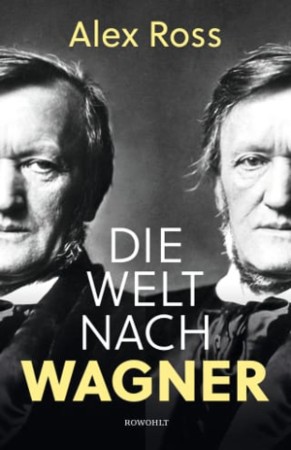NEUE BÜCHER

KAROL BERGER: JENSEITS DER VERNUNFT. FORM UND BEDEUTUNG IN WAGNERS MUSIKDRAMEN
Wirklich wichtig: ein neues Wagner-Buch
Erst kürzlich behauptete Elisabeth Fuchshuber-Weiß in ihrem Buch über die NS-Geschichte des Münchner Wagner-Verbands, dass die Thesen zur Form Richard Wagners, die Alfred Lorenz vor bald 100 Jahren in seinen Analysen der reifen Opern Richard Wagners aufstellte, umstandslos mit dem NS-Ordnungs- und Führerprinzip verbunden werden könnten. Alfred Lorenz hatte es unternommen, dem Vorwurf der Formlosigkeit in Wagners Werken mit einer genauen Betrachtung eben jener von ihm, Lorenz, entdeckten Formen entgegenzutreten. Lorenz‘ Abhandlungen waren lange Zeit das non plus ultra der musikwissenschaftlichen Wagner-Forschung, bis Carl Dahlhaus, der wie kein zweiter die deutsche Musikwissenschaft nach dem 2. Weltkrieg prägte, die vermeintlichen Nachweise cum grano salis als haltlos abtat. Lorenz hatte das „Geheimnis der Form“ nämlich nicht in den großen, akt- und werkbildenden Strukturen, sondern in den kleinsten „Perioden“ ausgemacht, die allzu oft völlig willkürlich mit den tatsächlichen Befunden umsprangen. Doch obwohl Dahlhaus sich außerordentlich oft mit Wagners Formen und seiner Kunst, sein Material auszubreiten, befasste, verblieb auch er meist im Mikro-Bereich; selten genug, dass er eine ganze Szene interpretierte.
Die Aufgabe, die Großform bei Wagner herauszuarbeiten und auf die Dramaturgie der einzelnen Werke zwischen dem Ring und dem Parsifal zu beziehen, wurde erstaunlicherweise noch nicht übernommen – bis Karol Berger, einstiger Lehrstuhlinhaber in Stanford, 2016 sein opus magnum vorlegte. Beyond reason: Wagner contra Nietzsche liefert tatsächlich, trotz einzelner Werke wie Heiko Jacobs profunde Arbeit zur Architektur des Parsifal, die erste wirkliche Zusammenschau, die die Rede vom „Gesamtwerk“ Richard Wagners nicht als hohle Formel erscheinen lässt. Gewiss: der Wagnerianer weiß, wenn er nicht ganz uninformiert ist, wieso die Meistersinger auf Tristan folgten und, im zielgerichteten Sinne, vielleicht folgen mussten, und welche dialektischen Bezüge es zwischen dem Ring und dem Parsifal gibt. Wie sich Form und Inhalt (oft) entsprechen, welche geistesgeschichtlichen Hintergründen die einzelnen Werke grundieren: auch das weiß man, aber so genau, so problemorientiert und kritisch, dabei immer ausgewogen zwischen Skepsis und Bewunderung changierend, hat das noch kein Autor zwischen zwei Buchdeckel gelegt. Als wäre dies noch nicht genug, nahm sich Berger zum Zweiten vor, „die ideologische Bedeutung von Wagners Dramen vor den Hintergrund der Weltanschauungen seiner Zeit zu stellen und seine Werke insbesondere mit Nietzsches Kritik zu konfrontieren“. Auch dies klingt – schon im Hinblick auf die existierende Wagner-Nietzsche-Bibliothek - im ersten Moment nicht erschütternd neu, aber es ist erstaunlich, mit welcher Klarheit Berger im Schnelldurchlauf Kants und Hegels Thesen darstellt und Wagner mit Nietzsche konfrontieren kann, um Wesentliches über den Dichtermusiker wie über den Philosophen zu sagen, die sich zeitweise in Einem trafen: einer Ideologie, oder besser: einer Ideologie, die man nur noch in historischer Perspektive verstehen sollte. Dies verschlägt sogar dann nichts, wenn man weiss, dass sich die menschliche Beziehung zwischen Nietzsche und Wagner ein wenig anders darstellte, als es Berger suggeriert (ich empfehle nachdrücklich die Lektüre von Manfred Egers Standardwerk zur biographischen Beziehung zwischen den beiden Größen). Seine konzise Sicht auf Nietzsche contra Wagner, dem Propagandisten des antichristlichen „Übermenschen“ und dem chrsitlich beeinflussten Bühnenweihfestspiel-Komponist, bleibt davon unberührt.
Um das Hauptergebnis vorwegzunehmen: Berger zeigt, dass sich Wagner, unterm Strich, selbst bei seinen reifen Werken öfter auf traditionelle Formen (wie Arie, Ariette, Lied, Duett mit Cantabile und Cabaletta) stützte, als man es gewöhnlich wahrnimmt. Mag sein, dass Bergers Formanalysen, die auch zwischen einzelnen Werken vermitteln (das ist einer ihrer Witze), angesichts der differenzierten Verläufe gelegentlich, und auch dies nur auf den ersten Blick, pauschal wirken. Er ist ehrlich genug, um einzugestehen, dass ein Duett, wie im zweiten Tristan-Akt, unterbrochen werden kann, ohne seine generelle Duetthaftigkeit zu verlieren. Zugrunde liegt die Überzeugung, dass erst ein Blick auf die durch die traditionellen Strukturen ermöglichten Großformen „Erkenntnisse über die dramatischen und philosophischen Implikationen seiner Werke“ ermöglichen. Auf deutsch: Die Meistersinger repräsentieren in ihrer genauen Form die Vermittlung von Tradition und Innovation, während ein auf tödliche Transzendenz gepoltes Werk anderen Formgesetzen gehorcht, ja gehorchen muss. Noch in den dialogischen Partien des Musikdramas vom Ring herrscht, unterm Strich, die „solita forma“, die wir v.a. aus der italienischen Oper und ihren Nachahmern kennen. So kann der gesamte erste Akt der Walküre als eine einzige Opernszene gelesen werden, ohne dass dem Werk ideologisch Gewalt engetan wird – wird auch die Form entschleiert, so bleibt doch der Respekt vor dem Genie eines Komponisten, dem es gelang, äußerst große Verläufe mit vergleichsloser Sicherheit zu bauen.
Im traditionellen Sinne ist, überspitzt gesagt, Rossini gar nicht so weit von Wagner entfernt - weder im musikalischen noch im theatralischen Sinn, wie es denn auch zu den Vorzügen des Bandes gehört, den Musiker Wagner zugleich als Theaterautor und Dramatiker wahrzunehmen: eine Eigenschaft, die Dahlhaus und Lorenz gänzlich abging (womit sie Wagner, man kann‘s nicht anders sagen, strikt verfehlten). Und so, wie Wagner von Feuerbach zu Schopenhauer überlief, bevor er im Parsifal einen Abschluss seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit den geistigen Strömungen seiner Zeit fixierte, folgen die Werke in ihrer Musik den Interessen, die der Ideologe Wagner gerade verfocht; der Abbruch des Ring-Projekts nach dem zweiten Siegfried-Akt und die „Einschübe“ von Tristan und Meistersinger sind ja kein Zufall. Faszinierenderweise stellt Bergers Nietzsche-Kritik hier keinen Appendix dar. Immer wieder wird klar, wieso dessen (völlig irriger) Hinweis auf den „Miniaturisten“ Wagner das Sprungbrett für eine Analyse der äußerst souverän gehandhabten Großform der Werke abgibt, die sich nicht in der Deutung der wagnerschen Erinnerungsmotive oder einzelner harmonischer Beobachtungen (wie dem in jedem – dem dramatischen wie dem musikalischen - Sinne spannenden Tritonus im Ring) erschöpft. Dass sich die Kritik, etwa an der „auffallend verzerrten“ Schlussszene des Siegfried oder an der lebensverneinenden, dabei schwammig bleibenden Tendenz des Tristan, nicht wie die negative Eloge eines Wagnergegners, sondern wie ein Ringen um Verständnis liest, gehört bei Berger zum sauberen Handwerk. Die Kritik am Tristan folgt allein der Analyse der verschiedenen „Achsen“ auf dem Fuß: der „lyrischen“, der „narrativen“, dem „orchestralen“ – und alle diese Stränge vermitteln in erster Linie dramatische Kernpunkte. Ebenso originell scheint mir die Beobachtung, dass das Orchester zumal im Tristan, viel weniger – im Sinne des antiken Chors, der gewöhnlich und auch von Wagner selbst mit seinem Orchester verglichen wird – Kommentarfunktion hat als Figurendenken und -fühlen ausmalt.
Das Buch böte selbst jenem Leser schon Wesentliches, der „nur“ die Schlusskapitel der einzelnen Ring-, Tristan-, Meistersinger- und Parsifal-Aufsätze lesen würde. Berger nimmt den jeweiligen „Mythos“ unter die Lupe, kritisiert ihn auf hohem Niveau und findet schließlich, ganz wie Wagner selbst, im Parsifal mit seiner Mitleidsethik die Lösung jener ideologisch belasteten Revolutions-, Nations- und Liebesvisionen, die Wagner auch heute noch, liest man nur seine Stücktexte und Aufsätze, für viele Interpreten so problematisch machen. Man könnte einiges anders deuten, etwa im Nationaldiskurs der Meistersinger eine völlig normale Taktik sehen, sich im Konzert der gerade entstehenden Nationen mit friedlichen Kulturmitteln einen Platz an der Sonne zu reservieren, aber die Tatsache, dass Wagner mit seiner Verdammung aller realen Politik und dem Putsch des einstigen Verfassungsverteidigers Hans Sachs, nicht zuletzt mit einigen Elementen der Schlussrede die Möglichkeit verteidigte, im Irrationalen die Lösung für alle Probleme dieser Welt zu sehen – diese Tatsache macht das Werk, zumindest auf seiner Schlussrunde, zu einem kritikwürdigen. Man könnte schließlich einwenden, dass Parsifals Mitleidsethik verbunden ist mit dem Ausschluss der Frau aus dem Männerbund und einer höchst seltsamen, sexuell verschmutzten Blut- und Schuld-Mystik – dass der tumbe Tor und spätere Gralskönig Werte anzubieten hat, über die zu streiten sich lohnt, wird davon nicht beeinträchtigt. Mag sein, dass von Wagner zu Hitler der Weg nicht ganz so kurz ist, wie es seine Ankläger behaupten – gleichzeitig, Berger kann das gut begründen, trennen den Musikdramatiker und den Diktator einige gewichtige Denkmuster. Dies nur zur Beruhigung für jene Leser, die in der Kritik an Wagners Totalitarismus sogleich einen Reflex sehen, Wagner zum alten Eisen der Ideologiegeschichte zu legen.
Bergers Zauberwort heisst: Differenzierung. Wie auch immer man den Parsifal inhaltlich im Licht des gesamten Werks beurteilen mag: die Idee, Nietzsches z.T. unsinnige Wagner-Sicht mit einer Konfrontation des späten Philosophen und des alten Komponisten zu korrigieren, ohne Wagners Erlösungswahn und -theater, das Nietzsche sehr genau betrachtet hat, ad absurdum zu führen, ist so gelungen wie seine panoptische Sicht auf die Werke, die Wagner seit dem Ring geschrieben hat. Er schrieb damit ein Buch für Anfänger und für Fortgeschrittene: für die, die es genau wissen wollen, und für die, die sich erstmals für Wagners Denken und die Fage, wie er es denn gemacht habe, interessieren – immer in Blick auf das Wesentliche, die Entsprechung von Musik und Drama, von Klang und Theater, das vom zeitgeschichtlichen Hintergrund nicht trennbar ist, so weit es auch von den zeitgenössischen Opern entfernt ist und/oder scheint.
Mit einem Wort: Ein sehr wichtiges, grundlegendes Buch – und gut lesbar ist es auch noch.
Karol Berger: Jenseits der Vernunft. Form und Bedeutung in Wagners Musikdramen. 539 Seiten. Metzler / Bärenreiter, 2021. 49,99 Euro.
Frank Piontek, 04.10.2022
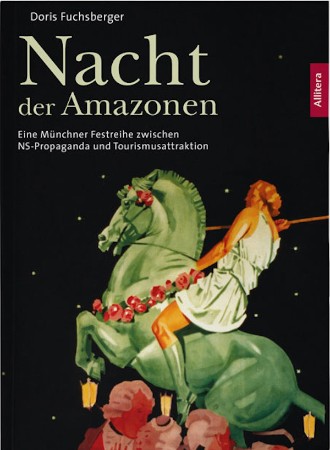
NACHT DER AMAZONEN
In der politisch überaus korrekten Geschichte der Bayerischen Staatsoper vor und nach 1945, die 2017 unter dem Titel Wie man wird, was man ist 2017 herauskam, kommt sie seltsamerweise nicht vor, obwohl die Autoren mit ihr noch zusätzlich hätten „beweisen“ können, dass damals alles, aber auch wirklich alles schlecht war an und in der Staatsoper, getreu dem Motto: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Dabei haben sich immer wieder bekannte und beliebte Künstler der Münchner Oper an der Nacht der Amazonen beteiligt, die genau viermal, in den Sommern der Jahre 1936 bis 1939, an der Isar über die Bühne ging.
Die Historikerin Doris Fuchsberger war die erste, die sich intensiv in das fast vergessene Kapitel der Münchner Festkultur hineinkniete und einen Band vorlegte, der nicht mit Materialien, Fotos und Texten, nicht zuletzt mit Zeitzeugenaussagen geizt. Fuhr Hitler auch lieber zu den zeitgleich veranstalteten Bayreuther Festspielen, weil ihn das Spektakel mit den nackten Frauen und Männern, die als Amazonen und lebende Statuen im Park von Schloss Nymphenburg aufzutreten hatten, vermutlich genierte, so verbanden sich in der Amazonennacht zugleich ideologische, wirtschaftliche wie künstlerische Motive – denn genau betrachtet, erwuchs die show aus einer langen Tradition. Höfische Barockdivertissements, Hofreitschule, Revue (mit Musik- und Gesangseinlagen), das waren die Elemente einer Festreihe, die als Höhepunkt der „Rennwoche Riem“ sowohl den München- und Oberbayern-Tourismus ankurbeln als auch die Präpotenz der Machthaber ins rechte Licht setzen sollte. Letzteres darf man übrigens wörtlich verstehen, denn die Licht-Installationen, die, profitierend vom gleichzeitigen Rüstungsaufbau, von Jahr zu Jahr aufwendiger und teurer wurden, unterstützten eine stundenlange Suite von Kampfspielen, Aufzügen und Szenen, die von einem Feuerwerk gekrönt wurden. Mittendrin: Hans Hermann Nissen, Erna Sack, Julius Patzak, also erste Namen der Staatsoper, die die „Frivolitäten“ mit ihren Einlagen gleichsam veredelten. Die shows boten Vieles: nackte Körper und „klassische“ Musik (Nissen durfte, warum auch immer, den Pagliacci-Prolog singen), Ballette (u.a. Mozarts Les petit riens), „schneidige“ (wie man damals sagte) militärische Auftritte, pseudo-barocke Szenen und Rokoko-Bilder. Man setzte bei allem auf absolute Popularität, die höher wog als eine völlig konsistente Dramaturgie – letztere aber lief darauf hinaus, den „schönen“ und „starken“ deutschen Menschen der Gegenwart zum Maß aller Dinge zu erklären. Um die dekadenten absolutistischen Fürsten als solche, und als zurecht überwundene, zu zeigen, mussten allerdings alle Zaubermittel historischer Ausstattungen angewendet werden – abgesehen davon, dass man die Bauherren des Schlosses, an dem die Nacht gerade stattfand, schon aus lokalpatriotischen Gründen nicht allzu sehr abwerten konnte.
Möglicherweise wäre die Nacht der Amazonen, die – die Autorin kann das sehr schön demonstrieren – die jahrzehntealte Geschichte des Münchner Faschings und vergleichbarer Ball-, Abend- und Nachtveranstaltungen als Höhepunkt des „Münchner Festsommers“ auf äußerst pompöse Weise fortsetzte, nicht mehr als ein mehr oder weniger geschmackvolles „event“ gewesen, wären die Veranstalter der Festreihe nicht skrupellose Nutznießer und Täter des Regimes gewesen, unter denen sich besonders Christian Weber, eine der übelsten Münchner Nazi-Figuren, hervortat, dem es auf zweierlei ankam: auf nackte Frauen und Pferdedemonstrationen. Mit im Spiel waren auch die Künstler; die Güntherschule, gegründet von Dorothee Günther und Carl Orff, und die aus dem Ausdruckstanz der 20er Jahre kommende Choreographin Hertha Meisenbach zeigen, dass die Moderne im Fall des NS-Regimes nicht vor Gebrauch schützte. Doris Fuchsberger hat im Anhang des Buchs nicht allein die Politprominenz, sondern auch die Künstler in kleinen biographischen Kapiteln charakterisiert, denen die Nacht der Amazonen ihre Form verdankte. Nicht zu vergessen: bis hinunter zum Statisten dienten viele Beteiligte als Bluthunde des Regimes: als Wachleute im nahen KZ Dachau, später in Polen, wo sich der für die Pferde zuständige Hermann Fegelein als Massenmörder betätigte, während Albert Reich, der künstlerische Leiter der Feste, SA-Mitglied gewesen war und 1930 eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet hatte. Nur Paul Wolz, Inhaber des Deutschen Theaters, der als Theaterfanatiker mitmachte, war nie ein vollkommen anerkannter Teil des Systems. Dafür waren seine verwandtschaftlichen Beziehungen für die Nazis einfach zu unsicher.
Fuchsberger hat mit ihrem Buch eine reich bebilderte, von historischen Daten flankierte Theater-Kulturgeschichte vorgelegt, die nicht allein ein fast unbekanntes Ereignis rekonstruiert. Sie konnte zeigen, wie alles mit fast allem zusammengehört: die Münchner Kunstgeschichte (mit Franz Stucks Amazonenskulptur an der Spitze), die Münchner Vergnügungskultur, Hitlers Forcierung Münchens als „Hauptstadt der deutschen Kultur“, die damit zusammenhängenden privaten und öffentlichen Interessen eines Christian Weber, der München zur Hauptstadt des Pferdesports machen wollte, Fremdenverkehrswerbung, Politpropaganda, ästhetische Machtdemonstrationen und Ideen zur Förderung eines „reinen“ deutschen Sexuallebens im Zeitalter der sog. Arterhaltung – nicht zuletzt die Arbeit von Staatsopernsängern, die schon damals außerhalb ihres Hauses attraktive Auftrittsmöglichkeiten suchten. Es scheint nicht leicht, der Nacht der Amazonen völlig gerecht zu werden, auch wenn Doris Fuchsberger sie im Kontext zur Münchner Kultur-, der Sport- und der NS-Geschichte sehr facettenreich beschrieben und gedeutet hat. Am Ende muss man sie wohl als das lesen, als was sie intendiert war: als touristisch ausschlachtbares gigantisches Propaganda-Fest eines sportlich inspirierten NS-Variétes, das seine Unschuld spätestens in jenem Augenblick verloren hatte, als die ersten SS-Reiter in das Nymphenburger Parterre einritten.
Und wenig später genoss man Leoncavallo.
Doris Fuchsberger: Nacht der Amazonen. Eine Münchner Festreihe zwischen NS-Propaganda und Tourismusattraktion. Allitera Verlag, 242 Seiten, 130 Fotos.
Frank Piontek, 12.9. 2022
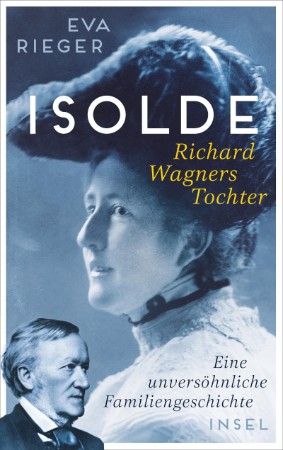
Tochter und Frau: Isolde Wagner
Über die Mutter erschien gerade eine wertvolle, von Sabine Zurmühl geschriebene Biographie, über den Bruder Siegfried gibt es schon viel, Blandine wurde vor ein paar Jahren immerhin ein Roman gewidmet, selbst über die uneheliche Tochter ihres Mannes, die spätere Chanteuse Eva Busch, gibt es ein autobiographisches Buch. Nur die Schwester Eva und sie haben bislang noch keine größere Lebenserzählung bekommen, obwohl sie gewiss nicht die unbekannteste Frau des Wagner-Clans ist. Sie blieb, Ironie des Schicksals, wohl nur deshalb im Gedächtnis, weil sie 1914 im berüchtigten Beidler-Prozess vor Gericht unterlag, als es galt, ihre Identität als Tochter Richard Wagners und eben nicht als Spross der von Bülows juristisch zu fixieren. Eva Rieger hat sich nun der ersten Wagner-Tochter gewidmet, nachdem in Die Beidlers, in Oliver Hilmes‘ Cosimas Kinder und der Veröffentlichung der ihrem Papa geschenkten Rosenstock-Bilder der jungen Dame schon Wesentliches, wenn auch interpretatorisch manchmal Anderes zu erfahren war. Um unser Bild der zwischen Konvention und Eigensinn changierenden Frau scharf zu stellen, hat Eva Rieger viele neue private Quellen, zumal aus dem Besitz der Enkelin Dagny Beidler, und öffentliche Texte, also Zeitungsberichte, ausgewertet. Interessant dürfte, soweit es die Kunst und das Kreative betrifft, v.a. der Hinweis auf Isolde Wagners künstlerische Tätigkeiten sein, die gezielt nicht gefördert wurden, wenn auch 1883 ihre Kostümentwürfe zum Parsifal ausgeführt wurden. Damit hat es sich allerdings auch schon. Die Tochter Cosima Wagners stand lebenslang unter dem Zwang ihrer Mutter, ihres Bruders, des Thronfolgers, und des Schwagers H.S. Chamberlains, indem sie in böseste, sie selbst schwer schädigende Erbschaftskämpfe hineingezogen wurde, in denen ihr Ehemann die Hauptrolle spielte. Das Buch müsste daher korrekt „Isolde Wagner und Franz Beidler“ heißen, denn über weite Strecken ist, und das ist gut so, von ihrem Mann, dem Dirigenten, die Rede, der, so genau las man‘s hierzulande noch nirgends, in Spanien, Portugal und England Erfolge feierte und in Barcelona erstmals den Parsifal, den Ring und – was die Wahnfriedler zusätzlich schockieren musste – dort auch Salome dirigierte. In Zürich brachte er den Tristan auf die Bühne: auch dies mit gutem Erfolg. Zu den Pluspunkten der Doppelbiographie gehört daher das gesamte Material, das die Biographin in spanischen, portugiesischen und englischen Periodica fand, die unser Bild von der ausländischen Wagner-Rezeption um 1900 en detail erweitern und den Musiker als das zeigen, als was er damals galt: als honorig und künstlerisch integer. Wahnfried aber setzte ein Bild in die Welt, das jahrzehntelang sein Porträt bestimmte.
Der Rest ist feministische Gesellschaftsgeschichte mit Einblicken in ein Zeitalter, in dem eine Isolde Wagner auf verlorenem Posten stand, wenn sie in eine kreuzkonservative Familie hineingeboren wurde. Den Konflikt zwischen Beidler und Siegfried Wagner sieht Eva Rieger daher auch als Teil eines Gesamtkonflikts zwischen Aufklärung und Finsternis, geschlechtlicher Selbstbestimmung und Reaktion – dass Siegfried Wagner und nicht der Ehemann der ungelernten Tochter Isolde im Kampf um das „Erbe“ gefördert wurde, solange der Bruder keinen weiteren Erben produziert hatte, verstand sich angesichts von Cosima Wagners Anbetung ihres Sohns allerdings von selbst. Als er Winifred zur Frau machte und in Kürze mehrere Kinder zeugte, war der Kampf schließlich auch biologisch entschieden.
So gesehen, standen die Beidlers immer auf verlorenem Posten – die Tochter konnte da nur Opfer sein, auch wenn sie es, anders als ihre Schwester und Halbschwestern, bisweilen wagte, der Mutter offen zu widersprechen, wenn diese wieder einmal nach ihrer Meinung „Unsinn“ sprach. Was Eva Rieger auf einer Quellenbasis, die manchmal in eine eher banale Tiefe geht, auch wenn die Briefkultur Isolde und Franz Beilders bewundernswert ist, was der Autorin also gelang, war auf jeden Fall eine Ehrenrettung Isolde Wagners, die dem zumal von Oliver Hilmes aufgestellten Popanz einer arroganten Frau vehement widerspricht. Sichtbar wird eine Frau, die, nicht allein im väterlich ererbten unkontrollierten Geldausgeben, die Freiheit liebte aber nicht die Freiheit besaß, sie wirklich umzusetzen. Um dies zu zeigen, brachte Eva Rieger freilich viele Informationen bei, die oft Hintergrund sind, aber die Titelfigur nicht wirklich betreffen, auch wenn sie durch die historische Kontextualisierung gerechter beurteilt werden kann. So wurde das Buch über weite Strecken zu einer durchaus spannenden Geschichte über die Festspiele um 1900, über den „Kampf zweier Welten um das Bayreuther Erbe“, wie des Bayreuther Chorleiters Julius Knieses Kampfschrift damals hieß.
Ohne Beidler, Franz wäre diese Biographie also wesentlicher dünner ausgefallen. Isolde Wagner-Beidler bleibt, trotz neuer Quellen, die Tochter und die Frau zweiter bedeutender Männer.
Eva Rieger: Isolde Wagner. Richard Wagners Tochter. Insel Verlag, 2022. 346 Seiten, 27 Abbildungen.
Frank Piontek, 2.9. 2022
Verführung durch Musik
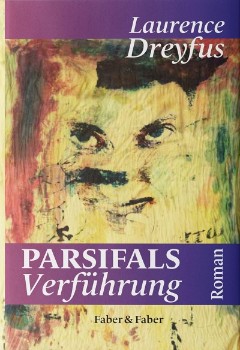 Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.
Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.
Wenn das Buch also mit einem „er“ beginnt, sind weder Parsifal noch Richard Wagner gemeint, sondern Levi, außer ihm gibt es eine zweite „Heldin“, die Frauenrechtlerin Anna Ettlinger, die ihren alten Freund Levi aufsucht, um mit ihm über eine Biographie, die sie schreiben will, zu sprechen. Die ihr gewidmeten Kapitel sind nach den Tagen des Aufenthalts im Hause Levi durchnummeriert, die mit Levi im Mittelpunkt tragen als Kapitelüberschriften Jahreszahlen. Der Autor ist bisher nicht als Romanschriftsteller bekannt, sondern vor allem als Gambenspieler und als Gründer und Leiter der Musikgruppe Phantasm, zudem als Musikhistoriker, verfasste unter anderem Bücher über Bach und Wagner.
Das nun erschienene Buch wird als Roman bezeichnet, auf der Rückseite des Bandes gleich doppelt sogar als Wagner-Roman beworben, was es nicht ist, hat aber durchaus halbdokumentarischen Charakter oder gibt sich als historisch getreu aus, so durch immer wieder eingestreute Briefe zum Beispiel des Freundes Brahms oder des Lehrers Lachner, deren beider Freundschaft Levi seiner Verehrung für nicht nur Wagners Musik , sondern auch für den Maestro selbst opferte. Eine tiefe Verwurzelung des amerikanischen Autors, der mittlerweile in Berlin lebt, in der deutschen Kultur, wie viele Zitate Hölderlins, Novalis‘ oder von Platens beweisen, ist verbunden mit Verbitterung über die antisemitischen Schriften Wagners und Spott über dessen menschliche Schwächen, doch spielt der Komponist eher indirekt eine Rolle in dem Buch, in dem auch gewisse Aspekte jüdischen Lebens in Deutschlands durchaus kritisch gesehen werden. Manchmal erweckt der Autor den Eindruck, er wolle seinen Leser durch die Ausbreitung von Kenntnissen über das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts geradezu überwältigen. Eine bedeutende Rolle spielt, und da tritt Fiktion in den Vordergrund, die Homosexualität, die in Bezug auf Levi und Brahms nur in einem Traum des Ersteren und da mit Problemen behaftet erscheint, da der eine beschnitten ist, der andere jedoch nicht, oder im Verhältnis zwischen Levi und seinem Masseur und Diener, das ausgerechnet nach der einzigen Liebesnacht mit Anna Ettlinger dieser offenbar wird. Da Siegfried Wagner in der vom Autor beleuchteten Zeit noch ein Kind war, gibt er für dieses Thema wenig her, auch wenn seine späteren Betreuer, der Bühnenbildner für den Parsifal und dessen italienischer Freund, bereits eine Rolle spielen.
Über die Musik Wagners wird wenig gesagt, was wohl der Gattung Roman geschuldet ist, der Verzicht auf eine chronologische Gliederung und auf die strenge Bindung an einen einzigen Romanhelden, nämlich Levi, bringen Abwechslung, aber auch eine gewisse Unruhe in das Werk.
Das Buch wurde von Wolfgang Schlüter übersetzt, dem man Sorgfalt und die Nähe zum Autor unterstellen möchte, so dass manche den Kitsch nicht nur streifende Äußerung, manche gewagte Formulierung nicht ihm anzulasten, ja vielleicht vom Autor so und so wirkend gewollt ist. „Schmälen“ sollte man allerdings nicht für schmähen halten, „Beseelung“ nicht „über Gesichtszüge huschen“ und der „nächtliche Schoß des Verlangens“ lieber verschlossen bleiben. Und als erfahrener Musiker hörte Levi sicherlich im Lohengrin-Vorspiel mehr als „ungezwungene Schönheit“, fand das Vorspiel zu Tristan nicht nur „erstaunlich“ und Auszüge aus dem Ring nicht nur „unwiderstehlich“. Aber es handelt sich ja nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern um einen „Roman“.
Wer, dem Titel glaubend, etwas über Parsifal oder Wagner erfahren will, dürfte enttäuscht sein. Wen Hermann Levi und die Möglichkeiten jüdischen Lebens im Deutschland des späten 19.Jahrhunderts interessieren, kann sich auf eine spannende Lektüre gefasst machen.
Faber & Faber 2022, 220 Seiten
ISBN 978 3 86730 226 5
23.08.2022 / Ingrid Wanja

SABINE ZURMÜHL: COSIMA WAGNER. EIN WIDERSPRÜCHLICHES LEBEN
„Cosima war keine Heerruferin für ein Befreiungskonzept für Frauen, schon gar nicht konkret eine Sprecherin für ihr Geschlecht und dessen Emanzipation. Und dennoch steht Cosima Wagner in ihrer Zeit mit all den Ungehorsamkeiten, persönlichen Befreiungsschlägen, ihrer Selbstverantwortung, ihrer Ungebundenheit bei gleichzeitiger Bindungsleidenschaft, ihrer Selbständigkeit, ihrer Hartnäckigkeit und ihrer unbeirrbaren Klarheit als Person des öffentlichen Interesses für ein provokantes und auf ihre Weise selbstbestimmtes Leben jenseits vorgegebener Regeln und Normen.“
Das eben meint der Untertitel des anzuzeigenden Buchs: „Ein widersprüchliches Leben“. Denn Cosima Wagner verstehen heißt: die Spannungen ihrer Existenz so wahrzunehmen, dass eine Betrachtung des immerhin fast ein ganzes Jahrhundert währenden Lebens sine ira et studio erst möglich wird. Kaum eine Biographin ist dafür so prädestiniert wie Sabine Zurmühl. Vor bald 40 Jahren veröffentlichte die taz-Autorin und Mediatorin ein kleines, doch ergiebiges Buch über die Beziehung von Wotan zu Brünnhilde, gespiegelt am eigenen Vater-Tochter-Verhältnis der Autorin, wobei man damals schon merkte, dass scharfsinnige Beobachtungen einer Feministin sich gut mit einem gerechten Blick auf schwierige Familien- und Geschlechterverhältnisse vertragen. Cosima Wagners Leben war voller Schwierigkeiten; es waren Schwierigkeiten jener Art, die vielleicht nur wirklich bedeutenden und das Jahrhundert „auf ihre Weise“ prägenden Menschen begegnen. Man mag einwenden, dass es schon genügend Bücher über Cosima Wagner gäbe, wobei sich die Biographie von Oliver Hilmes als Verkaufsschlager erwies. Vergleicht man das neue mit dem etwas älteren Buch, fällt sogleich ein markanter Unterschied ins Auge. Es ist ein Unterschied ums Ganze: Wo Hilmes als bloßer Historiker sein biographisches Objekt von außen taxiert, geht Sabine Zurmühl - soweit es überhaupt möglich ist, sich einer historischen Figur aus der bloßen Quellenkenntnis anzunähern – ins Innere der Gestalt, untersucht Motivationen und Gründe, historisiert die Beschriebene mit dem Rüstzeug der gegenwärtigen Bewusstseinslagen, ohne doch je zu vergessen, dass Cosima Wagner aus ihrer Zeit und ihren unverwechselbaren Befindlichkeiten und Voraussetzungen, ihren Vorlieben und Abneigungen heraus verstanden werden muss. Sie nennt ihre 33 Kapitel „biographische Skizzen“, wobei denn doch am Ende eine Lebensbeschreibung heraus kommt – eine thematisch konzentrierte, die sich an einzelnen markanten Haltepunkten inniger aufhält als Hilmes, dem es in erster Linie auf die Nachzeichnung der Ereignisse ankam.
Sabine Zurmühls Buch aber ist einfach spannender.
Es ist spannender, weil der Untertitel mehr ist als ein Versprechen. Cosima Wagner hat ein Leben geführt – und sie hat es „geführt“ -, das so selbstbestimmt wie abhängig war, soweit es das Leben mit und nach Richard Wagner betraf, in dem sie ihren Lebensmenschen traf, nachdem die Ehe mit Hans von Bülow schon schnell aus leicht nachvollziehbaren Gründen gescheitert war. Sabine Zurmühl urteilt nicht; sie breitet das Material aus, um sich ihre eigenen Gedanken über ein exzeptionelles Frauenleben des 19. Jahrhunderts zu machen, das Licht- wie Schattenseiten kannte. Wird Cosima Wagners bekannter Antisemitismus genau analysiert, gerät auch der monumentale Briefwechsel mit Hermann Levi in ein Kapitel, dessen Widersprüchlichkeit zwischen Abstoßung und Anziehung, Sympathie und Verstörung, kaum auflösbar ist (Stephan Mösch hat in seinem Parsifal-Buch das Verhältnis zwischen Cosima Wagner und dem Dirigenten viel rigoroser und einseitiger beurteilt, wo Eindeutigkeit kaum gegeben ist). Besonders faszinierend wird die Lektüre dort, wo alte Gewissheiten mit genauen Quellennachweisen über den Haufen geworfen werden: dass Cosima Wagner die Festspielästhetik über die Laufzeit ihrer Herrschaft auf dem Grünen Hügel petrifiziert habe, ist eine Legende, die spätestens seit Fabian Kerns Buch über die Bayreuther Bühnenmaler, die Coburger Gebrüder Brückner, revidiert gehört. Sabine Zurmühl widmet dem fundamentalen Thema „Festspielleitung, Regie, Ausstattung“ einen Raum, den man bei Hilmes vergeblich sucht – als sei die jahrzehntelange künstlerische Arbeit Cosima Wagners vernachlässigenswert. Das Gegenteil ist der Fall, Sabine Zurmühl zeigt, warum dies so ist: weil Cosima Wagner den Widerspruch aus der Ablehnung der krassen Moderne und dem Bewusstsein, dass stilistische Änderungen an Wagners Inszenierungen auf mehreren Ebenen (der Optik, der Gestik) vorgenommen werden müssen, auf ihre Weise bravourös bewältigte. Nichts davon bei Hilmes, viel darüber bei Zurmühl, die auch begriffen hat, dass Cosima Wagner – als Autorin und Übersetzerin – eine Figur der Literaturgeschichte ist.
Bemerkenswert ist schon die Aussage, dass Wagner ein Genie war. Damit ärgert die Autorin, mit gutem Recht, all jene Musik- und Kulturwissenschaftler, die das Genie zugunsten eines diffusen „Autor“-Begriffs aus ihrem Sprachschatz gestrichen haben, als hätte ein Max Bruch den Tristan vergleichbar komponieren können. Dass das Genie sich nach seinem Zusammenschluss mit der noch verheirateten Frau von Bülow so entwickelte, wie wir es kennen, war auch ein Verdienst der Frau, die als gebürtige d'Agoult und verheiratete von Bülow zugleich die Konventionen des Standes ihrer Zeit stolz verteidigte und bis zuletzt verinnerlichte und zugleich gegen diese Normen lebte. Nicht allein, dass sie die Partituren für Wagner überzog, auch die Tatsache, dass sie ihm den Rücken freihielt, ihn als Muse inspirierte, ihrem Mann ein Netzwerk zur Verfügung stellte, das die Festspiele sozial erst möglich machte. Nein, Cosima Wagner war keine Fricka, oder anders: Fricka ist keine hysterische Rechthaberin, sondern eine Frau, die einfach Recht und, nebenbei, auch eine starke Musik hat. In diesem Sinne war auch Wagners Frau eine (unter dem Ehebruch lange leidende) Ehegöttin, die eine schwierige, aber letzten Endes geglückte Lebensbeziehung bestand: für sich und den geliebten Partner, mit dem sie wechselseitige Bande knüpfte, über die man zu wenig wüsste, würde man allein Cosima Wagners Tagebücher lesen. Hier entstand ein „Kosmos, der Arbeit, Liebe und Neugierde aufeinander und Aufmerksamkeit füreinander gleich stark verbindet.“
So steht das Persönlich neben dem Beruflichen: hier die genaue und realistische wie verständnisvolle Darstellung der Dreierbeziehung Hans und Cosima von Bülows und Richard Wagners, auch die Frage, inwiefern Richard Wagner und Cosima von Bülow den König „betrogen“ (dies geschah, so Zurmühl, auch zum Schutz des gekränkten Gatten), nicht zuletzt die frustrierende wie prägende Beziehung der Tochter zum abwesenden und nicht wertschätzenden Vater und die frühen, gleichermaßen den Charakter formenden familiären Todeserfahrungen, dort die Darstellung der verschiedensten Tätigkeitsfelder einer Frau, die im Jahrhundert der anbrechenden Frauenemanzipation ihren Mann stand, ohne den modernen Tendenzen Verständnis entgegen bringen zu können. Hier das – die zahlreichen Aussagen unbestechlicher Beobachter sind da eindeutig - beeindruckende Porträt der Frau als souveräne Gastgeberin und immer elegante und meist elegant kommunizierende Erscheinung, dort ihr Einsatz innerhalb einer (tatsächlich) gleichberechtigten Arbeitsgemeinschaft, ohne die Wagner vermutlich gelegentlich verloren gewesen wäre. Dass es immer wieder kriselte: auch dies wird von Sabine Zurmühl – mit dem Blick der Mediatorin, nicht der Richterin – aufmerksam registriert, wobei das Grundbild der zweiten Ehe und des langen, langen Lebens danach, eher zärtlich als problemdurchsetzt anmutet. Dazugehörend (eines der wichtigsten Kapitel): Cosimas Beziehungen zu Frauen und zu jüngeren Damen der Gesellschaft, wobei ihre Freundschaft zu Helene von Heldburg, also Ellen Franz, der späteren Gattin des Herzogs von Meiningen, am wichtigsten ist. Wird Letztere bei Hilmes nur einmal nebenbei erwähnt, hat Zurmühl der Geschichte von Cosima und Ellen einige wichtige Seiten eingeräumt, die – nach der Lektüre der vor einigen Jahren publizierten Briefe – unser Bild von ihr wesentlich vertiefen. Dafür erwähnt Sabine Zurmühl Judith Gautier, der Wagner heimlich exaltierte Briefe und Mitteilungen schickte, nur einmal kurz; Mathilde Maier kommt gar nicht vor, obwohl ihr Wagner noch nach dem legendären Bündnisversprechen, das ihn, so die Erzählung in Mein Leben, für immer an Cosima band, einen Eheantrag machte.
Ist das wichtig? Liest man Zurmühls quellenmäßig reich ausgestattete Studien, die auch unpubliziertes Material ausbreiten, kann man sich als informierte Leserin selbst einen Begriff von einem Leben machen, das zwischen Trauer und Freude, Hingabe und Eigensinn, Liebe und Kühle seltsam changierte. Nach den Hagiographien des frühen 20. Jahrhunderts, Franz Wilhelm Beidlers Cosima-Jugend-Geschichte und Hilmes‘ Draufsicht ist Zurmühls Beitrag der Beweis dafür, dass sich über komplexe und produktive Persönlichkeiten immer noch Neues sagen lässt – vorausgesetzt, man verbindet analytische Tiefenschärfe mit jenem Verständnis, das bestimmte Eigenschaften einer Person so genau wie menschenfreundlich, dabei nicht blind für Verwerfungen, sichtbar macht. Keine Frage: Wer Cosima Wagner kennen lernen will, sollte dieses Buch studieren – nicht zuletzt aufgrund des Nachworts von Monika Beer, das sich zu einem biographischen Essay par excellence ausweitete.
Böhlau Verlag, 2022. 359 Seiten, 39 Abbildungen. 40 Euro.
Frank Piontek, 10.8. 2022

Wer glaubt mit dem aktuellen Buch von Ludwig Steinbach ein Buch über Gesangstechnik in der Hand zu halten, wird schnell feststellen, dass dem nicht so ist.
In elf Essays beschäftigt sich Musikjournalist und Opernkritiker Ludwig Steinbach mit verschiedenen Themen der Musik- und Theaterwelt.
Den Anfang macht ein Essay über die sog. „italienische Gesangstechnik“. Wer die Rezensionen von Ludwig Steinbach kennt, der weiß, dass darin häufig gesangstechnische Bewertungen und Empfehlungen zu lesen sind. Hier versucht der Autor das Wesen dieser Gesangstechnik zu erläutern, was z.T. nur gelingt und manche Vergleiche etwas abenteuerlich („die Brustwarzen werden herausgezogen“) anmuten.
Auch wirken viele Aussagen reichlich dogmatisch, was in der Ausbildung einer Stimme von jeher gefährlich sein kann. Jede Gesangsstimme ist anders veranlagt und es gibt immer wieder Ausnahmen, die z.B. sehr früh schweres Repertoire bewältigen können. Ebenso gibt es vielerlei technische Ansätze, um eine Stimme zu schulen. Steinbach vermittelt den Eindruck, als wäre die sog. „italienische Gesangstechnik“ alternativlos, was unzutreffend ist.
An dieser Stelle zwei Empfehlungen. Bariton Mauro Augustini, Schüler von Mario del Monaco, zeigt in zahllosen Beispielvideos auf youtube, wie einfach technisch richtiges und gesundes Singen sein kann. Ebenso zu erleben bei dem fabelhaften Gesangspädagogen Hans-Josef Kasper.
Steinbachs Beispiele sind dabei subjektiv und nicht immer treffsicher. Auf der einen Seite werden da reihenweise Sänger namentlich genannt, die stark gescholten werden. Als Beispiel sei hier Norman Bailey erwähnt, dem ein tremolo behafteter Gesang vorgeworfen wird, was nicht richtig ist.
Dann wieder ergeht sich der Autor lediglich in Andeutungen aktueller Sänger, ohne diese beim Namen zu nennen. Warum so mutlos an dieser Stelle? Unverständlich.
Spas Wenkoff wird da auch von ihm negativ erwähnt, der als Tannhäuser in Bayreuth seine Mühen gehabt haben soll. Dies ist jedoch völlig unzutreffend, da dieser immer noch unterschätzte Sänger im zitierten Bayreuther Mitschnitt eine sängerische und darstellerische Ausnahmeleistung an den Tag legt, von der wir heute nur träumen können.
Wenkoff war ein, vor allem auch gesangstechnisch, vorbildlicher Tenor mit einer sensationellen Atemtechnik, die es ihm ermöglichte, rekordverdächtig lange Phrasierungsbögen zu gestalten. Auf dieser Grundlage überanstrengte er niemals seine Stimme und behielt seine stimmliche Unverbrauchtheit bis zu seinem Karriereende.
Dazu dann gerade Jonas Kaufmann als besten Sänger für den Bacchus zu nennen, neben James King und Rudolf Schock, kommentiert sich fast von selbst. Es sind gute Interpreten, doch die besten Interpreten liegen etwas weiter zurück in der Vergangenheit, wie z.B. Max Lorenz, Helge Rosvaenge, Hans Hopf oder Peter Anders. Weniger weit zurückgeblickt, dann gehören sicherlich auch Ben Heppner und Johan Botha dazu.
Und Rudolf Schock, wenn auch überraschend gut als Bacchus in der Karajan Aufnahme (für die ursprünglich der junge Gedda geplant war), ist nun wahrlich kein Beispiel für technisch makellosen Gesang. Der beliebte Künstler war eher ein Exempel dafür, wie robust seine stimmlichen Kompensationsmechanismen waren, um seine technischen Defizite, wie überstarker Kehldruck oder schiefe Mundstellung auszugleichen.
Vielerlei Empfehlungen gibt es für Gesangsfreudige, allein sie zielen etwas am heutigen Theateralltag vorbei. Dort sitzen primär unkundige Entscheider, die eine Stimme nicht wirklich beurteilen können, Sänger nach visueller Eignung engagieren, die widerspruchslos jeden szenischen Schwachsinn mitmachen. Für die stimmliche Entwicklung eines Sängers gibt es nur ein geringes Interesse, denn auch der Sänger ist ein „Wegwerf-Artikel“ geworden.
Über den „kulturpolitischen Auftrag der Theater“ schreibt Steinbach im nächsten Essay. Eine seiner verschiedenen Kernaussagen ist hier die Empfehlung nach provokanten Inszenierungen, damit Theater auch weiterhin Sinn macht.
In meinen Augen ist das ein verfehlter und sinnbefreiter Gedanke, denn wenn Theater Provokation nutzen muss, um fehlende Qualität zu kompensieren, dann ist der Auftrag, ein Werk sinngebend und für ein Publikum nachvollziehbar zu erzählen, völlig verfehlt.
Fasziniert berichtet der Autor von den biographischen Spuren der Anneliese Franz.
Wer war das?
Hier handelt es sich um jene Frau, die in der Oper „Die Passagierin“ von Mieczyslaw Weinberg die KZ-Aufseherin Lisa ist. In vielen, teils bedrückenden Details, zeichnet Steinbach den vielschichtigen Lebensweg der Anneliese Franz nach. Ein wichtiges, lesenswertes und erschütterndes Essay!
Nach dieser schweren Kost folgt eine Hommage an Gottlob Frick. Frick, der „König der Bässe“, ist immer noch lebendig, zumindest in vielen Erinnerungen und Tondokumenten und vor allem durch die Gottlob Frick Gesellschaft, die jährlich viele Sänger zusammenruft, um Gottlob Frick zu gedenken. In vielen Lebensbeispielen zeichnet Steinbach ein eindrückliches, berührendes Portrait von Frick, angereichert von vielen Impressionen aus dem Leben des großen, bescheidenen Sängers.
Im Gegensatz zu Gottlob Frick dürften die wenigsten Musikfreunde den Tenor Adolf Wallnöfer (1854-1946) kennen. Ihm ist ein weiteres Essay gewidmet. Tenor Wallnöfer begann als Bassist, bevor er zum Tenor mutierte und entwickelte eine starke Spezialisierung auf die Werke Richard Wagners.
Spannend ist daran vor allem, dass es im langen Leben des Tenors tatsächlich zu persönlichen Begegnungen und zahlreichen Spaziergängen mit Richard Wagner selbst kam. Faszinierende Zeitzeugnisse weiß Steinbach zu berichten, so wurde Wallnöfer von Wagner in die sog. „Nibelungen-Kanzlei“ berufen. Im Kern ging es darum, mit anderen Kollegen die „Siegfried“ Partitur abzuschreiben. Als Tenor absolvierte Wallnöfer eine beeindruckende Karriere. Doch nach Bayreuth wurde er niemals engagiert.
Amüsant liest sich das Essay „Beckmesser – Rehabilitierung eines Stadtschreibers“. Dieser Abschnitt des Buches ist besonders gelungen, weil er dezidiert aufzeigt, wie vielschichtig sich diese faszinierende Rolle in ihren Auffassungen weiterentwickelt hat. Große Interpreten der Vergangenheit wie Karl Schmitt-Walter, Klaus Hirte, der unvergessene Herman Prey bis hin zu Michael Volle ziehen am Leser vorbei und werden en Detail charakterisiert.
Drei weitere Essays beschäftigen sich mit musikalischen Aspekten verschiedener Wagner Opern. So beleuchtet Steinbach „Wagners versteckte Mathilde-Wesendonck-Anspielungen in den Meistersingern“. Die Rede ist hier u.a. vom Wälsungen Liebes-Motiv, das u.a. im ersten Aufzug bei Davids Worten „neue Weise“ in der Oboe erklingt.
Weiter geht es mit „Tristan im Ring“, der sich im „Siegfried“ entdecken lässt.
Steinbach huldigt so dann dem „Trauermarsch“ aus der „Götterdämmerung“. Der Autor zeichnet hier eine treffliche Analyse dieser wunderbaren Musik und versucht, eine stilistische Einordnung zu geben.
Apropos Hommage: Hans Knappertsbusch und „Parsifal“ waren und sind eine perfekte Kombination! Ludwig Steinbach rekapituliert mit Detailkenntnis und Begeisterung die singuläre Bedeutung des Meister-Dirigenten.
Eine nette Idee des kurzweiligen Buches ist das abschließende Loblied auf die Opern DVD!
Natürlich kann dieses Medium die Entwicklung des Genres Oper einfangen und die vielen szenischen Irrwege vieler geltungssüchtiger Möchtegern-Inszenierungen belegen.
Steinbach ist begeistert von progressiven Machwerken, wie z.B. der grässliche „Tannhäuser“ aus Bayreuth in der Bearbeitung von Sebastian Baumgarten. Na ja .....
Vor allem aber kann die Opern DVD eindrücklich aufzeigen, was alles verloren gegangen ist! Gelungene Inszenierungen von Größen wie Jean-Pierre Ponnelle, Götz Friedrich oder Walter Felsenstein zeigen, wie verdichtet Oper wirkt, wenn Szene und Musik miteinander agieren.
Nicht zu reden von den vielen wunderbaren Sänger Zeugnissen, die deutlichst belegen, wie viel besser früher gesungen (Gesangstechnik) wurde und dass dies nicht autosuggestive Vergangenheitsverklärung ist, sondern schlicht stattgefundene Realität.
Alles in allem bietet das Buch von Ludwig Steinbach erbauliche Lektüre mit viel Informationswert.
Dirk Schauß
8. Juni 2022
Plädoyer für Wiener Volksoper und Musical

Gut gelaunt, ebenso informiert und stets ausgewogen hat sich Dramaturg, Übersetzer, Autor, Moderator und sonst noch vieles Christoph Wagner-Trenkwitz, bereits durch eine ansehnliche Reihe von Büchern vor allem über Oper bekannt, nun des Musicals angenommen und zwar dessen Geschichte an der Wiener Volksoper, deren Dramaturg er zur Zeit ist. Willkommen, bienvenue, welcome heißt das Werk, welcher Titel den Nagel und dessen Kopf erst einmal glatt zu verfehlen scheint, denn mit hochnäsigem Argwohn sah man zunächst an der Donau walzerselbstbewusst auf den Eindringling aus USA herab. In drei umfangreiche Kapitel ist das Buch gegliedert, und das erste davon widmet sich Marcel Prawy und dessen Bemühen um die neue Gattung Musiktheater, die er als Emigrant und Sekretär des Sängerpaars Martha Eggert und Jan Kiepura im amerikanischen Exil kennen gelernt hatte. 2007 blickte die Gattung auf ein halbes Jahrhundert Geschichte an der Volksoper zurück, beginnend mit einem Gastspiel von Kiss me, Kate, dazu gab es ein Buch, das nun überarbeitet, gestrafft und um weitere 15 Jahre erweitert, wieder vorliegt.
Legendär waren die Staatsopernmatineen und die Fernsehsendungen von Prawy, die so von grenzenloser Liebe zum Sujet und von so viel Wissen darum geprägt waren, dass zumindest die wohl letzte, aber vor einem Interview für den Orpheus selbst erlebte über Die Frau ohne Schatten der Rezensentin und ihrer Tochter unvergessen ist. Missionarisch ist der Einsatz Prawys für das Musical zu nennen, beginnend 1952 mit Shows mit Melodien aus der Gattung, erwähnenswert die Entdeckung des ersten Stars, Olive Moorfield, der ersten Musicals wie Kiss me, Kate 1956, Wonderful Town, Annie, get your gun 1957 und Porgy and Bess, nach Prawy, der sich auch als Übersetzer betätigte, der amerikanische Boris Godunov. Zu jedem Stück gibt es nach der Rezeptionsgeschichte auch Auszüge aus den damals erschienenen Kritiken und Erlebnis- und Erinnerungsberichte von Mitwirkenden. Da tauchen oft ganz unverhofft Namen auf, die man nicht in diesem Zusammenhang erwartet hätte, so der Italo Tajos oder Max Lorenz‘ und Bernd Weikls, und der deutsche Leser fragt sich, ob ablehnende Kritiken mit Vokabeln wie „landfremd“, „negroid“, „minderwertig“ in Deutschland auch möglich waren, will das aber nicht ausschließen.
Besonders interessant ist im Zusammenhang mit der Aufführung von West Side Story der Briefwechsel zwischen Bernstein und Prawy, des Ersteren Besuch einer Vorstellung in der Volksoper, durchgehend ist von einer Konkurrenz mit dem Theater an der Wien die Rede, wobei dieses oft flinker war als die Volksoper, wenn es um Wiener Erstaufführungen ging. Showboat und Carousel sind in den frühen Siebzigern die letzten Premieren der Ära Prawy, die als eine der ruhmreichsten im Gedächtnis bleiben wird, diese Einsicht dem Leser zumindest in so flüssiger, gefälliger, wie zugleich kenntnisreicher Art nahe gebracht wird.
Im zweiten Kapitel zusammengefasst sind die Jahre 1973 bis 2007 mit dem Intendanten Karl Dönch beginnend und, ab 2007, mit Robert Meyer endend, dem ab September dieses Jahres Lotte de Beer folgt. Oft taucht in diesen Jahren der Name Dagmar Koller auf, die nicht nur 23 Jahre lang Eliza Doolittle ist, ebenso der Heinz Maraceks oder Eberhard Waechters. My fair Lady, Hello, Dolly, La Cage aux Folles und der Mann von La Mancha mit zumindest auf dem Foto schlecht nachvollziehbarer Wandlung Meyers vom Knecht zum Ritter werden erwähnt und mehr als das, Mario Adorf muss feststellen, dass er nicht für das Musical taugt. Dieses und vieles, vieles mehr wird unterhaltsam geschildert und erweckt im Leser den Wunsch, sich selbst einmal von den Musical-Qualitäten der Volksoper zu überzeugen, und das, obwohl ihm die Gattung als solche, denkt er an Massenproduktionen wie unlängst die Eiskönigin, eigentlich zuwider sind. Wagner-Trenkwitz macht deutlich, dass man sich an der Volksoper dessen bewusst war, was „klassisches Musical“ und was dieses halt nicht und damit zu vermeiden ist. Gigi, Anatevka und The Sound of Music gehörten jedenfalls zu den Klassikern, auch wenn letzteres erst durch Amerikaner den Wienern als aufführungswert bekannt gemacht. Interessant ist auch die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Möglichkeiten, die Stimmen zu verstärken, und ein weiteres Mal tröstet es den Nicht-Musical-Freund, dass die Art des Singens in Musicals, der sogenannte Musical-Twang, durchaus kritisch gesehen wird.
In der langen Ära Meyer kommen Guys and Dolls, South Pacific, Die spinnen, die Römer, Candide, um nur einige zu nennen, auf die Bühne der Volksoper, die aber weiterhin auch ein Theater für Oper, Operette und Ballett bleibt und bleiben wird. Die letzten Jahre der Ära Meyer sind gekennzeichnet durch die Schwierigkeiten, in die immer wieder kehrende Lockdowns die Theater stürzen. Sweet Charity und Into the Woods wie auch Lady in the Dark leiden darunter, in der ersten Spielzeit von Lotte de Beer wird es keine Musicalpremiere an der Volksoper geben, aber Wagner-Trenkwitz dürfte ein Garant dafür sein, dass es nicht vergessen wird.
Im Anhang findet der Leser Premierenverzeichnis, Literaturverzeichnis, Bildnachweis und Namenregister
255 Seiten
2022 Amalthea Signum Verlag, Wien
ISBN 978 3 99050 224 2
Ingrid Wanja
Göttinger Händel-Beiträge
Händel lebt
 Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“.
Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“.
Auch in diesem Jahr sind die Vorträge, die in dem gut hundertseitigen Band miteinander vereint sind, von großer Vielseitigkeit, vereinbaren Politisches mit Ästhetischem, Ökonomisches mit Ethischem und lenken das Auge des Betrachters mit dem Cover auf den in Barockes gekleideten Unterleib eines Mannes und einer Frau, womit aber nichts Anstößiges verbunden ist. Im Innern darf man sich das Bild in seiner Gesamtheit anschauen, es stellt den Kastraten Farinelli mit seiner Lieblingskollegin, mit Pagen und Hund und außerdem dem wohl meistbenutzten Librettisten der Händelzeit und auch noch danach dar: Pietro Metastasio.
Der erste Artikel, eine Einführung in das Symposium von 2021, stammt von Laurenz Lütteken und befasst sich mit der Oper als Geschäft zu Händels Zeiten, schildert das Verhältnis von Komponist und Impresario zueinander, das Verhältnis der Oper zur Frühaufklärung und das von materiellem Einsatz und sinnlichem Vergnügen.
Wolfgang Sandberger aus Lübeck befasst sich mit der in den Zwanzigern einsetzenden Händel-Bewegung, beginnend mit einer stark gekürzten Rodelinda in deutscher Sprache, die auf über zwanzig Bühnen nachgespielt wurde und sich durch eine abstrakte Bühne und die Einbeziehung choreographischer Elemente hervortat. Der Verfasser führt anschaulich aus, warum Händel als „unbelastete Identitätsfigur“ angesehen werden konnte, wie es zu Vermutungen über eine Verwandtschaft mit dem Expressionismus und eine Gegnerschaft zum Jazz kommen konnte. Anschaulich gestaltet ist der Artikel durch zahlreiche Abbildungen von Händel-Produktionen der Zwanziger, nicht selten von monumentaler Art wie in Hannover in einer riesigen Halle, einem Alexander Balus mit 910 Mitwirkenden. Als das Interesse nachlässt, wird 1931 die Göttinger Händelgesellschaft gegründet, hier hat „Völkisches“, haben aus SA-Bataillonen bestehende Statistenmassen keinen Platz. Der Leser wird mit einer Fülle von Beispielen für Hänel-Aufführungen konfrontiert, eine übersichtliche Tabelle der in Göttingen tätigen Händel-Forscher und Händel Interpretierenden erleichtert es, den Überblick zu behalten.
Von Matthew Gardner stammt der Beitrag über Sängerinnen und Sänger zur Händelzeit, über den Einzug der italienischen Oper in London. Sehr anschaulich wird darüber berichtet, wie Opern für bestimmte Sänger geschrieben, bei Neuverpflichtungen entsprechend umgeändert wurden, wie nach dem Sänger, was die Wichtigkeit angeht, der Librettist und erst dann der Komponist kam. Und man möchte hinzufügen, dass der Regisseur gar nicht vorkam. Hier und auch anderswo wird auf die Wichtigkeit der Royal Academy of Music hingewiesen, deren Verbindung zu Händel, die Bedeutung von Benefizkonzerten für Sänger, meistens die dritte Aufführung einer Reihe.
Philine Lautenschläger aus Berlin befasste sich mit dem Verhältnis zwischen Sensualisierung und Kommerzialisierung, dem Widerstand der Engländer gegen die italienische Oper nicht nur wegen der Fremdsprache, sondern auch wegen des Kontrastes zu aufklärerischen Ideen. Dem Leser wird es bewusst gemacht, welchen Stellenwert die Oper aber auch besaß in einer Gesellschaft, die nicht über die technischen Möglichkeiten des Musikerlebens späterer Zeiten hatte. Die Versöhnung mit der Aufklärung erfolgte schließlich durch die Einsicht, wie stark die Empfindungsfähigkeit durch das Erleben von Musik gesteigert werden konnte. Notenbeispiele aus Rodelinda werden dem Leser zugänglich gemacht.
Panja Mücke informiert in ihrem Beitrag über Oper als Aktienunternehmen, ausgehend vom Impresario Swiney, der mit der Abendkasse das Weite suchte. Ähnliches gab es durchaus auch in der Jetztzeit, so bei einem nie stattgefunden habenden Festival in Taormina, zu dem zwar die Sänger, nicht aber der Veranstalter anreisten. Die Verbindung von Opernimpresario und Glücksspielunternehmer kannte man bereits aus Italien, in England kommt noch die Aktiengesellschaft, allerdings selten mit erzielter Dividende, kommen Subventionen durch das Königshaus dazu. Das alles wird in einer auch dem Nichtwissenschaftler zugänglichen Art anschaulich geschildert, ebenso die Versuche, ein zufriedenes Publikum zu gewinne, so durch zweisprachige Libretti, kurze Rezitative und die Verwendung allseits bekannter Stoffe. Damit wären wir schon beim letzten Beitrag, dem von Thomas Seedorf , und dieser befasst sich mit den Libretti , die oft von Reisen mitgebracht werden, teils Originale, teils Bearbeitungen sind, von denen ein Drittel aus Venedig stammt. Mythologie, Antike, Mittelalter, Boccaccio und Ariost sind die Quellen, wie der heutige Händel-Freund leicht anhand der Spielpläne feststellen kann.
Dem morgen beginnenden Festival kann man nur wünschen, dass es so gut gelingt wie dieses aufschlussreiche und Leselust bereitende Buch.
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 2022
115 Seiten
ISBN 978 3 525 27837 6
Ingrid Wanja
Vitali Alekseenok:
Die weißen Tage von Minsk - Unser Traum von einem freien Belarus
Musik und Revolution
 Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält.
Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält.
Der Leser wird in die Mentalität der Menschen in Weißrussland eingeführt und erfährt zu seinem Erstaunen, dass die Landbevölkerung bis 1974 keine Pässe erhielt, weil man sie in den Kolchosen halten wollte, nimmt davon Kenntnis, dass Akkordeon und Posaune die ersten Musikinstrumente im Leben des Verfassers waren und dass er seine Ausbildung am Minsker Konservatorium erhielt. Ist der Leser so weit gekommen, hat er auch schon mit dem größten Ärgernis des Buches Bekanntschaft schließen müssen, der gendergerechten Sprache, die zu Ungetümen wie folgenden führt: „Da die_der Dirigent_in die_der einzige offensichtliche Teilnehmer_in an der Veranstaltung war, waren meine Kolleg_innen und ich die einzigen, die große Anerkennung für den Chor bekamen.“ Das zieht sich natürlich durch das ganze Buch hin und kostet den Autor nicht wenige Sympathien und einige Aufmerksamkeit, ist sogar dem Rechtschreibprogramm, wie man anhand der roten Striche sieht, ein Ärgernis.
Trotzdem liest man mit Interesse über Wahlfälschungen bereits im Jahre 2004 und Proteste dagegen, über „Zwangsanstellungen“ für in Weißrussland Ausgebildete, der man nur durch eine Weiterbildung in Russland entgehen konnte und über den „belarussischen Minderheitskomplex“, die Angst vor Identitätsverlust und dem der Muttersprache, die durch das Russische verdrängt wurde.
Neuer Unmut macht sich breit, als Corona von Staats wegen geleugnet wird, die bevorstehenden Wahlen nichts Gutes ahnen lassen, da Gegenkandidaten gegen Lukaschenko zwar zugelassen, aber behindert werden, so massiv, dass mehrfach Frauen die Stelle der verfolgten Ehemänner einnehmen; man erinnert sich an die vielen jungen Weißrussinnen, die Demonstrationszüge anführten.
Kurz vor den Wahlen hält es den jungen Dirigenten nicht mehr in Deutschland, er erlebt ein Weißrussland, in dem Hupen, Klatschen und weiße Armbänder zu Protestzeichen gegen Unterdrückung und beargwöhnter Wahlfälschung geworden sind, das Protestlied „Veränderungen“ zur Hymne des Widerstands wird. Es folgen viele bedrückende und empörende Berichte von Verhaftungen, Folterungen und sogar Morden durch die Staatsgewalt, die natürlich nicht nachprüfbar, aber sehr wahrscheinlich sind, so wie sich dem Autor auch bei einem Besuch des KZs Erhellendes über die Banalität des Bösen ergibt.
Einige wenige Fotos dokumentieren den persönlichen Einsatz von Alekseenok für die Freiheitsbewegung in seinem Heimatland, der Protestplakate anfertigte, vor allem aber als Musiker, als Chor- und Orchesterleiter unter anderem mit „Va pensiero“ seine Solidarität bezeugte und mit dafür sorgte, dass ganz spontan und dezentralisiert immer und überall Konzerte oder Lesungen stattfanden, die bewiesen, dass die Freiheitsbewegung sich noch nicht geschlagen gegeben hatte. Am 16.8. findet noch einmal ein gewaltiger Protestmarsch gegen die Wahlmanipulationen und die Übergriffe des Staates auf friedliche Bürger statt- mittlerweile hört man nichts mehr aus Weißrussland, was Anlass zur Hoffnung gibt. Allerdings dürfte die auffallende Zurückhaltung des Machthabers im Krieg gegen die Ukraine auch auf dessen Einsicht darin zu sehen sein, dass er nicht auf die Unterstützung seines Volkes bauen kann. Bemerkenswert ist die große Bedeutung der Kunst, insbesondere der Musik bei dem Versuch, auf friedlichem Wege Entschlossenheit und Opferbereitschaft zu zeigen, wenn es um Freiheit und Selbstbestimmung geht. Aus diesem Grund und weil der Verfasser ein Musiker mit einer bereits beachtlichen Karriere ist, dürfte auch der Musikfreund an ihm interessiert sein.
Vitali Alekseenok ist Preisträger des MDR Dirigentenwettbewerbs, arbeitete in Weimar, Karlsbad, Jena, Lemberg, ist Gründer und Leiter des ensemble paradigme und Chef des Abaco-Orchesters der Universität München.
Am Schluss des Buches befindet sich eine ausführliche chronologisch Übersicht über die Ereignisse der Weißen Tage von Minsk.
Das Vorwort zum Buch stammt von Valzhyna Mort, Dichterin und Professorin an der Cornell University.
190 Seiten, Fischer Verlag 2021
ISBN 978 3 10 397098 2
Ingrid Wanja
Michael Meyer:
Moderne als Geschichtsvergewisserung
Musik und Vergangenheit in Wien um 1900
Schwierige, aber gewinnbringende Kost
 Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.
Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.
Die Einleitung beruft sich auf Robert Musil und die Meinungen seiner Romanhelden über Kultur als gleichzeitigen Reichtum und gleichzeitige Last, auf das zur damaligen Zeit herrschende Gefühl von Kultur, an der Wien so überreich war und ist, zugleich von Reichtum und Last, an die Furcht vor Identitätsverlust angesichts vieler Neuerungen, nicht zuletzt in der Stadtarchitektur. Eindrucksvoll wird das Schwanken zwischen dem Bemühen um Geschichtsvergewisserung und Traditionsbruch geschildert, ein Überblick über bisher zum Thema erschienene Literatur gegeben.
Im Kapitel über sein Vorgehen berichtet der Verfasser zunächst nachvollziehbar über die von ihm verschmähten Methoden, bekennt sich zur Freude des Lesers zur klassisch historisch-hermeneutischen Betrachtungsweise, die er in den drei folgenden Kapiteln Urbanität und Fortschritt, Geschichte und Erneuerung und Distanz und Auflösung anwendet.
Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen steht nicht nur die Musik, sondern auch die Gebäude, in denen sie erklingt, werden berücksichtigt, also das Konzertgebäude des Musikvereins und das Konzerthaus. Außerdem finden die großen Ausstellungen und Gedenktage die ihnen gebührende Beachtung, so die Jubiläumsfeiern für Schubert (1897) und Haydn (1909) und die große Internationale Ausstellung für Musik- und Theaterwesen. In den Gebäuden, das eine im „griechischen Renaissance-Stil“, das andere im Empire-Stil errichtet, sah man durchaus „klassische Musik fürs Auge“. Arbeitersinfoniekonzerte werden als Versuch einer neuen Klasse gesehen, neben Adel und Bourgeoisie Teilhabe an der Kultur zu gewinnen, Der Rosenkavalier entpuppt sich gleichzeitig als Verklärung und als Quelle der Erneuerung und zugleich als Ironisierung. Die zweite, die Wiener Fassung der Ariadne auf Naxos, greift ebenfalls indirekt in die Auseinandersetzung um die Rolle der Kultur mit ein.
Für den willigen, aber nicht bereits auf das Thema spezialisierten Leser ist es nützlich, die vielen Hinweise auf bereits erschienene Sekundärliteratur außer Acht zu lassen und dem enger auf das Sujet bezogenen Roten Faden durch das Buch zu verfolgen, allerdings nicht ohne die aufschlussreichen Abschnitte über die Deuter des Geschehens aus der Zeit selbst wie Eduard Hanslick, Robert Hirschfeld oder Guido Adler zu vernachlässigen. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr interessant zu erfahren, dass die deutschen Arbeiterführer Lassalle und Karl (!) Liebknecht eine idealistische Kunstauffassung vertraten.
Schon beinahe belustigend sind die erbitterten Kämpfe um die Deutungshoheit über den Wiener Walzer als Identitätsstifter und Zankapfel zugleich, das Phänomen, dass dieser zum Beispiel im zur Zeit Maria Theresias spielenden Rosenkavalier eine bedeutende Rolle spielt, obwohl er damals noch gar nicht existierte. Der Verfasser betrachtet auch die Rezeptionsgeschichte des Ballett-Divertissements „Wiener Walzer“, das als „Produkt des Aufblühens der modernen Geschichtskultur“ angesehen wurde, während mit der Haydn-Ehrung die Erinnerung an die Schlacht bei Aspern verbunden wurde, den ersten Sieg Österreichs über Napoleon.
Hochinteressant ist die Zweiteilung der Meinungen über die Stellung der sogenannten „Wiener Moderne“, die einerseits als ein Wiederaufgreifen musikalischer Gesetze aus der Renaissancemusik gesehen wird, sich über ein Urteil wie das von Hanslick hinwegsetzend, für den Musik erst mit Händel und Bach interessant zu werden schien. Das ist nach Meyer jedoch nicht der einzige Grabenkampf nicht nur in der Wiener Gesellschaft, sondern genauso gespalten ist man auch in der Einschätzung der Wissenschaft und ihrer Erkenntnisse, die von den einen als purer Fortschritt, von den anderen als Verlust an Poesie oder gar Profanierung des Heiligen angesehen wird. In diesem Zusammenhang wird dann auch die Legitimierung der „Moderne“ in dem „Rückbezug auf ältere Musik“ gesehen. Mit unendlich vielen Beispielen weiß Meyer seine Thesen zu untermauern, den Leser bereichernd, aber manchmal auch überfordernd, der schmunzelnd feststellt, dass auch damals schon Der Merker ein Wörtchen bei der Auseinandersetzung um klassische Musik mitzureden hatte.
Im Mittelpunkt des Kapitels III steht dann die Operette Alt-Wien, die gleichermaßen Nostalgie und Spott auslöste, und der Leser erfährt schmunzelnd von der alten Fürstin Metternich, die im Walzer die machtvolle Waffe gegen die sich ausbreitende Tangoseligkeit sah.
Stefan Zweigs Zehn Wege zum Deutschen Ruhm und andere Beispiele zeigen, mit wie viel Esprit und feinem Florett diese Kämpfe ausgefochten wurden, nicht nur literarisch, sondern auch musikalisch mit einer Verhohnepiepelung der Kaiserhymne, was mit vielen Notenbeispielen nachgewiesen wird. Als Leser weiß man nicht, ob man die Österreicher dafür beneiden oder bemitleiden soll, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch all der Kaiser-Vielvölker-Kultur-Herrlichkeit mit so großem Engagement den Kampf um die Deutungshoheit über den musikalischen Geschmack führen konnten, aber eigentlich ging es ja um wesentlich mehr, wie das Buch auch eindrucksvoll zu vermitteln weiß.
Ein umfangreicher Anhang beinhaltet Primär- und Sekundärquellen, Danksagung und Personenregister.
(245 Seiten, Bärenreiter Verlag 2021)
Ingrid Wanja

DIE ERSTEN BAYREUTHER FESTSPIELE 1876. EINE ANTHOLOGIE
„Cette soi-disant musique de l'avenir est vouée à un oubli certain - Diese sogenannte Musik der Zukunft ist dem sicheren Vergessen geweiht“. Albert Wolff, der Redakteur des Pariser Figaro, stand damals nicht allein mit dieser Meinung, ja, liest man sich alle Rezensionen und Berichte durch, die nun in einer Anthologie zu den ersten Bayreuther Festspielen zu finden sind, bekommt der Leser den Eindruck, dass der Chor derer, die nicht an eine Fortsetzung der Festspiele glaubten, größer war als der der Wagnerianer.
Eine Textsammlung zu Wagner ist an sich nichts Neues, viele Quellen und Zeitzeugenberichte wurden noch einmal post festum oder immer wieder publiziert; auch finden wir, im ersten Band von Susanne Großmann-Vendreys umfangreichem Werk zur Presseberichterstattung der Bayreuther Festspiele, die meisten der deutschen Berichte wieder, die Bernd Zegowitz (Autor einer lesenswerten Dissertation über Wagners unvollendete und unkomponierte Opern) nun neben den französischen und englischen kompiliert hat – die meisten, doch nicht alle. Vergleicht man zudem und unmittelbar die Berichte der (oft) begeisterten, manchmal sanft belustigten Erinnerungen der Sängerinnen (z.B. Lilli Lehmann), musikalischen Assistenten (z.B. Felix Mottl), des Chefchoreographen Richard Fricke und anderer Mitstreiter mit den kritischen Berichten der Zugereisten, wird die Diskrepanz zwischen den Produzenten und den Rezipienten offensichtlich – dass die Auswahl zumal der Rezensionen leicht tendenziös gefärbt ist, liegt allerdings, vielleicht, auch daran, dass sich die bösen Tiraden und vor Unverständnis nur so triefenden Meinungen der sog. Fachkritik wesentlich amüsanter lesen als die Elogen der Wagner-Aficionados. Dies gilt selbst und gerade für Idioten wie Eduard Hanslick oder Ludwig Speidel, wobei noch Unterschiede des Tons und der kritischen Begabung auszumachen sind. Beharrte Hanslick starr auf einer klassischen Ästhetik und einer angeblich „natürlichen“ Empfindung dessen, was „richtig“ und „falsch“ sei, so liest man bei Speidel kaum noch Differenzierungen heraus, was nicht ausschloss, dass man von einigen wenigen und meist den selben „Stellen“ (dem Waldweben, dem Schluss der Walküre) angetan sein konnte. Für viele Kritiker war Wagner schlicht und einfach der Schöpfer von „Monstrositäten“, da der Ring in seiner Großform und seiner Stilistik in kein Schema und keine Schublade von 1876 zu packen war. Das Einzige, was den Unmut, ja: den Hass mancher Herren allerdings wenn nicht entschuldigt, doch erklärt, waren die äußeren Umstände, von denen die meisten Berichte zeugen: wer in eine Stadt, eine „weltabgelegene Insel“ wie Julius Hey sie nannte, kommt, in der es für die vielen Besucher kaum genügend Nahrung gibt, wer vor den Aufführungen in Gluthitze eine staubige, schattenlose Alle hinaufsteigt, um dann stundenlang in einem viel zu heissen Saal zu verweilen und sich in den Pausen kaum einen Schluck Wasser erkämpft, ist schlecht gestimmt. Dies gilt damals wie heute. Wolff sprach damals von einer „atmosphère pestilentielle“, was sowohl auf die Temperaturen im Hohen Haus als auf die seltsamen Wagnerianer ging, die neben Wagner nur Wagner selbst anerkannten.
Berühmt wurde Peter Tschaikowskys Bericht weniger aufgrund seiner kritischen Anmerkungen zu Werk und Aufführung als für die Schilderung eben jener Umstände. Ein Plus der neuen Edition besteht darin, dass Zegowitz einige bis dato im deutschen Sprachraum unbekannte Kapitel des Berichts erstmals übersetzen ließ. Zu den Neuigkeiten der Sammlung gehören die Berichte aus dem Englischen, die Texte von Joseph Bennett und einem F.A.S., mit dem der Band versöhnlich schließt, weil der Autor sine ira et studio das Unternehmen wie das Werk gerecht einzuschätzen vermochte. Liest man alle Texte im Zusammenhang, werden Leitmotive sichtbar, die die reale Situation gut treffen: das Defizit mancher Sänger (wie des Siegfried Georg Unger) und Darsteller (die Sieglinde der Josefine Scheffzky war für fast alle Rezensenten furchtbar), die an manchen Stellen unvollkommene szenische Realisation (das Finale, das im Rheingold zu leise Orchester, die leicht bizarre, positiv ausgedrückt: moderne Lichtregie Richard Wagners (der durch die Bogenlampen erzeugte grelle Schein auf manch Protagonisten), der „barbarische Realismus“ der Inszenierung, gegen den sich Isidor Kastan, der geschworene Feind allen Naturalismus auf der Bühne, polemisch verwahrte. Dies lesend, denkt der Opernfreund von Heute: Was hätte der Kritiker wohl zu den heutigen (Wagner-)Inszenierungen gesagt? Schwerwiegender aber ist die Beobachtung, dass Wagner in einem wesentlichen Punkt von so ziemlich niemandem unter den kritischen Kritikern und wohl auch von den wohlwollenden nicht verstanden wurde: dass Wotan nicht „göttlich“ interpretiert wurde – dies ging keinem ein. Dass Wagner mit dem Obergott eine problematische Figur, einen Repräsentanten seines als verderbt erkannten Zeitalters also, ausstellen wollte, mochte und konnte niemand verstehen, auch wenn er die Handlung an sich genau interpretierte. Dass man Wotans Monolog im zweiten Walküre-Akt als zu lang, ja: so überflüssig empfand wie die Wissenswette, verstand sich angesichts der neuen Wagnerschen Epik von selbst. Dass viele Beobachter der sog. Fachpresse (nicht Theodor Helm, der darin schon klüger war als später der Wagner-Kritiker T.W. Adorno) offensichtlich taub waren, als sie die Besonderheiten der Variationstechnik der Wagnerschen Erinnerungsmotive überhörten, entspricht dem Unmut, mit dem sie die Möglichkeit abwehrten, dass noch in Zukunft Opern auch ohne Arien, „klassische“ Duette und Chöre (im vertrauten Schema) so möglich seien wie zu Beginn der Operngeschichte? Dass Wagners Festspiel besonders „national“ und „deutsch“ sei, wurde übrigens von den meisten Kritikern verneint, wenn sie auch Wagners „Tatkraft“, typisch gründerzeitlich, vorbehaltlos anerkannten – ein Hinweis darauf, dass Wagner nicht per se als „typisch deutsch“ (was immer das auch sein mag) klassifiziert wurde und werden kann.
Spannend also, was die Kollegen Helm, Speidel, Spitzer (der berühmte Daniel Spitzer, der „Wiener Spaziergänger“), Gehring, Marr und Lindau (dessen leicht amüsantes Büchlein vor einigen Jahrzehnten nachgedruckt wurde) damals alles herausließen. Kamen hinzu die Berichte der Kollegen Tschaikowsky und Saint-Saëns (hier in französischem Original; die deutsche Fassung ist anderweitig zu haben) – und die Reportagen aus der Werkstatt: nach dem Abschlussbericht Wagners kamen sie vom Requisiteur und Ausstatter Carl Emil Doepler, der der Ungnade Cosima Wagners verfiel, vom „Ballettmeister“ Richard Fricke (dessen erstrangiges Tagebuch in einem Reprintdruck vorliegt), vom Gesangs- und Stimmen-Coach Julius Hey, der die Proben panoptisch zusammenfasste (neuere Editionen liegen in dieser relativen Länge nicht vor), von Lilli Lehmann, Felix Mottl und vom Assistenten Heinrich Porges, dem es gelang, die moralische Klippe, über die der „Held“ in der Götterdämmerung stürzt (die Überwältigung Brünnhildes durch Siegfried), zu umschiffen, indem er sie ignorierte. Zegowitz erwähnt in seinem Vorwort noch einige andere Autoren und seltene Quellen (Nietzsches Freund Erwin Rohde kommt dabei ins Spiel) und gibt einen summarischen Überblick über die ersten Festspiele und ihre Themen, bevor sie selbst in den verschiedenen Stimmen in ihren Variationen erklingen. Viele Texte werden dem Kenner ganz oder zumindest in Teilen bekannt sein, doch zusammen mit den neugefundenen und edierten Raritäten und in der Zusammenschau, mit besonderer Konzentration auf die Praxis der Aufführungen, bilden sie ein Corpus, das so amüsant wie historisch faszinierend, so spannungsreich wie modern anmutet – denn die Frage, wie wir seinerzeit unter den Bayreuther Bedingungen des Jahres 1876 auf den Ring reagiert hätten, kann nur hypothetisch beantwortet werden. Vielleicht hätten ja auch wir Wagners Zukunftsmusik, die heute noch gespielt wird, verflucht.
Die ersten Bayreuther Festspiele 1876. Eine Anthologie (= Wagner in der Diskussion, Bd. 22). Hrg. von Bernd Zegowitz. Königshausen und Neumann 2022. 383 Seiten.
Frank Piontek, 27.3. 2022
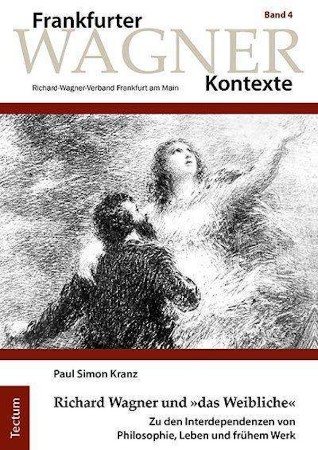
PAUL SIMON KRANZ: RICHARD WAGNER UND ‚DAS WEIBLICHE‘
„Wagners Frauen ist mit der Mutterrolle auch die Lust ausgetrieben worden (immer mit der einen Ausnahme der Sieglinde). Senta entschwindet mit ihrem Holländer sofort in der ewigen Erlösung; Elisabeth stirbt, ohne mit Tannhäuser mehr gepflogen zu haben als ein längeres Gespräch in der ‚teuren Halle‘; Elsa fragt Lohengrin im Brautgemach gleich nach seinem Namen, und alles ist aus […] Ohne Zweifel steckt nicht zuletzt bürgerliche Prüderie in dieser szenischen Lustfeindlichkeit, während nur (nur?) die scheinbar unverfängliche Musik von der Sache selbst redet.“
Man findet diese erhellenden wie pointierten Bemerkungen über Wagners sehr spezifische Art und Weise, die sog. Liebe in seinen Opern auf die Bühne zu bringen, nicht in einem neu anzuzeigenden Buch über „Richard Wagner und ‚das Weibliche‘“, sondern in einem bald vier Jahrzehnte alten, doch immer noch lesenswerten Buch über Richard Wagners erotische Gesellschaft. Damals machte sich Dieter Schickling daran, Wagners Theorien vom Kopf auf die Füße seiner Bühnenwerke zu stellen. Freilich widmete er sich, als er auf die Ähnlichkeiten und die tiefen Widersprüche zwischen Wagners Schriften und Wagners Opern zu sprechen kam, weniger den Traktaten als den Werken und ihren Figuren selbst: mit haltbaren Ergebnissen.
Im Literaturverzeichnis von Richard Wagner und ‚das Weibliche‘. Zu den Interdependenzen von Philosophie, Leben und frühem Werk erscheint Schicklings grundlegender Beitrag zum Thema „„Richard Wagner und ‚das Weibliche‘ / die Frauen / der Sex“ indes nicht. Paul Simon Kranz hat mit seinem Buch die Abschlussarbeit seines Schulmusikstudiums vorgelegt; wir müssen, um ihm gerecht zu werden, den Band als solche und als Einführung in ein Thema betrachten, das in den letzten Jahren relativ fleißig beackert wurde: auch von schicklingschen Nachfolgern wie Henrik Nebelong (der Mann heißt wirklich so), der mit Liebesverbot! Sex und Antisex in Wagners Dramen eine Studie über alle, auch die unvertonten Dramen Richard Wagners vorlegte und zum Schluss kam, dass sich Wagner lebenslang am Thema des Verbots der erotischen Liebe abgearbeitet hat. „Die Motivation dieses Titanen der Künste“, schrieb Wolfgang Eugen Etterich im Waschzettel zu seinem Büchlein mit dem obskuren Titel Richard Wagners sexuelle Autobiographie in der Genitalpassion seines Bühnenwerkes, „ist der Konflikt seiner natürlichen organischen mit seiner zwangsmoralisierten Sexualität“. Kein Wunder also, dass er sich ein „Weib der Zukunft“ imaginieren musste, um seinem Problem Herr zu werden. Paul Simon Kranz erfindet das Rad nicht neu, wenn er Wagners Frauen-Bild (der Wagnerkritiker Herman van Campenhout würde hier von einer „Imago“ sprechen) genauer unter die Lupe nimmt, wobei er methodisch problematisch vorgeht: Denn indem er die frühen Opern einschließlich der Hochzeit mit den Thesen konfrontiert, die Wagner erst einige Jahre nach der Textkonzeption des Lohengrin aufs Papier warf, nimmt er zumal Eine Mitteilung an meine Freunde als Selbstauskunft ernster, als es die zweifellos interessante Selbstsicht des nachschreibenden Autors verdient. Denn Theorie und Praxis gehen bei Wagner in der Regel parallel, selten hintereinander ihren Weg; der reale Anteil, den die Zürcher Schriften in Bezug auf den Holländer, den Tannhäuser und den Lohengrin haben, ist in der Forschung durchaus umstritten, weil sie einen Bewusstseinsstand widerspiegeln, den Wagner weder 1840 noch 1844 noch 1846 haben konnte (dass Wagners Selbstaussagen nicht immer zu trauen ist, sollte sich herumgesprochen haben). Setzen wir einmal dieses grundsätzliche methodische Problem der Parallelisierung zweier nicht zueinander gehörender Zeit- und Werksphären beiseite, haben wir es mit einer eher einschichtigen, am Text orientierten und mit breiten Zitaten der Primär- und Sekundärliteratur (Eva Rieger u.a.) angereicherten Werk- und Figurendeutung zu tun, die eher das Problematische von Wagners zeitgenössischer, tief im 19. Jahrhundert wurzelnder und eher den antiemanzipatorischen und nicht den revolutionären Tendenzen verpflichteter Denkart betont. Kranz wendet freilich ein, dass man Wagner nicht gerecht wird, wenn man eigene, westlichen und modernen Ansichten verhaftete Interpretationsansätze dem Werk und den Schriften überstülpt – so bemüht er sich, relativ vorurteilsfrei Wagners eigene Sicht auf „das Weibliche“ zu schildern und es zumal mit den Figuren seiner drei „romantischen“ Opern und seinem eigenen, summarisch geschilderten Lebensgang und seinen kurz erwähnten Begegnungen mit einigen ausgewählten Frauen zu erläutern. Ob Wagner wirklich eine „Philosophie“ des Weiblichen entwarf, bleibt jedoch fraglich; viel eher könnte man mit Sven Friedrich von einer „Phantasmagorie“ reden, in der „das Weib“ unterm Strich „hingebungsvoll“ zu agieren hat und Mann und Frau nur dann die Chance haben, zusammen „glücklich“ zu werden, wenn sich die Frau dem wie auch immer gearteten männlichen Hegemonialstreben unterordnet (und selbst und gerade, siehe Senta und Elisabeth, nicht einmal dann). Dies ist jedenfalls ein möglicher Schluss aus den Zürcher Schriften, die den frühen Opern – und nicht dem gleichzeitig konzipierten Ring, was logischer wäre – angenähert werden.
Nur noch, zur Ergänzung, einige wenige Beckmessereien: 1. Wenn Kranz behauptet, dass „Richards reale Senta“ den „Namen Cosima“ trug, wird diese Aussage der komplexen Persönlichkeit Cosima Wagners nicht einmal dann gerecht, wenn man „Richards“ Aussagen in dem von Cosima von Bülow / Wagner geschriebenen Tagebuch in Rechnung zieht; abgesehen davon verwundert es, Wagners Vornamen zu lesen – kennt Paul Herrn Wagner persönlich? Zum Zweiten ist die pauschale Entgegensetzung von Venus und Elisabeth – hier die „Heilige“, dort die „Hure“ – in Wissenschaft und Theaterpraxis längst einer differenzierten Sicht auf diese beiden Figuren gewichen. „Auch Venus hat ihre Unschuldsseite“, sagt Henrik Nebelong und verweist auf das Lied des Hirten, bevor Elisabeth ihrer erotisch gefärbten Liebessehnsucht fühlbar Ausdruck gibt. Selbst wenn man mit „Busen“ nicht die neudeutschen „Brüste“, sondern den Oberkörper versteht, bleibt die Aussage (und die Hauptsache, die Musik…) eindeutig: „Wie jetzt mein Busen hoch sich hebet, / so scheinst du jetzt mir stolz und hehr; / der dich und mich so neu belebet, / nicht länger weilt er ferne mehr.“ Singt so etwas eine „Heilige“? Und Venus? „Ha! Kehrtest du mir nie zurück! - / Was sagt' ich? - / Was sagt' er? - / Wie es denken? / Wie es fassen! / Mein Trauter ewig mich verlassen?“ Fleht so eine „Hure“? Zwischen den auf der Wartburg postulierten Gegensätzen von Apollinischem und Dionysischem bestehen denn doch tiefere Zusammenhänge, von denen Wagner selbst sehr genau wusste, wie sie zu komponieren waren. Nicht erst neuere Inszenierungen haben darauf verwiesen, Inszenierungen, die nicht anders sein können als heutig: was sowohl für „normale“ Deutungen als für das sog. Regietheater gilt. Man vermag seiner Zeit nicht zu entkommen – diese Einschränkung beseelt selbst jene Interpretationen, die, in Theorie und Praxis, den „originalen“ Kern der Wagnerschen Schriften und Bühnenwerke herausarbeiten wollen. Kranz ignoriert freilich nicht die Musik; in seinen Musikbeispielen, in denen das „Männliche“ dem „Weiblichen“ entgegengestellt wird, tauchen sogar die Jüngeren Pilger auf – weil sie von Frauen gesungen werden. Dass im Tannhäuser und im Lohengrin eher Männer als Frauen auftreten, verwundert angesichts der „Geschlechterklischees“ der großen Opern der Zeit von 1840 bis 1850 durchaus nicht.
4. Kranz behauptet, dass Tannhäuser „erlöst“ würde. Mir fällt ein Wort von Peter Konwitschny ein, der in Dresden eine hinreißende und tief bewegende Tannhäuser-Inszenierung gemacht hat: „Erlösung gibt es nur dort, wo es keine Lösung gibt.“ Man könnte Wagners Wort vom Lohengrin als seinem „tragischsten Stoff“ auch auf den Tannhäuser beziehen: denn das Finale, das bezeichnenderweise nicht mit einem harmonischen Akkord endet, sondern einfach – endet, verweist auf das Problem gerade dieser seltsamen Endlösung. Wo alle tot sind, ist es merkwürdig, Tannhäusers „Erlösung“ als „das Höchste“ und ihn selbst als „Exempel“ zu bezeichnen, „das hin- und hergereicht wird“. Zum Einen wird der Schluss auf das angeblich Erstrebenswerteste Wagners intrikater und höchst umstrittener musikdramatischer Finaldramaturgie nicht gerecht (kein Wunder, dass er bis zuletzt den Tannhäuser als unabgeschlossen betrachtete), zum Anderen ist Tannhäuser eine autonome Persönlichkeit, die zwar von ihren Interessen und Emotionen zerrissen wird, aber gewiss nicht fremdbestimmt wird – nicht einmal vom Autor, wie wir spätestens seit Tobias Kratzers Bayreuther Inszenierung wissen.
Zuletzt kommt der Leser darauf, dass Wagner offensichtlich Gegensätze zwischen „Männlichem“ und „Weiblichem“, Wagnerwelt und Moderne konstruierte, von denen er als Künstler wusste, dass er sie zur Produktion benötigte. Wie gesagt: Man darf, auch als Wissenschaftler, Wagner nicht immer beim Wort, viel eher bei der Musik nehmen – „Geschlechterklischees“ hin oder her. Denn der Hauptgrund für Wagners nachhaltige und anhaltende Faszinationskraft liegt nicht in seinen schriftstellerischen Thesen, sondern seinen durch Musik gestifteten Bühnenhandlungen. Sagen wir so: Wagners Weiblichkeitsvorstellungen und kein Ende – die Abschlussarbeit kann, mit einigen wenigen eigenen Akzentsetzungen, natürlich, kein Abschluss einer ewigen Debatte sein.
Paul Simon Kranz: Richard Wagner und ‚das Weibliche‘. Zu den Interdependenzen von Philosophie, Leben und frühem Werk (Frankfurter Wagner-Kontexte, Bd. 4). Hrg. vom Richard-Wagner-Verband Frankfurt am Main. Tectum Verlag, 2021. 181 Seiten. 44 Euro.
Frank Piontek, 9.3. 2022
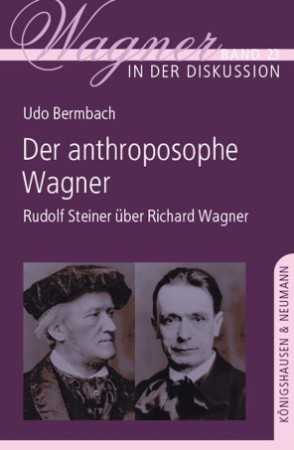
UDO BERMBACH: DER ANTHROPOSOPHE WAGNER. RUDOLF STEINER ÜBER RICHARD WAGNER
Rudolf Steiner hielt zwischen März und Dezember 1905 vier Vorträge in Berlin, die sich ausschließlich mit Wagner „im Lichte der Geisteswissenschaft“, also der Anthroposophie, auseinandersetzten. Im Dezember folgte ein Kölner Vortrag über Parzival und Lohengrin, genau zwei Jahre später, am 2. Dezember 1907, ein öffentlicher Vortrag in Nürnberg, der die Überlegungen zusammenfasste: Richard Wagner und sein Verhältnis zur Mystik. Die Vortragsnachschriften seiner Jünger und Jüngerinnen wurden 1999 im 92. Band der monströsen Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe publiziert: Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen – 70 Seiten, in denen sich der Anthroposoph, der über Alles, Alle und Jeden Bescheid zu wissen glaubte, über den sog. geistigen Gehalt der Opern und Musikdramen äußerte.
Wenn sich Udo Bermbach nun in einem kaum 120 Seiten umfassenden Band mit dem „anthroposophischen Wagner“ befasst, wirkt die Studie wie ein Nachschlag zum umfangreicheren Buch, das er den Lebensreformbewegungen von Anno 1900 gewidmet hat. Der Behauptung, dass Steiners Blick auf Wagner bisher in der Wagner-Literatur nicht bedacht wurde, kann kaum widersprochen werden, weil ein 1994 in einer anthroposophischen Zeitschrift publizierter Artikel keine Referenz ist und ein US-amerikanisches Buch (gedruckt in Seattle, dem Schatzhaus der ultrakonservativen Wagnerbühne) über Steiner und den Ring vermutlich nicht einmal über die internationale Fernleihe zu bekommen ist. Hätte ich meinen Vortrag über Steiners Wagneriana, den ich vor einigen Jahren vor den anthroposophischen Gesellschaften in Bayreuth und Nürnberg hielt, veröffentlicht, hätte man auch hierzulande und außerhalb der engeren Steinergemeinde herausbekommen, dass sich Steiner auch mit Wagner beschäftigt hat. Wichtiger ist die Frage, inwiefern die Wagner-Interpretationen des „versteinerten Rudi“ (wie er von den Anthrosophie-Kritikern lustig genannt wird) an die Forschung anschlussfähig sind. Man könnte, Goethe zitierend und die Rezension abkürzend, schlussendlich Folgendes wiedergeben: „Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“ Denn Steiner hat, so Bermbachs Schluss, Wagner nicht mit dem Handwerkszeug eines skrupulösen Philologen erläutert, sondern sich das aus dem Gebäude gebrochen, was er zur Bestätigung seiner eigenen irren Weltsicht benötigte. Da geht es um die „Wurzelrassen“, die „Eingeweihten“, um „höheres“ Bewusstsein – doch nie um jene Politik, die Udo Bermbach in seinen Büchern als Grund der Wagnerschen Gedanken- und Opernwelt fixiert hat. Treffen sich auch Wagner und Steiner scheinbar in dem, was sie Mythos bzw. Mystik nannten, so entwarf Steiner sein schizoides Weltbild aus einer „Schau“, die schlechthin unhinterfragbar bleiben sollte, womit er in Sachen Persönlichkeit gar nicht so weit entfernt war von Wagner, der immer und überall partout Recht haben wollte – nur, dass sein Humor und sein Genie seine Thesen über Gott und die Welt in großartige Werke gossen. Um Steiners Wagner zu erläutern, genügen Bermbach lediglich 28 Druckseiten – mit sehr breiten Zitaten. Um das Steinersche Gebräu verständlich zu machen, nahm er allerdings die Kärrnerarbeit auf sich, Leben und Werk Rudolf Steiners in einer Monumentaleinleitung so zu zeichnen, dass man den Band jedem, der von neutraler Seite aus an Steiner interessiert ist, als Grundlage empfehlen kann; die zweite, jüngere Rowohlt-Monographie wurde ja leider, wie die erste, von einem Anthroposophen, also einem Betroffenen geschrieben. Erst Helmut Zander hat 2011 eine unabhängige Biographie vorgelegt.
Die Sache scheint klar: Steiners Wagner war nicht der „wahre“ Wagner der Politikwissenschaftler und Historiker, sondern der unbeweisbare Wagner einer obskuren, wissenschaftlichen Kriterien hohnsprechenden „Geisteswissenschaft“. Und doch ist der Fall Steiner interessanter, als es Bermbach suggeriert: denn einige Interpretationen, die er zumal dem Parsifal angedeihen ließ, klingen weniger verrückt als seine pseudohistorischen, aus diversen theosophischen Quellen und Science-Fiction-Romanen gewonnen „Erkenntnisse“, die sich vor allem in seinen Ring-Betrachtungen niederschlugen („Sagen, in denen das Geschick desjenigen Volksstammes lebte, der nach der großen atlantischen Flut als Reste der atlantischen Bevölkerung über Europa und Asien sich verbreitete und die nachatlantische Epoche einleitete“), ja: zieht man das eindeutig anthroposophisch-christologische Element ab, haben wir es – auch Bermbachs Zitate lassen darüber keinen Zweifel – mit einer durchaus akzeptablen Parsifal-Deutung zu tun. Beobachtungen wie jene, dass Wagner im Rheingold-Vorspiel den „Einschlag des Ich-Bewusstseins“ in die reine Natur komponiert und dargestellt habe, sind gleichfalls diskutabel, stehen auch nicht allein in der Wagner-Interpretationsgeschichte – auch wenn Wagner sich nie en detail zu den einzelnen Episoden des Vorspiels geäußert hat. Das „Aufrücken in neue Bewusstseinszustände“ ist schon im Steinerschen Lohengrin eine Deutung, die Henning von Gierke, der Bühnenschöpfer der Bayreuther Lohengrin-Inszenierung von 1987, der kein Anthroposoph ist, als Zentrum seiner beeindruckenden Bilddeutung ausmachte. Will sagen: Wagners Musik, über die zu schreiben möglich, aber latent sinnlos ist, bietet tiefere (und wenn nicht dies, so zumindest weitere) Interpretationsmöglichkeiten als seine Schriften, die, so Bermbach, das Rüstzeug für eine einzig „richtige“ Wagnerdeutung geben würden. Der Ruf nach Rekonstruktion der „ursprünglichen Intentionen“ Wagners verkennt, dass Absichten nicht immer mit Wirkungen identisch sind, wohl auch nicht sein können.
Man muss sich also angesichts von Bühnen- und von Theoriewerk nicht eigens fragen, wieso sich die besten Köpfe nach wie vor nicht einig sind über bestimmte Begriffe und Thesen Richard Wagners. Der kürzlich verstorbene Richard Klein hat 1998 in einem Aufsatz über Bermbachs politischen und linken Wagner eingewandt, dass dessen „Konzessionslosigkeit“, die „Schriften Wagners als Dokumente einer politischen Theorie und Ästhetik so ernst wie kaum ein Interpret vor ihm“ zu nehmen, einen Preis nach sich ziehe: „Die Brüche, die Schieflagen zwischen Programm und Werk, Projekt und Phänomen werden nicht zum Thema, geschweige denn zum Problem“. Nicht, dass Steiner in seiner Verschwurbeltheit eine Alternative darstellt oder einen grundsätzlich probaten Weg zu Wagner geöffnet hätte; dafür war sein verschrobenes Weltbild aufgrund seiner schizoiden Störung denn doch zu pathologisch. Gleichwohl enthalten auch seine Vorträge, die Programm und Werk sehr eigentümlich, wenn auch oberflächlich und tendenziös darstellen, noch Spuren von vertretbaren Schlüssen – vorausgesetzt, man akzeptiert u.a., dass nicht alles in den Schriften, sondern das tatsächlich Unsagbare im Wesentlichen: der Musik (die bei Bermbach keine Rolle spielt), enthalten ist. Der Rest bleibt ein wenig Wahrheit und viel Fantasy – und Wagners und Steiners gemeinsames, wenn auch mit den verschiedensten Mitteln verfolgtes Projekt einer Weltreform, die weit über Soziales und Politisches hinausgeht.
Ps: Dass Bücher heute nicht mehr lektoriert werden, verwundert nicht, doch die Fülle der Flüchtigkeitsfehler erstaunt denn doch so sehr wie die ubiquitäre Floskel „doch muss/kann das hier nicht erläutert werden“. Schon der Klappentext bietet falsche Jahreszahlen und Orte, die den in der Steiner-Gesamtausgabe genannten Daten und Vortragsstätten widersprechen. Dass Steiner jährlich „Tausende“ von Vorträgen gehalten und Wagner (also vermutlich dessen „Geist“) noch 1904 einen Aufsatz Edouard Schourés gelobt habe, ist indes weniger bemerkenswert als die Tatsache, dass Udo Bermbach sich derart intensiv in ein psychopathisches, als falsch und bizarr charakterisiertes Randphänomen der Wagnerrezeption hineingearbeitet hat.
Udo Bermbach: Der anthroposophe Wagner. Rudolf Steiner über Richard Wagner. Königshausen & Neumann, 2021.
Frank Piontek, 4.3. 2022
Eleonore Büning
Wolfgang Rihm - Über die Linie
Die Biographie
 Vermessen klingt der Untertitel zu Eleonore Bünings Rihm-Biographie, wenn man mit DIE Biographie assoziiert, dass es vor und nach dieser keine andere gab und geben wird. Stark untertrieben allerdings ist der Begriff Biographie, denn Lebensdaten- und –ereignisse machen nur einen Bruchteil des Buches aus, hauptsächlich geht es um die Werke, denen eine so umfassende wie tiefschürfende Analyse zu Teil wird. Im Klappentext wird die Verfasserin als Old-School-Kritikerin bezeichnet, und nach der Lektüre des Buches kann man das nur als Lob begreifen, weniger die Aussage, ebenfalls auf dem Klappentext, allerdings dem vorderen, wenn von Rihm gesagt wird, er habe, obwohl noch lebendig, bereits mehr komponiert als Mozart, kein besonders überzeugendes Lob, wenn man bedenkt, in welch zartem Alter der Salzburger verstorben ist. Der Rihm-Nichtkenner muss immerhin bis zur Seite 205 und damit dem gleichnamigen Kapitel warten, ehe sich ihm der Buchtitel Über die Linie erschließt.
Vermessen klingt der Untertitel zu Eleonore Bünings Rihm-Biographie, wenn man mit DIE Biographie assoziiert, dass es vor und nach dieser keine andere gab und geben wird. Stark untertrieben allerdings ist der Begriff Biographie, denn Lebensdaten- und –ereignisse machen nur einen Bruchteil des Buches aus, hauptsächlich geht es um die Werke, denen eine so umfassende wie tiefschürfende Analyse zu Teil wird. Im Klappentext wird die Verfasserin als Old-School-Kritikerin bezeichnet, und nach der Lektüre des Buches kann man das nur als Lob begreifen, weniger die Aussage, ebenfalls auf dem Klappentext, allerdings dem vorderen, wenn von Rihm gesagt wird, er habe, obwohl noch lebendig, bereits mehr komponiert als Mozart, kein besonders überzeugendes Lob, wenn man bedenkt, in welch zartem Alter der Salzburger verstorben ist. Der Rihm-Nichtkenner muss immerhin bis zur Seite 205 und damit dem gleichnamigen Kapitel warten, ehe sich ihm der Buchtitel Über die Linie erschließt.
Im Vorwort weist die Autorin auf ihr freundschaftliches Vertrauensverhältnis zum Komponisten hin, den sie als einen Sonderfall unter den zeitgenössischen Musikern ansieht, da er ein Einzelgänger, old fashioned, weil mit Stift, Papier und Klavier arbeitend, sei, vom Publikum gemocht werde und seine Musik erkläre. Die Sprache der Verfasserin zeichnet sich durch Knappheit und Anschaulichkeit aus, detaillierter wird es stets, wenn es um die Musik geht, da kann sie sich auch einmal zu Wortschöpfungen wie „pausendurchweht“ versteigen oder zu mit einem „mit vier (Wald)-Hörnen gesegnet“.
Im Wesentlichen geht Büning chronologisch vor, allerdings, um in größeren Zusammenhängen darzustellen, auch ab und zu thematisch, so wenn gegen Ende lange Passagen ausschließlich den Liedkompositionen gewidmet sind. Der Leser verdankt ihr die Auflösung manches Rätsels, das die Namensgebung für viele Musikstücke für den Leser darstellt. Sie ist nicht nur Analytikerin und Kritikerin, sondern gibt auch reichlich die Meinungen von Kollegen ihres Metiers wieder. Auch das trägt dazu bei, dass man sehr viel mehr über das Werk Rihms als über ihn selbst erfährt, wenigstens direkt, indirekt natürlich umso mehr. Man kann mit gutem Grund vermuten, dass ihm das mehr als recht ist, schien er doch in seinem bisherigen Leben eher gegen als mit dem Strom zu schwimmen wie ein Zitat wie „Vorderste Avantgarde war nie Berufsziel“ wissen macht.
Der „Koloss aus Karlsruhe“ ist nicht nur Komponist, sondern auch Schriftsteller und Lehrender , entzieht sich jeder Kategorisierung außer der, die man mit „das Variable als Konstante“ umschreiben kann. Opern ( von Faust und Yorick bis zu Proserpina) schreibt er zunächst auf Texte von Nietzsche, Heiner Müller, Artaud und andere, dann eigene, und kehrt nur noch einmal mit Proserpina mit dem Goethetext zur Literaturoper zurück. Oft denkt er an bestimmte Interpreten, wenn er komponiert, so an Anne-Sophie Mutter, Renate Behle, Gabriele Schnaut, Mojca Erdmann, Richard Salter, Christian Gerhaher, Christoph Prégardien. Für die hohe Frauenstimme scheint der Komponist ein besonderes Faible zu haben.
Weder der gar nicht so selten sich äußernde Argwohn gegenüber dem Vielkomponierer wie dem Erfolgreichen beirren den Komponisten, die von der Verfasserin geäußerte, von Optimismus strotzende Aussage:“Noch wird er nicht weltweit gespielt, wie Wagner und Verdi“ allerdings dürfte, was das Noch betrifft, so heftig anzuzweifeln sein wie die Korrektheit des Kommas vor „wie“.
Der Leser wird mit Begriffen wie „inklusives Komponieren“ vertraut gemacht, erfährt viel darüber, wie sich Komponist (Rihm) und bildender Künstler (Kappa) gegenseitig beeinflussen können, dass sich eine Nike Wagner dazu verstieg, ihn den „Goethe der Neuen Musik“ zu nennen, dass man Freunde sein kann, auch wenn man komponierend Welten voneinander entfernt ist (Rihm-Lachenmann).
Interessant sind auch die Ausführungen zu den Kompositionen, die in irgendeiner Verbindung zu berühmten Komponisten wie Schubert oder Brahms haben, so zum Deutschen Requiem. Auch absurd Erscheinendes wie die Vertonung der Gedichte eines Kinderschänders oder einer Adlermörderin wird nicht gemieden, sondern verständlich gemacht. Mit dem Ausblick auf Kommendes schließt der erste Teil des Buches.
Es folgt ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes Interview zu wichtigen Fragen, auf die der Komponist nüchterne, vielleicht auch ernüchternde Antworten gibt, sich eher als Gärtner denn als Architekten sehen will. Anmerkungen, Diskographie und Personen- und Werkregister beschließen den Band, der wohl beinahe ein Lebenswerk sein könnte, auf jeden Fall von außergewöhnlicher Sachkenntnis und dazu noch Liebe zum Sujet zeugt.
345 Seiten, Benevento Verlag 2022
ISBN 978 3 7109 0147 8
Ingrid Wanja
Würdige Feier

Einen bereits auf den ersten Blick beeindruckenden Band mit güldenen Lettern auf dunkeltürkisfarbenem Grund stellen die Händel-Festspiele Halle zu ihrem hundertjährigen Geburtstag vor, und auch das Inhaltsverzeichnis enttäuscht nicht, da es keine trockene Abhandlung der Geschichte des Ereignisses androht, sondern höchst interessante, mit Händel zusammenhängende Themen verspricht. Alles Chronologische, Zahlen, Daten und Namen sind in die umfangreichen Register verbannt, so dass es auch an konkreten Informationen nicht mangelt. Feuerwerk und Halleluja ist der Titel des Prachtbandes, der zugleich auf zwei der bekanntesten Kompositionen des Hallensers hinweist wie er von Hochgestimmtheit und Festlichkeit angesichts des runden Geburtstages der Festspiele kündet.
Die üblichen Grußworte, hier die vom Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, vom Bürgermeister der Stadt Halle und vom Hauptsponsor der Festspiele, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, ergehen sich nicht in austauschbaren Floskeln, sondern thematisieren den Missbrauch des Komponisten zur Nazi- und zur DDR-Zeit oder weisen auf die enge Verbindung zwischen Halle und englischen Verehrern des Komponisten hin, die mit zum in den Zwanzigern errichteten Händeldenkmal beitrugen.
Interessant ist die Gliederung des Bandes nach kostbaren Attributen, die von Glanz und Gloria sprechen wie Grandiose Kulisse oder Magische Momente, wozu es eine Seite Text und auf der gegenüberliegenden Seite ein attraktives Bild gibt, während in einem längeren Artikel Beispiele für das beschrieben werden, was die Überschrift andeutete.
Ganz besonders interessant sind die Vergleiche von Aufführungen aus der Weimarer Republik mit denen der Nazizeit, der DDR und denen nach der Wende, wobei von einer Wende auch im Sinn zu einer Hinwendung zur historischen Aufführungspraxis gesprochen werden kann.
Manchmal überrascht ein Artikel, wenn man zum Beispiel vom Stichwort Händel-Familie Genealogisches erwartet hat und stattdessen die für Händel Begeisterten aus den Partnerstädten Halle und Karlsruhe als solche gelten.
Interessant ist es, zu erfahren, dass von Anfang an die Beschäftigung mit Händel in Halle wissenschaftlich untermauert war, nicht vergessen werden sollte, dass sie in einem kurzen Zeitraum im Osten Deutschlands ganz verpönt war, weil er als „formalistisch“ galt. Es werden einzelne Werke interpretiert wie das Oratorium Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, die Feuerwerksmusik zum Anlass genommen, über die Kunst des Feuerwerks im Barock zu referieren, oder es werden außerhalb Halles gelegene Aufführungsorte wie das Lauchstädter Theater oder die Galgenbergschlucht aufgesucht. Nicht nur Händel als Komponist findet Beachtung, sondern auch Händel als Statue oder als Romanfigur.
Nicht nur die 100 Jahre Händel-Festspiele in Halle stehen im Mittelpunkt des inhaltsreichen Buches, sondern auch die Zeit davor, wenn es um Aufführungen von Händel-Werken in Halle vor 1922 geht. Der Leser hat die Wahl zwischen einer Allgemeingültiges verkündenden Zeile (Musik Händels sehen und hören. So heißt das Glück. Olaf Brühl) oder einem längeren Aufsatz über so Spezielles wie Jenny Lind, Händel und Halle. Berühmte Interpreten wie Joyce DiDonato oder Cecilia Bartoli begegnen dem Leser und Betrachter der zahlreichen Illustrationen. Barocker wie moderner Bühnenzauber werden abgebildet oder beschrieben, die Lust auf jedwede Musik vergeht dem Betrachter beim Anblick eines Auditoriums voller Naziuniformen, von der Vielfalt der Möglichkeiten, Händel zu inszenieren erfährt er im Vergleich der Produktionen von Orlando in den Jahren 1961, 1993 und 2010. Und einen ganz jungen Jochen Kowalski sieht man im Artikel über die Wiederentdeckung des Countertenors.
Auch der reichhaltige Anhang geizt nicht mit schönen Bildern, und man freut sich über ein wunderbares Buch, das man sicher immer wieder zur Hand nehmen wird.
190 Seiten, 2022 Henschel Verlag
ISBN 978 3 98487 835 1
Ingrid Wanja
Ein Herz fürs Ballett

Gelhard / Deschiens: Das ist Ballett 50 Fragen – 50 Antworten,
Henschel 2021. 192 Seiten. € 26,80.
Gleich vorneweg: Das ist ein tolles Buch nicht nur für Tänzer jedweden Geschlechts – ob Profi oder Amateur - sondern auch und überhaupt für alle, die sich fürs Ballett interessieren, es lieben und sich deshalb etwas mehr damit beschäftigen wollen. Man muss kein Ballettomane sein, um daran Gefallen zu finden. Auch der Profi lernt noch dazu. Alles ist sehr lebendig und durchaus so spannend, wie lehrreich von Tanzwissenschaftlerin Dorothee Gelhard erzählt - in 50 prägnanten und gut ausgesuchten Fragen mit kurzweiligen Antworten. Die Form - seitenzahlenlos, rein kapitelorientiert und sehr robust gebunden - ist außergewöhnlich und die künstlerische Ausstattung mit den wunderbaren Aquarellen von Illustratorin Camille Deschiens ist allein schon ein optisches Gedicht.
Am Ende ergibt sich für den Leser eine informative kurzweilige Geschichte des Balletts; alles was man schon immer wissen wollte und wissen sollte - nicht chronologisch erzählt, sondern in 50 lockeren Themenschwerpunkten. Lustige Fragen variieren mit ernsteren. Sie werden trefflich informativ und öfter auch mit einem Augenzwinkern beantwortet. Vorurteile werden versachlicht. Hier schreibt jemand, der das Ballett kennt, mag und dies seiner Leserschaft nachvollziehbar erklären möchte. Ich nehme es gleich vorweg: Das gelingt wunderbar.
Dankenswerter Weise kommt das Buch weder lexikalisch noch thematisch erschlagend daher, so dass man es auch Menschen empfehlen kann, die bisher keinerlei Beziehung zum Ballett hatten. Eigentlich könnte man zu jedem Kapitel mindestens eine, wenn nicht mehrere Themen-Vorlesungen halten oder Gesprächsabende leiten. Ein VHS-Kurs Ballett in Buchform.
Gehen wir in medias res mit ein paar Beispielen ausgehend von den Kapitelüberschriften. Wie tanzt man Liebe und warum in der Form des Kreises. Anhand von Beispielen werden wohlausgewählte Szenen bekannter Produktionen angesprochen und so differenziert analysiert wie plastisch beschrieben. Des weiteren geht es um den Einsatz von Gesten. Gesten sind wesentliches Moment einer Choreografie. Pantomimische Gesten sind wichtige Handlungselemente. Tänzer dürfen weder reden, noch singen, wie die Kollegen von Schauspiel und Oper. Gesten zeigen das Innere der Protagonisten – ihre Verzweiflung, Liebe, Qualen oder Freuden. Bewegungen und Gesten sind typisch für bestimmte Choreographen. Ihr Fingerabdruck. Wer viel ins Theater geht oder sich Ballett im Film-Video anschaut erkennt seinen Lieblings-Choreographen meist nach wenigen Minuten.
Viele Ballette handeln immer noch von klassischer bzw. antiker Mythologie. Wussten Sie, dass ein Ballett oft auch viel mit Geometrie zu tun hat? Gibt es politisches Ballett? Interessant in diesem Zusammenhang, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR nur drei Genres überhaupt akzeptiert wurden. Natürlich die unverdächtigen Klassiker, russische Ballette und die systemstabilisierenden Eigenproduktionen des Arbeiter- und Bauernstaates. Persönliche Anmerkung: Dass man sich für letzteren gerade auf der Theaterbühne wenig interessierte, liegt natürlich auf der Hand. Wo sich der Tanz der Politik unterzuordnen hat, wird es meist künstlerisch uninteressant und langweilig.DDR-Ballett hatte sich an der Ballettarbeit der UDSSR zu orientieren. Klassenkampf auch im Ballett. Es gab 1953 tatsächlich ein Ballett mit dem Titel Das Recht des Herren. Selbstredend wird der Großkapitalist am Ende vom unterdrückten Arbeitervolk abgemurkst. Politisches, zeitgenössisches Ballett gab es dann später auch im Westen, Namen wie Pina Bausch oder Johann Kresnik, Kurt Joos bzw. Reinhild Hoffmann oder Sasha Waltz werden erwähnt. Mit Rassismus beschäftigt sich das provokative Kapitel: Wie weiß ist das Ballett.
Was macht eigentlich ein Choreograph? Warum so wenig Frauen in dieser Berufsgruppe? Wie zeichnete man ein Ballett in Vor-Videozeiten auf? Was sind klassische Notationen? Glücklich, wer Mats Eg Ballette live gesehen hat, denn der große Choreograph sperrte sich lange gegen Aufzeichnungen jedweder Art. Heute für den Ballettfreund kein Problem mehr, denn von fast allen Balletten gibt es ja Videos. Ich denke, dass auch hier das Buch eine Motivation sein wird sich die eine oder andere große Produktion gleich vom Silberscheiben-Händler zu bestellen. Nie war das Angebot so groß.
Noch ein paar Beispiele: Kann man Geschichte tanzen? Wie vertanzt man Romane - wie Manon Lescaut, Drei Schwestern oder Mayerling? Was und wann war die große Ballettreform? Requisiten genießen ebenso ein wichtiges Kapitel, wie die Frage, ob man Ballett auch ohne Musik tanzen kann. Und natürlich darf auch nicht das Kapitel über Das Weiße Tutu fehlen und den eigentlich unfassbaren Materialaufwand des Originals. Der größte Skandal im Ballett ist natürlich Le sacre du Printemps gewesen. Wichtiges Kapitel: Die Rolle Vaslav Nijinskys für das moderne klassische Ballett. Nijinsky hatte das Verhältnis von Musik und Tänzer neu definiert.
Selbstredend bekommen unsere meistgespielten Ballette Schwanensee und Nussknacker eigene Würdigungen. Sie gehören textlich zu den längsten. Wie sich die Technik des Ballett-Tanzes verändert hat, ist für mich eines der interessantesten Kapitel, leider sehr kurz. Des Weiteren geht es um Kostüme oder Ballett und bewegte Bilder. Wussten Sie, was ein triadisches Ballett ist? Warum gibt es so oft Vögel? Wie wird man Primaballerina und der humorvolle Zusatz: Wieviel Schokolade darf man dann noch essen. Es folgt der Kernsatz: Tanzen ist Schwerstarbeit.
Der Unterschied zwischen Ballett und Tanztheater in einem weiteren Kernsatz formuliert: Das Tanztheater versteckt weder die blutenden Füße noch akzeptiert es die strenge Disziplinierung des Körpers. Trefflicher geht es nicht. Kernsätze wie diesen gibt es einige; sind im Buch extra abgesetzt und stehen mitten auf einer halbleeren Seite. Augenfälliger geht es nicht – ein ungewohntes Layout. Kennen Sie das Geheimnis russischer Ballettschulen? Wie tanzt man Komik? …
Das Buch endet mit der Beantwortung der Frage, ob Ballett heute noch zeitgemäß ist. Aus der wunderbaren Antwort den letzten Satz. „Natürlich ist das Ballett zeitgemäß! Wer sich öffnet, wird dem Zauber des klassischen Tanzes auch heute noch erliegen.“
Das vielleicht schönste Ballettbuch der letzten Jahre zaubert dem Leser, in trüben Zeiten wie diesen, ein Lächeln ins Gesicht. So schön kann Fortbildung sein - auch für Kritiker ;-). Allein schon deshalb gibt es den OPERNFREUND-Stern für dies herrlich schöne Buch. Liebevoll mit großer Ballettbegeisterung und Empathie geschrieben. Ein MUST-BUY, besser MUST-HAVE nicht nur für alle Ballett-Eleven. Ein Kleinod für die Ewigkeit ��
Peter Bilsing, 8.2.2022
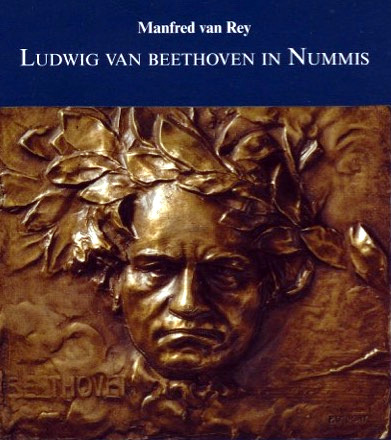
LUDWIG VAN BEETHOVEN IN NUMMIS
In jedem Sinne glänzend: Das Genie (und Fidelio) auf Münzen und Medaillen
Der Laie mag staunen, der Kenner wundert sich nicht: dass Münzen, Medaillen und Plaketten nicht zu den Nebensächlichkeiten, sondern zu den Hauptsachen nicht allein der Geld-, sondern auch der Kunstgeschichte gehören. Wer heute die einschlägigen Münzkabinette in Berlin, München oder Nürnberg besucht, weiß, dass die Kleinobjekte so gut die Entwicklung der Bildenden Kunst spiegeln wie die optisch größeren Werke, die seit dem 15. Jahrhundert entstanden – abgesehen davon, dass die Liebhaber der Numismatik Kenntnis davon haben, dass sich die Geschichte nicht zuletzt in jenen Artefakten zeigt, die zwar – in Zeiten des allmählichen Übergangs vom Münz- und Papiergeld zu digitalen Zahlungsmitteln – im täglichen Verkehr zunehmend seltener werden, aber in Abermillionen von Exemplaren vorliegen. Befasst man sich mit einem spezifischen Thema – etwa mit Komponisten, die in der kleinen Form verewigt wurden –, kommt man schon schnell dahinter, dass die populären Meister nicht allein im Gemälde, dem Druck, der Skulptur oder dem Foto festgehalten wurden, die uns eine jeweils besondere und subjektive Sicht eröffnen. Was hier Kitsch, Kunst oder Kunsthandwerk ist, entscheiden sowieso und letzten Endes der persönliche Geschmack und die Zeit. Tatsache ist, dass der Musikfreund, der sich beispielsweise mit der Wirkung Beethovens und der Art und Weise beschäftigt, wie zumal Nachlebende den Komponisten sahen, schönste Funde machen kann, wenn er die einschlägigen Arbeiten zum Thema „Beethoven auf Münzen, Medaillen und Plaketten“ in die Hand nimmt. Nebenbei: Kein Musiker wurde so oft auf Münzen und Medaillen verewigt. Im Genre der Beethoven-Porträts repräsentieren sie zudem die Majorität (2020 erschien die Beethoven-Euro-Münze in einer Auflage von 1,2 Millionen Stück...).
Das Beethovenjahr, besser: die Beethovenjahre, boten dafür einen Anlass, waren aber nicht der Grund für eine wertvolle Publikation, die nicht weniger als 207 ältere und jüngere und 10 neue Auftragsarbeiten in stechend scharfen Bildern präsentiert, womit nicht weniger als knapp die Hälfte aller numismatischen Beethoveniana vorliegt (von denen insgesamt nur 377 in Bildern nachweisbar sind) und die zwei bekannten Publikationen – Paul Niggls monumentale und mehrbändige Edition der Musiker-Medaillen und Bernd Müllers Ludwig van Beethoven in Nummis (2008) – eine sinnvolle und reiche Fortsetzung fanden; satte 95 Exemplare des neuen Bandes finden sich weder bei Niggl noch bei Müller. Bedenkt man, dass viele Münzen und Medaillen wenig originell sind, bietet van Reys Publikation also eine reiche Auswahl der besten Beispiele für ein zwischen Kunst und Kunstgewerbe changierendes Medium des gar nicht so speziellen Spezialgebiets „Komponisten auf Münzen und Medaillen“ – und, wie gesagt, auf Plaketten aus vielerlei Material. Die Prägungen beginne bereits 1827: in Beethovens Todesjahr. Der Gang durch die Münzgeschichte macht klar, dass viele Münzen und Medaillen nach einigen bekannten Porträts geschaffen wurden und sich viele Künstler frei bis sehr frei, je nach dem Stand der künstlerischen Stilentwicklung, ihren Beethoven zum Bilde schufen. Oft faszinierend sind schon die Rückseiten von manch Stück: vom Klassizismus über den Jugendstil zur Moderne des 20. Jahrhunderts führten Wege, die den Kopf oder das Brustbild des „Titanen“ mal gezügelt, mal düster, mal wild in die Form gruben. Nicht wenige der Objekte könnten – so macht man es beispielsweise im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg – sofort in Skulpturensammlungen oder Kunstabteilungen integriert werden, in denen die Malerei, die Plastik und das Kunsthandwerk gleichrangig nebeneinander stehen. Van Rey begnügte sich nicht damit, seine Exemplare abzubilden und genau zu beschreiben, sondern eröffnete seine Sammlung mit einer 40seitigen Einführung, die den Zusammenhang der einzelnen Stücke mit der Geschichte der Beethoven-Ikonographie beleuchtet. Den Genius darzustellen bedeutete und bedeutet zumal: Bilder zu finden, die ihn und sein Werk im kleinen Format darzustellen vermögen – die Betrachtung eines herausragenden Stücks, einer 1899 entstandenen Medaille von Jean-Marie Delpech und Camille Paulin Lancelot, zeigt uns, wie aus herkömmlichen Allegorien, einer Lyra, einer halbnackten schalmeispielenden Frau, einem flötespielenden Mädchen und einem Knaben mit Tambourin, ein repräsentatives Kunstwerk werden konnte. Franz Stiasnys Plakette von 1910 – ein markiger Kopf, der die Entstehungszeit und den Jugendstil nicht verleugnet –, Stephan Schwartz‘ Plakette von 1909 (das Motiv „Frau am Klavier, vom Kopf des Komponisten bewacht“ zitierend), Paul Vinczes Londoner Medaille von 1970, eine Muse am Flügel zeigend: sie mögen für die besten Exemplare der Sammlung einstehen, in denen das Thema mehr oder weniger symbolistisch bearbeitet wurde. Konkreter wurde es, wenn es galt, bestimmte Werke wenigstens kurz zu nennen. Goethe, den Beethoven häufig in Musik gesetzt hat und den er in Teplitz und Karlsbad traf, kommt mehrmals vor, die „ferne Geliebte“ wurde zweimal – interessanterweise bei einer Medailleurin, nicht einem Medailleur – bei Inka Klinkhard zum Motiv. Auch Komponistenansammlungen begegnen gelegentlich auf den Medaillen und Plaketten, auf denen sich Mozart, Haydn und unser Mann oder Bizet, Tschaikowsky und Beethoven zur Minigruppe zusammenfanden. Ein einziges Mal – dies lehrt die Zusammenstellung aller Wagner-Medaillen und Münzen – trafen sich Beethoven und Wagner im Medium: 1978 schuf der Portugiese José de Moura eine Medaille, auf der acht kleine Komponistenköpfe den großen des „Riesen“ einrahmen. Abgesehen von Bach, der im musikdramatischen Bereich „nur“ einige weltliche Kantaten hinterließ, hat jeder dieser Musiker mindestens eine Oper geschrieben; die „Musica dramática“, die auf Humberto J. Mendes‘ portugiesischer Medaille von ca. 1975 die konzise Gattungsliste anführt, ist ansonsten gelegentlich vertreten. Nimmt man sich umschlingende nackte Paare nicht als Allegorien einer sich verbrüdernden Menschheit im Sinne des Schlusssatzes der 9. Symphonie, sondern als mögliche Allegorie von Leonore und Florestan, begegnet Beethovens einzige Oper immerhin sechsmal: als Titel bei Heinrich Friedrich Brehmer (1870), einem Anonymus (1900), bei Calvin Massey (1977), Sonja Eschefeld (2020) und bei Hans Joachim Dobler (1977), der die Oper als Mittelteil einer „Trilogie des Lebens“, also zwischen der Eroica und der Missa solemnis, verortete. Als man 1978 den 200. Geburtstag der Mailänder Scala feierte, erschien eine mehrteilige Opernmedaillenedition, in der C.R. Rufo auch dem Fidelio einen Platz mit einer Illustration einräumte. Zugegeben: Bonn-Motive schlagen die Theater-Themen um Längen, aber für den Opernfreund ist es zuletzt schön, auf Medaillen auch das Theater an der Wien (Bernd Göbel, 1969) und das Kärntnertortheater, den Vorläuferbau der Wiener Staatsoper, zu entdecken (eine Arbeit von Herbert Wähner, 2005).
Hat man nicht auch Geld beineben… Dieses Zitat aus dem Fidelio muss fallen, wenn es um die Frage geht, was Beethoven mit dem Geld zu tun hatte (er hatte viel damit zu tun). Geld ist nicht alles; wo Münzen und Medaillen zu eigenständigen Kunstwerken werden, hat auch Beethoven wesentlich mehr als einen Groschen verloren. Der in jedem Sinne glänzende, weil in vielerlei Sinne glänzende Stücke porträtierende Band zeigt es in exemplarischer Weise.
Manfred van Rey: Ludwig van Beethoven in Nummis (Bonner Numismatische Studien, Bd. 3). Hrg. von der Numismatischen Gesellschaft Bonner Münzfreunde e.V. Bonn 2020. 296 Seiten, 17 farbige Abbildungen und 217 farbige Tafelseiten. 29,90 Euro. Erhältlich bei den Bonner Münzfreunden (kontakt@bonner-muenzfreunde.com) und im Shop des Bonner Beethovenhauses.
Frank Piontek, 3.12. 2021
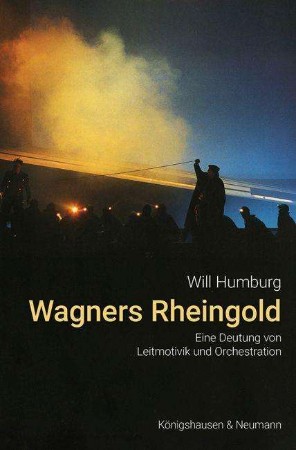
Will Humburg: Wagners Rheingold. Eine Deutung von Leitmotivik und Orchestration. Königshausen & Neumann, 2021.
Brillant und originell: Will Humburgs Rheingold-Interpretation aus dem Geist der Musik
Als Max Kalbeck 1876 die ersten Bayreuther Festspiele besuchte, hinterließ er anlässlich des Zitats des sog. Walhall-Motivs zu Alberichs Drohung „Habt Acht vor dem nächtlichen Heer“ folgenden Schluss: „Das sind Sachen für den musikalisch feinschmeckenden Kenner, der die Partitur so fest im Kopfe sitzen hat, dass man nur anzuklopfen braucht, um sämtliche Motive zum Vorschein zu bringen. Auf das Publikum indessen können solche geistreiche Kniffe keinen Eindruck machen, weil sie gar nicht bemerkt werden.“
Jeder Musikfreund, der glaubt, den Ring zu kennen, weiß um das Gefühl, wenn er von Neuem den Ring hört: dass er Anklänge, Zitate und Variationen der bekannten, in den einschlägigen Leitmotiv-Tafeln gelisteten Motive und Themen mehr oder weniger deutlich hört. Schaut er beispielsweise in Julius Burgholds Textausgabe, die die einzelnen Stellen am Textrand aufführt, wird er feststellen, dass zum einen schon im initialen Stück der Tetralogie die Einsetzung der Motive reichlich ist und zugleich – anders als in der Götterdämmerung, in der Wagner sein Verfahren (scheinbar) bruchlos verwirklichte – noch Lücken zwischen den einzelnen Lokalitäten klaffen. Als Götz Friedrich einmal gefragt wurde, welcher der vier Ring-Teile am genialsten sei, nannte er nicht eines der „großen“ Stücke, sondern das Rheingold, das in seiner Beliebtheit hinter der Walküre zurücksteht. Er hatte Recht, denn Wagner realisierte bereits zu Beginn seiner kompositorischen Arbeit am schließlich ersten Werk des Vierteilers seine revolutionäre Technik auf eine Weise, von der nur der etwas weiß, der sich die Partitur so genau anschaut, wie es Will Humburg nun tat.
Ein neues Buch über das, was Wagner selbst nicht als „Leitmotiv“, sondern als „Gefühlswegweiser“ bezeichnete, setzt sich dem Verdacht aus, nur das wiederzukäuen, was die Vorgänger schon abgearbeitet haben. In jüngerer Zeit waren das, um nur einige Autoren zu nennen, Uwe Färber, Melanie Unseld und Wolfgang Fuhrmann, Tobias Janz und Peter Berne; Christian Thorau veröffentlichte 2003 mit Semantisierte Sinnlichkeit eine grundlegende Studie zum Problem der „Rezeption und Zeichenstruktur der Leitmotivtechnik Richard Wagners“. Vergleicht man diese theoretisch anspruchsvollen Arbeiten mit der Monographie, die der vielgelobte Dirigent des Münsteraner Rings veröffentlichte, wird man schnell feststellen, dass ein Musiker, der Wagners Musik aus der Praxis kennt und zugleich in der Lage ist, über den Gehalt der Musik zu schreiben, der aus ihrer Struktur gewonnen werden kann, zu Interpretationen zu kommen vermag, die uns das Werk – tatsächlich – auch und gerade in Bezug auf die szenische und psychologische Deutung neu begreifen lassen. Dass Humburgs Motivliste 39 Nummern umfasst (nicht gezählt die Motive, die zusätzlich im Text erläutert werden), Burgholds kanonische Liste nur 30, ist weniger wichtig als der Umstand, dass Humburg mit seiner Takt für Takt vorgehenden Untersuchung ein von Theodor W. Adorno geäußertes Diktum, dem vermutlich immer noch einige Ring-Hörer glauben, in Grund und Boden rammt. Dass „das Motiv als Zeichen eine geronnene Bedeutung vermittelt“, wie Adorno im dritten Kapitel des Versuchs über Wagner schrieb, ist zwar längst widerlegt, aber selten wurde es so nah am Material dargestellt, was nicht allein daran ablesbar ist, dass Burghold sein Schema gelegentlich zu starr in Einsatz brachte, indem er Motivvarianten und -anspielungen (absichtlich?) ignorierte. Humburg sieht zudem das Motiv, seine Abspaltungen, Varianten und Anspielungen, nicht unabhängig vom Produktionsmedium – seine Arbeit bringt, weit über Tobias Janz‘ Klangdramaturgie hinaus, die Leitmotivik mit der Orchestration zusammen. Neu ist die dezidierte Analyse von Leitrhythmen und Leitakkorden. Versehen mit diesen „tools“ vermag der Autor, jene Lücken zu füllen, die Burgholds Motivzuweisungen noch besitzen, oder anders: So gut wie kein Takt des Rheingold ist frei von den grundlegenden Elementen und Motiven/Themen, die das musikalische Gewebe des „Vorabends“ in beeindruckendster Fülle und Fantasie ausmachen. Werden, an einer einzigen signifikanten Stelle im 4. Bild, über mehrere Takte keine Motive ins Spiel gebracht, hat auch dies einen Sinn, der sich aus der Dramaturgie ergibt: Wenn sich Wotan und Alberich um den Ring streiten und jenes Motiv, das dem Gegenstand zugeordnet werden kann, gerade nicht ertönt, verweist die Fehlstelle nicht auf eine Nachlässigkeit des Komponisten, sondern auf etwas Unausgesprochenes, das in diesem Fall absichtlich unerwähnt bleibt. Ansonsten offenbart das allwissende Orchester ja reichlich, worum es den streitenden Herr und Frauschaften bewusst und unbewusst geht. Im Widerspiel von Text und Musik fungiert die höchst rational konstruierte Musik als „eigenständige Bedeutungsebene“ (S. 10): diese Ebene en detail zu beschreiben war der Vorsatz, der den Wagnerschen „Beziehungszauber“ (wie Thomas Mann ihn nannte) in absolut eigenständiger Weise entschlüsselt, ohne ihm seine Magie zu nehmen. Dafür gibt es schon rein wissenschaftliche Gründe, denn der praktische Kenner der Partitur vermag es sogar, Egon Voss an einer Stelle zu korrigieren (die Wagnertuben treten wesentlich früher in Erscheinung, als es Voss einst in seinen Studien zur Instrumentation Richard Wagners behauptete). Schrieb Werner Breig (2013 in Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung), dass erst im zweiten Walküre-Akt „das wohl früheste Beispiel für die kontrapunktische Verbindung zweier selbständiger thematischer Gestalten“ zu finden sei, erhalten wir von Humburg den Beleg dafür, dass schon im Rheingold Parallelstellen auftreten. Wo Motivik und Instrumentation ineins gesetzt werden, kommt Humburg darauf, dass es nicht allein eine Leitmotivik, sondern auch eine Leitinstrumentaion gibt, von deren Differenziertheit selbst Ring-Kenenr kaum etwas ahnen. Dass Wagner ein großer Farbenmaler war, der in Sachen Instrumentation sehr genau arbeitete, ist bekannt, aber dass jedes Instrument, jede Instrumentalmischung und so gut wie jedes Kolorit im Sinn von „Leitklangfarben“ genauen Mustern gehorchen, die gedeutet werden können, blieb – mit bezeichnenden Einschränkungen - zu beweisen.
„Dabei kommt es nicht darauf an, dass jede einzelne von mir formulierte psychologische, philosophische oder auch politische Interpretation der ungeheuer vielfältigen Querbezüge ‚richtig‘ ist. Entscheidend ist – und zwar für Ausführende und Hörer -, überhaupt eine Deutung zu suchen…“ (S. 13). Angesichts der banalen Tatsache, dass das abendländische Tonsystem über relativ wenige Töne verfügt und auch die rhythmische Komplexität des Rheingold – im Vergleich zu den indischen tâlas, auf die sich Oliver Messiaen bezog – relativ schlicht anmuten mag, verwundert es natürlich nicht, dass der Interpret einer vom Komponisten unkommentierten Partitur auf Bezüge stößt, deren Relevanz eher in einem hermeneutischen Zirkel als in einer widerspruchsfreien und objektiv sein wollenden Analyse wurzeln muss. Da Wagner sich selbst so gut wie nie über die detaillierte musikdramatische Deutung und den Kompositionsprozess seiner Werke geäußert hat, haben viele Deutungen spezifischer Instrumentationen und Motive zunächst hypothetischen Charakter, doch ergibt sich im Zusammenklang aller Komponenten und Beobachtungen am Ende denn doch ein stringentes Bild, in dem gewagtere Deutungen völlig legitim sind. Humburg vermag tatsächlich zu zeigen, wie sich aus Motivmetamorphosen (am bekanntesten dürfte der Übergang vom sog. Ring-Motiv zum Walhall-Thema sein) neue Komplexe ergeben, wie sich aus wenigen Grundmotiven kompliziertere Gebilde ergeben, wie sich durch Leitrhythmen („Lebenskraft-Rhythmen“ und „Todes-Rhythmus“ genannt) Bedeutungen ergeben, die weit über bestimmte Figuren (wie die Zwerge oder Rheintöchter, die im gemeinsamen Rhythmus verbunden sind) hinausgehen, wie in Leitakkorden (etwa dem „Verführungs-Akkord“) Zusammenhänge zwischen Szenen und Opern geschaffen werden, die – darauf verweist Wagners Wort vom „Gefühlswegweiser“ – den Zusammenhang zwischen dem ersten und letzten Akkord des Ring zu stiften vermögen. Die Erläuterung jenes zentralen Motivs, in dem man gewöhnlich nur zwischen Freias Fluchtmotv und Siegmunds und Sieglindes Liebesmotiv Zusammenhänge sieht, als Nukleus vieler anderer Entwicklungen, die allmähliche Verfertigung des sog. Vertragsmotivs beim dramaturgisch genauen Komponieren: all das ist mehr oder weniger „bekannt“, wurde aber noch nie so genau in Bezug auf Szene, möglicher Inszenierung und Innenleben der handelnden Figuren an Hand der Musik hergeleitet. Entscheidend bleibt die These, dass es Wagner selbst beim sog. Schwert-Motiv nicht auf die dinghafte Zuweisung bestimmter Motive an Objekte und Figuren, sondern um eine psychologisch vertiefte Verknüpfung musikalischer Prozesse mit den gestisch und / oder textlich vermittelten Szenendetails ging. Nur so kann Humburg dahinter kommen, dass Loge vielleicht schon zu Beginn der zweiten Szene anwesend war, weil die Musik uns verrät, dass er den Disput zwischen Fricka und ihrem Göttergatten belauscht hat – die alternative Deutung bestünde darin, dass uns das Orchester nur verrät, was es weiß. Nimmt man Wagners Musikalisierung Ernst, dürfte es schwer sein, Humburg zu widersprechen, denn wieso sollte der Feuergott eine Melodie singen, die zuvor von Fricka angestimmt wurde? Nicht allein diese Stelle sagt uns Wesentliches über Wagners „Worttonmelodie“ und die erstaunlich häufige Entstehung eines Motivs aus gesungenen, nicht allein aus orchestralen Strecken (und auch dies kann gegen Adornos erstaunlich falsche Behauptungen in Anschlag gebracht werden).
Was aber hat der Ring mit der Politik zu tun? Dass der Ring ein politisches Kunstwerk ist, ist bekannt, aber wirklich spannend (und möglicherweise einzig relevant, wenn wir der Musik das Vorrecht der verbindlichen Textdeutung einräumen) wird die betreffende Deutung der Tetralogie dort, wo die Musik selbst Politik abbilden oder spiegeln kann. Die Frage, inwiefern Musik überhaupt politisch zu sein vermag – eine Frage, an der sich Martin Geck in Zwischen Romantik und Restauration, also über die „Musik im Realismus-Diskurs 1848-1871“ seltsam theoretisch abgearbeitet hat -, wird von Humburg eindeutig beantwortet: „Sozialistische“ Musik entsteht dort, wo die Wehe-Sekunde, das Ring-Motiv und andere Motive in der Nibelheim-Szene zusammenkommen, um das industrielle Proletariat, dem Mime angehört, über die üblichen Ambossschläge der Verwandlungsmusiken und des Schmiede-Motivs musikalisch konkret zu zeichnen (S. 109). Die dritte Verwandlungsmusik, die gleichfalls brillant beschrieben wird, vereinigt Riesen und Zwerge dann auf eine Weise, die, „kühn interpretiert, musikalisch die von Marx und Engels im ‚Kommunistischen Manifest‘ 1848 zeitgleich mit dem Beginn von Wagners Arbeit am ‚Ring‘ geforderte Vereinigung der ‚Proletarier aller Länder‘“ (S. 130) festhält. Wem diese Deutung zu vulgärmarxistisch erscheint, möge eine andere Idee über den Zusammenklang von Riesen- und Schmiedemotiv vorlegen.
Mit anderen Worten: Humburg legte eine ungewöhnlich ambitionierte und geglückte Arbeit vor, die den ungeheuren Reichtum des Rheingold in Sachen Instrumentation und (damit zusammenhängender) Motivarbeit Schicht für Schicht auf deliziöse Weise sichtbar macht und selbst dort, wo sie nicht unmittelbar einleuchtet oder leicht überzogen anmutet, zum Nachdenken über Funktion und Gehalt eines Musikdramas zwingt, das Camille Saint-Saens nicht grundlos als „Goldschmiedearbeit“ bezeichnete. „Heute floß mir das Rheingold bereits durch die Adern: muß es denn sein, und kann es nicht anders sein, so sollt Ihr denn ein Kunstwerk bekommen, das Euch Freude machen soll!“, schrieb Wagner Ende Oktober 1853 an Franz Liszt. Humburg hat dieses Kunstwerk so beschrieben, als kennten wir es nicht – weil uns die „geistreichen Kniffe“, von denen Max Kalbeck 1876 sprach, immer noch überraschen können.
Frank Piontek, 1.12. 2021
Anna Netrebko:
DER GESCHMACK MEINES LEBENS
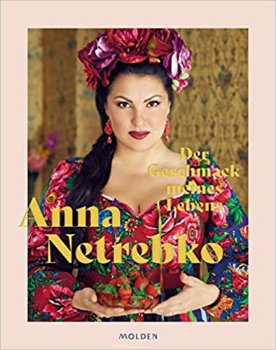
160 Seiten, Molden Verlag in Verlagsgruppe Styria. 2021
Rund um ihren „50er“ sind die Aktivitäten, ist die Unternehmungslust von Anna Netrebko ungebrochen. Auftritte überall (eine Schulteroperation wirft sie kaum aus der Bahn), inklusive die diesjährige Scala-Eröffnung (als Lady Macbeth in ihrer x-ten Inszenierung), eine neue CD (mit hoch dramatischem Cover) – und ein Buch.
So selbstverständlich unkonventionell wie die ganze Frau ist auch „Der Geschmack meines Lebens“, nun reich bebiidert im Molden Verlag erschienen. Allerdings nicht nur mit Fotos, die Anna zeigen, sondern auch zahlreiche, die aus dem Buch gewissermaßen ein Kochbuch machen (die überbordende, aber zweifellos appetitanregende Foodfotografie stammt von Vanessa Maas). Gleich im ersten Satz des Vorworts lässt Anna Netrebko ihre Leser wissen, dass das Kochen für sie in den letzten Jahren zu einem auftregenden Thema geworden ist. Und darum bezieht sie es so prominent in ihr Buch ein, dass es eigentlich den Hauptakzent setzt. Schon das Titelfoto zeigt sie nicht in einer Opernrolle, sondern fast folkloristische wie eine schöne russische Bäuerin, die dem Betrachter eine Schale Erdbeeren anbietet…
Opernfreunden sei gesagt: Es ist auch am Rande eine Lebensgeschichte, in Ich-Form erzählt, von dem kleinen Mädchen in Krasnodar, das sich schon als Kind so gerne verkleidet hat. Dabei gibt es anfangs Privatfotos (auch von Essensorgien…), später Rollenfotos (bestückt mit einzelnen hymnischen Sätzen aus Kritiken) – Bilder sind ein wichtiger Bestandteil des Buches, das am Ende jedes Kapitels dann Rezepte (wieder mit den vielen Fotos) bietet.
Die Analyse ihrer Karriere, detaillierte Berichte über Aufführungen, Dirigenten, Partner etc. darf man nicht erwarten. Die Netrebko besucht einfach die Orte ihres Lebens und ihrer Erfolge. Erste Station nach der Geburtsstadt: St. Petersburg, kein Geld, aber viel Ehrgeiz und gute Laune. 1994 hier ihr Debut als Susanna, und seither ist sie immer wieder zurückgekehrt.
Mit 24 bereits war sie erstmals in den USA, ein Gastspiel in San Francisco, sie erzählt all das in fröhlich privatem Ton (und kommt immer wieder aufs Essen zu sprechen). Wenn sie dann in die ganze Welt aufbricht, muss sie an ihr internationales Publikum denken und versichern, dass sie als Kosmopolitin keine Favoriten hat – aber italienisches Essen mag sie schon sehr (mit Foto beim Spaghetti-Essen).
Die Karriere hat bekanntlich in Salzburg bei den Festspielen abgehoben – nicht, als sie 1997 bei einem Marinskij-Gastspiel ein Blumenmädchen sang, sondern 2002 mit der Donna Anna. Und auch da gibt es ein Foto, wo sie mit Martin Kusej kocht…
Unter der „Lawine des Ruhms“ stellt sie fest – abgesehen von der Knusprigen Ente in München -, dass sie Deutschland liebt. „Met, Party & Pork“, seit 2004 war sie immer wieder in New York, heute einer ihrer Hauptwohnsitze. Dann kommt London, wo sie gerne in den großen Kaufhäusern einkauft (schließlich haben diese sensationelle Lebensmittel-Abteilungen), Moskau und zu guter Letzt Wien.
Wenn sie drei Wünsche offen hätte, erzählt Anna Netrebko am Endes dieses Buches, dann würde sie Gesundheit und Frieden für alle Menschen wünschen – und dass der ewige Wind in Wien endlich aufhören sollte. Für sie selbst wünscht sie nichts: Sie hat alles, was sie braucht. Der Welt sollte es besser gehen.
Der altruistische Wunsch einer Künstlerin, die sich ihren Fans als problemlose Hobby-Köchin präsentiert. Wer Sinn für Rezepte hat, wird vermutlich das eine oder andere nachkochen und Opernfreunde zu einem Netrebko-Abend anderer Art einladen.
Renate Wagner, 27.11.2021
Geiger und Naturschützer

Nicht recht zusammen zu passen scheinen Geige und Regenwald, selbst wenn sie dies auf dem Cover von Michael Schnitzlers „Erinnerungen“ vortäuschen und sich das Buch Der Geiger und der Regenwald nennt. Und tatsächlich musste der Autor die traurige Erfahrung machen, dass sich sein teures Meisterwerk im schwül-heißen Klima Südamerikas in seine Bestandeile auflöste. Der langjährige Konzertmeister der Wiener Symphoniker, Gründer des Haydn-Trios Wien und Professor an der Wiener Musikhochschule wird bereits im Vorwort von Mitarbeiterin Petra Hartlieb zusätzlich als Regenwald-Fan apostrophiert und eine Einladung an den Leser nach Costa Rica ausgesprochen.
Im Prolog wirft der Arthur-Schnitzler-Enkel drei Schlaglichter auf sein Leben und Wirken, auf ein Konzert während eines Gastspiels in Tokio in Begleitung seiner Carlo-Bergonzi-Geige, die nichts mit dem gleichnamigen Tenor zu tun hat, auf die Verleihung einer Urkunde für Verdienste um den Umweltschutz im Wiener Belvedere und die Begegnung mit einem englischen Touristen in der Esquinas Rainforest Lodge, dem er, beginnend mit „Das ist eine lange Geschichte“ sein Leben erzählt.
Das Buch ist in kurze, übersichtliche Kapitel mit die Neugier des Lesers weckenden Überschriften gegliedert, es gibt sehr viele interessante Fotos, und es wird nicht nur aus den Tagebüchen des Autors, sondern auch aus den Erinnerungen von Familienangehörigen zitiert. Bereits im ersten Kapitel erfährt der Leser, dass beide Stränge, die das Leben des Autors bestimmen, Musik und Natur, bereits bei den Großeltern nachweisbar sind.
Es beginnt 1938, als Schnitzler noch gar nicht geboren war, seine Mutter aber fluchtartig nach dem Anschluss Österreichs ihre Heimat verlassen musste, eine wertvolle Geige im Gepäck, den älteren Bruder aber zunächst zurücklassend. Michael Schnitzler wird in den USA geboren, wo der Vater als Regisseur tätig ist, Englisch wird seine Muttersprache, der Geigenunterricht des Jungen trägt so gute Früchte, dass er nach einem halben Jahr sein erstes Konzert geben kann. Schnell zieht es ihn zur Kammermusik, auf einer Europareise ist Österreich erst einmal „the land of Demel“, der berühmten Konditorei, aber auch schon der Alpen, und 1958 kehrt die Familie endgültig nach Österreich zurück.
Hochinteressant sind die Beobachtungen die der Geiger und Konzertmeister in bezug auf die Dirigenten, die er aus nächste Nähe erlebt, machen und wiedergeben kann: Klemperer, Karajan, Böhm, später dann Sawallisch, Krips, Giulini, Abbado, Roschdestwenski, Oistrach…..
Vom Großvater ist vor allem im Zusammenhang mit der Verwaltung des literarischen Erbes durch den Vater, besonders des skandalumwitterten Der Reigen die Rede und vom erfolgreichen Ringen um den Arthur-Schnitzler-Platz.
Die sich auflösende Violine im Regenwald ist nicht das einzige Instrument mit besonderem Schicksal, eine Guarneri wird auch mal am Bahnsteig vergessen und dort wieder gefunden, das Instrument wird später von einem Agenten unterschlagen, ein Diebstahl führt zu einem happy end, weil sich ein Verkäufer nicht zum Hehler machen lassen will.
Über die Bregenzer Festspiele weiß der Auto natürlich ebenfalls viel zu berichten, da die Symphoniker das sie seit Beginn bespielende Orchester waren und sind.
Nur fünf Jahre lang besteht das von Schnitzler gegründete Quartett seines Namens, immer wieder bemerkt der Leser, wie wichtig ihm das Wirken als Kammermusiker ist. Deshalb gibt es auch für das 1968 zum ersten Mal gegründete Haydn-Trio eine Wiederauferstehung, und es besteht bis 2019. Interessant sind die Berichte von den Gastspielreisen, so in die USA, als erstes österreichisches Kammerensemble nach Israel und, weniger erfreulich wegen schlechten Essens und ständiger Überwachung in die Ostblockstaaten einschließlich der Sowjetunion. Ein Raubüberfall in Südafrika und ein gerissener Keilriemen im Nationalpark von Simbabwe sind nur im Rückblick komisch, warteten doch bereits die Löwen auf eine leckere Mahlzeit. Das ist alles sehr spannend und sprachlich gewandt erzählt, nicht selbstverständlich, da ja die Muttersprache des Autors das Englische ist.
Schnitzler beschränkt sich nicht auf eine Darstellung seines künstlerischen Werdegangs, sondern bezieht den Leser in seine Überlegungen zu allgemeinen und engeren künstlerischen Fragen ein, so die leider nicht zu überhörbare Tatsache, dass die Orchester zwar immer technisch perfekter, aber auch miteinander austauschbarer klingen, dass insbesondere asiatische Instrumentalisten technisch einwandfrei, aber „seelenlos“ musizieren. So wagen sich österreichische Jungkünstler kaum noch zu Aufnahmeprüfungen, dies seine Beobachtung.
Schon 1979 hatte Hawaii, hatte der tropische Regenwald den reisefreudigen, vom Vater Globetrottel genannten Schnitzler beeindruckt. 1989 besuchte er zum ersten Mal Costa Rica, und einschließlich der gefährlichen Giftschlangen erfährt alles, was er dort antrifft, eine liebevolle Schilderung. Dabei lässt er es aber nicht bewenden, sondern beginnt mit dem Projekt „Natur freikaufen“ und der Regierung schenken, überwindet unendlich erscheinende Schwierigkeiten und leider auch Boshaftigkeiten von Teilen der Einwohnerschaft, kann nun aber stolz sein auf das Erreichte, das inzwischen kein Einzelfall mehr ist, sondern wohl der erste Schritt zu einer Rückgewinnung des Regenwaldes, der teilweise bereits zerstört, teilweise von Abholzung bedroht war. Gerade als die Rezensentin die letzten Kapitel des Buches las, lief auf Arte ein Film, der davon berichtete, das Costa Rica inzwischen zum Vorbild für eine Rückgewinnung des Regenwalds geworden ist, Schnitzler offensichtlich den Anstoß für eine weiterreichende Bewegung gegeben hat.
Der Geiger beansprucht gut drei Viertel des Buchumfangs, so ist also das Buch vor allem für den Musikfreund, aber durchaus nicht ausschließlich eine lohnende Lektüre. Der Autor selbst stellt abschließend fest, dass ihm die Arbeit als Naturschützer wesentlich mehr bedeutet als die als Geiger, was dem Menschen Michael Schnitzler das allerbeste Zeugnis ausstellt.
275 Seiten, Amalthea Verlag, Wien 2021
Ingrid Wanja 24.10.21
Was soll das?
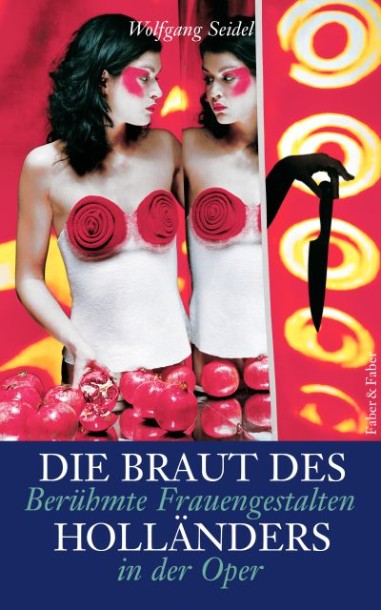
Es wimmelt von Falschem, Ungenauem und Peinlichem
Was erwartet der bildungswillige Leser von einem Buch mit dem Titel Die Braut des Holländers- Berühmte Frauengestalten in der Oper? Wahrscheinlich eine kurze (!) und korrekte (!) Inhaltsangabe, die Beschreibung der Art der literarischen und vor allem der musikalischen Charakterisierung durch den Librettisten und Komponisten, das Ziehen von Verbindungslinien zu eventuellen historischen Vorbildern, wohl auch den Hinweis auf berühmte Gestalterinnen der jeweiligen Partie. Als selbstverständlich darf der Leser auch eine einwandfreie sprachliche Gestaltung des Textes erwarten sowie eine Sprachebene, die der Bedeutung des Gegenstandes angemessen ist.
Was aber offeriert Wolfgang Seidel mit seinem Buch? Seine den einzelnen Opernheroinen gewidmeten Kapitel bestehen zum allergrößten Teil aus reinen, durchaus nicht immer korrekten Inhaltsangaben, verzichten weitgehend auf eine Darstellung der musikalischen Gestaltung, schwanken sprachlich zwischen Hoch-, Umgangs- und Gossen-oder Jugendsprache, letztere wohl der Versuch, sich bei einem jugendlichen Publikum anzubiedern, als „modern“ zu gelten, und wissen außer der Callas keine Interpreten zu nennen.
Der sich einem wie auch immer gearteten Publikum anbiedern wollende Stil meint, dass Elektra „ihr Ding schließlich durchzieht“, dass am Schluss der Oper „Friede, Freude, Eierkuchen“ herrschen (was nicht einmal zutrifft), Elektra „verfilzt“ und „von Kopf bis Fuß auf Rache eingestellt“ ist. Immer wieder werden so unpassende Vergleiche mit der Gegenwart konstruiert, so wenn Agrippina mit Aenne Burda, Scarpia mit Harry Weinstein, Orlando mit Harry Potter in eine Reihe gestellt werden. Gern widerspricht sich der Autor auch selbst, so wenn er einmal meint „und so geht es (mit Morden) bei den Atriden weiter“, dann aber der bereits erwähnte Eierkuchen.
Nicht glücklicher gelingen andere, oft in neckischem Tonfall gezogene Vergleiche , so der von Angela Merkel mit Dido, die auch freundlich Flüchtlinge aufnahm, und weder Senta, noch Isolde noch Brünnhilde können als Muster der Gattinnentreue angeführt werden, da Senta noch nicht verheiratet war, Isolde ihren Gatten betrog und Brünnhilde den ihren ( Gunther) nicht liebte. Nicht einmal die zeitlichen Zuordnungen stimmen, wenn das 19.mt dem 20.Jahrhundert verwechselt , Klassizismus mit Sturm und Drang gleichgesetzt wird. Auch in Kleinigkeiten sollte jemand, der sich als Opernkenner ausgibt, korrekt sein und nicht Desdemonas Mutter mit deren Dienerin verwechseln.
Rigoletto bzw. seine Tochter Gilda ist ein typisches Beispiel dafür, was der Autor alles falsch machen konnte: So verlangte der Duca von seinen Höflingen nicht, dass sie Gilda entführen, landete er nicht in ihrem Schlafzimmer, sondern sie in seinem, ist es albern, vom harten lockdown, der Kirche als Dating-Hotspot zu schreiben, Quatsch zu behaupten, im 19.Jahrhundert dürften höhere Töchter nur in die Kirche und sonst nirgends hingehen. Und sogar „vom Federbett zum Leichensack“ als Untertitel stimmt nicht, denn in Mantua begnügte man sich auch im Winter mit einer leichteren Zudecke. Etwas besser und interessanter wird es mit dem Bezug zu Hugos L’Roi s’amuse“, ehe man sich über die Behauptung ärgern muss, dass Verdi die „Schauerromantik“ suchte, und Putin wie Erdogan bemüht werden.
Es wimmelt einfach von Falschem, Ungenauem, Peinlichem, so der Behauptung, zur Zeit von Così fan tutte seine 99% aller Ärzte Scharlatane gewesen, Alfonso kündige an „eines Tages“ würden Fiordiligi und Dorabella ihre Liebhaber betrügen ( es heißt innerhalb eines Tages), Monostatos Pamina und Tamino gefangen nimmt. Brünnhilde, „die ja auch in keinster Weise von dieser Welt ist“, aber sich dann doch zur „Vollfrau“ mausert, wird sich in dieser Charakterisierung wiedererkennen. Und Athene ist nicht die Kriegsgöttin, sondern die Göttin der Weisheit.
Man könnte noch seitenlang Stilblüten und einfach falsche Aussagen aufführen, sich darüber auslassen, dass höchstens mal vom „donnernden Klang des Orchesters“ in Lucia di Lammermoor“ die Rede ist oder es heißt, das „Riesenorchester schwingt nur noch sehr verhalten vor sich hin“ (Rosenkavalier) , sonst aber kaum über die Musik referiert wird, ein wüster sprachlicher Mischmasch das gesamte Buch durchzieht, und auch das Fazit, dass der Autor aus dem freizügigen Verhalten Carmens zieht, nicht erfreuen kann: „Sie erleidet deswegen aber auch noch ein Schicksal“. Selbst einem Gebäude ergeht es übel, denn Octavian „fährt…vor dem vor Aufregung zitternden Haus der Faninals vor.“ Auch in dieser Oper muss noch einmal die baldige Ex-Kanzlerin ran: Merkel. Aber: „Poppt nicht auf.“ Übrigens ist der Ochs nicht eine Bariton-, sondern Basspartie.
Norma lässt den Autor noch einmal zu Höchstleistungen auflaufen, wenn in sechs Zeilen alle Weltreligionen abgehandelt werden und es auch historischen Epochen nicht anders ergeht. Schließlich bekommt auch noch Senta, die Titelhedin, als „ichschwach“ ihr Fett ab, was der Rezensentin die Lust nahm, sich auch noch mit Violetta oder Tosca zu befassen oder dem, was der Autor aus ihnen gemacht haben mag.
Biographien der Komponisten bilden das letzte Drittel des Buches, das leider ganz ohne Bebilderung auskommt.
290 Seiten
2021 Faber & Faber
ISBN 978 3 86730 217 3
Ingrid Wanja 8.10.2021
Auf der Himmelsleiter

Was kann einen biederen Opernfreund an einem Buch interessieren, das das Modewort Gender mehr als einmal zitiert, das in einer Reihe stehen will mit Werken, in denen „der Blick auf die kulturelle Konstruktion von Geschlecht“ gerichtet ist? Nun, in Band 18 einer langen Reihe mit dem Titel Musik-Kultur-Gender taucht immerhin ein „Paare in Kunst und Wissenschaft“ auf, und die Namen Giuseppe Verdi und Giuseppina Strepponi, Robert und Clara Schumann, Hermine und Eugen d’Albert sowie Galina Wischnewskaja und Mstislav Rostropowitsch lassen Interessierendes vermuten. Die Autoren sind mit einer Ausnahme weiblichen Geschlechts, ebenso die beiden Herausgeberinnen Christine Fornoff-Petrowski und Melanie Unseld, die auch das Vorwort verfasst haben. Der feministische Akzent macht sich bereits in diesem bemerkbar, indem auch den Film The Wife verwiesen wird, in dem eine begabte Gattin die Werke verfasst, für die der Gemahl den Nobel-Preis einheimst, und sogar in der profanen Welt des Schlagers soll es ähnliche Konstruktionen geben, wie das Paar Fischer-Silbereisen beweist. „Geschlechtsbezogene Handlungsspielräume“ sind demnach Mann und Frau zugewiesen oder zumindest zugeordnet gewesen.
Das hatte übrigens bereits der Dichter Jean Paul erkannt, wenn er meinte :“ Die guten Weiber müssen immer die Himmelsleiter tragen und halten, auf der die Männer ins Himmelblau und in die Abendröte steigen.“
Das Buch gliedert sich in vier Teile mit jeweils drei bis fünf Kapiteln, den Themen Schreiben über Paare, Schreiben als Paare, Selbstinszenierung und Konstellationen, Familien, Netzwerke gewidmet.
Das Thema „Paare“ wird bereits im ersten Kapitel von Beatrix Borchard über weite Strecken verlassen, indem nicht die Beziehung Clara Wiecks zu ihrem Gatten im Mittelpunkt steht, sondern die zu ihrem Vater und ihren zahlreichen Halbgeschwistern und Geschwistern, Neffen und Nichten.
Christine Fischer äußert sich über Verdi und Strepponi, und der Leser erfährt zu seiner großen Überraschung, dass die Sängerin nicht nur ihre Kinder aus frühen Beziehungen, sondern auch eins, dass während ihres Zusammenlebens mit Verdi geboren wurde, weggab. Da bricht jäh das Bild vom Komponisten zusammen, der angeblich so wunderbare Vaterfiguren wie Padre Miller, Simone Boccanegra und sogar Padre Gemont schuf, weil er sich selbst heiß, aber vergeblich wieder Kinder wünschte, nachdem die aus erster Ehe verstorben waren. Interessant ist die Erörterung der Frage, inwieweit Giuseppina mit Violetta gleichzusetzen ist, sind auch die Hinweise auf das Mitwirken an Jerusalem oder die Stellung zum Risorgimento, wobei die Zweifel berechtigt sind, dass die vielen dem Tod geweihten Heldinnen Verdis symbolisch für die geknechtete Nation stehen.
Wie heikel die Quellenlage gerade bei diesem Thema ist, zeigt sich im Beitrag Henrike Rosts über das Paar Ignaz und Charlotte Moscheles, er Pianist und Komponist, sie liebende Gattin, die den Künstler gegen die störende Außenwelt abschirmte, ihm so unentbehrlich war, wie er für sie. Stammbucheintragungen und Tagebücher wie Memoiren dürften eines hohen Maßes an Subjektivität nicht entbehren.
Hannah Gerlach schreibt über das Verhältnis Goethe- Frau von Stein und stellt fest, dass letztere in einem ihrer literarischen Werke wohl nicht, wie oft vermutet, die gescheiterte Beziehung aufarbeitete, es sich beim erwähnten Werk nicht um einen Schlüsseltext handelt.
Tagebücher stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen von Vera Viehöver, die „Bi-Textualität“ mit all ihren Problemen wird erörtert, Mendelssohn und Cosima Wagner spielen eine Rolle, generell sollen die Paar-Tagebücher eine Wir-Identität schaffen oder befestigen.
Zunehmend geht es weniger um Musiker-Ehepaare als um Elterntagebücher zu Beginn des 20.Jahrhunderts, um Ehe- und Feldforschung generell, um das Phänomen der romantischen Liebe, die „violent emotional attachments“.
Zur Musik zurückkehrt der Beitrag von Fornoff-Petrowski über d’Albert und seine dritte von sechs Ehefrauen und deren Ehetagebücher als Spiegelbild einer Partnerschaft,in der es vor allem um den Kampf d’Alberts um die Anerkennung nicht nur als Pianist, sondern als Komponist ging. Obwohl selbst Künstlerin, sieht sich Hermine d’Albert hier nur als Gefährtin und Unterstützerin eines Genies.
Auch in Anna Zimmermanns Beitrag erscheinen Frauen als die schleppetragenden Musen, Männer als die Genies, und „heterosexuelle Zumutungen“ beschweren zusätzlich die Gemüter. Der Opernfreund wird wieder aufmerksamer, wenn er zum Kapitel über Wischnewskaja-Rostropowitsch gelangt, in dem Anna Langenbruch übermittelt, dass in der SU, der das Paar 1974 den Rücken kehrte, im realen Leben die Lüge regierte, nur auf dem Theater der Künstler sein wahres Gesicht zu zeigen wagte. Sehr aufschlussreich ist das Bekenntnis, dass das Paar die jeweilige Kunst aus der Beziehung weitgehend heraushielt, künstlerische Konflikte nicht sprachlich bei den Proben, sondern erst während der Aufführung ausgetragen und gelöst wurden. Das macht Lust, die Memoiren der Sängerin zu lesen. Interessant ist auch die Analyse der Kompositionen, die Marcel Landowski über das Paar schuf.
Der vierte und letzte große Block befasst sich mit zwei Musikerinnen, die in ihrer Jugend musikalisch tätig waren ( Margarethe Quidde und Aline Valangin) und die ihre Karriere aufgaben. Dann geht es um die Figur des Dritten in der Beziehung Abramovic-Ulay, um Geigenausbildung als Familiensache anhand der Hellmesbergers und schließlich um Familiennetzwerke, und je konkreter und damit nachvollziehbarer das Dargestellte ist, desto williger folgt auch der operninteressierte Leser den jeweiligen Ausführungen.
328 Seiten, 2021 Böhlau Verlag
ISBN 978 3 412 51948 3
Ingrid Wanja, 16.9.2021
SPRACHEN DES MUSIKTHEATERS
Trübe Aussichten
Selbst an einem strahlenden Sommertag gelesen, könnte einen Opernfreund die Sammlung von Interviews, die Intendant Nikolaus Bachler unter dem Titel Sprachen des Musiktheaters mit Regisseuren führte, in trübe Bußtags- bis Totensonntagsstimmung versetzen, wenn ihm als Quintessenz und Höhe- wie Schlusspunkt in Aussicht gestellt wird, bald würde man auch Eingriffe in die Substanz der Werke als selbstverständlich hinnehmen. Dass Bruchstücke romantischen Liedguts bereits jetzt als Baumaterial für eine zeitgenössische Dichtung benutzt werden, erfährt der Leser in der geheimnisvoll raunenden, mit endlosen Aufzählungen wie krassen Gegensätzen arbeitenden Einleitung zum Buch von Albert Ostermaier, mündend in ein ER, den Regisseur und so recht überraschend doch noch zum Thema des Buches passend.
15 Regisseure hat Bachler befragt, den Anfang macht Hans Neuenfels, mit dessen Frankfurter Aida, in der Brathähnchen zum Triumphmarsch durch die Luft flogen, alles begann, eine Lösung, die verhinderte, dass durch Dirigent Gielen das Stück ganz gestrichen wurde. Wenn Bachler bei Regisseuren zwischen Visionären und Praktikern unterscheidet, dann gehört Neuenfels sicherlich zu den Ersteren, allerdings nicht nur in seiner Regiearbeit, sondern auch, wenn er rückblickend meint, die Sänger seien zwar nicht immer sofort mit seinen Lösungen einverstanden gewesen, letztendlich aber doch, wobei er Julia Varady als Beweis nennt. Wer Einblick in die Zustände an der Deutschen Oper Berlin der 80er und 90er hatte, weiß allerdings auch um einen Dano Raffanti, der als Duca wegen der Regiezumutungen nicht seine gewohnte Leistung abrufen konnte, von einem Alexandru Agache, der als Nabucco erst durch Intendant Götz Friedrich wieder zurück auf die Probenbühne geholt werden konnte ( Was ihm der Regisseur auf der Premierenfeier übel vergalt.) einem Paolo Coni, der fassungslos über die Trovatore-Produktion und entsprechend beeinträchtigt war. Man sollte also mit Vorsicht genießen, was einem als Leser sowohl vom Interviewer wie vom Interviewten aufgetischt wird.
Es folgt das Interview mit dem Polen Krzysztof Warlikowski, in dem es nicht nur um Regie geht, sondern u.a. auch um den polnischen Antisemitismus oder den Umgang der polnischen Gesellschaft mit Aidskranken, der Oper nähert man sich wieder mit dem Erstaunen des Regisseurs über die unfreundliche Aufnahme seine Iphigenie-Inszenierung durch das Pariser Publikum. Romeo Castellucci und sein Kollektiv Societas Raffaello Sanzio schließen sich an, der Text atmet die Begeisterung für die Schönheit, Dankbarkeit für den Wahnsinn, für diese, der Oper innewohnende Schönheit so viel Geld auszugeben, wie es zumindest in Deutschland geschieht. Frank Castorf behauptet zwar zu Beginn, DDR und Volksbühne vollkommen vergessen zu haben, widerlegt dies jedoch sofort mit einem endlosen Schwall von Erinnerungen daran. In gewohnter Weise kokettiert er mit der Ablehnung, die seine Arbeiten erfahren, meint über das Orchester, „man muss es eigentlich besiegen“, was immer das auch heißen mag. Auf Zustimmung dürfte er mit der Behauptung stoßen, Berghaus, Müller und Konwitschny, d.h. ihren Arbeiten, mangele es an Sinnlichkeit. Ob an ihn Andreas Kriegenburg gedacht hat, wenn er meint, die meisten Regisseure seien „sozial gestört“? Seine Ausführungen liest man gern, sie bestätigen Bachlers Behauptung, bei Kriegenburg handle es sich um einen „poetischen Regisseur“, der sich übrigens selbst als „handwerklicher“ Vertreter der Gattung sieht. Arpad Schilling ist einer der vielen Opernregisseure, die nie Opernregie studiert oder durch Assistenz erlernt haben, aber die Forderung nach einem Rigoletto ohne Buckel verzeiht man ihm. Andreas Dresen kommt vom Film, studierte vor der Inszenierung der Fanciulla del West das Leben moderner Bergarbeiter, strebt aber das Gegenteil von Realismus an. Donna Anna sieht er der Lüge überführt, weil sie im Piano nach Hilfe ruft. Hat er schon einmal von einem vor Entsetzen fast erstickten Schrei gehört? Als Laienverfassungsrichter lehrt ihn die Wirklichkeit vielleicht noch einiges an Psychologie.
Amélie Niermeyer sieht Regiearbeit als Teamarbeit, aber auch hier kommt, wie in allen bisherigen Beiträgen, der Dirigent nicht vor. Der wird erst genannt, als es darum geht, diesen Berufsstand „offener werden (zu lassen) für Eingriffe“, wohl solche, die es ihr ermöglichen „in die Extreme (zu) gehen.“ Gleiches schöpferisches Vermögen wie das eines Malers oder Schriftstellers sieht David Bösch im Regisseur verborgen. Und mit dieser Gabe will er auch „bei 80jährigen was bewirken“. Ob es Martin Kusej gelingt, einerseits mit den Dirigenten zusammen zu arbeiten und gleichzeitig in die Substanz eines Werks einzugreifen? Ihm ist es „nicht mehr als ein Kodex, demzufolge das Werk unantastbar und sakrosankt ist“. Gleichzeitig plagt ihn die Angst, als „alter weißer Mann“ nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein.
Zu Sinnlichkeit und Kitsch, wenn auch mit schlechtem Gewissen, bekennt sich Axel Ranisch, aber auch zur „Pflicht, zu suchen, von welcher Seite das Stück noch nie betrachtet worden ist“. Das wird natürlich immer schwieriger, bald gibt es nichts mehr, was nicht schon war. Vielleicht besinnt man sich dann wieder auf die Musik.
Nach dem Choreographen Sidi Larbi Cherkaoui kommt Mateja Koleznik zu Wort, die mit der Einsicht erfreut, „die Musik spielt eine große Rolle“, den Dirigenten aber als Konkurrenten sieht. Sympathisch berührt, dass sie sich nicht als Künstlerin sieht, das Werk nicht neu erschaffen, sondern nur in einem neuen Licht escheinen lassen will. Ein Dirigent wie Riccardo Muti, der um den perfekten Klang im Zusammenspiel von Orchester und Sängern besorgt ist, ist da allerdings ein Störenfried.
Erfrischend in seiner Direktheit, Unvoreingenommenheit und seinem Realitätssinn ist der Beitrag von Barrie Kosky, besonders aber in seiner Toleranz gegenüber den Teilen des Publikums, denen es vor allem um die Musik und die Sänger geht, da bekennt er sogar: „Wenn die Stimmkunst außergewöhnlich ist, erträgst du alles“. Wer außer ihm kommt in diesem Buch schon zu der Einsicht, dass Regietheater im Widerspruch zum Musiktheater steht, dass es Dilettanten anzieht und duldet, dass es „zur Parodie seiner selbst“ geworden ist. „Man hat es oder man hat es nicht“- die Fähigkeit, ein Stück zeit-, publikums- und werkgerecht auf die Bühne zu bringen. Und nicht nur überzeugend, sondern darüber hinaus sympathisch ist das Zugeständnis, zwei Enttäuschungen erlebt zu haben: die Operette für das 21. Jahrhundert nicht neu haben erfinden können und keine Antwort auf die Frage zu haben: Was soll Oper jetzt sein. Am ehesten wohl die Rückkehr zum griechischen Modell sei vorstellbar.
Nach so vielen klugen und tröstlichen Bemerkungen erträgt man sogar noch die wehleidigen Ausführungen von Dmitri Tcherniakov über seine Befindlichkeiten beim Inszenieren von Opern und hofft inständig, dass die von Interviewer und Interviewtem ausgesprochene Vermutung, bald würde man in die Partitur eingreifen können, nie Realität wird.
320 Seiten, Schirmer/Mosel 2021
ISBN 978 3 8296 0926 5
Ingrid Wanja 30.8.2021
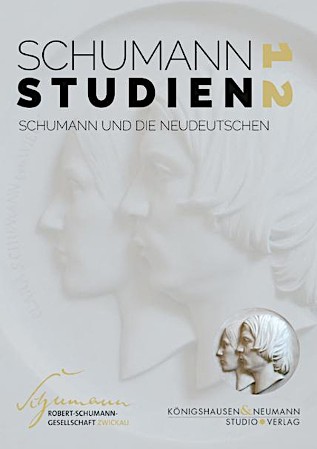
SCHUMANN UND DIE NEUDEUTSCHEN (und Wagner und die Oper)
Wagner und Schumann: das Verhältnis der beiden Meister kann, zumindest von Seiten Schumanns, nicht anders denn als „ambivalent“ bezeichnet werden. Bekannt ist ja der Umstand, dass Schumann nach der Lektüre des Klavierauszugs des Tannhäuser meinte, dass die Oper wenig tauge, bevor er nach dem Besuch der Oper sein Urteil derart revidierte, dass wir zumindest davon ausgehen können, dass er dem Werk mehr abgewinnen konnte als jene ignorante Zeitgenossen (wie den Idioten Julius Schladebach und später seinem eigenen System zum Opfer gefallene Eduard Hanslick, der den Tannhäuser allerdings noch sehr schätzte), die just im melodiereichen und dramatisch packenden Tannhäuser einen völlig unfähigen Musiker am Werk sahen. Wie differenziert Schumann über den halbwegs jungen Wagner zu urteilen mochte, und wie sehr dieses Urteil von der allgemeinen Opern-Situation im Sachsen der Jahre um 1840 beeinflusst wurde: man erfährt‘s in einem neuen Sammelband, dessen Titel – Schumann und die Neudeutschen – auch durch die Alternative Schumann, Wagner und dessen Anhänger und Gegner hätte ersetzt werden können. Denn Wagner spielt hier neben dem Protagonisten der Schumann-Studien die zweite Hauptrolle. Kein Wunder, denn die gesammelten Vorträge wurden 2013, also im großen Jubeljahr zum 200. Geburtstag Richard Wagners, auf einer Tagung in Schumanns Geburtsstadt, bei der Robert-Schumann-Gesellschaft Zwickau, gehalten – und bereits acht Jahre später erschien der Tagungsband. Nur schade, dass, wie im Vorwort mitgeteilt wird, zwei Vorträge (von Werner Breig und Joachim Draheim) „leider nicht rechtzeitig zur Drucklegung eingereicht“ wurden. Wissenschaftliche Realsatire kann ja so schön sein.
Dass es vielfältige Bezüge Wagners zu Zwickau gibt, ist interessant, wesentlich aber ist, nicht allein für einen Opernfreund, die Auseinandersetzung um Schumanns einzige vollendete Oper und die Frage, wieso er keine zweite komponierte und die einzige bis heute als problematisch und undramatisch gilt, so dass sie nur an heiligen Feiertagen szenisch realisiert wird. Schumann hatte, Eckhard Roch macht das in seinem Beitrag klar, die selben Schwierigkeiten wie Mendelssohn, der alle Genres mit Hauptwerken ausfüllte, aber im Medium der Oper letzten Endes scheiterte. Schumann muss es als Schmach empfunden haben, dass der Kollege ihm mit seinen „Mittelalter-Opern“ die schönsten Stoffe quasi vor der Nase wegschnappte und gleichzeitig bewies, dass man nicht Jahre über einem Sujet brüten musste, um publikumswirksame „Schlager“ zu schreiben. Die Unähnlichkeit zwischen dem bis an die Grenze des Verstummens agierenden Schumann und dem Vielredner Wagner beschränkte sich nicht allein auf die absolut verschiedenen Charakterzüge, oder anders: Die Tatsache, dass Schumann bei seiner Oper von der ästhetischen Leitlinie der Instrumentalmusik ausging (worauf schon Hanslick hinwies) und dramatische Verläufe nicht zu komponieren vermochte, hängt mit zwei unterschiedlichen Zugängen zur Musikdramatik zusammen. Theoretisch aber verband sie, so Roch, die Idee der „Oper ohne Text“ – nur fand Wagner dafür schnell die Mittel in der Integration des Orchesters in das Drama, während Schumann sich in anderen Gattungen betätigte, um seine halbszenischen Ideen zu verwirklichen. Michael Heinemann erläutert, wie Schumann Byrons Manfred bearbeitete, um seine Vision einer Mischform aus Oper und Konzertsaalstück mit einer „subjektiven Anverwandlung“, einer katholischen Umdeutung des Stoffs, zu retten. Mit diesem Stück im Blick erklärt sich vielleicht auch, wieso Schumann ausgerechnet nach Dresden ging, wo gerade eine „neue deutsche Kunst des Musiktheaters“, von der Grand Opéra Rienzi zum erzromantischen Holländer, erfunden wurde. Das Paradies und die Peri, die Genoveva, die (jüngst von Jürgen Flimm inszenierten) Faust-Szenen und Manfred bilden, so gesehen, einen engen Zusammenhang, wo „Kunst, Religion und Ich-Exuberanz“ in Werken aufscheinen, denen später Wagners Opern und Musikdramen antworten werden.
Genoveva spielt auch eine Rolle in den kritischen Texten Franz Brendels, des Redakteurs der von Schumann mitbegründeten Neuen Zeitschrift für Musik. Man kann es nicht oft genug sagen: Die Beschäftigung mit der Musikpublizistik (nicht allein des 19. Jahrhunderts, aber besonders mit dieser) sagt uns Wesentliches über die Grabenkämpfe und ästhetischen Schlachten, in deren Mitte zumal die „Neudeutschen“ standen. Etliche Beiträge des Bandes arbeiten Wagners Arbeiten für Schumanns Zeitschrift auf und erläutern den Nutzen, den die Beiträge der anderen Mitarbeiter für Wagners Propaganda hatten. Eine komplette Tabelle listet alle 29 Nummern auf, die unter Schumanns Ägide über Wagner veröffentlicht wurden, analysiert ihre Quelle (bisweilen war das Wagner selbst) und zitiert die wichtigsten Passagen. Wagner nutzte die Zeitschrift ganz gezielt für seine Popularität, bevor er Theodor Uhlig darin antrieb, gegen Schumanns Werke so zu polemisieren, wie Wagners Hauspianist Joseph Rubinstein es noch Jahrzehnte später in einem kindischen Aufsatz tat, der 1882 in Wagners Hauszeitschrift, den Bayreuther Blättern, erschien, als Wagner kein einziges gutes Wort mehr gegen den einstigen Geschäftspartner und Kollegen zu sagen und schreiben vermochte. Weitere Zeitungsautoren haben eigene Aufsätze erhalten: Emanuel Klitzsch (mit einer umfangreichen Publikationsliste) und Richard Pohl, der Schumann abwertete, um seinen Halbgott Wagner aufzuwerten, obwohl oder vielleicht: gerade weil er, mit leicht frustrierenden Erfahrungen, an Des Sängers Fluch und einem nicht geschriebenen Luther-Oratorium als Librettist mit Schumann zusammengearbeitet hatte.
Auch wenn ein abschließendes Wort zum Verhältnis Schumanns zu Wagner nicht möglich zu sein scheint, weil Schumann zwar weder den Lohengrin noch die folgenden Musikdramen zur Kenntnis nehmen konnte, doch in seiner Abwägung zwischen dem dramatisch begabten und (angeblich) unmelodiösen Wagner eine annähernd vermittelnde Position einnahm, bleibt die Frage, wie das Verhältnis Schumanns zu den „Neudeutschen“, zu denen auch Wagner gezählt wurde, eingeordnet werden kann. Es war wohl das Verständnis des „Poetischen“, was Schumann von Berlioz, Liszt und schließlich auch Wagner trennte. Wagners böse Auslassungen gegen den angeblich impotenten Schumann und dessen angeblicher Unfähigkeit zur „Melodie“ (ein seltsames Spiegelbild zu Schumanns Auffassung von Wagners Unfähigkeit, eben diese zu schreiben) fußen vielleicht auf eben diesen Unterschieden. Ironischerweise – darauf weist Jon W. Finson hin – gibt es auffallende Ähnlichkeiten zwischen dem Vorspiel des Fliegenden Holländers und dem Beginn der Symphonie op. 38. Und wenn man mit Carl Dahlhaus die Beobachtung macht, dass noch der Lohengrin über regelmäßige Periodenstrukturen verfügt und Schumann an Berlioz‘ Symphonie fantastique die Unregelmäßigkeit schätzte, die Wagner schließlich perfektionierte, könnte man auf rein strukturellem Gebiet die Meinung vertreten, dass sich die beiden so nahe wie fern waren – auch in ihren Tätigkeiten für die Dresdner Liedertafel (ein instruktiver Beitrag von Sebastian Nickel).
Wer zuletzt wissen will, wie Schumanns und Wagners Beziehungen sich chronologisch darstellten, sollte Gustav F. Jansens Aufsatz lesen, den er um 1900 verfasste, und der hier zum ersten Mal veröffentlicht wurde, allerdings ohne die - bis auf den ersten Brief - in der großen Schumann-Brief-Edition veröffentlichten Briefe Wagners an Schumann. Mit seinen Originalquellen, etwa einer wüsten Polemik gegen Wagner von 1846 und der Meinung Louis Spohrs, dass die Musik des Tannhäuser und des Lohengrin „gequält, schaudervoll und ermüdend“ klinge, ist er eine schöne kleine Fundgrube zum zeitgenössischen Wagner-Bild geworden, die trotz Ulrich Konrads Studie zu Schumann und Wagner ihren Wert behielt: so wie Schumanns Werke gegen Wagners Opern.
Schumann und die Neudeutschen (= Schumann-Studien 12). Studio-Verlag im Verlag Königshausen & Neumann. Hrg von Thomas Synofzik und Ute Scholz. 392 Seiten, 16 Abbildungen. 48 Euro.
Frank Piontek, 16.8. 2021
Riccardo Muti zum 80.
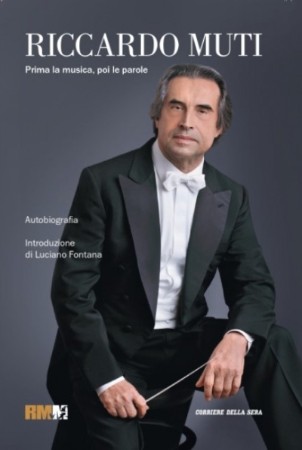
Nun ist es endlich geschafft, der Geburtstag, am 28.7. gefeiert, ist vorbei, nachdem wochenlang zuvor vom letzten Regenbogenblättchen bis zum seriösen Corriere della Sera die italienische Presse und wohl nicht nur diese Riccardo Muti, der auf di 80 wie das Kaninchen auf di Schlange zu starren schien, immer wieder die magische Zahl und die mit ihr verbundenen, nicht immer positiven Gedanken hatte wiederholen lassen. Geblieben ist, ebenfalls vom Corriere zu verantworten, die Autobiographie des Dirigenten mit dem Titel Prima la musica, poi le parole, die man zusammen mit der Zeitung kaufen konnte und, wenn man Glück hat, sogar noch jetzt versteckt unter Krimis und Liebesromanen, erwerben kann. Wer wegen des bekannten Zitats eine kämpferische Auseinandersetzung mit moderner Regie erwartet, wird enttäuscht, es geht darum, dass der Maestro, nachdem er Jahrzehnte lang Musik zu Gehör brachte, nun das Wort ergreift, um seine Erinnerungen mitzuteilen, seine Ziele, die er sich durchaus noch gesteckt hat, und optimistisch stimmt auch, dass die Rückseite des Buches ein Foto ziert, auf dem der Maestro nicht das Dirigentenpult verlässt und seinem camerino und dem Rentnerdasein zustrebt, sondern den umgekehrten Weg und damit zu weiterem musikalischem Schaffen geht.
Das Buch wurde mit Hilfe von Marco Grondona geschrieben, die Einführung stammt von Luciano Fontana. Dieser schaut auf die jüngste Vergangenheit, die der dank Corona verpassten Gelegenheiten besonders in den USA, speziell Chicago, aber auch auf den Neubeginn, der für Riccardo Muti in Wien mit dem Neujahrskonzert, im heimischen Ravenna mit seinem Orchestra Luigi Cherubini, dem Bellini-Festival auf Sizilien und, seit 1970 in Vorbereitung, mit der Missa solemnis in Salzburg besteht.
Wer den Maestro nur als strengen bis abweisenden Künstler kennt, als den er sich auch selbstkritisch und es mit Zurückhaltung erklärend sieht, der wird sich wundern, wie viel Humor in dem Buch verborgen ist, daneben aber auch die bewusste Zurschaustellung einer weitumfassenden humanistischen Bildung, die den deutschen Leser auf Nietzsche, Goethe, aber auch die Letzten Briefe aus Stalingrad stoßen lässt. Und nicht zuletzt die Verehrung für Friedrich II. von Hohenstaufen ließ ihn ein Grundstück zu Füßen von Castel del Monte in Puglia, wo er aufwuchs, erwerben. Geboren allerdings wurde Muti in Neapel, wo seine Mutter jeweils zur Entbindung auch mitten im Krieg reiste, damit die Kinder einen prominenten Geburtsort vorweisen konnten.
Der Leser wird nicht nur durch die Bildungsstätten geführt, die der junge Muti durchlief, erfährt etwas über den Violinisten, Pianisten und schließlich natürlich Dirigenten, auch die Schlachtfelder des Dirigenten, auf denen er meistens als Sieger zurücklieb, werden besucht: der Kampf um die Entvulgarisierung der Veristen, die eitlen Wünsche von Tenören wie Tucker, der unbedingt La commedia è finita singen musste, die nicht komponierten, aber so gern zur Schau gestellten hohen Cs oder Do di petto. Aber auch mancher Bariton ist nicht frei von Eitelkeiten, ein Sopran wie Leila Gencer sehr kämpferisch, und den Bruch mit der Scala, wohl nie ganz verwunden, sieht Muti bereits mit der Traviata ohne Orchester, aber ihm am Klavier sich abzeichnen. Ansonsten bleibt das Buch bei diesem Thema recht wortkarg.
Wichtige Persönlichkeiten für das künstlerische Reifen des jungen Dirigenten werden portraitiert, so Nino Rota, Antonino Votto, Swjatoslav Richter, Vittorio Gui und viele andere, die in einem der letzten Kapitel noch außerhalb der Chronologie gewürdigt werden. Ab 1968 ist Muti direttore stabile in Florenz, setzt sich für Spontini ein, dessen Agnese di Hohenstaufen er gern einmal in deutscher Sprache aufführen würde! Viele unvergessliche Produktionen entstehen mit ihm und Ronconi als Regisseur, Pizzi als Ausstatter. Ab 1971 (Don Paquale auf Vorschlag von Karajan) dirigiert er in Salzburg, seit 1972 in London, die ersten rapporti delicati mit der Regie gibt es in Paris mit einem französisch-italienischen Misch-Trovatore und in Salzburg mit einem Tito.
Das Buch beschränkt sich nicht auf eine Lebens- und Karrierebeschreibung, sondern schneidet viele wichtige Themen an wie den Vergleich des Orchesterklangs zwischen italienischen und deutschen Gruppen, die besonderen Klangvorstellungen, Rossini oder Verdi betreffend, in Philadelphia das ausschließlich weiße Publikum, die Absenkung des Diaposon für Otello, die Vorzüge des in der Scala ausgebuhten Don Carlo von Pavarotti mit der berüchtigten stecca, eine von Humor geprägte Begegnung mit Königin Elizabeth. Man kann einfach nicht aufhören zu lesen, weil immer wieder neue, interessante Fragen angeschnitten werden wie die Überführung von Richard Strauss durch einen neapolitanischen Musiker, der meinte, es gebe überhaupt keine spiaggia a Sorrento und damit sei dessen so genanntes Stück aus den italienischen Bildern einfach Quatsch.
Das neunte Kapitel schließlich widmet sich den Persönlichkeiten, die auf den jungen oder auch reifen Maestro besonderen Eindruck gemacht haben: Papst Benedikt, für dessen Laudate Dio con Arte er das Vorwort schrieb, Callas, der er die Lady Macbeth anbot und die meinte È tardi, Cesare Siepi, Christa Ludwig, Di Stefano, der wenigstens La cena è pronta für ihn sang. Im umfangreichen Bildteil am Schluss ist auch eine Danksagung von Carl Orff für die Aufführung der Carmina in Berlin, die er eine zweite Uraufführung nennt, zu sehen.
Wichtig für Muti ist offensichtlich nicht nur, was er aufführt, sondern wo er es zu Gehör bringt. So sind die nach dem jedes Jahr nach dem Festival in Ravenna stattfindenden Viaggi dell’Amiciza, immer in eine città martiri führend, ein besonderes Anliegen so wie auch Aufführungen an besonderen Orten wie dem Mailänder Gefängnis. Nie die Kammermusik aus den Augen und Ohren verlieren und eine ethische Haltung zum Beruf des Musikers einnehmen, das soll die Botschaft neben vielen Konzerten und Aufführungen sein, die Riccardo Muti in den nächsten Jahren, und das Vorwort kokettierte mit 120 erreichbaren, verbreiten will.
2020 Seiten plus umfangreicher Fototeil
Corriere della Sera Storie 2021
ISSN 2038 0844
Ingrid Wanja 13.8.2021

Dialoge mit fünfzehn zeitgenössischen Regisseuren
320 Seiten, Verlag Schirmer / Mosel Literatur, 2021
Als Nikolaus Bachler, damals noch als „Klaus“ Bachler bekannt, seine Direktionsära am Wiener Burgtheater beendete, hinterließ er (zum allgemeinen Erstaunen) kein Buch, das seine Ära dokumentiert hätte, sondern einfach nur eine Menge DVDs mit Aufzeichnungen von Inszenierungen. Wenn Nikolaus Bachler nun (wie die Zeit vergeht!) auf seine 13 Jahre als Intendant der Bayerischen Staatsoper zurück blickt, gibt es ein Buch – aber auch nicht unbedingt das, was man erwartet hätte.
Keine bebilderte Chronik (mit Triumph-Kritiken-Zitaten), sondern einen quasi essayistischen Interview-Band. Bachler hat sich mit 15 Regisseuren, die in seiner Ära tätig waren, gesprächsweise auseinander gesetzt. Sie sind (nur wenige Namen fehlen) die Creme de la Creme des heutigen „Regietheaters“. Und das erweckt natürlich auch in hohem Maße das Interesse jener Opernfreunde, denen bei manchen Produktionen der Genannten die Haare zu Berg gestanden sind…
Unkonventionell ist schon die Einladung, von Albert Ostermaier „gedichtet“, eine poetische, kaum fassbare Träumerei über einen Mann in der Oper. Auch andere Erwartungen werden relativiert: Es geht, wie man an den Gesprächen bald merkt, nicht ausschließlich ums Inszenieren. 13 Männer und 2 Frauen, alle mit Ausnahme eines Choreographen in der Regie tätig (viele sowohl im Theater wie auch in der Oper unterwegs), erzählen auch sehr von sich, manchmal so persönlich, dass sie ihre Jugend ausführlich schildern, ihre Ängste, ihre Träume.
Man erfährt von jenen, die in Polen (Krzysztof Warlikowski, *1962 – „Hau ab aus dem verdammten Polen!“), Ungarn (Árpád Schilling, *1974) oder Slowenien (Mateja Koležnik, *1962) geboren wurden, wie sie ihre Heimatländer empfunden haben (und heute beurteilen).
Die DDR spielt selbstverständlich bei vielen der deutschen Regisseure eine große Rolle – interessant, dass nicht einer von ihnen von den Härten des Regimes spricht, alle scheinen sich da fast gemütlich eingerichtet zu haben, als wäre es eine Operetten-Diktatur gewesen, wie Leander Haussmann sie uns in einigen Filmen so amüsant gezeigt hat…
Viel Persönliches erfährt man darüber hinaus, etwa die Resignation, die aus Martin Kusej (*1961) spricht, der sich altern fühlt und der sich der Gefahr ausgesetzt, sieht, ein „alter weißer Mann“ und damit verächtlich zu sein. Da kann er sich nur auf seine Minoritäten-Herkunft als Kärntner Slowene zurück ziehen, um etwas an Unangreifbarkeit zu erreichen…
Interessanterweise erfährt man auch vieles von „hinter den Kulissen“, etwa gleich beim ersten Gesprächspartner, Hans Neuenfels (*1941). Nikolaus Bachler, der das Wort „Regietheater“ an sich ablehnt, verwendet es in seinem ersten Satz, weil er meint, dass mit Neuenfels’ „Aida“ das begonnen habe, was man unter Regietheater versteht. Neuenfels erzählt, dass die Initiative damals von Michael Gielen ausging, der Intendant in Frankfurt war und „Interpretation einforderte“: Der Triumphmarsch in „Aida“ ging ihm ideologisch dermaßen gegen den Strich, dass er sogar erwog, ihn zu streichen (!!!). Die Lösung bestand darin zu zeigen, wie die mitgeführten Gefangenen verhöhnt wurden – und „Aida als Putzfrau“ machte deren Stellung am ägyptischen Hof klar… Seit damals galt, dass eine Interpretation „Haltung“ zeigen müsse. (Und seit damals gilt, dass die Zuschauer als uneinsichtige Tröpfe betrachtet werden, die man ununterbrochen belehren muss…)
Eine entscheidende Frage für jede Operninszenierung ist der Ausgangspunkt – von der Musik aus, wozu sich viele bekennen, vom Text aus (was sogar ein Dirigent wie Riccardo Muti sagt)? Dass Oper schwieriger ist als Theater, wo man mit der Sprache machen kann, was man will, und jede Szene beliebig dehnen, anreichern oder raffen, ist klar – alle Regisseure wissen, dass (noch) die Musik eisern die Zeit vorgibt, innerhalb deren man etwas erzählen muss…
Man schreitet mit Bachler von Persönlichkeit zu Persönlichkeit – Romeo Castellucci (*1960), wobei mancher Wagnerianer in Erinnerung an dessen Münchner „Tannhäuser“ Gänsehaut bekommen mag und dessen Erläuterungen etwas diffus klingen. Frank Castorf (*1951), der einfach alles locker sieht („Man darf die Mächtigen nicht zu ernst nehmen“). Andreas Kriegenburg (*1963) charakterisiert den Kollegen Castorf so: „So wie ich ihn kenne, hat seine Haltung eher mit einer jungenhaften Lust an der Provokation zu tun.“ Kriegenburg stellt Überlegungen zum Bühnenbild an und hat mit dem Tangotanzen noch ein anderes Leben. Desgleichen Andreas Dresen (*1963), vordringlich Filmregisseur, der dennoch an die Zukunft der Oper glaubt, einen Teil seiner Kraft aber auch darauf verwendet, Richter am Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg zu sein. Amélie Niermeyer (* 1965) tut Nikolaus Bachler den Gefallen, seine Verdienste zu definieren: „Ihre Intendanz in München hat einen Fokus auf Regie gelegt sowie auf unterschiedliche Handschriften und Herangehensweisen gesetzt.“ Sie tut sich in der Welt der Oper leichter als in der des Theaters, weil sie Opernfreunde offener für Regieideen findet. David Bösch (* 1978) weiß viel über die Unterschiede von Theater und Oper (die schon erwähnte Zeitvorgabe durch die Musik), Axel Ranisch (*1983) ist in allen Medien tätig, nennt vor allem den Film als seine zentrale Welt, liebt aber die Oper: „Ich brauche die Sinnlichkeit und den Kitsch.“ Der flämisch-nordafrikanische Choreograph Sidi Larbi Cherkaoui (*1976) bringt die Stimme des Tanztheaters ein. Und schließlich noch Dmitri Tcherniakov (*1970), der sich so viele Gedanken macht – und dann einen „Holländer“ ganz ohne Meer inszeniert, obwohl Wagner es doch mit komponiert hat…
Eines der interessantesten Gespräche führte Nikolaus Bachler mit Barrie Kosky (* 1967), nicht nur, weil dieser so witzig ist, sondern auch, weil er immer „down to earth“ bleibt und sich nie in den Schlingen hochgestochener Überlegungen und Interpretationen verfängt. Kosky, Nachfahre von polnischen Juden, die in der Entertainment-Branche tätig waren, und einer jüdisch-ungarischen Großmutter, die ihm deutsche Hochkultur predigte. So kam er von Australien über Wien, wo er sich (wir erinnern uns an seine Zeit am Schauspielhaus) gar nicht wohl fühlte, nach Berlin. Ein Weg, den so viele gegangen sind – die Stadt Berlin mit ihrer geistigen Lebendigkeit als Ziel der Wünsche von Theaterschaffenden.
Das immer wieder (in auch anderen Gesprächen) angesprochene Thema, dass man es im Musiktheater zu fast hundert Prozent mit „alten“ Werken zu tun habe, betraf auch Kosky in seiner Arbeit als Direktor der Komischen Oper. Seine beiden großen Enttäuschungen nach zehn Jahren Intendanz hier – dass er keinen Weg gefunden hat, die Operette für das 21. Jahrhundert neu zu erfinden, und dass die Uraufführungen, die er beauftragt hat, nicht erfolgreich waren… (Wovon viele Intendanten ein Lied singen können.)
Die Frage bleibt offen, wie oft sich die Interpretations-Überlegungen, die man in vielen der Gesprächen liest, erkennbar umsetzen und dem Zuschauer die von den Regisseuren gewünschten Ergebnisse wirklich klar machen – denn daran hapert es immer wieder. Ideen, die Papier bleiben und auf der Bühne in den Augen der Betrachter wie totale Willkür erscheinen…
Last not least, und das begleitet das ganze Buch, erfährt man sehr viel über Nikolaus Bachler selbst, persönliche Erinnerungen, durchformulierte Überzeugungen. Gewissermaßen statt einer Biographie? Vielleicht kommt sie noch – er hätte ja aus seinen verschiedenen hohen Funktionen einiges zu erzählen.
Am Ende stehen unbefriedigende Kurzbiographien der Interviewten, nicht einmal mit dezidierten Hinweisen darauf, was sie in München gearbeitet haben. Dem Intendanten geht es also nicht so sehr um seine Ära, als um das breite Feld der gegenwärtigen Meinungen zur Opernregie und um deren Persönlichkeiten. Ehrenwert.
Schade, dass er (wissentlich willentlich) auf einen Bildband mit Besetzungen etc. verzichtet, in welchem man Erinnerungen an die Münchner Ära Bachler hätte optisch auffrischen können. Für manchen Besucher hätte das vielleicht auch zusätzlich Sinn gemacht.
Nikolaus Bachler selbst geht mit 70 noch nicht in Pension, sondern zieht, wie bekannt, beruflich nach Salzburg zu den Osterfestspielen weiter, heiß umstritten in dieser Funktion von Anfang an, als er seine dortige Tätigkeit aufnahm. Aber das ist er ja gewöhnt.
Renate Wagner 3.8.2021
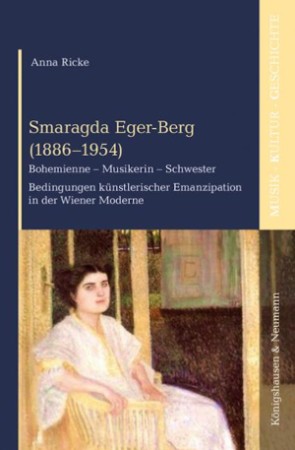
Mehr als „die Schwester“: Smaragda Eger-Berg. Eine kulturwissenschaftliche Studie von Anna Ricken
Dass sie eine „Schwester“ war: auch diese Information findet sich, doch bezeichnenderweise an dritter und letzter Stelle, im Untertitel eines dicken Buchs, das allein ihr gewidmet ist. Als Schwester eines großen Mannes haben sie große Teile der Mit- und Nachwelt wahrgenommen, freilich auch nur als Subjekt, das allein deshalb interessant schien, weil ihr Bruder Alban Berg hieß. Wer informierter schien, verglich sie aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung mit einer Figur, die Berg auf die Bühne gebracht hatte: die lesbische Gräfin Geschwitz. Zugegeben: besonders herausragend war (die Formel muss erlaubt sein, auch wenn jedes Leben als individuelles gelebt wird) Smaragda Eger-Bergs Existenz, vergleicht man sie nur mit der ihres weltberühmten Bruders, des Komponisten des Wozzeck, der Lulu, des Violinkonzerts und der Lyrischen Suite, gewiss nicht, auch wenn sie immer wieder auf interessante Zeitgenossen traf und ein schwieriges, von Liebes- und Lebenskrisen durchwirktes Privatleben hatte. Dass es sich mit der bloßen „Adaption der Künstler:innenkonzepte [!] der Wiener Boheme“ erklären lässt, kann indes bezweifelt werden: der Mensch ist ein wenig mehr als das Objekt einer nachträglich rekonstruierbaren Kulturgeschichte. Anders als Berg (der Berg) oder selbst Alma Mahler-Werfel, deren Wirken sich nicht darauf beschränkte, die Ehefrau dreier bedeutender Künstler gewesen zu sein, hinterließ „die Schwester“ keine Werke. Warum also kann eine biographische Arbeit mit gehörigem Umfang über sie geschrieben werden? Anna Ricke vermag es, in wenigen Zeilen, das Projekt zusammenzufassen: „Ihre Biographie legt nahe, dass Künstlerinnenschaft nicht nur ein Ausleben kreativer Energien ermöglichte, sondern überdies in bestimmten Zeiten für eine bestimmte Gruppe Frauen einen Möglichkeitsraum für gesellschaftliche Nonkonformität öffnete, für den der Musikberuf zugleich das Netzwerk und die finanzielle (Zu-)Versorgung sicherte. Zugleich wird deutlich, dass dieser Raum vielfach begrenzt war: Nicht nur vollzog sich die Emanzipation vieler Akteurinnen auf der Grundlage finanzieller Absicherung; außerdem setzte spätestens der Nationalsozialismus den Freiheitsbestrebungen von Frauen ein Ende.“ Was vorliegt, ist also keine klassische One-Woman-Lebensgeschichte, die relativ jenseits von Zeitgeist und Raummöglichkeiten geschrieben wurde, sondern eine kulturwissenschaftliche Studie, in der, sehr zugespitzt formuliert, Smaragda Eger-Berg als Platzhalterin für viele andere Frauen ihrer Generation, ihres Interesses und ihrer sexuellen Vorlieben steht – denn gerade aus letzterem Punkt ergaben sich bei ihr jene Perspektiven, die sie in Zeit, Raum und Gesellschaft auch positionierten. Als Angehörige der Gruppe der Bohemiennes der Wiener Moderne war sie indes nicht dazu verdammt, künstlerische Werke zu produzieren. Im Gegenteil: gerade die Impotenz – bezieht man den Begriff allein auf eine Kreativität, die sich in der konkreten Oper, dem Roman, dem Lied oder dem Theaterstück äußert – war das Signum nicht weniger "Lebenskünstler", deren Wirken sich, so Ricke, im bloßen „musikkulturellen Handeln“ (wie Ricke es nennt), im reinen Rezipieren von Kunst und Kultur erschöpfte, wenn man es nicht wie Peter Altenberg oder Anton Kuh vorzog, im Medium der sog. Kleinen Form, dem Feuilleton, denn doch Großes zu leisten. Smaragda Eger-Berg (so hieß sie, nachdem sie geheiratet hatte, so nannte sie sich noch, nachdem die Ehe schon in Jahresfrist gescheitert war) wuchs in einem sehr kulturellen, bürgerlichen und wohlhabenden Elternhaus auf, in dem sie – gleichberechtigt neben ihren Brüdern – an den Kulturgütern teilhaftig wurde; ihr vierhändiges Spiel mit Alban Berg wurde gerühmt und von ihm geschätzt, als Pianistin und Korrepetitorin war sie - die Zeugnisse, etwa einer Frida Leider, lassen keinen anderen Schluss zu - schlicht erstklassig.
Apropos Zeugnisse: Rickes Verdienst besteht nicht allein darin, den Horizont um die Persönlichkeit der „Schwester“, die so sehr Kind ihrer Zeit wie sie eigenständige Akteurin war, über die wenigen meist autobiographischen Mitteilungen eines Erich A. Berg und eines Soma Morgenstern (dessen Buch über Berg nur wärmstens empfohlen werden kann: Alban Berg und seine Idole) durch die erstmalige Auswertung der vielen Briefe und Karten der Biographierten gehörig erweitert zu haben, auch wenn manch Zitat eben nur das belegt, was angesichts des Lebens, das kein Werk hinterließ, sondern beständig an Netzwerken arbeitete, erwartet werden konnte: relative Banalität. Allein auch dies ist aussagekräftig, wo es darum geht, die sozialen und kulturellen Räume zu erforschen, die auch durch Persönlichkeiten wie Smaragda Eger-Berg am Leben gehalten wurden, denn Oper und klassischer Liedgesang sind ohne Korrepetitor nur schwer vorstellbar. Diente Smaragda Eger-Berg auch nur, nach dem ersten Weltkrieg, einen Monat lang an der Wiener Volksoper als Solokorrepetitorin, während sie sich mühselig durchs Leben schlug, so wird ihr Wirken für die „große“ Kulturgeschichte dort interessant, wo sie auf eine Marie Gutheil-Schoder oder Anna Bahr-Mildenburg stieß, der sie exzessive und – zeittypisch – schwülstige Liebesbriefe schrieb. Avantgardistisch war schon ihr Erscheinen in der Wiener Boheme der Vorkriegszeit, in der ihre sexuelle Veranlagung das Interesse für den Musikerberuf nicht zwanglos bedingte, aber stark beförderte. Wir sehen, dass musikpädagogische Berufe Refugien für „andersartige“ Frauen waren. Interessanterweise – das sind so die Widersprüche der Moderne – war ihr Verhalten als Bohemienne so konformistisch wie nonkonformistisch, denn dort, wo alle „anders“ sein wollen (und selbstverständlich vom Geld ihrer Eltern leben), sind alle gleich; den Punks der 80er Jahre ging es nicht anders. Kam hinzu ein auch musikalischer Elitismus und eine Arroganz dem gegenüber, was man als „gewöhnliches“ Leben zu bezeichnen pflegt, was man ihr angesichts mancher „blöder Operette“, die sie zu korrepetieren hatte, und dem Recht, sich gegen eine bestimmte Musik zu entscheiden, nicht verübeln sollte. Smaragda Eger-Bergs finanzielle Situation resultierte nicht zuletzt aus einem bürgerlichen Anspruch heraus, der sich mehr erlauben wollte als ökonomisch möglich war. Es kam – als sie in Berlin lebte – ein Netzwerken hinzu, das kaum über den Tellerrand der Wiener Szene hinausschaute, die sich inzwischen an der Spree angesiedelt hatte. Die kontroversen und freundschaftlichen Begegnungen der eigen-sinnigen Frau mit dem von ihrem Bruder hochverehrten Schönberg, den sie, wohl nicht zu Unrecht, als einen egomanen Typen und miserablen Klavierspieler empfand, gehören zu den amüsanten Passagen des Buchs, aber es ist bezeichnend, dass das Interesse hier wiederum nicht durch sie, sondern im Prinzip durch den „großen Mann“ (der Schönberg zweifellos war) provoziert wird. Auch für diese Quellenauswertung darf man dankbar sein.
So führte sie, wie sie selbst bemerkte, ein „Leben zwischen Kunst und Liebe“. Abgesehen vom Alltag des Korrepetierens, das im Anhang nach den verfügbaren Quellen vollständig gelistet wird, bleiben die Kontakte mit bemerkenswerten Werken und Aufführungen: sie war die erste Interpretin der Jugendlieder ihres Bruders, sie war bei den Proben des Pierrot lunaire dabei (die sie kenntnisreich kommentierte), nachdem ihr Peter Altenberg, der sie wie viele andere Frauen moralisch terrorisierte, verboten hatte, ein Wiener Schönberg-Konzert zu besuchen. Sie beurteilte Egon Wellesz' Bakchantinnen als „das unpersönlichste Kunstwerk was ich je erlebt“ und jene Passagen, die für sie wie reiner Alban Berg klangen, als „ganz anschmiegend“, sie spielte Strauss‘ Intermezzo, dessen Text die Mutter Johanna indiskret fand, Zemlinskys Zwerg und nicht zuletzt den Wozzeck durch – und sie zerstritt sich, je älter sie wurde, mit ihren Brüdern, zumal mit Alban Berg, mit dem sie in ihrer Kindheit und Jugend die engsten Bande verknüpften. Sie verehrte Wagner, spielte stundenlang aus der Walküre, als sie zufällig zusammen mit der geliebten Anna Bahr-Mildenburg (und ihrem eigenen Mann) in einer Pension in Hietzing wohnte, ging – typisch für viele Wiener der Jahrhundertwende – leidenschaftlich gern in die Oper und schrieb 1915 nach einer Berliner Elektra-Aufführung mit Marie Gutheil-Schoder und Anna Bahr-Mildenburg, dass dies das erste Mal gewesen sei, „daß ich die Opernkunst nicht als eine klägliche Missgeburt empfand“. Weitere emphatische oder kritische Äußerungen über Carmen, eine Aufführung der Verklärten Nacht u.a. schließen sich dem Spektrum an – Smaragda Eger-Berg hinterließ keine Musikkritiken, aber Bemerkungen über Aufführungen, die unser Wissen um die Musikkultur des beginnenden 20. Jahrhunderts erweitern. So wurde ihr die Musik zur Projektionsfläche und zur geliebtesten Kunst. Die Tatsache, dass sie sich in eine große Wagner- und Strauss-Sängerin und Alban Bergs zukünftige Frau, Helene Nahowski also, verliebte und – wieder einmal – die Familie, die tolerant und mit Smaragda Eger-Bergs Erregungszuständen vertraut war, molestierte, ist dagegen nur interessant, vermag uns jedoch nichts über die kunstliebende und musikpraktizierende Frau zu zeigen: nur einen Blick durch ein, zugegeben, angesichts des Bekanntheitsgrades der Beteiligten interessantes Schlüsselloch.
Was nach dem Tod des Bruders und dem Verlust des Berghofs blieb, war wenig: ein verschärfter Kampf ums Einkommen, der Verlust der Netzwerke, schließlich, nach ihrem Tod im Jahre 1954 in einem Altersheim in Wien-Lainz, ein paar wenige Erinnerungen der Zeitgenossen und die anzweifelbare These, dass der Bruder, als er die Lulu und die Gräfin Geschwitz komponierte, sich vom jungen und alt gewordenen Leben und psychischen Zustand seiner Schwester inspirieren ließ. Es bleibt auch das Gemälde, das Richard Gerstl 1907 von ihr malte, und in dem uns die Porträtierte nachdenklich und schon ein wenig unglücklich anschaut. Anna Ricke hat eine andere Art von Porträt gezeichnet, das denen empfohlen werden kann, die sich für die Wiener Moderne, die Musik der zweiten Wiener Schule und das Wiener und Berliner Musikleben des frühen 20. Jahrhunderts interessieren – und jenen Lesern, die das hochspannende und ungeheuer kreative fin de k.k.-siècle, das auch durch eine Smaragda Eger-Berg geprägt wurde, immer noch für eine Märchenzeit halten.
Anna Ricke: Smaragda Eger-Berg (1886-1954). Bohemienne – Musikerin – Schwester. Bedingungen künstlerischer Emanzipation in der Wiener Moderne. Königshausen & Neumann, 2021. 25 Abbildungen, 337 Seiten. 44 Euro.
Frank Piontek, 22.7.2021
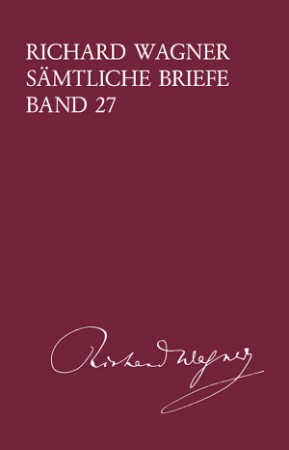
RICHARD WAGNER: SÄMTLICHE BRIEFE. BD. 27 (1875)
Ihr ganz und gariger Richard Wagner
Einmal unterschreibt er mit „RWagner (Canzelist)“. Kein Wunder: Wir befinden uns im Januar des Jahres 1875, und der Briefeschreiber hat bereits (mindestens, denn so genau weiß man das ja bei Wagner nie) 46 Briefe in die Welt geschickt, in denen es weniger um die Kunst als um die Kunst-Organisation geht.
Nicht weniger als knapp 400 Schreiben konnte Martin Dürrer, der Herausgeber des 27. Bandes „sämtlicher“ Briefe Richard Wagners, in der neuen, wie üblich mit wertvollen „Nebentexten“ glänzend kommentierten und mit mehreren Registern (auch Wagners Hunde haben ihre Auftritte) erschließbaren Sammlung diesmal vereinigen, womit das Jahr 1874 erst einmal übersprungen wurde. Immerhin 372 Texte sind in corpore edierbar gewesen, wobei nicht weniger als 98 Nummern hier erstmals zusammen mit drei Zeichnungen des Nicht-Zeichners im Druck erscheinen und weitere 23 zum ersten Mal vollständig präsentiert werden. Es versteht sich, dass auch die verschollenen Briefe in den Kommentaren so genau kommentiert werden, dass der Verlust gelegentlich verschmerzbar ist. 24 dieser Briefe und Brieflein, langen Schreiben und kurzen Telegramme wurden zudem noch nicht im Wagner-Briefe-Verzeichnis gelistet. Mit anderen Worten: Wir haben es wieder mit einem Wagner zu tun, in dessen tägliche Arbeit wir, zusätzlich zu den Einträgen im Tagebuch Cosima Wagners, so detailliert hineinschauen können, dass die Kenntnis dessen, wer Wagner war, durch den neuen Band zwar nicht neu justiert, aber auf eine quellenmäßig erweiterte Basis gestellt werden kann – völlig abgesehen davon, dass Wagner selbst dann, wenn es um die Mühen der Ebenen, das Kleinklein der täglichen Sekretärsarbeiten ging, ein meist amüsanter und bärbeißiger, literarisch gebildeter und herzhaft persönlicher Belletrist war.
Ging es im letzten publizierten Briefband, also dem Jahr 1873, bereits um die Finanzen des gerade gegründeten Festspielunternehmens, so sind sie auch 1875 ein Dauerthema, denn man kämpft in Bayreuth immer noch um jene Gelder, die die Vorproben und schließlich die Festspiele des Folgejahres möglich machen sollen; nichts ist in trockenen Tüchern. Nicht zuletzt mancher der vielen, zum größten Teil bis dato unveröffentlichten Briefe an den Freund und Bankier Friedrich Feustel sprechen von nichts Anderem. Ein zweites, von heute aus gesehen erstaunliches Problem kommt hinzu. Noch kurz vor der Beginn der Vorproben, die im Sommer beginnen, steht noch längst nicht fest, wer die meisten kleinen und manch große Rolle singen wird; die Entscheidung für den eher gut aussehenden als stimmstarken Georg Unger, der 1876 als Siegfried auf der Bühne stehen wird, gerät kompliziert, gewunden und qualvoll, ein sicherer Sänger wie Emil Scaria fällt schließlich aus, weil er aus finanzieller Verzweiflung auf einem für Wagner maßlosen Honorar besteht. „Sie können sich denken, wie schwierig mir alles von Meinem, allerdings gut gelegenen, aber doch sehr verbindungslosen Mittelpunkte aus, fällt“, schreibt er am 4. Januar an August Wilhelmj, der 1876 als Konzertmeister am Pult der ersten Geigen sitzen wird; beim Vater bestellt er den Wein, den er braucht, um die Sorgen herunterzuschlucken, die ihm das schreckliche Agentenpaar Voltz & Batz in diesem Jahr in extremer Weise bereitet. Hat Wagner nicht schon mit dem Ärger genug zu tun, den ihm die zweifelhaften Interessenvertreter bereiten, kommt im selben Jahr eine weitere juristische Auseinandersetzung auf ihn zu: etliche Briefe – es sind nicht die charmantesten – drehen sich um die Rechtewahrnehmung an der sog. „Pariser“ Fassung des Tannhäuser (sie ist eine Wiener Version), um die er sich bis zum Silvestertag mit dem Verleger Adolph Fürstner regelrecht – und zeitaufwendig - streiten muss. Dafür feiert er mit seinen Wiener und Budapester Engagements, mit Konzerten an der Donau und den beiden Musteraufführungen von Tannhäuser und Lohengrin, Triumphe, auf denen er – das ist der Zweck – Gelder für das Festspielunternehmen einnimmt; der gute Bekannte und Arzt, Josef Standhartner, empfängt einige freundschaftliche Briefe. „Wir reisen heute und melden uns morgen als Stadtkranke“, so geht ein (bislang unpubliziertes) Telegramm in die „Standhartnerei“: als Beitrag zum Thema „Wagner als Freund“. Ihm kann ein vergleichsweise langer, warmherziger Brief an die Wiener Freunde vom 20. März an die Seite gestellt werden, und auch er war bislang unveröffentlicht. Die künstlerischen Unternehmen werden von einer Unzahl von Briefen und Telegrammen vorbereitet; Drucke (von Programmzetteln und den üblichen Wagnerschen Erläuterungstexten), Bestellungen (von Instrumenten, wobei die Tuben besondere Probleme bereiten) und Engagements (der Sänger wie Amalie Materna) geraten in den intensiven Blick, Theorie und Praxis verschränken sich in jenen Momenten, wo das Kunstwerk realisiert und erklärt werden soll. Im Briefwerk wird lebendig, was in den Musikgeschichten ansonsten nur Name und Zahl ist.
Gleichzeitig bewirbt sich Wagner um Orchestermusiker für die Festspiele, nicht allein Bratschisten scheinen Mangelware zu sein; auch hier ist er sich nicht zu schade, sich persönlich um die Besetzungen der einzelnen Instrumentengruppen zu kümmern (was dort ärgerlich ist, wo die angefragten Musiker auf einem normalen Honorar bestehen). „Schöne“ Briefe wie noch in den 50er Jahren werden 1875 so gut wie nicht geschrieben – selten genug, dass Wagner sich in einem Schreiben an Liszt wendet und eine Dankbarkeit bekundet, die so poetisch wie ehrlich klingt: „Dafür werde ich dich stets mehr lieben, als du mich lieben kannst…“ Und auch dies ist einer der Funde des Bandes, denn just dieser Brief aus einer Zeit, in der keine Briefe mehr zwischen Wagner und seinem Schwiegervater hin- und hergingen, war bislang nur in einer ungarischen Ausgabe des Jahres 1916, aber nicht im Wagner-Liszt-Briefwechsel ediert worden. Der Band enthält auch, dank des ausgiebigen Kommentars, den kleinen, aber kompletten Briefwechsel zwischen Wagner und Brahms, der um die Rückgabe der Pariser Tannhäuser-Blätter herum entsteht, während ein langer, antisemitisch akzentuierter Brief („trotz jüdischer Finanz“) an Bismarck, eine mögliche Finanzierung der Festspiele durch den Kaiser anmahnend, tatsächlich bislang ungedruckt war; dass die populäre Formel, dass von Wagner „alles bekannt“ sei, eine Binsenweisheit ist, kann schon durch die Publikation eines solchen Schreibens widerlegt werden. Dass Wagner schwere Auseinandersetzungen mit dem Dirigenten Hans Richter hatte, in denen es um eine Untreuevermutung und Cosima Wagners öffentlich kritisierte Rolle als Künstlerfeindin ging, war zwar bislang bekannt, aber durch die breiten Zitate aus zeitgenössischen Zeitungen und aus Hans Richters Tagebüchern erhalten die Briefe an Richter einen Sitz im Leben, wie sie sie trotz Manfred Egers Richter-Biographie noch nicht besaßen. Den wütenden Erpressungsbrief, in dem Wagner ankündigt, den saumseligen Musiker bei dessen Intendanten so schlecht zu machen, dass er mutmaßlich entlassen worden wäre, hat Richter mit einem diplomatischen Brief beantwortet: auch dies ist ein unschätzbarer Mehrwert dieser Brief- und Kommentarausgabe.
Das Thema dieses Jahres ist, wenn es sich nicht gerade in seltenen Glücksmomenten, also diversen Stoffbestellungen, äußert, der Ärger; nicht zuletzt die Briefe an den kgl. Hofrat Düfflipp, von denen zwei noch nicht bekannt waren, zeugen von der Frustration, die Wagner befallen haben muss, als er erfuhr, dass sein größter Mäzen durchaus nicht gewillt war, in Sachen Patronatschein den Festspielen wirklich entgegenzukommen. Der Kommentar macht allerdings auch klar, dass dahinter wohl weniger der königliche Ärger über den einstigen Betrug als die Tatsache stand, dass er selbst kaum das Geld für seine Schlossbauten zusammenbekam. Dass Wagner München hasste und den Intendanten Karl von Perfall als Grund allen Übels ansah, wurde auch in diesem Jahr ersichtlich, als Wagner darauf hoffte, mehr als acht Münchner Hofmusiker zu bekommen. Wesentlich besser waren, obwohl Wagner sich zunächst weigerte, den Tristan für Wien freizugeben, die finanziellen Verhandlungen mit dem Direktor der Wiener Hofoper, Franz Jauner, die sich, auch als Beitrag zur Geschichte der Tantiemen, in vielen Briefen äußerten. Zu den Schätzen des neuen Bandes zählt zweifellos der ungewöhnlich lange Brief vom 28. Juni, der das letzte Mal 1950 an relativ „entlegener Stelle“ gedruckt wurde: wie so viele Texte dieses Buchs, in denen es um den Bau eines Gasthofs für die zukünftigen Festspielbesucher, um die Normierung von Harfenstimmen, das Englischhorn, familiäre Auseinandersetzungen mit den Brockhausens, die Arbeit mit den unverschämterweise in den Urlaub fahrenden Bühnenbildnern Brückner, die Wahnfried-Büste des Königs, die Tannhäuser-Choreographie, die Korrektur der Siegfried-Partitur, den in Arbeit befindlichen Klavierauszugsdruck der Götterdämmerung, Besetzungen, wieder Besetzungen und noch einmal Besetzungen – aber kaum um die Kunst selbst geht. Denn Wagner schrieb in diesem Jahr lediglich ein knapp fünf Minuten dauerndes Albumblatt für die Verlegerin Betty Schott (dass sie in diesem Jahr stirbt, macht Wagner zusätzliche Sorgen) – und kein Orchesterstück „von dem Umfange einer Ouvertüre“, das Wagner für den Verlag Peters komponieren wollte.
Und auch dieser kleine, aber charakteristische Brief, der das kuriose Angebot an den Verlag enthält, war bislang nur durch einen Auszug in einem Auktionskatalog „bekannt“.
Richard Wagner: Sämtliche Briefe. Band 27. Briefe des Jahres 1875. 728 Seiten, 6 Abbildungen. Hrg. von Martin Dürrer. Breitkopf & Härtel, 2021. 74 Euro.
Frank Piontek, 14.7. 2021

ANNO MUNGEN: HIER GILT‘S DER KUNST. WIELAND WAGNER 1941-1945
„Hitler-Wagner ist eine Einheit, über die die Geschichte längst ihr Urteil gesprochen hat.“ Nein, im neuen anzuzeigenden Buch ist ausnahmsweise mal nicht von Richard, sondern von Wieland die Rede, auch wenn sich der Satz, den der thüringische Beauftragte für Kultur und Erziehung kurz nach Kriegsende in einem Brief an Kurt Overhoff (ich verweise auf Adrian Müllers exzellente Biographie des Musikers, die jüngst erschien) notierte, auf den Großvater bezieht.
„Hier gilt‘s der Kunst“, so heißt das bekannte Zitat aus dem zweiten Meistersinger-Akt, das die beiden Wagner-Urenkel – als Verantwortliche fürs ganze Unternehmen – während der ersten Bayreuther Nachkriegsfestspiele als Direktive zur Vermeidung politischer Gespräche am Hügel aushingen. Dass Wieland Wagner, der schon mit seinen 1951er-Inszenierungen einen neuen inszenatorischen Weg beschritt, der (auf den ersten Blick) wenig mit der sog. Nazi-Ästhetik zu tun hatte, als Günstling Adolf Hitlers und erfolgreicher Hitler-Fotograf ein Nutznießer der Politik war, ist seit langem bekannt; er selbst hat nach 1945 kein Wort über seine Vergangenheit geäußert, als habe es eine Stunde Null gegeben, die all das ungeschehen machte, was Anno Mungen in einem neuen, schmalen und ergiebigen Buch zutage gefördert hat. In den letzten zehn Jahren hat sich, nicht zuletzt aufgrund des 100. Geburtstags Wieland Wagners, die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Regisseur und Protagonisten der Zeitgeschichte sichtlich verstärkt – Mungen greift nun nicht allein auf die bekannte Literatur, sondern auch auf Quellen zurück, die der Auswertung noch harrten: Zeitungsberichte mit inhaltlich relevanten Abschnitten, Briefe aus dem Nachlass Wieland und Wolfgang Wagners, Altenburger Material, nicht zuletzt das dato unpublizierte und unerschlossene Tagebuch Gertrud Strobels, die zusammen mit ihrem Mann Otto Strobel das Wagner-Archiv gehütet hat. Die „Chronik des Alltäglichen“, wie Mungen die Aufzeichnungen bezeichnet, bietet denn doch mehr als den Kriegsalltag und das bisher über Wielands frühe Bayreuther Existenz Bekannte. Es ergänzt in wesentlichen Teilen jene Passagen, in denen tatsächlich von jener Kunst die Rede ist, die noch bis 1944 – auch unter dem unmittelbaren Schutz Adolf Hitlers – prachtvoll gedieh. Wieland hat, Mungen nummeriert das deutlich genug durch, nicht weniger als 12 Inszenierungen vorgelegt, während die Welt unterging und allmählich befreit wurde. In keinem anderen Buch über Wieland Wagner findet sich die komplette Folge aller Arbeiten, die Wieland Wagner 1942 bis 1945 als Regisseur oder Bühnenbildner zu verantworten hatte (1942 beginnt, nach einem ersten Bühnenbild für den 1937er-Parsifal, mit dem Nürnberger Bühnenbild zum Holländer die Reihe von Wielands Arbeiten zu Stücken seines Großvaters, 1943 erlebt Die Walküre in Nürnberg ihre erste „richtige“ Wieland-Wagner-Premiere).
Für den Hinweis auf Max Wiskott, der den jungen Wagner in Sachen Beleuchtungstechnik beriet, muss man beispielweise dankbar sein, denn in Renate Schostacks Gertrud-Wagner- und in Brigitte Hamanns Winifred-Biographie war von ihm nur am Rande die Rede. Nur manchmal bricht der Theaterhistoriker in Mungen durch, der dem Leser erklären muss, was Theater eigentlich ist: dass es „flüchtig“ sei und sich „nur im Hier und Jetzt auf der Bühne“ entfalte, ist eine Plattitüde – und dass es die Geschichten der Opern seien, „deren Inhalte die Werke zum Kernrepertoire des deutschen Großbürgertums“ machen würden: diese Aussage ist im Buch eines Musikwissenschaftlers, der es besser wissen sollte, nun ja, erstaunlich. Unklar bleibt zudem, was mit folgender seltsamer Formulierung gemeint ist: „Wagners Raumbühne, die auf Hitler zurückgeht...“ – die Andeutung suggeriert einen Zusammenhang, der, so gewichtig behauptet, belegt werden müsste. Egal – es tangiert nicht das Wesentliche: die enge Verflechtung von Wielands künstlerischer Laufbahn und die Zeit, in der sich seine Geschichte gespenstisch spiegelt.
Wieland Wagner und seine Frau Gertrud waren nicht allein dabei, als es galt, die „arisierten“ Güter ausgeraubter Juden an sich zu reißen. Der ungesund ambitionierte Jung-Regisseur war auch darin erfolgreich, dass es ihm zumindest gelang, den Bühnenbildner Emil Preetorius förmlich wegzubeißen, als es darum ging, zum neuen Herren am Hügel aufzusteigen. Dass sich die Polemik gegen Preetorius‘ vorsichtigen Expressionismus durchaus mit eigenen Neuerungstendenzen vertrug, die der erste große Mann an der Münchner Nachkriegs-Staatsoper, Rudolf Hartmann, in einem internen, hier zum ersten Mal ausgewerteten Kommunique als gegen die „Werktreue“ gerichtet empfand: es ist eine der originellen Pointen des Buchs. Sie vermag uns etwas über die Anlagen des Szenikers Wieland Wagner mitzuteilen, der 1951 nicht aus dem Nichts kam. Im Gegenteil: schon seine Altenburger Ring-Inszenierung, die neben der Nürnberger entstand, als alles schon zu spät war für einen „Endsieg“, enthielt abstrahierende Elemente, die nach dem Krieg verabsolutiert wurden. Genaueres und Widersprüchlicheres (denn obwohl die Presse gleichgeschaltet war, gab es durchaus abweichende Meinungen über das, was „Stil“ und „Werktreue“ hieß) über diese frühen Ring-Aufführungen kann man nirgends lesen. „Die Nazis forcieren Wagners reduzierenden Stil“, schreibt Mungen und kann darauf verweisen, dass die Tradition zwischen den revolutionären Entwürfen Adolphe Appias, den Wieland-Arbeiten der NS-Bühne und der von allem Gegenstand befreiten „Koch-Scheibe“ Neu-Bayreuths eng war. Gleichzeitig blieb der Enkel Richard Wagners bis zuletzt der überzeugte Hitlerianer, der, so Mungen, den Parsifal noch Anfang 1945 „nationalsozialistisch passfähig“ machen wollte. Dass am 19. Dezember 1943 das Nornen-Seil, so wollte es der Regisseur, nicht riss, aber just am Tag der Bayreuther Premiere von Siegfried Wagners An allem ist Hütchen schuld die Alliierten in der Normandie landeten, passt zum ästhetisch-politischen Befund: Wieland Wagner ging, vertrauend auf den „Endsieg“, in dem ein Seilriss nicht vorgesehen war und ein Ring-Finale grün wie die Hoffnung aufleuchtete, seinen vom System beschirmten, krankhaft ehrgeizigen Weg: bis hin zur wie auch immer aussehenden Arbeit im Bayreuther Außenlager des KZs Flossenbürg.
Mungen hat seine Chronik der Ereignisse, mit genauen Rückblicken, in kleine Absätze eingeteilt, hat Bilddokumente, auch das Banale, das 1942 bis 1945 seinen eigenen Sinn hatte, beschrieben, um die bekannten Informationen mit den gar nicht so wenigen neuen zu einer Zeitgeschichte des allmählichen Untergangs zu kompilieren, in dem die Kunst, betrieb man sie wie Wieland Wagner, keine Chance hatte, ihre Autonomie zu bewahren – „schöne“, „stimmungsvolle“ Aufführungen hin oder her. So gesehen, hat sich Wieland Wagner selbst das Urteil gesprochen. Dass er es später erkannte, vielleicht sogar vor sich selbst anerkannte, kann zumindest zu seinen Gunsten vermutet werden, wenn wir denn nicht annehmen wollen, dass er der Opportunist blieb, der er schon immer war. Anno Mungens Buch ist ein vergleichsweise schmaler, aber gewichtiger Beitrag zum spannenden Thema und Menschen Wieland Wagner.
Anno Mungen: Hier gilt‘s der Kunst. Wieland Wagner 1942-1945. Westend Verlag 2021. 160 Seiten. 18 Euro.
Frank Piontek, 14.7. 2021
Hochaktuell

Eher Kurze Geschichten von Opern als eine Kurze Geschichte der Oper in 35 BIldern sind die zweite Auflage von Hans-Klaus Jungheinrichs Opernführer, die der Autor nicht mehr selbst vollenden konnte. Vor zehn Jahren erschien das Werk unter dem Titel „Hohes C und tiefe Liebe“, hatte nicht den gewünschten und erhofften Erfolg und erscheint nun immerhin neu bearbeitet, mit zusätzlichen Kapiteln zu Henze und Rihm und einem aufschlussreichen Nachwort von Wolfgang Molkow.
Jeweils eine Oper wird in den einzelnen Kapiteln vorgestellt, wobei der Belcanto keine Rolle spielt, das 19.Jahrhundert recht schnell verlasen wird mit nur einer Verdi- und einer Wagneroper, Slawisches mehr vertreten ist als Italienisches, Unbekanntes genauso häufig wie übermäßig Bekanntes.
Einleitend stellt der Verfasser fest, dass moderne Regie wie die von Neuenfels die Oper von dem Vorwurf befreit habe, sie beschäftige den Geist nicht angemessen, dass die Händelrenaissance erst im zweiten Anlauf glückte und durch Übertitel ein erheblicher Fortschritt erzielt worden sei. Offensichtlich ist seine Position eine zwischen Profilneurotikern und Werktreue-Orthodoxen, er streift das Thema Homosexuelle als Opernpublikum oder die Optik als Hinwegtäuscher über stimmliche Mängel anhand von Felsensteininszenierungen und den vokalen Leistungen der Sopranistin Anja Silja. Seine 35 Lieblingsopern hat der Autor in das Buch aufgenommen, der sich in jeder Zeile seines Buchs als der Gattung leidenschaftlich zugetan erweist und der zu Recht betont, dass sein Buch keinen Opernführer ersetzen kann und nichts für unvorbereitete Leser ist. Und keinesfalls sollten diese darauf hoffen, sie könnten die Geschichte der Oper durch das Betrachten von Fotos erfahren. Davon gibt es kein einziges.
Über den einzelnen Kapiteln steht neben dem Titel der jeweiligen Oper entweder eine kurze Meinungsäußerung, ein Hinweis auf einen aktuellen Anlass oder ein bestimmtes Ereignis, das mit ihm zusammenhängt, als Einstimmung.
Nach dem Lesen der ersten Kapitel wird klar, dass im Mittelpunkt der Betrachtungen weniger die Musik als das Libretto, die Entstehungs- oder Rezeptionsgeschichte stehen, im Fall von Monteverdis „L’incoronazione di Poppea“ sogar die Entstehung der Gattung als solcher. Besetzungsfragen wie die Untersuchung der Formelemente, die Rolle der Götter in den frühen Werken werden anschaulich und unterhaltsam dargestellt. Bei Glucks Orphée stehen generell der Orpheus-Mythos, der Begriff „Reformoper“ und Fragen der Tonartencharakterisierung im Vordergrund. Persönliche Kindheitserfahrungen fließen in die Ausführungen zur Zauberflöte ein, heutige Steine des Anstoßes wie Frauenfeindlichkeit- und das N-Wort war beim Erscheinen der Erstauflage wohl noch nicht der Verdammung anheimgefallen. Unterschiedliche Regieansätze spielen eine Rolle und Hinweise wie der auf Mörikes Mozart auf der Reise nach Prag. Wird das Kapitel über Fidelio zur Lobpreisung des schlichten Librettos, so das über die Meistersinger zur Feststellung der Fatalität der C-Dur-Tonart. Eher vage ist die Stellungnahme zum Schlussmonolog des Sachs, da versagt sich der Autor immerhin nicht dem allgemeinen Bedenkenäußern, ohne dass es heute mehr denn vor zehn Jahren nicht geht.
Kritisch wird es mit dem Übergang zu italienischen Opern, die der Verfasser nicht so gut kennt wie das sonstige Repertoire, denn sonst könnten folgende Irrtümer nicht Eingang in das Buch gefunden haben: Gilda im Rigoletto geht keinen „passiven Schmerzensweg“, sondern opfert sich sehr aktiv für den treulosen Duca, der Messner in Tosca wiegelt die Ministranten nicht gegen Cavaradossi auf, Musetta ist nicht damenhaft, Anna in Le Villi ist nicht Heilige und Hure, Liù lässt sich nicht abschlachten, sondern tötet sich selbst, Butterfly hat Pinkerton nicht viele „glühende Liebesbriefe“ geschrieben, Sharpless ist nicht „schwammig wie sein Name“, sondern nimmt mehrmals gegen Pinkerton Stellung, nicht die Ehe wurde für 99 Jahre geschlossen, sondern der Mietvertrag, Pinkerton hat durchaus Vornamen, nämlich Benjamin Franklin, das Kind tritt nicht nur einmal, sondern zweimal auf. Und dass Kate Pinkerton unfruchtbar ist, dürfte nach so kurzer Ehe auch nicht erwiesen sein. Das alles mögen kleine Ungenauigkeiten sein, die aber doch das Vertrauen des Lesers in den Text, soweit er dessen Wahrheitsgehalt nicht überprüfen kann, etwas mindern.
Besonders im Kapitel über Carmen wird deutlich, dass der Autor durchaus zu Recht den Anspruch erheben kann, als Wissenschaftler ernst genommen zu werden, dass aber auch zum Vorteil des auf Unterhaltung bedachten Lesers starke essayistische Tendenzen in seinem Text enthalten sind. An Nietzsches Seite stellt er sich, wenn er in der französischen Oper einen Gegensatz zum Tristan und zu den Meistersingern, „mühevoll und handwerksfleißig“ entstanden, sieht. Und stammen Don José und Micaela aus dem Baskenland? Das wäre eine lange Reise für das junge Mädchen gewesen, dessen Tracht unmissverständlich im Libretto Navarra zugeordnet wird.
Interessant sind die Ausführungen zum Thema, warum gerade die Dialoge der Karmeliterinnen einen Platz im Repertoire gefunden haben, inwieweit Opern aus anderen Schreckenszeiten eine besondere Art der „Bewältigung des Ausschwitzsyndroms“ sein könnten, welche Vergleichsmöglichkeiten es zwischen Poulenc und Julien Green geben könnte, beide katholisch und homosexuell. Auch in diesem Kapitel geht es weniger um die Musik als um die Werkstruktur.
Weit mehr Raum als auf den Spielplänen wird der zeitgenössischen Oper im Buch eingeräumt, was Henze betrifft nicht nur einem, sondern dem Gesamtwerk. Vom Jungen Lord bis zum L’Upupa reichen die Ausführungen, die in Henze einen Komponisten sehen, der „jungen Wein in alten Schläuchen“ hervorbrachte. Des Komponisten Dichterlibrettisten stehen auch hier eher im Mittelpunkt als die Musik, die Spiegelung zeitgenössischer Probleme im Spiel von Verkleidung und Entlarvung.
„Hineingewachsen in das Altern der neuen Musik“ ist für den Autor der Komponist Lachmann, dem „Wiederholungsverbot der Moderne“ unterworden. In diesem Kapitel geht es sehr viel um die Musik, um das Andersen-Märchen als Metapher für Gudrun Ensslin, und der Verfasser meint, solange es „Theater gibt, die Werke wie diese sich und ihrem Publikum zum Prüfstein machen, ist die Opernkultur noch am Leben.“
Sehr interessant ist das Nachwort, auch weil es gleichermaßen zur Zustimmung (lieber Cornelius‘ Barbier als zum 100.Mal der Rossinis) wie zum Zweifel (Lohengrin und Tannhäuser kitschverdächtig) anregt und weil der vielgescholtene Richard Strauss gegenüber Adorno in Schutz genommen wird. Im Buch ist er übrigens mit drei Werken vertreten.
Wolke Verlag 2021, 295 Seiten, 2. erweiterte Auflage
ISBN 978 3 95593 254 1
Ingrid Wanja 17.5.21
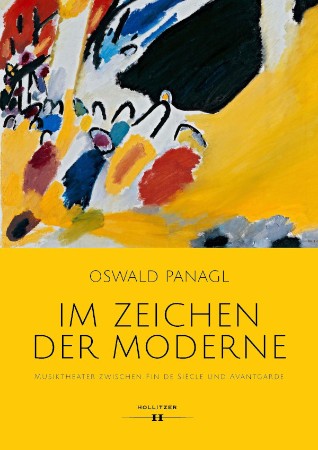
Oswald Panagl: Im Zeichen der Moderne
Wer das Glück hatte oder bald wieder haben wird, Oswald Panagl als Referent zu erleben, wird es begrüßen, dass er nun seine gesammelten Kleinen Schriften zur Oper der Moderne zum Druck befördern ließ. Der Professor für Sprachwissenschaft (Spezialgebiet: Mykenisch) ist den Opernfreunden längst schon bekannt; seine beiden zusammen mit seinem Kollegen, dem Mittelalterforscher Ulrich Müller (auch er kein Fachidiot), herausgegebenen Sammelbände zu Wagner und sein mit dem Mathematikprofessor Fritz Schweiger geschriebenes Buch zur Fledermaus gehören inzwischen zu den Standardwerken zu den beiden Genres namens Wagner-Oper und Operette. Kam kürzlich die Mitherausgabe eines in den 1930ern geschriebenen, fantastisch polemischen Buchs gegen die Moderne (Atonale Götzendämmerung von Julius Korngold) hinzu. Es scheint gerade die „Liebhaberei“ zu sein, die stets dafür sorgte, dass Panagl sich nun schon seit Jahrzehnten nicht allein über die reizvollen Probleme der Sprache äußert, sondern auch in erstaunlichem reichhaltigem Maß über die Oper. Und es sind die Qualifikationen der Sprachforschung - mit dem Schwerpunkt der Gräzistik, aber das erklärt noch nichts -, die ihn dazu bringen, für jenen Leser zu schreiben, der es genauer wissen will.
64 Beiträge auf rund 400 Seiten aus über 30 Jahren – was zur Buchbindersynthese hätte werden können, enthüllt sich schon schnell als eine Sammlung mit thematischen Fixpunkten (und -personen). Handelt es sich bei fast allen Texten auch um sog. Gelegenheitsstücke (für Programmhefte, Tagungsbände, Jahrbücher), so kreisen die Gedanken zum einen um einige Großmeister der Oper und einige weniger im Focus der allgemeinen Aufmerksamkeit stehende Meister sowie um die Frage, was denn das „Moderne“ an all den Stücken ist, die zwischen der Boheme und Bernsteins Balletten auf die Bühnen kamen. Panagl – ein gewiegter (wie er sagen würde) Kenner der Urgründe und Bedeutungsebenen der Sprache – versteht es schon meisterhaft, den Begriff, der sich nicht von selbst versteht, in all seiner Fülle zu definieren. Schreibt er über Strauss, einen seiner musikalischen Hausgötter, und nicht allein über dessen Arbeiten, die er zusammen mit Hofmannsthal gemacht hat, wird das (scheinbar) Ungleichzeitige im schillernden Phänomen der „Moderne“ klar. Denn die Moderne hat sich nicht nur dem Futurismus, der zerbrochenen Form und der völligen Verstörung gewidmet, sondern – im Zeichen einer nervösen Sensibilität und einer Hinwendung zu den literarischen Traditionen – in gleichem Maß der Antike. „Modisch“ kommt von „Moderne“, aber Panagl interessiert sich weniger für den „letzten Schrei“ als für das zeitlich Bedingte, das zugleich – durch die Musik, weniger durch die Libretti – so etwas wie zeitlose Gültigkeit erhielt, auch wenn politikwissenschaftlich orientierte Operndeuter die Idee, dass der Rosenkavalier ein Werk der literarischen und kompositorischen Moderne ist, nicht zu verstehen vermögen. Nebenbei: Wenn Panagl Tosca aufgrund der verschiedenen Erwartungen, die die Opernbesucher damals wie heute an dieses Meisterwerk des Polittheaters herantragen, als „Mischtypus“ bezeichnet, wird er dem Kunstwerk gerechter als jene Interpreten, die auf „Idealtypen“ aus sind. Eben deshalb fällt auch seine Antwort auf die einstmals stark umstrittene Frage, was denn eine „Literaturoper“ recht eigentlich sei, angemessen liberal aus.
Elektra, Ariadne und Danae sind nicht allein aufgrund der Gleichzeitigkeit von (antikem, aber bearbeitetem) Mythos und Moderne gefundene Fressen für den opernliebenden und -verstehenden Autor. Straussens Hauptwerke werden denn auch nicht nur bis zur Arabella, sondern bis zu jenen Werken ausgemessen, die der Komponist in einer konfliktreichen Zusammenarbeit mit Joseph Gregor realisierte; der Leser erhält also Informationen über Werke, denen er (leider…) nur selten auf den Bühnen begegnet. Schön auch, dass Panagl nicht in den Chor der Strauss-Kritiker einstimmt, derzufolge die politischen Verirrungen des Meisters einher gingen mit einer abnehmenden künstlerischen Größe. Man kann es ja auch anders sehen: „Der Reduktionismus im Konzept von Capriccio (1942), das Abschotten von einer immer hoffnungsloser bedrängenden Realität und der Rückzug in ästhetische Bezirke mögen bereits auf die symphonischen Metamorphosen (1945/46) vorausweisen. Die Trauer um verspielte Werte und eine zerbrochene Identität manifestiert sich als Flucht, vielleicht Zuflucht in Bezirke des Unverlierbaren.“ Dass die Ägyptische Helena von Panagl nicht als gescheitert, sondern als „reizvoll“ widersprüchlich und Korngolds Wunder der Heliane als thematischer Hybrid wahrgenommen und geschätzt wird, passt zum Befund des liberalen Opernliebhabers, dem apodiktische Urteile so fremd sind wie ihm die Sprache Freund ist.
Die Meisterreihe beginnt mit Puccini; es ist folgerichtig, dass sich Panagl nicht allein einigen Hauptwerken der ästhetischen Opernmoderne, sondern auch der Rondine gewidmet hat, um sie wenigstens teilweise zu rehabilitieren, weil er so klug ist, sie in die historischen Zusammenhänge, der Zeit um 1914 und der k.k.-Ära, zu situieren. Er interessiert sich weniger für Misserfolge als für literarische Spuren, Quellen und Querverweise zu anderen Werken, erläutert oft souverän die Stoffgeschichten und lässt uns verstehen, wieso im Jahr X das Werk Y entstehen konnte. Neben dem dritten Giganten der Operngeschichte, Panagls lookalike Janácek, dem sieben Texte gewidmet wurden, treten viele andere Komponisten hervor, denen er Einzelstudien gewidmet hat: Busoni (Doktor Faust), Debussy (die Studie zur Frage, wieso der Komponist des Pelléas bestimmte Passagen des Bühnenstücks nicht vertont hat, gehört zu den besten), Martinu (Julietta), Pfitzner, Korngold (Tote Stadt und Heliane), Krenek (Orpheus), Prokofjew (Der Spieler), Enescu (Oedipe), Nielsen (Saul und David), Szymanowski (Król Roger), Berg, Schönberg undundund… Die Herkunft der Texte aus Programmbüchern wie aus Ankündigungsheften und wissenschaftlichen Publikationen macht es verständlich, dass die Beiträge durchaus verschiedene Gewichte – aber niemals unterschiedliche Qualitäten haben. Panagl durchmisst das weite Feld der modernen Oper, um auf den Traum und die Tiefenpsychologie, Hofmannsthal „Allomatik“ (die Lebenskunst der menschlichen Verwandlung) und die Bedingungen von Kunst und Leben (besonders stark in den Studien zu Janácek) zu kommen. Vieles wäre eigens zu loben: die Anmerkungen zu den Interludes in Brittens Billy Budd, die Interpretation der Interpretation der Antike in Egon Wellesz‘ Bakchantinnen, die biographische Arbeit zum komplizierten Fall Pfitzner, der Aufsatz über das modische (?) Genre der sog. Renaissance-Oper.
Belassen wir‘s dabei: Panagl hat ein Kompendium für all jene Opernliebhaber vorgelegt, die sich für Motive, Tendenzen der Moderne und die von der kulturwissenschaftlichen Linken verschmähte Geistesgeschichte, für Stoffgeschichten und die Entstehungsgründe der Werke interessieren. Im Zeichen der Moderne zeugt nicht allein von Panagls Souveränität, große Stoffmassen zu bündeln, sondern auch von seinem feinen Humor, nicht zuletzt von der Fähigkeit, Lust zu machen auf all die Werke, die wir eher selten in den CD-Player einlegen: die Opera eines Max von Schillings, eines Hindemith und eines Rimski-Korsakow, wo doch die wunderbare Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch zu seinen Hauptwerken und zu einem Signum des russischen, religiös geprägten Symbolismus zählt. Wie gesagt: Wer das Glück hatte oder noch haben wird, Panagl auf einem Podium zu erleben – und dies nicht nur deshalb, weil „Hukvald Janagl“, rein optisch betrachtet, dem Zuschauer wie ein Enkel des großen mährischen Komponisten entgegentritt) –, wird das Lesebuch (denn das ist es vor allem) mit Freude aufschlagen: Vor der Oper – und nach der Oper.
Oswald Panagl: Im Zeichen der Moderne. Musiktheater zwischen Fin de Siècle und Avantgarde. 443 Seiten. Hollitzer Verlag, Wien 2020. 40 Euro.
Frank Piontek, 5.5. 2021

Am ersten April dieses Jahres starb Giorgio Gatti, und wer sein nach vierzig Karrierejahren erschienenes Buch „Giorgio Gatti si racconta, „mille grazie, miei signori“ gelesen und sich nun daran erinnert hat, den stimmt es traurig, dass sich augenscheinlich sein größter Wunsch, seine beiden Enkelkinder in das Musikleben einführen zu können, nicht mehr erfüllt hat.
Der Bariton war in seinen früheren Karrierejahren ein angesehener Buffo, in seinen späteren einer der wichtigsten Comprimarii, wovon nicht nur seine Mitwirkung in allen drei Filmen der Reihe „Tosca nei luoghi e nelle ore di Tosca“, „La Traviata à Paris“ und „Rigoletto a Mantova“ unter Zubin Mehta Zeugnis ablegt. Das Buch, das bei Zecchino Editore erschienen ist, stellt die exakt 27 Personen vor, die für Leben und Karriere von Giorgio Gatti wichtig waren, es ist chronologisch gegliedert und reicht von der Geburt des späteren Sängers im toskanischen Poggio a Caiano bis zu seinem Rückzug von der Bühne. Eingeführt wird der Leser von Stephen Hastings, der ein Menottizitat, das dieser dem Sänger widmete, dem von Emanuela Dolci betreuten Buch voranstellt.
Zwar sang Gatti niemals den Rigoletto, obwohl sein Vater diesen schicksalsträchtigen Namen trug, es reichte im gleichnamigen Film nur zum Conte di Ceprano, aber die vielen Fotos mit Widmungen der großen Stars, seien Dirigenten oder Kollegen, beweisen, wie angesehen nicht nur der Bariton war, sondern wie sehr auch seine Gattin, eine Pianistin geschätzt wurde, die sogar durch ihre Bereitschaft zum Einspringen eine Aufführung von Alfredo Kraus als Hoffmann rettete und mit der er eine Tournee unter dem Motto „L’Arte del Buffo“ unternahm.
Der Weg zum Ruhm führte durch die damals üblichen Stationen Kirchenchor, sehr bald alldort als Solist, die Opfer, die die Familie für die Ausbildung bringt, das Stipendium, für Gatti am Conservatorio Santa Cecilia in Rom, die Begegnung mit Vincenzo Guerrieri, der als erster von der Tenorlaufbahn ab- und zur Baritonlaufbahn rät. Im immer noch wundergläubigen Italien darf eine Begegnung mit Padre Pio und die damit verbundene Heilung nicht fehlen, und auch bei Gatti taucht Mario Del Monaco als Wohltäter und damit Engagementsverschaffer auf. Gatti gewinnt die üblichen Concorsi, lernt durch Luciano Bettarini die italienische Buffa kennen und lieben, nimmt gemeinsam mit Magda Olivero Canzonen von Nino Porto auf und ist der Enrico im Lucia-di-Lammermoor-Film von Franca Valeri. Lange und intensiv ist die Zusammenarbeit mit Gian Carlo Menotti, die über „Il telefono“, zu „Il console“ zu „L’ultimo selvaggio“ und „La santa di Bleecker Street“ führte, ja sogar zu einer kleinen Rolle im Parsifal von 1987. Mit Carmelo Bene in der Titelpartie führt er Schumanns „Manfred“ auf, an der Seite von Giuseppe Taddei ist er in Lucca Belcore, in Israel ist er in der „Bohéme“ von Zubin Mehta mit Andrea Bocelli als Rodolfo sowohl Benoit als Alcindoro.
Neid scheint nie eine Eigenschaft von Giorgio Gaatti gewesen zu sein, denn die ganz Großen werden von ihm nur mit den schmeichelhaftesten Attributen bedacht, so Domingo, dem er professionalità, umiltà und serietà bescheinigt. Auch an der ganz leichten Muse geht Gatti nicht vorbei, und Paolo Ferrari wertet seine Partie in Victor Victoria mit einem Auftrittslied auf. Bis zuletzt ist der Bariton bereit dazu zu lernen, so von Marco Bellocchio, der von ihm verlangt, auch dann in der Rolle zu bleiben, wenn er gerade nicht singt.
Die beiden letzten Kapitel widmete Gatti seinen beiden Enkelkindern, in denen er eine Sängerin und einen Dirigenten heranwachsen sah. Das ist ihm nun, da er nur 72 Jahre alt wurde, nicht vergönnt gewesen.
ISBN 978 88 6540 128 6
Ingrid Wanja 24.4.2021
Lücke geschlossen

Der Briefwechsel zwischen Richard Strauss und seinem „Librettisten“ Hugo von Hofmannsthal ist legendär und gut zugänglich, der zwischen den beiden Künstlern und ihrem Szenographen Alfred Roller ist jetzt unter dem Titel Mit dir keine Oper zu lang beim Benevento Verlag erschienen und gibt auf 465 Seiten Text und zusätzlich vielen Bildseiten einen so umfassenden wie detaillierten Einblick in die gemeinsame Arbeit an vielen Ur- und Erstaufführungen zwischen Elektra und Intermezzo. Das Cover zeigt einen Ausschnitt aus einem Foto von 1911 anlässlich der Aufführung des Rosenkavalier in Dresden, herausgeschnitten sind die weiteren Mitwirkenden, unter ihnen Max Reinhardt, dies aber nur, weil er an dem im Buch veröffentlichten Briefwechsel nicht beteiligt war.
Die beiden Herausgeberinnen Christiane Mühlegger-Henhapel und Ursula Renner berichten in der Einleitung zum von ihnen betreuten Buch über den Werdegang Rollers, der in Wien ausgebildet , mit Makart und Klimt verglichen wurde, Präsident der Wiener Sezession war, über „die Ablösung der Kulissenbühne durch den Bedeutungsraum“ referierte und der Meinung war: „Jedes Kunstwerk trägt das Gesetzt seiner Inszenierung in sich.“ Zunächst arbeitet Roller mit Gustav Mahler zusammen, nach dessen Übersiedlung nach New York begann das Gemeinschaftswerk mit Hofmannsthal und Strauss, sorgte er für die Optik u. von Elektra in Wien 1909, Rosenkavalier 1911, Frosch Wien 1919, Josephs Legende Wien 1922, Ruinen von Athen Wien 1924, Die ägyptische Helena 1928 und 1925 für den Stummfilm Der Rosenkavalier. Die Zusammenarbeit mit Hofmannsthal beschränkte sich nicht auf dessen Libretti, sondern umfasste auch Werk wie Ödipus und die Sphinx. Die Salzburger Festspiele sehen ihn als Mitbegründer, und vielleicht hätte die Weltgeschichte einen glücklicheren Verlauf genommen, wäre der junge Adolf Hitler einer Einladung Rollers gefolgt, ihm seine künstlerischen Werke vorzustellen.
Ein Drittel von Rollers Briefen sind an Strauss gerichtet, zwei Drittel an Hofmannsthal, zu dem sich im Verlauf der Zeit eine aufrichtige Freundschaft entwickelte, die die Gattinnen beider Künstler mit einschloss.
An die 300 Seiten Briefe lassen den erwartungsvollen Leser erst einmal in Ehrfurcht erstarren, die der Erleichterung weicht, wenn er feststellen kann, dass zu jedem der Schriftstücke umfassende Erklärungen mitgeliefert werden, die die Form der Überlieferung, die dazu gehörenden Abbildungen und schließlich überaus aufschlussreiche und teilweise sehr umfangreiche Erläuterungen betreffen. Erstaunt ist der heutige Leser, wie trotz zunehmender Vertraulichkeit die Anreden über die Jahre hinweg Distanz ausdrücken, wenn ein Herr Hofrat, ein Herr Professor ganz allmählich erst durch die jeweiligen Namen abgelöst werden, das Duzen wohl außerhalb alles Denkbaren lag. Natürlich unterscheiden sich die Briefe, was sprachliche Kompetenz angeht, voneinander, ist unverkennbar trotz der im Brief des Lord Chandos geäußerten Zweifel, das Vermögen Hofmannsthals ein emanzipierteres als das des stets sachlich und gelassen bleibenden Rollers ist, während der Dichter, abhängig vom jeweiligen Zustand des Nervenkostüms, sich eher seinen Gefühlen hingibt.
Bis in die kleinsten Einzelheiten werden Dekorationen und Kostüme erörtert bis hin zum weißen Turban für Adele Sandrock, die partout keine weißen Haare tragen wollte. Interessant sind die Erörterungen bei der Titelsuche nach der Komödie, die eigentlich Ochs von Lerchenau heißen sollte, ehe sie zum Rosenkavalier wurde- und auch vor dem Ersten Weltkrieg speisten Künstler bereits bei Borchardt und gab es wohl auch schon den „Merker“.
Viel Raum wird er Zusammenarbeit am Jedermann und am Großen Welttheater gewidmet, ebenso dem 5000-Mann-Zelt für den Berliner Ödipus, und wenn auch nicht immer Harmonie herrscht, so doch durchgehend gegenseitiger Respekt und eine sprachlich gepflegte Auseinandersetzung über strittige Themen, selbst wenn Hofmannsthal mal ein „der ganze öffentliche Dreck“ herausrutscht oder Roller sich lustig macht über sein fehlendes Glück mit Primadonnenkostümen. Dem Leser wird zunehmend bewusst, wie viel sich in der Welt des Theaters geändert hat und wie viel sich wohl immer gleich bleiben wird.
Der Erste Weltkrieg hinterlässt seine Spuren, was dem damals recht spärlichen Briefwechsel zu entnehmen ist, der Hofmannsthal Kriegspropaganda betreiben, Strauss sein gesamtes Vermögen in England konfisziert sehen und Roller fast verhungern lässt.
Mit welcher Akribie man damals arbeitete zeigt der umfangreiche Briefwechsel über die unterschiedlichen Arten des Färbens anlässlich der Uraufführung der Frau ohne Schatten, speziell über die sogenannte Krappfärberei. Dass man sich nicht dem Naturalismus nähern will, zeigt Hofmannsthals Warnung vor zu viel Realität auf der Bühne.
Erstaunlich ist es, dass die Auflösung des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarns nach dem verlorenen Krieg keine Rolle spielt, man macht auf den Bühnen dort weiter, wo man im Krieg aufgehört hatte. Das betrifft auch die allgegenwertigen Querelen wie die notwendige Diplomatie gegenüber „einheimischen“ Bühnenbildnern, die Gegnerschaft Korngolds, weitere Theaterintrigen. Und man schreibt sich Aussagen wie diese von Strauss hinter die Ohren:“Die Bühne soll sich einordnen ins Gesamtkonzept des Dichters“, so wie das Bekenntnis zum Theater, ohne das Oper zum Konzert mutiere.
Vieles ist Alltägliches, Vergängliches, sich Wiederholendes, aber es gibt viele Perlen, die sich als neu in das Gedächtnis des Lesers einprägen, so das Zugeständnis an Kokoschka, er sei genial, mit dem Zusatz, aber „unfähig zur Teamarbeit“, die scharfsinnigen Betrachtungen der politischen und künstlerischen Situation durch Roller, dem seinerseits Hofmannsthal anlastet, ihm fehle „ein freies und leicht auffassendes Verhältnis zum Dichterischen“. Zu den markantesten Äußerungen von Strauss wiederum gehört wohl: „Nichts ist gräulicher als eine mittelmäßige Meyerbeeraufführung.“
Mit den seetüchtigen Ozeanriesen beginnt auch für die drei Briefeschreiber das Problem der reisenden Sänger und Dirigenten, was u.a. Roller feststellen lässt: „Die Oper stirbt. Das ist keine Frage.“ Und dann wird es immer trauriger, folgen die Kondolenzbriefe an die Witwe Hofmannsthals, der zwei Tage nach dem Freitod seines Sohnes stirbt, die Würdigung Rollers 1942, der 1935 sich zum Komponisten bekannte und das „Rechts und Linksgeschrei“ um seine Person kritisierte. Tragisch ist auch das Ende des hochbegabten Sohnes Rollers, der, auch weil sein Vater Parsifal in Bayreuth ausgestattet hatte, auf die Liste der „Gottbegnadeten“ aufgenommen worden war, als SS-Mann in einem KZ Dienst tat, sich von der Liste streichen ließ und an der Ostfront fiel.
Einen großen Teil des umfangreichen Bandes macht der Anhang aus, bestehend aus Danksagung, editorischem Bericht, Abkürzungen, Bilddokumentation, Chronik, Bibliographie zu Alfred Roller, Literatur und Register.
Eine große Lücke in der Aufarbeitung eines der wichtigsten Kapitel der Geschichte der Oper ist damit geschlossen, und den Leser erwartet eine hochinteressante Lektüre.
465 Seiten, Benevento Verlag München-Salzburg
ISBN 978 3 7109 0127 0
Ingrid Wanja, 21-4-2021
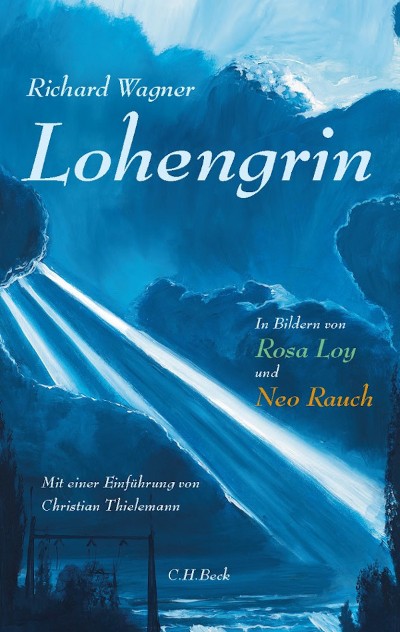
Richard Wagner: Lohengrin. In Bildern von Rosa Loy und Neo Rauch
Als Keith Warner einst den Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen inszenierte, sagte er, dass die Grundfarbe der Oper für ihn Schwarz sei. So sah die Bühne dann auch meist aus: ein Waste Land auf schwarzem Grund. Ein unbefangener Hörer, der die Farbe der Oper nach dem Klang der Musik beurteilen müsste, käme nach Anhören des Vorspiels mit größter Wahrscheinlichkeit auf einen schimmernden Silberton. Der Lohengrin, der 2018 in Bayreuth herauskam, zeichnete sich äußerlich durch eine Farbe aus, die eher in der Silbernähe als dem Schwarzgrund zu verorten ist: das Blau war unübersehbar; hinzu kam, bei Elsa, ein grelles Orange, zuletzt bei der Erscheinung Gottfrieds ein intensives Grün, das manch Beobachter an das Grün der DDR-Ampelmännchen erinnerte.
Wir begegnen all diesen Farben und Figuren in einem Band, der – das ist bei den Festspielen inzwischen eine gute Tradition – die Produktion nachträglich dokumentiert. Es war ja nicht das erste Mal, dass sich ein, in diesem Fall zwei bildende Künstler an einem Bayreuther Lohengrin beteiligten, in diesem Fall das Künstlerpaar Rosa Loy und Neo Rauch. Auch von Henning von Gierkes Entwürfen zu einem romantischen Lohengrin, der die Geschichte symbolistisch durch die vier Jahreszeiten und die deutsche Kunstgeschichte (mit einer tiefen Verbeugung vor Caspar David Friedrich) führte, gibt es einen Kunstband, der die Idee der Inszenierung ästhetisch erläutert. Im Fall des neuen Buchs zum Lohengrin von 2018 ist dies nur bedingt der Fall – denn Erklärungen zu den Bildfindungen, den Flügeln und dem Elektrowerk, finden sich weniger hier als im Programmheft der Premiere. Worauf die Insektenflügel des Fliegenvolks und die Käfer für Ortrud verweisen, bleibt nach wie vor persönliche Interpretationssache: je nach Insektenzu- oder abneigung. Dass sich das grundlegende Blau und die Gestalt der Kostüme vor allem, mit Abweichungen zu Strickweste und Overall, auf das Goldene Zeitalter der Niederlande und die Kunst der Delfter Kacheln beziehen, ist dagegen klar. Wer sich also die blauen Wolkenprospekte, die blauen Kostümentwürfe für die Damen und Herren des Chors, für König Heinrich und die vier blauen Edlen genauer anschauen will, erhält jetzt durch einen schön gestalteten und ebenso schön gebundenen Band eine Gelegenheit, die sich der Bayreuth-Aficionado selbst dann nicht entgehen lassen sollte, wenn er die Inszenierung schlicht und einfach ridikül fand; über Geschmack (betr. der Bühnenbilder und Kostüme) lässt sich im Übrigen nicht streiten. Loy und Rauch sprechen, in Tusche und Acryl, eine durchaus unterschiedliche Zeichensprache, aber wer Rauchs Gemälde kennt, wird in Loys Skizzen das genaue Widerspiel einer ästhetischen Idee entdecken, die in diesem Fall das traditionelle Herbeizitierte und das interpretatorisch Gewagte – das gleichzeitig sehr einschichtig ist – ineins setzte. „Spannung, Energie, Elektrizität“, das war es auch schon, eingepackt in, ja, interessante Bilder, aber wie so oft sind die Entwürfe bisweilen faszinierender als die fertigen Produkte. Das wussten vielleicht schon die Maler des Barock, deren Bozetti moderner sind als die vollendeten Altartafeln. Also ein weiterer Pluspunkt für dieses neue Bayreuth-Produkt.
Was hier vorgelegt wurde, ist also ein autonomer Kunstband, der für den Wagnerneuling den Komplettabdruck des Textbuchs und für den „Kenner“ die Skizzen, Entwürfe und ein Gespräch mit dem Dirigenten der 2018er-Premiere, Christian Thielemann, bereit hält. Was er zu sagen hat, ist durchwegs beachtenswert. Als langjähriger Praktiker im Graben der Bayreuther Festspiele weiß er um die Tücken und Vorzüge desselben, aber auch um den eigenen Charme der „Romantischen Oper“. Was er über den Theater-Charakter des Werks und seine singuläre Stellung in Wagners Oeuvre zu sagen hat, ist aphoristisch und genau – und seine Kritik an Elsa, die zu früh fragt, ist diskutabel; die meisten Regisseure dürften das anders sehen, während Thielemann eher (s)einen Wagner von innen befragt. So wie Loy und Rauch, die ihre eigene Sicht auf den ins Heute transzendierten Märchenstoff im Kunstbuch verewigt haben. Wie gesagt: Für Kenner und Neulinge, für Kunstfreunde und Bayreuth-Narren.
Und wenn er genau hinschaut, weicht das Blau nicht selten dem nächtlichen Schwarz.
Richard Wagner: Lohengrin. In Bildern von Rosa Loy und Neo Rauch. 152 Seiten, 51 farbige Abbildungen. Verlag C.H. Beck. 34 Euro.
Frank Piontek, 15.4. 2021
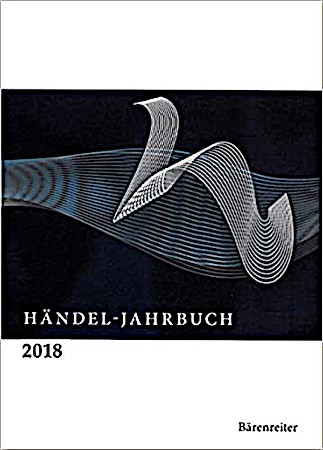
Händel-Jahrbuch 2020
Der Bayreuther Walk of Wagner ist 2021/22 dem hübschen Thema Wagner und die Frauen gewidmet. Das ist viel, aber doch nicht so viel wie das, was im neuen Händel-Jahrbuch der Leserin an Weiblichkeit kredenzt wird – denn 2019 unterhielt man sich in Halle über „Frauengestalten in den Werken Händels und seiner Zeitgenossen“, Obertitel: „Zwischen Alcina und Theodora“. Der halbwegs poetische Ober- und der sachliche Untertitel verdanken sich nun weniger dem Thema, sondern dem Zwang zur Kürze, denn der bessere Titel müsste lauten: „Händels und seiner Librettisten und seiner Sänger und Sängerinnen und Mitkünstler Frauenfiguren“ (so schreibt das Florian Mehltretter in seinem Beitrag, freilich versehen mit dem linguistisch uninformierten Gender-Asterisk) oder: Händels Frauenfiguren und Sängerinnen.
Wie auch immer: 2019 wurde in 17 Referaten und einem Festvortrag der Primadonna der „Barockoper“-Forschung, Silke Leopold, das Thema mit diversen Fallstudien und Querschnitten vertieft angerissen. Silke Leopold trifft schon das Richtige, wenn sie bemerkt, dass Händels Figuren zwar nicht aus dem seinerzeit konventionellen Schema der Einteilung in einerseits tugendhafte Damen, andererseits gefährliche Femme fatales ausbrechen. Faszinierend bleibt – dies ist das Plus der theoretischen, aber v.a. praktischen Beschäftigung mit den Opern der Ära – die Tatsache, dass Händel musikalisch und charakterlich reife Gestalten erfand, die das Wort von der „Alten Musik“ den Garaus machen sollten: „Gerade bei seinen Frauenfiguren gelangen Händel musikalische Rollenporträts von einer psychologischen Stringenz, die der Opera seria mit ihrer vermeintlich schematischen Abfolge von Arien unterschiedlichen Affektinhalts generell abgesprochen wird.“ Wobei Silke Leopold natürlich weiß, dass die Differenzen zu einer modernen Charakter-Psychologie nicht unterschlagen werden sollten – was die Analyse der feinen Unterschiede nur umso spannender macht; Ruth Smith‘ genaues, musikdramatisch vielschichtig interpretiertes Figurenporträt der Dorinda (im genialen Orlando) bietet sozusagen die Blaupause für eine subtile Händel-Operndeutung. Es muss auffallen, dass sog. schwache Frauen in Händels Oeuvre selbst dort nicht auftreten, wo die Zeichnung, die sie durch den Librettisten und den Komponisten erfuhren, auf relativ traditionellen Bahnen angelegt wurde, ja: Die Musikwissenschaftlerin plädiert am Ende dafür, in einigen Händel-Figuren „role models“ für die Gegenwart zu entdecken.
Nicht jeder Beiträger aber versuchte, die von Händel angelegte und auskomponierte Musikdramatik ganzheitlich zu erfassen. Allzu viele Referate beschränken sich darauf, die Musiktheaterstücke – neben den Opern die bedeutenden Oratorien – mit rein literaturwissenschaftlichen Mitteln zu erfassen, was im einzelnen Fall – des Vergleichs der Opern / Oratorien mit den Quellen oder des Vergleichs einzelner Handlungsmuster – interessant sein kann. Die Frage aber, ob eine Figur mehr oder weniger typisiert ist, lässt sich m.E. nicht allein in Hinblick auf eine erschließbare sozialgeschichtliche Realität beantworten, auch wenn Informationen über die Rolle der Frau im Zeitalter der sog. Aufklärung im Spiegel der Opern- und Oratorientexte erhellend sind. Nicht in allen Aufsätzen spielt Händels Musik die erste Geige – wo sie sie spielt, kommen die Autorinnen (sie sind, dem Thema angemessen, in der Überzahl) gelegentlich zu schönen Ergebnissen. Es sind nicht zuletzt die Recherchen bezüglich der Sängerinnen und Vokalisten, die unsere Kenntnis von den Enstehungsbedingungen quellenmäßig vergrößern. Gerade die äußeren Umstände aber haben meist dafür gesorgt, dass sich ein Werk bzw. das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem konkreten Ort gespielt wurde, nicht allein den Interessen der Autoren, sondern nicht weniger der Auftraggeber und der Interpreten verdankte. Wenn Elena Abbado in ihrem freien und wertvollen Forschungsbeitrag über die ersten Rodrigo-Vorstellungen berichtet, bekommen wir einen tiefen Einblick in die Unbeliebtheit und Unfähigkeit des Impresarios Gregorio Barsotti, der durch die Lektüre der Tagebücher des Sängers Stefano Frilli namhaft gemacht werden konnte.
Wenn Berta Joncus über die „first songster“ Giulia Frasi und Ina Knoth über Margherita Durastanti berichten und ganze Repertoireverzeichnisse dieser Sängerpersönlichkeiten mitliefern, ist die Erkenntnis über den Show-Betrieb und Rollenschemata und Typbesetzungen, die oft auch durchbrochen wurden, so wertvoll wie die Definition verschiedener geschlechtsspezifischer Arien-Typen (Aria parlante, Zwei-Paar-Arien, Preghiera), die Reinhard Strohm vorgelegt hat. Frauen sind eben nicht gleich Frauen, oder anders: Der Ton machte bei Händel ganz besonders die Musik jener Frauen, die von Händel oft mit einer sehr genauen Motiv- und Klang-Arbeit, vorzugsweise pastoral gemacht wurde, worauf beispielsweise Ivan Curkovic in seinem Beitrag über Atalanta hinweist. Und wenn eine vorgesehene Arie wegfiel oder / und durch eine andere und / oder neue ersetzt wurde, wirkte sich die Operation so auf die Musikdramaturgie einer Figur, eines Akts, einer Figur aus, dass es gut ist, dass die Forschung nicht allein den Umstand festhält, dass, sondern warum z.B. in Atalanta ein Stück ausgetauscht wurde: was nicht immer mit der Fähigkeit oder Unfähigkeit der Sänger zusammenhing.
Wer sich dafür interessiert, wie tänzerisch sich im Zeitalter der höfischen Maskierungskunst Verstellung in der Musik anhörte, als frau zur Sarabande reizvoll log (Wendy Hiller), welche Tricks Händels weibliche Opernfiguren anwenden mussten, um auf den Schlachtfeldern der Liebe und des Krieges erfolgreich zu sein (Anke Charton), in welcher Art Händel Leonardo Vincis Semiramide en detail, besonders in den Rezitativen, bearbeitete, um die Titelfigur noch intimer auszustatten (John H. Roberts), sollte zum Sammelband greifen, um davon überzeugt zu werden, dass es erst das „Klein-Klein“ der Forschung, das Wühlen in den Archiven und das geduldige Vergleichen verschiedener Werk-Schichten ist, das uns Genaueres über die Stücke und ihre verschiedenen Entstehungsgründe mitzuteilen vermag – abgesehen von den detaillierten Deutungen der Noten. Die Frage, ob es bei dieser oder jener Frauenfigur um eine charakterlich stringente oder nur handlungsmäßig konsequente Gestalt handelt, ist am Ende unwichtig, weil es Händel oft gelang, mit der Kraft und Poesie seiner zukunftsweisenden Musik Frauen zu porträtieren, die – Konvention hin oder her - ein absolutes Eigenleben besitzen. Und Scipio, zweifellos ein Mann, bekannt als einer der grausamen römischen Herrscher? Händels Oper gehört, wie Mozarts, zu seinen unbekannteren. Auf sie in einem wenn auch kurzen Beitrag aufmerksam gemacht zu haben ist das Verdienst Paul van Reijens. Was danach noch kommt, ist eine 26 Seiten umfassende Biblio- und Diskographie aller Händel-Neuerscheinungen.
Mit Almira, Königin von Kastilien, an der CD-Spitze.
Händel-Jahrbuch. Hrg von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e.V. Bärenreiter Verlag 2020. 463 Seiten. 14 SW-Abbildungen und viele Notenbeispiele. Deutsch / Englisch. 78 Euro.
Frank Piontek, an Händels 262. Todestag

Zwischenbericht
Spaziergänge durch das musikalische Leipzig hat der Henschel Verlag inzwischen in vierter Auflage herausgebracht, nach dem Raum wird nun die Zeit erforscht mit Hagen Kunzes Gesang vom Leben-Biografie der Musikmetropole Leipzig. Der zunächst befremdlich erscheinende Titel erklärt sich mit dem Cover, das Teile von Sighard Gille gleichnamigem, sich über vier Etagen erstreckendem Gemälde im Gewandhaus zeigt, leider die einzige Bebilderung, obwohl sich eine besonders reichhaltige eigentlich anbieten würde.
Das Buch ist geschickt gegliedert, indem es einerseits chronologisch vorgeht, zugleich aber auch thematisch, so bestimmten Persönlichkeiten oder Institutionen ein Kapitel widmend, was dazu führt, dass sich manche Kapitel zeitlich überlappen. Jedes Kapitel, und alle umfassen nur jeweils einige Seiten, ist untergliedert in Schwerpunkte, was erstens das gesamte Buch trotz seines beachtlichen Umfangs übersichtlich erscheinen lässt und zweitens dem Leser die Möglichkeit lässt, auch einmal , zeigt er sich nicht besonders interessiert, den einen oder anderen Abschnitt zu überspringen.
Es beginnt mit der Gründung des Klosters Sankt Thomas und damit mit einer der berühmtesten Institutionen, dem Thomanerchor. Er und seine Chorleiter begegnen dem Leser natürlich immer wieder, ebenso wie die Betonung, dass Leipzig nicht Residenzstadt wie Dresden, sondern eine Stadt freier Bürger war, die seit 1190 das Messeprivileg besaßen und die nach der Reformation den Chor zu einem städtischen werden ließen. Hand in Hand geht mit der Entwicklung der Stadt, der Thomaner und der „Stadtpfeifer“ die Entwicklung der Musik von der Gregorianik zur Mehrstimmigkeit, und ein Chorbuch beweist, dass schon früh der Sopran zur führenden Stimme wurde. Neben der geistlichen Chormusik, Heinrich Schütz widmet der Stadt in schwerster Zeit, dem 30jährigen Krieg, eine solche, wird die Entwicklung auch der weltlichen Musik detailliert beschrieben, so die Opern von Johann Kuhnau, unsterblich aber sind Lieder wie Vom Himmel hoch oder Lobet den Herrn .
Viel erfährt der Leser über die Komponisten, die in Leipzig wirkten, als Thomaskantor oder Gewandhausorchesterdirigent, so über Telemann, Melchior Hoffmann mit seiner 15stündigen Oper und natürlich Johann Sebastian Bach, der seinen Einstieg in Leipzig als Orgelbegutachter hat.
Nicht nur Künstler machen Leipzig zur Musikstadt, sondern auch Orgelbauer wie Silbermann, Verleger wie Breitkopf, zu dem später Härtel stößt oder Peters oder Klavierbauer wieBlüthner. Einige dieser Namen tauchen auch in den Kapiteln über die Nazizeit und die DDR-Geschichte auf, wenn glücklich, dann mit einer Neugründung oder Wiedergründung endend.
Natürlich nimmt Bachs Wirken einen breiten Raum im Buch ein, seine Johannespassion und danach die Matthäuspassion, das Musikalische Opfer, das nicht der Stadt, sondern dem Erzfeind Friedrich von Preußen gewidmet ist. Zur Posse wird das Schicksal des Toten, endend mit dem lakonischen „Tach, ich bring Bach.“
Die Geschichte des Musklebens der Stadt Leipzig ist auch eine der Gebäude, in denen musiziert wird, sei es die Thomanerkirche oder sei es das Gewandhaus. Nicht vergessen werden das Musikinstrumentenmuseum oder die Singakademie, die Völkerschlacht von 1813, dem Jahr, in dem auch Richard Wagner in Leipzig geboren wurde.
Immer wieder wird Leipzig von berühmten Künstlern besucht, sei es Mozart mit einem Orgelkonzert, Paganini oder Clara Wieck, deren leidvolle Liebesgeschichte mit Robert Schumann nicht ausgespart wird. Nicht nur damals ist Albert Lortzing „der verkannte Komponist“, heute ist es viel schlimmer, denn er ist der vergessene Komponist. Das alles wird in einem romanhaft flüssigen wie sachlich korrekt wirkenden Stil beschrieben, so dass die Lektüre zugleich unterhaltsam wie kenntniserweiternd ist.
Natürlich darf Mendelssohn-Bartholdy nicht fehlen, noch darf es der Streit um sein Denkmal, dass während des Urlaubs des Oberbürgermeisters Carl Goerdeler von den Nazis abgerissen wurde, der später zum engsten Kreis um Stauffenberg gehörte. Mendelssohn seinerseits hatte ein Bachdenkmal gestiftet, das in Beisein des letzten Urenkels Bachs eingeweiht wurde.
In manchen Institutionen oder vielmehr ihren wechselnden Namen spiegelt sich deutsche Geschichte, so im Musikerverein Euterpe von 1824, der 1948 zum Orchester der DeutschSowjetischen Freundschaft mutieren musste, um nach dem Mauerfall zum Sinfonischen Musikverein zu werden.
Auch Gustav Mahler ist Teil der Musikgeschichte Leipzigs und vollendet Webers Die drei Pintos, nicht nur neue Dirigenten kommen, es werden auch neue Gebäude für alte Institutionen gebaut und die Interpreten mit der Zeit wichtiger als die Komponisten.
Bereits 1924 wird der Mitteldeutsche Rundfunk aus der Taufe gehoben, die Nazis kommen an die Macht und vertreiben Gustav Brecher wie Bruno Walter, Nachfolger Hermann Abendroth ist Parteimitglied wie SU-Freund und deshalb Abgeordneter für die NDPD in der Volkskammer. Die Thomaner werden der Hitlerjugend eingegliedert, aber ihre Bindung an die Kirche bleibt, nach den ersten Bombenangriffen werden sie nach Grimma evakuiert, ihre Schule bleibt auch nach 1945 humanistisches Gymnasium.
Bereits 1943 wird Leipzig durch Bomben zerstört, die Oper geht ins Varieté Dreilinden, das Gewandhausorchester ins Capitol und spielt weiterhin im Rundfunk, was vielen Mitgliedern das Leben rettet.
Nach 1945 bleibt Leipzig Musikstadt, mit der die Namen Joachim Herz, Uwe Wand, Herbert Kegel, Udo Zimmermann, Henri Maier, Ulf Schirmer verbunden sind, und natürlich ist dem Wirken von Kurt Masur, sei es künstlerisch oder politisch, ein Kapitel gewidmet.
Dem Jazz, Swing, der Tanz- und Straßenmusik sind eigene Kapitel zugedacht, aus den Montagsgebeten werden Montagsdemonstrationen, aus Wir sind das Volk wird Wir sind ein Volk. In die klassische Musik bringen das Triumvirat Luisi, Viotti, Honneck neue Impulse, ebenso Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly und Andris Nelson. Aber auch die U-Musik mit Rammstein, Prinzen oder Kulturfabrik Werk 2 prägt das Leipziger Musikleben. Schließlich lugt sogar schon Corona um die Ecke und lässt den Veranstalter des Bachfestes weinen.
Endnoten, Literaturverzeichnis und Register vervollständigen den Band.
Der Verfasser nennt sein Buch eine Biographie, die normalerweise mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Die Geburt der Musikstadt Leipzig liegt im Dunkeln, ihren Tod wird sie hoffentlich nie erleiden müssen, so dass das Buch mit der Hoffnung schließen kann, dass noch viele Kapitel über sie geschrieben werden können.
338 Seiten, Henschel Verlag 2021
ISBN 978 3 89487 811 5
Ingrid Wanja, 7.4.2021

Gluck, der Reformer?
„Die Komponisten von Reformopern waren keine Missionare der Opernreform“. Man liest Silke Leopolds Satz und begreift, wieso es schwer, wenn nicht gar fast unmöglich ist, in Zusammenhang mit Christoph Willibald Gluck, seinem Librettisten Calzabigi und dem Wiener Theaterrdirektor Durazzo von der Opernreform zu sprechen.
Schon längst ist bekannt, dass nur ein wenn auch wesentlicher Bruchteil des Gluckschen Opernschaffens jener Bewegung zugeordnet werden kann, die zumal die deutsche Musikwissenschaft – im Rücken: Wagners Lobpreis des „Vorgängers“ Gluck – als Reform der Gattung bezeichnete, als hätte Gluck nach dem Orfeo nichts Anderes geschrieben als „Reformopern“. In einem neuen Band, der schon sechs Jahre nach einer in Zusammenhang mit den Nürnberger Gluckfestspielen stattgefundenen Tagung herauskam, wurden die sieben theoretischen Beiträge des Symposions vereinigt, wobei im Prinzip allein fünf Beiträge dem Tagungsthema gewidmet waren. Worum ging's? „Die Rolle Glucks als Opernreformator zu hinterfragen und eine Standortbestimmung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Opernreformbestrebungen des mittleren 18. Jahrhunderts vorzunehmen“ und „herauszuarbeiten, auf welche Weise Gluck die künstlerische Prägung erfuhr, die ihn für die Gedanken des Wiener Reformkreises empfänglich machten“. Tatsächlich konnten wenigstens einige wenige Aspekte dieses gewaltigen Themenkreises diskutiert werden – beginnend mit einer wünschenswert detaillierten und spannenden Spurensuche. Bruce Alan Brown gelang es, den douanier und Direttore delle Dogane, also den Finanzdirektor in der Toskana, Daniel de Villeneuve, als Verfasser eines typischen Reformtraktats, des Lettre sur le méchanisme de l'opera italien von 1756, zu identifizieren. Im Plädoyer für eine italienisch-französische Mischform zugunsten einer neuen Oper sehen wir jene Ziele in der Theorie eines Aufklärungs-„Philosophen“, der, rein theoretisch, das Übernationale der Opernkultur propagierte. Damit ging der Autor konform mit jenen Überlegungen, die der von Laurine Quetin erläuterte Monsieur de Chabanon publizierte, denen wir das Wort von „deutschen Teufel“ namens Gluck verdanken, der die Pariser Opernszene gleichsam aufgemischt hat. Durch die Identifikation Villeneuves werden wir auf ein weiteres Werk gestoßen, in dem gleichartige Thesen zur modernen Oper und zur Rettung der französischen Kunst vor den italienischen Missständen formuliert werden: im Voyageur philosophe (1761). Man sieht: Es hat sich gelohnt, tief in die Archive, auch des florentinischen Archivo di stato, hineingestiegen zu sein, um über den fiskalischen Keller in die Bel Etage der Querelles des Bouffons zu geraten.
Der Theorie stand immer die Praxis gegenüber, oder anders: es war die Praxis, die die Theorie gleichsam vor sich her jagte. Daniel Brandenburg nimmt seine Forschungen zum jungen Gluck der Wandertruppen auf, um die große Bedeutung seiner italienischen Erfahrungen zu betonen; der Mann war hier nicht allein der Komponist der aufgeführten Werke, sondern gleichsam ein Mann für Alles, damit bereits jene Persönlichkeit, die später mit ihren Mitarbeitern den Zusammenhang von Text, Musik und Szene als verantwortlicher Autor beschwor. Es waren, so Brandenburg, v.a. die Buffonisten, die einen wesentlichen Anteil an den szenisch-dramaturgischen Ausprägungen hatten, die wir als „Reformwerke“ zu bezeichnen pflegen – interessanterweise begegnen die Kontakte zwischen den Komödianten und den Vertretern eines „noblen“ Stils gleichzeitig in den Balletten, die sich mit ähnlichen Transformationen zwischen einem älteren, angeblich „schlechten“ und einem neuen, „besseren“ choreographischen Stil beschäftigen. Marie-Thérèse Mourey bietet in ihrem Beitrag einen konzentrierten Aufriss über die gesamteuropäischen Tanzreformen, oder besser: Tanzentwicklungen des 18. Jahrhunderts, deren ästhetische Argumente denen der Oper so auffallend ähneln, und deren Praxisbezug (die Abhängigkeit von Publikumsgeschmack und -reaktion, die Interessen der Künstler, der Widerspruch und die Synthese zwischen Musik/Handlung/action und Sujet) vergleichbar ist. Auch unter den Tänzern und Choreographen gab es Querelles, wofür die bekannten Namen Noverre, Hilverding und Marie Sallé einstehen mögen.
Zwei Beiträge des Bandes fallen ein wenig aus dem Reform-Thema heraus: Daniela Philippis Aufsatz über die Klavierauszüge der Gluck-Zeit, besonders über drei frühe, durchaus unterschiedliche Auszüge zur taurischen Iphigenie, schließlich Frieder Reininghaus' kurze Übersicht über herausragende Gluck-Inszenierungen von 1987 bis 2016 unter besonderer Berücksichtigung des Wiener 2014er-Orfeo von Romeo Castelluci. Zwei Aussagen des Kollegen fallen auf: „Der Alte Meister war freilich wohl zu sehr den Denkformen und Kulturcodes des Ancienne Régime verhaftet, als dass von seinen Werken im 21. Jahrhundert ohne weiteres 'revolutionärer' Impuls ausgehen könnte – und würden die Stücke auch in noch so elaborierter Weise frisch aufgesattelt. Tunlichst sollte die Meute de Medienleute aufhören, von den Tonkünstlern zu verlangen, 'revolutionär' zu sein.“ Gluck bleibt gleichwohl ein großer Musikdramatiker; da hatte Wagner schon Recht. Wie Reininghaus am Ende in Zusammenhang mit Johan Simons' Alceste-Inszenierung in der Jahrhunderthalle Bochum so schön schreibt: „Das allzu große Zutrauen zum auratischen Raum, der 'es schon richten werde', mag als Ausflucht genommen werden, was angesichts der vorwaltenden Ratlosigkeit mit Glucks Opern heute noch oder morgen wieder 'anzufangen' sei. Dabei ist die Musik lebendiger, als die Verächter Glucks argwöhnen: auf der 'Backlist' ein Dauerbrenner.“ Der Rest ist spannungsvolle Theorie und „Reform“-Geschichte.
Gluck, der Reformer? (Gluck-Studien, Bd. 8). Hrg. von Daniel Brandenburg. Bärenreiter Verlag 2020. 105 Seiten, 22 Abbildungen. 42,95 Euro.
Frank Piontek
Reiseführer für Opernfreunde
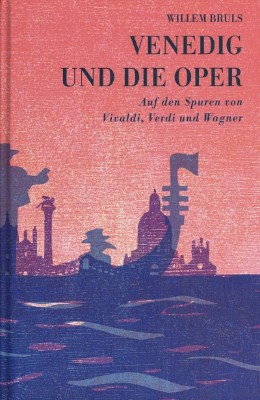
Die 25 Kriminalfälle Commissario Brunettis und ihre Schauplätze kann der Venedig-Verrückte (und wer ist das nicht, wenn er die Stadt auch nur einmal besucht hat) schon seit langem erforschen und anhand eines Stadtplans und genauer Beschreibungen aufsuchen. Nun ist das auch seit einiger Zeit für Holländer und seit kurzem für Deutsche möglich, die der Oper verfallen sind, denn Willem Bruls hat mit seinem Buch Venedig und die Oper- Auf den Spuren
von Vivaldi, Verdi und Wagner die Möglichkeit dazu geschaffen. Auf einem kleinen Plan der Stadt sind die immerhin 36 Stätten markiert, die der Auto für seine Forschungen aufgesucht hat, dazu kommen noch einige weitere mit Buchstaben versehene. Zwei darauf folgende Seiten bekunden, wie sehr Schriftsteller aus ganz Europa von der Lagunenstadt verzaubert waren und welche Dichtungen sie ihr gewidmet haben. August von Platens „Venedig liegt nur noch im Land der Träume“ kommt der Einstellung des Verfassers am nächsten, der auf den folgenden 250 Seiten nicht müde wird zu beteuern, dass Venedig nicht nur eine sterbende, sondern ein bereits seit langem tote Stadt sei, deren Blütezeit und damit auch die der Oper in ihren Mauern aus Wasser gerade einmal von ca. 1600 bis ca. 1800 dauerte, als Napoleon den letzten Dogen absetzte. Der Totgesagten allerdings widmet er eine höchst poetische Sprache, wenn er von „Fassaden, die auf dem Wasser treiben“ schreibt und manchmal versteigt er sich auch zu gewagten Vergleichen, wenn er ihr Siechtum nach 1800 mit dem der Gralsritter in Wagners Parsifal vergleicht. Dem deutschen Komponisten ist natürlich ein Kapitel des Buches gewidmet, denn er komponierte in Venedig den zweiten Akt vom Tristan und starb im Palazzo Vendramin, heute das Casinò der Stadt im Winter. Hier und bei der Beschreibung anderer sehenswerter Orte hat der Autor die Erfahrung vieler Besucher gemacht, dass man viele Orte nur vom Wasser her erreichen kann, ansonsten kann man stundenlang ohne Erfolg in den engen Gässchen umherirren. Im Wagnerkapitel gibt es auch Hinweise zum Grab von Hasse und seiner italienischen Gattin Faustina Bordoni in der Kirche San Marcula und auf das Ghetto, ein Begriff, der auf il getto, die venezianische Schmelzerei, zurückzuführen ist. Das Buch konfrontiert den Leser mit einer Fülle von interessanten Fakten, manchmal auch mit Behauptungen, die ohne Beweise im Raum stehen gelassen werden wie die, im Ring gebe es „unzählige antisemitische Bezüge“. Und reichlich oft wird wie auch in diesem Kapitel wiederholt, das Dasein Venedigs sei wie „regloses Warten auf das Ende“. Noch schlimmer wird es auf Seite 152, wo es über die Zeit ab 1797 heißt: „Der morbide Leichnam dieser Erinnerung wird nun schon mehr als zwei Jahrhunderte einbalsamiert bewahrt. Doch unter den Schichten von Schminke, Stuck und Spachtelmasse dringt ein fürchterlicher Gestank hervor und lauert eine gähnende Leere“.
Der eher noch häufiger erhobene, aber durchaus nicht strafende Zeigefinger gilt der ungebremsten Wollust, derer man sich in der Blütezeit der Stadt hingab. Zuvor wird aber mit dem Kapitel über Attila, über seinen Regierungssitz auf der Insel Torcello Verdis gleichnamiger Oper und der Gründung Venedigs gedacht, in Forestos Arie findet sogar schon „la fenice“ Erwähnung.
Gleich fünf Kapitel gelten Claudio Monteverdi und der Geburt der Oper, dem Übergang von der Renaissance zum Barock, der Zerstörung des christlichen Konstantinopels durch die Intrigen der Venezianer. Der Leser lernt die Opern des Maestro kennen und die Orte, an denen sie uraufgeführt wurden. Fast jede der reichen Patrizierfamilien hielt sich ihr eigenes Theater, noch erhalten für den ursprünglichen Zweck, wenn auch nicht in der ursprünglichen Form sind La Fenice, Teatro Goldoni oder Teatro Malibran. Bei der Einsicht in die Partitur von Cavallis La Calisto gibt es ein interesantes Gespräch mit dem verantwortlichen Musikwissenschaftler, beim Besuch der Fondazione Luigi Nono ein solches mit der Witwe des Komponisten.
Zwischen beiden aber liegen noch die Kapitel über Händel und seine für den aus Venedig stammenden Kardinal Grimani komponierte Agrippina, über den Zwist zwischen Vivaldi und Benedetto Marcello und über die Chöre von himmlisch singenden und hässlich aussehenden Mädchen. Interessant ist es auch, dass es bereits vor Mozarts Don Giovanni in Venedig eine Oper gleichen Namens als Angriff auf das Lotterleben Casanovas gab.
Von Mozart über Rossini zieht Bruls eine Entwicklunglinie, die vom edlen Bassa Selim zum lächerlichen Ausländer Mustafa reicht und die er als eine verhängnisvolle Wandlung vom Humanismus zum extremen Nationalismus ansehen möchte. Der Lido, Thomas Mann und sein Tod in Venedig, Visconti, Djagilew, Frederick Rolfe, Britten, die Homosexualität, der schöne Tadzio und sein Darsteller Björn Andrésen, der Helmut Berger eifersüchtig werden ließ, dürfen natürlich nicht fehlen. Und noch immer steht das Grand Hotel des Bains leer, in dem sie alle einst logierten, und im Café Florian kostet der Cappuccino inzwischen zehn Euro. Für den nächsten Venedig-Besuch aber muss man mindestens eine Woche einplanen, um alle die interessanten Orte zu besuchen, von denen der Autor berichtet hat und die man nun mit anderen, wissenderen Augen wahrnehmen wird.
Hinweise zum Weiterlesen und Weiterhören und Wegbeschreibungen finden sich am Ende des Buches.
264 Seiten, Henschel Verlag 2021
ISBN 978 3 89487 818 4
Ingrid Wanja
Bekenntnisse
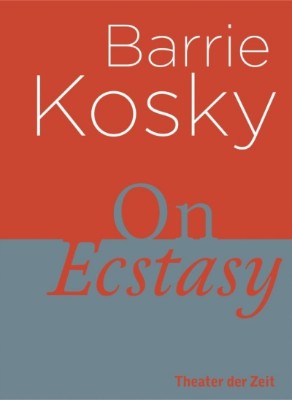
Am besten liest man zuerst das Gespräch mit dem Titel More Ecstasy , das der (sehr einfühlsame) Übersetzer von Barrie Koskys Büchlein On Ecstasy geführt hat und das am Schluss steht. Man erfährt, dass es in einer Zeit der „Heimatlosigkeit“, Wien war bereits verlassen, Berlin noch nicht neues Zuhause, im Jahr 2007, entstand und dass es durchaus, so erfragt es
Ulrich Lenz, auch danach noch Zustände der Ekstase für den australischen Regisseur gegeben hat. Der Begriff selbst wird auf der ersten Seite des Buchs erklärt, für Kosky scheint Ekstase aus Sinneseindrücken, die sich ins fast Unerträgliche steigern und dann in eine neue Qualität münden, zu entstehen, und das können Tasten wie Hören, Schmecken wie Sehen und ebenso Riechen sein, so dass der Duft der Hühnersuppe der polnischen Großmutter (ihr und der zweiten, der ungarischen, ist das Buch gewidmet), ebenso zur Ekstase führt wie das Jahrzehnte später stattgefunden habende japanische Festessen, dem Kind und jungen Mann Barrie Kosky außerdem die Musik Mahlers, die nassen Jeans auf einem strammen Hinterteil, der Geruch in einer Umkleidekabine oder die erste Regie, die einer jüdischen Legende um den Dybbuk, Zustände der Ekstase erlauben. Auch die Stimme von Renata Tebaldi, die er in Australien als Butterfly erlebte, verhilft zur Ekstase, das Betasten der Tierfelle im Pelzgeschäft des Vaters beweist, dass auch der fünfte der Sinne ekstasefähig ist, wenigstens bei einem so sensiblen Kind, wie es Kosky gewesen sein muss. Der weiß davon so knapp wie anschaulich, so ehrlich wie den Leser zielsicher in seine Welt hineinziehend, zu erzählen, und am Schluss ist der erstaunt, wie viel er auf so relativ wenigen Seiten erfahren hat.
Erst im Nachwort erfährt man, dass Bayreuth kein Stimulans für Ekstase war, dass Kosky sich als Intendant zur Objektivität, zur Analyse verpflichtet sieht, als Regisseur jedoch dem Diktat der in die Ekstase führenden Sinne gehorchen darf, wenn er in der bei ihm blinden Elsa unterstellt, durch das Hören , Isolde durch das Schmecken, Senta durch das Sehen in den Zustand der Ekstase zu geraten. Da kann man sich dem Eindruck nicht entziehen, dass auch das Wieder- und Nacherleben bestimmter Situationen bei der Regiearbeit erneut in einen Ausnahmezustand geraten lässt, so wenn sich Kosky an Regiearbeiten wie Medea und den Mord an ihren Kindern, den von sterbenden Meerjungfrauen und einem überlaufenden Abort umgebenen Bariton in Ligetis Oper erinnert.
Interessant zu erfahren ist auch, dass der Regisseur sich eines kleinen Dämons, der ihm Antisemitisches ins Ohr flüsterte, dadurch entledigte, dass er in Bayreuth inszenierte, sich selbst davon befreien konnte, einen Zusammenhang zwischen Wagners Musik und seinen antisemitischen Schriften herzustellen.
Nicht jeder Leser wird einige Schlussfolgerungen nachvollziehen können, die Kosky aus seinen Interpretationen zieht, so wenn Senta den Holländer ermordet. Sympathisch aber wird es jeder finden, dass Misserfolge zugegeben werden, so der Ring in Hannover, und dass Kosky einen neuen Anlauf nehmen wird mit der Neuinszenierung der Trilogie in London 2023. Das Buch jedenfalls hat wegen seiner Unmittelbarkeit ebenfalls die Qualität, in Ekstase zu versetzen, weiterhin interessiert zu verfolgen, was wie Rameau oder die Weimarer Operette und einiges andere, Ekstaseerzeugungsqualitäten hatte und hoffentlich haben wird.
101 Seiten, Verlag Theater der Zeit 2021
ISBN 978 3 95749 342 2
Ingrid Wanja 18.7.2021
WIEN 1900
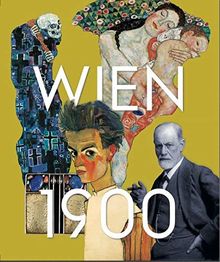
Verlag Leopold Museum, 560 Seiten, 2019
Es gibt in Wien keine bessere Übersichts-Präsentation des Themas „Wien 1900“ als jene, die permanent im Leopold Museum zu sehen ist. Man schreitet durch die Räume wie durch Welten, erlebt Kunst, Kultur, Alltag, sieht Gemälde und Fotos, Möbel und Mode, Dinge des täglichen Lebens und singuläre Kostbarkeiten. Man kann den Eindruck live genießen, einmal, mehrfach. Und man kann ihn auch nach Hause nehmen.
Der voluminöse Katalog zeigt am Titel das Gesicht des jungen Egon Schiele, eine Fotografie von Sigmund Freud, zwei Elemente aus Klimts „Tod und Leben“, die Figur des Todes und eine Frau, von dem charakteristischen floralen Muster umgossen – Fakten und Gefühle.
Herausgegeben von Hans-Peter Wipplinger, dem Direktor des Hauses, folgen auf eine Anzahl von Artikeln über die Gesellschaft der Zeit, ihren philosophischen Unterbau, ihre Stimmungslage (nervös!), über Literatur und Tanz, Theater und Musik. Einzige Einschränkung: Das Lesen wird einem schwer gemacht. Weiß auf Gold und Gold auf Weiß, Zartgold auf Schwarz, sieht zwar unendlich elegant aus, ist aber auch mit Lesebrille schwierig zu entziffern, und die Texte der Artikel sind kleiner, als sie sein sollten.
Dafür entfaltet sich in der Folge die volle Wonne des Schauens. Hat man bei den Einführungsartikeln zusätzliches Bildmaterial zur jeweiligen Thematik erhalten, so bietet der Katalog nun Schritt für Schritt das, was man beim Gang durch die Ausstellung sieht. Bekanntlich hat man „Wien 1900“ ja eingebettet, nicht nur in Fotos, die die Monarchie zwischen Kaiserpracht und Arbeiterelend zeigen und von extremer Aussagekraft sind, sondern auch in die Vorgeschichte und gewissermaßen die Nachwehen des Zeitalters, das auch als Fin de Siècle ein Begriff ist.
Die Vorgeschichte war der Historismus, die Welt von Hans Makart, gegen welche die „Modernen“ so erfolgreich angerannt sind – statt Opulenz, Plüsch und Pathos nun Klarheit, ornamentale Strukturen, abstrahierender Gestaltungswille. Die Herren, die sich da auf einem so fröhlich wirkendes Gruppenfoto zusammen kauerten, unter ihnen Gustav Klimt, Kolo Moser, Emil Orlik, Max Kurzweil, Carl Moll, hatten handwerklich alles von der vorigen Generation gelernt und waren willens, ihren eigenen „Secessions“-Stil zu finden – was ihnen bekanntlich gelungen ist.
Wie die Ausstellung, so setzt der Katalog die Schwerpunkte – zwischen Plakatkunst und neuer Theater-Ästhetik (das Kabarett „Fledermaus“), der neue, „freie“ Tanz der Schwestern Wiesenthal, der Einfluß der Japaner, der Franzosen, der Deutschen. Ausdruck vor Schönheit, wie man sie früher verstand, wenngleich erotisches Flair immer noch gelegentlich durchblitzte. Die Modewelt der Emilie Flöge und anderer Wiener Modeschöpfer wird befragt („Reformkleider“ und Befreiung vom Korsett), „andere“ Häuser und Möbel, Gebrauchsgegenstände und Stoffmuster, exzentrisch, einfallsreich, verschlungen ornamental. Kaffeehaus, Dichter und Schönberg. Kultur, so breit aufgestellt, wie man denken kann.
Schwerpunkte werden auf große Persönlichkeiten gelegt: Gustav Klimt (mit dem Versuch, einen Raum seines Josefstädter Ateliers nachzubauen), viel Kolo Moser, Otto Wagner und Wien als Architektur-Metropole, Josef Hoffmann und die Wiener Werkstätte, Adolf Loos und Richard Gerstl, Schließlich Egon Schiele als persönlicher Höhepunkt auch des ausstellenden Hauses, des Leopold Museums, das die weltgrößte Sammlung seiner Werke besitzt. Und da ist Oskar Kokoschka, der schon wieder in neue Welten hinüber reicht, und der Erste Weltkrieg, der einen Schlussstrich auch unter diese Welt um 1900 zieht. Expressionismus und neue Sachlichkeit lassen grüßen. Ein großer Überblick ist gegeben.
Renate Wagner, 7.2.2021
Zum ersten Jahrestag des Todes
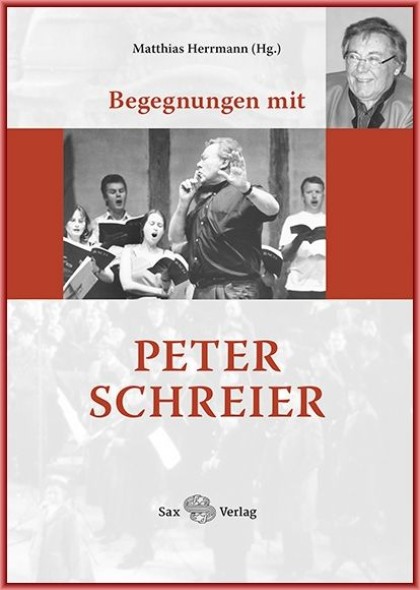
Erscheint ein würdigendes Buch über eine allseits bekannte Persönlichkeit bereits ein Jahr nach deren Hinscheiden, dann kann man sicher sein, dass fast durchweg Lobendes, zumindest Anerkennendes zu vernehmen sein wird. So seien denn gleich zu Beginn und an dieser Stelle zügig die beiden schüchternen Ansätze für Kritik in dem Buch über Peter Schreier, das von Matthias Herrmann, ebenfalls Kruzianer, herausgegeben wurde, vermerkt. Einmal ist vom kritischen Erstaunen von Orchestermitgliedern darüber die Rede, dass der viel beschäftigte Säger auch noch das Dirigieren übernehme, zum anderen vom Schweigen zu den Ereignissen im Herbst 1989, als sich andere Kulturschaffende wie zum Beispiel Kurt Masur für die Demonstranten, die schließlich das Ende der DDR erzwangen, einsetzten, während der ebenfalls über große moralische Autorität verfügende Peter Schreier sich nicht äußerte. Im Buch wird aber auch die „Entschuldigung“ mitgeliefert, die besagt, dass der Tenor sich gerade in einer Phase der Erholung befunden habe.
Das Buch gliedert sich in einen besonders umfangreichen Teil, der Zeugnisse von Zeit- und Weggenossen, vor allem natürlich von Musikern über das Wirken des Sängers, Dirigenten und Cembalisten enthält, es folgt ein schmalerer Abschnitt mit Reden anlässlich der Verleihung von Musikpreisen an Peter Schreier, „Aspekte des Wirkens“, durchweg aus dem Jahre 2020 stammend, würdigen des Sängers und Dirigenten Arbeit in Österreich und Japan, außerdem besonders den Bach-Interpreten, schließlich sind die Reden, die auf der Trauerfeier im Januar 2020 in der Dresdner Kreuzkirche gehalten wurden, abgedruckt, während ein umfangreicher Bildteil und ein Anhang, bestehend aus Personenregister und Präsentation des Herausgebers, den Schluss bilden.
Anekdotisches wird durchaus nicht ausgespart, so im Geleitwort der Scherz Herbert Blomstedts über den gänzlich unpassenden Familiennamen, in der Einführung wird die enge Beziehung Schreiers zu Dresden, von der Geburt bis zur Beerdigungsstätte reichend, hervorgehoben. „Weil ich nun mal eine alte sächsische Provinznudel bin“, will sich der Tenor selbst charakterisiert haben. Die wichtigsten Daten zum Lebenslauf legen davon Zeugnis ab, die in Bezug auf Furtwängler oft erhobene Anklage, er habe den Nazis zu Renommee verholfen, klingt vorsichtig im Beitrag von Hansjörg Albrecht an, wenn er über die Aushängeschilder der DDR Schreier, Adam und Güttler berichtet. Vom Bewunderer zum Kollegen wurde Olaf Bär, der „Demut und Respekt“ gegenüber Bachs Werk mit ihm teilte, bereits 1948 hörte ihn der Hornist Peter Damm als Altus und ist dankbar dafür. Lang ist die Liste der Vorzüge, die der Liedbegleiter Helmut Deutsch mit erstklassiger Diktion, sicherer Intonation, technischer Souveränität aufzuzählen weiß, so dass gelegentliche Spannungslosigkeit daneben kaum ins Gewicht fällt, durch seltene Proben aufgehoben werden kann. Gewagt sind die Vermutungen Peter Gülkes, der in Schreiers Palestrina einen Protest gegen die DDR nicht ausschließen mag, auch wenn der Sänger „auf abgründige Weise“ in der DDR zuhause war. Ludwig Güttler erinnert sich gern an die Heiterkeit während der Arbeit, Hartmut Haenchen an die „musikalische Sensibilität“ beim Kollegen. Eckart Haupt, der zeitweise Untermieter bei den Schreiers war, erwähnt eine gewisse Unbarmherzigkeit des Dirigenten gegenüber Sängern, Robert Holl behauptet: „Er klingt in mir.“
Als „außergewöhnlichen Musiker“ erlebte ihn Marek Janowski bei den Aufnahmen zum Rheingold. Siegfried Matthus schätzte besonders den David in der Karajan-Aufnahme, Christian Thielemann den Schumann-Interpreten. Der Bariton Egbert Junghanns erlebte Schreier zwischen den Polen „Hier gibt‘s alles umsonst“ und „Was wird bleiben?“ Edda Moser sah in Schreier „dieses Begnadete“, Heinz Zednick schätzte die gemeinsamen Abende beim Heurigen.
Die Laudatio zur Verleihung der Hugo-Wolf-Medaille hielt Brigitte Fassbaender und bekannte, Schreiers Die schöne Müllerin habe sie zu Tränen gerührt, weitere Reden stammen von Reimar Bluth anlässlich der Verleihung des Preises der Europäischen Kirchenmusik und von Hans John zur Überreichung des Sächsischen Mozartpreises. Günter Jena berichtet vom Neumeier-Projekt Matthäuspassion.
Viele Ausschnitte aus Kritiken finden sich in Markus Vorzellners Aufsatz, der besonders interessant wird durch die Schilderung einer Begegnung von Schreier mit Wunderlich. Fabian Enders vermittelt wohl am eindringlichsten in seinem Beitrag über den Bach-Interpreten die besonderen Vorzüge des Tenors Peter Schreier (S. 196). Alle Beiträge und ihre Verfasser durften zum Nachruhm des Sängers beitragen, der letztgenannte aber dürfte den Gepriesenen besonders freuen.
256 Seiten, 2020 Sax-Verlag
ISBN 978 3 86729 263 4
Ingrid Wanja 6.2.2021
Zu Unrecht vergessen
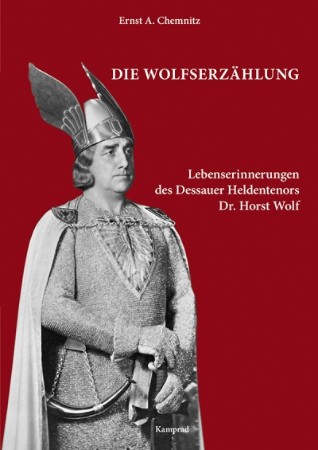
Dem Mimen flicht di Nachwelt zwar keine Kränze, dem Sänger jedoch verhilft You Tube zu ewigem Ruhm, und so ist es fast unglaublich, dass ein Heldentenor, der zwar 25 Jahre lang an einem „Provinztheater“ wie dem Dessauer alle großen Wagnerpartien und die italienischen dazu sang, der aber auch Gastspiele an den großen Bühnen in Berlin, Leipzig, Dresden und Wien gab und berühmte Partnerinnen wie Erna Schlüter oder Frida Leider hatte, mit keiner einzigen Aufnahme vertreten ist. Dabei ist in dem Roman seines Lebens, den er selber schrieb und der jetzt von Ernst A. Chemnitz als Die Wolfserzählung, Lebenserinnerungen des Dessauer Heldentenors Dr.Horst Wolf herausgegeben worden ist, oftmals von Tonaufnahmen die Rede, die angefertigt wurden und die vielleicht noch vorhanden sind. Es geht um Horst Wolf, im Buch penetrant als Dr. Wolf tituliert, denn er hatte als Ingenieur promoviert, der als Max 1938 in Anwesenheit Adolf Hitlers das neue Dessauer Haus einweihte, 1949 als das im Krieg zerstört und wiederaufgebaute Theater wieder eröffnete mit dem Tiefland-Pedro sein 25. Bühnenjubiläum feierte, der in sieben Tagen fünf große Wagnerpartien sang. Im Vorwort wird auch nicht verschwiegen, wie es 1940 zur NSDAP-Mitgliedschaft des Tenors kam, die diesem „unangenehm“ war, und damit wird zugleich das zweite große Thema neben der Lebens- und Karrieregeschichte Horst Wolfs offenbar: der tragisch-lächerlich anmutende Versuch, abseits von politischen Verstrickungen eine künstlerische Existenz zu verwirklichen. Wahrscheinlich hoffte der Sänger auf eine Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte in der DDR, und so ist zu verstehen, dass der Mauerbau lediglich Erwähnung findet, weil dadurch eine Reparatur seines Aufnahmegeräts unmöglich wurde, die Beendigung des Prager Frühlings bedeutet für den Verfasser lediglich, dass er seinen Urlaub im nun gesperrten Grenzgebiet nicht antreten kann, der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 schließlich ist lediglich ein Streik mit lästigen Auswirkungen.
Was nun das Dritte Reich und seine „Bewältigung“ durch den Verfasser angeht, liegt im Text ein Stolperstein von historischen Ausmaßen, wenn er beschreibt, dass sein Bruder beim Rückflug nach Danzig am 28. 8. 1939, also drei Tage vor Kriegsbeginn, von polnischem Militär beschossen worden sei, dass er diesen Sachverhalt (?) geradezu trotzig mit einem „denn mein Bruder saß in dem Flugzeug“ bestätigt. Ironie des Schicksals ist es, dass nach 1945 ausgerechnet eine Hakenkreuzfahne, die beim Bombenangriff aus ihrer Kiste auf den Dachfirst des halb zerstörten Hauses geflogen war, die Entnazifizierung, die offensichtlich in Dessau recht lasch betrieben wurde, erst einmal verhinderte.
Zwar kann das Buch zunehmend das Interesse am Schicksal des Menschen und Sängers Horst Wolf wecken, im Vordergrund dürfte jedoch das an dem Problem der Unvereinbarkeit von makelloser Reinheit und Karriere in zwei Diktaturen sein.
Das Buch gliedert sich in Lebensalter-Kapitel, angefangen mit Das Kind, endend mit Der Greis, welches verständlicherweise die knappsten Abschnitte sind. Durchweg überzeugt das Buch durch die Vielfalt an privaten wie Künstler-Fotos, durch die vielen Anmerkungen durch den Herausgeber und den reichhaltigen Anhang.
In der Einleitung zeigt sich der Verfasser nicht nur durch den betulich-beschaulichen Stil als Kind seiner Zeit, sondern auch durch die Auffassung, dass ein dauernder Kampf als notwendig für die menschliche Reife angesehen wird. Das Kind (1894 bis 1904) schildert mit vielen literarischen Beispielen geschmückt die Schulzeit in Zwickau, wo er das Robert-Schumann-Gymnasium besucht. Wie in der Feuerzangenbowle geben sich die Lehrer, deren Portraits Der Jüngling entwirft, dazu ist vom Altisten im Kirchenchor und von Gesangsstunden die Rede, vom Gymnasiasten, der bereits Wagnerpartien einstudiert, aber noch interessanter sind Einblicke in die Zwänge, die damals herrschten, wenn ein Sohn aus einem Geschäftshaus nicht Offizier werden konnte, Anstandsbesuche Pflicht waren, vor dem Gesangsstudium die Promotion stehen musste. Von 1914 bis 1924 reicht das Kapitel Der junge Mann, der mit 20 als Kriegsfreiwilliger bereits 60 Mann kommandiert, der als bejahrter Verfasser noch vom „Heldentod“ spricht, der mit einer für immer lahmen linken Hand aus dem Krieg zurückkehrt und von Anfang an Kritiken sammelt, die in großer Zahl im Buch abgedruckt worden sind.
Der Mann wird als Sänger in Stralsund, Dessau, Rostock und wieder Dessau hart gefordert, singt alles und alles durcheinander von Chateauneuf bis Tannhäuser, von Wildschütz bis Götterdämmerungs-Siegfried und auch drei Premieren in einer Woche, sonntags auch schon mal zwei Vorstellungen, führt dazu noch Regie, was damals als Stellprobe bezeichnet wird, und lernt die Tücke von Vorverträgen kennen. 1927 wird er Freimaurer und versucht später, dies als Grund vorzuschieben, nicht in die Partei eintreten zu können. Die Nazipresse ist ihm feindlich gesonnen, weil sie ihn für einen Juden hält, aber besonders interessant ist für den Leser zu lesen, worauf damals in den Opernkritiken Wert gelegt wurde. So ist oft nicht der fast Dauerstreit mit Intendanten das Wichtigste für den Leser, sondern Spielplangestaltung, Kriterien der Sängerbeurteilung, Stil der Kritiken (für einen langen Zeitabschnitt fast ausschließlich aus dem Anhalter Anzeiger und wie Hofberichtserstattung klingend), die ihm zur Quelle für die Beurteilung der damaligen Zeit werden, für die Horst Wolf Zeuge ist.
Für den Mann in den besten Jahren dreht sich weiterhin alles um seine Karriere, geht es mehr um Durchhaltevermögen und Erfolg, um dauernd absagende lyrische Tenöre, über seine Ansichten über die vielen Rollen, die er singt, liest man kaum etwas, der Krieg bedeutet zunächst nur volle Bahnen und geschlossene Restaurants nach der Vorstellung. Die Machtergreifung ist weniger wichtig als die Striche oder Nichtstriche in den Partien, die zu singen sind. Wäre das Sekundärliteratur, müsste man das Buch tadeln, als Quelle für die Darstellung eines „normalen Lebens“ auch im Krieg und in einer Diktatur ist es hochinteressant. Gastspiele in besetzten Gebieten werden nicht als heikel angesehen, auch nicht Wehrmachtstourneen, und nach zwei Angriffen auf das Opernhaus, wird gemeinsam wacker aufgeräumt.
Der gereifte Mann durchlebt die Jahre 1944 bis 1954, der 20. Juli 44 ist das Datum des 3. Luftangriffs auf Dessau, nicht des Attentats auf Hitler, die Amis sind bemerkenswert, weil sie nach Leicas forschen, die Sowjets, über die kein böses Wort verloren wird, bringen die Junkers-Leute in die Sowjetunion. Die 40 Vorhänge nach Undine, die er inszeniert hat, sind wichtiger als alle politischen Entscheidungen, die das Leben der Menschen beeinflussen aber „ich bin immer Idealist gewesen“ und ich wollte „Freude und Erbauung schenken“ sind die Motti des Sängers, und wie gesagt, wahrscheinlich rechnete er mit einer Veröffentlichung in der DDR. Leise Kritik gibt es am Verbot des Auftretens von Kaiser Franz Joseph im Weißen Röss’l und des Zarenlieds in Lortzings Oper. 1953 singt Horst Wolf seinen 100. Tannhäuser und seinen 100. Lohengrin und nach schwerer Krankheit wieder Tristan, Stolzing bei der Einweihung des Bitterfelder Kulturpalasts und die Titelpartie in Erkels Bánk Bán. 1956 bei den damals renommierten Wagner-Festspielen in Dessau hat er Tristan, Tannhäuser, Lohengrin, Loge, Siegmund und Götterdämmerungs-Siegfried auf dem Programm, gibt sich bei Ärgernissen mit Dirigenten gelassen, ist es aber nicht. Mit 70 Jahren singt er noch sieben Tannhäuser, Der Greis (1964-80) veranstaltet Liederabende, auch von Selbstkomponiertem, mit 75 Jahren imponiert er mit einer tadellosen Winterreise, zum Jubiläum 25 Jahre wiederaufgebautes Dessauer Theater notiert er mit Genugtuung, dass der Intendant an seinen Tisch gesetzt wurde- oder war es umgekehrt? Mit 80 Jahren nimmt er seine noch immer intakte Stimme auf einem Tonband auf. Wo mag es sein? Mit 86 Jahren stirbt er 1980 nach einem Brand in seinem Haus, in dem seine zweite Frau umgekommen war. Der Leser ist berührt von diesem Leben in schwierigen Zeiten und in einem ständigen Kampf um Anerkennung einer immensen künstlerischen Leistung.
Der Anhang besteht aus Rollenverzeichnis, Rollendebütverzeichnis, Gastspielorten, Operninszenierungen.
416 Seiten, Kamprad 2020
ISBN 978 3 95755 657 8
Ingrid Wanja 27.1.2002
Teilweise abgekupfert

É strano- da liest man mit wachsendem Vergnügen ein nach langer Irrfahrt von Bologna nach Berlin gelangtes Buch, erfreut sich an aussagekräftigen Fotos, sucht bei You Tube nach Bestätigung dafür, dass Carlo Bergonzi, wie der Autor Vittorio Testa bekundet, tatsächlich der unangefochtene, absolute Tenore di Verdi war und wird doch zunehmend verstörter, weil sich ein Dé-jà- vu- Erlebnis anzubahnen scheint. Das alles hat man doch schon einmal und dazu noch in denselben Wortlaut nicht gelesen, sondern gehört, und zwar in dem Film von Mauro Biondini, in dem der große Tenor kurz vor seinem Tod genau das erzählt, was der Verfasser des Buches zu berichten weiß, dazu in einer Art und Weise als wäre er selbst der Gesprächspartner Bergonzis gewesen. Das Buch kann aber erst nach seinem Tod entstanden sein, denn es berichtet auch vom Ableben des Sängers und enthält viele Zeugnisse der Dankbarkeit von Kollegen und Schülern des Verstorbenen, es wurde 2019, also fünf Jahre nach dem Tod Bergonzis gedruckt, und es ist anzunehmen, dass sich der Verfasser über weite Strecken hinweg des Films von Biondini bedient hat, dort aber, wo er darüber hinausgeht, oft ungenau oder unangenehm pauschalisierend wird. Das Falschschreiben ausländischer Namen gehört eigentlich zum allerdings nicht guten Ton italienischer Autoren, so dass ein „Bismark“ nicht verwundert, auch nicht ein „Lutero“, aber das pauschale Urteil über die Protestanten, die angeblich zu einer „inflessibile intolleranza“ erzogen werden, stammt zum Glück nicht von Bergonzi, sondern vom Autor des Buches über ihn. Da muss erst ein katholischer Österreicher kommen, sich von Schuberts Ave Maria erweichen lassen und Gutes tun.
Das Buch hat also viele Schwächen, wozu wohl auch die aufdringliche Familiarität gehört, mit der Testa den Sänger behandelt, der zunächst als „il nostro Carletto“, später als „il nostro eroe“ durch den Band marschiert, während dem Personal des Buches, soweit aus der Poebene stammend, ein extrem verfremdender Dialekt zugeordnet wird. . Aber man erfährt natürlich auch viel Interessantes über den Sänger, über die früh mit dem 5. Schuljahr endende Kindheit, die Arbeit in der Molkerei und als Kohlenschlepper, den Militärdienst, die Kriegsgefangenschaft in Neubrandenburg, den frühen Wunsch danach, ein Tenor zu werden. Wer die Gegend zwischen Piacenza und Parma kennt, der weiß, dass die Winter neblig trüb, die Sommer drückend heiß sind, der Verfasser verklärt die Landschaft und auch den Charakter ihrer Bewohner, falls es einen speziell solchen gibt, nimmt einen durchgehenden Jubelton an, der dem Portraitierten wahrscheinlich unangenehm gewesen wäre.
Immerhin erfährt man eine Menge Interessantes, das Fehlurteil Ettore Campogalianis, des berühmten Stimmbildners, der einen Bariton in Bergonzi sieht, das Debüt als Figaro in dörflichen Pappkulissen, das heimliche Umstudieren auf Tenor, die einzelnen Karriereschritte und Einblicke in das unmittelbare Nachkriegsleben, so mit dem Motto des Mailänder Bürgermeisters: „Prima la Scala, poi il pane“, was in krassem Gegensatz zu einem Brecht-Zitat steht. Dem Leser begegnen die Großen der lirica italiana wie Votto, Serafin, Gavazzeni, die Vorbilder Gigli, Pertile, Schipa, und der Leser bewundert den Mut des Noch-Bariton Bergonzi, der dem Tenorkollegen vormacht, wie man ein Hohes C stützt, nachdem er in aller Heimlichkeit Tag für Tag einen Viertelton auf dem Weg zum Tenor gewonnen hat, um dann weit entfernt vom heimischen Vidalenzo nahe Busseto in Bari als Tenor mit Andrea Chenier zu debütieren und triumphieren. Mit seinem berühmt gewordenen Morendo am Schluss von Celeste Aida weiß er einen Agenten zur Betreuung seine Tenorlaufbahn zu gewinnen, und gemeinsam mit der Mitschülerin Renata Tebaldi darf er bereits den 50. Jahrestag von Verdis Tod bei der RAI als Tenor mitfeiern.
Erstaunlich ist das Verhältnis zu den Tenorkollegen, wenn Mario del Monaco ihm zwei seiner Vorstellungen an der MET abtritt, Franco Corelli mit seiner Hilfe etwas von seinem Lampenfieber verliert, Pavarotti und Martinucci seinen Rat einholen. Liebenswert erscheint der Tenor dem Leser auch durch die Riten vor jedem Auftritt, die Anhänglichkeit an den Heiligen Antonius von Padua, die Großzügigkeit, was Trinkgelder aller Arten angeht, den Seitenhieb auf Andrea Bocelli und man denkt an die eigenen positiven Erfahrungen zurück, den Tenor, der vor seinem Theater in Busseto auf- und abspazierte, sofort zu einem spontanen Interview bereit war und mit 72 Jahren nicht ohne Stolz meinte:“Komm morgen wieder, da singe ich den Rodolfo“, weil der aus Bergonzis Accademia hervorgegangene junge Tenor sich überlastet fühlte.
Die Dirigenten liebten diesen Sänger, Bruno Walter bewunderte sein „Hostias“, Karajan ebenfalls, brach aber, wie bei ihm üblich, als der Tenor sich nicht reif genug für den vorgeschlagenen Pagliaccio fühlte, den Dirigenten mit einem „maleducato“ bedachte, die künstlerische Beziehung ab. Immerhin schickte er Jahre später dem Tenor ein „il più bravo tenore del mondo“ ins Hotel.
Vieles hört sich wie aus einer längst vergangenen Zeit stammend an, so die Beschreibung des einst als besonders kritisch angesehenen Publikums von Parma, das längst die schlimmsten stimmlichen Schwächen schluckt, bei Bergonzi fehlurteilte und sein morendo als Radames monierte und in zwei einander wütend bekämpfende Lager zerfiel, während die beiden Tenöre Bergonzi und Corelli selbst beste Freunde waren. Kaum zu glauben ist die vom Autor erzählte Geschichte von der Krokodilledertasche, die Bergonzis Gattin Adele von der Theaterleitung angeboten wurde, wenn sie den Tenor dazu bewegen könnte, doch weiterhin in Parma zu singen. Als Füllmaterial werden dann noch die Auseinandersetzungen anderer Sänger wie Renato Bruson mit dem Publikum von Parma herangezogen.
Das Buch ist nicht sehr sorgfältig betreut worden, denn dann befände sich nicht zweimal der gleiche Textabschnitt in ihm, begrüßenswert ist hingegen, dass auch viele andere „Autoren“ zu Wort kommen, so im Vorwort von Alberto Mattioli, im Nachwort von Enrico Stinchelli und vor allem in den vielen Lobpreisungen seiner Kollegen oder Schüler, so Raina Kabaivanska, Leo Nucci (beide auch im Film), Michele Pertusi, Alberto Gazale, Fabio Armiliato und auch Carlo Fontana.
Den Anhang bilden ein Alfabeto Bergonziano, das Repertorio discografico, DVD, Repertorio da Baritono e da Tenore.
130 Seiten, Diabasis 2019
Ingrid Wanja 17.1.2021
Bereits vergessen?
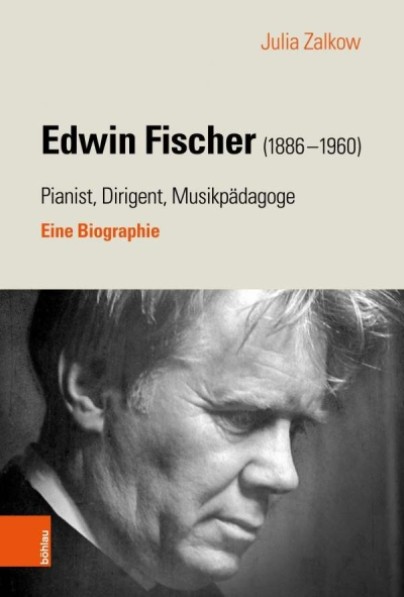
Einen hochinteressanten Zwitter zwischen höchsten wissenschaftlichen Kriterien verpflichteter Dissertation und Emotionen wie Intellekt beschäftigender Künstlerbiografie hat Julia Zalkow mit der des Schweizer Pianisten Edwin Fischer (1886-1960) Pianist, Dirigent, Musikpädagoge- Eine Biographie, in gewichtigen mehr als 450 Seiten vorgelegt. Allein drei Jahre des Reisens auf der Suche nach Quellenmaterial hat die Verfasserin verbracht, um einen fast Vergessenen wieder in das Bewusstsein zumindest der musikalisch Interessierten zurückzurufen. Sie selbst wurde durch das Hören von besonders Bachinterpretationen des Pianisten auf ihn aufmerksam, stellte sich vier Ziele mit ihrem Werk, nämlich zu erkunden, wodurch der Pianist erfolgreich wurde, was seine Künstlerpersönlichkeit ausmachte, warum er relativ schnell vergessen wurde und warum man sich an ihn erinnern sollte.
Ihre Herangehensweise an diese komplexe Aufgabe ist eine sehr vielseitige, bezieht Fotos und Beschreibungen nicht nur des Pianisten, sondern auch des Privatmenschen ein, setzt sich mit falschen Behauptungen auseinander, mit Hobbies, mit dem oft behaupteten übergroßen Einfluss der Mutter auf den früh zur Halbwaise Gewordenen, auf die Wandlungen seines Spiels, und auch eine Beschäftigung mit dem ihm verliehenen Attribut „Tastenlöwe“ wird in Angriff genommen.
Der eigentlichen Biographie geht eine Betrachtung dessen voraus, was die Autorin als „Biographienwerkstatt“ bezeichnet, der Quellenlage, den unterschiedlichen Herangehensweisen wie zum Beispiel der quantitativen Umfrageforschung oder der soziologischen Biographieforschung. Bewusst grenzt sich Zalkow ab von den gängigen Biographien, die vieles erfinden, sie bekennt sich hingegen zur Lücke, vielfach entstanden durch Kriegseinwirkungen, denn Fischer lebte bis zum Sommer 1943 vorwiegend in Berlin. Dem nicht das wissenschaftliche Werk, sondern die auch unterhaltsame Biographie Suchenden kommt es sicherlich entgegen, dass das Buch chronologisch gegliedert ist. Hin und wieder schiebt sich die Autorin in den Erzählfluss hinein, um über besondere Probleme bei der Forschung, Ihre Vorgehensweise, Erfolge oder Misserfolge zu berichten.
Ehe der Leser in die Biographie einsteigen darf, wird er noch über Forschungsstand und Quellen, über bisher bereits Erforschtes und über das Material und die noch vorhandenen Zeitzeugen informiert.
Edwin Fischers Leben spielte sich in Basel, Berlin, Luzern ab, und selbst wer sich für den Pianisten nicht sonderlich interessiert (doch die Anteilnahme wächst mit der Lektüre), der erfährt sehr viel über die Zeit, in die er hineingeboren wurde, über die Schweiz im ausgehenden 19. Jahrhundert, ihre Ideale von Wohlanständigkeit und Arbeit, die Bedeutung der Hausmusik, auch über das bereits beim Schüler Fischer vorhandene Lampenfieber, das auch den reifen und alternden Pianisten noch plagen sollte.
Aus eine Fülle von Mosaiksteinchen setzt die Verfasserin ein so farbiges wie fundiertes Bild des mit siebzehn Jahren nach Berlin ziehenden Studenten, der bereits nach dem ersten Studienjahr auch als Lehrer tätig wird, zusammen, charakterisiert die vielen unterschiedlichen Musikschulen, die es damals in Berlin gab, und vermittelt dem Leser auch Eindrücke von den Menschen, die wichtig für den jungen Fischer waren, so von dem Sänger Ludwig Wüllner, dem er Klavierbegleiter war.
Interessant ist, was über Wiener und Berliner Salons, oft von jüdischen Familien, und das musikalische Leben dort berichtet wird, eine große Rolle spielt die Selbstreflexion des Künstlers, der sich als Vertreter des traditionellen Interpretationsmodus sieht und gesehen wird, der sich um die Wiederherstellung von Urtexten bemüht, aber gegen Dogmatismus ist.
In der Weimarer Republik zeigt sich Fischer durchaus aufgeschlossen für moderne Musik, durchlebt zwei Episoden als Dirigent in Lübeck und München und kreiert den „Klavierdirigenten“. Interessant sind der Italien-Reisebericht einer Freundin, die Informationen über das von Fischer gegründete Musikinstitut für Ausländer in Potsdam und seine Schwierigkeiten als Professor an der UdK in Berlin.
Noch nicht zum Problem wurde Fischer seine Parteinahme für Deutschland im Ersten Weltkrieg, wohl aber sein Verbleiben in Deutschland nach der Machtergreifung der Nazis. Da gibt es auch ein Foto, das ihn vor einer riesigen Hakenkreuzfahne zeigt und ein Dankschreiben an Adolf Hitler. Ein Entnazifizierungsverfahren musste der Schweizer nicht durchmachen, wohl aber die Feindseligkeit maßgeblicher Kreise in den USA (ähnlich wie gegenüber Furtwängler) oder die Zurückweisung von Dirigenten, die nicht mit ihm musizieren wollten, erleiden. Immerhin sprach für ihn, dass er kein Amt ausübte, sich an keiner Hetze beteiligte, keine Konzerte in besetzten Ländern gab und befreundeten Juden half. Einen aufschlussreichen Blick auf das von Ideologie durchtränkte Kulturleben gewährt ein Artikel über das angeblich „artfremde“ Musizieren eines jüdischen Pianisten im Vergleich mit dem des „artgerechten“ Wirkens von Edwin Fischer. Dieser fühlte sich dem Land, in dem er Karriere gemacht hatte, dessen Komponisten er verehrte, verpflichtet, was auch erklärt, dass er für Winterhilfswerk und KdF musizierte. Das alles wird von der Verfasserin so einfühlsam wie unter Verzicht auf ein demonstratives Überlegenheitsgefühl der Nachgeborenen ausgeführt.
Walter Legge gewann neben vielen anderen auch Fischer für Aufnahmen, der aber die „Patzer für die Ewigkeit“ fürchtete, lieber ein Trio mit Kulenkampff und Mainardi, später mit Schneiderhan bildete und bereits 1946 nach Salzburg zurückkehrte. Es folgen noch Berichte von Meisterkursen in Luzern, und unter dem Stichwort „calando“ wird von der nachlassenden Gesundheit und damit verbundenen schwindenden Qualität der künstlerischen Arbeit berichtet. 1957 findet das letzte Konzert in Zürich statt, 1958 noch ein Sommerkurs, 1960 stirbt Edwin Fischer.
Als „wissenschaftliche Künstlerbiographie“ klassifiziert Julia Zalkow ihr Buch, das sich zum Ziel gesetzt hat, auf einen „vergessenen Künstler“ aufmerksam zu machen. Immerhin war er der Rezensentin bekannt, auch sein Image als Tastentiger und „romantischer“ Bachinterpret. Doch sich alles, was auf You Tube verfügbar ist anzuhören, dazu gab das Buch den Anstoß und dazu, über die Möglichkeit, als Künstler „unpolitisch“ zu bleiben, nachzugrübeln.
Der umfangreiche Anhang besteht aus Abkürzungen, Tabellen, Abbildungen, Quellen und Literatur, Personen
460 Seiten, 2020 Böhlau Verlag
ISBN 978 3 205 21123 5
Ingrid Wanja 10.1.2021
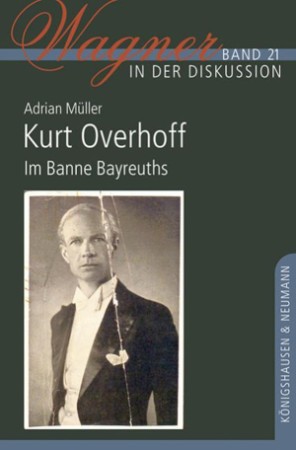
ADRIAN MÜLLER: KURT OVERHOFF. IM BANNE BAYREUTHS
„Wielands grosse Liebe zu Richard zündete über seinen Verstand als er Richards Partituren begreifen lernte. Und das wiederum durch Overhoff. Er allein öffnete erst das Tor, durch das Wieland zum Grossvater hindurchtreten konnte“ - und, möchte man ergänzen, zu dem bedeutendsten Wagnerregisseur zwischen 1951 und 1966 werden konnte, der eine ganze Epoche der szenischen Wagnerinterpretation bestimmte und befeuerte, darüber hinaus zu einem der bedeutendsten Opernregisseure der zweiten deutschen Nachkriegszeit avancierte.
Dass es Overhoff war, der dem mit 23 Jahren nicht mehr ganz jungen Wagnersproß das Rüstzeug für dessen spätere Arbeit in die Hand gab, hat Gertrud Wagner, die Frau und Witwe Wieland Wagners, genau beobachtet. Kurt Overhoffs Ruf aber litt nicht zum Wenigsten unter dem Fluch, den der Atridensohn über ihn verhängte, als er sich – vor den frühen Biographen und der Mitwelt – als Originalgenie ausgab. Erst 1970 hat Geoffrey Skelton in seiner Wieland-Biographie auf Overhoffs Bedeutung hingewiesen – der Lehrer sollte da noch 16 Jahre leben. Dass Overhoff nach dem Maler Ferdinand Staeger die wichtigste Persönlichkeit in Wielands Lehrjahren war, konnte man dann immerhin in Berndt W. Wesslings Wieland-Buch relativ genau nachlesen, bevor Ingrid Kapsamer 2010 in ihrer Monographie über Leben und Werk des Wagnerenkels die nötigsten Auskünfte über den Mann gab, der damals wohl fast nur nach seinen Wagnerbüchern beurteilt wurde – wenn überhaupt. Dass er 1978 eine äußerst gründliche Arbeit über „Elektra“ veröffentlichte, war vermutlich nur den Freunden von Richard Strauss aufgefallen. Wenn Adrian Müller nun in einem ersten Buch über Kurt Overhoff die Bedeutung gerade dieser Schrift für das Denken des Musikers und Musikphilosophen herausarbeitet, erfährt man nicht zum letzten Mal, dass Overhoff mehr, als es für ein Leben ausreichen würde, übel mitgespielt wurde: nicht allein von Wieland und Winifred Wagner.
Dass Overhoff nicht nur deshalb interessant ist, weil er das seltsame Glück hatte, Wieland Wagner in das Werk seines Großvaters einzuführen, duldet nach der Lektüre des Buchs keinen Zweifel. Als Komponist, Dirigent, Autor und Lehrer hat er genügend Spuren hinterlassen, um als markante Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts anerkannt zu werden – und dies vielleicht nicht obwohl, sondern weil er mit seinen (wenigen) Werken und Publikationen stets quer stand zum Zeitgeist, zumindest zu jenem, der als „modern“ oder (hier beginnen schon die Schwierigkeiten, Overhoff gerecht zu werden) „modernistisch“ galt. Müller konnte, versehen mit dem reichhaltigsten Quellenmaterial aus öffentlichen und aus Privatarchiven, eine Arbeit über Overhoff vorlegen, die ihm sine ira et studio in Kritik und Anerkennung gerecht zu werden sucht. Wieland-Anhänger werden glücklich sein, die Arbeit des Älteren derart genau beschrieben zu finden, Opern- und Musikfreunde erhalten einen Blick in die deutsche und österreichische Musikgeschichte zwischen dem Beginn des 20. Jahrhunderts und der frühen Nachkriegszeit; nach den frühen 50er Jahren spielte Overhoff aufgrund seiner Weigerung, sich irgendeiner Moderne anzudienen, kaum noch eine Rolle auf den Podien. Müller betrachtet seine Figur als „musikhistorischen Gegenstand“ und betreibt gleichzeitig Quellenkritik, denn Overhoffs eigenen Aussagen – den Texten eines immer wieder in Depressionen abstürzenden, labilen und geschädigten, wenn auch hochbegabten Menschen – ist nicht immer zu trauen. Auch deshalb berührt die breit dokumentierte Geschichte seiner Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken so stark: weil Overhoff auch im Banne seiner Psyche stand, die wiederum immer wieder von außen irritiert wurde. Dass das Haus Wagner, zumindest bis 1966, Overhoff bei anderen Intendanten und Opernhäuser durch Hinweise auf seine angebliche Arbeitsunfähigkeit und seine Aufenthalte in diversen Kliniken mobbte, ist eine Vermutung, die nicht allein von Overhoff geäußert werden konnte.
„Im Banne Bayreuths“? In der Tat: Wurde Overhoff schon kurz nach der Gründung „Neu-Bayreuths“ von Wieland aus Bayreuth regelrecht herausgeschmissen, so zeigen sich die deutlichsten Spuren der Overhoffschen Pädagogik in Wieland Wagners Anmerkungen zu seinen Regiearbeiten und Figureninterpretationen, weniger in seinen Bildern, die Overhoff gemäß seiner Theorie von der Dominanz des szenisch Konkreten bei gleichzeitiger klanglicher Transzendenz viel zu abstrakt fand. Erst 2017 hat Arne Stollberg in einem Vortrag beim Bayreuther Wieland-Symposion auf die Spuren der Overhoffschen Tristan-Analyse in Wielands Arbeiten aufmerksam gemacht. Nun aber versteht man, mit Müllers Buch im Gepäck, erst eigentlich, auf welchen Grundlagen Overhoffs Überzeugung des gesamtkunstwerklichen Charakters der Wagner-Partituren (und der Opern von Richard Strauss) basierte. Philosophisch wurde er von Karl Jaspers und dessen „Chiffern“ geprägt, in seiner genauen Art und Weise, Musik zu deuten, vom Komponisten Hermann Hans Wetzler. In seiner „Elektra“-Arbeit hat er das ganzheitliche Prinzip seiner Partituranalysen beispielhaft veröffentlicht; Müller definiert die drei unabdingbar zusammenhängenden Konstanten Musik, Psyche und Bühne, um von hier aus Overhoffs (und Wielands) Ansatz darzustellen, wobei der musikalische Teil mit den Kategorien des Symbols, des Intervalls, des Motivs, des Einzeltons, der Harmonik und der Synästhesie beschrieben wird: mit schönen Einzelbeispielen aus dem „Lohengrin“, dem „Tristan“ dem „Ring“ und „Parsifal“, den Mittelstücken zwischen Mozart und Strauss. Dessen Enkel wurde übrigens auch kurz nach dem Krieg von Overhoff unterrichtet, wobei das Ehepaar Overhoff im späteren Sterbezimmer des „Elektra“-Komponisten wohnen durfte.
Der Biograph zeichnet den Berufsweg des Wiener Musikers nach, dessen Qualifikationen im Korrepetieren, Partiturspielen, Transponieren, ökonomischen Dirigieren und präzisen Nachvollzug des Notentexts schon früh erkannt wurde; dass Furtwängler den jungen Mann förderte, verwundert nicht. Nach Stationen an den Theatern in Köln, Ulm, Münster, der Wiener Staatsoper (für Overhoff ein „Sanatorium der Hoffnungslosen“) und Koblenz kam Overhoff 1931 nach Heidelberg, wo er 1935 zum GMD ernannt wurde und nach acht höchst fruchtbaren Jahren als Konzert- und Operndirigent in eine tiefe Krise geriet, die sich privaten (einer fatalen Eheschließung) und politischen Problemen (Overhoffs Großmutter war Jüdin, er selbst bis fast zuletzt ein überzeugter Hitler-Anhänger) verdankte. Ab 1940 war er dann - nach Aufenthalten in drei Kliniken, die zum Teil von Direktoren geleitet wurden, die der Leser nur als Verbrecher an der menschlichen Seele bezeichnen kann – in Wahnfried angestellt. Dass Overhoff nicht mehr an seine Heidelberger Stelle zurückkehren konnte und auch später keine Position bekam, die ihm angemessen gewesen wäre, lag – die Quellen lassen kaum einen anderen Schluss zu – neben Wieland auch an Winifred Wagner, die 1940 bei den Heidelberger Obrigkeiten dafür sorgte, dass Overhoff dort nicht mehr das Pult betreten konnte. Nach dem 2. Weltkrieg leitete er für kurze Zeit das Bayreuther Symphonieo-Orchester, das im Festspielhaus gastierte und schon 1948 aufgelöst wurde, 1949 übernahm er die Leitung des Philharmonischen Chors Bayreuth, aber auch damit war es bereits 1952 zuende. Diesmal geriet Overhoff, weil der Humanist sich für eine vom späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann initiierte Petition gegen die Wiederbewaffnung einsetzte und den Deutschen Kulturbund unterstützte, in den Fokus der Kommunistenjäger. Als Overhoff nach einigen Jahren zum Professor am Salzburger Mozarteum ernannt werden sollte, setzten sich zwar seine Studenten für ihn ein, die ihn aufgrund seiner überragenden musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten so liebten wie seine Studenten in Texas (wo er 1966 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Lubbock verliehen bekam!), aber die Instanzen verzögerten so lange den bürokratischen Prozess, dass er 1968 lediglich zum außerordentlichen Professor ernannt werden konnte. Gleichzeitig schlugen alle Versuche fehl, seine einzige vollendete Oper „Mira“, die wenigstens ein paar Mal, doch immer nur unter seiner eigenen Leitung, in kleineren Häusern aufgeführt werden konnte, in einer überarbeiteten Fassung auf eine Nachkriegsbühne zu bringen. Overhoff hat selbst gewusst, dass ihn seine kompromisslose Haltung für die Tradition und gegen die moderne Kunst, der er nicht zu folgen bereit war, als Opfer der Wahrhaftigkeit zur Erfolglosigkeit verdammte: „womit“, schrieb er 1985 in seiner Autobiographie, „Wieland Wagners rücksichtslose Sabotage meiner Karriere nicht entschuldigt ist“. Overhoff hätte, auch dies wird aus dem sorgfältig recherchierten Buch klar, zumindest als Kapellmeister oder GMD auch noch nach 1945 in der ersten Reihe stehen müssen; wenn auch allein als Sachwalter eines älteren oder musiksprachlich konservativeren Repertoires. Ersichtlich wird auch der Umstand, dass es bei Charakteren wie Overhoff schwierig ist, von einer Schuld in Sachen NS-Verfallenheit zu sprechen. Seine Analysen der Musik, die er während der 12 Jahre auch in Bezug auf Wagners Regenerationsthesen vorgelegt hat, zeigen keinen NS-Ideologen sondern einen Denker am Werk, der die Musik auf der Basis des Humanismus deutete. Da erscheint es eher wie ein gespenstischer Treppenwitz der Geschichte, dass zu den Grundlagen Neu-Bayreuths nicht nur der nachträgliche Einfluss Overhoffs, sondern zumindest eine Bildidee Adolf Hitlers gehörte: die Nornenszene in Wielands „Ring“ von 1951 nahm einen Vorschlag des einstigen Wielandförderers auf, der sich nicht im Geringsten für Overhoff interessierte, auch wenn das Propagandaministerium fast alles dafür tat, den Dirigenten 1940 in Heidelberg zu halten, damit Wieland dort eine Bühne ganz für sich allein haben konnte. Bekanntlich konnte er erst in Altenburg einen seiner ersten beiden „Ringe“ und einige andere Inszenierungen unter Overhoffs Schirmherrschaft realisieren.
Für Opernfreunde dürfte der neue Band vor allem deshalb interessant sein, weil die Entstehungs- und Aufführungs- wie Nichtaufführungsgeschichte der Overhoff-Opern so genau wie möglich erzählt wird. Die Mysterienoper „Mira“, die 1925 in Essen uraufgeführt wurde, wird zudem in einem 75 Seiten umfassenden, vergleichenden Notenanhang porträtiert. Von den „Freiern“ nach Eichendorff liegt nur die Ouvertüre vor, nachdem der Komponist die Sinnlosigkeit einer Operndramatisierung eingesehen hatte, von „Shiwas Tod“ nur ein kurzes Motiv. Liest man, dass sich Overhoff mit dem Textlieferanten der „Mira“ über Änderungen zerstritten hat, woran eher der Librettist als der Musiker schuld war, wundert man sich angesichts von Overhoffs Karriere kaum noch: eher über das Ansinnen der deutschen Okkupanten, Overhoff 1938 zum Direktor der Wiener Staatsoper zu machen; zu mehr als einem Dirigat des „Fliegenden Holländers“ sollte es am Pult des Hauses am Ring nie kommen. Weitere Szenen sind ebenso faszinierend: die köstlichen Beschreibungen, die Overhoff 1920 über Richard Strauss und später über Siegfried Wagner notierte, die Tatsache, dass der Eingangschor aus Hugo Wolfs Opernfragment „Manuel Venegas“ in Koblenz uraufgeführt wurde, aber auch die Spielplanpolitik, die die Ulmer und Heidelberger Theater Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre auszeichnete. Wer wissen will, welche Werke Overhoff dirigiert hat, findet im Anhang auf nicht weniger als 58 Seiten ein komplettes Verzeichnis aller Stücke und ermittelten Aufführungsdaten. Ein Werkverzeichnis mit genauen Standorten von Partituren und Aufnahmen, ein Schriftenverzeichnis einschließlich der vielen unveröffentlichten Texte und eine Übersicht über existierende Tonaufnahmen in Rundfunkarchiven bilden schließlich die Basis für jede weitere quellenmässige Beschäftigung mit dem Werk Kurt Overhoffs.
Zum kompositorischen Werk gehört übrigens auch eine Gruppe von Stücken, die zu Overhoffs verquerer Biographie glänzend passen: vier Klavierkonzerte, die er als Ghostwriter für den Pianisten Kurt Leimer schrieb. Wer wissen will, wie man zusätzlich zu drittklassigen Klavierübungen eines guten Pianisten einen Orchestersatz schreibt, der sich um das substanzlose Geklimper herumrankt, und wie derartige Machwerke bei den zeitgenössischen Musikfreunden als „Meisterwerke“ passieren können, erhält bei Müller genügend Auskunft. Interessanterweise wurden die Konzerte damals von Karajan, Stokowski und Cluytens aufgeführt bzw. eingespielt – diese ausgesprochen dumme Musik kann man sich heute noch auf Youtube anhören; der Wikipedia-Eintrag über Kurz Leimer erwähnt allerdings mit keinem Wort, dass diese seltsamen Stücke, abgesehen vom geistlosen Herumhämmern auf dem Klavier, von Overhoff geschrieben wurden, der sich mangels anderer Arbeitsmöglichkeiten dafür vom Auftraggeber ausbeuten ließ, um „Kurt Leimers Klavierkonzerte“ zu schaffen.
Dass seine eigenen wenigen Werke nach 1945 kaum eine Chance hatten, wahrgenommen zu werden, war für Overhoff wohl, neben den beruflichen Erfolgen und Misserfolgen, die größte Katastrophe seines Künstlerlebens, wie er 1986, kurz vor seinem Tod, einem Schüler, dem Dirigenten Gustav Kuhn, in einem Brief andeutete. Wer dem Komponisten Kurt Overhoff gerecht werden will, hat dazu die Chance, wenn er eine der seltenen Exemplare der einzigen Schallplatte erwirbt, die Overhoff jemals aufnahm: mit einem eigenen Werk, dem 1962 komponierten „Bayreuther Bilderbogen“. Hört man diese kurzweilige fünfsätzige Suite mit lyrischen Bildern aus dem alten Bayreuth, könnte man sie für ein Werk der späten, tonal verpflichteten Romantik von maximal anno 1930 halten – die Musik ist gut gemacht, die Nichtbeachtung durch die Avantgarde verständlich. Sie klingt ein wenig wie Strauss; darauf angesprochen, meinte der Komponist der Oper „Mira“, dass es doch gut sei, als vermeintlicher „Epigone“ eines Richard Strauss, also auf höchstem Niveau zu komponieren. Wie differenziert Overhoff, der sich in Sachen Harmonielehre exzellent auskannte, aber auf die Bi- und Polytonalität der „Elektra“ sah, die gemeinhin als Wendepunkt in Straussens Moderne gilt: auch das kann man in Müllers Buch nun nachlesen.
Begraben wurde Overhoff übrigens in Bayreuth: kurz nach einer geplanten Übersiedlung in die Stadt am Roten Main, die der Tod verhinderte. Ausgerechnet hier, wo er zutiefst gedemütigt worden war, wollte er nach seiner Salzburger Emeritierung leben. Im Banne Bayreuths liegt er noch heute, also in der Nähe von Liszt und Jean Paul, aber auch seines Quälgeists Wieland Wagner. Die Frage bleibt: Warum wollte er ihm noch im Tode nah sein? Honni soit, qui mal y pense. Dem unglücklichen Musiker und Lehrer, der endlich einen Biographen gefunden hat, bleibt zumindest dieses Geheimnis.
Adrian Müller: Kurt Overhoff. Im Banne Bayreuths (Wagner in der Diskussion, Bd. 21). Königshausen & Neumann. 511 Seiten. 29 Abbildungen, 18 Notenbeispiele im Text, 75 Notenseiten im Anhang. Würzburg 2020. 48 Euro.
Frank Piontek, 30.12. 2020
Nie sollst du mich befragen…

Zum ersten Mal seit der des Parsifal gab es in Bayreuth wieder eine Uraufführung, und zwar die von Klaus Langs „der verschwundene hochzeiter“, sich nicht nur durch die Kleinschreibung des Titels, sondern auch durch die minimalistische Musik auszeichnend. Parallel fand mit dem zweiten „Bayreuther Diskurs“ auch ein Symposion zum Thema „Verbote in der Kunst-Positionen zur Freiheit der Künste von Wagner bis heute“ statt. Allerdings ist der Untertitel nicht ganz zutreffend, da es in einem der Beiträge auch um die Musik um 1600 ging.
Im Vorwort verweisen die Herausgeber Katharina Wagner, Holger von Berg und Marie Luise Maintz darauf, dass jederzeit die Grundrechte in Gefahr sein können, dass das Thema politische Korrektheit zunehmend an Bedeutung gewinnt und Frageverbote wie im Lohengrin durchaus nicht der Vergangenheit angehören.
An einige der Referate schlossen sich Diskussionen an, so auch an Thea Dorns und Feridun Zaimoglus, die über die me-too-Bewegung, Reaktionen auf den Echo-Preis und andere Herausforderungen für die Gesellschaft berichten, die Meinung vertreten, alle echte Kunst beginne mit Provokation als Form der Verweigerung, die Provokation der Liberalen jedoch für „eine Eselei“ halten. Von Wagner erfährt der Leser in diesem Zusammenhang kaum etwas.
Auch in der Diskussion geht es zunächst nicht um Wagner, sondern um Verdi mit der Erinnerung an die Proteststürme gegen Neuenfels‘ Inszenierung von Aida in Frankfurt, von der behauptet wird, sie habe nur das gezeigt, was im Stück steht.
Eugen Gomringer und Lucian Hölscher nahmen zum Thema, wie politisch korrekt Kunst sein müsse, Stellung, gehen weit zurück mit den Beispielen für heikle Situationen, die Folgen davon mit den Fällen Jenniger, Heitmann und Walser und fragen sich, ob Künstler sich mehr erlauben dürfen als das gemeine Volk. Einzelne Begriffe werden untersucht wie „Zigeuner“, zunehmend verfemt, und „Schwule“, zunehmend akzeptiert. Gomringer ist selbst das Opfer politischer Korrektheit, indem sein unschuldiges, in spanischer Sprache verfasstes Gedicht, das Alleen, Blumen und Frauen in eine Reihe stellt, von vorwiegend Schülerinnen mit Migrationshintergrund beanstandet und von der Mauer ihrer Schule entfernt wurde. Der Beitrag ist erfrischend sowohl durch die Meinung Dorns, wir würden uns durch Überempfindlichkeit selbst „infantilisieren“, als durch die Einsicht, dass in vielen Diskussionen ein hysterischer und selbstgefälliger Ton herrsche. Auch das „Heideröslein“ und Wagners Frauenbild erst recht müssten verboten bzw. angegriffen werden, wenn man so strenge wie ahistorische Maßstäbe anlege.
Kunst und Globalisierung hatten sich Gerhard Baum und Charlotte Seitner zum Thema gewählt, und es handelt von der Spannung zwischen künstlerischer Freiheit und Persönlichkeitsrechten, vom Bildungsauftrag von Rundfunk und Fernsehen und vom Quotenzwang, von der Digitalisierung und ihrem Einfluss auf die Kunst. Weitgespannt ist die Diskussion, in der es um Gendergerechtigkeit, passiven und proaktiven Freiheitsbegriff, um die Förderung der Freien Szene und die „Algorithmisierung unseres Menschenbilds“ geht.
Konkreter und wagnerbezogener verhält man sich im Beitrag von Detlef Brandenburg über das Frageverbot von Lohengrin. Der Verfasser sieht in ihm „eine ästhetische Revolution“, um den Versuch einer „Erneuerung des politischen Gemeinwesens durch Kunst und Liebe“, so wie er den Komponisten im Spannungsfeld zwischen Hegel und Feuerbach, zwischen Bakunin und den Romantikern“ wähnt.
Mit der Nachkriegsgeschichte wird hart ins Gericht gegangen, sie wird als Flucht der Deutschen in die unpolitische Kunst gesehen. Erst Chereau, Friedrich und Neuenfels hätten diese Haltung überwunden. Interessant ist, dass der Autor auch auf Ringinszenierungen wie die von Flimm, Harms und rosalie eingeht.
Bernd Feuchtner begibt sich in seinem Beitrag über „Verbotene Oper“ zunächst sehr kämpferisch auf einen Waffengang mit Pfitzner und dessen Naziverstrickung, wendet sich dann einer Fülle von Fällen verbotener Oper zu, die so kurz sind, dass der Opernfreund nichts Neues erfährt, der Unkundige über zu vieles im Unklaren gelassen wird. Es werden der Fall Furtwängler (um Mathis der Maler), Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk, die Römische Kirche und die Kastraten, Dessaus Lukullus und Eislers Johann Faustus, The Death of Klinghoffer und anderes gestreift, auch übertrieben, wenn behauptet wird, Floyds Susannah an der DOB hätte nur Verrisse provoziert. Es wird nicht ganz klar, ob es dem Verfasser mehr um die Avantgarde oder die Schönheit geht.
Ute Frevert kehrt zu Lohengrin zurück, dem sie das Brechen mit drei Prinzipien zur Last legt: Gleichheit, Transparenz und Gegenseitigkeit in seiner Beziehung zu Elsa.
Hans Rudolf Vagelt befasst sich mit dem Wagnerkult im Nationalsozialismus, den damals herrschenden Frage- und Denkverboten, wobei die Forschungsstätte unter Otto Strobel eine wichtige Rolle spielt. Die „Inkubationszeit des Nationalsozialismus“ sei diejenige gewesen, in der in Deutschland Wagner landauf und landab gespielt wurde, wobei etwas vergessen wird, dass die Massen, die Hitler zujubelten, kaum die typischen Besucher Bayreuths darstellten. In der darauf folgenden Diskussion widmete man sich der Frage nach dem Antiamerikanismus in der Bundesrepublik, stehen sich die Aussagen von Ute Frevert, Antisemitismus finde sich auch in Wagners Musik, nicht nur in seinen Schriften, statt, und Hans Rudolf Vagets Hinweis, auch die Juden seien fasziniert von Wagners Musik, gegenüber. Als Ausweg aus dem Dilemma wird die Hinwendung zur Pariser Wagnertradition gesehen, womit sicherlich nicht der Skandal um den Tannhäuser gemeint ist. Am nachvollziehbarsten ist wohl der Ratschlag, man solle Wagner im Kontext seiner Zeit sehen. Einen Streitpunkt bildet die Frage danach, ob Deutschland seine imperialistischen Überlegenheitsphantasien aus der Bedeutung seiner Musik abgeleitet habe.
Relativ knapp ist der Beitrag über „Verbote“ in der Musik um 1600“, in dem Klaus Lang, Komponist der oben erwähnten Oper, sich über Musik als „hörbar gemachte Zeit“ äußert, anhand eines Trillers von Quantz und eines solchen von Frescobaldi zu seinem Thema Stellung nimmt, über Dissonanz und Konsonanz im Wandel des Geschmacks, aber nicht nur diesen, über die Tatsache, dass mit der Zeit Regeln zum „Natürlichen“ werden,referiert.
Krass wird es mit „Das Verbotene suchen“, wo über die Versuche moderner Komponisten, die Schmerzgrenze zu erkunden, berichtet wird. Das kann über trashige Aufführungen, Genre-Verwirrung, „Dunkelkonzerte“, übermäßige Länge der Werke, das Überschreiten der Schmerzgrenze geschehen. Zu all dem gehört die Uraufführung 2018 nicht, denn „der verschwundene hochzeiter“ wie das Gespräch über ihn respektieren die Grenzen, die den Sinnesorganen der Menschen gesetzt sind.
190 Seiten, Bärenreiter 2019
ISBN 978 3 7618 7207 9
Ingrid Wanja 24.12.2020

AN DIE „THEUERSTE NICHTE“ - DIE BRIEFE COSIMA WAGNERS AN TONI PETERSEN
„Seltsam ist dabei der gänzlich mangelnde Einfluss der bedeutenden Männer über die Frauen, als ob sie gar nicht zueinander gehörten, gehen sie nebeneinander her.“
War Cosima Wagner eine Frau, die ihrem „bedeutenden Mann“ gehörte? Wir finden diesen Satz in einem Brief, den die Frau Richard Wagners am 12. Juni 1874 an Toni Petersen schrieb – enthalten in einem Konvolut von 71 Schreiben, die vor allem zwischen 1873 und 1881 geschrieben wurden, bevor der Kontakt fast vollständig erstarb. Es lag nicht allein an Cosima Wagner – es lag auch an der Adressatin, die sich im Lauf der Jahre und der Zuwendung zu einer anderen neuen Musik (der des Hamburgers Johannes Brahms) von Bayreuth emanzipiert hatte. Man kann das alles genau nachlesen: in der exzellenten Biographie der Hamburger Bürgermeistertochter Toni Petersen, die die Nachfahrin Claudia Graciela Petersen 2018 vorlegte („Die Tochter des 'Dogen'“). Nun also kann man, wiederum herausgegeben von C.G. Petersen, sämtliche Briefe studieren, die damals von Franken in den Norden gingen, während die Briefe Toni Petersens, warum auch immer, nicht mehr in Bayreuth vorhanden sind. Wurden sie bei einem der Autodafés vernichtet, die Cosima zusammen mit ihrer Tochter und Sekretärin Eva nach Richard Wagners Tod veranstaltet hat? War die Beziehung zur 1909 verstorbenen Frau, die sich so intensiv für das „Bayreuther Werk“ und die Finanzierung der ersten Bayreuther Festspiele eingesetzt hatte, irgendwann auch ideell aufgebraucht?
Cosima Wagner hat, wenn nicht alles täuscht, immer noch einen schlechten Ruf. Dass er zugleich wohlverdient und gleichzeitig schwer korrekturbedürftig ist, weil Cosima Wagner gelegentlich liberale Züge zeigte, die die Cosimahasser ihr nicht zutrauen würden, belegen nicht zum Wenigsten die vorliegenden Briefbände; dies ist der zehnte, der den Strauss-, Levi-, Chamberlain-, Humperdinck-, Daniela-, Ludwig II-, Helene von Heldburg-, Hohenlohe-Editionen und dem „Zweiten Leben“ nachfolgt. Petersens Editionsarbeit ist – abgesehen davon, dass wir nicht erfahren, dass die Originale der Korrespondenz im Petersen-Familienarchiv liegen – vorbildlich. Wieder, wie in der Petersen-Biographie, haben wir es mit einem bildlich reich und farblich gut ausgestatteten, also in jedem Sinne schönen Buch zu tun, in dem man die relevanten Informationen über die vielen erwähnten Persönlichkeiten aus Kunst und Politik, Kultur und Philosophie, in den dazugehörigen Fußnoten und die Erläuterungen zu den verhandelten „faits divers“ in den Zwischentexten findet. In der Erzählung aber finden sich erst die Zusammenhänge zwischen den relativ seltenen Lebens- und Lektüre- und Betrachtungsstationen, die das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden Frauen, aber auch zwischen Hamburg und Bayreuth markieren: zwischen Geist und Geschäft, Alltag- und Feiertag, Kunst und Küche, Heimat und Ferne, London und Italien, Festspiel und Familie (wer weiß schon, dass Richard Wagner über sechs Ecken mit Matthias Claudius verwandt war?).
Ging es zunächst vor allem um jene „Nöthe und Sorgen“ (O-Ton Richard Wagner in einem seiner typischen Widmungsverse, diesmal an die Hamburger Förderin), die mit den hanseatischen Patronatsgeschäften und dem Kaufmann Adolph Nicolaus Zacharias zusammenhingen, so öffnete sich schon früh das Gespräch in Richtung Literatur, Religion und Herzensbildung. Wer die breit angelegten Überlegungen zu den theologischen Werken, die Cosima Wagner, die sich, obwohl nur zwei Jahre älter, als „Tante“ verstand, ihrer „Nichte“ zur Lektüre empfahl, für Cosima Wagners Privatsache hält, verkennt, dass ihr Mann gleichzeitig ein letztes „Bühnenweihfestspiel“ plante und schließlich komponierte, in dem es zentral um die Idee einer neuen Mitleids-Religion auf der Basis eines gelichteten, protestantisch und buddhistisch inspirierten und doch freien Christentums geht. Ihre Anmerkungen zu den Schriften Nietzsches, der eine Polemik gegen D.F. Strauss' Christologie schrieb, zu den Werken Overbecks und Eugénie de Guérins ergänzen nicht allein das Tagebuch Cosima Wagners – sie gehören auf eine sehr spezielle Weise zum Bayreuther Kosmos und zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts zwischen Bismarck und den Ultramontanen. Kommen hinzu jene Anmerkungen zur „Socialdemokratie“, die das ergänzen, was abends in Cosima Wagners Lila Salon ins Diarium geschrieben wurde: als durchaus differenzierte Sicht auf eine neuere politisch-soziale Bewegung, die in Cosima Wagners Entsagungsphilosophie nicht wirklich bedeutend sein konnte, und dies auch, weil man und frau zunächst noch Bismarck verehrte.
Die Briefe aber bieten nicht nur eine geistige und, mit ihren gelegentlichen Hinweisen auf die Vor- und Hauptproben der Festspiele und auf diverse Tee-, Zigarren- und Köchinnenbestellungen, materielle Innenschau auf das Bayreuth der Gründerjahre, die die Tagebücher und die anderen Quellen gut ergänzen. Sie präsentieren vor allem, nicht zuletzt dank der Kommentare und Bildquellen, eine wagnerianische Sicht auf das Hamburger Musik- und Theaterleben der 1870er Jahre, in denen das Stadttheater neu eröffnet wurde und der Walkürenritt im Circus Renz performt wurde. Die Leserin erfährt, dass Carl Brandt, der erste Technische Direktor der ersten Festspiele, auch in Hamburg tätig war, während einzelne Bayreuther Künstler an der Alster auf der Bühne oder, wie Anton Seidl, am Pult standen. Sie kann sich ein Foto anschauen, das, freilich in einer baulich stark veränderten Ansicht, jene Passage der Dammtorallee zeigt, bei der Wagner 1844 gewohnt hatte (eine Information, die sich so genau nicht in Kiesels et.al. Wagner-Reisebuch „Wandrer heißt mich die Welt“ findet). Zu den Funden gehört auch eine witzige Anmerkung Prosper Mérimées zum Pariser „Tannhäuser“ und eine freundliche Einschätzung von „Carmen“ - der Novelle und der Oper, die, so die Kritikerin, „überall hübsch“ sei, „wo sie nicht ins Pathetische geht“. Und Parsifal-Aficionados bekommen einige seltenere Fotos geschenkt, die die Uraufführung dokumentieren – vor allem aber eine Cosima Wagner, um die zu bemühen sich aus vielen Gründen lohnt: nicht allein aus richardwagnerischen.
Claudia Graciela Petersen: An die „theuerste Nichte“. Cosima Wagner im Spiegel ihrer Korrespondenz mit der Hamburger Bürgermeistertochter Antonie Petersen. Leipziger Universitätsverlag, 2020. 251 Seiten, 72 Bilder und 31 Seiten Brieffaksimile.
Frank Piontek, 22.12. 2020
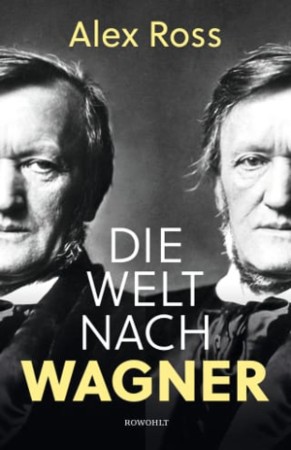
ALEX ROSS: DIE WELT NACH WAGNER
„Diese beharrlichen und zugleich flüchtigen Themen, die in einem Akt anklingen, sich entfernen, um zurückzukehren, und, manchmal weit entfernt, abklingend, fast losgelöst, in anderen Augenblicken, auch wenn sie nur angedeutet bleiben, so eindringlich und nah, so innerlich, so organisch, so körperlich zu spüren sind.“ Man kann das Programm des monumentalen Buchs, das schon schnell in deutscher Übersetzung vorlag, nicht besser charakterisieren als durch ein Zitat, das der Autor Marcel Prousts „La prisonnière“, einem Band aus dem Zyklus der „Recherche du temps perdu“, entnahm. Man könnte es auch kürzer ausdrücken: wie „die emotionale Wirkung einer Kunst mit den Mitteln einer anderen Kunst wiedergegeben“ wird – und auch dieses Zitat, diesmal aus Willa Cathers Anmerkungen zu Gertrude Halls „The Wagnerian Romances“, findet sich in Alex Ross' „Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne“.
Der englische Untertitel lautet etwas anders – und präziser: „Wagnerism. Art and Politics in the Shadow of Music.“ Die These lautet also: „Wagner hat maßgeblich das bürgerliche Jahrhundert geprägt, von der Blütezeit bis zum verhängnisvollen Niedergang“, und dies, man weiß es, weil er nicht allein ein Musiker, sondern auch ein Ideologe und Autor war, dessen Schriften und Musikdramen weit über den Tellerrand der Opernwelt hinaus wirkten. Dass Ross die Wirkung(en) Wagners auf die Kunst und die Politik, die sich bisweilen meist unheilvoll annäherten, aber nicht auf dem Gebiet von Wagners eigentlicher Kunst: der Musik verfolgt, hat Gründe, denn dieser Einfluss ist – selbst dort, wo er ohrenscheinlich anklingt – viel weniger nachweisbar als auf dem Terrain von Bildender Kunst, Literatur, Theater, Philosophie, Film – und eben Politik. Wer indes vermutet, dass sich der politische Wagner allein im Besitz der Rechten befindet, irrt; Ross' Buch, das sich an die sog. Kenner wie die neugierigen Novizen richtet, ist gerade dort stark, wo die linken und anarchischen Wege des linksradikalen Wagnerismus beschritten werden. Kein Wunder also, dass diese „Geschichte missglückter Analogien“, wie der Autor selbst sein Themengebiet beschreibt, das er sodann auf 750 Seiten höchst materialreich betritt, nicht irgendeinen „wahren Wagner“, sondern die verschiedensten Wagner-Abbilder beschreibt: denn er wirkte zu wesentlichen Teilen durch Transformationen (wie in Mallarmés Sprachmusik), nicht allein durch Adaptionen. Verlief die Rezeption zwischen „Lobhudelei und Verachtung“, Anbetung und scharfer Kritik, so erscheint Wagners Werk, um ein Wort Sigmund Freuds (der natürlich auch seinen Auftritt hat) abzuwandeln, als polymorph perverser Katalysator von Interpretationen, die sich oft ausschließen. Das ist nicht neu – aber auf so breiter Basis wurde die These noch nie bewiesen. Nebenbei: Man bekommt Lust, sich das ganze Originalmaterial ins Haus zu holen, um die Romane, Erzählungen und Analysen zu lesen, die Bilder und die Filme sich anzuschauen. Ross kennt sich übrigens nicht nur in der englischsprachigen, auch in der deutschen Literatur gut aus; das bezeugen die gut 100 kleingedruckten Seiten mit den präzise Nachweisen. Er bietet sichtlich mehr als die Spitze eines Eisbergs, ja: er steigt mit uns auf ein gewaltiges Massiv, lässt uns jedoch nicht mit den vielen Persönlichkeiten am Wegesrand allein. „Die Welt nach Wagner“ ist gerade für jene Wagnerianer geeignet, die meinen, dass sie „schon alles“ über Wagners Wirkungen wüssten. Und Ross beglaubigt in seinem Nachwort die Relevanz seiner Einschätzungen, in dem er die Authentizität durch seine autobiographischen Erfahrungen vermittelt, also durch eine Subjektivität, wie sie dem Gegenstand allein gerecht wird.
„Wagner resümirt die Modernität“, wie Nietzsche schon sagte. Nietzsche ist denn auch der Ariadnefaden im Labyrinth des Wagnerismus, weil er die (notorisch umstrittene) Grundlage der modernen Wagnerkritik schuf, die zugleich affirmativ ist, vielleicht sein muss. Schon schnell wird klar, dass Ross – nicht nur ein ausgewiesener Musiktheoretiker, sondern auch ein -praktiker - ein Meister darin ist, musikalische Techniken wie das Leitmotiv und harmonische Sequenzen mit kulturgeschichtlichen Beobachtungen zu verbinden. Das Tristan-Vorspiel ist ein Hauptwerk der „décadence“? Ross belegt es, mit genauen Zitaten nicht nur von Baudelaire. Immer wieder überrascht Ross durch wahre Trouvaillen: Wer weiß schon, dass Fergus Hume kurz nach Wagners Tod ein Sonett verfasste, in dem er von „Aeschylean Music“ sprach? Wer kennt schon das Echo von Wagners „Freischütz“-Artikel in George Sands Novelle „Mouny-Robin“? Und wer ist sich darüber bewusst, dass Wagners Rezeption manchmal auf Wagner zurückwirkte: wie im Fall der von Wagner inspirierten Waldmetaphorik, die über Baudelaire und Champfleury den „Siegfried“-Komponisten selbst inspirierte? Auch so konnte die „subjektive Wiederaneignung“ (Lacoue-Labarthe) aussehen, die Ross bei Gerard de Nerval und dessen „Aurelie“ mit ihren Walküren entdeckte. Wen wundert es, dass, nachdem Ducasse, Champfleury, Zola und Verlaine sich an Wagner abgearbeitet hatten, nicht nur Wagner, sondern auch die Wagnerianer schon früh parodiert wurden?
Zweifellos ist die englische Wagner-Rezeption einem deutschsprachige Publikum weniger vertraut als die französische und die belgische. Sie hat durch Ross ihren Biographen gefunden, der die ganz andere Art und Weise beschreibt, wie Wagner, dieser „Leckerbissen“ (Queen Victoria), vor dem Hintergrund des King-Arthur-Kults von den Briten begriffen wurde. Doch auch hier entfernt sich der feinnervige Ästhetizismus des viktorianischen Zeitalters von den mythischen Ursprüngen. Mythos und Moderne trennten sich spätestens dort, wo Darwins „On the Origin of Species“, Marx' „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ und „Tristan und Isolde“ zu verblüffend analogen Signaturen des Zeitalters wurden: im Sinne einer Aufklärung, die in Wagner die Moderne am Werk sah, während George Eliot mit „Middlemarch“ und dem „Daniel Deronda“ pur wagnerische Romane schuf. Zwischen dem französischen und englischen Ästhetizismus war der Unterschied allerdings so groß wie der zwischen dem russischen Symbolismus und der deutschen Tümelei, so dass ein deutsch-österreichischer Wagnerverein alles mögliche, nur nicht musikalisch oder im strengen Sinne wagnerisch orientiert sein konnte. Aber was heißt schon: „in strengem Sinn“, wenn Wagner in den subkutansten Schichten zu wirken vermochte.
Ebenso unbekannt dürfte dem, der an den seltsamen Wegen der Wagnerwirkung interessiert ist, die US-amerikanische Aufnahme des Dichterkomponisten in das ästhetisch-ideologische Pantheon sein. Pinckney Marcius-Simons war, um ein prägnantes Beispiel zu nennen, das weniger abseitig ist als es zunächst scheint, ein in Bayreuth lebender Maler, für den sich im 20. Jahrhundert Jackson Pollock interessierte. Nicht allein bei George Bernard Shaw, dessen „Perfecte Wagnerite“ zu den bekanntesten Zeugnissen einer entwickelten britischen Wagner-Idolatrie gehört, begegnet, etwa bei Sidney Lancier (so wie bei Fontane), die Deutung Wagners durch die Brille der modernen Gegenwart. Es mag beruhigend sein, zu erfahren, dass der rechte Wagner kein deutsches Privileg war und ist. Er war auch der „mentale Soundtrack“ für rassistische Cowboy-Phantasien, wie sie in D.W. Griffitths reaktionärem Filmmeisterwerk „The Birth of a Nation“ von Neuem erscheinen werden. Man sieht: Besonders spannend wird das Buch dort, wo der „gemeine“ Wagnerianer Türen geöffnet bekommt, von denen er bislang nicht einmal ahnte, dass sie existieren. Stichwort „Tür“: in der Architektur planten John Wellborn Root und Louis Sullivan so etwas wie wagnerianische Bauten: „Sullivan wollte das amerikanische Bankenwesen in ein angenehmes Licht tauchen, als ob in den Tresoren unberührtes Rheingold schimmerte.“
Dies nur als Beleg dafür, dass Ross immer wieder zu brillanten Pointen findet (wie die, dass Brünnhilde, musikentstehungsgeschichtlich betrachtet, Wotan zeugte und nicht umgekehrt), die ihren Teil dazu beitragen, das uferlos scheinende Material so wie die starken Interferenzen zwischen einzelnen Kapiteln thesenhaft zu strukturieren. Wenn die Hauptfigur in Willa Cathers „A Wagner Matinée“ mit der in sich gekehrten Mutter in Fernand Khnopffs symbolistischem Gemälde „En écoutant du Schumann“ verglichen wird, begreifen wir, dass der Beziehungszauber nicht nur in, sondern auch außerhalb des Wagnerschen Gesamtkunstwerks zu wirken vermochte – eines Gesamtkunstwerks, das mal mehr, mal weniger adaptiert und abgelehnt wurde. So ist „Die Welt nach Wagner“ Schatzkammer und Pandämonium in einem, bis unter die Decke angefüllt mit Kunst und Kitsch (was bisweilen kaum unterscheidbar ist), doch gleichzeitig stringent konzipiert. Den Begriff des „Pandämonium“ verwendet Ross übrigens selbst, und zwar genau dort, wo er die Unterscheidung zwischen Wagners Werk und seinen Folgen mit einem Wort Roland Barthes' belegt, demzufolge „die Einheit eines Textes nicht im Ursprung, sondern in seinem Zielpunkt liegt“. Die sei, so der kritische Monograph, eine Schlussfolgerung, die sich ganz natürlich aus dem „interpretatorisches Pandämonium des Wagnerismus“ ergebe. Auch aus diesem Grund ist es uns ja heute unmöglich, die Werke so zu sehen und zu inszenieren, „wie Wagner es sich vorstellte“.
Und also lernen wir endlich den irischen Wagnersopranroman „Evelyn Innes“ (1898) von George Moore kennen. Wir besteigen mit Marcel Batilliats „Chair mystique“ einen frühen Gipfel des perversen Wagnerismus, dem mit Lina Wertmüllers Film „Pasqualino Settebelezze“ ein später (von 1975), unter dem Schatten der NS-Diktatur stehender folgt. Immer wieder bemerken wir mit Ross, dass man – wie Stefan George und James Joyce – durch Wagner hindurch muss, um ihn zu überwinden und ein neues Kunstwerk zu schaffen, das gleichzeitig, siehe „Ulysses“, siehe „Finnegans Wake“, mit Wagnerzitaten und -techniken vollgestopft ist und sich trotzdem vom „Meister“ emanzipiert hat. Mit Joyces Zeitgenossen Gabriele d'Annunzio beschwört Ross die politischen Gefahren des (dekadenten) Wagnerismus, doch mit dem „doppelten Bewusstsein“, das bei einigen schwarzen und jüdischen Wagnerbewunderern herrschte, gleichzeitig die ambivalenten Wirkungen auf ausgewählte Außenseiter. Gerade der Blick auf Wagner und die Schwarzen – ein Thema, das dem durchschnittlichen europäischen Wagnerianer fremd sein dürfte – und den Afro-Wagnerism könnte uns davor bewahren, im Wagnerismus ein lokal und zugleich zeitlich begrenztes Phänomen zu sehen. Dass Wagner auf ungeahnte Resonanzflächen, selbst und gerade bei vielen Juden, stieß und immer noch stößt, muss nicht verwundern – doch dass mit Luranah Aldridge im Jahre 1893, während die „Judenfeindschaft gewöhnlich nicht zu Wagners charakteristischen Eigenschaften gezählt“ wurde, eine erste schwarze Walküre auf der Bayreuther Festspielbühne stand, ist einer jener wunderbaren Funde, um derentwillen es sich schon lohnt, das Buch zu lesen. Wird um 1900 der Wagnerismus und gleichzeitig der Anti-Wagnerismus, der – das ist nur scheinbar widersprüchlich – von ihm abhängt, immer komplexer, so wundert es den Leser nicht, mehr wagnerisch inspirierte Tode in Venedig als bei Thomas Mann zu entdecken. Wir treffen folgerichtigerweise auf den Wagner der Schwulen und der Psychoanalytiker, der Lesben und der Linken. Wir bekommen eine ausführliche Analyse von Willa Cathers „The song of the lark“ („Unter den bedeutenderen Autoren war Thomas Mann der einzige, der mehr über Wagner wusste, aber er kannte sich nicht so gut mit Sängern aus“), von Virginia Woolfs „The waves“ (in dem der Stream of consciousness, also Tristans unendliche Melodie ein Stilprinzip ist) und von Joyces „Ulysses“ (eine großartige Umdeutung und fröhliche Burleske“) geschenkt, erblicken den Fliegenden Holländer in Stephen Dedalus und die möglicherweise kaum zufällige Analogie von Leopold Bloom und dem Blühen (blüht = Bloom) des Karfreitagszaubers. Ist Joyces Werk ein Opus der Apophrades (wie der Literaturhistoriker Harold Bloom die Haltung der Akzeptanz eines vorher unterdrückten Vorläufers bei gleichzeitigem Überlegenheitsgefühl nennt), so ist T.S. Eliots Wagner anti-wagnerianisch, ohne in „The Waste Land“ den „Parsifal“ und den „Tristan“ vergessen zu machen. Wagner konnte Vor- und Feindbild sein, manchmal sogar gleichzeitig. Verwirrenderweise waren die Futuristen gegen und für Wagner – selbst Marinetti, der auf Wagner spuckte, war Wagner in seinem revolutionären Furor verpflichtet: „Sogar wenn sie Wagner'sche Kultur bekämpften, folgten sie einem Wagner'schen Regiebuch“ – nämlich dem des Agitators von 1849. Es mag sein, dass der Erste Weltkrieg das Ende des Wagnerismus als intellektuelles Phänomen markierte – als künstlerisch wirksames Phänomen hatte er noch lange nicht ausgespielt: wie Appia, Fortuny, Kandinsky, die Bildenden Künste und die Bühnen nach 1900 belegen, unter denen die Reformbühnen und die Kroll-Oper der späten Weimarer Republik herausragen. Es mag sein, dass Assoziationen eines „unsichtbaren Theaters“, das Ross in den esoterischen Zeichnungen einer Hilma af Klint entdeckt, weit hergeholt scheinen – dass sie im Umkreis von Wagnerianern entstanden, sollte zu denken geben: so wie der Einsatz der Leitmotivtechnik, ohne den Prousts monumentaler Siebenteiler anders aussehen würde und Antoni Gaudí seine extravaganten Bauprojekte, bis hin zur geplanten, parsifalesken Kuppel der Sagrada Família und dem Palau Güell, nicht entworfen hätte.
Nein, Wagner-Interpretationen waren nicht „richtig“ oder „falsch“, sie waren und sind angesichts seines maßlosen und uneinheitlichen Deutungsangebots nur zu verständlich. Im Wagner der Linken und der Rechten, bei Lassalle, Bebel, Zetkin und Jaurès, bei Hitler, dem späten Dalí, den White Supremacists (Alain de Benoist) und Heidegger konnte der Dämon Wagner sehr bequem seine Masken wechseln. Denn „es wäre falsch zu behaupten, dass Shaw und seine linken Gefährten den 'wahren' Wagner gefunden hätten. Aber es wäre ebenso falsch, zu behaupten, dass sie ihn missverstanden hätten.“ So gab es nur scheinbar erstaunliche Allianzen zwischen Kunst und Politik: die Bolschewiken und die Nazis konnten Wagner gleichermaßen interpretieren, während deutschnationale und perverse Ästheten den Zauberer von Bayreuth vergötterten. Hier also Wladimir Tatlins berühmter Turm, der ursprünglich der Mast des Holländerschiffs war, der russische Wagner des Futurismus und des Regietheaters, dort der Wagner von Walt Disney, Adorno und Thomas Mann. Dass Hans Castorp und Willa Cathers Claude Wheeler in „One of ours“ verwandt sind, ist nach allem, was man bisher las, nur selbstverständlich – und dass Hitlers Wagner nicht der Wagner der NS-Zeit war: auch dies sollte sich, nach den Untersuchungen zur Musikkultur des Dritten Reichs, inzwischen auch unter Wagnergegnern herumgesprochen haben.
Ross' Werk ist auch deshalb ein Werk der Aufklärung, weil die kulturhistorischen Funde und Analysen nicht umstandslos als herausragende Einzeltaten gedeutet werden und berühmt-berüchtigte Einsätze nicht als „Begleitmusik der Nazis“ (wie Ernst Bloch dies in Zusammenhang mit dem Vorspiel zu den 'Meistersingern' mit guten Gründen abwehrte) interpretiert werden können. Bestes Beispiel: „Wenn man beim Walkürenritt sowohl an Bugs Bunny als auch an Hubschrauber denkt, kann die Musik fast alles bedeuten“. Denn das berühmte Musikstück wurde nicht allein in „Apocalypse now“ – in durchaus differenzierter Weise – , sondern auch in „The Birth of a Nation“ und bei Walt Disney zum Fliegen gebracht. Ross nennt auch die bedeutenden Vorläufer des Gebrauchs der Walkürenmusik in den Interferenzen zwischen Literatur und Film und den verschiedenen kulturellen Kriegskontexten: bei Proust, im Programmheft eines Toscanini-Konzerts und in einer Deutschen Wochenschau – was es schwer macht, die Musik Richard Wagners zu nazifizieren.
Haben die Philosophen Wagner dem Stresstext des Nazismus ausgesetzt? Natürlich. Denn Nietzsche hatte ja, siehe oben, behauptet, dass Wagner „die Modernität resümirt“. Auftritt der Wagner der Philosophen: Adorno, Lévy-Strauss, Badiou kämpft gegen Lacoue-Labarthe (der Wagner nicht mag), Zizek hat indirekten und negativen Kontakt zu Papst Franziskus. Ross rekonstruiert ein Gewebe von Bezügen, in denen die deutschen Nachkriegskünstler, die Syberberg, Kiefer, Schlingensief und Nitsch ihre Auftritte haben, bevor das heikle Thema „Wagner in Israel“ konzis und gerecht skizziert wird. Bleibt der Wagner der Fantasy-Autoren, die dem Schöpfer des „Ring“ so viel zu verdanken haben. Wagner ist nicht allein in Tolkien, er ist auch in Star Wars, in Matrix und bei Philip K. Dick. Es gibt da, in 'VALIS', ein „Wagnertier“, das Amok läuft und sich unheimlich und grauenerregend verändert hat: „Ich erkenne es kaum wieder.“
Keine schlechte Metapher für Wagners Wirkung. Oder, wie Ross so schön schreibt: „Wagner bleibt das Monster im Herzen des modernen Labyrinths, dem man nicht entrinnen kann.“
Alex Ross: Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne. Rowohlt, 2020. 907 Seiten. 120 Abbildungen. 40 Euro.
Frank Piontek, 18.12. 2020
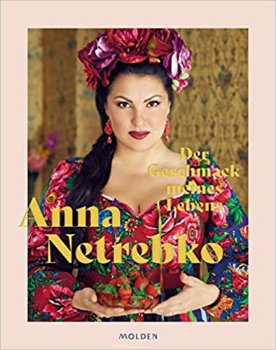





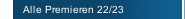




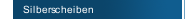
















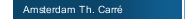













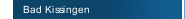




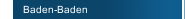





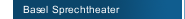




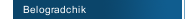

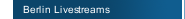





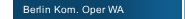



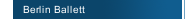





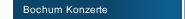



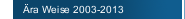





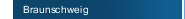

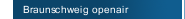




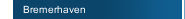




















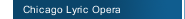


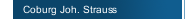





















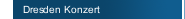



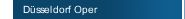



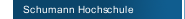









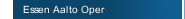




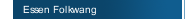










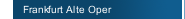
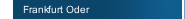





















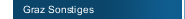








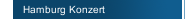
















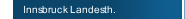

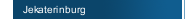

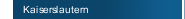











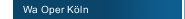


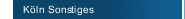
















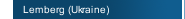





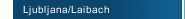





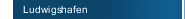























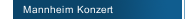













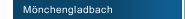





















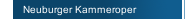
















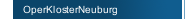


























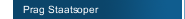
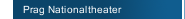

















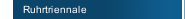

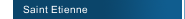







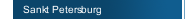



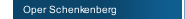
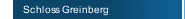














































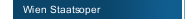

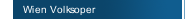

















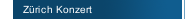
















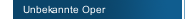




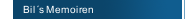


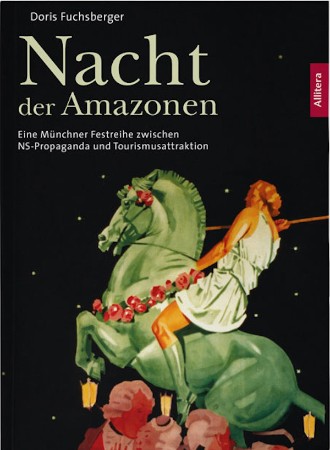
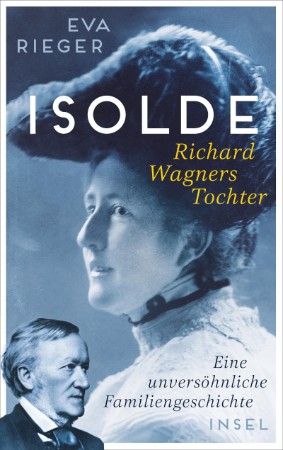
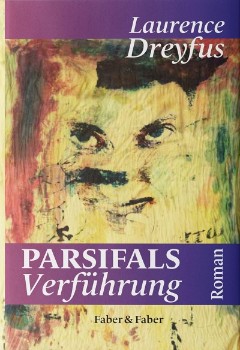 Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.
Wer denkt nicht an Klingsors Zaubergarten, an die schönen Blumenmädchen, an Kundrys sündigen Kuss, wenn er den Titel Parsifals Verführung liest, und wer hat nicht bei einem Verfassernamen wie Laurence Dreyfus das Schicksal des gleichnamigen zu Unrecht beschuldigten französischen Offiziers vor Augen? Wenn dann noch vom Cover ein Gesicht mit verzerrten Zügen wie das eines E.T.A. Hoffmann nach dem Besuch von Lutter & Wegner guckt, ist die Verwirrung vollkommen. Es geht aber weder um die Verführung von Parsifal, noch um Spionage oder nächtliche Gelage, sondern um die Umgarnung des jüdischen Dirigenten Hermann Levi durch Richard Wagner, der ihn für die Uraufführung seines Bühnenweihfestspiels in Bayreuth und zum Übertritt zum christlichen Glauben bewegen wollte. Ersteres gelang ihm, letzteres nicht.


 Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“.
Bereits ihre 23. Ausgabe erleben die Göttinger Händel-Beiträge der Göttinger Händel-Gesellschaft, die auch die alljährlich, falls nicht durch Krieg oder Pandemie verhindert, Händel-Festspiele unterstützt, die in diesem Jahr wieder, beginnend am 12. Mai, stattfinden dürfen. Auch wenn die Stadt Halle das Privileg besitzt, die Geburtsstadt des Komponisten zu sein, ist Göttingen nicht etwa eine Parallelgründung wie die Deutsche Bücherei in Frankfurt oder der Tierpark in Friedrichsfelde zu DDR-Zeiten, sondern die Gesellschaft besteht bereits seit 1920, ist vielleicht auch nach dem verlorenen Weltkrieg als Kontrast zur Wagnerei zu verstehen, als Beginn der „Göttinger Händel-Renaissance“. Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält.
Wer erinnert sich, während Horrornachrichten aus der Ukraine und mal steigende, mal fallende Zahlen über die Ausbreitung von Omikron über den Bildschirm flackern, noch an die vor weniger als zwei Jahren die Nachrichten beherrschenden Bilder aus Minsk von manipulierten Wahlen, dem Zorn der Bürger und ihre Versuche, aus Weißrussland einen demokratischen Staat zu machen? Der junge weißrussische Dirigent Vitali Alekseenok hat unter dem Titel Die weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus ein Buch darüber geschrieben, denn obwohl vor allem in Deutschland tätig, hielt es ihn in den Tagen, in denen seine Landsleute auf die Straße gingen und Leben und Freiheit riskierten, nicht in seinem Gastland, und er versuchte vor allem mit seinen Möglichkeiten, der Musik, in das Geschehen einzugreifen. Im Prolog zu seinem 190-Seiten-Buch schildert er zunächst die Proteste, die in Berlin vor der Belorussischen Botschaft in Treptow und am Mauerpark stattfanden und setzt sich mit anderen Intellektuellen und Künstlern erfolgreich dafür ein, dass die Opposition in seinem Heimatland den Sacharow-Preis erhält. Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.
Liegt es an einer Ahnung vom baldigen Untergang des Vielvölkerstaats Habsburgerreich und seiner Monarchie, dass um das Jahr 1900 herum ein heftiger Kampf um die Einschätzung der kulturellen Vergangenheit und deren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft stattfand? Michael Meyer hat unter dem Titel Moderne als Geschichtsvergewisserung- Musik und Vergangenheit in Wien um 1900 verfasst, dass sich hoch anspruchsvoll und tief wissenschaftlich mit umfangreichem kritischem Apparat des Themas annimmt und dazu längst vergessene, aber auch noch heute beliebte Kunstwerke einer intensiven und ausführlichen Betrachtung unterzieht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass an den Leser einige Ansprüche gestellt werden, und der nicht Fachkundige sollte zuerst die Anmerkungen unberücksichtigt lassen, wenn er den Faden nicht verlieren will.
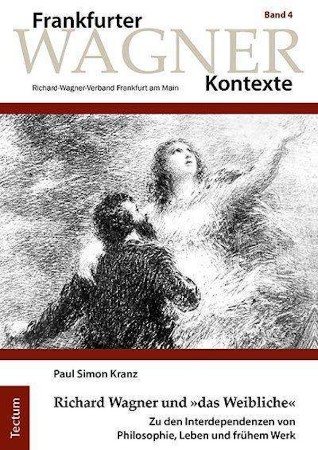
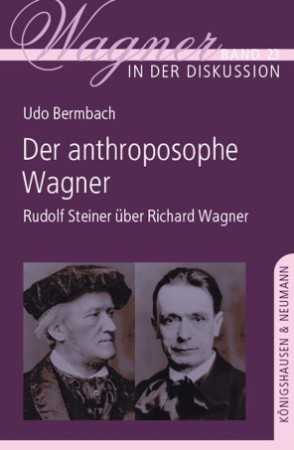
 Vermessen klingt der Untertitel zu Eleonore Bünings Rihm-Biographie, wenn man mit DIE Biographie assoziiert, dass es vor und nach dieser keine andere gab und geben wird. Stark untertrieben allerdings ist der Begriff Biographie, denn Lebensdaten- und –ereignisse machen nur einen Bruchteil des Buches aus, hauptsächlich geht es um die Werke, denen eine so umfassende wie tiefschürfende Analyse zu Teil wird. Im Klappentext wird die Verfasserin als Old-School-Kritikerin bezeichnet, und nach der Lektüre des Buches kann man das nur als Lob begreifen, weniger die Aussage, ebenfalls auf dem Klappentext, allerdings dem vorderen, wenn von Rihm gesagt wird, er habe, obwohl noch lebendig, bereits mehr komponiert als Mozart, kein besonders überzeugendes Lob, wenn man bedenkt, in welch zartem Alter der Salzburger verstorben ist. Der Rihm-Nichtkenner muss immerhin bis zur Seite 205 und damit dem gleichnamigen Kapitel warten, ehe sich ihm der Buchtitel Über die Linie erschließt.
Vermessen klingt der Untertitel zu Eleonore Bünings Rihm-Biographie, wenn man mit DIE Biographie assoziiert, dass es vor und nach dieser keine andere gab und geben wird. Stark untertrieben allerdings ist der Begriff Biographie, denn Lebensdaten- und –ereignisse machen nur einen Bruchteil des Buches aus, hauptsächlich geht es um die Werke, denen eine so umfassende wie tiefschürfende Analyse zu Teil wird. Im Klappentext wird die Verfasserin als Old-School-Kritikerin bezeichnet, und nach der Lektüre des Buches kann man das nur als Lob begreifen, weniger die Aussage, ebenfalls auf dem Klappentext, allerdings dem vorderen, wenn von Rihm gesagt wird, er habe, obwohl noch lebendig, bereits mehr komponiert als Mozart, kein besonders überzeugendes Lob, wenn man bedenkt, in welch zartem Alter der Salzburger verstorben ist. Der Rihm-Nichtkenner muss immerhin bis zur Seite 205 und damit dem gleichnamigen Kapitel warten, ehe sich ihm der Buchtitel Über die Linie erschließt.